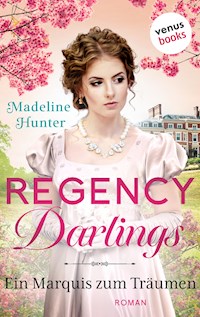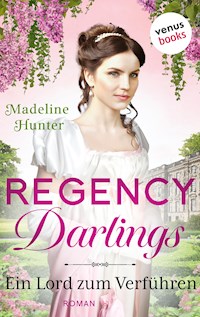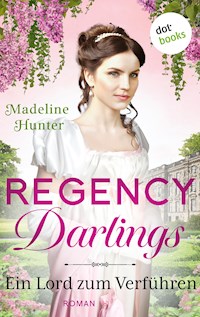9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fairbourne Quartet
- Sprache: Deutsch
Marielle Lyon hütet ein Geheimnis, und Gavin Norwood, der Viscount Kendale, ist überzeugt davon, es zu kennen. Er hält die zarte, mysteriöse Französin für eine Spionin im Dienste Frankreichs und beschattet sie regelmäßig, um sie im richtigen Moment entlarven zu können. Als sie von zwielichtigen Gaunern angegriffen wird, ist er daher sofort zur Stelle und rettet sie. Bereit alles zu tun, um ihr Geheimnis zu lüften, lässt er sich auf ein Spiel der Verführung ein, doch die tiefen Gefühle, die Marielle in ihm auslöst, treffen ihn völlig unerwartet. Ebenso wie die Erkenntnis, dass ihr Geheimnis weitaus düsterer ist, als er vermutet hätte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Die Autorin
Die Romane von Madeline Hunter bei LYX
Impressum
MADELINE HUNTER
Das Geheimnis der Mademoiselle Lyon
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Anja Mehrmann
Zu diesem Buch
Marielle Lyon kennt die Gerüchte um ihre Person nur allzu gut. Seit sie vor Jahren in Folge der Französischen Revolution nach London floh, hält man sie für eine Hochstaplerin oder noch schlimmer: eine Spionin im Dienste Frankreichs. Doch das Gerede ist ihr gerade recht, denn solange die Londoner Gesellschaft diesen Gerüchten glaubt, bleibt ihr eigentliches Geheimnis gewahrt. So reagiert sie zunächst auch gelassen, nachdem sie bemerkt, dass sie seit Monaten beschattet wird. Sie sieht keine Gefahr in dem schönen Fremden, der ihr auf Schritt und Tritt folgt und seine Sache so auffällig unauffällig macht, dass es sie regelrecht amüsiert. Doch als sie eines Tages von zwielichtigen Gaunern angegriffen wird und ihr ausgerechnet ihr Verfolger zu Hilfe kommt, erkennt sie, dass sie ihn möglicherweise unterschätzt hat. Gavin Norwood, der Viscount Kendale, nimmt sie mit zu sich nach Hause und konfrontiert sie mit seinen Vermutungen. Dabei muss sie feststellen, dass er mehr weiß, als sie ihm zugetraut hatte, auch wenn er noch nicht hinter ihre wahren Absichten gekommen ist. Damit das auch so bleibt, lässt sie sich auf ein verführerisches Spiel mit dem attraktiven Viscount ein. Denn eines ist klar: Gavin Norwood begehrt sie. Doch sie hat nicht damit gerechnet, in ihm einen ebenbürtigen Gegenspieler zu finden, der in der Kunst der Verführung nicht weniger erfahren ist als sie selbst. Und noch weniger rechnet sie damit, dass sie ihr Herz an ihn verlieren könnte …
In Erinnerung an meine Tanten
Rose und Madeline
1
Der Schöne Esel folgte ihr erneut.
Marielle bemerkte den Mann sofort, als sie in der Nähe ihres Hauses in eine Gasse abbog. Sie drückte die Papierrolle noch fester an sich und schlängelte sich eilig zwischen den Menschen hindurch, die sich in der engen Straße drängten.
Monate waren vergangen, seit sie ihn im Frühjahr das letzte Mal gesehen hatte. Sie hatte geglaubt, er habe aufgegeben, nachdem sie ihn hatte wissen lassen, dass sie sich der Tatsache bewusst war, von ihm beobachtet zu werden.
Solange es gedauert hatte, war es ein Spiel für sie gewesen. Sie hatte es genossen, ihn durch ganz London zu locken, während sie mit den alltäglichen Angelegenheiten ihres Lebens beschäftigt war. Hatte sie hingegen Wichtiges zu tun gehabt, war es ihr stets gelungen, ihn abzuschütteln.
Verstohlen warf sie einen Blick über die Schulter, um zu sehen, ob auch er abgebogen war, und sie musste lächeln angesichts seiner absurden Überzeugung, dass sie ihn nicht bemerkte. Ein Mann, der aussah wie er, wurde immer und überall bemerkt.
Ein Agent, der Spione verfolgte, musste über ein unauffälliges Äußeres verfügen, seine Anwesenheit durfte keinerlei Aufmerksamkeit erregen. Heikle Aufgaben erforderten ein Allerweltsgesicht und keines, bei dessen Anblick Frauen zu seufzen begannen. Mit scharfen, wie gemeißelten Zügen von männlicher Schönheit zog sein Gesicht trotz seiner Strenge alle Blicke auf sich – oder vielleicht gerade deshalb. Weil sofort offenkundig wurde, was er tat, und er offenbar nicht begriff, dass er für die Aufgabe des Ausspähens ungeeignet war, hatte sie ihm den Namen Schöner Esel gegeben. Wie unerquicklich für sie, dass er ihr ausgerechnet heute wieder folgte. Die Leute, mit denen sie sich treffen wollte, würden von seiner Anwesenheit nicht begeistert sein, so viel war sicher. Sie musste ihn loswerden, bevor sie ihr Ziel erreichte.
Marielle bog in die nächste Straße ein, um sich an der folgenden Biegung wieder rechts zu halten. Sie lief vor einem Fuhrwerk her, das von einem stämmigen Pferd gezogen wurde, um in der Menschenmenge zu verschwinden. Ein Stück vor sich entdeckte sie den Laden einer Hutmacherin und huschte hinein, als das Fuhrwerk daran vorbeirollte. Drinnen bezog sie neben dem Schaufenster Stellung und beobachtete die Straße.
Endlich kam Schöner Esel in Sicht. Er ließ sein Pferd Schritt gehen. Mitten auf der Kreuzung blieb das Ross stehen. Marielle spähte hinter einer Haube hervor, die im Schaufenster ausgestellt war, und betrachtete den Mann im Sattel.
Stirnrunzelnd ließ er den Blick über die Gasse schweifen. Verdutzt fuhr er sich mit den Fingern durch das dunkle, kurz geschnittene Haar und drehte sich im Sattel, um die Straße hinter sich zu überprüfen. Der Blick seiner smaragdgrünen Augen schoss nach links und nach rechts, er schaute wieder nach vorn, dann noch einmal zurück. Er sah sogar direkt in ihr Fenster, aber die Haube und die kleinen, welligen Fensterscheiben behinderten seine Sicht. Endlich wendete er das Pferd. Mit der Haltung eines Feldmarschalls ritt er den Weg, den er gekommen war, noch einmal ab.
Sie unterdrückte ein Kichern. Was für ein dummer Esel!
Sie wartete, bis der Schweif des Pferdes außer Sichtweite war, und begann dann die Sekunden zu zählen, bis es Zeit war, den Laden zu verlassen.
Das Gefühl, dass jemand hinter ihr stand, ließ Marielle herumfahren. Die Inhaberin des Ladens war ihr bedrohlich nahe gerückt, und das mit einem Stirnrunzeln, das fast so streng war wie das von Schöner Esel.
»Möchten Sie diese Haube vielleicht anprobieren? Sie bewundern sie jetzt schon sehr lange«, sagte sie. Aus blassblauen Augen betrachtete sie argwöhnisch Marielles breiten, üppigen Schal, der zugegebenermaßen hin und wieder mehr als nur einer Haube als Versteck gedient hatte.
Marielle blickte an sich hinab und bemerkte, dass der obere Rand der Dokumentenrolle, die sie an die Brust gedrückt hielt, über die gemusterte Seide des Schals lugte. Es sah in der Tat so aus, als verbärge sie einen gestohlenen Gegenstand.
Sie zupfte an einem Band der Haube, hinter der sie sich versteckt hatte. Solcher Luxus war nicht für sie bestimmt, obwohl sie genug Geld dafür gehortet hatte. Sie sparte auf etwas sehr viel Bedeutenderes als eine Haube.
»Ich dachte, ich würde sie vielleicht kaufen wollen, aber bei näherem Hinsehen hat sie einige Details, die mir nicht zusagen.«
Beim Klang von Marielles Stimme senkte die Frau die Lider. »Oh, Sie sind Französin. Einer unserer Gäste. Das erklärt natürlich …« Sie ließ den Blick über Marielles Kleider wandern und auf der zerrissenen Spitze am Kragen verweilen, dann auf der verblassten Pracht des hellen, gemusterten venezianischen Schals und auf dem Tellerrock, der verriet, wie altmodisch das Kleid war. Und schließlich musterte sie eindringlich die Farbflecken, die Marielles nackte Hände verunzierten.
Marielle zwang die Ladenbesitzerin zum Wegsehen. »Oui, ein Gast Ihres Landes. Meine Kleider mögen alt sein, Madame, aber mein Geblüt ist es auch, und darauf kommt es schließlich an, nicht wahr? Zufällig bin ich gerade dabei, mir eine neue Garderobe mit Mitteln zusammenzustellen, die soeben aus meiner Heimat hergebracht wurden. Ich dachte, meine Freundin, die Viscountess Ambury, hätte mir Ihr Geschäft empfohlen, aber offenbar war das ein Missverständnis. Ich fürchte, Ihre Ware verfügt nicht über die notwendige Qualität, um ihre Gunst zu gewinnen.«
In kerzengerader Haltung verließ sie den Laden und begab sich zu der Kreuzung zurück. Dort spähte sie um die Ecke, um sich zu vergewissern, dass ihr Verfolger verschwunden war.
Er war nirgendwo zu sehen. Rasch lief sie in der entgegengesetzten Richtung die Gasse entlang und bis zur nächsten Straße. Auf Umwegen begab sie sich zu ihrem Stelldichein.
Als sie aus einer kleinen Gasse auf die belebte Straße huschte, erblickte sie eine Droschke, der soeben ein Fahrgast entstieg. Sie wusste immer genau, wie viele Münzen sie in ihrem Geldbeutel mit sich führte, und heute waren es genug. Sie verfluchte die Zeit und das Geld, das Schöner Esel sie kostete, und sprang in die Kutsche.
Wo zum Teufel war diese französische Hexe abgeblieben?
Gavin Norwood, Viscount Kendale, ließ den Blick über die Menschen gleiten, die die Gasse bevölkerten, und suchte nach der Frau mit den langen braunen Locken, die ihr bis über die schmalen Schultern fielen.
Er wusste, dass er Marielle Lyon auch aus großer Entfernung problemlos erkennen würde. Doch es waren nicht ihr Haar oder ihre schlanke Gestalt, die sie aus der Menge hervorstechen ließen. Es lag auch nicht an ihren altmodischen Kleidern und dem langen Schal, in den sie sich meist hüllte.
Es war ihr Gang, der sie von der Masse abhob. Irgendetwas stellte er mit ihrem Körper an. Er ließ ihn sich leicht wiegen und vermittelte den Eindruck, dass sie nur kleine Schritte zu machen wagte. Infolgedessen bewegte sie sich mit einer Eleganz, die im unübersehbaren Gegensatz zu den großen, zielstrebigen Schritten der Menschen stand, von denen es in den Gassen wimmelte. Sie ging wie eine Königin, und das strafte all ihre Versuche, arm zu wirken, Lügen.
Als er sie im vergangenen Frühjahr regelmäßig verfolgt hatte, hatte sie oft geglaubt, ihn überlistet und abgeschüttelt zu haben. Er hatte sie in diesem Glauben gelassen, doch tatsächlich hatte er sie kaum je aus den Augen verloren. Heute jedoch war genau das womöglich geschehen. Diese Oase der Eleganz, die sie inmitten des geschäftigen Treibens gebildet hatte, war verschwunden. Wenn das stimmte, würde er seine Pläne für den heutigen Tag aufschieben müssen. Diese Aussicht verbesserte seine Laune keineswegs. Ihm blieb höchstens noch ein Monat Zeit, um diese lästige Angelegenheit zu Ende zu bringen, bevor er sich seinem nächsten Auftrag zuwenden würde.
Er zügelte sein Pferd und schätzte die Entfernung bis zur nächsten Kreuzung ab. Bevor er die Suche endgültig aufgab, würde er noch die Gässchen zwischen den Gebäuden zu seiner Rechten überprüfen. Wenn Marielle Lyon vor ihm davonlief, hielt sie sich immer nach rechts.
Kendale hatte sein Pferd langsam wieder in Bewegung gesetzt, als etwas seine Aufmerksamkeit erregte. Der Fahrer einer Droschke hatte sich umgewandt und sprach mit seinem Fahrgast. Ein schlanker Arm erschien in der Fensteröffnung, als der Kutscher sich herunterbeugte, um das Entgelt entgegenzunehmen. Nachdem eine Münze den Besitzer gewechselt hatte, hob er die Zügel.
Offenbar hatte Marielle es eilig, denn sie hatte noch nie zuvor eine Kutsche benutzt. Kendale zweifelte nicht daran, dass sie es war, deren Arm er gesehen hatte. Der blaue Farbfleck auf der schneeweißen Haut und die schmalen, schlanken Finger verrieten es.
Er folgte der Kutsche in weitem Abstand. Der Vorteil, hoch zu Pferde zu sitzen, bestand darin, dass er fast den ganzen Straßenzug überblicken konnte. Er hatte schon des Öfteren Leute beschattet, die zu Fuß in dichterem Gedränge als diesem unterwegs gewesen waren, und hatte dabei eine Entfernung von gut dreihundert Metern einhalten können.
Die Kutsche bog mehrmals ab, doch Kendale fand sie stets wieder. Als er um eine weitere Ecke bog, sah er, dass die Kutsche mitten auf der Straße angehalten hatte. Der Fahrer steckte die Peitsche in die Halterung, zog einen Apfel unter dem Rock hervor und biss hinein.
Der Viscount gab seinem Pferd die Sporen. Als er an der Kutsche vorbeiritt, konnte er einen Blick hineinwerfen. Leer. Er hielt an und spähte die Straße hinunter.
»Die Frau, die Sie hergebracht haben – wohin ist sie gegangen?«, fragte er den Kutscher.
Der Gefragte musterte Kendale und sein Pferd lange und gründlich. Mit vollem Mund und mahlenden Kiefern wies er mit dem Daumen auf eine dunkle Gasse auf der anderen Seite der Straße, die zwischen zwei Häusern hindurchführte.
Kendale stieg ab und band sein Pferd an einen Pfosten. Dann ging er zu dem Krämerladen, der sich in einem der Häuser befand. Von dort aus konnte er den engen Durchgang in voller Länge überblicken.
Drei Gestalten bewegten sich im Schatten, auf halbem Weg zur nächsten Straße. Zwei Männer blickten in seine Richtung, doch die Schatten erwiesen sich als zu dunkel, um sie genau zu erkennen. Marielle Lyon ging auf sie zu, ihr schlanker Körper wiegte sich im Kokon ihres langen Schals.
Kendale wartete. Es war nicht das erste Mal, dass sie sich in einer dunklen Gasse mit Männern traf, das wusste er mit Sicherheit. Er dachte darüber nach, wie er das Rendezvous unterbrechen konnte. Sie hatte eine Rolle Dokumente bei sich. Als sie aus dem Haus geeilt war, hatte er diese unter ihrem Schal gesehen. Und er konnte nicht zulassen, dass sie die Papiere auf die geplante Weise übergab.
Am Ende der engen Passage, die zwischen zwei Häusern hindurchführte und wie ein Tunnel wirkte, war Licht zu sehen. Kendale bezweifelte, dass er die Flucht der beiden Männer vereiteln konnte, doch er wollte verdammt sein, wenn sie ihm entkam. Wenn es nach ihm ging, würde das Geheimnis um Marielle Lyon gelüftet sein, bevor die nächste Stunde schlug.
Marielle spähte in die Dunkelheit. Zuerst schien niemand sich in dem schmalen Durchgang zu befinden, was ihr sehr missfallen hätte. Das wäre ja noch schöner gewesen, wenn sie für diese Droschke bezahlt hätte, nur um festzustellen, dass Luc und Éduard zu spät kamen. Oder gar nicht.
Sie hätte die beiden schon vor Monaten ersetzen sollen. Es war niemals klug, sich zu lange derselben Personen zu bedienen. Am Ende wurden die Muster erkannt. Fragen wurden gestellt. Schlimmer noch, mit der Zeit schlichen sich Bequemlichkeit und Sorglosigkeit ein.
Letzteres konnten weder sie noch die anderen sich leisten. Luc und Éduard gingen bei dieser Sache keinerlei Risiko ein. Für die beiden war es nur eine Routinearbeit, für die sie bezahlt wurden. Sie war diejenige, die am Ende womöglich Rechenschaft ablegen musste, und dabei ging es um mehr als nur um Geld. Wenn die Engländer zu dem Schluss kamen, dass sie eine Spionin war, erwartete sie ein unerfreuliches Schicksal. Wenn ihre Feinde ihren Namen mit diesen Papieren in Verbindung brachten, würde sie letzten Endes vielleicht mit ihrem Leben dafür bezahlen.
Eine Bewegung am anderen Ende der Passage veranlasste die Schatten, sich zurückzuziehen. Ein Mann hob die Hand und winkte. Erleichtert ging Marielle auf ihn zu.
»Warum versteckst du dich?«, fragte sie beim Näherkommen. »Ist euch jemand gefolgt?« Sie traute weder Luc noch Éduard zu, dass sie wussten, was sie in diesem Fall zu tun hatten. Sie waren nur Boten.
Der Mann antwortete nicht. Das war merkwürdig. In rascher Folge nahm Marielle weitere Seltsamkeiten wahr. Der Mann trug einen Dreispitz. Luc und Éduard hielten diese Hüte für altmodisch. Als ihre Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, wurde die Gestalt des Mannes breiter. Er war zu dick. Zu kurz. Ein anderer Mann gesellte sich zu ihm, und plötzlich schnürte es ihr vor Misstrauen die Kehle zu. Auch dieser Mann sah nicht aus, wie er sollte.
Alles in ihr schlug Alarm. Wie angewurzelt blieb sie stehen. Die Männer mussten ihre Angst gerochen haben, denn nun kamen sie mit großen Schritten näher.
»Attendez-vous«, flüsterte der Dicke mit heiserer Stimme.
Sie drehte sich auf dem Absatz um und rannte zurück zu der Straße, von der sie gekommen war.
Schwere Schritte stampften hinter ihr her. Entsetzen durchfuhr Marielle wie ein Blitz. Sie schleuderte die Schuhe von den Füßen, damit sie schneller laufen konnte, doch es war bereits zu spät. Wie ein Schraubstock umklammerte eine Hand ihre Schulter. Sie wirbelte herum, wollte sich losreißen, doch sie prallte mit dem Rücken gegen die Mauer eines der Häuser. Der Schmerz raubte ihr den Atem, und ihr wurde schwarz vor Augen.
Verzweifelt tastete sie nach ihrem Geldbeutel, während sie sich aufrecht zu halten versuchte. Sie biss die Zähne zusammen und kämpfte den Drang nieder, zu Boden zu sinken und sich zu ergeben. Ihre Angreifer bedrängten sie so sehr, dass sie das Bier riechen konnte, das der Dicke zu seiner letzten Mahlzeit getrunken hatte.
»Hier. Mehr habe ich nicht.« Sie warf den Geldbeutel auf den Boden.
Der dicke Mann blickte erst die Börse, dann Marielle an. »Darum sind wir nicht hier.« Er sprach Französisch. Und zwar wie ein Franzose. Damit bestätigte er ihre schlimmsten Befürchtungen. Diese Männer waren nicht einfach nur Diebe.
Wenn sie es nicht auf ihr Geld abgesehen hatten, dann auf sie selbst. Die Wahrheit ließ Marielle frösteln. Sie würde heute in dieser engen Gasse sterben.
Die beiden Männer starrten Marielle an, und eine entsetzliche Drohung ging von ihnen aus. Ihr wurde übel. Sie wusste, warum sie zögerten. Es war nicht einfach zu töten. Auch der kaltblütigste Mensch musste sich überwinden, um so etwas zu tun.
Sie spürte die wachsende Entschlossenheit der beiden. Erst passierte es bei dem anderen, nicht bei dem Dicken. Ein animalisches Leuchten trat in seine Augen.
Sobald er sich bewegte, reagierte Marielle. Mit aller Kraft stieß sie sich von der Wand ab, stürzte sich auf ihn und achtete nicht auf den Schmerz, der in ihrem zerschrammten Rücken brannte. Sie drehte und wand sich, um Verwirrung zu stiften und dem Griff des Mannes auszuweichen. Wenn sie es an ihnen vorbeischaffte, konnte sie vielleicht wegrennen und …
Sein Arm schnellte vor und nach oben, Metall blitzte auf. Erneut wand sie sich, und die Klinge verfing sich in ihrem Schal. Doch Seide ist ein schwaches Schild. Der Stoff fing den Messerstich zwar ab, aber dennoch spürte sie ihn. Roher Schmerz fuhr ihr in die Hüfte.
Sie wagte nicht, innezuhalten. Sie schlug um sich, wand sich und weigerte sich, ihr Schicksal hinzunehmen. Sie ließ die Papiere fallen und zerkratzte ihm das Gesicht. Zur Strafe bekam sie einen Schlag auf den Kopf. Und noch einen, diesmal auf die Schulter.
Noch mehr Schatten, sie sammelten sich vor ihren Augen und in ihrem Kopf. Schwarze Schatten, die näher rückten. Den nächsten Schlag, der sie erneut an die Wand prallen ließ, spürte sie kaum.
Unfähig zu kämpfen, gab sie auf, stand auf schwankenden Beinen da, von Chaos umgeben. Dann sah und hörte sie nichts mehr und trieb auf die Dunkelheit zu.
Sie fügte sich in das Unvermeidliche. Es war aus. Vorbei. Sie hatte verloren. Vielleicht war es dumm von ihr gewesen, jemals zu glauben, dass es anders hätte ausgehen können. Je suis désolée. Es tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe.
Kendale benutzte seine Fäuste und versuchte, dem Dolch auszuweichen, der gegen ihn geschwungen wurde. Als er vom Pferd gestiegen war, hätte er seine Pistole mitnehmen sollen.
Die beiden Männer schienen überzeugt zu sein, dass sie den Kampf gewinnen würden. Als Kendale die Klinge durch den Gehrock ins Fleisch drang, fragte er sich, ob sie vielleicht recht behalten würden.
Diese Attacke weckte den Kämpfer in ihm, der sich einst ganz allein gegen fünf ausgebildete Soldaten durchgesetzt hatte.
Er wartete, bis der Dolch noch einmal auf ihn niedersauste, doch diesmal hielt er den Arm fest, der die Waffe führte. Hart packte er zu und schleuderte den Angreifer mit einem Ruck herum. Er hörte das Knacken eines brechenden Knochens.
Sein Opfer schrie auf und sank in sich zusammen. Kendale stieß ihn in Richtung des zweiten Mannes. Dieser, es war der dicke Kerl, hatte endlich sein Messer aus der Scheide befreit, doch der Schrei ließ ihn mitten in der Bewegung erstarren.
Kendale starrte ihm ins Gesicht. »Verlierst du jetzt etwa die Nerven? Hast du etwa Angst vor dem Kampf Mann gegen Mann? Nur ein Feigling greift eine Frau an und braucht dazu noch einen Komplizen.« Er war empört, und er hoffte, dass der Dummkopf versuchen würde, das Messer zu benutzen.
Der Dicke wich rückwärtsgehend zurück und hielt die Waffe zu seinem Schutz vor sich. Sein Kumpan folgte ihm taumelnd. Als sie die Gasse zur Hälfte erreicht hatten, drehte der Dicke sich um und gab Fersengeld.
Kendale versuchte, Atem zu schöpfen, während er zu Marielle Lyon ging. Sie kauerte am Boden, genau an der Stelle, an der sie unter den Schlägen der Männer niedergesunken war. Ihre nackten Füße guckten unter dem zerknitterten Rock hervor, und der Kopf war ihr auf die Brust gesunken.
Als sie zu Boden gegangen war, hatte sie etwas gesagt. Kendale fragte sich, ob er ihre Worte richtig verstanden hatte.
Sie gab keinen Laut von sich, bewegte sich auch nicht. Womöglich war sie tot.
Er ging in die Hocke, schob den Schal beiseite und legte ihr eine Hand auf den Brustkorb, unterhalb der linken Brust. Er spürte erst nur ihren Herzschlag, doch dann fühlte seine Hand sich auf einmal feucht an. Blut. Sie lebte, doch wenn sie ernsthaft verletzt war, würde sie vielleicht nicht mehr lange leben.
Seine eigene Schnittwunde brannte heftig. Jetzt, da die Aufregung des Kampfes abgeklungen war, hatte er Schmerzen und fühlte sich erschöpft. Er entdeckte ihre Schuhe und holte sie, dann ging er zu ihr zurück und beugte sich zu ihr. Froh, dass sie den Schmerz nicht spüren würde, hob er sie hoch und lehnte sie an die Wand. Etwas kullerte ihm vor die Füße. Die Dokumentenrolle.
Er bückte sich danach und hob sie auf, während er mit der anderen Hand die Frau festhielt. Dann legte er sich ihren erschlafften Körper über die Schulter und trug sie zu der Kutsche, die sie hergebracht hatte.
Als Kendale die Tür der Droschke öffnete, drehte der Kutscher sich überrascht um.
»Sie ist doch wohl nicht krank. Nicht, dass sie mir noch alles mit ihrem Erbrochenen verdreckt.«
»Sie fahren uns, wohin ich will, und Sie werden sich meinen Befehlen nicht widersetzen.«
»Befehle! Ich will verdammt sein, wenn ich … Verflucht, Mann, Sie bluten! Es ist überall auf Ihrer Weste. Verdammt, und die Frau auch! Ich werde Sie nirgendwohin …«
»Ich bin Viscount Kendale. Wenn Ihre elende Kutsche dreckig wird, werde ich Ihnen verdammt noch mal eine neue kaufen.« Er öffnete die Tür und verfrachtete Marielle auf die Bank, die Dokumente und ihre Schuhe warf er hinterher. Er holte sein Pferd und machte es hinten an der Droschke fest. »Und jetzt lassen Sie die Zügel schnalzen und bringen uns zur Hertford Street, so schnell Sie können«, sagte er, als er in die Kutsche kletterte. »Es lohnt sich für Sie, mir gute Dienste zu leisten. Denn wenn Sie es nicht tun, werden Sie einen verdammt hohen Preis dafür zahlen.«
2
»Um Himmels willen, wie sehen Sie denn aus?«, fragte Anderson, als er die Bibliothek von Kendales Junggesellenwohnung in der Stadt betrat. »Wie ich sehe, waren Sie in einen Kampf verwickelt und haben offensichtlich ziemlich viel abgekriegt.«
»Ich habe ihm den Arm gebrochen. Dabei konnte ich bestenfalls nur daran ziehen, weil er zuvor auf mich eingestochen hat.«
»Eingestochen, so, so! Ziehen Sie das Hemd aus, ich will sehen, was sich unter all dem Blut verbirgt. Es ist ein Wunder, dass Sie sich noch auf den Beinen halten können.«
»Das ist nicht nur mein Blut. Ein Gutteil davon ist ihres.« Kendale zog sich das Hemd aus, als bereitete ihm die Bewegung keine Mühe, doch das Drehen und Strecken seines Oberkörpers rief einen tiefen, scharfen Schmerz in seiner Seite hervor. Er wusste bereits, wie schlimm es war … schlimm genug, um höllisch wehzutun, aber nicht schlimm genug, um ihn umzubringen. Mit einem Messer zu töten war nicht leicht. Sogar mit einem Bajonett oder einem Degen war es selten mit einem einzigen Stich getan.
Anderson, ein Wundarzt, der den Militärdienst quittiert hatte und zu dessen Patienten jetzt die Mitglieder der feinen Gesellschaft Londons gehörten, untersuchte die Wunde im Licht der Nachmittagssonne, das schräg durch das Fenster hereinfiel. Edinburgh war eine gute Schule gewesen, er verstand sich auf sein Geschäft wie nur wenige andere. Die Schotten waren die besten Ärzte, hatte Anderson erklärt. Sie studierten Medizin an der Universität und machten keinen Unterschied zwischen Wundarzt und Physikus, wie die Engländer es taten. Schottische Wundärzte waren keine herausgeputzten Barbiere, und die Armee konnte sich verdammt glücklich schätzen, dass Anderson in ihren Diensten gestanden hatte.
»Tief, und es ist ein Stich, kein Schnitt«, sagte er, betrachtete die Wunde und betastete sie. »Legen Sie sich am besten auf den Diwan dort, während ich sie säubere. Ist Ihr Diener hier? Wir sollten uns Handtücher bringen lassen.«
»Diesmal habe ich ihn nicht von meinem Landsitz mitgebracht. Irgendwo im Ankleidezimmer müssen Handtücher sein.« Er ließ sich auf dem Diwan nieder, und es fühlte sich an, als steckte das Messer noch in der Wunde. »Verflucht!«
»Fluchen Sie, weil ich angeordnet habe, dass Sie sich hinlegen sollen, oder weil ich die Wunde reinigen will?«, rief Anderson aus dem Ankleidezimmer zu Kendale hinüber. »Wenn Letzteres der Grund ist … was macht ein bisschen mehr Schmerz jetzt noch aus? Es bekommt dem menschlichen Körper schlecht, so aufgespießt zu werden. Was gleich folgt, ist eine Kleinigkeit dagegen.«
»Ich fluche, weil der Narr es fertiggebracht hat, mir einen Stich zuzufügen.«
»Sie meinen wohl Narren, stimmt’s? Sie haben angedeutet, dass es mehr als einer war. Und Sie sind schließlich nicht Herkules, mein Freund.« Mit einem großen, gefalteten Bettlaken und zwei Handtüchern kam Anderson zurück. Er deckte den Diwan mit dem Laken ab und legte ein Handtuch darauf. »Und jetzt legen Sie sich auf die unverletzte Seite, dann bin ich ganz schnell mit Ihnen fertig.«
Kendale gehorchte. Er biss die Zähne zusammen, als Anderson sich, eine Arzneiflasche in der Hand, über ihn beugte. Was auch immer sie enthielt, die Tinktur schmerzte höllisch, als sie in seine Wunde tropfte. Stoisch ertrug er das heftige Brennen. »Welch glückliche Fügung, dass Sie das nicht ihr antun müssen.« Er hätte Marielle schreien gehört, wenn Anderson dieses Feuerwasser auch bei ihr verwendet hätte.
»Oh, das habe ich bereits, obwohl ihre Wunde anders ist als Ihre. Eher eine üble Schürfwunde. Die Klinge hat sie schräg getroffen und ihr einen langen, flachen Schnitt zugefügt, oberhalb der Hüfte. Es hat stark geblutet, aber sie musste nicht genäht werden.« Anderson stellte die Flasche beiseite und faltete das andere Handtuch zu einem Wundverband.
»Wie gut, dass sie noch ohnmächtig war, als Sie sich um sie gekümmert haben.«
»Sie war nicht ohnmächtig. Sie war bei vollem Bewusstsein. Ich wage zu behaupten, dass sie jedes Wort hört, das wir hier drin sagen.«
Also hatte sie sich der Reinigung der Wunde unterzogen und nicht geschrien. Das sprach für sie. Natürlich erwartete man von einer Spionin, tapfer zu sein, denn andernfalls wäre sie zu nichts zu gebrauchen gewesen.
»Und jetzt stehen Sie auf«, befahl Anderson. Als Kendale sich erhob, wickelte der Arzt ihm einen langen Streifen Stoff um den Oberkörper, um den Wundverband zu befestigen. »Ich werde Ihnen etwas von der Reinigungstinktur dalassen. Ein Fläschchen für Sie und eines für die Frau. Verwenden Sie es drei Tage lang, jeden Tag. Sollte die Wunde nach Fäulnis aussehen oder riechen, lassen Sie mich holen.«
»Ich werde ihr das Fläschchen und Ihre Anweisungen mitgeben.«
»Bleibt sie denn nicht hier?«
»Ohne den Angriff wäre sie überhaupt nicht hergekommen.«
»Ah. Dann ist sie also nicht Ihre …« Fragend hob Anderson die Augenbrauen.
Kendales Antwort war ein wütender Blick.
»Schade«, murmelte Anderson, als er die beiden Flaschen auf den Tisch stellte. »Sie ist ein hübsches kleines Ding.«
»Zu hübsch und zu sehr Französin, als dass man ihr trauen könnte.«
»Immerhin haben Sie sich die Mühe gemacht, ihr das Leben zu retten. Und jetzt wollen Sie sie hinauswerfen, kaum dass ich weg bin? Mindestens eine Woche lang sollte sie nicht in der Stadt herumlaufen und ein paar Tage lang im Bett bleiben, bis feststeht, dass der Schlag, den sie einstecken musste, ihr nicht mehr Schaden zugefügt hat, als auf den ersten Blick zu sehen ist. Und dasselbe sollten auch Sie tun. Im Bett bleiben, meine ich. In getrennten Betten, so wie es aussieht.«
Anderson half Kendale, die Arme in einen langen Morgenrock zu schieben, und streifte dann seinen eigenen Gehrock über. »Ich muss mich nur noch selten um Messerstiche kümmern. Dieser Nachmittag hat mich wehmütig gestimmt. Bitte lassen Sie mich rufen, wenn Sie noch einmal aufgespießt oder aufgeschlitzt werden. Es waren erquickliche zwei Stunden.«
Nachdem Anderson sich verabschiedet hatte, lauschte Kendale auf Geräusche aus dem Schlafgemach. Stille. Nach dieser Tortur war Marielle wahrscheinlich eingeschlafen.
Er beschloss, sie eine Weile ruhen zu lassen, und nahm die Papierrolle von dem Stuhl, auf den er sie geworfen hatte. Er legte die Rolle auf den Tisch in der Bibliothek, löste das Band, von dem sie zusammengehalten wurde, und breitete die Papiere vor sich aus.
Die Stimmen waren verstummt. Marielle wartete. Sicher würde gleich jemand kommen und sie von hier wegschicken. Leute, die in einem Haus wie diesem wohnten, mochten zu guten Taten bereit sein, aber sie würden nicht wollen, dass das Objekt ihrer Barmherzigkeit allzu lange bei ihnen blieb.
Prüfend blickte sie sich in der Kammer um. Ein Mann schlief normalerweise in diesem Bett. Die Gardinen und das Mobiliar verrieten, dass er Geld, aber wenig Stil hatte. Farben und Zierrat dieser Art waren in Frankreich vor mehr als dreißig Jahren einmal sehr beliebt gewesen, und auch in England fand jetzt niemand mehr Gefallen daran. Zu viel Goldfarbe. Zu aristokratisch und zu blass. Klassisch wäre passender gewesen, vor allem für einen Mann. Und da die Welt inzwischen so viel Wert auf égalité legte, wäre es vielleicht auch sicherer gewesen.
Das Laken fühlte sich kalt an auf ihrer Haut. Dieser Aderlasser hatte sie entkleidet, um ihre Wunden zu untersuchen. An seinem Benehmen war nichts Ungehöriges gewesen, obwohl er noch nicht sehr alt war. Vielleicht hatte er sich wegen ihrer Blutergüsse zurückgehalten. Sie fand seine ausdrucklose Miene und seine Zurückhaltung beruhigend, und während er getupft und gestochert hatte, hatte sie überlegt, wie er wohl aussehen würde, wenn sein schütteres Haar schließlich ganz verschwunden sein würde. Für ihn war sie ein Objekt, das er reparieren musste, mehr nicht, obwohl er versuchte, ihr nicht wehzutun. Was ihm allerdings nicht gelungen war, vor allem, als er diese scheußliche Arznei in die Stichwunde geträufelt hatte.
Dieses Brennen war es gewesen, was sie aufgeweckt hatte. Nie zuvor hatte sie es begrüßt, Schmerzen zu haben, aber heute schon. Noch bevor sie die Augen öffnete, wusste sie, was der Schmerz bedeutete: Sie war noch nicht tot. Welche Erleichterung, diesen Blutsauger zu sehen und zu entdecken, dass der Schmerz nicht von Folter herrührte, sondern von dem Versuch, ihr zu helfen.
Noch mehr Schmerzen. An der Schulter, am Rücken und im Gesicht. In ihrer rechten Wange pochte es. Aus dem Augenwinkel sah sie, dass sie geschwollen war. Nun, egal, wie schlimm die Schmerzen auch waren und wie merkwürdig sie aussah, egal, wie angenehm sie dieses Bett fand und wie sehr sie sich danach sehnte, eine ganze Woche lang zu schlafen, sie musste sich bei ihren Wohltätern bedanken und dann fortgehen. Vieles musste getan, Entscheidungen mussten getroffen werden. Der heutige Tag hatte vieles verändert.
Obwohl sie wusste, dass es unangenehm werden würde, setzte sie sich mühsam auf. Ihr Rücken rebellierte so heftig, dass es ihr den Atem verschlug. Sie bewegte sich langsamer, drehte sich und setzte sich auf die Bettkante. Ihr Unterkleid und ihr Kleid waren blutverschmiert und lagen auf einem Stuhl neben der Tür.
Sie stand auf und näherte sich vorsichtig. Mit dem Ohr an der Tür lauschte sie. Ein Fluchen schien durch das Holz zu dringen.
Lautlos öffnete sie die Tür und spähte hinaus.
Sie konnte den Quacksalber nicht sehen, doch sie sah einen Mann auf der anderen Seite des Zimmers. Es schien sich um eine Bibliothek zu handeln. Er stand mit dem Rücken zu ihr, dann drehte er sich zur Seite und beugte sich über einen Tisch, auf dem Bücher gestapelt waren. Er trug einen teuren Morgenrock, die Sorte, die aussah wie ein Wintermantel, aber aus grünem Seidenbrokat und nicht aus Wolle gefertigt war.
Er richtete sich auf, und sie erkannte ihn. Schöner Esel.
Vorsichtig schloss sie die Tür und lehnte sich mit der unverletzten Schulter daran, während sich in ihrem Kopf die Gedanken überschlugen.
Hatte sie den heutigen Tag völlig falsch verstanden? War es möglich, dass die Männer von diesem Mann geschickt worden waren, um ihr aufzulauern und sie herzubringen? Aber zu welchem Zweck? Sie blickte an ihrem nackten Körper hinunter und stellte sich dann seinen Morgenrock vor. Lady Cassandra hatte ihr erzählt, dass er ein Lord war und dass sein Name Viscount Kendale lautete. Es gab diese Männer, die glaubten, alles haben zu können, was sie begehrten, sogar Frauen. Vor allem Frauen.
Gehörte er zu dieser Sorte von Männern? Wenn es so war, hatte sie mit dem Feuer gespielt, als sie ihr Spielchen mit ihm getrieben hatte.
Sie berührte ihr verschmutztes Kleid und kämpfte die Panik nieder, die sie zu überwältigen drohte. Wenn er diese Männer geschickt hatte, um sie zu entführen, dann hatte er ihnen gewiss nicht aufgetragen, ihm eine geprügelte, verwundete Frau zu bringen, die nicht einmal bei Bewusstsein war. Nein, ihre anfängliche Vermutung stimmte. Er hatte sich eingemischt und sie gerettet. Was auch immer seine Absicht gewesen war, nun war sie in Sicherheit. Es sei denn, er war ein Ungeheuer. Dass er mit den Ehemännern von Cassandra und Emma befreundet war, deutete darauf hin, dass er keines war, aber genau konnte man das nie wissen.
Sie brachte ihr Kleid und die Chemise zum Waschtisch. In der Kanne war noch ein wenig Wasser. Sie goss es in die Waschschale, weichte die Kleidung ein und rieb das Blut heraus, so gut es ging. Dann breitete sie das Kleid zum Trocken auf einem Stuhl aus.
Marielle ging wieder zum Bett und zog die weiche blaue Decke zurück. Sie würde sie besser bedecken als ihre zerrissene Kleidung, doch zugleich würde sie ihn daran erinnern, dass sie schwer verletzt war. Ihre Verletzlichkeit würde ihn zugleich reizen und abschrecken. Das konnte von Vorteil für sie sein, wenn sie sich gegenüberstanden. Das und die Tatsache, dass Schöner Esel sie begehrte.
Oh ja, er wollte sie. Das wusste sie schon seit Monaten.
Beim Blick in die Papiere verwandelte Kendales Triumph sich zunächst in Verwirrung, dann in Verdruss. Es handelte sich nicht um Briefe oder Dokumente, wie er angenommen hatte. Er blätterte sie flüchtig durch. Nichts davon enthielt die Geheimnisse einer Spionin. Stattdessen wies jedes Blatt von dem Stapel dicken Papiers dasselbe Motiv auf. Es war ein Spottbild von der Art, wie Buchläden und Druckereien sie in ihren Fenstern zur Schau stellten. Auf einer vulgären Zeichnung voll übertriebener Gesichter und Posen, die von Sprechblasen aus verschiedenen Mündern begleitet wurden, entfaltete sich eine possenhafte kleine Szene.
Die Worte jedoch waren auf Französisch. Er beugte sich darüber und betrachtete die Karikaturen genau. Figuren, die britische Politiker darstellten oder Mitglieder des Hochadels und der feinen Gesellschaft, erkannte er stets genau. Von diesen Männern dagegen kannte er keinen einzigen.
Es schien kein Bild zu sein, das britische Politik zu Propagandazwecken lächerlich machte. Eher sah es aus wie die satirische Darstellung eines französischen Staatsdieners. Mit seinem Französisch war es nicht zum Besten bestellt, doch der Stich beschuldigte den abgebildeten Amtsträger, der Regierung Gelder entwendet zu haben. Er saß auf einem Thron, der aus Bauern und Arbeitern bestand, während er einen Teil der Steuern an sie verteilte, die die Untertanen zuvor gezahlt hatten.
Warum sollte Marielle Lyon sich in einer Gasse mit irgendwelchen Männern treffen und ihnen diese Bilder aushändigen? Vielleicht hatte sie herausgefunden, von wem die Stiche stammten, und sie hatte diese hier als Proben erhalten und sollte sie als Beweisstücke nach Frankreich schicken. Wenn es so war, schwebte der Künstler womöglich in Gefahr, sobald den Franzosen sein Name bekannt wurde.
»Ah, Sie sind es. Ich wollte mich bei der guten Seele bedanken, die mich gefunden hat. Aber wenn das hier Ihr Haus ist, ist es vielleicht komplizierter, als ich dachte.«
Die klangvolle Stimme ließ Kendale hochfahren. Er widerstand dem Impuls, sich zu ihr umzudrehen. Stattdessen verschob er mehrere Folianten so, dass sie die Papiere bedeckten, die über den Tisch verteilt lagen. Die Stiche waren noch das Geringste. Es wäre unerhört gewesen, eine französische Spionin diese Gemächer betreten und Karten von Frankreichs Küste sichtbar herumliegen zu lassen.
Endlich wandte er sich zu ihr um. Marielle Lyon stand in der Tür zum Schlafgemach. Das offene goldbraune Haar fiel ihr zersaust über die Schultern, ihre Füße waren nackt und schmutzig. Sie hatte sich in eine Decke gehüllt, so, wie sie sich sonst in ihren großen Schal hüllte.
Unter dieser Decke aus weicher Wolle schien sie nackt zu sein. Sie presste sie fest an ihre Brust, aber dennoch sah er an ihrem Nacken und dem Dekolleté viel von ihrer nackten Haut. Eine Wunde besudelte ihre schneeweiße Schulter, und eine weitere befleckte ihr ansonsten makelloses Gesicht. Allein die Schläge mussten sie schmerzen, und dazu noch die Stichwunde. Doch sie ließ nichts dergleichen erkennen.
Kühl ließ sie den Blick an seinem Körper hinabgleiten und erinnerte ihn daran, dass er kaum besser gekleidet war als sie. Er widerstand dem Impuls, seinen Morgenrock zuzuknöpfen, um seine nackte Brust zu bedecken. Er würde mit Marielle Lyon niemals fertig werden, wenn sie sich für kühner und weltgewandter hielt als ihn.
»Es ist nicht kompliziert«, sagte er, »es ist sehr einfach. Ich habe die Burschen weggejagt und Sie hergebracht, damit Sie versorgt werden.«
»Sie sind wohl kaum zufällig auf mich gestoßen.«
»Wie auch immer, jedenfalls ist dies der Grund, dass Sie noch am Leben sind. Ihre Verbündeten schienen fest entschlossen, Sie zu töten. Sie können sich also bei mir bedanken.«
»Sie waren nicht meine Verbündeten. Das waren gemeine Diebe, die auf eine Frau losgegangen sind.«
»Diebe stehlen Geldbörsen und Schuhe und sogar Kleidung, und dann verschwinden sie. Sie nehmen sich nicht die Zeit, zuzuschlagen und auf ihr Opfer einzustechen.«
Sie zuckte mit den Schultern und zeigte so ihre Gleichgültigkeit. Wenn Sie das glauben wollen, mir ist es gleich. Vermutlich bedeutete es auch, dass sie sich nicht erkenntlich zeigen würde. Undankbares Weib.
Sie wandte ihre Aufmerksamkeit der Bibliothek zu, den Regalen voller Bücher und den Gardinen vor den Fenstern. Ihr Blick verweilte auf dem Kamin, auf der Muskete und dem Säbel, die auf Eisenträgern an der Wand hingen. Sie tat einige Schritte und betastete aufmerksam das Holz eines Stuhls.
»Sie sind reich«, sagte sie. »Ich habe gehört, dass Sie ein Viscount sind, aber nicht jeder Viscount ist auch reich.«
»Bessere als ich sind mir vorausgegangen und haben das Vermögen vergrößert.«
»Wie bescheiden Sie sind. Oder vielleicht war das eher die Feststellung, dass Ihre Interessen anders gelagert sind.« Nun kreuzten ihre Blicke sich. Sie ging auf ihn zu, bis sie sehr nahe voreinanderstanden. Feuer und eine Herausforderung lagen in ihrem Blick. »Sie haben sich entkleidet. Selbst wenn Sie sich Genüsse erhofft haben, die auf meiner Dankbarkeit beruhen, war das sehr gewagt.«
Genuss war das Letzte, was er im Sinn hatte. Bis jetzt. Ihre offensichtliche Tändelei und ihre provozierenden Worte ließen seine Muskeln sich anspannen, und ihm wurde heiß. Sie sah es ihm an. Süß lächelnd, triumphierend, kam sie noch näher. Ihre Augen funkelten vor Temperament und Vergnügen.
Schon einmal hatte sie ihn so angesehen, von weit weg. Er war unerwartet auf sie gestoßen, als sie mit Emma Fairbourne und Lady Cassandra in einem Garten gesessen hatte. Der Anblick seiner Spionin, die mit den Ladys plauderte, hatte ihn verblüfft. Während er noch überlegte, was er tun sollte, hatte Miss Lyon ihn bereits bemerkt. Keck und selbstgefällig hatte sie ihn angesehen.
Dann hatte sie gelächelt. Einfach so. Das Lächeln verwandelte sie in ein Mädchen. Eine Unschuld. Es war, als hätte die Zeit sich umgekehrt, und er sah Marielle Lyon, wie sie gewesen war, Jahre bevor sie nach England kam.
Verlangen und Verwirrung hatten ihn damals überfallen. Genau wie jetzt. Was ihn zutiefst irritierte. Auch das Wissen, dass Französinnen die Meisterinnen koketten Charmes waren, half da nichts. Und auch nicht das Wissen, dass sie verwundet war, schwerer noch, als es auf den ersten Blick den Anschein hatte. Im Geiste begann er sie zu verführen, unerbittlich und quälend langsam.
Sie legte eine Hand auf die Stelle, an der sein Morgenrock sich teilte, und wagte sich unter die Seide vor. Die Wärme ihrer Hand drang ihm unter die Haut und in die Brust. Wie ein gefährliches Tier brüllte das Verlangen in ihm. Zur Hölle mit dem Verführungsteil. Er schaffte es nur mit Mühe, nicht nach der Decke zu greifen und sie ihr vom Leib zu reißen. Er biss die Zähne zusammen, und schließlich gelang es ihm, kühlen Kopf zu bewahren.
Eine Liebkosung, so leicht wie die aufreizende Berührung von Samt, zaghaft, vorsichtig. Er musste deutlicher darauf reagiert haben, als er glaubte, denn wieder lächelte sie. Dann berührten ihre Finger den Verband. Ganz leicht betasteten sie den Stoff, um seine Größe und Lage zu ermessen. Die Berührung war nicht mehr kokett, aber noch immer zwang sie ihn, die Zähne zusammenzubeißen.
»Sie haben das Messer auch zu spüren gekriegt«, sagte sie. »Sie haben sie nicht weggejagt, sondern gegen sie gekämpft.«
»Es ist nicht so schlimm. Nicht schlimmer als bei Ihnen.«
Sie wandte sich von ihm ab und schlenderte durch das Zimmer. »Das macht den heutigen Tag allerdings noch komplizierter.«
»Wenn Sie damit andeuten wollen, dass niemand von uns in der Lage ist, das Spiel zu beenden, das Sie soeben begonnen haben, dann unterschätzen Sie mich.«
Mit ihrem Blick gestand sie ein, dass sie gespielt und sich verrechnet hatte. »Ich dachte, dass vielleicht Sie diese Männer geschickt haben, um mich zu überfallen. Aber wenn Sie selbst verwundet sind …«
»Warum hätte ich sie beauftragen sollen?«
»Vielleicht, damit sie mich entführen.«
»Ich habe es nicht nötig, Sie verschleppen zu lassen, um herauszufinden, was Sie tun. Da wäre es doch viel einfacher, Sie weitermachen zu lassen wie bisher. Und sollte ich jemals Männer auf eine Frau ansetzen, dann würden sie sie niemals schlagen.«
Sie legte den Kopf in den Nacken und betrachtete eingehend die Folianten auf einem der oberen Regal. »Sie verfolgen mich nicht nur, um zu überprüfen, ob die Gerüchte über mich stimmen.«
Die Decke rutschte ihr über die Schulter hinab, entblößte mehr Haut und ließ sie unter dem Stoff so nackt wirken, wie sie war. Sie war mager. Zu mager, aber dennoch weich. Ihr Körper würde zu ihrem Gesicht passen und zu ihrem Gang – fein und geschmeidig. Wahrscheinlich nutzte sie ihre Weiblichkeit auf dieselbe Weise, wie sie auch ihren Verstand nutzte, mit gefährlicher und weltgewandter Raffinesse.
Doch sie irrte sich. Er verfolgte sie nicht wegen der Aussicht auf Lust oder Verführung. Auch wenn sie tatsächlich die war, die zu sein sie vorgab, und nicht die Betrügerin, für die er sie hielt – niemals hätte er eine Französin um ihrer Gunst willen verfolgt. Nicht einmal den Besten unter ihnen durfte man vertrauen.
Suchend blickte sie sich in der Bibliothek um. »Ich hatte einige Papiere bei mir. Haben Sie sie gefunden?«
»Nein. Waren sie wichtig?«
»Nicht besonders.« Sie zog sich die Decke wieder über die Schulter hoch. »Ich muss jetzt nach Hause.«
Noch nicht. »Zuerst werde ich Kleidung für Sie holen lassen. So können Sie nicht gehen.«
»Ich trage das, was ich besitze. Ich kann nicht länger warten.«
»Ihr Kleid ist voller Blut.«
»Das meiste habe ich ausgewaschen. Mein Schal wird den Rest verdecken.« Mit großen Schritten näherte sie sich dem Schlafgemach.
»Ihr Schal ist völlig zerfetzt.«
»Dann sehe ich eben so arm aus, wie ich bin. Niemanden wird das kümmern.«
Die Bewegung schmerzte mehr, als ihm lieb war, doch Kendale war bei Marielle, bevor sie die Tür öffnen konnte. Er stützte die Hand auf die Tür und versperrte ihr so den Fluchtweg. »Sie werden hierbleiben, bis wir das Gespräch geführt haben, das ich heute mit Ihnen führen wollte.«
Sie drehte sich um und lehnte sich mit dem Rücken an die Tür. »Was könnten wir einander zu sagen haben?«
»Ich weiß, warum Sie in dieser Gasse waren. Ich weiß über die Papiere Bescheid, die an die Küste gebracht werden.«
»Sie wissen gar nichts. Die besten Köpfe Ihrer Regierung haben diese Unterhaltung schon mit mir geführt, und am Ende mussten auch sie zugeben, dass sie nichts wussten.«
Sie wussten nichts Genaues, aber der Verdacht gegen Marielle nahm zu. In der Regierung und sogar bei den französischen Emigranten selbst. Das musste sie doch wissen. Gewiss waren ihre Gleichgültigkeit und Ungeduld nur ein Täuschungsmanöver.
»Aber ich weiß etwas, denn man hat den Weg dieser Papiere bereits zweimal verfolgt, und zwar von dem Moment an, in dem Sie sie aus dem Haus getragen haben, bis zum dem Augenblick, in dem sie Schmugglern an der Küste übergeben wurden.«
»Sie lügen. Wenn Sie mir in den letzten Monaten gefolgt wären, hätte ich das gemerkt.«
»Nicht, wenn ich nicht wollte, dass Sie es erfahren.«
Sie reckte sich ihm entgegen, näherte ihr Gesicht dem seinem, streitlustig. »Eine wehende Flagge wäre weniger auffällig, als Sie es sind. Ich weiß immer, wann Sie da sind. Ich lasse zu, dass Sie mir folgen, solange es mich amüsiert, und wenn es langweilig wird, beende ich es.«
»So wie heute?«
»Ja.«
»Und doch hat es Sie überrascht zu erfahren, dass ich es war, der in der Gasse eingegriffen hat. Wenn Sie immer wissen, wann ich Ihnen folge, dann hätten Sie zumindest damit rechnen müssen, dass ich Zeuge des Angriffs werde.«
Sie dachte über die Logik seiner Worte nach. Dann blickte sie an sich selbst hinunter. »Darf ich mich vor dieser Unterhaltung ankleiden? Oder ziehen Sie es vor, dass ich nackt bleibe, weil ich dann verletzlicher bin?«
»Nackt und verletzlich ziehe ich Sie bei Weitem vor. Allerdings …« Er löste seine Hand vom Türblatt.
Sie stieß die Tür auf und betrat das Schlafgemach. »Ich werde mich beeilen, damit Sie mir sagen können, was Sie sagen müssen. Aber ich muss wirklich bald nach Hause, also bete ich, dass es schnell geht.«
Es würde ziemlich schnell gehen. Vielleicht würde sie danach sogar heimgehen können. Bald allerdings würde diese außergewöhnlich gescheite und hübsche Französin ins Gefängnis wandern, und das war noch der glücklichste Ausgang, den sie erwarten konnte.
3
Eilig zog sie sich an. Sie achtete nicht darauf, dass die feuchte Kleidung hart wie Eisen auf ihre Wunde drückte. Ihr Schal wies zwei lange Risse auf, war ansonsten aber glimpflich davongekommen. Wenigstens war er nicht blutverschmiert. Sie hüllte sich so geschickt darin ein, dass niemand den Schaden bemerken würde.
Dieser Viscount allerdings würde alles sehen. Das Blut und die Risse. Er würde wissen, dass beides da war. Vielleicht tat sie ihm leid. Hilfreich wäre es.
Sie kehrte in die Bibliothek zurück und setzte sich auf den Diwan. Neben ihr lag ein feuchtes Handtuch, das nach der Arznei roch, mit der ihre Wunde gereinigt worden war und die wie Feuer gebrannt hatte. Der Viscount hatte die Behandlung ertragen, ohne einen Ton von sich zu geben. Dabei war er, wie sein großer Verband vermuten ließ, schwerer verletzt worden als sie.
Er setzte sich nicht. Vielleicht machte die Verletzung ihm zu schaffen. Der seidene Morgenrock hing an ihm herunter, als wage er es nicht, Falten zu schlagen. Trotz seiner Schmerzen und seiner unzureichenden Kleidung hielt der Viscount sich so aufrecht, als ritte er bei einer Parade auf einem Pferd. Niemand konnte einen solchen Mann umstimmen, wenn er einen Entschluss gefasst hatte.
Und jetzt hatte er offenbar vor, sie zu verhören. Sie musste ihn davon überzeugen, dass er nichts mit Gewissheit wusste, mochte er auch vieles vermuten. Ein Zweifel, ein einziger Zweifel, würde ihr etwas Zeit verschaffen. Und die brauchte sie. Sein Verdacht gegen sie war die kleinere Sorge im Vergleich zu den vielen großen, die sich jetzt anbahnten.
Er stellte sich vor sie hin, und sie fühlte sich klein und hilflos. Und nackt. Oh ja, sie sah ihm an, dass ihre Einschätzung richtig gewesen war: dass ihr noch feuchtes Kleid sie kaum verhüllte. Das Messer hatte dem Kleid großen Schaden zugefügt, und der Arzt hatte ein Übriges getan. Ohne ihr großes Tuch wäre viel von ihrer Haut zu sehen gewesen. Das interessierte ihn. Sie interessierte ihn. So etwas weiß eine Frau einfach.
Mit Sicherheit wusste sie es seit dem letzten Frühling, seit dem Tag, an dem sie ihn hatte wissen lassen, dass ihr bewusst war, unter seiner Beobachtung zu stehen. Beides war danach zu Ende gewesen, sowohl die Verfolgung als auch sein Interesse. Oder zumindest hatte sie das geglaubt. Doch er hatte angedeutet, dass er sie weiterhin beobachtet hatte – auf so geschickte Weise, dass es ihr entgangen war. Das war keine gute Nachricht. Schwierigkeiten aus zwei Richtungen konnte sie nicht gebrauchen.
»Was sind das für Papiere, die Sie den Kurieren übergeben?«, fragte er.
»Briefe. Einige an den Anwalt meiner Familie, der versucht, Geld aus unserem Besitz für mich zu bekommen. Andere sind Versuche, Kontakt zu Familienmitgliedern aufzunehmen, die vielleicht noch am Leben sind. Immer wieder schreibe ich Briefe, und dann warte und hoffe ich.«
»Sie nehmen große Mühen auf sich, um Briefe außer Landes zu bringen.«
»Die Familie ist jede Mühe wert, finden Sie nicht?«
Offenbar nicht. Er nickte nicht einmal bestätigend.
»Sie haben nicht nur Briefe versendet. Manchmal haben Sie unversiegelte Papiere verschickt. Dokumente. Massen davon, in Rollen, wie Sie heute eine bei sich trugen.«
»Heute habe ich nur ein paar Bilder aus meinem Geschäft bei mir getragen, um sie zu einem Drucker zu bringen, der sie einfärben wollte. Das ist es, was wir bei mir zu Hause tun. Bilder einfärben. Fragen Sie Lady Cassandra oder Emma. Fragen Sie diesen anderen Viscount, den Cassandra geheiratet hat. Alle waren schon dort und haben die Frauen bei der Arbeit gesehen.« Hoffentlich würde ihn das ablenken, falls er diese Rolle am Ende doch genauer betrachtet hatte.
Seine Augen blitzten, und sein Gesicht nahm einen äußerst strengen Ausdruck an. »Es geht schneller, wenn Sie mich nicht wie einen Narren behandeln. Ich habe Ihnen gesagt, dass die Männer, mit denen Sie sich treffen, bis zur Küste verfolgt worden sind. Man hat gesehen, dass diese Rollen England auf Schmugglerbooten verlassen haben. Und die Drucker, die Sie beauftragen, werden sich wohl kaum in Frankreich befinden.«
Bedauerlicherweise war Schöner Esel nicht dumm genug, um sich so einfach hereinlegen zu lassen. Dennoch versuchte sie es. »Haben Sie das mit eigenen Augen gesehen?«
»Leute, denen ich vertraue, haben es gesehen.«
So hatte er sie also ohne ihr Wissen überwacht. Er hatte andere mit der Aufgabe betraut. Wie unfair! »Sie täuschen sich. Oder die Männer, die die Drucker zu mir geschickt haben, haben meine Arbeiten gestohlen und sie an diese Schmuggler verkauft. Oder Ihre Vertrauensmänner haben London nie verlassen, sondern Ihr Geld für Ale ausgegeben und Ihnen hinterher erzählt, was Sie hören wollten. Sie wissen überhaupt nichts, und Sie können auch nichts beweisen.«
Er verschränkte die Arme und starrte wütend auf sie hinab. Die Bewegung wurde begleitet von einem kaum wahrnehmbaren Zusammenzucken. Seine Haltung sorgte dafür, dass der Morgenrock sich gerade so weit öffnete, dass sie seine Brust sehen konnte, aber er schien sich dessen nicht bewusst zu sein. Eine ansehnliche Brust. Breit und mit kräftigen Muskeln als Beweis eines aktiven Lebens. Ein Mann des Militärs, vermutete Marielle. Alles an ihm deutete darauf hin. Kein Soldat allerdings. Ein Viscount würde sich nicht als gemeiner Soldat verdingen.
»Ihr Englisch ist sehr gut«, sagte er.
Sie versuchte, geschmeichelt zu wirken, aber in ihrem Kopf läuteten die Alarmglocken. »Seitdem ich hier bin, habe ich häufig Gelegenheit zu üben. Ich verbringe meine Zeit nicht nur mit meinen eigenen Landsleuten.«
»Haben Sie Englisch in Frankreich gelernt?«
»So viel ich konnte. Es hat mir Spaß gemacht, die Sprache zu lernen.«
Sein Blick ruhte auf ihr. »Sogar Ihr Akzent …«
»Ich imitiere die Sprache derjenigen, die der besseren Gesellschaft angehören.« Er schien nur neugierig zu sein, dennoch gefiel es ihr nicht, dass er sie so bedrängte. In ihren Schläfen begann es zu pochen. »Wer eine Fremdsprache mit starkem Akzent spricht, ist faul. Es reicht, wenn man sich ein wenig anstrengt und das nachahmt, was man hört.«
Nachdenklich ging er auf und ab und warf ihr gelegentlich einen Blick zu. »Denken Sie auf Englisch? Beherrschen Sie die Sprache so gut?«
Ein Schauer überlief sie. »Selten.« Mit einer Hand berührte sie ihren Kopf. »Pardon, m’sieur, aber …« Sie schloss die Augen und kämpfte gegen die Panik an, die sie erzittern ließ.
»Sind Sie krank?«
Seine Stimme erschreckte sie, denn sie klang aufrichtig besorgt. Als sie die Augen öffnete, sah sie ihn direkt vor sich. Er kniete und blickte ihr prüfend ins Gesicht.
»Nur ein kleiner Schwächeanfall. Es ist gleich vorbei.«
»Sie haben Blut verloren. Ich schätze, es war genug, um Sie ohnmächtig werden zu lassen. Und dann die Schläge.« Er ließ die Fingerspitzen über der Wunde in ihrem Gesicht schweben und betrachtete es eingehend.
»Wenn ich nach Hause gehen und mich ausruhen kann, wird es gleich besser.«
»Das kommt überhaupt nicht infrage.«
Ihr sank der Mut. »Weil Ihnen meine Hälfte dieser Unterhaltung nicht gefällt?«
»Weil Sie zu schwach sind.« Er stand auf und half ihr, auf die Füße zu kommen. »Es war schändlich von mir, Ihnen jetzt dieses Gespräch aufzuzwingen. Gehen Sie und ruhen Sie sich aus. Wir werden ein anderes Mal Zeit finden.«
Sanft manövrierte er sie zu der Tür, die in das Schlafgemach führte.
»In meinem eigenen Bett würde ich mich sehr viel wohler fühlen. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie eine Droschke für mich rufen würden. Zu Hause habe ich genug Geld, um dafür zu bezahlen.«
»Ich will nichts mehr davon hören. Der Arzt hat gesagt, dass Sie sich mehrere Tage lang nicht von hier fortbewegen sollen. Ich hätte darauf bestehen müssen, dass Sie wieder ins Bett gehen, anstatt Sie um diese Zeit mit meinen Fragen zu belästigen.«
Er würde nicht aufgeben. Wie lästig er sein konnte! Also würde sie sich später hinausschleichen müssen.
»Werden die Bediensteten nicht …?«
»Im Augenblick bin ich ganz allein hier. Niemand wird es erfahren. In einigen Stunden werde ich uns etwas zu essen bringen lassen. Ich werde Ihnen Bescheid geben. Dann können Sie sich stärken.«
Die Wohnung war klein, und es gab kein weiteres Schlafgemach. Wenn er in dieser Bibliothek blieb, würde die Schlafkammer ihr Gefängnis werden.
Sie legte sich vollständig angekleidet auf das Bett, das wunderbar bequem war. Marielle fühlte sich wirklich ein bisschen benommen, und der Gedanke, sich auszuruhen, war verlockend. Bis das Essen kam, würde sie es sich gut gehen lassen und dann verschwinden, bevor er das Verhör fortsetzen konnte.
Kendale machte sich daran, eine Mahlzeit für seinen kranken Gast zu beschaffen. Er lehnte sich aus dem Fenster und rief einen Jungen von der Straße heran. Der junge Harry lungerte stets dort herum und hoffte auf Botengänge und ein paar Pence als Bezahlung.
»Was kann ich für Sie tun, M’lord?«, rief er, als er seinen Namen hörte. »Brauchen Sie den Aderlasser noch mal?«
»Geh zum White Knight und sag dem alten Percy, er soll mir etwas von dem schicken, was er heute gekocht hat. Genug für zwei.«
»Zwei, ja? Is’ sie wieder zu sich gekommen, ja? Sie sah wie tot aus, als Sie sie reingebracht haben.«
Kendale schnickte einen der Pennys, die er in der Hand hatte. Die kleine Münze flog durch die Luft und landete mit leisem Geklingel auf dem Straßenpflaster. »Dafür vergisst du, dass ich jemanden hereingetragen habe, Junge. Und das hier kriegst du, weil du im Wirtshaus Bescheid sagst.« Er warf ihm weitere drei Pence zu.
Harry sammelte das Geld auf. »Wollen Sie Bier zu dem Essen?«
»Wein.« Er redete sich ein, dass er sich nicht deshalb für den Wein entschieden hatte, weil eine Französin mit ihm geflirtet hatte. Vielmehr kam er sich rüpelhaft vor, weil er sie mit Fragen drangsaliert hatte, obwohl sie verletzt und krank war. Er wollte lediglich etwas wiedergutmachen.
Kendale öffnete mehrere Vitrinen, um herauszufinden, wo sein Diener Porzellan und Kristallgläser aufbewahrte. Er hätte Mr Pottsward mitnehmen sollen zu diesem Besuch in der Stadt, aber bei kurzen Reisen tat er das fast nie. Wenn er nicht mehr in der Lage war, sich eine Woche lang selbst zu waschen, anzukleiden und zu verpflegen, dann würde er wissen, dass er den Kampf verloren hatte. Den Kampf, der Mann zu bleiben, der er war, anstatt der zu werden, der er seinem verdammten Titel zufolge sein sollte.
Er fand die Teller und Gläser, dazu ein Tischtuch und Tafelsilber. Wie gut, dass Pottsward alles zusammen aufbewahrte. Andernfalls hätte er das Tischtuch vergessen. Unsicher, ob er es richtig machte, versuchte er sich zu erinnern, wo die Gabeln zu liegen hatten, als er den Tisch in der Bibliothek deckte. Dazu hatte er die riesigen Folianten forträumen müssen und die Kupferstiche und Landkarten, die darunterlagen. Nachdem er die Karten aufgerollt und die Stiche zusammengebunden hatte, versteckte er sie auf den oberen Regalen des verglasten Bücherschranks.
Dann wartete er, dass Marielle Lyon aufwachen würde, und wieder fragte er sich, was es mit den Bildern auf sich hatte, die sie bei sich gehabt hatte, und mit den Männern, die sie angegriffen hatten. Was hatte es zu bedeuten, dass Marielle Lyon für ein paar Bilder beinahe gestorben wäre? Sie behauptete, damit zu einem Drucker und Verleger unterwegs gewesen zu sein, der Frauen angeheuert hatte, um sie einzufärben. Aber diese hier waren nicht farbig.
Sie sagte, der Angriff sei ein typischer Fall von versuchtem Straßenraub gewesen. Das hielt er für unwahrscheinlich, doch ganz konnte er es in Anbetracht des enttäuschenden Inhalts jener Dokumentrolle nicht ausschließen.
Seine Gedanken wanderten zu den letzten Worten, die sie gesagt hatte, bevor sie in der Gasse zu Boden gesunken war. Je suis désolée. Es tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe.
Sie hatte es auf Französisch gesagt, dann auf Englisch. In gutem Englisch. Zu gut, dachte er jetzt, nachdem er länger mit ihr gesprochen hatte. Auf die Rolle, die sie spielte, war sie gründlich vorbereitet worden. Ohne Zweifel verstand sie Englisch sogar noch besser, als sie es sprach.
Er hatte noch nie Spione ausgebildet, doch wenn es jemals dazu kommen sollte, würde er verlangen, dass sie die Sprache gut zu sprechen und noch besser zu verstehen lernten. Es war sinnlos, das Ohr am Feind zu haben, wenn dieses Ohr nicht alles verstand, was es belauschte, egal, ob die Worte von einem Schulmeister kamen oder von einem Ungebildeten, der sich einfachster Umgangssprache bediente.
Sie hatte auf alles eine Antwort gewusst und sich von seinen Fragen und Anschuldigungen nicht im Geringsten einschüchtern lassen. Und auch, als er ihr gesagt hatte, dass der Weg ihrer Dokumente bis zur Küste und in die Hände von Schmugglern verfolgt worden war, die bekannt dafür waren, dass sie über den Kanal ruderten, hatte sie nicht einmal mit der Wimper gezuckt. Was hatte sie gesagt? Ach ja. Dass klügere Köpfe als er diese Unterhaltung bereits mit ihr geführt hatten und am Ende zugeben mussten, dass auch sie nichts wussten.
Unbehaglich verlagerte er das Gewicht auf dem Diwan. Die Schmerzen in seiner Hüfte waren stärker geworden, seitdem Anderson fort war. Er war schon zuvor verwundet worden und wusste, dass das normal war. Morgen würde es sogar noch schlimmer sein. Und dann würde es vorbeigehen, langsam, Tag für Tag, bis der Morgen kam, an dem er vergessen würde, dass es jemals eine Wunde gegeben hatte. Er betrachtete den Diwan, auf dem er heute Nacht schlafen würde.
An der Tür war ein Klopfen zu vernehmen. Er stand auf und ließ den Bediensteten des Wirtshauses herein. Der Mann trug ein Tablett, auf dem etliche Speisen standen, jede davon mit einer umgedrehten Schüssel aus Zinn bedeckt. Zwei Flaschen Wein lugten aus einem Sack, den der Diener sich um den Leib gebunden hatte.
»Hier. Behalten Sie den Rest.« Kendale reichte ihm ein paar Münzen, mehr als genug, um für das Essen zu bezahlen. Bevor er die Wohnung verließ, steckte der Diener schon einige davon ein.
Da er ohnehin auf den Beinen war, begab er sich zur Tür der Schlafkammer. Von dort waren Geräusche zu hören. »Kommen Sie, essen Sie etwas.« Er sprach so leise, dass sie ihn nicht hören würde, falls er sich irrte und sie noch schlief.
Die Tür öffnete sich, und Marielle tauchte auf, den Schal in der Hand. Ohne das verhüllende Tuch war der Schaden an ihrem Kleid deutlich zu sehen. Offenbar hatte sie das Waschwasser des Morgens benutzt, um den größten Teil des Blutes auszuwaschen. Die feuchte Seite ihres Kleides klebte ihr am Körper. Es war eines dieser altmodischen Kleider mit tief sitzender Taille und Schnürung auf der Vorderseite. Vermutlich war es neu sehr hübsch gewesen, aber jetzt hatte das Hellbraun des Stoffes sich in etwas verwandelt, das der Farbe angetrockneten Schlamms auf einer Landstraße ähnelte, und die welken weißen Spitzenbesätze waren graustichig geworden.
»Ich habe keine Zeit zum Essen.« Trotzdem ging sie zu dem Tablett, nahm die Zinnschüsseln ab und schnupperte.
»Ich bestehe darauf. Sie waren ohnmächtig. Wenn Sie eine anständige Mahlzeit zu sich nehmen, werden Sie schneller wieder gesund.«
»Es ist falsch von Ihnen, mich wie eine Gefangene zu halten.«
»Keine Gefangene. Ein Gast. Als ich Ihnen das Leben gerettet habe, bin ich beinahe aufgespießt worden, und ich werde nicht riskieren, dass alles umsonst war, nur weil Sie nicht vernünftig sind und sich ein paar Tage ausruhen.«
»Sie wollen mir nur noch mehr lästige Fragen stellen.«
»Gentlemen belästigen kranke oder verletzte Frauen nicht mit Fragen. Ich müsste Sie eine ganze Woche hierbehalten, bis Sie gesund genug sind, damit ich Sie weiter befragen kann. Einsperren würde ich das nicht nennen, aber wenn Sie unbedingt darauf bestehen …«
»Eine Woche wäre höchst unangemessen. Unmöglich. Das würde ich nicht zulassen.«
»Die Sache ist die: Als Gefangene haben Sie überhaupt keine Wahl. Aber wie ich schon sagte, Sie werden nur so lange hierbleiben und sich ausruhen, wie der Arzt es verordnet hat. Danach sind Sie frei zu gehen.«