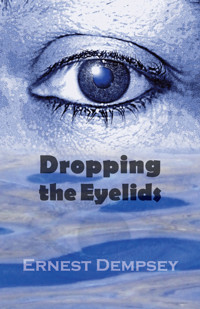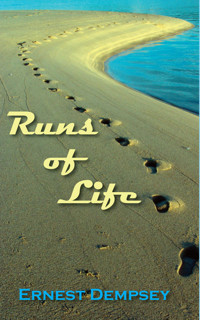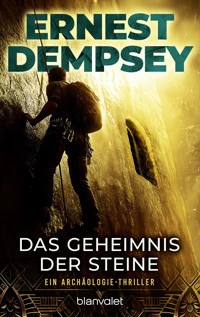
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Sean-Wyatt-Thriller
- Sprache: Deutsch
Rasante Action, atemberaubende Abenteuer und faszinierende historische Fakten – der beste Archäologie-Thriller des Jahres.
Der ehemalige Geheimagent Sean Wyatt zögert keine Sekunde, als sein bester Freund Thomas Schultz entführt wird, und heftet sich auf die Spur der Kidnapper. Doch was wollen die Verbrecher von dem Archäologen? Unterstützt von der Reporterin Allyson Webster stößt Sean auf Hinweise auf die sagenumwobenen Goldenen Kammern der Cherokee – und auf die darin verborgenen, angeblich magischen Steine. Er glaubt nicht an Zauberei, doch die Entführer offenbar durchaus. Wer steckt dahinter? Und was verbirgt Allyson vor ihm?
Rasanter als Tom Clancy, fesselnder als Dan Brown.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Der ehemalige Geheimagent Sean Wyatt zögert keine Sekunde, als sein bester Freund Thomas Schultz entführt wird, und heftet sich an die Fersen der Kidnapper. Doch was wollen die Verbrecher von dem Archäologen? Unterstützt von der Reporterin Allyson Webster, stößt Sean auf Hinweise auf die sagenumwobenen Goldenen Kammern der Cherokee – und auf die darin verborgenen, angeblich magischen Steine. Er glaubt nicht an Zauberei, doch die Entführer offenbar durchaus. Wer steckt dahinter? Und was verbirgt Allyson vor ihm?
Autor
Ernest Dempsey hat einen Bachelor of Science in Psychologie und einen Master in Schulseelsorge. Er hat seine erste Story bereits 2010 veröffentlicht, schrieb zu der Zeit allerdings hauptsächlich Songtexte für seine Rockband »Soulcrush«. Doch inzwischen hat Dempsey bereits mehrere Thriller und Abenteuerromane geschrieben, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Der internationale Durchbruch gelang ihm schließlich mit seinen Archäologie-Thrillern um den ehemaligen Geheimagenten Sean Wyatt. Dempsey lebt heute in Chattanooga, Tennessee.
Ernest Dempsey
Das Geheimnis der Steine
Archäologie-Thriller
Deutsch von Wolfgang Thon
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel »The Secret of the Stones (Sean Wyatt 1)« bei Enclave Books.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright der Originalausgabe © 2012 Ernest Walter Dempsey III
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2025 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Michael Rahn
Covergestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von stock.adobe.com (Nok, ЕвгенийКожевников, Kanisorn, The img)
Bilddetails: Mann, Wand: AdobeStock_916082697 (Nok – stock.adobe.com) / Fenster: AdobeStock_167607509 (ЕвгенийКожевников – stock.adobe.com) / Muster: AdobeStock_571505414 (Kanisorn – stock.adobe.com) / Texture: AdobeStock_729981553 (The img – stock.adobe.com)
HK · Herstellung: DiMo
ISBN 978-3-6413-2758-3V002
www.blanvalet.de
Für meine Freundin Zena Gibson. Ich vermisse Dich.
»Am meisten erstreben die Menschen weder Geld noch Liebe, sondern Unsterblichkeit.«
Anonym
Prolog
NORDWEST-GEORGIA, 1838
Der junge Cherokee-Krieger trat aus dem frühen Morgennebel und lief durch das Unterholz des Waldes. Er hielt sich gebückt und schlängelte sich rasch zwischen den Bäumen hindurch. Bei jedem schnellen Schritt knackten und knirschten Zweige und Blätter unter seinen Mokassins. Er war froh, dass er noch etwas von seiner traditionellen alten Kleidung behalten hatte. Der weiche Lendenschurz und der cremefarbene Überwurf wogen nicht viel und erleichterten die Bewegung erheblich.
Trotz seiner hervorragenden Verfassung war John Burse außer Atem. Er blieb an einer hohen Pappel stehen und riskierte eine kurze Pause. Er blinzelte mit seinen tiefbraunen Augen und suchte die Umgebung nach einem Ausweg ab, nach einem Fluchtweg. Er sog mit tiefen Atemzügen die kühle Frühlingsluft ein; der Duft von trockenem Laub und Tannennadeln stieg ihm in die Nase. Seine Befürchtungen bewahrheiteten sich, als er das Heulen und Kläffen näher kommender Hunde hörte, in das sich menschliche Stimmen mischten. Sechzig Meter hinter ihm tauchte ein Trupp von etwa einem Dutzend Männern mit drei Jagdhunden in dem Bodennebel auf.
John wusste, wie gefährlich der Auftrag war, der ihm am Abend zuvor bei einer geheimen Zusammenkunft erteilt worden war. Der Stammesrat hatte ihm eine Mission von größter Wichtigkeit anvertraut. Wenn er sich fangen ließe, hätte es nicht nur seinen sicheren Tod bedeutet; es konnte in letzter Konsequenz auch zum Untergang seines Cherokee-Stammes führen.
Mit neuer Entschlossenheit schnürte er seinen braunen Lederbeutel und setzte seinen Weg durch das Labyrinth der Baumstämme fort, wobei er sich gelegentlich nach hinten umsah. Der Trupp war noch ein ganzes Stück hinter ihm, aber bereits in guter Schussdistanz. Er hatte es kaum gedacht, als er auch schon den sattsam bekannten Knall eines Schusses hörte und in einem Baum nicht weit von ihm entfernt eine Musketenkugel einschlug. Der Schuss verfehlte ihn nur um wenige Meter. Das beschleunigte seine Schritte.
Seine schlanken Beine brannten von der Anstrengung, und seine Lunge gierte nach Luft. Die Jagd hatte ihn in Form gehalten. Oft verfolgten sein Vater und er Rehe meilenweit, nachdem sie sie angeschossen hatten. Rehe liefen selbst nach einer lebensbedrohlichen Verletzung durch eine Gewehrkugel oder einen Pfeil noch sehr weit und sehr lange. Aber heute war er der Gejagte, und die Last, die John trug, machte seine Reise noch beschwerlicher.
Erschöpft erklomm er einen kleinen Bergrücken. Auf der Kuppe geriet er plötzlich ins Straucheln und rutschte eine kleine Schlucht hinunter, bis er schließlich am Rand eines Flusses zum Stehen kam.
Er war schon oft hier gewesen. Das Gewässer war etwa vierzig Fuß breit und an der tiefsten Stelle nur etwa sechs Fuß tief. Er sah in der Ferne die Soldaten und ihre Hunde, die schnell näher kamen. Der flache Fluss schäumte und gurgelte, wo er nach einer kleinen Biegung weiter abwärtsströmte. Der junge Cherokee kannte die Gegend gut, wahrscheinlich besser als selbst die erfahrensten Soldaten. Er fasste einen Entschluss und sprang in das eiskalte, rauschende Wasser.
Der Suchtrupp sammelte sich genau dort, wo der Verfolgte in den Fluss gestiegen war. Ein Spurenleser untersuchte akribisch den Boden in Ufernähe. Die Fußabdrücke endeten dort und führten nirgendwo anders hin. Die Hunde waren unruhig, es verwirrte sie, was mit der Spur geschehen war, die sie verfolgt hatten. Für die Tiere war es, als wäre der Gesuchte einfach verschwunden.
»Cleverer Bursche«, murmelte ein wettergegerbter Offizier und spuckte einen Schwall Tabaksaft aus. Er trug goldene Rangabzeichen auf seiner dunkelblauen Armeeuniform und hatte hier offenbar das Sagen. Sein Kavalleristenhut hatte bereits ein paar Schmutzflecken, aber die markante goldene Quaste war noch deutlich zu erkennen. Der Siebentagebart in seinem Gesicht war ein Flickenteppich aus Grau und Hellbraun. Er kratzte sich im Nacken, während er über seinen nächsten Schritt nachdachte.
»Er ist ins Wasser gesprungen, Männer«, teilte er seinen Soldaten nüchtern mit. »Thompson, nehmen Sie drei Mann und die Hunde, und überqueren Sie den Bach. Gehen Sie am Ufer flussaufwärts zweihundert Fuß zurück, und suchen Sie nach Spuren, ob er herausgekommen ist. Ich gehe mit den übrigen Männern flussabwärts. Falls er im Wasser ist, kommt er nur langsam voran.«
Zehn Minuten später gelangte die Kerngruppe des Suchtrupps an einen Wasserfall. Das Wasser fiel dort siebzig Fuß in die Tiefe, wo sich die Fluten brodelnd in ein flaches Becken stürzten. Ein kleiner Hügel auf der linken Seite endete an einer steilen Kante. Der Cherokee konnte dort unmöglich entlanggegangen sein. Wegen der steilen Klippen hätte er sich rechts halten müssen. Der Weg führte über einen kaum erkennbaren Pfad nach unten. Kühle Gischt stieg auf beiden Seiten des Wasserfalls bis zu der Stelle hinauf, an der die Männer standen.
»Sir, falls er hier heruntergesprungen ist, dürfte er das kaum überlebt haben!«, wandte ein junger Soldat ein, der im Stillen hoffte, dass sie für heute genug gelaufen waren.
Aber sein kluger Anführer wollte das nicht so einfach glauben. Dieser Cherokee war viel zu gerissen, um so weit zu kommen und sich dann einfach von einer Klippe zu stürzen. »Er ist nicht da runtergesprungen, Soldat. Männer, klettert nach unten, und sucht dort alles ab. Jemand soll in das Becken steigen und jeden Zentimeter des Bodens absuchen. Untersucht auch das umliegende Gelände. Sollte er da rausgekommen sein, will ich wissen, an welcher Stelle. Wir dürfen ihn auf keinen Fall entkommen lassen.«
Die Soldaten setzten sich in Bewegung und stiegen über den Pfad rechts vom Wasserfall hinunter. Thompsons Männer und die Hunde hatten inzwischen ihren Kontrollgang auf der anderen Seite des Baches beendet und standen am anderen Ufer auf der Höhe des Offiziers.
»Haben Sie was gefunden, Lieutenant?«
»Nein, Colonel. Gar nichts, Sir.«
»Wie weit flussaufwärts sind Sie gegangen?« Der befehlshabende Offizier blickte in die Richtung, aus der das Wasser kam.
»Dreihundert Fuß, Sir, nur um auf Nummer sicher zu gehen!«, rief Thompson.
Der Colonel runzelte die Stirn, drehte den Kopf und spuckte in die andere Richtung. Seine Augen verengten sich, und er suchte das Unterholz ab. »Gut gemacht, Lieutenant. Kommen Sie zu uns rüber, und klettern Sie dann mit den anderen nach unten. Er muss in diese Richtung gelaufen sein. Ich weiß nicht, ob er gesprungen ist, aber falls ja, müssten wir ihn schnell finden.«
»Jawohl, Sir.«
Die verbliebenen Männer und die Hunde hasteten durch das eisige Wasser auf die gegenüberliegende Seite und folgten dem kleinen Pfad in die Tiefe. Der alte Offizier schaute sich im umliegenden Wald um, konnte aber keine Spur des Cherokee entdecken. Dann machte er entschlossen kehrt und stapfte selbst den Pfad hinunter, um sich seinen Soldaten anzuschließen.
Der Gejagte wartete nervös und zusammengekauert in der Dunkelheit. Die Soldaten, die ihn verfolgten, hatten bestimmt nicht gesehen, wohin er verschwunden war. Er musste knapp ihren Blicken entgangen sein, bevor sie den Fluss erreichten. Er hatte sich vorsichtig bewegt, als er aus dem Wasser am Rand der Klippen auf der linken Seite des Wasserfalls auftauchte. Es war ein riskantes Manöver gewesen, sich zu dem von oben fast unsichtbaren Felsvorsprung hinunterzuhangeln, der zu einer kleinen Höhle hinter dem Sprühnebel des Wasserfalls führte.
In seinem Versteck konnte er die Befehle des Offiziers und die Stimmen der verwirrten Männer unter ihm kaum hören. Was gesagt wurde, war zwar wegen des rauschenden Wassers nicht zu verstehen, aber die Frustration des Trupps war unverkennbar. Er lehnte sich mit dem Rücken an den Fels und nutzte die Gelegenheit, Atem zu schöpfen. Ihm blieb nichts anderes übrig, als zu warten und die Felshöhle erst zu verlassen, wenn sie weg waren. Langsam streckte er seine Beine auf dem kalten, feuchten Stein aus und versuchte, sich zu entspannen – was angesichts der Umstände schwierig war. Er hoffte, dass sie den versteckten Vorsprung an der Klippe nicht bemerkten. Wer ihn nicht kannte, würde den schmalen Pfad dorthin wahrscheinlich übersehen.
Etwa eine Stunde war vergangen, ohne dass die Soldaten etwas gefunden hatten. Ihr befehlshabender Offizier brüllte seit fünf Minuten Befehle und war hörbar verärgert über das unerklärliche Verschwinden seiner Beute. Durch den Nebel und das herabstürzende Wasser erkannte der Cherokee die verschwommenen Gestalten der Soldaten, die sich entfernten und weiter flussabwärts liefen. Offenbar vermuteten sie, er wäre in den Wasserfall gesprungen und weiter durch das Flussbett gewatet. In der Gewissheit, dass die unmittelbare Gefahr vorbei war, legte er seinen Kopf auf den Beutel und sank in einen erschöpften Schlaf.
Der junge Krieger erwachte unvermittelt. Er musste viele Stunden geschlafen haben. Die Dämmerung hatte sich über den Wald gelegt, und schon bald würde es vollkommen dunkel sein. In der Nacht war es wahrscheinlich sicherer, um sich auf den Weg zu machen. Die Hunde würden seine Nähe zwar wittern, aber Menschen hatten eine viel eingeschränktere Sicht. Bevor er eingeschlafen war, hatte er überlegt, was er mit seiner kostbaren Last anfangen sollte. Seine Aufgabe war es, sie vor dem Zugriff der Armee in Sicherheit zu bringen. Die Regierung der Vereinigten Staaten durfte niemals etwas über den Verbleib oder den Inhalt des Beutels erfahren. Heute hätte er beinahe versagt. Wenn er sein Versteck verließ und versuchte, sich nach Westen durchzuschlagen, riskierte er es, gefangen genommen zu werden. Damit würde er alles aufs Spiel setzen, wofür Generationen seines Volkes gekämpft hatten.
Dann hatte er sich an der Stelle umgesehen, an der er saß. Nur Stammesmitglieder kannten die kleine Nische hinter dem Wasserfall. Wer sonst käme schon auf die Idee, auf den glitschigen Felsvorsprung zu klettern? Er bedachte in aller Ruhe seine Optionen und die damit verbundenen Risiken.
Er schloss die Augen und richtete ein stilles Gebet an den Großen Geist. Es gab tatsächlich nur eine einzige Möglichkeit. Er hatte den Befehl, den Beutel nach Westen zu bringen und alles zu tun, was nötig war, um ihn vor der Armee der Vereinigten Staaten zu schützen. Aber jetzt beschloss er, den Ratsbeschluss zu missachten, wusste jedoch nicht genau, ob es das Richtige war.
Vorsichtig legte er den Lederbeutel in den hintersten Winkel der Höhle und öffnete die Riemen. Sein Volk hatte gewusst, was die Regierung der Vereinigten Staaten wollte. Über ein Jahrzehnt hatten die Cherokee sich bemüht, das Vertrauen der Regierung zu erringen. Sie hatten die Lebensweise der Weißen angenommen und sogar ihre Kleidung getragen. Doch die Häuptlinge der Cherokee hatten immer gewusst, dass irgendwann Gier die Herzen der weißen Männer vergiften würde. Sie wollten Gold und taten alles, um es zu bekommen. John starrte auf das schöne gelbe Metall. In der Dämmerung wirkte es fast etwas matt.
Vorsichtig nahm er die zwei Goldbarren heraus und stapelte sie an der Wand übereinander. In der Felshöhle waren sie nur schwer zu erkennen, aber um sicherzugehen, warf er noch ein paar lose Steine über die Barren, um sie zu verdecken.
Dann kletterte er aus seinem Unterschlupf und schaute noch einmal hinein, um sich zu vergewissern, dass der Schatz durch einen flüchtigen Blick nicht zu erkennen war. Das reicht fürs Erste, sagte er sich. Sein Stamm würde sich hoffentlich nur ein oder zwei Jahre von hier zurückziehen müssen und dann in seine alten Jagdgründe zurückkehren. Erst danach würde er das Gold zurückholen können. Bis dahin war es hier sicher.
Er umklammerte den nun viel leichteren Beutel. Das Gewicht der schweren Goldbarren hatte ihn belastet, doch das, was sich noch in seinem Lederbeutel befand, war weitaus bedeutsamer.
Mit diesem Gedanken arbeitete er sich vorsichtig auf den Felsvorsprung hinaus und kletterte wieder zur oberen Kante des Wasserfalls, um in sein Dorf zurückzukehren. Wenn er sich beeilte, schaffte er es vielleicht gerade noch rechtzeitig, sich dem letzten Treck anzuschließen.
Einige Meilen entfernt hatte der Suchtrupp sein Nachtlager aufgeschlagen. Der alte Offizier saß allein mit einer brennenden Kerze in seinem Zelt und las einen Brief. Das Pergament trug das Siegel des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ein jüngerer Offizier, kaum älter als neunzehn, betrat das Zelt, räusperte sich und wartete darauf, angesprochen zu werden. Die Uniform des Lieutenants sah bemerkenswert sauber aus, wenn man die Umstände ihrer Jagd berücksichtigte.
»Darf ich sprechen, Sir?« Der junge Mann schien etwas befangen zu sein, weil er seinen Kommandanten störte, und blieb regungslos stehen, bis ihm seine Bitte gewährt wurde.
Der Colonel beendete seine Lektüre, als wäre sonst niemand zugegen, faltete den Brief zusammen und legte seine Lesebrille auf ein kleines Kästchen neben seinem Feldbett.
»Stehen Sie bequem, Charles«, befahl er schließlich und wies auf einen kleinen Hocker in der Ecke des Zeltes. »Setzen Sie sich. Was haben Sie auf dem Herzen, Junge?«
»Sir, wir verfolgen diese Rothaut schon seit drei Tagen. Ich beschwere mich nicht, Sir. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich befolge selbstverständlich die Befehle, komme, was wolle. Ich bin nur neugierig: Was ist so besonders an diesem einen Cherokee? Es gibt hier im ganzen Süden jeden Tag bestimmt Dutzende, die aus den Umsiedlungstrecks flüchten. Warum machen wir uns all die Mühe, nur um diesen einen zu jagen?«
Der alte Mann lächelte, sah auf den Brief hinunter, den er gerade gelesen hatte. Er war nicht verärgert über die Frage. Vor dreißig Jahren hätte er wahrscheinlich das Gleiche gefragt, wenn er an der Stelle des Jungen gewesen wäre. Das alles musste wirklich einen seltsamen Eindruck auf die Leute machen. Und Charlesʼ Argument war schlüssig. Er beschloss, dem Lieutenant gerade genug zu sagen, um ihn zu beruhigen, ohne alles zu verraten.
»Charles, das ist kein gewöhnlicher Cherokee. Und unser Zug ist keine gewöhnliche Abteilung. Sie alle wurden ausgewählt, um an einer Eliteoperation teilzunehmen. Diese ganze Einheit wurde nicht willkürlich zusammengewürfelt. Wir haben die Besten der Besten der US-Army ausgewählt und genauestens darauf geachtet, dass keiner von ihnen eine Familie hat, weil unsere Missionen sehr gefährlich sind. Sie sind doch ein Waisenkind, nicht wahr, Charles?«
»Ja, Sir.« In der Miene des Lieutenants zeichnete sich Verwirrung ab.
»Jeder einzelne Mann dieser Einheit hat einen ähnlichen familiären Hintergrund; und er hat ebenfalls seine militärische Ausbildung mit Bravour abgeschlossen. Jeder von Ihnen schießt besser, läuft schneller und ist erwiesenermaßen intelligenter als der Rest Ihrer Kameraden.«
Charles hörte immer noch zu. Bei den wohlwollenden Worten des harten Befehlshabers mischte sich zwar Stolz in sein jugendliches Grinsen, aber er wusste immer noch nicht, worauf die Erklärung hinauslaufen sollte.
»Diese Einheit wurde von der obersten Behörde unseres Landes zusammengestellt, auf den persönlichen Befehl des Präsidenten. Es ist unsere Aufgabe, die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika um jeden Preis zu schützen. Dieser Cherokee hat etwas bei sich, das als Bedrohung für die Sicherheit unserer Regierung und die Zukunft dieses Landes angesehen wird.«
Der Colonel ließ dem jungen Mann Zeit, das Gesagte zu verarbeiten.
»Ich darf Ihnen nicht alle Details verraten, Charles. Diese Informationen waren ausdrücklich nur für mich bestimmt. Aber weil ich es für notwendig halte, Ihre Moral zu stärken, damit wir diese Situation schnell in den Griff bekommen, kann ich Ihnen so viel verraten ...«
Der junge Mann beugte sich vor, seine Aufregung wuchs.
»Die Cherokee und die anderen Stämme führen schon lange Krieg gegen uns. Aber ihre kleinen Feldzüge gegen die Vereinigten Staaten waren zum Scheitern verurteilt. Wir sind in der Überzahl, und wir verfügen über viel bessere Waffen. Zudem fangen sie sich schnell Krankheiten ein, und die Taktik ihrer Kriegsführung ist in vielerlei Hinsicht ziemlich primitiv. Bisher wurden all ihre Aufstände niedergeschlagen. Und jetzt werden die Cherokee und was vom Volk der Creek noch übrig ist, nach Westen umgesiedelt.« Er machte eine kleine Pause.
»Fast alle unsere Feldzüge gegen sie waren erfolgreich, weil ihre Attacken planlos und weitgehend unkoordiniert sind. Aber wenn es ihnen gelänge, alle Stämme zu vereinen, könnten sie stark genug werden, um uns Probleme zu bereiten. Das ist einer der Gründe, weshalb wir die Stämme voneinander trennen. Sie dürfen keinen Kontakt miteinander haben. Eine Vereinigung aller Indianerstämme könnte die Kämpfe über ein Jahrzehnt ausdehnen. Erschwerend kommt hinzu, dass es etwas gibt, das womöglich einen Schulterschluss mit den Spaniern, den Briten oder sogar den Franzosen bewerkstelligen könnte.«
»Und dieser Cherokee, den wir verfolgen, hat etwas dabei, das all das bewirken könnte?« Der junge Offizier war immer noch skeptisch.
Er erhielt nur ein Nicken als Antwort.
»Was?«
Der ältere Mann zögerte. Er hatte dem Jungen wahrscheinlich schon zu viel verraten. Aber eine weitere kleine Information würde das Engagement der Männer bei der Suche vermutlich zusätzlich anstacheln.
»Gold«, antwortete er schlicht.
Der junge Mann brauchte einen Moment, um diese Information zu verarbeiten. Er war unverkennbar enttäuscht von der Antwort und lehnte sich zurück.
»Das ist alles?«
»Das ist alles.«
»Verzeihen Sie, Sir, aber ich bezweifle ernsthaft, dass eine einzige Rothaut genug Gold mit sich herumschleppen kann, um alle Stämme zu vereinen und Verstärkung aus England, Spanien oder Frankreich heranzuschaffen.«
»Es geht nicht um das Gold, das er bei sich hat, Charles, obwohl er sicherlich eine Probe davon mit sich führt. Nein – aber er weiß, wo sich der Rest des Goldes befindet. Und genau danach suchen wir.«
»Nach einer Karte?« Das Interesse des jungen Mannes war wieder entfacht.
»Ganz genau.«
Kapitel 1
Atlanta
Frank Borringer starrte angestrengt auf den alten Text. Er ergab einfach keinen Sinn. Falls zutraf, was sein Partner ihm über die Herkunft dieses Schriftstücks erzählt hatte, wäre seine Bedeutung enorm. Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und nahm die Lesebrille ab. Mit der anderen Hand wischte er über seine Augen und rieb sich die Nasenwurzel. Die geistige Anstrengung brachte ihn in seinem braunen Tweed-Blazer richtig ins Schwitzen. Er schob die Finger unter die eng sitzende hellblaue Fliege um seinen Hals und lockerte sie ein wenig.
Er fragte sich, wie lange er schon an dem Text saß. Es war leicht, die Zeit zu vergessen, wenn der Verstand bei intensiver Lektüre auf Hochtouren lief.
Die Bibliothek war bereits dunkel, nur ein paar verstreute Lampen spendeten etwas Licht. Er suchte die Bibliothek gewohnheitsgemäß zu fortgeschrittener Stunde auf, obwohl dieser fast anachronistisch anmutende Ort heutzutage vermutlich ohnehin nicht mehr viel Zulauf hatte. Seit dem Aufkommen des Internets war es möglich, fast alle Recherchen von zu Hause aus durchzuführen. Dennoch hielt Frank sich gern in Bibliotheken auf: Hier war er umgeben von Büchern, von Werken aus mehreren Jahrtausenden, und die Dokumente hier waren ganz real, er konnte sie anfassen. Ein Computer verschaffte einem die Informationen zwar ebenfalls, doch es fehlte das Gefühl der Realität.
Er hatte sich von seinen Gedanken davontragen lassen und schüttelte frustriert den Kopf. Frank Borringer war seit fünfzehn Jahren Professor für Weltgeschichte und Altertumskunde an der Kennesaw State University. In dieser Zeit hatte er Gelegenheit gehabt, als geladener Gast zahlreicher IAA-Exkursionen viele verschiedene Länder zu bereisen.
Die IAA – die International Archaeological Agency – suchte in der ganzen Welt nach antiken Artefakten, von denen nach Ansicht moderner Historiker die meisten gar nicht existierten. Der Hauptsitz der IAA befand sich erfreulicherweise nicht weit von seinem Wohnsitz in Atlanta entfernt. Die räumliche Nähe und sein Fachwissen über viele alte Kulturen und Sprachen machten ihn für viele Forschungsexpeditionen der Agency zu einem wichtigen Ansprechpartner und gefragten Teilnehmer.
In den vergangenen zehn Jahren war er im Fernen Osten, mehrmals in Europa, in Mittel- und Südamerika und im Nahen Osten gewesen, der ihn zunächst am meisten fasziniert hatte. In den letzten Jahren aber hatte sich sein Augenmerk vor allem auf sein eigenes Land gerichtet. Da er im Nordwesten Georgias aufgewachsen war, hatte er ein besonderes Interesse an der Geschichte des Landes, das heute Vereinigte Staaten von Amerika genannt wird. Frank hatte begonnen, sich schwerpunktmäßig mit der Geschichte der amerikanischen Ureinwohner zu beschäftigen, damit, woher sie kamen, auf welche Weise sie hierher gelangt waren und was sie hinterlassen hatten.
Jetzt saß er an einem Arbeitstisch in der Bibliothek der Kennesaw State University und starrte auf etwas, das ihn verwirrte und gleichzeitig in kindliches Staunen versetzte.
Er zwang sich, zurück an die Arbeit zu gehen, setzte sich die Brille wieder auf die Nase und las weiter. »Die Kammern werden deinen Weg erleuchten.«
Borringer saß allein am Tisch und starrte auf einen kleinen, kreisrunden Stein von einem Ort weit jenseits der amerikanischen Südstaaten, in den Zeichen einer längst vergessenen Schrift eingraviert waren. Diese Steinscheibe war vor einer Woche bei ihm eingetroffen. Frank hatte dem Freund, der sie geschickt hatte, versprochen, die Schrift zu analysieren, sobald er einen Moment Zeit entbehren könne. Bis gestern hatte er die Schachtel, in der der Stein geliefert worden war, nicht einmal geöffnet. Er war von sich selbst enttäuscht, weil er dieses fantastische Stück nicht schon früher betrachtet hatte. Dann lief ihm ein Schauer über den Rücken, als er den Stein umdrehte – sowohl wegen der Bedeutung des Steins als auch wegen der Botschaft, die er vermittelte. Mit größter Aufmerksamkeit betrachtete er die glatte Oberfläche.
Er war wie gebannt und konnte kaum glauben, was er da las. Ausgeschlossen. Konnte es sein, dass es diese vier Kammern wirklich gab? Er hatte sie immer für eine alte Stammeslegende gehalten, ein Märchen, wie die Geschichten vom Jungbrunnen oder über El Dorado. Aber genau wie diese mythischen Orte waren auch die Goldenen Kammern bisher nicht gefunden worden. Und doch hielt er hier ein Indiz dafür in der Hand, dass sie möglicherweise doch existierten.
Seine Gedanken schweiften in die Vergangenheit, und er erinnerte sich an das erste Mal, als er von den vier mythischen Kammern gehört hatte. Ein guter Freund hatte ihm von der Legende über das Gold der Ureinwohner im nördlichen Georgia erzählt.
Eigentlich waren es mehrere Legenden. Als Kind hatte er manche Vorfälle miterlebt, die der Idee in ihm Nahrung gaben, dass ein riesiges Lager des Edelmetalls zum Greifen nahe wäre. Aber es wurde nie gefunden – es gab stets nur Gerüchte und Geschichten. Der riesige Schatz der Ureinwohner wurde schon seit Langem als Mythos betrachtet.
Der Stein, den er jetzt in der Hand hielt, hatte die Form einer zentimeterdicken Münze und etwa einen Durchmesser von einer menschlichen Handfläche. Auf der einen Seite befand sich ein seltsames Bild, das wahrscheinlich zwei Vögel darstellen sollte. Die andere Seite war mit äußerst ungewöhnlichen Schriftzeichen versehen. Die Inschrift verwirrte auf den ersten Blick. Manche Zeichen sahen wie Hieroglyphen aus, andere wirkten wie Schriftzeichen des Althebräischen. Etliche eingekerbte Zeichen wiederum gehörten offenbar zu einer Keilschrift.
Es hatte ihn wie eine Erleuchtung getroffen, als er zu seiner Verblüffung erkannte, dass bei den Inschriften auf diesem Stein vier alte Sprachen verwendet worden waren. Diese Erkenntnis erleichterte die Übersetzung enorm. Nur ... wie waren die alten Sprachen auf ein Artefakt gelangt, das zweifelsfrei von amerikanischen Ureinwohnern stammte? Diese Schriftzeichen sollten nur in den geschichtsträchtigen Regionen des Nahen Ostens zu finden sein – aber gewiss nicht vereint in einem einzigen Text.
Noch beunruhigender war jedoch das Rätsel, das der Text selbst enthielt.
Er betrachtete die beiden Briefe mit den Übersetzungen. Der eine war an seinen Freund gerichtet, der ihm das Artefakt geschickt hatte, der andere war an einen Kollegen von der IAA.
Frank warf einen Blick auf seine Uhr. Es war schon sehr spät geworden. Er rief seine Frau an, damit sie sich keine Sorgen machte, und packte dann seine Sachen zusammen. Nachdem er alles in seiner Laptoptasche verstaut hatte, kehrte er an den Computer zurück. Es war besser, alles auszudrucken, ein paar Kopien zu machen und morgen daran weiterzuarbeiten. Der Nervenkitzel der Entdeckung verlockte ihn, länger zu bleiben und weiterzuarbeiten, aber er wusste, dass er zu Hause jetzt schon ein Donnerwetter für seine Verspätung zu erwarten hatte.
Er packte den Laptop in die Tasche mit den anderen Forschungsunterlagen und schlenderte zum Schreibtisch der Bibliothekare. Die Bibliothek hatte vor einer Stunde geschlossen, aber eine Professur war mit gewissen Privilegien verknüpft. Die Angestellten waren so freundlich, ihn abends abschließen zu lassen. Er umrundete den vorderen Tresen und nahm die Ausdrucke mit den Übersetzungen des Textes auf der Steinscheibe an sich. Er kopierte alles und verfasste einen kurzen Vermerk, dann schob er die Unterlagen in Briefumschläge und adressierte sie. Danach legte er die Briefe in den Korb für ausgehende Post, ging eilig um den Schalter herum, zur Tür hinaus, und trat auf den Bürgersteig.
Eine Herbstbrise empfing ihn, als er die Promenade hinunter zu seinem Auto ging. Er atmete tief die frische Luft ein und fühlte sich wie verjüngt. Vielleicht war es das Wetter, vielleicht seine Hoffnung, dass noch viele Generationen über seine Entdeckung sprechen würden. Vielleicht war es auch beides. Frank lächelte und bog um die Ecke des Bibliotheksgebäudes, hinter der sich der Parkplatz erstreckte.
Die Universität lag im Norden Atlantas in einem Gebiet jenseits der langgestreckten Umgehungsstraße I-285. Kennesaw war kaum mehr als eine Schlafstadt. Nächtliche Spaziergänge waren hier unbedenklich. Dennoch sah sich Frank an diesem Abend ständig um, obwohl er nicht recht wusste, weshalb er sich verfolgt fühlte.
Frank war bei seiner Arbeit für die IAA noch nie auf Probleme gestoßen, obwohl ihm über manche ihrer Mitarbeiter einiges zu Ohren gekommen war, insbesondere über einen, der – wohin er auch geschickt wurde – stets Ärger anzuziehen schien.
Er schüttelte das beklemmende Gefühl ab, das ihn kurzfristig überkam, ging zu seinem Auto und steckte den Schlüssel ins Türschloss. Worüber sollte er sich Sorgen machen? Außer seinem Freund wusste niemand, woran er gearbeitet hatte. Außerdem befasste er sich erst seit ein paar Tagen mit dem neuen Fund.
Frank lächelte und stellte sich vor, wie er ein paar kleine Ehrungen erhielt. Vielleicht würde man ihm eine Auszeichnung für seinen Beitrag zur Enträtselung des alten Geheimnisses verleihen, wenn er mehr Informationen ausgegraben hatte. Er öffnete die Fondtür seines Wagens und ließ die Laptoptasche auf den Rücksitz fallen. Nachdem er die Tür zugeschlagen hatte, ging er zur Fahrertür und fasste gerade nach dem Türgriff, als er plötzlich Schritte hinter sich hörte. Unmittelbar gefolgt von einem stechenden Schmerz in seinem unteren Rücken.
Sein erster Impuls war, sich umzudrehen und dem Angreifer entgegenzutreten, aber er hatte kein Gefühl mehr in den Beinen und verlor im nächsten Moment jede Kontrolle darüber. Einen Moment später sackte er zu Boden. Er versuchte, nach hinten zu fassen, um nach der Einstichstelle zu tasten, aber jetzt versagten ihm auch die Arme ihren Dienst. Als er begriff, dass er gelähmt war, setzte Panik ein.
Füße mit schwarzen Schuhen traten über Borringer hinweg. Die Fondtür seiner Limousine wurde geöffnet, während er auf dem Asphalt liegend hilflos zusah. Er bemühte sich, seinen Kopf wenigstens so weit zu bewegen, dass er den Angreifer sehen konnte, aber er sah nur eine Silhouette auf der Rückbank des Autos, die seine Laptoptasche durchsuchte.
Nach einer gefühlten Ewigkeit tauchten die schwarzen Schuhe und eine schwarze Hose vor ihm auf. Dann schob sich das Gesicht des Angreifers in sein Blickfeld. Ein blonder Mann, Ende zwanzig bis Anfang dreißig, blickte gereizt auf ihn herunter.
»Wo ist es, alter Mann?«, fragte eine kalte Stimme. Sie hatte einen unverkennbar deutschen Akzent.
Vor Franks Augen verschwamm alles und begann sich zu drehen. Nebel kroch in seine Augenwinkel, schien die Taubheit seines Körpers zu überschatten.
Der Mann hob seine Stimme. »Wo ist der Stein, Professor?«
»Sie finden nie, was Sie suchen«, keuchte Borringer und kämpfte verzweifelt gegen die aufkommende Bewusstlosigkeit an.
Der blonde Mann packte den Professor am Hemd und hob ihn ein paar Zentimeter vom Boden hoch, was neue Schmerzwellen durch Franks Körper schickte.
»Ich brauche den Stein.« Der Angreifer schüttelte ihn heftig. »Wo ist er? Raus mit der Sprache«, presste er zwischen den Zähnen hervor.
»Wenn Sie ihn bislang nicht finden konnten«, keuchte er, »waren Sie auch nicht dazu bestimmt, ihn zu besitzen.«
Der feste Griff um das Hemd löste sich, und Franks schlaffer Körper fiel zu Boden. Borringers Kopf knallte auf den Asphalt und löschte jeden zusammenhängenden Gedanken aus.
Die bedrohliche Stimme kam wie aus weiter Ferne zu ihm. »Ich werde den Stein finden. Und wenn ich ihn habe, kann uns nichts mehr aufhalten.«
Doch Frank hörte die letzten Worte kaum noch, weil schon die Dunkelheit von ihm Besitz ergriff.
Kapitel 2
Atlanta
Tommy Schultz saß am kleinen Frühstückstisch seiner Küche und nippte an einem café nube. Er hatte das Getränk im Sommer auf einer Spanienreise zum ersten Mal probiert. Es ähnelte einer Latte macchiato, wurde aber mit normalem Kaffee anstatt mit Espresso zubereitet. Es enthielt mehr Milch als ein café con leche, deshalb schmeckte es nicht so bitter. Mit zufriedener, entspannter Miene genoss er das milde Röstaroma. Er hatte heute viel zu tun, aber wie arbeitsreich sein Morgen auch sein mochte – für einen guten Kaffee war immer Zeit. Das machten die Europäer seiner Meinung nach ganz richtig. Sie nahmen sich immer Zeit für Kaffee oder Tee, besonders nachmittags. Für die meisten Amerikaner war Kaffee nicht viel mehr als ein Wachmacher – etwas, das man schnell herunterstürzte. Was für ein Frevel!
Diese und andere triviale Gedanken gingen Schultz durch den Kopf, als er den letzten Rest Kaffee aus seinem Becher trank. Er betrachtete etwas enttäuscht das leere Gefäß, hätte gern noch mehr von diesem köstlichen Getränk gehabt.
Tommy stand auf und schlenderte in die Küche. Dabei richtete er sich die rot-weiß gestreifte Krawatte. Sie musste nicht perfekt gebunden sein, denn auch sein übriges Outfit war eher leger: hellbraune Chinos und ein weißes Button-up-Hemd, dazu ein Paar braune Skechers.
An dem kleinen Bistrotisch stehend, betrachtete er sich einen Moment lang im Spiegel gegenüber. Er fand nicht, dass er alt aussah. Schließlich war er erst dreiunddreißig. Aber innerlich fühlte er sich viel zu müde für jemanden seines Alters.
Unter seinen dunkelbraunen Augen fanden sich nur ein paar Fältchen, wahrscheinlich aufgrund der jahrelangen Ausgrabungen an sonnigen, heißen Orten. Wegen der Sonne kniff er immer die Augen zusammen. Und in seiner schokoladenbraunen Mähne entdeckte er nur selten ein graues Haar. Tommy lächelte über seine Eitelkeit und griff nach den Schlüsseln auf dem Tisch.
Tommy Schultz hatte vor einigen Jahren die International Archaeological Agency gegründet. Seine Eltern waren sehr wohlhabend gewesen, und als sie plötzlich bei einem Unfall verstarben, erbte Tommy alles. Seine archäologische Karriere hatte gerade erst Fahrt aufgenommen, als der Unfall passierte. Danach war er für eine kurze Zeit orientierungslos gewesen und hatte versucht, seinem Leben eine neue Richtung zu geben.
Dann kam ihm eines Abends, als er allein in einer Bar saß, die Idee für die Agency. Im Fernsehen lief gerade eine Dokumentation über Schatzsucher. Er fragte sich, wie es wohl wäre, eine Agency zu gründen, die antike Artefakte aufspürt und sie den rechtmäßigen staatlichen Stellen zurückgibt. Von diesem Moment an begann er mit den Planungen für die IAA.
Er holte tief Luft und unterdrückte eine Träne, die sich in seinem rechten Auge bildete. Es war schon mehr als ein Jahrzehnt her, dass Tommys Eltern bei dem Unfall ums Leben gekommen waren, aber von Zeit zu Zeit beschlichen ihn Erinnerungen.
Er nahm seine Computertasche vom Tisch und ging zur Tür, die in die Garage führte. Aus dem Augenwinkel bemerkte er durch das Esszimmerfenster ein Auto in seiner Einfahrt. Er blieb neugierig stehen und trat zum Fenster, um zu sehen, was es mit dem Fahrzeug auf sich hatte. Er kannte den Wagen nicht.
Es war ein riesiger Hummer, größer als die meisten Modelle, die er bisher gesehen hatte. Er fragte sich, wer sich angesichts der hohen Benzinpreise einen so großen Wagen leisten konnte. Aber seltsam, warum saß niemand drin?
Er runzelte verwirrt die Stirn und ging zur Haustür, halb in der Erwartung, den Fahrer zu überraschen, als der gerade klingeln wollte. Da schlang sich plötzlich von hinten ein Arm um seinen Hals und drückte fest zu.
Aus dem dunklen Flur trat ein großer blonder Mann in einem englischen Trenchcoat. »Hallo, Mr. Schultz.« Die Stimme hatte einen deutschen Akzent.
»Was zum ...?«, begann Tommy verärgert, aber der Arm um seinen Hals drückte fester zu und schnürte ihm die Luft ab.
»Worum es geht, erfahren Sie noch. Jetzt kommen Sie erst einmal mit.«
Der große Mann nickte, und wieder drückte der Arm fester zu. Die Umgebung verschwamm. Er spürte einen kleinen Piks in seinem Arm, als eine Spritze etwas in seinen Blutkreislauf injizierte. Etwas Kaltes breitete sich in seinem Arm aus, und es dauerte nur wenige Sekunden, bis Tommy das Bewusstsein verlor.
Da er morgens ungewöhnlich früh zur Arbeit ging, bemerkte niemand seiner Nachbarn die drei Männer, die Tommys schlaffen Körper zu dem SUV trugen und ihn im Kofferraum verstauten.
Kapitel 3
Atlanta City
»Und wie wirkt es sich auf Ihre persönlichen Beziehungen aus, dass Sie so viel unterwegs sind? Es muss doch schwierig sein, Freundschaften oder eine Liebesbeziehung aufrechtzuerhalten. Oder ist Ihnen dieser Lebensstil vielleicht sogar lieber?«
Die Frau musterte ihr männliches Gegenüber in der kakifarbenen Hose und der olivgrünen Button-up-Jacke mit aufrichtiger Neugier, auch wenn in ihrer Bemerkung ein sarkastischer Unterton mitschwang. Sie hatte den Kopf etwas zur Seite geneigt, und ihre haselnussbraunen Augen schimmerten amüsiert. Der Lärm der Kaffeemühlen und Cappuccino-Maschinen im Hintergrund verhinderte eine peinliche Stille nach ihrer Frage.
Sean Wyatt saß etwas befangen Allyson Webster gegenüber, einer Journalistin des Atlanta Sentinel. Er fuhr sich kurz durch sein ungebärdiges blondes Haar, während er über ihre Frage nachdachte. Der Krach und das geschäftige Treiben der Leute, die gerade ihren Morgenkaffee genossen, trugen nicht gerade zu seiner Beruhigung bei. Allyson hatte Wyatt um ein Interview gebeten, weil sie ihm ein paar Fragen über die International Archaeological Agency stellen wollte, die treibende Kraft hinter dem Bau des Georgia Historical Center. Tatsächlich waren auch die meisten Exponate darin von IAA-Agenten entdeckt worden. Und einer dieser Agenten war an mehr Bergungsmissionen beteiligt gewesen als die meisten seiner Kollegen.
Dieser Agent war Sean, und Allyson wollte mit ihm über die Abläufe in der IAA sprechen. Nachdem sie zwei Tassen Milchkaffee bestellt hatten, zogen sich die beiden in große, gepolsterte Sessel in einer Ecke des Cafés zurück; ihr Gespräch sollte privat bleiben.
Sean hatte gezögert, Fragen zu seinem Beruf zu beantworten. Er fand nicht, dass die Öffentlichkeit etwas darüber erfahren wollte oder sollte. Sicher, es hatte ein paar dramatische Vorfälle gegeben, aber keiner davon war geeignet, sie vor den Lesern des Sentinel auszubreiten.
Einen Moment blickte er gedankenverloren aus dem wandhohen Fenster. In der Innenstadt von Buckhead, einem Stadtteil von Atlanta, wimmelte es von Fußgängern und Pendlern, die eilig zur Arbeit oder zu anderen dringenden Terminen unterwegs waren. Auf der anderen Seite der Peachtree Street stand eine Frau in einem cremefarbenen Kleid und starrte gebannt in ein Schaufenster, ohne auf den morgendlichen Trubel zu achten.
Er nippte an seinem Kaffee und ließ einige Sekunden verstreichen, bevor er antwortete. »Also, wenn es Sie wirklich interessiert: Es ist mir tatsächlich lieber so«, antwortete er mit einem schiefen Lächeln.
»Wirklich?« Sie kniff misstrauisch die Augen zusammen.
»Ja.«
»Wie kommt das?«
»Mein Beruf lässt sich mit Beziehungen nur schwer unter einen Hut bringen. Ich bin fast nie zu Hause. Und wenn doch, dann meistens nicht sehr lange, vielleicht ein paar Wochen am Stück. Aber genau so will ich es auch haben.«
»Sie sind also eher ein Einzelgänger?« Sie hob fragend eine Braue.
Er schnaubte leise, um sein Grinsen zu unterstreichen. »Das könnte man wohl so sagen.« Er stellte die Tasse auf den kleinen Beistelltisch zwischen ihren beiden Sesseln.
Sie erwiderte sein Lächeln. »Also gut. Wie wäre es, wenn Sie mir dann ein paar Einzelheiten über Ihre Eskapaden in Peru verraten? Was genau ist da unten passiert? Ich habe einige ziemlich interessante Dinge über dieses kleine Abenteuer gehört.«
Wieder setzte er eine etwas verlegene Miene auf. »Bestimmt war das meiste davon übertrieben. Es war eine ereignislose Reise.«
Etwas in seinen grauen Augen verriet ihr, dass er nicht die Wahrheit sagte. »Tatsächlich? Wenn ich mich recht entsinne, war die Rede von einer Auseinandersetzung mit einem südamerikanischen Drogenkartell.«
Er konnte nicht gut bluffen, das wusste er. Und sein verlegenes Herumgerutsche war wohl auch nicht hilfreich. »Miss Webster, ich weiß zwar nicht, was genau Sie gehört haben, aber ich glaube nicht, dass es von Bedeutung ist. Wir sind hingefahren, haben das Artefakt beschafft, nach dem wir gesucht hatten, und es danach den peruanischen Behörden übergeben. Eine kleine Belohnung für das Auffinden und die Rückgabe des Gegenstandes haben wir natürlich nicht ausgeschlagen.«
»Versteht sich«, sagte sie zynisch und mit unbewegter Miene. »Warum erzählen Sie mir nicht einfach, was da unten wirklich passiert ist?«
Er beugte sich dichter zu ihr. Ihr lockiges Haar duftete nach Äpfeln, vermischt mit einem schwach süßlichen Parfüm, vielleicht Vanille. Weil sie den Kopf geneigt hielt, fielen ihre vollen braunen Locken über ihre Schulter. Es musste irgendwo eine Schule für berufstätige Frauen geben, an der sie lernten, ihr Haar so zu stylen. Sean versuchte zu ignorieren, dass sie zunehmend anziehend auf ihn wirkte, und trank rasch einen weiteren Schluck Milchkaffee.
»Tut mir leid. Ich weiß nicht, was Sie über die Expedition in Peru gehört haben wollen, aber ich versichere Ihnen, dass es wirklich nicht besonders aufregend war, abgesehen natürlich von der historischen Dimension dieser Entdeckung.«
»Sie wollen also behaupten, dass Sie dort unten nicht mit Drogenschmugglern aneinandergeraten sind und nicht von deren Anführer gefangen genommen wurden? Dass Sie nicht mit knapper Not entkommen und mit der Statue zurückgekehrt sind, nach der Sie gesucht hatten?« Sie holte tief Luft.
Sean rutschte schon wieder unbehaglich in seinem Sessel herum. »Nochmals, Miss Webster, ich möchte bei unseren Expeditionen nicht allzu sehr ins Detail gehen. Bei der Expedition nach Peru gab es gewisse Schwierigkeiten, zugegeben, aber wir haben sie alle gut überstanden. Die Peruaner haben mit Unterstützung der IAA ein außerordentlich wichtiges Artefakt aus ihrer Geschichte wiedererlangt. Wofür sie sehr dankbar waren, darf ich hinzufügen.«
Amanda begriff, dass sie ihn nicht zum Reden bringen würde, auch wenn er ganz offensichtlich etwas ausließ.
Also wechselte sie das Thema. »Stimmt es, dass Sie nach Ihrem Studium bei einer Spezialeinheit waren?«
Wieder errötete er und schien zudem einfach keine bequeme Sitzposition zu finden. Sie war gut. »Ich fürchte, diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, Miss Webster.«
Die Art und Weise, wie er ihren Namen aussprach, ließ sie leicht erröten. »Und warum können Sie das nicht? Weil Sie mich dann töten müssten?«
»So ähnlich.«
»Was können Sie mir denn überhaupt erzählen?«
»Ich kann Ihnen verraten, dass die IAA für über zwanzig verschiedene Staaten verloren gegangene Artefakte wiederbeschafft hat. Wir sind weltweit tätig und suchen nach Dingen, die andere nicht finden. Man könnte sagen, wir graben dort, wo es sonst niemand tut.«
»Warum tragen Sie dann eine Waffe?« Sie deutete mit einem Nicken auf seine kakifarbene Jacke, die gerade so weit geöffnet war, dass man den Griff der Ruger Kaliber .40 sehen konnte, die er immer bei sich trug.
Er zog die Jacke hastig wieder über die Waffe. »Die gehört mir. Es gibt in der Agentur keine Dienstwaffen, wenn Sie darauf anspielen wollten. Ich habe für diese Waffe eine Lizenz, falls Sie sich das gefragt haben.«
»Ich habe mich eher gefragt, Mr. Wyatt, weshalb all die Gerüchte über geheimnisvolle Aktivitäten kursieren, in die Ihre Organisation verwickelt sein soll. Aber Sie wollen mir nicht mal einen winzigen Knochen zuwerfen.« Sie stieß missbilligend den Atem aus, und ihr Gesicht lief rot an. Seine ausweichenden Antworten waren ärgerlich.
»Was soll ich Ihnen sagen? Ich trage nicht gern Vertrauliches in die Öffentlichkeit.«
Jetzt seufzte Allyson hörbar frustriert. Dieses Gespräch war fruchtlos gewesen. Sie stopfte den Notizblock in ihre Laptoptasche und griff beim Aufstehen nach ihrem Kaffeebecher.
»Danke für Ihre Zeit, Mr. Wyatt. Aber meine habe ich leider vergeudet. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten.«
»Aber nicht doch«, erwiderte er hastig. »Ich wollte hier sowieso auf einen Kaffee vorbeischauen. Aber ich werde Sie wenigstens hinausbegleiten.«
»Das ist nicht nötig.«
»Ich bestehe darauf.« Er streckte höflich seine Hand aus.
Sie schüttelte sie nicht, ging einfach zur Tür. Sean folgte ihr, trat rasch um sie herum und öffnete ihr die Tür. Sie warf ihm einen wütenden Blick zu. Offenbar wollte sie sich nicht auch noch für eine solch altmodische Höflichkeit bedanken.
Trotzig marschierte sie zu ihrem viertürigen schwarzen Honda Civic und schaltete mit der Fernbedienung die Alarmanlage aus, als sie sich der Fahrertür näherte.
Wieder streckte Sean den Arm aus, um ihr die Tür zu öffnen, aber dieses Mal war sie schneller. »Nochmals danke, Mr. Wyatt. Ich wünsche Ihnen einen schönen ...«
Ihre Miene veränderte sich plötzlich, als sie zwei Männer in schwarzen Anzügen bemerkte, die von der anderen Seite des Bürgersteigs auf sie zukamen. Etwa auf halbem Weg griffen sie gleichzeitig in ihre Jacken und zogen Pistolen.
Sean sah, wie sie die Augen aufriss, als sie auf die andere Seite des Parkplatzes blickte. Er reagierte blitzschnell. Sein jahrelanges Kampftraining und die Erfahrungen bei Außeneinsätzen übernahmen das Kommando. Überraschend energisch schob er Allyson auf den Vordersitz des Autos.
»Unten bleiben!«, wies er sie in knappem Befehlston an.
Mit einer weiteren fließenden Bewegung sprang er hinter die offene Autotür und drückte sie ganz nach vorne, um sich vor den beiden Bewaffneten zu schützen. Eine Sekunde später hatte er seine eigene Waffe aus der Jacke gezogen. Kugeln schlugen dumpf in die Autotür vor ihm ein und zerfetzten die Verkleidung aus Plastik und Leder.
Sie benutzten Schalldämpfer. Seine eigene Waffe würde leider nicht so diskret sein. Als er einen Blick über den Rand der Tür riskierte, sah er, dass die beiden Angreifer nur noch ein paar Meter entfernt waren.
Es gibt nur eine Möglichkeit, dieses Spiel zu gewinnen, dachte Sean. Er ließ sich auf den Boden fallen, streckte seine Waffe unter dem Auto durch und gab vier Schüsse auf die Füße und Schienbeine der sich nähernden Angreifer ab.
Der Fuß des einen Mannes explodierte in einer Masse aus schwarzem italienischem Leder und Blut. Das rechte Schienbein des anderen Mannes zersplitterte durch die Wucht des Geschosses.
Beide Angreifer sanken auf die Knie und verzerrten die Gesichter angesichts der unerträglichen Schmerzen in ihren Beinen. Der eine ließ seine Waffe fallen, der andere presste sie an seine Seite. Und beide griffen mit der freien Hand an ihre Schussverletzungen. Mehr brauchte Wyatt nicht.
Er stand auf und gab zwei weitere Schüsse ab. Der Anzugträger mit der Schienbeinverletzung fiel nach hinten um. In seine Stirn hatte eine Kugel ein schwarz-rotes Loch von der Größe eines Fünfcentstücks gestanzt. Der andere griff sich an den Hals und versuchte verzweifelt, den Blutfluss einzudämmen, der plötzlich aus seinem Körper strömte. Sein Kampf dauerte nur wenige Sekunden, bevor er nach vorne fiel.
Sean sah sich besorgt um. Auf dem Parkplatz war niemand zu sehen, aber seine Schüsse mussten bis in das Café gehört worden sein. Die Passanten auf den Bürgersteigen rannten schreiend und panisch vom Tatort weg.
Er ging zur offenen Fahrzeugtür und entdeckte Allyson zusammengerollt und verängstigt im Wagen.
»Wir müssen hier weg.«
»Was?« Sie war sichtlich geschockt.
»Sofort, Allyson.«
Er streckte die Hand aus, packte ihren Arm und zerrte sie aus dem Auto. Erneut überraschte es sie, wie viel Kraft er für einen Mann seiner Größe besaß.
Allyson starrte mit leerem Blick auf die beiden Leichen, die auf dem Asphalt lagen. »Sind sie ...?«, begann sie.
»Ja«, antwortete er, bevor sie ihren Satz beenden konnte.
Er steckte seine Waffe in das Halfter zurück. An einem anthrazitgrauen 1969er Camaro, der auf dem Parkplatz nicht weit von ihnen entfernt stand, blinkten die Lichter kurz auf.
»Wir nehmen mein Auto.«
Allyson war im Moment zu verblüfft und verängstigt, um ihm zu widersprechen.
Trotz ihrer Verwirrung schossen Fragen durch ihrer beider Köpfe. Was war hier los? Warum hatten diese zwei Männer versucht, sie zu töten?
Sean öffnete die Beifahrertür und schob sie so sanft wie möglich auf den Sitz. Dann lief er rasch zur Fahrertür und warf einen letzten Blick auf den Parkplatz, bevor er sich hinter das Lenkrad schwang.
Er schob den Schlüssel ins Schloss, und der Motor sprang sofort an. Dann gab er behutsam Gas, um keine Aufmerksamkeit zu erregen, und fuhr langsam zur hinteren Ausfahrt.
Kapitel 4
Nevada
Durch ein riesiges Bogenfenster fielen die letzten Strahlen der Nachmittagssonne auf das dunkle Nussbaumparkett. Ein grauhaariger Mann mit einem faltigen, wettergegerbten Gesicht betrachtete regungslos die Berglandschaft. Einige wenige treue Anhänger kannten ihn als den Propheten, ihren Führer in einer Zeit geistiger und religiöser Schwäche. Sie mussten nicht wissen, dass er sich diesen Titel selbst verliehen hatte. Es kam nur darauf an, dass sie an das glaubten, was er sagte und tat. Er war vollkommen mit einer Aufgabe beschäftigt, von der nur wenige wussten. Auf einem großen Eichenschreibtisch klingelte ein altes Telefon, wie es vor zwanzig Jahren noch gebräuchlich war.
Der alte Mann, der in seinem Arbeitszimmer im Dunkeln saß, wurde aus seinen Gedanken gerissen und nahm den Anruf entgegen.
»Haben Sie angefangen?« Er sprach ohne Umschweife und im Befehlston.
»Ja, Sir. Alles ist an seinem Platz, so wie Sie es gewünscht haben.«
Die Stimme am anderen Ende der Leitung hatte einen fremdländischen Akzent.
»Und Sie sind sicher, dass Sie aus Schultz herauskriegen, was wir wissen wollen?«
»Hundertprozentig sicher.«
»Und Wyatt?«
»Der wird keine Probleme machen.«
»Ist er tot?«
»Nein. Aber er hat keinen Zugang zu den Informationen.«
»Warum ist er dann noch am Leben?« Der alte Mann klang verärgert.
»Machen Sie sich keine Sorgen, Sir. Der Peilsender an Wyatts Fahrzeug funktioniert. Ich kann jede seiner Bewegungen nachvollziehen.«
»Ich bin nicht besorgt. Aber ich weiß, wozu dieser Sean Wyatt fähig ist. Sie sind ja Experte in derlei Dingen, also wissen Sie ganz genau, wovon ich spreche. Wir fahren mit dem Plan fort, den Sie mir präsentiert haben, aber sollte ich zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl bekommen, dass die Dinge aus dem Ruder laufen, werde ich nicht zögern, Sie von der Sache abzuziehen.« Diese Drohung wurde mit Schweigen am anderen Ende der Leitung quittiert. Dann fuhr die im Dunklen sitzende Gestalt fort: »Halten Sie mich über alle weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden. Und Jens ...«
»Sir?«
»Beseitigen Sie die Frau. Sie hat keinerlei Nutzen für uns.«
»Selbstverständlich, Sir.«
Die dunkle Gestalt in dem hohen Ledersessel legte den Hörer bedächtig auf die Telefongabel zurück und blickte wieder durch das große Arbeitszimmerfenster hinaus.
Bald, sagte er sich, wird sich die ganze Welt verändern.
Kapitel 5
Atlanta
Für Detective Trent Morris war der Tag bereits anstrengend genug gewesen. Er arbeitete seit sieben Uhr morgens, und jetzt wurde er zu einem Doppelmord vor einem Café in Buckhead gerufen. Wie es sich anhörte, war das alles andere als ein Routineeinsatz.
Als er am Tatort eintraf, informierte ihn einer der Mitarbeiter der Spurensicherung, die bereits vor Ort war, dass beide Opfer keine Ausweispapiere bei sich trugen. Sie waren beide männlich, muskulös und hatten dunkelbraunes Haar. Sie trugen ähnliche Anzüge und lange schwarze Mäntel. Außerdem hatten beide Sonnenbrillen getragen.
Hätte er es nicht besser gewusst, hätte Trent geschworen, dass diese Typen vom Secret Service waren. Da er jedoch nicht über einen Besuch des Präsidenten in Nord-Atlanta am heutigen Tag informiert worden war, konnte er diese Möglichkeit getrost ausschließen.
Trent Morris war eine stattliche Erscheinung und genoss bei seinen Kollegen großen Respekt. Er war mit sechs Geschwistern im Südosten Atlantas aufgewachsen. Als Ältester hatte er früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Er ging zielstrebig auf das Absperrband der Polizei zu und hob seine Marke, die an einem Schlüsselband um seinen Hals baumelte, als er an dem Officer vorbeiging, der die Absperrung bewachte. Er bedankte sich bei dem Mann mit einem Nicken, als der das flatternde Band für ihn anhob. Trent atmete tief die milde Stadtluft ein. In seiner Nase mischten sich die Gerüche von Restaurants, Bäumen, Autoabgasen mit dem Zigarettenrauch von einigen anderen Detectives, die bereits am Tatort eingetroffen waren.
»Was haben wir denn hier, Will?«, wandte er sich beim Näherkommen an einen Kollegen, der neben einer Leiche kniete.
Will Hastings war vor einigen Wochen in seine Abteilung versetzt worden. Der Endzwanziger hatte frischen Wind in die Abteilung gebracht, und die Chemie zwischen ihm und dem dunkelhäutigen Trent hatte von Anfang an gestimmt. Der jüngere Polizist hatte die Attitüde eines Draufgängers, ähnlich wie Morris sie einst besessen hatte, als er in den Polizeidienst getreten war. Aber irgendetwas ließ den Jungen gereift erscheinen, und er war nicht so übereifrig wie viele Neulinge, die Trent schon erlebt hatte.
Will drehte sich um, als er seinen Namen hörte, stand auf und streifte die Latexhandschuhe ab, die er benutzt hatte. »He, Partner.« Er ließ den Blick über den Tatort schweifen. »Wenigstens hat man uns diesmal schon morgens verständigt. Normalerweise passiert so etwas immer erst am Ende einer Schicht.«
»Dachte ich auch gerade, Broʼ. Also, was ist hier los?«
Trent ging zu der Leiche, die Will gerade inspiziert hatte, und blickte auf sie herab. »Wurden sie hier erledigt?«
»Sieht so aus. Die Schüsse kamen aus nächster Nähe. Allem Anschein nach von dort drüben, von dem schwarzen Auto. Der hier hat eine tödliche Kopfwunde«, er deutete auf das Opfer vor ihm. »Dem anderen Typen«, er zeigte auf den zweiten Toten, »wurde in den Hals geschossen. Es hat höchstens eine Minute gedauert, bis er tot war.« Das Opfer lag ausgestreckt auf dem Rücken, die Arme weit ausgebreitet. Der mit dem Kopfschuss lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Asphalt. Unter ihm hatte sich eine Blutlache aus der Wunde im Hinterkopf gebildet.
»Einer ist nach vorne gefallen und der andere einfach nach hinten gekippt«, setzte Trent die Zusammenfassung seines Partners fort.
»Wissen wir denn schon, wer diese Typen sind?«
»Wir versuchen, sie zu identifizieren, aber wie gesagt, sie hatten nichts bei sich.«
»Wurden sie ausgeraubt?« Trent wollte die Sache so schnell wie möglich klären. Der Hunger setzte ihm zu. Als hätte er seinen Magen knurren gehört, kam ein junger Streifenpolizist mit einem frischen Becher Kaffee aus dem Café. »Einen Kaffee, Sir?«
»Sie haben meine Gedanken gelesen, Kyle. Danke.«
Der junge Officer schien sich über Trents Höflichkeit zu freuen und ging zu der Absperrung, um den Officer abzulösen, dem Trent bei seiner Ankunft begegnet war.
Will antwortete derweil auf die Frage. »Ich glaube nicht, dass es ein Raubüberfall war. Diese Typen hatten beide eine 9-mm-Glock bei sich. Schmauchspuren an ihren Händen deuten darauf hin, dass sie ebenfalls geschossen haben, und auf dem Boden liegen überall Patronenhülsen, die zu ihren Waffen passen.«
»Womit wurden sie erledigt?«
»Die Ballistiker haben zwar noch nichts gesagt, aber ich vermute, dass es eine 40er war oder so. Das hier sieht wie ein missglückter Anschlag aus.«
Na großartig!, dachte Trent. Das war das Letzte, was die Stadt zusätzlich zu der zunehmenden Bandengewalt gebrauchen konnte. Im Laufe der Jahre hatte Atlanta zwar einige Korruptionsfälle erlebt, aber im Großen und Ganzen hatte das organisierte Verbrechen hier nicht Fuß fassen können. Angesichts der vielen internationalen Unternehmen, die sich in der ständig wachsenden Stadt ansiedelten, gab es keinen Platz für die lokal ausgerichteten Aktivitäten der Mafia.
»Also reden wir von einer Mafiafehde? Ich meine, hatten sie es auf jemanden abgesehen, den wir kennen?«
»Das bezweifle ich. Da drüben wartet ein Zeuge. Er behauptet, er hätte alles gesehen. Seinen Worten nach waren es ein Mann und eine Frau. Der Polizeizeichner ist gerade bei ihm und fertigt ein Phantombild der beiden an. Der Zeuge hat einen starken Akzent. Klingt für mich irgendwie Deutsch, aber ich kann es nicht genau sagen.«
Trent sah zu dem Zeugen, der auf einem der Stühle auf der Terrasse des Cafés saß und äußerst entsetzt wirkte. Wahrscheinlich hatte der Mann noch nie einen Mord gesehen, geschweige denn zwei. Er war blond, um die dreißig, etwa einen Meter neunzig groß und geschätzte neunzig Kilogramm schwer. Sein Kiefer war ziemlich markant, genau wie der Rest seines Knochenbaus. Er trug eine Polizeidecke um die Schultern und beschrieb dem Zeichner gerade aufgeregt die Verdächtigen.
»Irgendeine Spur von der Tatwaffe?« Trent nahm einen Schluck von seinem Kaffee und war angenehm überrascht, dass er genau so schmeckte, wie er ihn mochte. Er hob seinen Becher und blickte zu Kyle hinüber, der die Geste mit einem kurzen Nicken und einem Winken erwiderte.
»Wir haben sie noch nicht gefunden. Ein Team durchkämmt alle Ecken und Winkel in den umliegenden Häuserblocks, aber bisher haben sie nichts entdeckt. Der Zeuge sagt, die beiden Verdächtigen seien in ein Auto gestiegen und hätten die hintere Ausfahrt genommen.«
»Ein Mann und eine Frau? Konnte der Zeuge das Auto erkennen?«, fragte Trent mit vorsichtiger Hoffnung.
»Noch besser. Es war ein 69er Camaro, silberfarben mit schwarzen Zierleisten, und der Zeuge hat sich sogar das Kennzeichen gemerkt. Die Chancen stehen also gut, dass wir die Skizzen überhaupt nicht brauchen.«
Trent konnte kaum fassen, was er da hörte. Das bedeutete, dass die Angelegenheit tatsächlich innerhalb einer Stunde erledigt sein könnte. »Habe ich dir in letzter Zeit gesagt, dass ich dich liebe?«
»Nein. Aber mir wäre es lieber, wenn du mir nachher ein Bier ausgibst.« Will erwiderte das Lächeln.
»Abgemacht. Also, zu wem gehört das Kennzeichen?«
»Der Wagen ist auf einen gewissen Sean Wyatt zugelassen. Er ist in der Nähe von Dunwoody gemeldet, im Norden der Stadt. Wir wissen noch nicht, ob er da wohnt, aber drei Einheiten sind gerade auf dem Weg dorthin, um das zu überprüfen.«