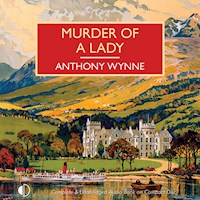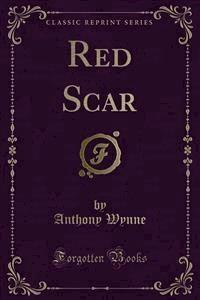9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Klassiker der englischen Kriminalliteratur - 90 Jahre nach seinem Entstehen erstmals in deutscher Übersetzung Es ist zehn Uhr abends, als der örtliche Staatsanwalt mit einer Schreckensnachricht in den Salon platzt: Lady Mary Gregor, die Herrin von Duchlan Castle, ist tot, im Schlaf erstochen. Und das Seltsamste ist: Nicht nur fehlt jede Spur der Mordwaffe, auch waren Tür und Fenster im Zimmer der alten Dame von innen verriegelt. Glücklicherweise ist Doktor Hailey zu Gast auf dem schottischen Anwesen - ein hochtalentierter Amateurdetektiv. Als kurz darauf weitere rätselhafte Morde verübt werden, machen die Bewohner der Gegend fischartige Geschöpfe aus den umliegenden Gewässern für die Morde verantwortlich. Aber Doktor Hailey ahnt, dass es für diese teuflischen Taten eine logische Erklärung geben muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Geheimnis von Duchlan Castle
Der Autor
ANTHONY WYNNE ist das Pseudonym, das sich Robert McNair-Wilson (1882-1963) zulegte. Er schrieb siebenundzwanzig Kriminalgeschichten, in denen der Arzt Eustace Hailey als Amateurdetektiv ermittelt. Darüber hinaus verfasste Anthony Wynne Artikel und Bücher über Ökonomie und Geschichte, zudem eine Biografie über Napoleon.
Das Buch
AGATHA-CHRISTIE-SPANNUNG aus dem GOLDENEN ZEITALTER DER DETEKTIVROMANE:Very Scottish!Es ist zehn Uhr abends, als der örtliche Staatsanwalt mit einer Schreckensnachricht in den Salon platzt: Lady Mary Gregor, die Herrin von Duchlan Castle, ist tot, im Schlaf erschlagen. Und das Seltsamste ist: Nicht nur fehlt jede Spur der Mordwaffe, auch waren Tür und Fenster im Zimmer der alten Dame von innen verriegelt. Glücklicherweise ist Doktor Hailey zu Gast auf dem schottischen Anwesen – ein hochtalentierter Amateurdetektiv. Als kurz darauf weitere rätselhafte Morde verübt werden, machen die Bewohner der Gegend fischartige Geschöpfe aus den umliegenden Gewässern für die Morde verantwortlich. Aber Doktor Hailey ahnt, dass es für diese teuflischen Taten eine logische Erklärung geben muss.
Anthony Wynne
Das Geheimnis von Duchlan Castle
Ein Fall für Eustace Hailey
Aus dem Englischen von Holger Hanowell
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Deutsche Erstausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage Oktober 2021© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2021© 2016 Estate of Anthony WynneDie englische Ausgabe erschien 2016 unter dem Titel Murder of a Lady bei The British Library, 96 Euston Road, London NWI 2DB. Die Originalausgabe erschien 1931 bei Hutchinson, London.Nachwort: © 2016 Martin EdwardsUmschlaggestaltung: Sabine KwaukaTitelabbildung: shutterstock /© Naticka (Schloss); shutterstock / © Amanita Silvicora (Berge); shutterstock / © Darq (Boot); shutterstock /© Gluiki (Wald); shutterstock / © Alan Benge (Allee); shutterstock / © TB studio (Blätter)E-Book Konvertierung powered by pepyrus.comISBN 978-3-8437-2559-0
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
Nachwort
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
1. Kapitel
1. Kapitel
Mord auf Duchlan Castle
Mr Leod McLeod, seines Zeichens Staatsanwalt für Mid-Argyll, war landesweit unter dem Namen »der Monarch vom Glen« bekannt. Diesen Titel hatte er sich redlich verdient, allein schon wegen seiner Kopfhaltung und der ausgeprägten Gesichtszüge. Er war Highlander vom Scheitel bis zur Sohle, trug Ölzeug, würdevoll wie ein Berg, unberechenbar wie der Wind, verschlossen und skurril nach Art der griechischen Komödie. Als er gegen zehn Uhr abends hereinspazierte, an dem Butler vorbeischritt und das Raucherzimmer im Darroch Mor betrat, schnappte selbst Dr. Eustace Hailey hörbar nach Luft, was Colonel John MacCallien sichtlich amüsierte.
»Entschuldigen Sie, meine Herren, wenn ich zu so später Stunde noch störe.« Mr McLeod machte eine kleine Verbeugung und wippte wie ein Schössling im Sturm.
»Möchten Sie nicht Platz nehmen?«
»Haben Sie vielen Dank, ja, durchaus, das tue ich. Du liebe Güte, ist es wirklich schon zehn Uhr?«
John MacCallien bedeutete seinem Butler, einen Tisch samt Karaffe und Sodasiphon näher an den Besucher zu rücken. Mit einer kleinen Geste lud er McLeod ein, sich selbst zu bedienen.
»Wirklich sehr nett von Ihnen. Nun also …«
Dr. Haileys Ansicht nach goss sich Mr McLeod eine gehörige Menge Whisky in einen Tumbler. Dann leerte er das Glas unverdünnt und mit nur einem Schluck. Ein Seufzer löste sich von seinen Lippen.
»Glauben Sie mir, meine Herren«, sagte er in ernstem Ton, »ich behellige Sie nicht aus irgendeiner Laune heraus. Ich hörte, dass Dr. Hailey hier abgestiegen ist. Da die Angelegenheit so ernster Natur ist und wir auf die Schnelle keine Hilfe holen können, fühle ich mich berechtigt, Dr. Hailey mit seinen Fertigkeiten in die Sache einzubeziehen.«
Bei diesen Worten rutschte er unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Dr. Hailey fiel auf, dass die Stirn des späten Gasts von einem dünnen Schweißfilm überzogen war.
»Es hat einen Mord gegeben«, sagte McLeod leiser als zuvor. »Auf Duchlan Castle. Miss Mary Gregor ist ermordet worden.«
»Was?«
»Ja, Colonel MacCallien, das ist leider wahr. Die arme Frau wurde gestern Nacht ermordet, als sie friedlich in ihrem Bett schlief.« Mit einer ruckartig erhobenen Hand brachte der Staatsanwalt sein Entsetzen zum Ausdruck. Ihm war anzusehen, wie sehr er diese Tat verurteilte.
»Kaum zu glauben. Mary Gregor hatte keine Feinde.« John MacCallien wandte sich verdutzt Dr. Hailey zu. »Sogar Landstreicher und Kesselflicker priesen die alte Dame, wenn sie an ihnen vorüberging, und dazu hatten sie allen Grund, da Miss Gregor ihnen stets unter die Arme griff.«
»Ja, ich weiß, Colonel MacCallien, ich weiß«, sagte Mr McLeod. »Wer hier in Argyll wüsste das nicht? Aber ich kann nur wiederholen, was sich auf Duchlan Castle ereignet hat. Dort liegt sie, ermordet.« Dem Mann versagte die Stimme, und er flüsterte: »Ich habe nie eine so grässliche Wunde gesehen.«
2. Kapitel
Eine Fischschuppe
Mr McLeod wischte sich einmal mit der Hand über die Stirn, da er schnell schwitzte. Seine Nasenflügel bebten. »Die Wunde wurde von keinem gewöhnlichen Messer verursacht«, bemerkte er heiser. »Das Fleisch ist geradezu zerfetzt.« Er wandte sich an Dr. Hailey. »Miss Gregor kauerte neben ihrem Bett, als man sie fand.« Er hielt inne, das Blut wich ihm aus dem Gesicht. »Die Tür zum Schlafzimmer war von innen verschlossen, die Fenster waren verriegelt.«
»Wie, ein verschlossener Raum?«, entfuhr es John MacCallien.
»Exakt, Colonel MacCallien. Niemand konnte in das Zimmer hinein oder aus dem Zimmer heraus. Ich habe die Fenster persönlich untersucht, ja, natürlich auch die Tür. Man kann diese Fenster nicht von außen verschließen, unmöglich. Und vom Flur aus konnte man die Tür nicht aufmachen.«
Er saß kopfschüttelnd da und hatte die Augen geschlossen, als habe er sich im Stillen an eine höhere Macht gewandt. Kurz darauf sah er wieder Dr. Hailey an. »Die Wunde«, fuhr er fort, »ist an der linken Schulter, dicht an der Halsbeuge. Soweit ich das beurteilen konnte, geht sie drei oder vier Zoll tief ins Fleisch. Eine klaffende Wunde, die so aussieht, als habe jemand mit einer Axt zugeschlagen. Aber seltsam ist, dass offenbar nur wenig Blut aus der Wunde getreten ist. Dr. McDonald aus Ardmore hat die Leiche untersucht und ist der Ansicht, die alte Dame sei eher an den Folgen des Schocks als an der Wunde an sich gestorben. Wie es scheint, litt Miss Gregor seit vielen Jahren an einer Herzschwäche. Ist es richtig, dass in so einem Fall nur wenig Blut fließen würde?«
»Das mag sein.«
»Etwas Blut findet sich auf dem Nachthemd, aber nicht viel. Wirklich nicht der Rede wert.« Mr McLeod nahm noch einen Schluck von dem Whisky. »Ich habe gleich im Präsidium in Glasgow angerufen«, erklärte er, »aber da wir heute Sonntag haben, rechne ich nicht vor morgen Vormittag mit Inspektor Dundas, der sich der Sache annehmen wird. Als ich erfuhr, dass Sie heute Abend hier sind, sagte ich mir: Wenn Dr. Hailey so freundlich wäre, das Zimmer und die Leiche in Augenschein zu nehmen, dann hätten wir am Montagmorgen wenigstens etwas vorzuweisen.« Mit diesen Worten erhob er sich. »Draußen wartet mein Wagen.«
John MacCallien begleitete Dr. Hailey nach Duchlan Castle.
In der Eingangshalle wurden sie von Major Hamish Gregor begrüßt, dem Bruder der toten Frau, den Mr McLeod wie selbstverständlich mit »Duchlan« anredete. Der Duchlan sah wie ein alter Adler aus. Er schüttelte Dr. Hailey erstaunlich kräftig die Hand und äußerte kein Wort. Dann geleitete er John MacCallien in einen Raum unmittelbar neben der Eingangshalle, während Mr McLeod den Doktor nach oben führte.
»Wer weiß, vielleicht hat dieser heftige Schock noch Folgen für ihn«, vertraute der Staatsanwalt seinem Begleiter im Flüsterton an, als sie die Treppe aus Eichenholz hinaufgingen. »Der Duchlan und seine Schwester standen sich nämlich sehr nah.«
Die Treppe endete auf einer Galerie, von der mehrere Flure ins Innere des stattlichen Herrenhauses führten. Sie folgten dem Verlauf eines Korridors und gelangten an eine Tür, an der man erkennbar die Schließvorrichtung entfernt hatte. Mr McLeod blieb stehen und wandte sich dem Doktor zu.
»Das ist das Schlafzimmer, von dem ich gesprochen habe. Abgesehen von dem Schloss wurde hier nichts verändert oder angerührt. Ich bekam einen ordentlichen Schreck, als ich eintrat. Machen Sie sich auf etwas gefasst.«
Dr. Hailey neigte leicht den Kopf und begegnete dem Ernst des Highlanders mit vorsichtiger Zurückhaltung, mit der er nichts preisgab. Die Tür ließ sich geräuschlos öffnen. Dr. Haileys Blick fiel auf eine Frau in einem weißen Nachtgewand, die neben einem Bett kniete. Die Fensterläden waren geschlossen, und das einzige Licht kam von einer Petroleumlampe, die auf einer Frisierkommode stand. Die am Bett kniende Gestalt hatte schlohweißes Haar, das im Schein der Lampe leuchtete. Die Tote sah aus, als wäre sie ins Gebet vertieft.
Der Doktor schaute sich um. An den Wänden hingen, neben vielen Gemälden, gerahmte Stickmustertücher und andere feine Stickarbeiten. Das Mobiliar war alt und schwer: ein großes Himmelbett aus Mahagoni mit Baldachin, ein Waschtisch, der aussah, als sei er eigens für einen Riesen angefertigt worden, des Weiteren ein Schrank, der so trutzig wirkte wie eine Burg. Zwischen all diesen Ungetümen standen hier und dort Stühle mit verblichener Polsterung und kleine Tische, die von den anderen schweren Möbeln geradezu erdrückt wurden.
Dr. Hailey trat an das Bett und besah sich die tote Frau. Der Staatsanwalt hatte nicht übertrieben. Die Waffe hatte das Schlüsselbein der alten Dame durchschlagen. Hailey bückte sich und zog vorsichtig das Nachthemd zur Seite, um das ganze Ausmaß der Wunde zu sehen. Der Ausdruck von Mitgefühl in seinem Gesicht wich Erstaunen. Hailey schaute zurück zur Tür und bedeutete Mr McLeod, zu ihm zu kommen. Er zeigte auf die Brust der Toten, genauer auf eine blasse Narbe, die knapp oberhalb der frischen Wunde ansetzte und sich fast bis zur Herzgegend zog.
»Sehen Sie sich das an.«
Mr McLeod starrte einen Moment auf diese Narbe und schüttelte dann den Kopf. »Was hat das zu bedeuten?«, fragte er im Flüsterton.
»Es handelt sich um eine alte Wunde. Soweit ich das beurteilen kann, wurde die alte Dame schon einmal vor vielen Jahren verletzt, und zwar genauso ernstlich wie vergangene Nacht.«
»Aber könnte das nicht eine Operationsnarbe sein?«
»Es sind keine Anzeichen von einer Wundnaht zu erkennen. Einstiche einer Naht verschwinden nie ganz.«
Der Staatsanwalt hörte staunend zu. »Ich wusste gar nicht, dass Miss Gregor sich schon einmal verletzt hatte«, sagte er kopfschüttelnd. Er sah, wie der Doktor sein Monokel knapp über der Narbe auf und ab bewegte, um schärfer sehen zu können. Erneut brach ihm der Schweiß auf der Stirn aus.
Als der heisere Ruf einer Eule von draußen durch die Fenster hereindrang, zuckte Mr McLeod erschrocken zusammen.
»Diese alte Verletzung«, sinnierte Dr. Hailey, »wurde der alten Dame mit einer scharfen Waffe zugefügt. Die Wunde ist, wie Sie sehen, gut verheilt, und die Narbe ist so blass, als wäre sie vernäht worden. Schauen Sie nur, wie schmal und sauber sie an den Rändern ist. Eine stumpfe Waffe hätte das Fleisch aufgerissen und eine weitaus hässlichere Narbe hinterlassen.«
Er deutete auf die frische Wunde. »Hier zum Beispiel. Diese Wunde wurde von einer stumpfen Waffe verursacht. Es ist nur eine Vermutung, aber ich würde sagen, dass Miss Gregor vor vielen Jahren von jemandem niedergestochen wurde, der sie ermorden wollte. Die Erfahrung zeigt uns immer wieder, dass Laien das menschliche Herz sehr viel höher in der Brust vermuten, obwohl es tatsächlich mittiger sitzt.«
Der Doktor löste sich aus seiner gebückten Haltung, und als er sich ganz aufrichtete, überragte er seinen Begleiter fast um Haupteslänge. Der Staatsanwalt schaute zu ihm auf und musste unweigerlich an ein Gemälde von Goliath denken, vor dem er sich als Kind immer gefürchtet hatte.
»Mir ist nie zu Ohren gekommen, dass irgendjemand versucht haben sollte, Miss Gregor zu ermorden«, sagte Mr McLeod.
»So, wie John MacCallien über sie sprach, wäre Miss Gregor auch nie und nimmer in den Sinn gekommen, sich selbst das Leben zu nehmen.«
»Wohl eher nicht.«
Der Doktor beugte sich erneut über die Narbe. »Leute, die sich selbst erstechen«, sagte er, »führen einen direkten Stich aus, der für gewöhnlich eine kurze Narbe hinterlässt. Wohingegen Täter, die andere erstechen, schräg nach unten zustechen, was meist zu einer längeren Narbe führt. Diese Narbe ist ziemlich lang, wie Sie unschwer erkennen können. Und sie wird nach unten hin breiter, und genau das ist der Fall, wenn eine Wunde von einem Messer verursacht wird.«
Er hielt das Monokel über eine andere Stelle der frischen Wunde. »Der tödliche Schlag wurde mit starker Gewalt ausgeführt, und ich denke, dass der Täter eine Waffe mit einem langen Griff benutzt hat. Einen stumpfen Gegenstand etwa. Der Mörder stand vor seinem Opfer. Die alte Dame starb an einem Schock, denn hätte ihr Herz weiter geschlagen, hätte die Wunde viel stärker bluten müssen.«
Erneut flog die Eule schreiend am Fenster vorbei, und erneut erschrak Mr McLeod. »Diesen Hieb kann doch nur jemand ausgeführt haben, der nicht ganz bei Sinnen ist«, sagte er mit Nachdruck.
»Das mag stimmen.«
Dr. Hailey nahm eine Wundsonde aus seiner Tasche und untersuchte die Wunde genauer. Dann knipste er eine Taschenlampe an und richtete den Strahl auf das Gesicht der alten Frau. Er vernahm ein Keuchen von Mr McLeod. Die Stirn wies Streifen auf, die darauf schließen ließen, dass Miss Gregor kurz vor ihrem Tod die Finger mit ihrem eigenen Blut befeuchtet hatte. Hailey ging auf ein Knie und nahm die rechte Hand der Dame, die so verkrampft war, dass er die Finger nur gewaltsam zurückbiegen konnte. Er sah, dass die Fingerkuppen mit Blut verschmiert waren. Der Doktor wirkte ratlos.
»Sie umklammerte die Tatwaffe«, erklärte er. »Das bedeutet, dass sie nicht im selben Moment starb, als auf sie eingeschlagen wurde.« Er betrachtete die Finger ihrer linken Hand; sie waren frei von Blut. Dann erhob er sich und wandte sich dem Staatsanwalt zu. »Mit ihrer linken Hand konnte sie nichts ausrichten. Sie packte die Waffe mit der rechten, ehe sie sich mit derselben Hand an die Stirn fasste. Da wenig Blut geflossen ist, muss die Tatwaffe, die diese Wunde hinterließ, im Körper stecken geblieben sein, und zwar, als die Dame schon tot war. Vielleicht hat sie noch versucht, die Waffe aus der Wunde zu ziehen, ehe sie zusammenbrach. Der Mörder muss diesen Todeskampf miterlebt haben, denn er hat die Tatwaffe mitgenommen.«
Mr McLeod umklammerte das Geländer am Fußende des Bettes, es klapperte in seinem festen Griff.
»Zweifellos, zweifellos«, meinte er. »Aber wie konnte der Mörder aus dem Zimmer entkommen? Schauen Sie sich die Tür an.« Er deutete auf die Stelle im schweren Mahagoniholz, an der jemand das Schloss ausgesägt hatte. »Dort konnte er nicht hinaus, ebenso wenig aus den Fenstern.«
Dr. Hailey nickte. Er trat an das Fenster, das am nächsten zum Bett war, und zog den Vorhang beiseite. Dann öffnete er das Fenster. Die laue Luft des Augustabends wehte hinein, begleitet von einem Streifen Mondlicht. Der Doktor knipste noch einmal seine Taschenlampe an und untersuchte den Sims. Danach schloss er das Fenster wieder und sperrte es zu.
»Und es war verriegelt, sagen Sie?«
»Ja, das war es. Auch das andere Fenster ist von innen verriegelt.« Der Staatsanwalt wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Dieses Zimmer liegt genau über dem Herrenzimmer vom Duchlan«, erklärte er.
Dr. Hailey bewegte den Schubriegel am Fenster von einer Seite zur anderen. Die Feder, die den Riegel in Position hielt, war nicht sonderlich stark und sah reichlich mitgenommen aus.
»Schlief Miss Gregor bei offenem Fenster?«, erkundigte er sich.
»Ich denke schon, insbesondere bei diesem Wetter. Ich habe mir sagen lassen, dass die Fenster gestern Abend offen standen.«
Der Doktor richtete den Lichtstrahl seiner Taschenlampe auf den Fußboden unmittelbar vor dem Fenster und bückte sich daraufhin sofort. Auf den Dielen waren Blutstropfen.
»Sehen Sie sich das an.«
»Glauben Sie, die alte Dame wurde hier verletzt?«, fragte Mr McLeod gedämpft.
»Möglich. Wenn nicht, so hätte sie hier ans Fenster kommen müssen, nachdem sie verwundet wurde. Aber beachten Sie bitte, wie wenig Blut wir hier finden. Nur ein paar Tropfen. Die Tatwaffe steckte in der Wunde.« Er beugte sich erneut einen Moment über die Blutflecken. »Es spricht manches dafür, dass sie hier am Fenster tödlich verletzt wurde. Bleibt eine Klinge in einer Wunde stecken, dauert es meist einen Moment, bis sich das Blut sammelt und aus der Wunde fließt. Zweifellos eilte die Dame zu ihrem Bett und brach dort zusammen.«
»Der Mörder floh aber nicht aus einem der Fenster«, verkündete Mr McLeod überzeugt. »Unten finden sich keine Fußabdrücke, und der Boden im Beet ist so weich, man würde sogar die Spuren eines Spatzen bemerken. Wenn Sie morgen einen Blick auf das Beet werfen, werden Sie sehen, dass niemand an der Hauswand nach oben oder nach unten klettern könnte. Das Mauerwerk ist so glatt wie Ihr Handrücken. Man bräuchte ein Gerüst, um bis zu den Fenstern zu gelangen.«
Offensichtlich hatte der Staatsanwalt sämtliche Eventualitäten in Betracht gezogen und dann verworfen. Wieder wischte er sich einmal über die Stirn. Dr. Hailey ging zum Kamin, in dem ein kleines Feuer brannte, und untersuchte ihn genauso eingehend wie das Fenster.
»Zumindest können wir sicher sein, dass niemand durch den Kamin kam.«
»Ja, das ist so gut wie ausgeschlossen. Auch darüber habe ich schon nachgedacht. Der Schornstein wird weiter oben so schmal, dass kein Mensch hindurchpasst. Ich habe mir das bereits angesehen.«
Nun musste nur noch der Ort, an dem die alte Dame kniete, gewissenhaft untersucht werden. Auf den Dielen war wieder Blut zu erkennen, aber man hätte deutlich mehr finden müssen, wenn die Tatwaffe nach dem Tod nicht noch eine Weile in der Wunde gesteckt hätte.
Dr. Hailey bewegte den Lichtstrahl seiner Taschenlampe mehrmals über die kauernde Gestalt am Bett und betrachtete einige Stellen eingehender. Er war mit seiner Begutachtung fast fertig, als auf der linken Schulter der Toten etwas silbrig aufleuchtete und seine Aufmerksamkeit erregte, wie ein glitzernder Tautropfen im Gras. Er beugte sich näher heran, wo der Kragen des Nachthemds die Wunde säumte, und entdeckte einen kleinen ovalen Gegenstand, der an der Haut zu haften schien. Vorsichtig berührte er ihn mit dem Finger; er löste sich sofort. Es war eine Fischschuppe.
3. Kapitel
Bruder und Schwester
Dr. Hailey wandte sich Mr McLeod zu und fragte ihn, ob er bei der Einschätzung des Fundstücks richtiglag. Der Staatsanwalt trat näher, betrachtete das kleine schillernde Beweisstück und gab dem Doktor ohne zu zögern recht.
»Ja, das ist eine Fischschuppe, Hering würde ich sagen. Heringsschuppen sind unverwechselbar. Kein anderer Fisch hat solche Schuppen, wie Ihnen jeder hier am Loch Fyne bestätigen würde, Mann oder Frau.«
»Wenn dem so ist, dann sollten wir uns nach einer Tatwaffe umschauen, die beim Heringsfang verwendet wird.« Man merkte Dr. Haileys Tonfall an, dass er aufgeregt war.
Mr McLeod stimmte ihm zu. »So sieht es wohl aus, ja, so sieht es wohl aus, Doktor. Manchmal benutzen die Fischer eine Axt, glaube ich, allerdings hatte ich mit diesen Leuten nie viel zu tun. Seltsam nur, dass hier keine weiteren Schuppen sind. Man hat Hunderte an der Hand, wenn man einen Hering auch nur anfasst.«
»Vielleicht wurde die Schneide der Axt im Voraus gereinigt.«
»Möglich, aber es ist ziemlich schwierig, Fischschuppen gründlich zu entfernen. Man übersieht sie leicht, weil sie überall festkleben.«
Mr McLeod wirkte aufgeregter. Der Fund der Heringsschuppe schien ihn beinahe genauso zu erschüttern wie der Leichenfund. Der Grund lag auf der Hand, denn viele Menschen in Argyllshire verdienten ihren Lebensunterhalt mit dem Heringsfang am Loch Fyne, als Fischer oder in der Weiterverarbeitung. Dr. Hailey klappte ein Federmesser auf und hob die Fischschuppe sehr behutsam auf die Klinge. Dann brachte er das Fundstück zur Frisierkommode, auf der die Petroleumlampe brannte.
»Ich gehe davon aus, dass nichts dagegenspricht, wenn ich diese Schuppe an mich nehme?«, fragte er. »Glücklicherweise haben Sie gesehen, wo sie sich befand, und können anderen gegenüber bestätigen, dass es sich um ein Beweisstück handelt.«
Mit diesen Worten legte er das Federmesser auf den Tisch und zog seine Taschenuhr aus der Weste. Er klappte den Deckel auf und war im Begriff, die Fischschuppe in den Deckel der Taschenuhr zu legen, als Mr McLeod den Einwand erhob, dass man ein derart bedeutsames Beweisstück zunächst Inspektor Dundas vorlegen müsse.
»Doktor, ich hielte es für besser«, fuhr er fort, »wenn Sie die Schuppe hier im Zimmer lassen würden, damit Dundas sie sich direkt am Tatort ansehen kann. Wissen Sie, er ist ein ziemlich pedantischer Zeitgenosse, und er wird es Ihnen nicht danken, wenn er merkt, dass Sie ihm einen Schritt voraus sind. Wenn wir also irgendein Beweisstück an uns nehmen, wird das sicher den Unmut des Inspektors hervorrufen.«
»Wie Sie meinen.«
Daraufhin legte Dr. Hailey besagte Fischschuppe vorsichtig in eines der kleinen Schubfächer der Kommode. »Ehe wir uns wieder nach unten begeben, würde ich gern noch einmal das Fenster öffnen«, sagte er, als er die Schublade schloss. »Ich habe gesehen, dass in der Nähe des Hauses ein Boot festgemacht ist.«
»Ja, die Motorbarkasse. Sie gehört dem Sohn des Duchlans, Eoghan.«
Sobald der schwere Vorhang nicht mehr das Fenster verdeckte, wirkte der Schein der Petroleumlampe im Licht des Mondes fahl und matt. Dr. Hailey stieß das Fenster auf und blickte hinaus auf die sanften Wellen des Loch Fyne. Er konnte erkennen, wie das silbrig schimmernde Wasser in einen Bachlauf mündete, der seitlich am Herrenhaus vorbeilief. Man konnte das sprudelnde Wasser des Bachs hören. Hailey beugte sich weit über den Fenstersims und sah unten ein breites Blumenbeet, das vom Licht aus dem Herrenzimmer beleuchtet wurde. Das Beet bildete einen natürlichen Streifen zwischen der Auffahrt und dem Mauerwerk von Duchlan Castle. Die Auffahrt zog sich bis zum Portal, linker Hand vom Fenster aus gesehen. Dahinter fiel eine steile Böschung hinab zum Ufer des Bachlaufs.
Das Motorboot war an einem Steg an der Mündung des Bachs festgemacht. Matt schimmerte der helle Rumpf im Mondlicht und bildete einen scharfen Kontrast zu dem schwarzen Landungssteg, der in die Mündung des Bachs ragte.
»Würden Sie bitte die Lampe löschen?«, bat er seinen Begleiter.
McLeod kam der Aufforderung nach, und als Hailey den Blick von der friedlichen, mondbeschienenen Landschaft wendete, stellte er sich innerlich wieder auf die Schrecken des Zimmers ein, in dem ein Mord geschehen war. Im Mondlicht glänzte das schlohweiße Haar der Leiche fast unwirklich, und es machte das Nachtgewand zu einem bleichen Totenhemd. In der düsteren Atmosphäre des Raums wirkte die Tote entrückt, geisterhaft, erbärmlich. Mr McLeod nahm die Petroleumlampe, öffnete die Tür und trat hinaus auf den Korridor, wo er sie erneut entzündete.
Als sich Dr. Hailey ihm anschloss, hielt er die Lampe mit beiden Händen umfasst. Der Glaszylinder wackelte und klapperte leise.
»Es fällt mir schwer, die arme Frau dort zu sehen«, gestand er. »Haben Sie bemerkt, wie das Mondlicht ihr Haar zum Leuchten bringt? Ich denke, dass sie kurz vor ihrem Tod noch betete.« Der Staatsanwalt schaute sich im Korridor um, als wäre ihm unbehaglich zumute.
Dr. Hailey befürchtete schon, dass McLeod die Lampe aus den zittrigen Händen fallen würde.
»Dieses alte Gebäude hat etwas Unheimliches an sich«, fuhr der Staatsanwalt leise fort. »Es soll hier gespukt haben, wie ich hörte.«
Trotz dieser Aussage schien Mr McLeod den Tatort eher widerwillig verlassen zu wollen, ganz so, als würde ihm das Grauen, das er durchlebte, eine makabre Freude bereiten. Dies war womöglich eine Erklärung, warum der Staatsanwalt in seiner Schlussfolgerung religiöse Aspekte mit teuflischem Aberglauben verknüpfte. Als Dr. Hailey über den tieferen Sinn dieser Ideen sinnierte, kam er zu dem Schluss, dass die Menschen all die zurückliegenden Jahrhunderte gebraucht hatten, um eine Trennung zwischen dem Religiösen und dem Dämonischen herbeizuführen.
»Ich fürchte nur«, sagte Dr. Hailey dann, »dass Miss Gregor kaum Zeit zum Beten blieb, nachdem sie den Schlag erhalten hatte.«
»Oh, Sir, nicht doch, Sir«, kam es McLeod fast eifrig über die Lippen. »›Mitten im Leben sind wir im Tod.‹«
Er sprach die vertrauten Worte fast liebevoll vor sich hin und nickte mehrmals mit dem Kopf, als wolle er sich durch die Zeilen beruhigen. Er schien aus altbekannten Zitaten Kraft zu ziehen, doch dann gewannen seine Ängste wieder die Oberhand.
»Ein schrecklicher Gedanke«, fuhr er fort, »dass die Hand des Todes hier waltet, innerhalb dieser Mauern, an diesem Abend.« Er stockte und schaute sich um wie ein Hund, der Schatten nachjagt. Unübersehbar spiegelte sich seine lebhafte Fantasie in seinen Gesichtszügen.
»Doch«, bekräftigte er, »in jenem furchtbaren Augenblick war Mary Gregor auf ihren Knien. Sie hat immer schon Kraft aus Gebeten geschöpft.« Seine Stimme verlor sich in dem weitläufigen Korridor. Offenbar hatte sich McLeod im selben Moment bewusst gemacht, dass die Bitte der Toten nicht erhört worden war, und so sagte der Staatsanwalt furchterfüllt: »Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen.«
Sein Kopf zitterte, wie bei jemandem, der über geheimes Wissen verfügt, das er nicht zu teilen bereit ist. Wieder klapperte die Lampe leicht. Vorsichtshalber nahm Dr. Hailey sie dem Staatsanwalt ab.
Sie gingen wieder nach unten und betraten kurz darauf das Raucherzimmer des Duchlans. Dr. Haileys erster Eindruck war, den Ausstellungsraum eines Antiquitätenhändlers zu betreten. Wohin man blickte, überall ausgestopfte Tiere, Geweihe an den Wänden und alte Eichenmöbel. Der alte Herr erhob sich und begrüßte die beiden, ehe er ihnen mit ausladender Geste zwei Lehnstühle anbot. Entweder stand der alte Mann noch unter dem Eindruck des Unheils, das ihm widerfahren war, oder er hatte das höfliche Benehmen so sehr verinnerlicht, dass er selbst angesichts großen Kummers stets zuvorkommend blieb.
»Nun, Doktor?«, fragte er mit klarer, fast schriller Stimme.
»Ich fürchte, ich kann bislang nichts zur Aufklärung beitragen«, erwiderte Dr. Hailey und schüttelte halb entschuldigend den Kopf. Er ließ das Zimmer und den Hausherrn auf sich wirken, verstand es aber, das wache Interesse hinter unbeteiligten Blicken zu verbergen. Ihm fiel sogleich auf, dass es zwischen dem Schlafzimmer im oberen Stockwerk und diesem übervollen Raum Parallelen gab, die einer Berücksichtigung bedurften. Beide Zimmer ließen eine gewisse geistige Zerstreutheit erkennen, und sowohl oben als auch hier im Raucherzimmer war unübersehbar, dass die alte Dame und ihr Bruder krampfhaft an allem festhielten, was je in ihren Besitz gekommen war. Der alte Duchlan bewahrte die Felle und Geweihe der Waldtiere und Vögel auf, die er gejagt hatte, seine Schwester die Stickmustertücher und andere Handarbeiten. Die Geschwister schienen Wert auf Dinge zu legen, die eher hässlich und unbequem daherkamen. Hailey spürte sofort, dass ihm der Lehnstuhl, auf dem er saß, im Rücken wehtat. Die Sitzgelegenheiten, die er in Miss Gregors Zimmer gesehen hatte, waren gleichermaßen unbequem wie reizlos. Dennoch hatten Generationen der Gregors auf diesen Stühlen Platz genommen. Wie es schien, wurde auf Duchlan Castle sozusagen die »abgelegte Kleidung« ganzer Generationen aufbewahrt.
»Meine liebe Schwester hatte keine Feinde«, ließ sich der alte Duchlan vernehmen. »Daher ist es unvorstellbar, dass irgendjemand einen Groll gegen sie hegte.« Fast zärtlich strich er den Kilt auf Höhe der Knie glatt. »Glauben Sie mir, meine Schwester verbrachte ihre Tage mit dem Dienst am Herrn.«
Er sprach mit der Überzeugung eines amtierenden Geistlichen. Sein Gesicht glich einer ausdruckslosen Maske, doch eine flüchtige Röte zog über seine Wangen. »Ihre Wege waren gesegnete Wege«, fügte er hinzu. »Und ihre Wege waren liebliche Wege.«
Auf diese anerkennenden Worte folgte Schweigen. Dr. Hailey fühlte sich unwohl. Zweifellos meinte der alte Herr, was er sagte, aber der Stolz auf die Familie war so eklatant, dass man sich des Eindrucks nicht erwehren konnte, der Duchlan wolle mit dem Lob seiner Schwester auch sich selbst loben.
»Würden Sie dem Doktor bitte alles erzählen, was Sie wissen, Duchlan?«, forderte Mr McLeod den alten Herrn höflich auf.
»Ich fürchte, da gibt es nicht viel zu erzählen. Unser Leben hier war nicht sonderlich ereignisreich.« Der Duchlan wandte sich seinem Besucher zu und umfasste mit beiden Händen die geschnitzten Enden der Armlehnen. Seine Hände waren dünn und weiß, und als er seine Finger auf und ab bewegte, musste Hailey unweigerlich an Spinnenbeine denken. »Meine geliebte Schwester und ich«, fuhr er fort, »nahmen gestern Abend wie gewöhnlich das Abendessen ein. Ich hatte den Eindruck, dass sie ziemlich müde aussah, denn sie war den Tag über beschäftigt gewesen.«
Er hielt inne und rückte das silberne Ornament an seinem Gürtel zurecht. Hailey fiel auf, dass auf dieser Schnalle ein Wappen eingraviert war. Auch dieser kleinen Geste wohnte Zärtlichkeit inne, als erfülle es den alten Herrn mit tiefer Befriedigung, als Oberhaupt einem Clan vorzustehen. »Meine Schwester ließ mich wissen, sie habe Kopfschmerzen«, fuhr er fort. »Ehe wir uns zu Tisch begaben, machte ich den Vorschlag, wir könnten während der Mahlzeit ausnahmsweise auf die Dienste unseres Pipers verzichten. Doch meine Schwester wies den Vorschlag zurück. ›Mein lieber Hamish‹, sprach sie, ›gewiss hast du nicht vergessen, dass unser seliger Vater selbst am Abend vor seinem Tod während des Abendessens den Dudelsack spielen ließ.‹ Die Sitten und Gebräuche der Highlands waren ihr immer sehr wichtig, nicht nur, weil es unsere Sitten sind, sondern auch weil damit so viele Erinnerungen verbunden sind. Mir war bewusst, dass sie Schmerzen litt, dennoch hieß sie Angus, meinen Piper, wie eh und je mit derselben Anmut willkommen, und als Angus zu Ende gespielt hatte, erhob sie sich und reichte ihm den Becher, wie es die Tradition vorsieht. Ich bin mir sicher, dass Angus zu schätzen wusste, mit wie viel Tapferkeit meine Schwester den Gepflogenheiten nachkam. So war meine Schwester am letzten Abend ihres Lebens, Dr. Hailey, nachdenklich und stets besorgt um andere. Sie blieb den Traditionen und Sitten unserer Familie immer treu.«
Tränen schimmerten in den Augen des alten Duchlans. Er wischte sie mit leichter Hand fort.
»Wir saßen allein zu Tisch, sie und ich, da meine Schwiegertochter sich unpässlich fühlte – und mein Sohn war noch unterwegs. Glauben Sie mir, im Geiste wähnte ich mich zurückversetzt in jene Zeit, als mein Vater, der selige Duchlan, den Platz einnahm, den ich heute einnehme. Für uns Kinder verkörperte er stets die Güte schlechthin. Marys Gedanken gingen offenbar in dieselbe Richtung wie meine, denn sie brachte zum Ausdruck, sie halte unseren Vater für den edelmütigsten Menschen, der je auf Erden wandelte. ›Sein Haus‹, sprach sie, ›ist erfüllt von seiner Güte.‹ Dann kam sie auf meinen kleinen Enkelsohn zu sprechen. Wie deutlich sie ihrer Hoffnung Ausdruck verlieh, der Kleine möge sich der Traditionen würdig erweisen, die er eines Tages übernimmt. ›Wenn wir ihm nur beibringen können‹, sprach sie, ›dass es kein anderes Vorrecht gibt als das, unserem Herrn und Schöpfer zu dienen.‹ Es erfüllte meine liebe Schwester mit großer Freude, als der kleine Bursche vor einem Jahr zu uns kam, solange sein Vater auf Malta stationiert war. Dadurch war es ihr möglich, Einfluss auf den Jungen zu nehmen.«
Nach einer kurzen Pause fuhr er fort: »Und glauben Sie mir, sie hat diese Gelegenheit bestens genutzt. Sie vertrat nämlich die feste Überzeugung, die Grundlage des Charakters müsse immer die Religion sein. ›Gottesfurcht‹, sagte sie immer wieder, ›ist der Beginn aller Weisheit.‹ Sie war stets darum bemüht, dem Kleinen diese Gottesfurcht ins Herz zu pflanzen. Wie nur wenigen Menschen war es ihr gegeben, in das Gemüt eines Kindes vorzudringen. Die Erklärung dafür dürfte die Schlichtheit ihres Charakters gewesen sein. Mit nur einer Geste war sie imstande, eine ganze Gedankenwelt zu suggerieren. Ihr Geist erfreute sich an Liebe und Schönheit, aber nie ließ sie zu, dass ihre Gedanken sich der Kontrolle des Gewissens entzogen. Wenn sie an die Gnade dachte, so verschloss sie nie die Augen vor der Gerechtigkeit. Ein Kind, so verlangte sie stets, müsse imstande sein, sich auf die göttlichen Attribute wie auch auf das Licht und die Luft zu verlassen. Es muss all die Liebe und Freundlichkeit kennenlernen, zu denen das menschliche Herz fähig ist, aber gleichzeitig muss es erkennen, dass sogar die Liebe von Rechtschaffenheit bedingt wird. Die Bibelstellen, auf die meine Schwester oft zurückgriff, dienten dazu, die Heiligkeit zu bezeugen, die selbst den anmutigsten unserer menschlichen Gefühle Grenzen setzt und zur Läuterung führt.«
Die Miene des Duchlans verfinsterte sich. Als er die Hand hob, wirkte diese Geste halb wie eine Segnung, halb wie stummer Protest.
»Ich möchte nicht verhehlen«, sprach er weiter, »dass die Ansichten meiner geliebten Schwester nicht von all denen gutgeheißen wurden, die die Pflicht hatten, das Kind zu umsorgen. Heutzutage erleben wir überall nachlassende Disziplin. Rührselige Vorstellungen, die im Kern bereits verdorben sind, haben allzu oft die alten Ideale von Gerechtigkeit und Verantwortung verdrängt. Heute hören Kinder zu viel über Vergebung, Gnade, Liebe und Freundlichkeit, sie hören aber zu wenig über die Konsequenzen, die jeder Bruch der Sittengesetze nach sich zieht, mag dieser Bruch auch noch so trivial sein. Wir entfernen uns zu weit von den strengen Tugenden unserer Vorväter. Es war Marys Aufgabe, ja, es war ihre heilige Mission, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um diesen Fehler zu korrigieren.«
Er sprach in einem gleichbleibend ernsten Tonfall, sodass sich seine Worte eher wie ein aus dem Gedächtnis zitierter Vortrag anhörten. Dieser Eindruck drängte sich so stark auf, dass Dr. Hailey den Einwand wagte, moderne Vorstellungen seien nicht notwendigerweise falsch, da sie auf dem Guten basierten und nicht auf dem Bösen, das der menschlichen Natur innewohne. Er ließ den alten Mann nicht aus den Augen, als er dies sagte, und sah, wie der Duchlan zusammenzuckte.
»Meine geliebte Schwester hatte grenzenloses Vertrauen in das Gute der menschlichen Natur«, gab der Laird vehement zurück. »Dieser Glaube beruhte jedoch auf ihrer tiefen religiösen Überzeugung, dass der Mensch in Sünde geboren ist. Sie hasste das Böse zu sehr, als dass sie ihm nachgegeben oder so getan hätte, als wäre das Böse nur ein Irrtum. ›Ich habe langsam keine Geduld mehr‹, sagte sie oft zu mir, ›mit der verweichlichten Sentimentalität, die jede Verfehlung im Namen der Liebe entschuldigt.‹ Wann immer sie das sagte, zitierte sie die Bibelstelle: ›Denn welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er.‹«
Der Duchlan sprach voller Leidenschaft, als hätte die leise Kritik, der er sich ausgesetzt sah, in seinem Innern Zweifel wachgerufen, die unbedingt unterdrückt werden mussten. Er machte eine fahrige Geste mit seiner dünnen Hand.
»Seien Sie gewiss«, sagte er weiter, »Marys Glaube war ein Turm der Kraft. Wieder und wieder fand ich dort Hilfe und Trost, wenn meine eigenen Überzeugungen ins Wanken gerieten. Ihr Charakter war auf Fels gebaut. Sie war standhaft und unerschütterlich. Ich selbst habe nie die Stufe des Widerstands gegen das Böse erreicht, die ihr herausragendes Verdienst war. Aber sie gab mir Kraft.«
Wieder trocknete der alte Mann seine Tränen.
»Sehen Sie mir diese kleinen Beobachtungen nach«, entschuldigte er sich. »Da Sie so freundlich gewesen sind, mir bei diesem Unheil zur Seite zu stehen, habe ich das Gefühl, dass ich es Ihnen und dem Andenken meiner Schwester schuldig bin, Ihnen ein wenig aus dem Leben und dem Charakter meiner lieben Mary erzählen zu können.« Er neigte leicht den Kopf. »Recht bald nach dem Essen begab sie sich in ihr Zimmer. Gegen zehn Uhr brachte ihr Dienstmädchen Christina ihr ein Glas Milch. Mary trank immer ein Glas, bevor sie zu Bett ging. Christina verließ das Zimmer Viertel nach zehn. Meine Schwester hatte sich da bereits schlafen gelegt und schien bereits eingeschlummert zu sein. Jedenfalls blies Christina die einzige Kerze aus, die im Zimmer brannte.«
»War ihr Dienstmädchen die letzte Person, die Miss Gregor lebend gesehen hat?«, fragte Dr. Hailey.
»Ja.« Der alte Mann richtete sich in seinem Lehnstuhl auf. »Und ich bin froh, dass es so war, denn die beiden waren seit jeher gut befreundet. Christina schloss meinem geliebten Vater, dem verstorbenen Duchlan, die Augen. Seit mehr als dreißig Jahren teilt sie mit uns unsere Freuden und unsere Sorgen.«
Jedes Mal, wenn der Duchlan seinen Vater erwähnte, senkte er die Stimme, wie Hailey auffiel. Diese Anerkennung war eindrucksvoll. Aber Hailey konnte nicht vergessen, was John MacCallien ihm über den verstorbenen Laird von Duchlan Castle erzählt hatte. Der Mann war ein Tyrann gewesen, ein halsstarriger Mann mit starkem Willen, der keinen Widerspruch zuließ. Darüber hinaus war der alte Laird insbesondere gegen Ende seines Lebens ein starker Trinker gewesen, und mit seinen Zechgelagen brachte er Schande über seine Familie. Alle hatten Angst vor ihm. Lag es an diesen unschönen Szenen, dass sich sein Sohn und seine Tochter so sehr aufeinander verlassen hatten? Zweifellos hatten sie Trost nötig gehabt.
»Dann hat Ihre Schwester also keine Petroleumlampe in ihrem Zimmer benutzt?«, fragte Hailey.
»Nein, Sir.« Für einen kurzen Moment erschien ein kleines Lächeln auf den Lippen des alten Mannes. »Zweifelsohne denken Sie, dass wir der Moderne hinterherhinken, aber Tatsache ist, dass Mary den Petroleumlampen mit einer Besorgnis begegnete, die neue Erfindungen offenbar immer bei alten Gemütern auslösen. Wir wuchsen im Zeitalter der Kerzen auf, und diese sanfte Art der Beleuchtung übte auf uns beide einen besonderen Reiz aus. Unser Wohnzimmer wurde immer von Kerzen erleuchtet, und ich meine, mich zu erinnern, dass die heimelige Atmosphäre stets bewundert wurde, wenn der Raum in dieses Licht getaucht wurde, selbst von den Leuten, die elektrisches Licht gewohnt sind. Mein Sohn sprach kürzlich davon, auf Duchlan Castle Stromleitungen verlegen zu lassen. Mary bat ihn, er möge diese Erneuerungen auf einen Zeitpunkt nach ihrem Tode verschieben.«
Diese Aussage wie auch die vorausgegangenen brachte der Duchlan mit einem Eifer vor, der von der eigentlichen Wirkung ablenkte. Erneut hatte der Doktor den Eindruck, dass der Laird als reines Sprachrohr agierte. Selbst vom Totenbett aus schien die Schwester die Gedanken und Worte des Bruders zu bestimmen. Für Hailey war die Versuchung groß, den Duchlan zu fragen, was für Ansichten er vertrat, wenn es um Themen wie Kindererziehung, Petroleumlampen und Elektrizität ging.
»Hat Ihre Schwester Duchlan Castle im Laufe des Jahres öfter verlassen?«, lautete die nächste Frage des Doktors.
»Nie. Ihr Leben spielte sich hier ab, in diesem Haus. Lange ist es her, dass sie gelegentlich nach Edinburgh fuhr, selten kam es vor, dass sie im Sommer eine Woche in London weilte. Aber in den letzten Jahren hatte sie von derartigen Ausflügen ganz Abstand genommen.« Der Duchlan lehnte sich in seinem Stuhl zurück und schloss die Augen. »Jedes Detail der Führung dieses Hauses und Grundstücks lag in ihren Händen. Nichts überließ sie dem Zufall, nichts wurde übersehen oder vernachlässigt. Sie war wirklich eine wunderbare Verwalterin des Anwesens, ja, eine wunderbare Leiterin und Wirtschafterin. Nichts tat sie überstürzt oder hektisch, nichts wurde verschwendet. Ich versichere Ihnen, dass ich bereits vor Jahren nicht länger auf Duchlan Castle hätte bleiben können, wenn meine Schwester nicht über diese bewundernswerten Fertigkeiten und so viel Weitsicht verfügt hätte. Ich wäre gezwungen gewesen, mein Jagdrevier zu verpachten, und vielleicht hätte ich mich auf Dauer in eins der kleineren Häuser auf dem Anwesen zurückziehen müssen. Mary fürchtete diesen Schritt, der ihr stets großes Unbehagen bereitete.«
Der Doktor holte ein silbernes Kästchen aus seiner Westentasche, öffnete es nach kurzem Zögern und nahm stilvoll eine Prise Schnupftabak. Dabei ließ er sich Zeit, doch der leere Ausdruck auf seinem Gesicht blieb unverändert.
»Wie wurde ihr Tod entdeckt?«, erkundigte er sich.
»Als Flora, das Hausmädchen, meiner Schwester in der Frühe den Tee brachte. Offenbar hatte Mary die Tür zu ihrem Schlafzimmer verriegelt, was sie bis dahin nie getan hatte. Flora erhielt keine Antwort, als sie an die Tür klopfte. Daher rief sie Christina, danach Angus, aber auch die beiden klopften, ohne dass sich etwas tat. Schließlich kam Angus zu mir.« Der alte Mann unterbrach sich und saß einen Moment mit hängendem Kopf da. »In der Nacht war mein Sohn zurückgekehrt«, erklärte er. »Er hatte Militärdienst in Ayrshire. Ich weckte ihn sofort. Wir ließen einen Zimmermann kommen, der das Schloss aus der Tür sägte. Gleichzeitig schickten wir nach Dr. McDonald aus Ardmore. Er traf hier ein, ehe die Tür geöffnet werden konnte.«
Der Duchlan lehnte sich wieder zurück. Sein altes Gesicht, dessen Haut im Licht pergamentartig aussah, war abgehärmt wie bei einem Leichnam. Er schien nur schwer Luft zu bekommen.
»Sie sind sich also recht sicher, dass Miss Gregor die Tür zu ihrem Schlafzimmer für gewöhnlich nicht abschloss?«, fragte Dr. Hailey.
»Absolut sicher.« Die dunklen Augen des Duchlans flimmerten, als er die Frage beantwortete.
Der Doktor schüttelte langsam den Kopf. »Und vergangene Nacht brach sie also mit einer lebenslangen Gewohnheit?« Er ließ diese Frage im Raum stehen.
Der alte Mann ging darauf nicht ein, bewegte sich von Unruhe erfüllt auf seinem Stuhl und begann, mit den dünnen Fingern auf den Armlehnen zu trommeln. Plötzlich beugte er sich vor und lauschte. Ein Auto fuhr über die Auffahrt in Richtung Eingangstür.
4. Kapitel
Inspektor Dundas
Inspektor Robert Dundas war ein junger Mann, der gewieft aussah. Schon die Art, mit der er das Raucherzimmer auf Duchlan Castle betrat, verriet, wie erfolgsverwöhnt und siegesgewiss er war. Er begrüßte den alten Laird mit einer Mischung aus Höflichkeit und Unnahbarkeit, womit er unmissverständlich nahezulegen schien, dass er bei der Ausübung seiner Pflicht keinerlei Einmischung zulassen würde.
Dundas war nicht sonderlich groß, aber seine schlanke Erscheinung ließ den Mangel an Körpergröße unbedeutend erscheinen. Dr. Hailey fiel beim Anblick dieses Mannes der Begriff »drahtig« ein, denn auf ihn machte der Inspektor einen widerstandsfähigen und gelenkigen Eindruck. Allerdings wirkte der junge Mann auf Hailey auch ein wenig mädchenhaft, was die Form der Stirn und die Augen betraf, aber sein Mund schien bestens dafür geeignet, einen bissigen Kommentar loszuwerden. Die Mundwinkel waren leicht nach unten gezogen, die Lippen kamen Hailey überraschend schmal vor. Mr McLeod, der den jungen Mann bereits kannte, stellte ihn John MacCallien und Dr. Hailey vor. Dundas ließ alle Anwesenden wissen, dass er sich freue, sie kennenzulernen. Allerdings sah er dabei alles andere als erfreut aus.
»Wie Sie sehen, bin ich unverzüglich gekommen, Herr Staatsanwalt«, sagte er zu Mr McLeod.
Er trat ruhig auf, legte allenfalls die erzwungene Zurückhaltung eines Bestatters an den Tag, der gerade seiner Arbeit nachkam. Mit seinen blauen Augen blickte er sich im Raucherzimmer um. Ein eisiger Ausdruck kam in diese Augen, als Dundas vom Staatsanwalt erfuhr, welche Schritte Dr. Hailey bereits unternommen hatte.
»Ehe ich mich ins obere Stockwerk begebe«, ließ er sich vernehmen, »würde ich gerne wissen, wer gegenwärtig auf Duchlan Castle lebt.« Er wandte sich dem alten Laird zu und fischte ein dünnes Notizbuch aus der Tasche. »Ich hätte gerne eine vollständige Auflistung der Personen, wenn ich bitten darf.«
Die letzte Bemerkung erinnerte an die Sprechweise eines Arztes, der die Symptome eines Kranken durchgeht, wobei nur der Arzt selbst die Tragweite dieser Symptome ermessen kann. Der alte Laird deutete etwas steif eine kleine Verbeugung an.
»Ich sollte vielleicht mit meiner Wenigkeit beginnen«, sprach er. »Dann wären da noch mein Sohn Eoghan und seine Frau. Im Haus habe ich nur vier Bedienstete …«
Dundas hob eine fein manikürte Hand. »Einen Augenblick bitte. Sie sind Major Hamish Gregor, zuletzt stationiert bei den Argyll and Sutherland Highlanders, und Laird von Duchlan Castle in der Grafschaft von Argyll?« Er notierte sich alles mit flinker Hand. »Wie alt sind Sie, Sir?«
»Vierundsiebzig.«
»Älter oder jünger als Ihre verstorbene Schwester?«
»Älter.«
»Und Ihr Sohn? Er ist Offizier in der Armee, richtig?«
»Eoghan ist Captain beim Royal Regiment of Artillery.«
»Auf Urlaub?«
»Nein. Mein Sohn kam vor einem Monat aus Malta zurück. Er hielt sich dort fast ein Jahr auf, hat aber inzwischen spezielle Aufgaben in Ayrshire übernommen.«
»Verstehe. Dann ist er also nur für einen Tag hier, oder so?«
»Er kam letzte Nacht. Ich weiß nicht, wann er zurück sein muss.«
»Sein Alter?«
»Zweiunddreißig.«
»Ist er Ihr einziger Sohn?«
»Mein einziges Kind.«
»Sie sind Witwer, nehme ich an?«
»Ja, das ist richtig.«
»Wie lange schon?«
Der Duchlan zog die Stirn in Falten, doch dann glättete sich seine Stirn wieder. »Seit mein Sohn vier Jahre alt war.«
»Also seit achtundzwanzig Jahren.«
»Richtig.«
»Hat Ihre Schwester seither bei Ihnen gewohnt?«
»Hat sie.«
»Demzufolge hat sie Ihren Sohn erzogen?«
»Ja.«
Der emsige Bleistift schien alles hinter sich gelassen zu haben, denn Dundas stellte keine Fragen mehr, bis dass er doch wieder etwas notiert hatte. Dann hob er ruckartig den Kopf. »Wie lange ist Ihr Sohn schon verheiratet?«, wollte er dann wissen.
»Drei Jahre und ein paar Monate.«