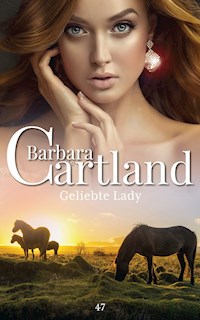Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Regency Scandals
- Sprache: Deutsch
Ein Balanceakt auf der Grenze zwischen Hass und Leidenschaft … Marokko, 1899: Atalya konnte dem Raubüberfall, der ihren Vater das Leben kostete, nur knapp entkommen. Vollkommen mittellos muss sie sich allein durchschlagen – bis sie einen lukrativen Auftrag annimmt: Sie soll die Tochter der französischen Comtesse de Soisson nach England begleiten und mit ihrem entfremdeten Vater, dem Earl of Rothwell, vereinen. Doch als Atalya nach einer schweren Reise mit der jungen Felicity auf dessen Schloss ankommt, ist sie schockiert von der Eiseskälte, mit der sie empfangen wird. Was sie nicht ahnt: Der gutaussehende Earl, gebannt wie erzürnt von Atalyas Schönheit und Weltgewandtheit, fürchtet die manipulative Comtesse könnte sie gesandt haben, um ihn zu verführen und dann des Ehebruchs zu beschuldigen … Ein historischer Liebesroman voll wogender Gefühle – Fans von Julia Quinn werden begeistert sein!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Marokko, 1899: Atalya konnte dem Raubüberfall, der ihren Vater das Leben kostete, nur knapp entkommen. Vollkommen mittellos muss sie sich allein durchschlagen – bis sie einen lukrativen Auftrag annimmt: Sie soll die Tochter der französischen Comtesse de Soisson nach England begleiten und mit ihrem entfremdeten Vater, dem Earl of Rothwell, vereinen. Doch als Atalya nach einer schweren Reise mit der jungen Felicity auf dessen Schloss ankommt, ist sie schockiert von der Eiseskälte, mit der sie empfangen wird. Was sie nicht ahnt: Der gutaussehende Earl, gebannt wie erzürnt von Atalyas Schönheit und Weltgewandtheit, fürchtet die manipulative Comtesse könnte sie gesandt haben, um ihn zu verführen und dann des Ehebruchs zu beschuldigen …
eBook-Neuausgabe September 2025
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1982 unter dem Originaltitel »From Hate to Love«. Die deutsche Erstausgabe erschien 1982 unter dem Titel »Kampf der Herzen«.
Copyright © der englischen Originalausgabe by Barbara Cartland E-Books Ltd. 2013; Copyright Cartland Promotions 1982
Copyright © der deutschen Erstausgabe by Barbara Cartland E-Books Ltd. 2020; Copyright Cartland Promotions 1982
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / shutterstock AI
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (lj)
ISBN 978-3-98952-934-2
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Dieses Buch wurde ursprünglich 1982 veröffentlicht und verwendet eine Sprache, die diese Ära widerspiegelt.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Cartland
Das Geheimnis von Rothwell Castle
Untertitel
Aus dem Englischen von Iris Foerster
KAPITEL 1
1899
»Du kommst zu spät! Wenn du Hunger hast, dann kümmere dich selbst darum, wo du was zu essen findest! Ich hab' weiß Gott besseres zu tun, als hier stundenlang auf dich zu warten!«
Mit diesen Worten schlurfte die alte Araberin aus der Küche und knallte mürrisch die Tür hinter sich zu.
Atayla stieß einen tiefen Seufzer aus. Nach ihrer schweren Schulterverletzung war sie immer noch sehr geschwächt. Um wieder zu Kräften zu kommen, mußte sie sich unbedingt gut ernähren. Aber das war schwierig in einem so streng religiösen Haushalt wie dem von Pater Ignatius, wo jeder Tag ein Fastentag zu sein schien und Mrs. Mansur, seine Haushälterin, aus ihrer Feindseligkeit Atayla gegenüber keinen Hehl machte.
Als man Atayla in die Missionsstation von Tanger gebracht hatte, war sie noch bewußtlos gewesen, und als sie wieder zur Besinnung gekommen war, hatte sie einige Mühe gehabt, sich an die Geschehnisse zu erinnern.
Doch dann war ihr alles wieder eingefallen: Sie hatte ihren Vater, Gordon Lindsay, auf einer seiner Forschungsreisen durch Nordafrika begleitet – ein gefährliches Unternehmen, nicht zuletzt deshalb, weil es ihnen an Ausrüstung fehlte. Sie hatten nur wenige Träger mitnehmen können, eines ihrer Kamele war gestorben, und ein zweites hatten sie völlig entkräftet unterwegs zurücklassen müssen. Zum Glück war dennoch alles gut gegangen. Erst als am Horizont die Minarette von Tanger auftauchten und sie sich schon glücklich am Ende ihrer Reise glaubten, war das Grauen über sie hereingebrochen: Mitten in der Wüste, wie aus dem Nichts, fiel plötzlich eine Horde wilder Räuber über sie her. Es ging alles sehr schnell. Atayla spürte einen stechenden Schmerz an ihrer Schulter, dann sank sie in eine tiefe Ohnmacht.
Als sie wieder zu sich kam, erzählte man ihr, daß hilfreiche Reisende, die des Weges gekommen waren, sie gefunden und hierher in die Missionsstation gebracht hätten. Und dann erfuhr sie auch, daß ihr Vater bei dem Überfall ums Leben gekommen war und daß man ihnen alle Habseligkeiten geraubt hatte, sogar die Kleider, die sie am Leibe trug. Splitternackt und bewußtlos hatten die Räuber sie in der Wüste zurückgelassen. Gott sei Dank war ihr sonst nichts angetan worden.
Es war wie ein Alptraum. Noch heute überkam Atayla ein Zittern, wenn sie daran zurückdachte. Sie stieß einen tiefen Seufzer aus. Was sollte sie jetzt bloß tun völlig mittellos und mutterseelenallein auf der Welt?
Sie mußte versuchen, irgendwie zurück nach England zu gelangen. Vielleicht konnte sie ja bei Verwandten unterkriechen, wenigstens so lange, bis sie irgendeine Anstellung gefunden hatte.
Atayla schloß die Augen. Wie nur sollte sie das schaffen? Sie fühlte sich so schwach, so hilflos. In ihrem Kopf begann es sich wieder zu drehen, als wäre sie aus diesem schrecklichen Alptraum immer noch nicht erwacht. Sie fühlte sich unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen.
Suchend schaute sie sich in der engen, stickigen Küche um. Wo sollte sie hier etwas zu essen finden?
Letzte Woche, als sie zum ersten Mal nach ihrer langen Krankheit aufgestanden und gemeinsam mit Pater Ignatius zu Tisch gesessen war, hatte sie sofort erkannt, daß ihr die alte Haushälterin nicht nur jeden Bissen mißgönnte, den sie sich in den Mund schob, sondern sie außerdem mit glühender Eifersucht verfolgte, als sie sah, wie freundlich der Pater mit Atayla sprach. Die Araberin verehrte den katholischen Missionsleiter in geradezu hündischer Ergebenheit.
Pater Ignatius, ein sympathischer älterer Mann, hatte immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Menschen, die zu ihm kamen. Seine Mönche waren zusätzlich in Krankenpflege ausgebildet und gaben sich große Mühe, die Araber in ihrer Umgebung zum Christentum zu bekehren, leider mit wenig Erfolg. Doch die Glaubensbrüder ließen sich auch durch die härtesten Widerstände nicht entmutigen. Ihre feste Überzeugung lautete, daß jede erduldete Pein sie dem Himmelreich ein Stück näher brachte; daher nahmen sie sogar den Märtyrertod in Kauf.
Doch bis zu Mrs. Mansur hatte sich das Gebot der christlichen Nächstenliebe offenbar noch nicht herumgesprochen. Und so wußte Atayla: Sie mußte fort, so bald wie möglich! Heute Abend würde sie mit Pater Ignatius darüber sprechen.
Zunächst, aber ging es darum, etwas zu essen aufzutreiben. Aber wo? Gestern abend hatte es nur zwei trockene Scheiben Brot und ein Glas Wasser gegeben, was den Pater nicht daran gehindert hatte, in einem inbrünstigen Gebet Gott für seine reichen Gaben zu danken.
Sie öffnete die Küchenschränke und entdeckte nach einigem Suchen ein kleines Hühnerei, das, sorgfältig versteckt hinter einem Stapel Tassen, offenbar ihrer Aufmerksamkeit hatte entgehen sollen.
Vorsichtig legte sie es auf den Küchentisch und schnitt sich von dem steinharten Laib Brot mühselig eine dicke Scheibe ab, die sie über dem halb erloschenen Herdfeuer röstete. Diese wenigen Handgriffe strengten sie bereits derart an, daß sie am Ende, als sie das rohe Ei über die geröstete Brotscheibe goß, überhaupt keinen Hunger mehr verspürte. Aber sie mußte jetzt essen! Nur so würde sie wieder zu Kräften kommen.
»Und nun bitte noch ein knusprig gebratenes Hühnchen«, murmelte sie vor sich hin, als sie den letzten Krümel Brot verspeist hatte, »dazu knackig frischen Salat und Frühkartoffeln aus einem englischen Gemüsegarten.«
Bitter lachte sie auf. Sie warf einen Blick aus dem Fenster hinaus in die gleißende Mittagssonne, in der es um diese Zeit keine Minute lang auszuhalten war. Was für eine absurde Phantasie!
Ihre Augen kehrten zurück zu dem leeren Teller vor ihr. Sie durfte sich jetzt keinen Träumen hingeben, nein, sie mußte mit kühlem Kopf ihre Zukunft planen!
Vielleicht würde ihr ja der Verleger ihres Vaters eine Anzahlung auf das letzte Manuskript leisten, das ihr Vater ihm erst vor kurzem geschickt hatte. Unvorstellbar, was passiert wäre, hätte er es bei dem Überfall noch bei sich gehabt! Für die Banditen wäre es zwar nichts wert gewesen, aber sie hätten es dennoch mitgenommen, wie alles andere, die gesamte Ausrüstung, ihre Kleider, die Pferde und ihr letztes Kamel, das ganze hundert Pfund gekostet hatte.
Aber würde ein Vorschuß vom Verleger ihres Vaters für die Heimreise nach England reichen? Wohl kaum. Sie müßte also die Hilfe des britischen Konsulats in Anspruch nehmen. Doch da standen die Aussichten schlecht, wie Pater Ignatius ihr bereits erzählt hatte. Zur Zeit gab es derartig viele Engländer in Nordafrika, die ihr gesamtes Hab und Gut verloren hatten, sei es durch Raubüberfälle oder durch schieren Leichtsinn, daß sich das britische Konsulat außerstande sah, ihnen allen zu helfen. Nur noch in besonderen Ausnahmefällen finanzierten sie einem britischen Staatsangehörigen die Heimreise ins Mutterland.
Ihr Vater hatte ja als Wissenschaftler hohes Ansehen genossen, überlegte Atayla. Vielleicht würde man da bei ihr eine Ausnahme machen?
Doch im gleichen Moment verspürte sie eine tiefsitzende Abneigung dagegen, um Almosen zu betteln. Sie scheute davor zurück, irgendeinem eingebildeten Konsulatsbeamten Rede und Antwort stehen zu müssen, warum ihr Vater derart gefährliche Gebiete bereist hatte.
Ihr Vater war Völkerkundler gewesen, und seine Begeisterung und seine Opferbereitschaft für diesen Beruf konnte im Grunde nur verstehen, wer selber zu dieser Zunft gehörte. Gordon Lindsay hatte sein Leben der Erforschung der nordafrikanischen Stämme gewidmet. Besonders interessiert hatte ihn die Kultur der Berber. Vieles von ihrer Geschichte, ihrer Religion, ihren Sitten und Gebräuchen war noch gänzlich unbekannt, und so trieb jede seiner Veröffentlichungen die Wissenschaft einen bedeutenden Schritt voran.
Wenn Papas Buch herauskommt, dachte Atayla wehmütig, dann wird er womöglich endlich den Ruhm erlangen, der ihm zu Lebzeiten nicht vergönnt war.
Doch sogleich stellte sich der ernüchternde Gedanke ein, daß es wieder so sein würde wie bei seinen vielen anderen Beiträgen, die er im ›Royal Geographical Magazine‹ der ›Royal Geographical Society‹ veröffentlicht hatte: Nur eine verschwindende Zahl von Experten verstand es, den Wert seiner Forschungsergebnisse wirklich zu würdigen. Deshalb würde auch dieses Buch wohl wieder nur eine sehr kleine Auflage erreichen.
Ich muß mich also alleine durchbeißen, dachte Atayla und preßte die Lippen aufeinander. Aber was hatte sie schon an Fähigkeiten zu bieten, mit denen Geld zu verdienen war?
Sie könnte zwar fließend Arabisch sprechen und ebenso eine ganze Anzahl nordafrikanischer Dialekte, doch das war auf dem englischen Arbeitsmarkt nun wirklich nicht gefragt.
Doch auch Afrika war kein Land, in dem eine junge, unverheiratete Frau auf sich selbst gestellt leben konnte. Natürlich gab es die eine oder andere Anstalt für ledige Frauen – aber dort würde ihr sicher die gleiche Feindseligkeit entgegenschlagen wie hier in der katholischen Mission.
Atayla mußte wieder daran denken, was ihre Mutter ihr kurz vor ihrem Tode gesagt hatte: »Du wirst ein sehr hübsches Mädchen werden, mein Liebes«, hatte sie gemeint, »so, wie Papa und ich es uns immer erträumt haben. Aber leider wirst du auch erfahren müssen, daß eine schöne Frau auf dieser Welt einen hohen Preis für ihre Schönheit zahlen muß.«
Fragend hatte sie ihre Mama angeschaut, die mit einem milden Lächeln fortgefahren war: »Es wird viele Männer geben, die dich begehren und viele Frauen, die dich hassen. Ach, mein Kind, ich wünsche mir ja nur eines: daß du einen Mann findest, mit dem du genauso glücklich wirst wie ich mit deinem Vater!«
»Warst du denn wirklich glücklich, Mama?« hatte Atayla schüchtern gefragt. »Ohne ein Zuhause, immer auf Reisen, von einem Land in das nächste?«
Ein strahlendes Lächeln war über die Züge ihrer Mutter geglitten. »Ich war die glücklichste Frau der Welt! Was habe ich alles erlebt mit deinem Vater! Alles war so aufregend! Und wenn es manchmal ein bißchen unbequem war oder auch ein wenig gefährlich – wir haben immer nur darüber gelacht!«
Ja und nach ihrem Tode schien es, als wäre das Lachen aus dem Leben ihres Vaters entschwunden.
Atayla bemühte sich nach besten Kräften, den Platz ihrer Mutter einzunehmen. Sie kümmerte sich um ihren Papa, bekochte ihn und begleitete ihn auf all seinen Reisen. Diese führten manchmal durch unerforschte Gebiete große, weiße Flecken auf der Landkarte.
Mit der Zeit lernte auch er wieder zu lachen. Aber den eigentlichen Quell seiner Freude und seines Glücks hatte er in einem schmucklosen Grab zurücklassen müssen, in einem arabischen Dorf, das so winzig war, daß es nicht einmal einen Namen hatte.
Nur zwei- oder dreimal während ihrer Ehe waren die Eltern nach England zurückgekehrt, und bei einer dieser Gelegenheiten hatte sie, Atayla, das Licht der Welt erblickt.
Vor sechs Jahren waren sie zum Begräbnis ihres Großvaters mütterlicherseits nach England gereist. Sie war damals gerade erst zwölf und konnte sich daher nur noch vage an einzelne Gesichter erinnern, aber sie hatte deutlich gespürt, daß die Verwandtschaft insgeheim über das Leben, das ihre Eltern führten, die Nase rümpfte. So konnte sie sich ausrechnen, daß ihre Onkel und Tanten sie alles andere als mit offenen Armen aufnehmen würden, wenn sie eines Tages verwaist und mittellos, wie sie war, bei ihnen auftauchte.
Ihr Vater stammte aus Nordengland, nahe der schottischen Grenze. War es vielleicht ein Schuß schottisches Abenteurerblut, das ihn hinaus in die Welt getrieben, und sein englisches Erbe, das ihn zur Wissenschaft gezogen hatte?
Atayla versuchte, sich an die Verwandten ihres Vaters zu erinnern. Seine Eltern lebten schon lange nicht mehr, aber er hatte noch einen älteren Bruder, von dem sie allerdings seit Jahren nichts mehr gehört hatte.
Womöglich war auch er schon tot. Dann gab es noch eine verheiratete Schwester, aber deren neuer Nachname fiel ihr beim besten Willen nicht ein.
Es wird mir also nichts anderes übrigbleiben, seufzte Atayla, als nach Nordengland zu reisen und die beiden zu suchen.
Aber woher das Geld nehmen? Wirklich zu dumm, daß ihr Vater seine gesamten Konten bei der Bank von Tanger geräumt hatte, bevor sie zu ihrer letzten Expedition aufgebrochen waren!
Das meiste hatte er für die Träger und die Kamele ausgegeben, doch war genug übriggeblieben, um davon nach ihrer Rückkehr in Tanger einen Monat oder länger leben und sich von den Strapazen der Reise erholen zu können.
»Wir mieten uns einfach ein nettes Häuschen, draußen in der Vorstadt von Tanger«, hatte ihr Vater gesagt. »Und dann bekomme ich sicher noch eine kleine Überweisung von der ›Royal Geographical Society‹, die sich immer für Artikel über Afrika interessiert. Und dann, mein Kind, überlegen wir uns in aller Ruhe, was wir als nächstes unternehmen.«
Atayla hatte sich keine Sorgen gemacht. Sie war daran gewöhnt, wie ihre Mutter es genannt hatte, ›von der Hand in den Mund zu leben‹, und vertraute voll auf ihren Vater. »Irgendwas ergibt sich immer«, pflegte er in seinem unverwüstlichen Optimismus zu sagen, und so kam es denn auch wirklich jedes Mal.
Doch jetzt gab es ihren Vater nicht mehr. Zum ersten Mal in ihrem Leben hatte Atayla Angst vor der Zukunft.
Sie war so tief in Gedanken versunken, daß sie aufschreckte, als die Haustür ging. Pater Ignatius war zurückgekommen. Schnell sprang sie auf, stellte ihren leeren Teller in die Spüle – sie würde ihn später abwaschen – und eilte hinaus, um ihn zu begrüßen.
Der Missionar wirkte müde und abgespannt. Tiefe Schatten lagen unter seinen Augen, und er ging mit gebeugter Haltung, obwohl er erst knappe sechzig war. Atayla wußte, daß er die Mittagshitze nicht vertrug und deshalb stets in die Missionsstation heimkehrte, um in seinem kleinen Arbeitszimmer ein Nickerchen zu machen.
Ein gütiges Lächeln huschte über das Gesicht des Mannes, als er Atayla erblickte. »Ah, da bist du ja, mein Kind«, sagte er leise, während er den breitkrempigen schwarzen Hut ablegte. »Ich würde gerne einmal in Ruhe etwas mit dir besprechen.«
»Genau das ist auch mein Wunsch, Pater Ignatius«, erwiderte Atayla überrascht. »Hätten Sie denn jetzt einen Augenblick Zeit?«
»Aber sicher doch. Laß uns in mein Arbeitszimmer gehen, dort ist es kühler.«
»Soll ich Ihnen etwas zu trinken bringen?«
»Ja, gerne. Ein Glas Wasser würde mir guttun.«
Schnell lief sie in die Küche und ließ kaltes Wasser in ein Glas laufen. Aus dem ansonsten gähnend leeren Obstkorb nahm sie eine halb vertrocknete Zitrone und preßte die letzten Tropfen aus ihr heraus, um dem Wasser wenigstens einen Hauch von Geschmack zu geben.
Wenn ich ihm jetzt ein Glas Champagner vorsetzen würde, würde er es wahrscheinlich gar nicht merken, dachte sie schmunzelnd, als sie dem Pater das Glas reichte: Er saß in seinem Bambussessel und schien bereits wieder tief in seine Gedanken und Gebete versunken.
»Sie sind jetzt sicher sehr müde«, sagte Atayla mitfühlend. »Ich glaube, es ist besser, sie ruhen sich erst einmal ein wenig aus, und ich komme später wieder.«
»Ach, was! Wenn hier jemand Ruhe braucht, dann bist es doch eher du!« Besorgt schaute ihr der alte Mann in die Augen. »Wie geht es dir denn, mein Kind?«
»Besser«, antwortete Atayla. »Die Wunde an meiner Schulter ist inzwischen verheilt. Die Narbe sieht natürlich nicht sehr schön aus, aber das macht nichts.«
Atayla gab sich Mühe, ihrer Stimme einen hoffnungsfrohen Klang zu geben, um den Pater, der wirkte, als trüge er alles Elend dieser Welt auf seinen Schultern ein wenig aufzuheitern. Doch nicht einmal der Anflug eines Lächelns erhellte sein Gesicht. Mit gerunzelter Stirn starrte er vor sich hin.
Dann, als hätte er ihr gar nicht zugehört, sagte er plötzlich: »Atayla, ich hätte unter Umständen eine Aufgabe für dich...« Er zögerte ein wenig, bevor er fortfuhr. »Obwohl ich nicht weiß, ob ich es verantworten kann...«
Atayla horchte auf. »Wenn ich... wenn ich dabei ein wenig Geld verdienen könnte« meinte sie, »dann... dann käme mir das sehr entgegen, Pater Ignatius. Ich stehe ohne einen einzigen Penny da. Alles, was mein Vater besaß, haben die Räuber gestohlen. Ich kann von Glück reden, daß sein Manuskript schon auf dem Weg nach England war.«
»Ja, wir sollten Gott dafür danken, daß er es vor ihrem Zugriff gerettet hat«, pflichtete der Mönch ihr bei. »Und wir sollten ihm noch mehr dafür danken, daß er seine schützende Hand über dein junges Leben gehalten hat, denn das ist das kostbarste, was du auf dieser Welt besitzt, mein Kind.«
»Ja, Peter Ignatius«, erwiderte Atayla demütig. »Und dennoch«, wandte sie vorsichtig ein, »weiß ich nicht, wovon ich in Zukunft leben soll. Ich muß irgendwie Geld verdienen, um nach England zurückkehren und dort bei den Verwandten meines Vaters unterkommen zu können. Wenn die überhaupt noch am Leben sind«, fügte sie leise hinzu.
Schweigen breitete sich zwischen ihnen aus. Dann nahm der Geistliche das Gespräch wieder auf.
»Genau darüber wollte ich mit dir reden, Atayla.« Versonnen blickte er vor sich hin. »Ja, die Wege des Herrn sind unergründlich...«, murmelte er.
Gespannt wartete Atayla, daß er fortführe, doch der Pater ließ sich Zeit, und sie wagte es nicht, ihn zu drängen.
»Heute vormittag« sagte er schließlich, »hat mich ein Arzt an das Bett einer seiner Patientinnen geholt. Die Lady ist sehr krank.« Er sprach langsam und wählte jedes seiner Worte mit Bedacht.
»Sie lebt in einer dieser großen Prachtvillen, von denen aus man die ganze Bucht überschaut. Die Lady bat mich, eine Engländerin ausfindig zu machen, die ihre kleine Tochter nach England bringen könnte.«
Atayla traute ihren Ohren nicht. Atemlos beugte sie sich in ihrem Bambussessel vor, damit ihr keines der Worte entginge. Hatte sie richtig gehört? Gab es da einen schwachen Lichtschimmer am Ende des dunklen Tunnels?
»Die Lady bestand darauf, daß die Begleitperson ihrer Tochter eine Engländerin sein sollte. Natürlich habe ich sofort an dich gedacht, mein Kind. Auf diese Weise kämst du in deine Heimat zurück ohne daß es dich einen einzigen Penny kosten würde.«
Atayla sog hörbar den Atem ein. »Pater Ignatius, das ... das ist doch ... ein Wink des Schicksals ... ein Wink des Himmels!« verbesserte sie sich schnell.
Der Pater schwieg.
»Was ... was gefällt Ihnen denn daran nicht?« Atayla hielt es kaum noch auf ihrem Sessel. »Etwas Besseres kann mir doch gar nicht passieren!«
Der Mönch rang sichtbar nach Worten. »Die Lady nennt sich ›Comtesse de Soissons‹«, sagte er nach einer Weile, »doch sie war mir gegenüber so ehrlich zuzugeben, was ich schon längst wußte: daß sie mit dem Comte, mit dem sie zusammenlebt, nicht verheiratet ist.«
Es war Atayla nicht unbekannt, daß viele Menschen in Tanger, vor allem Ausländer, ein Leben führten, das mit den überkommenen gesellschaftlichen und moralischen Vorstellungen nicht in Einklang stand.
Nach einem Moment betroffenen Schweigens fragte sie scheu: »Ist die Tochter dieser Lady Engländerin oder Französin?«
»Engländerin.«
»Aber dann wird es mir doch ein Vergnügen sein, die Kleine nach England zu bringen!« rief Atayla begeistert.
Pater Ignatius seufzte. »Ich wußte, daß du so reagieren würdest.« Seine Stirn umwölkte sich. »Aber ich kann es einfach nicht zulassen, daß du in den verderblichen Einfluß dieser... dieser Frau gerätst, die in den Augen Gottes und der Heiligen Kirche im Stande der Sünde lebt!«
»Ist die Lady Katholikin?« fragte Atayla.
Grimmig schüttelte der Mönch den Kopf. »Nein, aber der Comte ist Katholik. Er hat Frau und Kind in Frankreich zurückgelassen!« Atayla konnte dem Pater ansehen, wie abgrundtief er das Verhalten dieses Mannes verabscheute. Doch sie selbst kümmerte das, wenn sie ehrlich war, herzlich wenig. Für sie war diese Lady, die ihr die Tochter anvertrauen wollte, ein Geschenk des Himmels!
Mit flehentlichem Blick beugte sie sich zu Pater Ignatius vor: »Pater, ich bitte Sie! Das ist eine einmalige Gelegenheit für mich! Ansonsten müßte ich mir hier in Tanger eine Arbeit suchen, was schon schwer genug wäre. Aber selbst wenn ich eine fände, könnte es mich Monate kosten, bis ich genug Geld für die Heimreise nach England zusammen hätte! Und wo sollte ich die ganze Zeit über wohnen?«
Der Geistliche öffnete den Mund, um ihr zu versichern, daß sie unter seinem Dach so lange bleiben könnte, wie sie wollte – doch dann schloß er wieder die Lippen. Nicht, daß Atayla ihm nicht jederzeit willkommen gewesen wäre. Aber Mrs. Mansur würde dabei nicht mitspielen, das wußte er genauso wie Atayla.
Die tiefe Abneigung, ja, offene Feindseligkeit, die seine Haushälterin dem Mädchen entgegenbrachte, war ihm nicht entgangen, auch wenn er es bisher diplomatisch vermieden hatte, den Konflikt offen anzusprechen.
Ihre Eifersucht, ihr Haß, ihre Mißgunst ließen sich geradezu körperlich spüren, wenn er sich mit beiden Frauen in einem Raum befand, und jedes Wort, das Mrs. Mansur an Atayla richtete, klang wie eine offene Kriegserklärung.
»Bitte, Pater Ignatius«, flüsterte Atayla. »Erlauben Sie mir, zu der Lady zu gehen und ihr zu sagen, daß ich gerne bereit bin, ihre kleine Tochter nach England zu bringen! Bitte!«
Die Lippen des Priesters verhärteten sich. »Ich habe gebetet, Atayla«, murmelte er. »Den ganzen Heimweg lang habe ich Gott angerufen und ihn gefragt, was ich tun soll. Du bist einfach noch zu jung, um mit so einer verderbten Person in Berührung zu kommen, ohne dabei Schaden an deiner Seele zu nehmen!«
»Ich verspreche Ihnen, Pater«, beteuerte Atayla »ich verspreche Ihnen hoch und heilig, daß diese... diese ›verderbte Person‹, wie Sie sie nennen, mir nichts anhaben wird! Es geht mir doch nur um das Kind! Sobald die Kleine und ich Tanger verlassen haben, werden sie und ich all dem schlechten Einfluß entzogen sein, den ihre Mutter je auf sie ausgeübt haben mag!«
Mit Erleichterung nahm Atayla wahr, daß sich bei ihren Worten das Gesicht des Paters ein wenig aufhellte. Doch noch schienen seine Bedenken nicht restlos ausgeräumt.
»Jetzt, wo der Herr deine beiden Eltern zu sich genommen hat«, wandte er ein, »habe ich das Gefühl, daß die Verantwortung für dein junges Leben auf meinen Schultern ruht.« Er seufzte. »Und dennoch weiß ich, daß wir Menschen nichts ausrichten können, und daß unser aller Wohl in der Hand einer Macht liegt, die alle menschliche Macht überragt.«
Ehrfürchtig schlug Atayla die Augen zu Boden. »Ja, das ist wahr«, flüsterte sie. »Und außerdem, Pater, bin ich vielleicht doch den Gefährdungen des Lebens nicht ganz so hilflos ausgeliefert, wie Sie meinen. Auf den vielen Reisen mit meinem Vater, auf denen wir viele fremde Menschen mit fremden Sitten und Gebräuchen kennengelernt haben, habe ich sicher mehr Reife und Lebenserfahrung gewonnen, als wenn ich behütet im Schoße der Familie in England aufgewachsen wäre.«
Zum ersten Mal glitt ein Lächeln über die Züge des alten Mannes.
»Ja, da mag etwas dran sein«, antwortete er schmunzelnd. »So mancher brave Engländer wäre wohl völlig schockiert, wenn er erführe, was diese Heidenkinder so alles treiben...«
»Eben, Pater Ignatius«, beeilte sich Atayla zu erwidern. »Und deshalb brauchen Sie sich keine Sorgen um mich zu machen. Vielleicht ist es ja auch Gottes Wille, mich auf diesen Weg zu schicken. Und ich bin sicher, daß es sich bei den Verwandten dieses Kindes um tugendhafte und gottesfürchtige Menschen handelt!« Der Pater seufzte. Er sah die Begeisterung und das Flehen in Ataylas Augen, und so gab er demütig ihr Schicksal in Gottes Hand.
»Geh und leg dich ein bißchen hin, mein Kind«, sagte er leise. »Nachher, wenn es kühler ist, gehen wir beide zu der Lady. Es ist ein längerer Fußmarsch, und du darfst dich nicht überanstrengen. Ruh dich also vorher noch ein wenig aus.«
Ataylas Augen leuchteten auf. Sie wußte – sie hatte gewonnen!
»Danke, Pater!« jubelte sie. »Danke, tausend Dank! Ich schwöre Ihnen, daß ich Ihr Vertrauen in mich nicht enttäuschen werde! Ich bin so glücklich. Ach, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll!« Der Pater antwortete nicht und saß bewegungslos und mit geschlossenen Augen da. Atayla wußte: Er betete zu Gott, daß er die richtige Entscheidung getroffen hatte.
Leise schloß sie die Tür hinter sich, als sie den Raum verließ.
In ihrem Schlafzimmer, das um diese Tageszeit heiß und stickig war, warf sie sich mit einem erleichterten Seufzer aufs Bett. Ein glückliches Lächeln lag auf ihrem Gesicht. Wieder einmal ›hatte sich was ergeben‹ wie ihr Vater zu sagen pflegte.
Natürlich lagen wohl noch viele Schwierigkeiten vor ihr, aber der erste Schritt war getan!
Sie hoffte nur, daß die Angehörigen des kleinen Mädchens ebenfalls in Nordengland lebten, dann würde ihr Weg bis nach Baronswell zur eigenen Familie nicht so weit sein.
Ihr Vater hatte ihr nie viel aus seiner Kindheit und Jugend erzählt, denn auf all ihren gemeinsamen Reisen in Afrika hatte er immer nur seine Forschungsarbeit im Kopf gehabt. So war es ihre Mutter gewesen, die ihr das prachtvolle Herrenhaus beschrieben hatte, wohin der Vater sie nach ihrer Verlobung geführt hatte, um sie seinen Eltern vorzustellen.
»Es hat mir vor Ehrfurcht glatt die Sprache verschlagen!« hatte sie berichtet. »Papas Bruder fiel aus allen Wolken, als man ihm seine zukünftige Schwägerin vorführte. Dann tobte er wie ein Wilder los. Er beschimpfte Papa als armen Schlucker und meinte, daß er es sich doch gar nicht leisten könne, eine Familie zu gründen!«
Ataylas Mutter lachte. »Mein Vater hat ebenfalls die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als er Papa kennenlernte«, fuhr sie kichernd fort. »Er war schließlich Baron und äußerst stolz auf seinen Familienstammbaum. Schlimm genug, daß ich schon kein Junge war, naja, dafür war ich wenigstens sehr hübsch. Also hat er erwartet, daß ich eine entsprechende Partie machen würde. Aber nein! Sucht sich sein einziges Kind ausgerechnet so einen brotlosen Abenteurer aus!«
»Mochte er Papa nicht?« fragte Atayla.
»Doch, natürlich. Wer konnte schon Papas Charme widerstehen? Aber er hatte eben kein Geld und wollte unbedingt nach Afrika, und ich war wild entschlossen, ihn dorthin zu begleiten.«
»Und hast du es jemals bereut?«
»Bereut? Niemals! Keine Sekunde, die ich mit deinem Vater verbracht habe, habe ich je bereut! Inzwischen interessiert mich das Leben und die Kultur dieser Stämme genauso brennend wie Papa! Unglaublich, wie zum Beispiel die Berber ihr Volkstum über zweitausend Jahre lang bewahrt haben, trotz der Wellen von Eroberern, die über sie hinweggeschwappt sind – die Phönizier, die Römer, die Vandalen, die Araber!«
Atayla erinnerte sich noch gut, wie sie mit ihren Eltern ihre erste Reise in das Rif-Gebirge unternommen hatte, wo ein besonderer Berberstamm, die Rifkabylen, lebte. Wie aufregend hatte sie alles gefunden!
Mit den Jahren hatte sie immer mehr über die afrikanischen Stämme erfahren. Staunend hatte sie ihren Eltern zugehört, die ihr erzählten, wie die Araber vom Osten Nordafrikas nach Westen zogen – in einer Hand das Schwert, in der anderen den Koran. Sie las über die Mauren, deren Vorfahren Spanien erobert hatten, um den islamischen Glauben zu verbreiten. Und Ataylas Vater weihte sie in die Grundsätze des Koran ein, die dem gläubigen Moslem sagten, was gut und was böse sei.