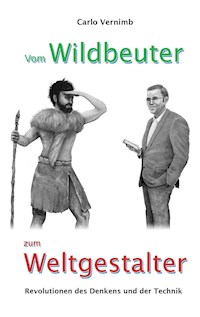Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Wir leben in einer Zeit des Umbruchs, gekennzeichnet durch Globalisierung, Klimawandel und Digitalisierung. Die 10 Gebote mögen zweieinhalb Jahrtausende lang ein nützlicher Leitfaden gewesen sein. Heute reichen sie nicht mehr aus. Unsere Vorfahren fingen irgendwann an, an Waldgeister, Kobolde und Feen zu glauben, später an Götter und viele schließlich an einen Gott. Den brauchen wir nicht mehr. Religionen sind Stufen in der Menschheitsgeschichte. Was wir brauchen, sind Regeln für das Zusammenleben. Wir brauchen einen Allgemeinen Menschenkodex, den die Menschen aller Völker der Erde akzeptieren können und sie vereint in der Erhaltung unseres Planeten und der Bewahrung des Weltfriedens. Ein solcher Kodex wird vorgeschlagen: 1. Mach etwas aus deinem Leben, gib ihm einen Sinn! 2. Achte alle Menschen und behandle sie so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest, und respektiere die Würde des Menschen und die daraus resultierenden Allgemeinen Menschenrechte! 3. Erhalte unseren Planeten! 4. Bemühe dich, am Frieden in der Welt mitzuarbeiten!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Meine Töchter Jacqueline und Nicole
Carlo (amtlich Carl-Otto) Vernimb wurde am 3. April 1928 in Hamburg geboren, studierte Physik in Hamburg und Innsbruck, war nach der Promotion 4 Jahre lang angestellt bei der ESSO AG in Hamburg und danach 25 Jahre leitender Beamter der Kommission der Europäischen Union in Brüssel und Luxemburg. Nach der Pensionierung gründete und leitete er 10 Jahre lang eine Beratungsfirma. Im Lauf seines Berufslebens verfasste er 72 wissenschaftlich-technische Veröffentlichungen.
Carlo Vernimb war 59 Jahre lang verheiratet und hat zwei Töchter.
Carlo Vernimb 2011
Inhalt
Vorwort
Einleitung und Zusammenfassung
Gläubige Jugend
Erste Zweifel
Kirchenaustritt
Suche nach Gott
Lösung von Gott
Wie kam der Mensch auf Gott?
Moral
Die Schöpfung der Welt
Gottesbeweise
Klarheit
Agnostiker
Hybris
Klerikale Anmaßungen
Evolution
Naturwissenschaften
Ungelöste kosmologische Probleme
Von der Freiheit eines Atheisten-Menschen
Mein weiteres Leben
Wirkung von Religionen
Erbsünde
Vertuschungen
Missbrauch
Islam
Würde
Angst
„Einsprüche“
Mein Atheismus auf YouTube
Ich habe einen Traum
Beten
Herausforderungen
Fazite
Nachwort
Literatur-Nachweise
Vorwort
Es ist ein wunderbares Abenteuer, den Sinn seines Lebens zu suchen.
Umfragen [1] zufolge gab es in Deutschland im Jahr 2017 41% – 49% Atheisten, Agnostiker und Gottlose. Es gibt aber auch viele Menschen, die einen Halt in der Religion finden. Das respektiere ich. Ich erwarte allerdings, dass die Gläubigen meine Gottlosigkeit auch respektieren. Ich verurteile die Religionen nicht, sondern begreife sie als Stufen in der Entwicklung der Menschheit. Bevor der Homo Sapiens an einen Gott glaubte, glaubte er an viele Götter, davor an Geister, Dämonen, Kobolde und Feen. Was er davor glaubte, wissen wir nicht. Vielleicht hatte er nur Gefühle, z. B. Angst und Glück.
Ich akzeptiere, dass Gott in den Köpfen sehr vieler Menschen existiert, halte ihn aber für entbehrlich. Die 10 Gebote waren weit über zweitausend Jahre lang eine brauchbare Richtschnur. Heute reichen sie nicht mehr aus. Wir brauchen einen neuen Allgemeinen Menschenkodex.
Dieses Buch ist für Fanatiker des religiösen Glaubens nicht geeignet.
Einleitung und Zusammenfassung
Ich berichte von der Entwicklung meiner Denkweise und meines Charakters, die beide zum Austritt aus der evangelischen Kirche und danach zur Loslösung von Gott beigetragen haben. Diese spirituelle Befreiung erzeugte in mir ein Gefühl der Verantwortung. Ich beschreibe, wie die Menschen auf Gott kamen und wie sich im Lauf der Evolution ihre Moral entwickelt hat. Ich stelle eine globale Ethik vor, gehe auf den Urknall ein, auf sogenannte Gottesbeweise, auf ein ästhetisches Argument gegen Gott, auf Agnostiker, auf die Überheblichkeit der Menschen, auf die Evolution, auf bisher ungelöste kosmologische Probleme, auf mein weiteres Leben, auf die Wirkung von Religionen, auf die Erbsünde, auf klerikale Vertuschungen, auf den Islam, auf Ängste, auf das Beten und die Würde des Menschen. Ich berichte, wie ich meine Auffassungen in Leserbriefen an DIE ZEIT und in YouTube-Videos zum Thema Gedanken eines Atheisten öffentlich gemacht habe. Unter der Überschrift Von der Freiheit eines Atheisten-Menschen berichte ich, dass mir immer klarer wurde, dass zur Freiheit von immer auch eine Freiheit für gehört, und dass ich als Dank für das mir selbst gemachte Geschenk der Freiheit etwas zurückgeben wollte: Mitzuhelfen die Welt zu verbessern, Gutes zu tun und anderen das Geschenk der Freiheit zu empfehlen. Unter der Überschrift Ich habe einen Traum schlage ich, fußend auf meinen Anregungen zu einer globalen Ethik, einen Allgemeinen Menschenkodex, einen kategorischen Imperativ, vor:
Mach etwas aus deinem Leben, gib ihm einen Sinn!
Achte alle Menschen und behandle sie so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest, und respektiere die Würde des Menschen und die daraus resultierenden Allgemeinen Menschenrechte!
Bemühe dich, unseren Planeten zu erhalten!
Bemühe dich, am Frieden in der Welt mitzuarbeiten!
Schließlich schlage ich Verbesserungen der Welt vor.
Gläubige Jugend
Wer dieses Buch liest, wird wahrscheinlich wissen wollen, wie ich zu meinen gottlosen Ansichten gelangt bin. Ich werde deshalb ein wenig aus meinem Leben berichten und auch ein paar Ereignisse erwähnen, die nicht unmittelbar mit dem Glauben zu tun haben, aber mich und meine Denkweise und meinen Charakter geprägt und letztlich zu meinen Ansichten und Anregungen geführt haben.
Wen mein Werdegang nicht interessiert, sollte mit dem Kapitel „Wie kam der Mensch auf Gott?“ (Seite →) fortfahren.
Am 3. April 1928 wurde ich im Graumannsweg in Hamburg im Haus meiner Eltern geboren. Mein Vater war Konditormeister und Mitinhaber einer Konditorei mit Café in Hamburg. Als er die Nachricht von meiner Geburt erhielt, sprang er vor Freude über den Tresen, über den die Kellner Kuchen und Kaffee in Empfang nahmen. Am 18. November 1928 wurde ich in der St. Gertrudkirche evangelisch getauft.
Meine Eltern waren evangelisch, allerdings nicht strenggläubig. Mein Vater hielt es mit dem Alten Fritz: Jeder soll nach seiner eigenen Fasson selig werden. Meine Mutter lehrte mich immerhin das Beten. Jeden Abend vor dem Einschlafen betete ich „Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komm! Amen.“ Und unser Vater sprach mittags ein Tischgebet: „Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was Du uns bescheret hast!“
In meiner Jugend kam es mehrere Male vor, dass ich vor Lachen fast platzen musste, weil mir schien, dass irgendeine Respektsperson, ein Lehrer, ein Onkel, etwas furchtbar Dummes gesagt hatte. Ich wusste, dass man nicht respektlos lachen durfte. Ich sagte mir dann blitzschnell im Kopf mein Gebet auf: „Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komm! Amen.“ Wenn das nicht sofort wirkte, schickte ich das gleiche Gebet hinterher. Es half immer; so tief war die Ernsthaftigkeit des Gebets in meinem Kopf verwurzelt.
Als ich vier oder fünf Jahre alt und allein im Haus war, bekam ich einmal einen Heißhunger auf Zucker. Ich wusste genau, dass man nicht stehlen darf, aber ich wusste auch, wo der Zucker war. So nahm ich einen Stuhl, schob ihn vor den Küchenschrank, kletterte hinauf, öffnete den Schrank, nahm mir ein Stück Würfelzucker aus der Zuckerdose und ließ es auf der Zunge zergehen. Danach bekam ich ein furchtbar schlechtes Gewissen. Als meine Mutter abends nach Hause kam, gestand ich ihr unter Tränen meine Missetat. Sie nahm mich in den Arm und tröstete mich. Zwei Dinge habe ich daraus gelernt: Das schlechte Gewissen war so entsetzlich, dass ich nie wieder dieses Gefühl haben wollte. Und zweitens: Alles wird wieder gut. Dieses „Alles wird gut“ hat sich mir tief eingegraben und wirkt noch heute, dank der Liebe meiner Mutter.
Als ich im Alter von sechs Jahren in die Grundschule kam, waren dort Jungs und Mädchen. Meine Schreibschrift geriet mir nicht besonders gut, aber sonst war ich kein schlechter Schüler.
Wenn das Wetter es zuließ, spielten meine ältere Schwester Eva, mein jüngerer Bruder Kurt und ich in unserem Garten. Im Nachbarhaus wohnte eine Arztfamilie. Irgendwann waren wir wohl mal sehr laut im Garten. Unsere Mutter rief mich zu sich und sagte, der Nachbar hätte angerufen und gebeten, ihr möchtet bitte nicht so laut sein. Dass wir ein Telefon hatten, war mir bis dahin nicht aufgefallen. Ich wunderte mich, warum der Nachbar nicht einfach über den Zaun gerufen hatte. Telefonieren kostet doch bestimmt etwas. Und gibt es da einen Draht zwischen den Telefonapparaten in beiden Häusern? Nein, lernte ich, beide Apparate sind mit Kabeln mit einer Zentrale irgendwo in Hamburg verbunden, und über diese Zentrale läuft das Gespräch. Darüber habe ich lange nachgedacht.
Wenn wir nicht in den Garten konnten, spielten wir oft Höhle. Dazu zogen wir den Tisch in unserem Schlafzimmer aus und deckten die Seiten mit Wolldecken ab, die wir auf dem Tisch mit Büchern beschwerten, so dass sie nicht runterrutschten. Auch Eva war gern in der Höhle. Es war einfach ein gutes Gefühl, da so im Dunkeln und geschützt zu sein. Heute vermute ich, dass dieses Gefühl etwas mit unseren Höhlen bewohnenden Vorfahren zu tun hat.
Oft spielten wir auch mit dem „Stabilbaukasten“. Der enthielt lange, flache schwarze Stangen mit vielen Löchern; auch abgewinkelte, auch kürzere Stangen und Winkel und viele kurze Schrauben, die durch die Löcher passten, und zu den Schrauben passende Muttern, sowie Räder. Daraus konnte man alle möglichen Sachen bauen, z.B. einen Kran, der sich auf einer Plattform drehen ließ. Mit einem Bindfaden, der oben über eine Rolle lief, und unten mit einer Kurbel aufgewickelt wurde, konnte man Lasten hochziehen. Das war die Zeit, als ich Ingenieur werden wollte.
Aber ich habe auch viel gelesen. Karl May hat mich begeistert und die Zukunftsromane von Hans Dominik.
Einmal tobten wir abends in den Betten. Eva kam aus ihrem Zimmer dazu und machte mit. Unsere Mutter sagte: „Wollt ihr wohl Ruhe geben und endlich schlafen!“ Und als das nichts nützte, rief sie unseren Vater: „Carl, bring die Kinder mal zur Räson!“ Nach kurzer Zeit kam mein Vater aus dem Elternschlafzimmer mit grimmigem Gesicht und der Doppelflinte in der Hand, die er aus dem Gewehrschrank genommen hatte. Ich weiß nicht, wer von uns zuerst gelacht hat; wir konnten uns gar nicht mehr halten. Unsere Mutter was not amused: „Aber Carl, doch nicht so!“ Immerhin waren wir vom Toben und Lachen so erschöpft, dass wir bald einschliefen. Mein Vater war Jäger und hatte mehrere Jagdgewehre: Die Doppelflinte für Schrot, einen Drillich (zwei Läufe für Schrot und ein Lauf für Gewehrpatronen) und ein Kleinkalibergewehr; außerdem eine Pistole; alles eingeschlossen in einem Gewehrschrank neben seinem Bett. Aber er ging in meiner Erinnerung nur sehr selten zur Jagd, und wenn, dann mit Freunden, die eine Jagd hatten, also ein Gebiet, für das sie eine Genehmigung zum Jagen hatten. Immerhin hingen im Treppenhaus zwei ausgestopfte Raubvögel an der Wand, ein Bussard, geschossen von meinem Vater, und ein Sperber, geschossen von meiner Mutter.
An Sonn- und Feiertagen kochte meine Mutter. Die Vorbereitung des immer guten Essens zog sich manchmal etwas hin, und wir saßen schon am Tisch und redeten, meist Eva mit Vati, und oft auch ziemlich streitlustig; wir hatten ja alle einen leeren Magen. Einmal, an einem Karfreitag, hatte meine Mutter die Suppe schon aufgefüllt, und die beiden stritten immer noch. Um dem ein Ende zu setzen, sagte sie statt „Guten Appetit!“ „Fröhlichen Karfreitag!“ Alle stockten einen Moment und brachen dann in schallendes Gelächter aus. Am ernstesten Tag der Christenheit sollten wir fröhlich sein. Das hatte keiner erwartet. Das wurde zum geflügelten Wort der Familie. Wenn wir später karfreitags noch so weit voneinander entfernt waren, wünschten wir uns gegenseitig telefonisch einen „Fröhlichen Karfreitag!“
Mein Vater brachte mir das Schachspielen bei, spielte auch mit mir und schlug mich natürlich. Aber ich wurde besser dabei und bald gewann nur noch ich. Da suchte mein Vater nach anderen Kontrahenten und fand Onkel Oschi, den Bruder meiner Mutter. Wir spielten nur einmal. Als ich deutlich im Vorteil war, sagte er: „Das ist Remis.“ Ich sagte: „Das ist kein Remis; Du bist gleich matt.“ „Nein, das ist Remis“, sagte er und ging aus dem Zimmer. Mein Vater, der im Hintergrund in einer Zeitung las, sagte nichts. Da habe ich gelernt, wie schwer es manchen Menschen fällt zu verlieren.
Eines Tages klingelte ein Jungzugführer. Der wollte mich als Pimpf werben. Ich wollte das erst mit meinen Eltern besprechen. Wir hatten bis dahin mit Nazis nichts zu tun. Allerdings, einmal kam einer, der sagte wir sollten in der nächsten Woche an einem bestimmten Tag eine Hakenkreuzfahne vom Balkon herunterhängen lassen; der Führer käme nach Hamburg (das muss 1934 gewesen sein) und würde zufällig auch durch den Graumannsweg fahren. Na, wir taten das, hörten an dem Tag Polizeisirenen, stürzten auf den Balkon und sahen Motorräder mit Blaulicht und einen schwarzen Mercedes vorbeiflitzen. Das war schon alles. Erkennen konnten wir sonst nichts. Meine Eltern sagten, ich könne vielleicht bei den Pimpfen etwas lernen. Ich lernte Geländekarten zu lesen und nach dem Kompass auszurichten, die Himmelsrichtungen nach dem Stand der Sonne zu bestimmen, dass in unseren Breiten die Bäume auf der Westseite bemoost sind, dass man Meldungen mit Bleistift auf Papier schreibt, weil Tinte oder Tintenstift im Regen auslaufen könnte usw. Wir machten auch Übungen im Gelände. Beim Marschieren mussten wir singen: „drei, vier, schwarzbraun ist die Haselnuss“. Irgendwann wurde ich Jungschafts-Führer. Da trug man eine rotweiße Kordel von der Braunhemdtasche bis zur Knopfleiste. Da musste ich 12 oder 15 Jungen antreten und abzählen lassen und schimpfen, wenn nicht alle gekommen waren. Aber die, die da waren, waren ja da. Und die, die nicht da waren, hörten das Schimpfen nicht. Und nun musste ich die Neuen in Kartenkunde usw. unterrichten.
Mit meinem Zugführer Hans unterhielt ich mich einmal über Musik. Er meinte, die 5. und 6. Sinfonie von Tschaikowsky würden mich sicher sehr beeindrucken. Er hatte Recht. Ich mochte Wagner. Aber es zog mich noch mehr zu Beethoven und Tschaikowsky. In der Musikhalle am Karl-Muckplatz, heute Ernst Laeiszhalle am Johannes Brahmsplatz, gab es sonntags um 15:00 Uhr ein Vorkonzert mit dem Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks unter der Leitung von Hans Schmitt-Isserstedt. Diese Konzerte wurden auf Magnetband aufgenommen und am Montag um 20:15 vom NDR im Radio ausgestrahlt. Fernsehen gab es noch nicht. Einmal, die ersten Takte waren gerade gespielt, fiel eine Garderobenmarke vom 2. Rang, klack, klack, klack bis ins Parkett. Schmitt-Isserstedt klopfte mit seinem Stab auf das Pult, die Musiker setzten ihre Instrumente wieder ab, er drehte sich ganz langsam um, schickte einen strafenden Blick nach oben, drehte sich wieder um und begann von neuem. Ich habe dort über Jahre die Sinfonien und Konzerte von Beethoven, Brahms, Bruch, Mozart, Haydn und Tschaikowsky gehört. Am liebsten denke ich an die 5. Sinfonie von Tschaikowsky. Im 4. Satz gibt es eine Pause zwischen dem Allegro vivace und dem Andante maestoso. Schmidt-Isserstedt macht die Pause etwas länger als andere Dirigenten, die anscheinend (und manchmal tatsächlich zu recht) befürchteten, dass das Publikum zu klatschen anfängt, wodurch die Stimmung futsch wäre. Für mich ist es die schönste Pause der Welt. Nach den furiosen Schlussakkorden des Allegro vivace denkt man, es könne keine Steigerung mehr geben. Und dann – setzt das Andante maestoso mit wuchtigen, überwältigenden Schlägen ein.
Mit elf oder zwölf Jahren bekam ich einen Chemie-Baukasten geschenkt. Das war der Beginn einer leidenschaftlichen Beschäftigung mit der (anorganischen) Chemie. Ich führte nicht nur alle im Begleitbuch angegebenen Experimente aus, meist zusammen mit meinem Bruder und meinem Schulfreund Dieter, sondern durfte mir in unserer Waschküche auch ein eigenes Labor einrichten. Wir stellten dort Sauerstoff, Wasserstoff und viele weitere Chemikalien her, wobei wir für das Mischungsverhältnis der Ausgangssubstanzen die im Periodischen System der Elemente angegebenen Massezahlen berücksichtigten. Ganz nebenbei lernten wir den Umgang mit chemischen Formeln und Reaktionsgleichungen. Schließlich hatten wir weit über 100 Präparate, und ich machte es mir zur Aufgabe, daraus jede mir gereichte Probe zu bestimmen, angefangen mit flüssig oder fest, Farbe, bei festen Substanzen kristallin oder amorph, löslich in Wasser oder nicht usw. bis hin zu chemischen Reaktionen. Das war die Zeit, als ich Chemiker werden wollte.
Einmal fuhren wir zum Vetter meines Vaters, Onkel Max, ein Maschinenbau-Diplom-Ingenieur, der in Kiel-Hassee eine Fabrik für Autoersatzteile hatte. Er war älter als unser Vater und kehrte gern einmal den „Großen Max“ heraus, vielleicht auch, weil unser Vater nur die Volksschule besucht hatte. Immerhin war Onkel Max der bisher einzige Akademiker unter den Vernimbs, die ich später in Deutschland aufspüren konnte.
Zu der Zeit bauten wir uns auch ein Radio. Dazu brauchten wir eine Batterie, einen Kopfhörer, einen Kupferdraht als Antenne, eine aus Draht gewickelte Spule, einen Drehkondensator und einen „Fritter“. Der Fritter bestand aus einem Glasrohr, das mit Metallspänen gefüllt war. An beiden Enden führten Drahtspitzen ins Rohr. Die Teile wurden anhand eines Schaltplans mit Kabeln verbunden. Es hat, nach einigem Probieren, tatsächlich funktioniert! Später haben wir noch manch andere Geräte zusammengelötet.
Ich war häufiger mal in der Konditorei und konnte auch die Backstube besichtigen und mir von den Konditoren erklären lassen, was sie gerade machten. Darunter gab es Spezialisten und richtige Künstler, z.B. einen Zuckerbläser, der aus verschieden gefärbtem Zucker Figuren schuf, die dann Torten zierten, die zu Geschäftsjubiläen oder anderen Anlässen bestellt worden waren. Mein Vater konnte besonders gut Baumkuchen backen. Das ist hohe Kunst. Eine Walze, die mit Pergamentpapier bedeckt war, wurde gedreht. Hinter der Walze befanden sich sehr viele kleine Gasflammen. Der Kuchenteich wurde mit einer Kelle auf die Walze getröpfelt bis gegossen, und durch die Hitze wurden Schichten auf der Walze gebacken. Es kam sehr auf die Abstimmung der Drehgeschwindigkeit mit der Zufuhr von Teig und der Stärke der Gasflammen an. Der erkaltete Baumkuchen wurde dann noch mit Zuckerguss oder flüssiger Schokolade bedeckt. Wenn man ihn in Scheiben schnitt, sah man die Ringe wie bei einem Baum. Einmal roch ich an dem Baumkuchen, bevor er mit Zuckerguss oder Schokolade bedeckt war, und sagte, das riecht ja nach Schwefel. Die Konditoren, die hinzugezogen wurden, sagten alle: nein, das riecht nicht nach Schwefel. Ich sagte: doch, es riecht nach Schwefelwasserstoff, allerdings nur sehr schwach. Ich weiß nicht, ob mein Vater der Sache nachgegangen ist. Ich meine zu erinnern, dass er viel später sagte: Du hattest Recht, im Stadtgas, das damals für die Gasflammen verwendet wurde, ist Schwefel enthalten. Übrigens wurde später irgendwann auf das energiereichere Erdgas umgestellt. Aus dem hatte man dann den Schwefel besser herausgeholt. Als ich viel später bei der ESSO gearbeitet habe, habe ich auch die Raffinerie besichtigt, in der Erdöl verarbeitet wurde. Da gab es riesige gelbe Berge von Schwefel, den man aus dem Erdöl herausgeholt hatte.
Der Krieg machte sich inzwischen bemerkbar. Häufig gab es Luftangriffe. Dann heulten die Sirenen und wir mussten in den Luftschutzkeller.
Von der Schule gab es nicht viel zu berichten. Einmal hielt unser Biologielehrer eine Pflanze hoch und fragte einen aus der Klasse, zu welcher Familie die Pflanze gehöre. Ich wusste die Antwort: Hahnenfußgewächse. Ich saß in der ersten Reihe und machte mit meiner rechten Hand die Fußbewegung eines schreitenden Hahns. Dabei liegt die Hand zunächst gespreizt auf dem Tisch; beim Hochheben werden dann Finger und Daumen eng zusammengelegt und beim Hinunterlassen wieder gespreizt usw. Noch bevor der befragte Mitschüler antworten konnte, sagte Trumpf: „Was soll das denn, Vernimb; das kommt wohl von der Schlagsahne!“ Wie er in diesem Zusammenhang auf den Beruf meines Vaters kommen konnte, ist mir bis heute ein Rätsel.
Einmal nahm er zwei mit Blumenerde gefüllte Töpfe und drückte in jeden einen Pflanzensamen. Einen Topf stellte er auf die Fensterbank, den anderen in einen lichtundurchlässigen Schrank. Nach zwei Wochen stellte er beide nebeneinander auf einen Tisch. Die Pflanze vom Fenster hatte grüne Blätter, die andere weiß-gelbliche Stängel. „Welche Pflanze ist größer?“, fragte Trumpf. Die Stängel schienen die grünen Blätter ein wenig zu überragen. Aber das konnte eigentlich doch gar nicht sein. „Die mit den grünen Blättern“, sagte einer etwas zögerlich. Trumpf fragte weiter. „Grün“, sagten alle, wenn auch ohne große Überzeugung. Ohne ein weiteres Wort stellte Trumpf die Töpfe an ihre ursprünglichen Plätze zurück und holte sie nach einer Woche wieder hervor. Nun war unverkennbar, dass das gelbliche Gestrüpp die grünen Blätter überragte. „Die Pflanze im Dunkeln will ans Licht und verwendet dafür all ihre Kraft“, war seine Erklärung. Aber was wir wirklich lernten, war, genau zu beobachten, uns nicht von Vorurteilen leiten zu lassen und nicht einfach etwas nachzuplappern. Meine Neigung galt eigentlich der Physik und Mathematik; aber in Biologie hatte ich immer die bessere Note.
Ein anderer Lehrer, dem es an natürlicher Autorität mangelte, sagte: „Ich bin mit den Hereros fertig geworden; ich werde auch mit Euch fertig werden.“ Heute wissen wir, dass die blutige Niederschlagung des Herero-Aufstandes in Deutsch-Südwest-Afrika zu den schändlichsten Kapiteln der deutschen Kolonialgeschichte gehört.
In Sport war ich gut. Ich lief kurze Strecken schnell, sprang hoch und weit und war vor allem im Turnen einer der Besten. Langlauf und Werfen lagen mir nicht so. Einmal machte ich am Barren eine Übung, die geht so: Man geht mit den Händen an beiden Holmen in den Stütz, senkt sich dann ab, führt den einen Arm nach hinten und unten und führt ihn dann von unten nach vorn, wo man so weit wie möglich nach vorn den Holm wieder umklammert. Dabei hängt das ganze Gewicht am anderen Arm, der dabei auf dem Holm aufliegt. Dann stützt man sich wieder hoch. Danach kommt der andere Arm dran und so weiter bis man am anderen Ende des Barrens angekommen ist. Einer der Mitschüler sagte: „Der ist ja schneller wie die anderen“. „Als die anderen“, keuchte ich, „nach dem Komparativ steht als, nicht wie!“ „Jetzt gibt er auch noch Deutschunterricht“, sagte der Turnlehrer. Ich nahm das als Lob.
Es gab eine Liste mit Punkten, die man für bestimmte Turnübungen bekommen konnte. Zu den Übungen am Reck stand da auch ‚Flanke aus dem Stütz‘, ‚Hocke aus dem Stütz‘ und ‚Grätsche aus dem Stütz‘. Für die Hocke gab es mehr Punkte als für die Flanke, aber die Grätsche brachte die meisten Punkte. Ich fragte den Turnlehrer, ob wir das auch machen würden. Er sagte, das käme erst später dran. In unserem Garten hatten wir ein Reck, und ich wollte mir zunächst die Flanke selber beibringen. Ich konnte Klimmzug, Aufschwung, Schwungstemme, Fallkippe und halber Riese. Und ich wusste, dass man vor allem den richtigen Schwung brauchte. Als ich so im Stütz an der Stange war und überlegte, wie ich Schwung nehmen sollte, um meine gestreckten Beine seitlich über die Reckstange zu bringen, wurde mir mulmig. Wenn ich mit den Füßen an der Reckstange hängen bliebe, würde ich furchtbar auf die Nase fallen. Aber es musste ja möglich sein; sonst würde es ja nicht im Lehrplan stehen. Ich nahm also meinen Mut zusammen, und es gelang. Ich kam zwar nicht sauber in den Stand. Aber ich übte bis ich es konnte. Dann kam die Hocke dran und dann die Grätsche. In der Schule hatte ich keine Gelegenheit, damit zu glänzen. Aber viel später hat es mir sehr geholfen.
Zweimal wurden wir zum Ernteeinsatz verpflichtet. Einmal zur Kartoffelernte und das zweite Mal zur Kirschernte im Alten Land. Meine Aufgabe war es, die „Sprehen“ in einem Obstgarten zu „hüten“, der noch nicht abgepflückt war. Sprehe ist das plattdeutsche Wort für Star. Und hüten bedeutete, die Stare vom Fressen der Kirschen abzuhalten. Dazu bekam ich eine Ratsche, ein Gerät, mit dem man ein lautes, knatterndes Geräusch erzeugen kann, das die Stare vertreiben soll. Das war mühsam; denn, wenn ich sie an einem Ende des großen Obstgartens vertrieben hatte, flogen sie zum anderen Ende und fraßen einfach weiter. Ich musste also von einem Ende zum anderen eilen und wieder zurück und dabei kräftig ratschen. Das war nicht nur mühsam, sondern auch langweilig. Ich sang alle Lieder, die ich kannte, so laut wie möglich in der Hoffnung, auch damit die Stare zu verschrecken. Dann brüllte ich ihnen alle Gedichte entgegen, die ich auswendig konnte. „Die Glocke“ von Schiller hatten wir vom Deutschlehrer zum Auswendiglernen aufbekommen. Als ich sie zu zwei Dritteln gelernt hatte, bekamen wir einen anderen Deutschlehrer. Mich störte es, mit zwei Dritteln einer Glocke im Kopf herumzulaufen. Den Anfang vergessen wollte und konnte ich nicht. Deshalb habe ich den Rest der Glocke freiwillig dazu gelernt. Die Stare konnte ich damit allerdings nicht sehr beeindrucken. Immerhin bekam ich Routine im Auswendiglernen, und Schillers Gedichte gefielen mir so gut, dass ich auch noch „Die Bürgschaft“, „Der Taucher“ und „Der Handschuh“ auswendig lernte.
Vom Frühjahr bis zum Spätherbst 1942 waren wir in der Kinderlandverschickung in Seiffen im Erzgebirge, um den ständigen Luftangriffen auf Hamburg zu entgehen.
Danach gingen wir wieder in Hamburg zur Schule. Nöllemann, so nenne ich ihn hier, war ein guter Mathe-Lehrer. Mein Freund Dieter und ich waren von Mathe so begeistert, dass wir uns nach der Schule und den Hausaufgaben weiter mit Mathe beschäftigten. Einmal zeichneten wir verschiedene geometrische Figuren: Dreiecke, Quadrate, Rechtecke, Parallelogramme, Trapeze usw. mit den zugehörigen Diagonalen. Das Trapez ist ein Viereck, bei dem zwei Seiten zueinander parallel sind, wobei die parallelen Seiten ungleich lang sind; sonst wäre es ein Parallelogramm. Wenn man die Diagonalen im Trapez zieht, entstehen 4 Dreiecke. Die beiden Dreiecke, die je eine der Parallelen als Seite haben, sind einander ähnlich, weil sie gleiche Winkel haben (Scheitelwinkel und Wechselwinkel an Parallelen). Das ist bekannt, das steht so in den Lehrbüchern, die uns zur Verfügung standen. Aber was ist mit den beiden anderen Dreiecken? Wir zeichneten mehrere Trapeze, mal symmetrisch, mal mehr oder weniger „windschief“. Dabei fiel uns auf, dass diese beiden Dreiecke immer den etwa gleichen Flächeninhalt besaßen. Um das zu prüfen, zeichneten wir verschiedene Trapeze und ihre Diagonalen auf Millimeterpapier und zählten dann mühsam die Anzahl der Quadratmillimeter der beiden Dreiecke. Und siehe da, die Anzahlen stimmten ziemlich genau überein. Aber das war natürlich noch kein mathematischer Beweis. Wir grübelten lange und besannen uns schließlich auf einen mathematischen Lehrsatz, nach dem Dreiecke mit gleicher Grundlinie und gleicher „Höhe“ flächengleich sind. Zwei solche Dreiecke gab es tatsächlich im Trapez: Beide Dreiecke, die die gleiche Parallele als Grundlinie hatten und deren dritter Eckpunkt auf der anderen Parallele lag, hatten die gleiche Höhe, weil ja die Parallelen gleichen Abstand voneinander haben. Man brauchte nur noch das in beiden Dreiecken enthaltene gemeinsame Dreieck abzuziehen. Wir waren sehr aufgeregt und durchsuchten nochmals die Lehrbücher. Aber dieser Satz, geschweige denn der Beweis, war nirgends zu finden.
Am nächsten Tag meldeten wir uns in der Mathe-Stunde und sagten, wir hätten einen neuen Lehrsatz der Geometrie aufgestellt. „Und der lautet?“, fragte Nöllemann belustigt. Ich sagte: „Ein Trapez wird von seinen Diagonalen in zwei ähnliche und zwei inhaltsgleiche Dreiecke zerlegt“. Nöllemann sagte sofort: „Das gibt es nicht; das würde ich wissen“.
Ich zeichnete ein Trapez an die Wandtafel mit den Eckpunkten A, B, C und D, der Höhe h, den Diagonalen e und f und deren Schnittpunkt M und sagte:
„Wie wir gelernt haben, ist das Dreieck mit den Eckpunkten ABM dem Dreieck CDM ähnlich, weil sie gleiche Winkel haben (Scheitelwinkel und Wechselwinkel bei Parallelen). Und nun kommt Dieter.“
Dieter sagte: „Die Dreiecke ADM und BCM sind flächengleich, weil die Dreiecke ABD und ABC flächengleich sind (beide haben gleiche Grundlinie und gleiche Höhe). Von beiden Dreiecken braucht nur noch das gemeinsame Dreieck ABM abgezogen zu werden.“ Nöllemann sagte: „Man lernt doch immer wieder etwas Neues“ und trug Dieter und mir eine Eins in sein Notizbuch ein.
Diesen mathematischen Lehrsatz aufzustellen und zu beweisen, hat ein unglaublich intensives Glücksgefühl in uns erzeugt und uns inspiriert, uns nachhaltig mit Mathematik und den damit verbundenen Naturwissenschaften zu befassen.
Das war die Zeit, als ich Mathematiker werden wollte. Übrigens: Mehr als 60 Jahre später (inzwischen gab es Internet und Wikipedia) war unser Lehrsatz immer noch nicht in den Lehrbüchern zu finden. Ich lud ihn deshalb, mit Dieters Einverständnis, auf Wikipedia hoch. Und da steht er immer noch, wörtlich! Ich hatte in Klammern hinzugefügt: (Carl O. Vernimb und Karl D. Möller, 1942). Das stand auch so einige Jahre lang in Wikipedia. Die Frau meines Enkels erinnert sich noch daran. Dann wurde die Klammer entfernt, wohl auf Grund der Wikipedia-Gepflogenheit, nicht überprüfte Urheber-Angaben zu löschen. Die Administratoren von Wikipedia haben diesen Vorgang natürlich archiviert.