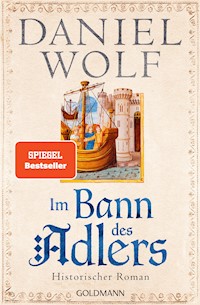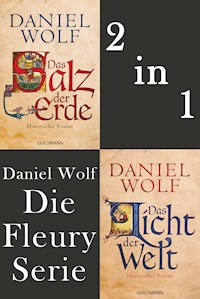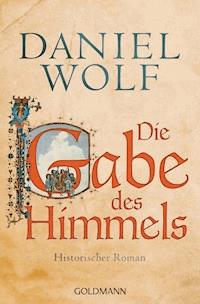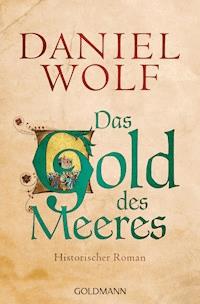
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Fleury-Serie
- Sprache: Deutsch
Die Fortsetzung der großen Spiegel-Bestseller "Das Salz der Erde" und "Das Licht der Welt".
Varennes-Saint-Jacques 1260: Die Gebrüder Fleury könnten verschiedener nicht sein. Während Michel das legendäre kaufmännische Talent seines Großvaters geerbt hat und das Handelsimperium der Familie ausbaut, träumt Balian von Ruhm und Ehre auf dem Schlachtfeld. Doch das Schicksal hat andere Pläne mit ihm. Nach dem Tod seines Bruders muss Balian die Geschäfte plötzlich allein führen. Es kommt, wie es kommen muss: Bald steht die Familie vor dem Ruin. Balian sieht nur noch eine Chance: Eine waghalsige Handelsfahrt soll ihn retten. Das Abenteuer führt ihn und seine Schwester Blanche bis ans Ende der bekannten Welt – und einer seiner Gefährten ist ein Mörder ...
Die Abenteuer der Familie Fleury gehen weiter – lesen Sie die Vorgeschichte von Balian Fleury in der E-Only-Zusatzgeschichte „Der Vasall des Königs“.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 868
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Varennes-Saint-Jacques 1260: Die Gebrüder Fleury könnten verschiedener nicht sein. Während Michel das legendäre kaufmännische Talent seines Großvaters geerbt hat und das Handelsimperium der Familie ausbaut, träumt Balian von Ruhm und Ehre auf dem Schlachtfeld. Doch das Schicksal hat andere Pläne mit ihm. Nach dem Tod seines Bruders muss Balian die Geschäfte plötzlich allein führen. Es kommt, wie es kommen muss: Bald steht die Familie vor dem Ruin. Balian sieht nur noch eine Chance: Eine waghalsige Handelsfahrt soll ihn retten. Das Abenteuer führt ihn und seine Schwester Blanche bis ans Ende der bekannten Welt – und einer seiner Gefährten ist ein Mörder …
Daniel Wolf ist das Pseudonym von Christoph Lode. Der 1977 geborene Schriftsteller arbeitete zunächst u. a. als Musiklehrer, in einer Chemiefabrik und in einer psychiatrischen Klinik, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Mit den historischen Romanen »Das Salz der Erde« und »Das Licht der Welt« gelang ihm der Sprung auf die Bestsellerlisten. Er lebt mit seiner Frau und zwei Katzen in Speyer.
Daniel Wolf
___________________________________
Das Gold des Meeres
Historischer Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe August 2016
Copyright © 2016 by Wilhelm Goldmann Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Gestaltung des Umschlags: UNO Werbeagentur München
Umschlagfoto: Getty Images / De Agostini / A. Dagli Orti
Getty Images / DEA PICTURE LIBRARY;
Getty Images / De Agostini / A. Dagli Orti
FinePic®, München
Redaktion: Eva Wagner
Karte: Peter Palm, Berlin
BH · Herstellung: Str.
Satz: Uhl +Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-16646-5V003
www.goldmann-verlag.de
»Nach Centnern wogen die Goten das GoldSie spielten mit EdelsteinenDie Frauen spannen mit Spindeln von GoldAus silbernen Trögen gab man den Schweinen.«
– Altes gotländisches Volkslied
Dramatis Personae
Varennes-Saint-Jacques
Die Familie Fleury
Michel, ein Kaufmann
Balian, sein Bruder
Blanche, Balians Zwillingsschwester, eine Buchmalerin
Rémy, ihr Vater, ein Meister der Buchmalerei
Philippine, ihre Mutter
Isabelle, ihre Großmutter
Clément Travère, Blanches Ehemann, ein Kaufmann
Odet, ein Knecht
Kaufleute
Célestin Baffour
Fulbert de Neufchâteau
Martin Vanchelle
Maurice Deforest
Thomas Carbonel
Raphael Pérouse
Bertrandon Marcel
Aymery Pelletier, ein verarmter Kaufmann
Sonstige
Godefroid, ein Söldner
Saint Jacques, der Patron von Varennes
Trier
Meinhard von Osburg, ein Ritter
Rosamund von Osburg, seine Schwester
Dietrich von Osburg, ihr Vater
Wolbero, Meinhards Knappe
Vater Nicasius, ein Ordenspriester
Hatho
Rufus von Hatho, ein Ritter
Rufus der Ältere, sein Vater, der Burgherr
Lübeck
Die Familie Rapesulver
Sievert, ein Kaufmann
Helmold, sein Bruder, ein Ritter des Deutschen Ordens
Winrich, der dritte Bruder, ein Kaufmann
Agnes, ihre Mutter
Mechthild, Sieverts Weib
Sonstige
Elva, eine dänische Schiffseignerin
Arnfast, ein Seeräuber
Henrik, ein Kaufmann aus Gotland
Preussen und Litauen
Konrad von Stettin, ein Ritter des Deutschen Ordens
Algis, Sohn des Samaitenfürsten Treniota, ein Krieger
Der Krive, der oberste Priester der Litauer
Valdas, ein litauischer Krieger
Rimas, ein Sklavenaufseher
Giedrius, ein Krieger und Geschichtenerzähler
Nowgorod
Fjodor Andrejewitsch, ein Krieger
Kathrina Fjodorowna, genannt Katjuschka, seine älteste Tochter
Grigori Iwanowitsch, sein Herr, ein Bojar
Tarmaschirin, ein Mongole
Rutger, Olav und Emich, Handelsherren der Gotländischen Genossenschaft
Historische Personen
Wilhelm von Holland, römisch-deutscher König bis zu seinem Tod 1256
Richard von Cornwall, römisch-deutscher König ab 1257
Alfons von Kastilien, römisch-deutscher König ab 1257
Henry III., König von England
Konrad von Hochstaden, Erzbischof von Köln
Albertus Magnus, ein Mönch und Universalgelehrter
Mathias Overstolz, ein Patrizier der Stadt Köln
Balduin von Rüssel, Bischof von Osnabrück
Burkhard von Hornhausen, Landmeister von Livland
Treniota, Fürst der Samaiten
Mindaugas, Großfürst der Litauer
Alexander Jaroslawitsch Newski, ehemaliger Fürst von Nowgorod und amtierender Großfürst von Kiew
Dmitri Alexandrowitsch, Alexanders Sohn, amtierender Fürst von Nowgorod
Berke, Khan der Mongolen im russischen Teilreich der Goldenen Horde
Prolog
Mai 1256
Balian dankte Gott und allen Heiligen, als er in London von Bord ging. Die Überfahrt von Calais hatte wegen des flauen Windes ewig gedauert, und sein Bruder und er auf einem beengten Schiff – das ging nicht lange gut. Viel hatte nicht gefehlt, dass einer den anderen ins Meer geworfen hätte.
Endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Balian atmete tief durch und roch den Gestank der riesigen Stadt, betrachtete das Gewirr aus Gassen und Hütten, das sich jenseits der Kais erstreckte. Ihr Schiff lag am Hafen von Billingsgate, das schmutzige Wasser der Themse umspülte den Rumpf. Es wirkte klein und bescheiden gegen die beiden bauchigen Koggen zu ihrer Rechten, doch für ihre Zwecke genügte es. Die Knechte brachten soeben die Wagen an Land und spannten die Ochsen vor. Hafenarbeiter löschten die Ladung: Tuchballen und Moselweine, vor allem aber das begehrte Salz aus ihrer Heimatstadt Varennes-Saint-Jacques im fernen Lothringen.
Michel dirigierte die Männer mit befehlsgewohnter Stimme. Immer selbstbewusst, niemals unsicher, dachte Balian missmutig und wünschte, er könnte genauso souverän auftreten wie sein älterer Bruder. Auf Michel hörten die Leute, sie hingen geradezu an seinen Lippen. Wenn dagegen Balian etwas sagte, wurde es meist belächelt. Er war das schwarze Schaf der Familie Fleury, ein Versager und Tunichtgut, das ließ man ihn bei jeder Gelegenheit spüren.
»Balian!« Sein Bruder rief nach ihm.
Balian sah, dass soeben Clément Travère von Bord ging. Ihr Schwager, der Gemahl seiner Zwillingsschwester Blanche, war Michels fattore und unternahm normalerweise die Handelsfahrten, während Michel das Familiengeschäft von der heimischen Schreibstube aus leitete. Diesmal war Michel ausnahmsweise mitgekommen, denn wichtige Geschäfte standen an.
Die Hand auf dem Schwertknauf, schritt Balian zu den beiden Männern.
»Ich habe alles überprüft«, berichtete Clément. »Die gesamte Ware ist draußen.«
»Gut«, sagte Michel. »Wir gehen heute nicht auf den Markt, das lohnt sich nicht mehr. Wir bringen die Ware zur Guildhall und gehen morgen in aller Frühe. Einverstanden?«
»Das erscheint mir sinnvoll«, antwortete Clément.
»Da kommt der Büttel des Sheriffs. Wo habe ich denn die Privilegienbriefe …? Ah, hier.« Michel förderte ein Bündel Pergamente zutage.
Balian überließ ihn seinen höchst wichtigen Aufgaben und half den Knechten, die Fässer und Tuchballen auf den Wagen zu verstauen. Körperliche Arbeit zog er stets den lästigen Pflichten eines Kaufmanns vor. Das Schachern mit Vertretern der Obrigkeit war ihm ein Graus, ganz im Gegensatz zu Michel, der beim Verhandeln in seinem Element war.
Balian dachte oft darüber nach, wieso Gott ihre Talente so ungleich verteilt hatte. Michel kam ganz nach ihrem legendären Großvater. Seit er das Familiengeschäft von ihrer greisen Großmutter übernommen hatte, führte er es mit Umsicht und Geschick. Obwohl erst achtundzwanzig Jahre alt, galt er bereits als einer der besten Kaufleute Varennes’. Niemand zweifelte daran, dass er einmal Großes vollbringen würde. Und die Frauen – sie lagen ihm zu Füßen. Trotzdem hatte er bisher nicht geheiratet. Michel schätzte seine Freiheit.
Balian hingegen lag niemand zu Füßen. Alles an ihm war mittelmäßig – seine Intelligenz, seine kaufmännische Befähigung, sogar sein Aussehen, denn Blanche hatte die ganze Schönheit ihrer Mutter geerbt, sodass für ihn nicht allzu viel übrig geblieben war. Kupferfarbenes, kinnlanges Haar, das er meist hinter die Ohren strich; leidlich breite Schultern und ein Allerweltsgesicht, das man rasch vergaß – das war Balian der Gewöhnliche. Manchmal wünschte er, er könnte seinen mit zahllosen Gaben gesegneten Bruder hassen. Aber natürlich tat er das nicht. Er liebte Michel. Jeder liebte Michel.
Oh, er hatte gegen sein Schicksal aufbegehrt, immer wieder – zuletzt im vergangenen Winter, als er mit König Wilhelm von Holland gegen die rebellischen Friesen gezogen war. Die kaufmännische Arbeit langweilte ihn, er träumte davon, Abenteuer zu bestehen und Ritter zu werden wie sein Großonkel mütterlicherseits. Seit seiner Jugend übte er sich an den Waffen. Ein Krieg war die Chance, sich zu bewähren, Ruhm zu ernten … hatte er gedacht. Tatsächlich aber hatte sich der Feldzug als katastrophaler Fehlschlag erwiesen. Bevor der König die Friesen bezwingen konnte, brach er mit seinem Pferd im Eis ein, schwamm hilflos im Wasser und wurde von feindlichen Kriegern erschlagen. Wilhelms Heer löste sich auf, die Männer zogen heim. Ein erbärmliches Ende für einen Krieg. Wenig überraschend wurde Balian in Varennes nicht als Held gefeiert – nein, man lachte über ihn, schmähte ihn als Verlierer und nahm ihn als Kaufmann nicht mehr ernst.
Schluss mit dem Selbstmitleid, schalt er sich. Sein Traum war geplatzt, er würde niemals Ritter werden – höchste Zeit, dass er sich damit abfand. War er eben Kaufmann, na und? Das Leben konnte er trotzdem genießen. Immerhin war er jetzt in London, der großartigsten Stadt, die er kannte. Balian war entschlossen, jeden Moment seines Aufenthaltes auszukosten.
Als er das letzte Fass auf den Wagen wuchtete, hörte er, dass der Wortwechsel zwischen Michel und dem Büttel hitziger wurde.
Balian trat zu ihnen. »Stimmt etwas nicht?«
»Er verwehrt uns unsere Handelsprivilegien«, empörte sich Michel. »Dabei haben wir sie schwarz auf weiß!«
Seit die Lothringer häufiger in England Handel trieben, hatte König Henry sie in den wichtigsten Küstenstädten von den Hafengebühren befreit. Michel besaß eine Abschrift des Privilegs. Leider schützten auch königliche Urkunden nicht immer vor der Willkür der Obrigkeit. Dass man ihnen in der Fremde ihre Rechte verwehrte, geschah wahrlich nicht zum ersten Mal.
Michel wedelte mit dem Pergament. »Er behauptet, der Brief sei eine Fälschung. Ist das zu fassen?«
»Soll ich mit ihm reden?«, schlug Balian vor.
»Sag ihm, dass wir keinen Pfennig bezahlen! Dass wir uns beim König beschweren, wenn er nicht einlenkt!«
Balian nahm die Urkunde an sich und wandte sich an den Büttel. Er konnte wesentlich besser Englisch als Michel und Clément, denn er hatte eine Begabung für Sprachen – eine der wenigen Fähigkeiten, die er seinem Bruder voraushatte. Er hatte Englisch bei ihren vergangenen Reisen nach London gelernt. Da die Sprache mit dem Deutschen verwandt war und viele französische Ausdrücke enthielt, hatte er nicht lange dafür gebraucht.
»Euer König hat uns von den Gebühren am Billingsgate befreit«, erklärte Balian dem Büttel geduldig. »Seht – hier steht es. Es ist keine Fälschung, mein Wort darauf.«
Der städtische Amtmann grinste verschlagen. »Ist mir egal, was da steht, doche. Die Gebühren gelten für alle. Auch für euch.«
Die beiden Bewaffneten hinter ihm stierten Balian an und schienen nur auf einen Anlass zu warten, die Schwerter zu ziehen.
»Das verstößt gegen königliches Recht.«
»Ich bin das königliche Recht am Billingsgate. Ich kann dich einfach so in den Tower werfen lassen, doche – und weißt du auch, warum? Weil mir dein Gesicht nicht gefällt. Jetzt zahlt, oder ihr lernt mich kennen.«
»Und wenn wir uns weigern?«
»Beschlagnahme ich eure Ware und führe euch dem Sheriff vor.«
»Aussichtslos«, wandte sich Balian an seinen Bruder. »Es ist besser, wir zahlen.«
»So schnell gibst du auf?«, schnappte Michel. »Du hast es doch noch gar nicht richtig versucht! Du musst ihm drohen, damit ihm die Frechheit vergeht.«
Natürlich – wenn etwas schiefging, war der Fehler stets bei ihm zu suchen. Doch Balian zwang sich, ruhig zu bleiben. »Es hat keinen Zweck. Schau dir den Kerl doch an. Er ist korrupt. Und ich habe keine Lust, die Nacht im Tower zu verbringen.«
Fluchend zählte Michel die Münzen ab und drückte sie dem Büttel in die Hand. Der verneigte sich spöttisch.
»Habt Dank, Ihr Herren, und herzlich willkommen in London. Ich wünsch Euch gute Geschäfte.« Mit diesen Worten stolzierte er davon.
»Das fängt ja gut an«, murmelte Clément.
Michel starrte dem Büttel finster nach. »Fahren wir zur Guildhall.« Er spuckte aus und kletterte auf den Wagen.
Die Guildhall war ein befestigter Handelshof am Ufer der Themse, nicht weit vom Billingsgate entfernt, jenseits der London Bridge mit ihren stinkenden Fischmärkten. Kaufleute aus Köln, die regelmäßig nach London kamen, hatten das Haus im vergangenen Jahrhundert erworben, als Stützpunkt für ihre Geschäfte auf der Insel. Inzwischen wurde es auch von der mächtigen Gotländischen Genossenschaft und anderen Englandfahrern aus dem Heiligen Römischen Reich genutzt. Ein festes Tor und hohe Mauern schützten die Kaufleute vor dem Stadtvolk, das den Ausländern ihre zahlreichen Privilegien neidete und schon manches Mal versucht hatte, sie aus London zu verjagen.
Zurzeit war in der Guildhall nicht viel los. Einige Kaufleute aus dem Rheinland und aus Bremen weilten gerade in dem Handelshof, doch sie blieben unter sich und wohnten in einem eigenen Gebäude. Nachdem Balian und seine Begleiter die Wagen untergestellt hatten, quartierten sie sich in einem der Häuser ein. Den Schlafsaal hatten sie ganz für sich. Eine Wohltat nach der Enge des Schiffes.
Die Strapazen der langen Reise steckten ihnen in den Gliedern, weshalb sie früh zu Bett gingen. Ehe Clément das Licht löschte, kniete er neben dem Schlaflager nieder und hielt leise Zwiesprache mit Gott. Jeden Tag sprach er gewissenhaft seine Gebete, auch widrige Umstände hielten ihn nicht davon ab. Balians Schwager war eine freundliche Natur, ein stiller, besonnener Mann, der nur sprach, wenn es wirklich etwas zu sagen gab. Blanche war bei ihm in guten Händen. Vor der Hochzeit hatten sie sich kaum gekannt, doch inzwischen liebten sie einander sehr. »Glück für dich«, pflegte Balian zu witzeln. »Wärst du ihr ein schlechter Ehemann, bekämst du es mit mir zu tun.« Sie lachten darüber, obwohl sie beide wussten, dass Balian es nur teilweise im Scherz meinte. Er zögerte nie, Blanche mit den Fäusten zu verteidigen, wenn ihr ein Unrecht geschah.
»Diesmal klappt es«, sagte Clément, als er sein Untergewand auszog. »Blanche ist schwanger, ich kann es spüren. Sowie wir zu Hause sind, wird sie es mir sagen.«
Sie wünschten sich sehnlichst ein Kind, doch bisher hatte Gott sie nicht erhört. Im ersten Jahr ihrer Ehe hatte Blanche eine Fehlgeburt gehabt; zwei Jahre später hatte sie einen gesunden Jungen zur Welt gebracht, trotzdem war der Säugling wenige Wochen nach der Geburt gestorben.
»Das will ich schwer hoffen«, meinte Balian. »Ich will endlich Onkel werden, Mann.«
Clément lächelte. »Gute Nacht, Schwager.« Er pustete die Kerze aus und schlüpfte ins Bett.
»Da drüben ist noch ein Stand frei«, sagte der Marktaufseher, während sie ihre Wagen durch das lärmende Gedränge lenkten. »Den könnt Ihr haben.«
»Gibt es keinen größeren?«, fragte Balian.
»Tut mir leid, alles belegt. Das ist der letzte.«
»Was sagt er?«, wollte Michel wissen.
»Wir bekommen den Stand an der Ecke. Einen besseren gibt’s leider nicht«, fügte Balian hinzu, als sich sein Bruder beschweren wollte.
Es dauerte eine Ewigkeit, bis sie die Waren abladen konnten, denn ein schimpfender Viehhändler mit seinen Mastschweinen blockierte die Gasse, und sie konnten erst weiterfahren, als die Menschenmenge die Herde endlich durchgelassen hatte. Obwohl um die kleine Holzbude herum kaum Platz war, gelang es ihnen irgendwie, die Ochsen auszuspannen und einen Teil der Ware zu abenteuerlichen Stapeln aufzutürmen.
Die Glocken hatten eben erst zur Terz gerufen, doch in den Gassen war bereits die Hölle los. Um sie herum bevölkerten Bauern, Fleischer und Fischhändler die Buden und priesen brüllend ihre Auslagen an. Das Gackern der Hühner und das Blöken der Rinder waren ohrenbetäubend; zahllose Gerüche bestürmten Balians Nase, nach Dung, Wollfett, Bier, frischem Brot und gebratenem Fleisch. Cheap im Herzen Londons war nicht der größte Markt, den er je besucht hatte, ganz gewiss aber der chaotischste. Die Verkaufsbuden, Warenstapel und Viehgehege standen nicht auf einem weitläufigen Platz, sondern drängten sich in den engen Gassen östlich von St. Paul’s. Es war ein brodelndes Labyrinth der Sinnesfreuden, in dem man schlichtweg alles fand, was das Herz begehrte – Kleider, Essen, Wein, Waffen, Pferde –, wenn man die Ausdauer hatte, sich durch die Menschenmassen zu kämpfen und danach zu suchen.
Obwohl ihr Stand nicht eben zentral lag, gelang es Michel rasch, Käufer für ihre Waren zu finden. Die Kunst des Feilschens beherrschte er meisterhaft. Man hätte annehmen können, dass ihm sein mäßiges Englisch dabei im Weg stehen würde, doch das Gegenteil war der Fall: Er schaffte es, dass sein starker Akzent und seine holprigen Sätze nicht lächerlich wirkten, sondern charmant. Auf diese Weise schwatzte er den Engländern fässerweise Salz auf und behauptete dreist, das Tuch aus Varennes sei noch feiner und weicher als die Stoffe aus Flandern und Italien. Balian hätte man für diese Übertreibung ausgelacht, Michel hingegen glaubte man jedes falsch ausgesprochene Wort und riss ihm die Tuchballen förmlich aus den Händen. Wein aus dem Reich war ohnehin begehrt in London, und so prasselten ständig blitzende Münzen in ihre Schatulle. Bereits am späten Nachmittag des zweiten Tages hatten sie den größten Teil ihrer Waren verkauft. Die Truhe unter dem Wagenbock war randvoll mit englischem Silber.
Michel ließ seine müden Schultern kreisen. Balian ging zu einer Schenke und holte einen Krug Bier, den sie sich teilten.
»Für heute lassen wir es gut sein«, entschied sein Bruder. »Es wird Zeit, dass wir Basing besuchen. Unsere Einnahmen sollten genügen, um ihm ein gutes Angebot machen zu können.«
Stephen Basing war ein Alderman, ein Mitglied des Londoner Stadtregiments. Darüber hinaus war er königlicher Lieferant und versorgte den Hof in Westminster mit Pelzen, Wachs und anderen Gütern. Michel wollte ihm die Genehmigung für die Ausfuhr von Wolle aus Lincolnshire abkaufen. Bisher war es Kaufleuten aus Varennes lediglich gestattet, Wolle in kleinen Mengen nach Lothringen zu importieren. Eine Ausweitung des Handels versprach enorme Gewinne, denn das aufstrebende Tuchgewerbe in der Heimat hatte einen unstillbaren Hunger nach Wolle.
»Am besten verlieren wir keine Zeit und laden gleich die restlichen Waren auf.« Balian trank den Humpen aus und stand auf.
»Die Knechte sollen die Wagen zur Guildhall zurückbringen«, sagte Michel. »Für dich habe ich eine andere Aufgabe.«
»Soll ich nicht zum Alderman mitkommen? Wer soll übersetzen, wenn ich nicht dabei bin?«
»Basing spricht Französisch, wir kommen ohne dich zurecht. Du gehst zum Sheriff’s Court, beschwerst dich über diesen frechen Büttel vom Billingsgate und siehst zu, dass du unsere Gebühren zurückbekommst.«
Balian verzog den Mund. Es war wie immer: Er durfte lästige Botengänge machen, während sein Bruder den ganzen Ruhm einheimste.
»Bist du damit einverstanden?«, hakte Michel nach.
Balian gab sich keine Mühe, seinen Unmut zu verbergen. »Einer muss es ja machen, schätze ich.«
»Es ist wichtig, Bruder. Wir brauchen das Geld. Also verdirb es nicht wieder.«
»›Wieder‹? Was meinst du mit ›wieder‹?«, fragte Balian gereizt.
»Dass du mitunter unbesonnen bist und dem Geschäft schadest, das ist alles.« Michel hob abwehrend die Hände.
»Ach ja? Wann habe ich je dem Geschäft geschadet?«
»Zum Beispiel in Calais, als die Tuchballen ins Wasser gefallen sind.«
»Das war nicht meine Schuld!«
»Doch, war es. Oder die Sache in Troyes, als wir deinetwegen Ärger mit der Marktaufsicht hatten …«
»Das hatte überhaupt nichts mit mir zu tun«, brauste Balian auf. »Das war dieser dumme Kerl mit seinem Köter, das weißt du genau …«
»Hört auf damit«, ging Clément dazwischen und starrte Michel verärgert an. »Ist es nötig, dauernd auf ihm herumzuhacken? Mag ja sein, dass er früher den einen oder anderen Fehler gemacht hat. Aber er hat gewiss daraus gelernt. Er wird das schon richtig machen.«
»Ich sage ja nur, dass er sich Mühe geben soll«, meinte Michel. »Mehr nicht.«
»Ich bin sicher, das wird er, nicht wahr?« Clément blickte Balian auffordernd an.
»Ich werd das schon hinkriegen«, lenkte der ein.
Michel nickte. »Wir treffen uns später in der Guildhall. Viel Glück, Bruder.«
Damit trennten sich ihre Wege. Balian gab den Knechten letzte Anweisungen, ehe er durch die Gassen zum Sheriff’s Court schritt.
Es war ein herrlicher Frühlingsabend. Die Sonne versank bereits hinter den Dächern, ihr Licht hatte die Farbe von Bernstein und glühenden Kohlen; es vertiefte die Schatten in den Höfen und ließ den Rauch der Herdfeuer schimmern wie gesponnenes Gold. Balians Ärger verflog. Er betrat das Gebäude durch das breite Tor – und wäre am liebsten rückwärts wieder hinausgegangen. Ganze Heerscharen bevölkerten die Halle, an deren Stirnseite die beiden Sheriffs saßen und in ihrer Eigenschaft als Obleute des Königs Gericht hielten. Die Bittsteller bildeten lange Schlangen vor ihrem Podest. Soeben brachte ein Wollhändler umständlich seine Klagen gegen Gott und die Welt vor, und es war abzusehen, dass allein dieser Fall eine halbe Ewigkeit in Anspruch nehmen würde.
Ohne mich, dachte Balian. Er war nicht nach London gekommen, um seinen ersten freien Abend in einem finsteren Gerichtsgebäude zu verbringen. Nach der langen Reise und den ermüdenden Markttagen wollte er etwas sehen von der Stadt. Der riesige Moloch erfüllte ihn mit unbändigem Lebenshunger, ließ sein Blut prickeln. Er sehnte sich nach dem weichen Körper einer Frau. Balian beschloss, hinüber nach Southwark zu gehen; dort gab es die schönsten Mädchen Londons in den Hurenhäusern des Bischofs von Winchester. Mit dem Sheriff kann ich auch später noch reden. Es war ohnehin vernünftiger zu warten, bis sich die Menge etwas gelichtet hatte.
Doch kaum hatte er die Halle verlassen, vergeudete er keinen Gedanken mehr an den Sheriff und die Hafengebühren. Er ließ sich treiben, sog die Eindrücke in sich auf, als er die Thames Street mit ihren duftenden Garküchen, Weinhändlern und Tavernen entlangschlenderte. Seeleute und Einheimische strömten in die Schenken, Balian lauschte ihren fröhlichen Stimmen und verdorbenen Liedern. Ein Straßenverkäufer schob einen Handwagen und bot Zuckergebäck an, bis einige Männer von der Bäckergilde auftauchten und ihn mit wütendem Gebrüll verjagten.
Von All-Hallows-the-Great, der Kirche der deutschen Kaufleute, schritt Balian zur London Bridge. Im Osten erblickte er den Tower, der Ehrfurcht gebietend in den Abendhimmel ragte. Die Brücke selbst war ein Kuriosum, an dem er sich kaum sattsehen konnte. Sie war bewohnt: Wo sich die Brüstung hätte befinden sollen, standen dicht gedrängt Wohnhütten und Läden. Die windschiefen Holzgebäude ragten, getragen von waghalsigen Stützkonstruktionen, weit auf den Fluss hinaus.
Balian war bei Weitem nicht der Einzige, der die Themse überqueren wollte. Allerhand Vergnügungssüchtige strömten nach Southwark, darunter nicht wenige zwielichtige Gesellen, denn die Siedlung im Süden war nicht nur das Zentrum der käuflichen Liebe, sondern auch ein Schlupfwinkel für allerlei Gesindel. Balian jedenfalls war froh, dass er sein Schwert am Gürtel trug, wie es sein Recht als fahrender Kaufmann war. In Southwark gab es beinahe jede Nacht Raufhändel und Messerstechereien.
Er hatte Durst und beschloss, einen kurzen Abstecher in ein Alehouse auf der Brücke zu machen. Geduckt trat er durch die niedrige Tür und gelangte in einen rauchverhangenen Raum. Ein Kessel hing über dem Herdfeuer. In einer Ecke befand sich ein Gehege, darin kämpften zwei Hähne gegeneinander. Mehrere Männer feuerten die Tiere brüllend an, der Wirt nahm die letzten Wetteinsätze entgegen. Balian fand einen freien Platz in einer Nische, bestellte ein Bier und lauschte den Gesprächen der Gäste.
Eine Geschichte interessierte ihn besonders: Offenbar hatte man im Heiligen Römischen Reich endlich einen Nachfolger für König Wilhelm gefunden, der im Januar so unrühmlich verschieden war. Eine Gesandtschaft aus Pisa, berichtete ein Händler aus Köln seinen Zechbrüdern, hätte vor einigen Wochen Alfons von Kastilien zum neuen römisch-deutschen König ausgerufen. Der englische König Henry III. sei deswegen sehr aufgebracht, denn Alfons von Kastilien war nicht eben sein Freund, und er wünsche sich einen deutschen König, der England gewogen sei. »Ich habe gehört, dass er versuchen will, seinem jüngeren Bruder Richard von Cornwall zur Krone zu verhelfen«, schloss der Kölner seinen Bericht.
»Wie will er das anstellen?«, fragte einer seiner Freunde, offenbar ein Einheimischer. »Jetzt ist doch schon Alfons von Kastilien König.«
»So einfach ist das nicht«, erklärte der Kölner. »Die Pisaner können keinen König bestimmen. Was da geschehen ist, ist ganz und gar schändlich. Der deutsche Herrscher muss von den sieben mächtigsten Fürsten gewählt werden. Wenn Henry diese Fürsten für seine Pläne gewinnen kann, hat sein Bruder vielleicht doch eine Chance.«
Diese komplizierten politischen Verwicklungen wurden von den Männern ausgiebig erörtert. Auch Balian machte sich seine Gedanken dazu. Zwei Könige, die um den Thron stritten – das war schlecht für das Reich. Das bedeutete Unfrieden, Zwietracht, vielleicht sogar Krieg. Er spielte mit dem Talisman, den er stets um den Hals trug, ein Lederbändchen mit einem Pilgerzeichen, in das die Buchstaben CMB eingraviert waren. Hoffen wir, dass die Sache gut ausgeht.
Eine Schankmaid brachte sein Bier.
»Merci beaucoup«, sagte Balian zerstreut, ehe er sich daran erinnerte, wo er war, und ein »Thanks!« nachschob.
Das Mädchen reagierte nicht, wohl aber ein Engländer am Nachbartisch, der ihn plötzlich argwöhnisch anstarrte. Der Kerl, vielleicht ein Seemann, sah zum Fürchten aus. Er hatte nur noch ein Auge und hielt das andere mit einer schmutzigen Binde bedeckt.
Balian trank von seinem Bier und wischte sich den Schaum von der Oberlippe. Der Kerl glotzte immer noch. »Gibt es ein Problem?«, erkundigte sich Balian.
»Aye«, knurrte der Einäugige. »Und was für eins. Du bist Franzose. Ich hasse alle Franzosen.«
Balian schwieg und trank noch einen Schluck.
»Hab zweiundvierzig bei Taillebourg für König Henry gekämpft«, fuhr der Engländer fort. »Schau, was ich dafür von den verdammten Franzosen bekommen habe.« Er hob die Binde und entblößte sein zerstörtes Auge: ein wunder Krater in dem vernarbten Antlitz.
»Das tut mir leid für dich«, meinte Balian.
»Tut’s nicht. Also lüg mir nicht ins Gesicht. Hör mir lieber zu, denn ich hab dir was zu sagen.«
Balian seufzte innerlich. »Ich bin ganz Ohr.«
Der Einäugige baute sich vor ihm auf. Seine beiden Kumpane am Tisch grinsten breit und entblößten dabei gelbe Zähne.
»Ihr Franzosen seid nicht nur Lügner, ihr seid schmutzig wie die Schweine und stinkt auch wie welche. Außerdem wisst ihr nicht, wie man eine Frau anpackt, weil ihr euer Ding lieber in einen hübschen Knaben steckt.«
Noch ein Schluck. »Bist du fertig?«
»Mehr hast du nicht zu sagen? Hast du keine Ehre im Leib?«
»Mein Freund, ich habe sehr wohl Ehre im Leib. Aber ich muss dir leider mitteilen, dass mich deine Schmähungen nicht getroffen haben. Tatsächlich gingen sie weit daneben.«
»Ach ja? Wieso das, wenn ich fragen darf?«
»Ich bin kein Franzose«, ließ Balian ihn wissen.
»Wo kommst du dann her?«
»Aus dem schönen Lothringen.«
Verwirrung ergriff den Einäugigen. Aber er war bereits zu weit vorgeprescht, um einen Rückzieher zu machen. »Nie davon gehört«, schnappte er. »Aber ich wette, dieses Lothringen ist ein Scheißloch voller Schwachsinniger und Krüppel, die sich gegenseitig den Hintern streicheln.«
»Jetzt haben wir ein Problem.« Balian stand auf.
»Was tun wir dagegen?«
Der Engländer war ein Schrank von einem Mann und einen halben Kopf größer als er, doch das schreckte Balian nicht. Er war flink, und im Kampf war Schnelligkeit wichtiger als rohe Muskelkraft.
»Ich schätze, wir müssen uns schlagen.«
»Aye«, knurrte der Einäugige. »Das mein ich auch.«
Seine Kumpane erhoben sich. Einen Moment lang standen sich die vier Männer reglos gegenüber – und dann ging plötzlich alles sehr schnell. Balian schnellte vor und rammte dem Einäugigen die Faust in den Magen. Als der zur Seite fiel, stieß Balian mit einem Tritt den Tisch um und hielt so die anderen auf Abstand. Drei gegen einen, das war nicht einfach. Aber wenn Balian eins konnte, dann kämpfen; das hatte er spätestens im Krieg gegen die Friesen gelernt. Außerdem waren seine Gegner betrunken und langsam. Er tauchte unter einem Schlag des Einäugigen durch, ergriff die Sitzbank und schwang sie mit beiden Händen wie eine riesige Keule. Das schwere Holz traf einen Engländer an der Schulter, der Mann fiel rücklings auf den Tisch der Kölner, die brüllend aufsprangen. Einer zerrte den Engländer auf die Füße und schlug ihm ins Gesicht – und plötzlich waren es nicht mehr vier Leute, die rauften, sondern fünf, sechs, sieben, kurz darauf die halbe Schenke. Fäuste flogen, Männer brüllten, Krüge zersplitterten. Balian wich Faustschlägen aus und stöhnte vor Schmerz, wenn er getroffen wurde. Doch auf jeden Hieb, den er einstecken musste, kamen fünf, die er austeilte. Er warf die Bank dem Einäugigen zu, der sie prompt auffing und sich daher kaum verteidigen konnte, als Balian ihn mit einer schnellen Serie von Schlägen eindeckte.
»Jetzt reicht’s mir!« Der Kerl zückte ein böse schimmerndes Messer.
Balian wich zurück. Die Sache wurde ernst. Als er gerade sein Schwert ziehen wollte, übertönte ein Schrei das Kampfgetümmel.
»Die Büttel!«, brüllte jemand. »Die Büttel des Sheriffs! Schnell weg!«
Augenblicklich war die Rauferei zu Ende. Einige Männer flohen durch die Vordertür, doch die meisten drängten in den hinteren Teil der Schenke. Als Balian sah, dass sie durch den Hintereingang entkamen, schloss er sich ihnen an, denn er hatte keine Lust, den Ordnungshütern geradewegs in die Arme zu laufen.
Die Tür führte zu einem Gewirr aus Stützbalken, Planken und Leitern hinter dem Alehouse, das sich wie eine riesige Kletterpflanze an die Brücke und die Häuser darauf klammerte.
»Da lang!«, rief der Einäugige, und die Zecher hasteten über einen schmalen Steg. Mehrere Mannslängen unter ihnen floss die Themse, und es gab nur ein schlaffes Seil zum Festhalten.
»Im Namen des Königs, stehen bleiben!«
Balian war der Letzte, der das Ende des Stegs erreichte. Er wandte sich um und sah mehrere Büttel aus dem Alehouse kommen. Die Männer trugen nietenbesetzte Wämser und Helme mit Nasenschutz und zogen Schwerter, als sie über die Planken kletterten.
Balian sah sich schon im Tower sitzen. Geistesgegenwärtig versetzte er dem Steg einen Tritt, woraufhin sich der schlecht verankerte Balken löste und in den Fluss fiel. Der vorderste Büttel rang vergeblich um sein Gleichgewicht und landete platschend im Wasser. Die anderen Stadtknechte schüttelten wütend die Fäuste, als sie erkannten, dass man ihnen den Weg abgeschnitten hatte. Die Zecher johlten.
Eilends flohen Balian und seine Gefährten über das Balkengewirr zum Südufer der Themse nach Southwark. Erst als sie sicher waren, die Stadtknechte abgeschüttelt zu haben, blieben sie stehen und schöpften Atem.
»Bei Gott, war das knapp!«, ächzte einer der Kölner.
Mit finsterer Miene kam der Engländer auf Balian zu. Er war nicht wenig zugerichtet von der Rauferei. Wo ihn ein Faustschlag getroffen hatte, schwoll bereits seine Backe an.
»Wir sind noch nicht fertig miteinander. Wo waren wir stehen geblieben?«
»Du hast gerade dein Messer gezogen«, erinnerte Balian ihn.
So standen sie da und starrten einander an, jeder die Hand auf dem Griff seiner Waffe. Die übrigen Zecher hielten den Atem an, in Erwartung des bevorstehenden Blutvergießens. Plötzlich zuckte der Mundwinkel des Einäugigen, Balian begann zu grinsen – und im nächsten Moment prusteten sie los. Die anderen Raufbolde fielen in das Gelächter ein.
»Das war ein guter Kampf«, meinte der Einäugige, als er sich beruhigt hatte.
»Ganz deiner Meinung«, stimmte Balian zu.
»Du hast einen ganz schönen Schlag drauf. Sind alle Lothringer so kräftig wie du?«
»Aye. Wenn wir uns nicht gerade gegenseitig den Hintern streicheln, schuften wir in der Saline, das gibt Muskeln.«
Wieder lachten die Männer.
»Gehen wir was trinken«, schlug der Einäugige vor. »Dann kannst du uns von deiner Heimat erzählen.«
Balian wollte zustimmen, als er die beleuchtete Guildhall am gegenüberliegenden Flussufer erblickte. Brandheiß fiel ihm ein, was er zu tun hatte. Es wurde bereits dunkel – hoffentlich war es noch nicht zu spät. »Ich habe leider noch was vor. Trinkt einen für mich mit.« Er schlug dem Engländer zum Abschied auf die Schulter und eilte zurück zur London Bridge.
Die Büttel hatten offenbar den Rückzug angetreten, als sie erkannten, dass die Raufbolde entkommen waren, denn auf der Brücke war weit und breit kein Ordnungshüter zu sehen. Balian hastete an den Läden und Hütten vorbei zur Thames Street und betete, dass der Sheriff ihn zu so später Stunde noch anhören würde. Wo ist nur die Zeit hin? Normalerweise hätte er sich leicht eine halbe Stunde im Hurenhaus vergnügen und wieder zurück sein können, bevor es dunkel wurde. Warum nur war er in das verdammte Alehouse gegangen? Dadurch hatte alles viel zu lange gedauert.
Er erreichte den Sheriff’s Court. Das Tor der Halle war verschlossen.
»Ich muss sofort zum Sheriff«, sprach Balian den Wächter an.
»Ihr kommt reichlich spät«, entgegnete der Mann. »Es hat schon vor einer ganzen Weile zur Komplet geschlagen. Die Sheriffs sind längst weg.«
»Und morgen? Wann kommen sie morgen?«
»Gar nicht. Und übermorgen auch nicht. Sie halten erst wieder nächste Woche Gericht.«
Nächste Woche, hallte es in Balian nach. Am liebsten hätte er sich gegen die Stirn geschlagen. Wieder einmal hatte er alles verdorben.
Michel würde ihm den Kopf abreißen.
Es war bereits dunkel, als Michel und Clément zur Guildhall zurückkehrten. Die meisten Bewohner des Handelshauses schliefen schon; nur der Torwächter war noch auf den Beinen und ließ die beiden Kaufleute herein.
Schweigend überquerten sie den Hof. Michel ging noch einmal in Gedanken das Gespräch mit Stephen Basing durch. Die Unterredung mit dem Alderman war wenig erfreulich verlaufen. Basing hatte sie zwar herzlich in seinem Haus empfangen, doch ihr Ansinnen hatte er entschieden zurückgewiesen. Der Wollhandel sei bei den Kaufleuten aus Flandern und Köln in guten Händen; Lothringen hingegen sei zu weit weg von London, als dass Kaufleute aus Varennes den kostbaren Rohstoff preiswert vertreiben könnten. »Außerdem scheint mir Euer Unternehmen für eine solche Aufgabe zu klein zu sein«, hatte der Alderman gesagt.
Natürlich hatte Michel widersprochen und versucht, Basing von seinen Plänen zu überzeugen; sie hatten ihm sogar eine stolze Summe für die Lizenz geboten. Vergeblich. Der Engländer beharrte auf seiner Meinung und wünschte ihnen zum Abschied gute Geschäfte in London. Die Enttäuschung darüber saß tief.
»Lass uns eine Nacht darüber schlafen«, sagte Clément, der zu ahnen schien, was in Michel vorging. »Morgen überlegen wir, wie wir Basing umstimmen können.«
»So machen wir’s.« Michel legte all seine Entschlossenheit in seine Stimme. Er war ein Fleury – so leicht würde er sich nicht geschlagen geben. Gleich morgen früh würde er sich hinsetzen und einen neuen Plan schmieden – eben ganz so, wie es auch sein berühmter Großvater getan hätte, dem Michel nacheiferte.
Sie betraten ihr Wohnquartier. Zwei Knechte schliefen bereits, die anderen beiden kauerten im Licht eines Kienspans und würfelten um ein paar Kupfermünzen.
»Ist mein Bruder noch nicht wieder da?«, erkundigte sich Michel.
»Hab ihn nicht gesehen, Herr.«
Gewiss weilte Balian noch im Sheriff’s Court; Gerichtsverhandlungen vor den Obleuten des Königs waren eine langwierige Angelegenheit und konnten sich bis in die späten Abendstunden hinziehen. Zumindest hoffte Michel das. Die andere Möglichkeit war, dass Balian wieder Unfug anstellte. Michel liebte seinen Bruder, aber Balian trieb ihn mit seiner Unbesonnenheit mitunter zur Weißglut. Besonders große Städte wie London mit ihren Tavernen, Hurenhäusern und Verlockungen an jeder Straßenecke brachten stets das Schlechteste in ihm zum Vorschein.
Ich hoffe für ihn, er hat gehorcht. Sonst kann er was erleben.
»Wir sollten noch einmal nach den restlichen Waren sehen, bevor wir ins Bett gehen«, sagte Clément.
Michel nickte. Sie hatten die Knechte angewiesen, die Fässer in den Lagerkeller zu schaffen. Aber wenn man die Bediensteten nicht beaufsichtigte, neigten sie dazu, nur das Nötigste zu tun. Besser, sie überzeugten sich davon, dass alles ordnungsgemäß verstaut war, damit sie morgen keine böse Überraschung erwartete.
»Kommt«, forderte Michel die Knechte auf.
»Ich will erst fertig spielen«, murrte einer der Männer. »Hab gerade eine Glückssträhne.«
Michel war bereits drauf und dran, den Kerl scharf zu ermahnen, als Clément sagte: »Lass sie doch spielen. Wir rufen sie, wenn es Arbeit gibt.«
Der Lagerraum befand sich unter dem Nachbargebäude und war über eine breite Rampe zu erreichen. Sie öffneten das Tor und betraten den dunklen Gewölbekeller. Die vorderen Kammern waren vollgestellt mit Kisten und Fässern. Dank der Hausmarken an den Behältnissen ließen sich die Waren leicht ihrem jeweiligen Besitzer zuordnen.
Sie drangen tiefer in den Keller vor, bis sie schwaches Licht sahen, das aus der hintersten Kammer fiel. Im Raum davor standen ihre Waren, doch Michel interessierte sich plötzlich mehr für die Schatten, die im Fackelschein zuckten. Außerdem vernahm er Stimmen: Zwei Männer unterhielten sich leise. Michel hatte gute Instinkte, auf die er sich stets verlassen konnte, und jetzt sagten sie ihm, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zuging. Wer traf sich des Nachts im Keller der Guildhall zu einem vertraulichen Gespräch?
Er wandte sich zu Clément um und legte den Zeigefinger an die Lippen, ehe er näher an den Durchgang heranschlich.
»… in Westminster … wir und König Henry …«, waren die einzigen gewisperten Wortfetzen, die er verstand. Die Männer sprachen Deutsch. Leider nicht die Zunge des südlichen Rheinlandes, mit der er gut zurechtkam, sondern Niederdeutsch, das ihm einige Schwierigkeiten bereitete.
Er verbarg sich neben dem Durchgang, spitzte die Ohren und spähte in die hintere Kammer. Einer der Männer hatte ihm den Rücken zugewandt. Der Waffenrock, den er trug – waren das die Farben des Deutschen Ordens?
In diesem Moment trat Clément auf einen kleinen Stein, und es knirschte vernehmlich.
Du wirst es nicht glauben, Michel, aber die Sheriffs sind gerade nicht in der Stadt, alle beide. Sie sollen im Norden sein und können kein Gericht halten. Was für ein Pech!
Nein, nicht gut. Michel musste morgen in der Stadt nur zwei, drei Fragen stellen, um diese Geschichte als dreiste Lüge zu enttarnen.
Bei Gott! Als ich zum Sheriff’s Court kam, brannte er lichterloh!
Das war sogar noch um einiges schlechter. Balian betastete seinen Talisman und zermarterte sich das Hirn, während er durch die Gassen schlurfte.
Es war so viel los, dass sie meine Beschwerde partout nicht annehmen wollten. Ich fürchte, wir müssen bis nächste Woche warten.
Das klang einigermaßen glaubhaft und kam zudem der Wahrheit recht nah. Doch leider hatte Michel die beinahe überirdische Gabe, Balians Ausreden zu durchschauen. Davon abgesehen – was wäre er für ein Mann, wenn er nicht willens war, für seine Fehler geradezustehen? Er würde Michel die Wahrheit sagen und das Donnerwetter stoisch ertragen. Das war das kleinere Übel. Er hatte bereits genug angerichtet und musste nicht auch noch einen Lügner aus sich machen.
Niedergeschlagen betrat er die Guildhall und ging zum Schlafsaal.
Sein Bruder und sein Schwager mussten bereits zurück sein, denn ihre Mäntel und Schwerter lagen auf den Betten. »Wo sind Michel und Clément?«, fragte Balian die beiden Knechte, die noch wach waren.
»Sie wollten in den Lagerkeller, nach den Waren sehen.«
Als Balian das Wohngebäude verließ, sah er zwei Männer die Kellerrampe heraufkommen. Nicht Michel und Clément, sondern zwei Fremde. Einer war gekleidet wie ein Kaufmann; der andere, ein stämmiger Kerl mit lockigem schwarzem Haar und akkurat gestutztem Vollbart, trug eine Kettenrüstung und darüber einen weißen Rock mit schwarzem Kreuz auf der Brust. Was macht ein Ordensritter hier?, dachte Balian. Normalerweise operierte der Deutsche Orden ausschließlich im Heiligen Land, in Preußen und im römisch-deutschen Reich. Es war das erste Mal, dass er einen der Mönchskrieger in London traf.
Die beiden Männer schritten an ihm vorbei, sie wirkten gehetzt, beinahe panisch. Nun, nicht sein Problem. Balian stieg die Rampe hinab und trat durch das offene Tor.
»Michel?«
Seine Stimme hallte durch das Gewölbe. Er ging an den Fässern und Kisten vorbei und erblickte flackerndes Fackellicht.
»Wo seid ihr denn?«
Stille.
Da hörte er ein leises Geräusch, eine Art Keuchen. Von einer bösen Ahnung erfüllt, beschleunigte er seine Schritte. Vor dem Durchgang zur erleuchteten Kammer lagen zwei Körper auf dem Steinboden.
Einer war Clément. Ein Schwerthieb hatte ihm die Kehle gespalten. Mit stumpfen Augen starrte er zur Decke, alles war voller Blut.
Ein schwaches Wispern: »Balian …«
Wie von fremden Mächten gelenkt, sank er neben dem zweiten Körper auf die Knie, fasste seinen Bruder unter den Schultern, legte Michels Kopf in seinen Schoß. Versuchte irgendwie, mit den Händen die grässliche Wunde in der Brust zu schließen, doch sie war viel zu groß, viel zu tief, das Gewand war längst von Blut getränkt.
»Bei Gott, Michel. Michel …«, brachte Balian hervor.
Sein Bruder bewegte die Lippen, versuchte, Worte zu formen, vergeblich.
»Was ist geschehen? Bitte sag es mir …«
Michel blickte ihm in die Augen und ergriff seine Hand, drückte sie, drückte so fest, dass es schmerzte. Ein kaum hörbares Seufzen entwich seinem Mund, ein letztes Flüstern. Dann erschlaffte sein Griff.
Balian saß reglos da, hielt seinen Bruder in den Armen und spürte kaum, wie ihm die Tränen über die Wangen flossen. Michel und Clément tot auf dem Boden, ihre Wunden, das ganze Blut – das geschah nicht wirklich, er bildete sich alles nur ein, es war nichts als ein Traum, ein scheußlicher Nachtmahr.
Steh auf, sagte er sich. Tu etwas.
Sanft legte er Michels Kopf auf den Boden, bewegte seine steifen Glieder, erhob sich. Als er die beiden Körper da liegen sah, packte ihn alles verzehrende Wut, ein Zorn, der das Entsetzen und den Schmerz einfach fortspülte.
Der Kaufmann und der Ordensritter – sie waren das. Sie haben Michel und Clément getötet.
Balian riss sein Schwert aus der Scheide und rannte durch den Keller, die Rampe hinauf, über den Hof.
»Mörder!«, brüllte er. »Mörder!«
Doch die beiden Männer waren längst verschwunden.
Kapitel eins
November 1259
Es war ein anstrengender Ritt gewesen, doch kaum hatte Blanche das Skriptorium des Klosters Larrivour betreten, fiel die Erschöpfung von ihr ab. Das Kratzen der Federkiele auf dem Pergament, das Flüstern der Mönche, der Duft der Farben wirkten eigentümlich beruhigend auf sie. Blanche war Buchmalerin. In allen Schreibstuben der Christenheit fühlte sie sich zu Hause.
Sie öffnete ihre Tasche. »Euer Exemplar der Gesta Francorum. Noch einmal tausend Dank für die Leihgabe, Abbé Germain, auch im Namen meines Vaters.«
Der Abt übergab das ledergebundene Buch einem Novizen, ohne es auf Schäden zu untersuchen. Er vertraute Blanche blind. Seit Jahren liehen sie sich gegen eine kleine Gebühr Bücher aus der Klosterbibliothek, um sie in der heimischen Werkstatt zu kopieren und reichen Sammlern zu verkaufen. Abbé Germain nahm keinen Anstoß an ihren kommerziellen Absichten. Ihm war allein daran gelegen, die Kunst der Buchmalerei zu fördern und zur Verbreitung des Wissens beizutragen.
Der kauzige Geistliche lächelte verschmitzt. »Wie geht es dem alten Eigenbrötler Rémy? Wird es nicht allmählich Zeit für ihn, sich zur Ruhe zu setzen und dir die Werkstatt zu überlassen?«
»Er denkt gar nicht daran. Ihr kennt ihn doch. Er wird Bücher machen, solange er kann.«
»Gewiss, gewiss. Denn wer über einen Bogen Pergament gebeugt dasitzt und lateinische Phrasen abschreibt, kommt nicht in Verlegenheit, mit anderen sprechen zu müssen, nicht wahr?«
Blanche lächelte. »Das mag so sein.«
»Gott segne deinen Vater. Möge der Herr ihm viele weitere Jahre schenken, damit uns sein Geschick mit der Feder noch lange erhalten bleibt«, sagte Abbé Germain. »Bestelle ihm bitte meine Grüße. Und richte ihm aus, dass er sich gerne wieder einmal bei uns blicken lassen darf.«
»Ich fürchte, auf seine alten Tage verlässt er Varennes nur noch ungern.«
»Ach, und recht hat er. Reisen ist scheußlich. Wenn mich das Mutterkloster ruft, bin ich schon eine Woche vor der Abreise so nervös, dass ich kaum schlafen kann. Aber was rede ich – du willst gewiss die Bücher sehen.«
Sie gingen nach hinten, wo der Abt einen schweren Schlüssel aus seiner Kutte fischte und die beiden Bücherschränke aufschloss.
»Nimm mit, was du brauchst.«
Blanche betrachtete die Folianten und Prachtcodices, nahm das eine oder andere Buch heraus und blätterte darin. Die Evangeliare und Psalter und die anderen liturgischen Schriften, die den Hauptteil der Sammlung ausmachten, waren uninteressant für sie. Ihr Augenmerk galt den profanen Werken: den Enzyklopädien, wissenschaftlichen Abhandlungen und Texten der antiken Philosophen. »Die haben wir alle schon einmal ausgeliehen. Habt Ihr keine neuen Bücher bekommen?«
»In letzter Zeit nicht. Obwohl … Ich hätte vielleicht etwas für dich.« Abbé Germain schritt zu einem Lesepult und kam mit einem Büchlein zurück. »Das ist die Legende vom guten Gerhard. Hast du davon schon einmal gehört?«
Blanche verneinte.
»Mir ist sie auch kein Begriff. Aber jenseits des Rheins kennt man die Geschichte offenbar. Ein gewisser Rudolf von Ems hat sie niedergeschrieben. Das Mutterkloster wünscht, dass wir sie ins Französische übertragen. Leider kommen meine Brüder damit nicht zurecht. Möchtet ihr einen Versuch wagen?«
Blanche schlug das Büchlein auf. Die Verse füllten viele eng beschriebene Seiten. Die Sprache war zweifellos Deutsch, doch handelte es sich um einen Dialekt, der ihr nicht vertraut war. Sie hatte mitunter Mühe, dem Text zu folgen. »Schwierig«, meinte sie.
»Wir würden euch gut bezahlen.«
Blanche konnte es sich nicht erlauben, einen lukrativen Auftrag abzulehnen. Nun, sie würden es schon irgendwie schaffen. Rémy und sie hatten schon ganz andere Schwierigkeiten gemeistert, hatten etwa nahezu unleserliche Handschriften entziffert oder katastrophal falschem Latein die Stirn geboten. Außerdem war da immer noch ihr sprachbegabter Bruder, der ihnen helfen konnte, wenn sie nicht weiterkamen. »Ich schaue, was wir tun können.« Blanche verstaute das Büchlein in ihrer Tasche. »Wann benötigt Ihr die Übersetzung?«
»Es eilt nicht. Nehmt euch so viel Zeit, wie ihr braucht.«
Der Abt geleitete sie hinaus.
»Es war mir wie immer ein Vergnügen, mein Kind. Bitte besuch uns bald wieder«, sagte er, als sie den Kreuzgang entlangschritten. Wind blies ihnen kalt ins Gesicht, wirbelte das Herbstlaub auf und ließ die vertrockneten Blätter um die Säulen tanzen wie übermütige Feen, die ihren Schabernack mit den Menschen trieben. »Ich fürchte, das gibt ein Unwetter. Soll ich dir ein Quartier für die Nacht herrichten lassen?«
»Ich muss gleich weiter. Mein Bruder erwartet mich in Troyes.«
Abbé Germain ließ sie nur ungern ziehen. »Sei vorsichtig da draußen. Dieser Wind hat Zähne und Klauen.«
»Bevor ich gehe, würde ich gern die Kapelle aufsuchen, wenn Ihr erlaubt.«
Der Geistliche brachte sie zum Gotteshaus. Vor dem Portal musterte er sie besorgt. »Du willst für deinen Mann beten, hab ich recht?«
Abbé Germain deutete ihr Schweigen richtig – er kannte ihre Geschichte.
»Es ist nicht gut, so lange zu trauern. Es ist fast vier Jahre her … Vielleicht solltest du allmählich loslassen.«
»Das ist meine Sache«, sagte Blanche knapp.
»Gewiss. Niemand will dir verbieten, für deinen Clément zu beten. Aber du darfst nicht zulassen, dass die Vergangenheit dich gefangen hält. Wie alt bist du, mein Kind?«
»Siebenundzwanzig.«
»So jung. Gott will nicht, dass du für alle Zeiten Witwe bleibst. Er will, dass du einen Mann glücklich machst und ihm Kinder schenkst. Dass du glücklich bist.«
»Habt Dank für alles, Abbé.« Der Wind bauschte ihren Mantel auf, als sie das Portal öffnete. Blanche ließ den Geistlichen stehen und ging hinein.
Vor dem Altar legte sie die Tasche ab, sank auf die Knie und spürte seinen Blick im Rücken. Sie wusste, Abbé Germain meinte es nur gut mit ihr; dennoch war sie wütend auf ihn. Dieser Mönch hatte nie geheiratet, er wusste nichts von der Liebe und erst recht nichts von der Ehe – und er wollte ihr vorschreiben, was sie zu fühlen hatte? Cléments sinnloser Tod hatte sie beinahe zugrunde gerichtet, und der Schmerz quälte sie noch immer, manchmal so heftig wie am ersten Tag. Sie würde so lange trauern, wie es nötig war. Und wenn es zehn Jahre dauerte.
Als der Abt schließlich ging, konnte sie sich endlich auf ihr Gebet konzentrieren. Sie betrachtete das Kruzifix auf dem Altar. Larrivour war ein reiches Kloster und das Reliquienkreuz prunkvoll gestaltet. Gehämmertes Goldblech umhüllte Knochen des heiligen Alanus; die schmückenden Gemmen und Karfunkel glitzerten wie die Splitter eines Regenbogens, moosgrün und blutrot und himmelblau. Blanche bat den Heiligen, sich im Jenseits für ihren Mann einzusetzen. Cléments Seele sollte Frieden finden in Gottes Gnade – das wünschte sie sich mehr als alles andere.
Der Wind pfiff um die Kapelle, während ihr Blick auf dem Reliquienkreuz ruhte. Warum nur hatte sie Clément kein gesundes Kind geboren? Sie hatten sich so sehr einen Sohn oder eine Tochter gewünscht. Ein Kind hätte es gewiss leichter gemacht, den Schmerz zu ertragen. Denn ein Teil von Clément hätte in ihm weitergelebt. Aber Gott hatte ihnen diesen Wunsch nicht erfüllt.
Werde ich je Kinder haben?
Blanche ertappte sich dabei, dass sie über Germains Ratschlag nachdachte. Gott will, dass du einen Mann glücklich machst, hallten seine Worte in ihr nach. Natürlich hatte sie in Erwägung gezogen, wieder zu heiraten. Auch ihr Vater und Balian würden dies begrüßen, wobei sie Blanche niemals bedrängten und die Entscheidung ihr überließen. An Bewerbern mangelte es nicht. In den vergangenen drei Jahren hatten einige Männer ein Auge auf sie geworfen und ihr Glück versucht, darunter zwei oder drei, die eine gute Partie gewesen wären. Blanche hatte sie alle abgewiesen.
Keiner war wie Clément.
Natürlich war das ungerecht. Aber so fühlte sie nun einmal. Und während sie vor dem Kruzifix auf dem kalten Steinboden kniete, bezweifelte sie, dass sich das je ändern würde.
Blanche schloss die Augen und sprach ein weiteres Gebet, diesmal für ihren älteren Bruder. Sie vermisste Michel jeden Tag, aber anders als bei Clément war es ihr irgendwann gelungen, von ihm Abschied zu nehmen – loszulassen, wie Abbé Germain sagen würde. Vielleicht, weil die Liebe zwischen Geschwistern anders beschaffen war als die zwischen Mann und Frau.
Ihre Gedanken wanderten zu Balian, und sie beschloss, auch für ihn zu beten. Ihr Zwillingsbruder weilte auf dem Jahrmarkt von Troyes und konnte gewiss jeden Beistand gebrauchen, den Himmel und Erde zu bieten hatten. »Heiliger Alanus, bitte verhilf ihm zu guten Geschäften«, flüsterte sie. »Sende ihm gute Gelegenheiten und zahlungskräftige Kundschaft.«
Blanche öffnete die Augen und betrachtete das Reliquienkreuz. »Und bitte bewahre ihn davor, sich wieder in Schwierigkeiten zu bringen.«
Kalter Wind fegte über das Messegelände vor den Stadtmauern. Balian zog den Mantel enger um die Schultern, kniff die Augen zu Schlitzen zusammen und hielt nach dem Verkaufsstand Ausschau, den man ihm zugewiesen hatte. »Welchen Heiligen verehrt man in Troyes?«, fragte er Odet.
Sein Knecht musste nicht lange überlegen: Mit den Heiligen kannte er sich aus. »Mehrere, Herr«, erklärte er eifrig. »Da wäre zum Beispiel der heilige Patroclus. Aber man hat seine Gebeine schon lange fortgebracht, er zählt also nicht. Wichtiger ist die heilige Hulda. Auch die heilige Maura wird oft angerufen.«
»Dann bitte doch die heilige Maura, etwas gegen diesen scheußlichen Wind zu unternehmen.«
»Maura ist dafür leider nicht die Richtige, Herr«, belehrte ihn Odet. »Sie ist die Patronin der Wäscherinnen und Ammen. Ich fürchte, gegen kalten Wind kann sie nichts ausrichten.«
Balian bereute bereits, dass er gefragt hatte. »Dann eben die heilige Hulda.«
»Hulda würden wir um Beistand bitten, wenn uns Trockenheit oder Überschwemmungen zusetzen würden. Ich empfehle, dass wir uns an den heiligen Urban wenden. Er ist zuständig für Gewitter und Blitze und hat gewiss ein offenes Ohr, wenn wir uns über eisige Böen beklagen. Außerdem ist er der Patron von Troyes.«
»Fang am besten gleich an. Dieser Wind wird allmählich lästig.«
Sogleich bat der Knecht Urban um Beistand, während er den Ochsenwagen mit der Ware über das weitläufige Gelände steuerte. Odet war ein gedrungener Bursche mit einem ansehnlichen Bauch. Wenn er nicht gerade die Heiligen anrief, stopfte er Essen in sich hinein.
Odet war Balians letzter verbliebener Dienstbote, abgesehen von der Magd, die sich in Varennes um das Haus kümmerte. Alle anderen Diener hatte er längst entlassen – die finanziellen Nöte der letzten Jahre hatten ihn zu diesem Schritt gezwungen. Wenn kurzfristige Arbeiten anfielen, warb er billige Tagelöhner an. Auch zur Messe in Troyes begleiteten ihn drei Gehilfen, die Odet zur Hand gingen.
Sein Standplatz befand sich am äußersten Rand des Messegeländes, denn einen in günstigerer Lage konnte er sich nicht leisten. Die Wiese neben dem Weg war gelb und zertrampelt, unterhalb einer Böschung floss ein Bach. Balian wies Odet und die Tagelöhner an, die Salzfässer und Tuchballen abzuladen und die Ochsen zu tränken.
»Wäre es nicht besser, die Ware über Nacht im Speicher unterzubringen?«, gab der Knecht zu bedenken. »Bei diesem Wetter weiß man nie.«
Balian scheute die hohen Gebühren, die der Marktvogt für Lagerraum verlangte. Außerdem hatte er keine Lust, morgen in aller Herrgottsfrühe aufzustehen und die Handelsgüter bei Dunkelheit und Eiseskälte aufzubauen. »Es macht der Ware nichts aus, über Nacht hier zu stehen. Nach Regen sieht’s nicht aus.«
»Gewiss, Herr Balian«, sagte Odet wenig überzeugt. »Ich werde trotzdem den heiligen Bernard bitten, Unwetter von uns fernzuhalten.«
Während die Männer ihrer Arbeit nachgingen, beobachtete Balian die anderen Buden und Zelte. Obwohl der Novembermarkt in Troyes nicht eben zu den beliebtesten Champagnemessen zählte, war er gut besucht. Kaufleute aus ganz Frankreich waren da, außerdem Flamen, Deutsche und viele Lombarden. Er hoffte, ein bestimmtes Gesicht zu entdecken, eines, das er das erste und letzte Mal in London gesehen hatte, vor nunmehr dreieinhalb Jahren: das Antlitz des Kaufmanns, der in den Mord an Michel und Clément verwickelt war.
Balian hatte damals alles versucht, um die beiden Männer zu finden, den fremden Händler und den Ordensritter, jedoch ohne Erfolg. Sie hatten sich förmlich in Luft aufgelöst. In der Guildhall hatte man sie zwar gesehen, aber niemand kannte ihre Namen; niemand wusste, woher sie kamen. Auch den Stadtknechten, die Balian sogleich alarmiert hatte, war es nicht gelungen, sie aufzuspüren. Offenbar hatten die Mörder noch in derselben Nacht London verlassen und das Weite gesucht.
Aber Balian hatte ihre Gesichter gesehen und sich ihre Züge eingeprägt, er würde sie unter Tausenden wiedererkennen. Auf jedem Jahrmarkt in der Fremde, in jeder fernen Handelsstadt hielt er Ausschau nach dem Kaufmann, denn er war entschlossen, sich an ihm und seinem Ritterfreund zu rächen, die beiden Mörder zu bestrafen für ihr Verbrechen an seiner Familie.
Michel und Clément ruhten in der geweihten Erde von All-Hallows-the-Great, wo Balian sie begraben hatte. Anschließend war es an ihm gewesen, das Familiengeschäft zu führen – eine Aufgabe, die er manches Mal verfluchte. Das Unternehmen erschien ihm wie ein Klotz am Bein, wie eine Fußschelle, die ihn an ein Leben fesselte, für das er nicht geschaffen war. Handeln, die Bücher führen, gute Gelegenheiten erkennen – das war stets Michels Gebiet gewesen. Auch Balian konnte all das, wenn er musste, aber er konnte es lange nicht so gut wie sein Bruder. Doch er war ein Fleury, und das bedeutete Verpflichtungen. Man hatte Erwartungen an ihn, und Balian tat sein Bestes, sie zu erfüllen.
Leider war das nicht genug. Seit Jahren schrumpften die Einnahmen, während die Ausgaben wuchsen. Seit Michels Tod hatte Balian viel Pech gehabt, und sein legendäres Talent, falsche Entscheidungen zu treffen, hatte ein Übriges getan. Der Reichtum der Familie Fleury zerrann ihm zwischen den Fingern. Um das Unternehmen zu retten, hatte er nicht nur die Dienstboten entlassen müssen; er hatte zudem seinen Grundbesitz verkauft und die Handelsniederlassung in Speyer an seinen dortigen fattore Sieghart Weiß abgegeben. Diese Geschäfte hatten ihm einiges an Geld eingebracht … von dem inzwischen leider auch nicht mehr viel übrig war.
Aber das war die Vergangenheit. Balian blickte entschlossen in die Zukunft. Deshalb war er nach Troyes gekommen: um seine geschäftliche Misere zu beenden. Irgendwann musste das Glück einmal zu ihm kommen. Selbst die längste Pechsträhne war irgendwann vorbei.
Eines jedoch trübte seine Zuversicht: Früher ein Paradies für den Handel, verkamen die Champagnemessen mehr und mehr zu Zentren des Geldgeschäfts. Wechsler und Wucherer machten sich breit und verdrängten allmählich die Tuch-, Woll- und Gewürzhändler, die noch vor wenigen Jahren die Märkte der Grafschaft dominiert hatten. Früher konnte man in Troyes, Provins, Lagny-sur-Marne und Bar-sur-Aube mit Salz aus Varennes ein Vermögen verdienen. Inzwischen war das nicht mehr so leicht. Dennoch: Troyes war und blieb ein lukratives Ziel für Kaufleute aus Lothringen, und Balian würde die Möglichkeiten des Jahrmarktes zu seinem Vorteil ausschöpfen.
Michels Mörder war nirgendwo zu sehen. Das musste nichts heißen – die Messe war groß. Balian beschloss daher, auch in den nächsten Tagen nach ihm Ausschau zu halten. Irgendwann würde er ihn finden. Wenn nicht hier, dann anderswo. Er musste Gottes Gerechtigkeit vertrauen.
Wo bleibt Blanche?
Sie war seit jeher seine engste Vertraute, seine beste Freundin, seine Seelengefährtin. Von ihr getrennt zu sein erschien ihm unnatürlich, einfach falsch. Aber es gab keinen Grund, sich Sorgen um sie zu machen – Blanche konnte auf sich aufpassen. Sicher kommt sie bald.
»Wir sind fertig, Herr Balian«, sagte Odet.
Balian betrachtete die Warenstapel am Ufer des kleinen Bachs. Es dämmerte, der Markttag war so gut wie zu Ende. Die Aufseher machten bereits ihre Runden und ermahnten die Kaufleute, demnächst die Geschäfte einzustellen. Jetzt noch anzufangen lohnte nicht mehr. Da der Wind trotz Odets Heiligenanrufung nach wie vor heftig blies, entschied er: »Deckt alles mit Planen ab und bindet sie fest.«
»Wird gemacht!«
Balian fror, er war müde von der Anreise und sehnte sich nach Zerstreuung. Am Stadtrand gab es eine gemütliche Schenke mit angeschlossenem Freudenhaus, dort wollte er den Abend verbringen. »Baut das Zelt auf und lasst die Ware nicht aus den Augen«, befahl er den Männern. »Wenn meine Schwester auftaucht, sagt ihr, sie soll sich ein Quartier für die Nacht suchen und mich morgen am Stand treffen.«
»Wohin geht Ihr?«, fragte Odet.
»Das geht dich nichts an, mein Bester.«
»Aber wenn etwas passiert!«
»Dafür hast du doch deine Heiligen«, sagte Balian und schritt davon.
Der Wind wurde immer stärker, während Blanche westwärts ritt. Sturmböen fegten über das Flachland, peitschten die Bäume am Wegesrand und rissen an ihrem Mantel. Dennoch trieb sie ihr Pferd an, denn sie wollte vor Einbruch der Nacht in Troyes sein.
Normalerweise war es nicht ratsam für eine Frau, allein durch fremdes Land zu reiten, noch dazu mit einem kostbaren Buch im Gepäck. In dieser Gegend jedoch fühlte Blanche sich sicher. Während in Troyes Markt gehalten wurde, schützten die Ritter des Grafen von Blois die an- und abreisenden Kaufleute. Mehrmals begegnete sie schwer bewaffneten Reitern auf der Handelsstraße. Niemand würde es wagen, sie zu belästigen.
Gegen Abend endlich erblickte sie Troyes. Die Stadt lag am Ufer der Seine und wuchs wuchtig aus der Ebene. Mächtige Befestigungsanlagen umgaben Fachwerkhäuser und Paläste; über den Giebeln der fünfschiffigen Kathedrale brodelte der Himmel. Der Wind blies Blanche ins Gesicht und ließ ihren Umhang flattern wie ein Kriegsbanner, als sie zum Messegelände vor dem Stadttor ritt.
Böen rüttelten an den Buden und Verkaufsständen, trieben Wolken aus Staub vor sich her. Kaufleute und Marktbesucher hatten längst vor dem Sturm Schutz gesucht. Soeben hasteten der Marktvogt und seine Männer zum Stadttor und hielten ihre Mützen fest. Balian und Blanche hatten sich am frühen Morgen getrennt; ihr Bruder musste längst hier sein. Vermutlich hatte er die Ware untergestellt und dann in einer Herberge Quartier bezogen. Als sie gerade beschloss, in der Stadt nach ihm zu suchen, bemerkte sie mehrere Gestalten auf dem verlassenen Gelände. Sie kniff die Augen zusammen. War das Odet? Ja, kein Zweifel.
Blanche schlug ihrem Pferd die Absätze in die Flanken.
Der Wind riss an Balians Zelt und hätte es längst fortgeweht, wenn die Tagelöhner die Seile nicht mit aller Kraft festgehalten hätten. Überall lagen verstreute Tuchballen. Der Fässerstapel am Ufer des Bachs schwankte bedenklich.
»Frau Blanche!«, schrie Odet, der verzweifelt versuchte, die Ochsen einzuspannen.
»Wieso habt ihr die Ware nicht in den Speicher gebracht?«, brüllte sie gegen den Sturm an.
»Herr Balian – er wollte es so!«
»Wo ist er?«
»Keine Ahnung!« Odet zerrte an einem Ochsen, doch das verängstigte Tier weigerte sich, auch nur einen Schritt zu tun.
Blanche schwang sich aus dem Sattel und wurde fast von den Böen umgerissen. »Baut sofort das Zelt ab«, rief sie den Tagelöhnern zu. »Dann ladet die Ware auf den Karren. Du suchst meinen Bruder«, befahl sie Odet.
Geduckt rannte der Knecht los.
»Ich bring dich um, Balian«, zischte Blanche und bekam einen Tuchballen zu fassen, der über die Wiese rollte. Sie hörte einen Schrei und sah, dass einer der Tagelöhner gestürzt war. Das Zelt neigte sich zur Seite, die Stangen knickten um, und die Plane löste sich. Der Wind wehte sie gegen den Fässerstapel, der daraufhin umkippte.
»Nein«, ächzte Blanche.
Sie spürte Regentropfen im Gesicht. Im nächsten Moment begann es sintflutartig zu schütten.
Balian musste eingenickt sein, denn als er zu sich kam, war der Kienspan heruntergebrannt. Er lag im Stroh, es war wohlig warm unter den Decken und Fellen; warm war auch der Körper der Dirne, die sich an seinen nackten Leib schmiegte. Er öffnete die Augen nicht weiter als einen Spalt, denn er war erschöpft vom Liebesakt, sein Verstand war benebelt vom Wein, und er wollte noch nicht aufstehen. Er lag in den Armen einer Frau und wollte das schläfrige Gefühl und die Glückseligkeit noch eine Weile genießen.
Draußen heulte die Nacht. Sturm, dachte Balian schlaftrunken, Sturm ist nicht gut, und eine leise Stimme tief in seinem Innern empfahl ihm, rasch etwas zu unternehmen. Nur was? Und weswegen? Er wusste es nicht und sank zurück in die selige Benommenheit des Halbschlafes. Noch ein wenig entspannen. Die nächsten Tage werden hart.
Irgendwann vernahm er eine aufgeregte Stimme. Schwere Schritte stampften durch das Hurenhaus.
»Herr Balian!«, rief jemand. »Seid Ihr da?«
Die Dirne reckte den Kopf und knuffte ihn in die Seite. »Wach auf«, sagte sie schroff.
Balian blinzelte und zupfte sich Stroh aus dem Haar. Da flog die Tür auf, und Odet stürzte in die Kammer.
»Herr!«, rief er atemlos. »Ihr müsst sofort mitkommen. Der Sturm! Er hat alles weggeweht!«
»Was?«, murmelte Balian.
»Die ganze Ware! Sie ist dahin, wenn wir nichts tun!«
Schlagartig war Balian nüchtern. Er sprang auf, schlüpfte in Gewand und Schuhe und hastete hinter Odet die Treppe hinab.