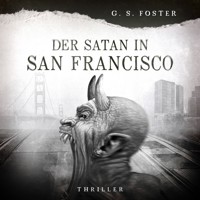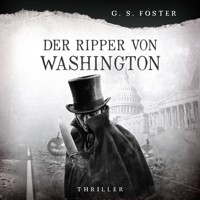Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Um eine Schreibblockade zu überwinden, zieht sich der Schriftsteller Xander Ripley in einen verlassenen Leuchtturm vor der Küste Neuenglands zurück. In der stillen Abgeschiedenheit hofft er, Zeit und Muße für seinen längst überfälligen Roman zu finden. Doch isoliert zwischen Klippen und Gezeiten erwartet Xander der pure Horror. Die triste Einsamkeit des Ortes zehrt schnell an seinen Nerven und treibt ihn an den Rand des Wahnsinns. Bald ist für ihn an Schreiben nicht mehr zu denken, denn er fürchtet um sein Leben. Als der Autor im nahe gelegenen Küstenstädtchen Cape De Ville der unheimlichen Geschichte des Leuchtturms auf den Grund geht, kommt er hinter ein düsteres Geheimnis: Ein unbekanntes Grauen sucht den Ort seit Ewigkeiten heim und hat sich nun auch an Xanders Fersen geheftet …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DAS GRAUEN VON CAPE DE VILLE
THRILLER
G. S. Foster
Inhalt
Logbuch von James Tucker
Prolog
Teil I
Teil II
Teil III
Teil IV
Epilog
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
© 2025 Blitz Verlag
Ein Unternehmen der SilberScore Beteiligungs GmbH
Andreas-Hofer-Straße 44
6020 Innsbruck - Österreich
Redaktion: Danny Winter
Coverdesign: Giessel Design
www.giessel-design.de
unter Verwendung mehrerer Bilder von Shutterstock
Alle Rechte vorbehalten
eBook Satz: Gero Reimer
www.BLITZ-Verlag.de
ISBN 978-3-68984-411-0
7033 vom 28.04.2025
Für H. P. Lovecraft
„The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown.“
Howard Phillips Lovecraft
Auszug aus dem Logbuch von James Tucker, dem letzten Leuchtturmwärter von Cape De Ville
Freitag, 13. Mai 1927
23:47 Uhr
Ich halte es nicht mehr aus!
Keine Sekunde länger kann und will ich die stickige Luft dieses verfluchten Turms atmen! Wieso bloß habe ich nicht auf meine Kinder gehört? Statt mich stur auf meine Pflichten im Lampenraum zu konzentrieren, hätte ich lieber diesen elendigen Riss schließen sollen. Dann wäre es nie so weit gekommen. Doch für Einsicht ist es zu spät. Für Rettung ist es zu spät …
Während draußen der Sturm kein Ende findet, spüre ich, wie der Tod seine kalten Klauen nach meiner Familie und mir ausstreckt. Der Turm zehrt an meinen Kräften und saugt mich bis aufs Blut aus. Noch mehr als mein Körper leidet mein Geist. Einfach alles in diesen beengten, gewundenen Mauern raubt mir den Verstand. Was ist wahr? Was ist Einbildung? Ich vermag den Unterschied nicht mehr zu erkennen.
An Isolation und Einsamkeit habe ich mich im Lauf der Jahre als Wärter vieler Leuchttürme entlang der Küste von Massachusetts gewöhnt. Aber was sich in den letzten Tagen und Nächten hier vor den Klippen Cape De Villes abgespielt hat, bringt mein Nervenkostüm stärker ins Wanken als der Orkan diesen Leuchtturm.
Das Grauen ist real! Ja, daran besteht kein Zweifel. Ebenso wie die Stimmen, die meine Familie und mich entzweit haben. Die Stimmen, die mich … die uns alle in den Wahnsinn treiben.
Er will mich, aber er kriegt mich nicht!
Trauer erfüllt mich bei dem tragischen Gedanken, dass wir nur noch wenige Wochen hätten durchhalten müssen. Dann hätte man die Lampe des Turms elektrifiziert und ich wäre mit meiner Frau und meinen Kindern erlöst worden. Nun muss ich selbst für unsere Erlösung sorgen. Auch wenn das bedeutet, dass ich vor den Augen des Herrn die schlimmste Sünde begehe. Doch die Stimmen lassen mir keine Wahl. Ich muss es tun! Lieber früher als später, bevor ich diesen Gedanken nicht mehr fassen und mein Vorhaben in die Tat umsetzen kann.
Da! Ich höre sie. Sie hämmern wieder gegen die Tür. Die Schläge ihrer Fäuste werden nur von ihrem Schreien, Jammern, Flehen übertönt. Aber ich werde die Tür nicht öffnen. Ich kann es nicht! Darf es nicht …
Der Herr ist mein Zeuge, und er möge mir verzeihen. Meine Familie möge mir verzeihen. Doch die Stimmen erlauben es mir nicht!
Ich schließe diesen Eintrag mit der Gewissheit, dass meine Schicht als Leuchtturmwärter ebenso vorbei ist wie mein Leben als Ehemann und Vater. Wenn ich ein letztes Mal die steinerne Wendeltreppe beschreite, die sich wie ein gigantischer Korkenzieher direkt in den Abgrund meines Verderbens bohrt, werde ich in aller Augen bloß noch eines sein: ein grausamer Mörder.
Prolog
Skip
Cape De Ville, Massachusetts
Weihnachten 1953
„Das ist einfach nicht fair! Ausgerechnet am Weihnachtsabend. Wer macht denn so was?“
„Willst du Gerechtigkeit? Die ist nur Leuten mit Job und festem Wohnsitz vorbehalten.“
„Solange wir die Drecksarbeit erledigt haben, waren wir gut genug. Und jetzt? Zwanzig Dollar und einen Arschtritt als Lohn. Pah! Nicht mal ein scheiß Danke gab es für uns.“
„Du klingst beinahe überrascht. Dabei weißt du doch genau, wie unser Geschäft funktioniert.“
Das sogenannte Geschäft der Freunde Skip und Jackson bestand seit einigen Jahren darin, als Tagelöhner durchs Land zu ziehen, nach Arbeit zu suchen und sich ein paar Dollar für eine warme Mahlzeit und ein Bett für die Nacht zu verdienen. Es war ein schmutziges und hartes Geschäft, aber Skip und Jackson hatten ohne Schulabschluss und Ausbildung keine andere Wahl. Obwohl die Volkswirtschaft der Vereinigten Staaten seit Ende des Zweiten Weltkrieges boomte und der Übergang von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft in einer hohen Beschäftigungsquote gipfelte, hatten ungelernte Hilfskräfte einen schweren Stand.
Vor ein paar Jahren hatten Rüstungskonzerne wie Boeing oder Cessna aufgrund der hohen Nachfrage an Flugzeugen jeden Mann eingestellt, der aufrecht am Fließband stehen und Teile zusammennieten konnte. Ganz gleich, ob er zuvor die Schule mit einem Diplom oder – wie in Skips Fall – nach der achten Klasse mit einem Verweis verlassen hatte. Doch seit der Krieg vorbei war, ließen die Flugzeughersteller ihre ungelernten Arbeiter fallen wie die Kampfflugzeuge die Bomben über Deutschland. Deshalb waren Skip und Jackson mit Mitte zwanzig auf der Straße gelandet.
Skips Meinung nach war das Leben als Tagelöhner nicht per se schlecht. Da er stets versuchte, aus jeder Situation etwas Positives zu ziehen, sah er in seinem ungebundenen Dasein die Möglichkeit, spannende Orte zu besuchen und interessante Menschen kennenzulernen. In seinen Augen war es ein Abenteuer, im Sommer nach einem langen Arbeitstag unter dem Sternenhimmel am Fuß eines Baumes zu schlafen und selbst gefangenen Fisch über dem Lagerfeuer zu grillen. Die Schattenseiten des Lebens als Tagelöhner zeigten sich meist erst im Winter – besonders, wenn er so hart war wie in diesem Jahr. Dann war es zu gefährlich, im Freien zu schlafen, und zu mühsam, auf zugefrorenen Seen zum Angeln Löcher ins Eis zu hacken. Im Winter stiegen die Preise für Lebensmittel und Unterkünfte, und weil ihr hart verdientes Geld dann meist kaum ausreichte, gingen nicht selten die im Sommer ersparten Rücklagen drauf.
Weil dieser Winter die Ostküste schon wochenlang fest in der Zange hielt, waren die Freunde inzwischen pleite.Bloß hatte Skip, der zwei Jahre länger als Jackson eine Schulbildung genossen hatte und deswegen ihre Finanzen überwachte, dies seinem Freund noch nicht gebeichtet.
Seit Anfang November lagen die Temperaturen Tag wie Nacht unter dem Gefrierpunkt. Hinzu kamen der beinahe tägliche Schneefall und Stürme, die einem die Flocken über das Gesicht trieben wie Schmirgelpapier. Wer keine Erfrierungen in Kauf nehmen wollte, hielt sich nach Sonnenuntergang nicht länger als nötig im Freien auf.
Skip und Jackson jedoch irrten an diesem Abend schon seit über einer Stunde durch die Straßen des Küstenstädtchens Cape De Ville. Die Kälte hatte bereits die drei Schichten von Skips abgetragener, löchriger Kleidung durchdrungen und war bis in seine Finger- und Zehenspitzen gekrochen.
Skip war nicht unbedingt fromm erzogen worden, fragte sich aber unentwegt, welcher gehässige Gott zwei fleißige Arbeiter gerade an Heiligabend, der Geburtsstunde Jesu Christi, mit dem schwersten Blizzard seit Jahren strafte. Noch unbarmherziger als Gott war der Fischer Edgar Brooks, dessen Boot Skip und Jackson eine Woche lang von früh bis spät repariert, gestrichen und auf Vordermann gebracht hatten. Trotz ihrer guten Arbeit hatte er ihnen nicht einmal erlaubt, eine weitere Nacht im Bootshaus unten am Hafen zu schlafen.
„Brooks’ Herz muss noch kälter sein als die heutige Nacht“, sagte Jackson, als könnte er Skips Gedanken lesen. Er schlug den Kragen seines zu engen Pelzmantels hoch, den er von einer Frau in New York City geschenkt bekommen hatte, pustete sich in die Hände, die in zwei verschiedenfarbigen Handschuhen steckten, und schob sie sich dann wieder in die Achselhöhlen. „Und du bist dir sicher, dass wir uns nicht einfach zurück in sein Bootshaus schleichen sollen? Er wird ja kaum die ganze Nacht unten am Hafen Wache …“
„Das Gewehr, mit dem er uns vorhin den Weg gewiesen hat, macht mir diese Entscheidung relativ einfach“, erklärte Skip und klopfte sich auf die Brust, damit die Schneeschicht herunterfiel, die sich auf seiner Jacke gebildet hatte.
Unerbittlich peitschte der pfeifende Wind die Schneeflocken beinahe waagerecht durch die Straßen. Da Cape De Ville an der Spitze einer vorgelagerten Landzunge an der Küste lag, traf der Wind vom Atlantik ungebremst und unbarmherzig auf die Stadt.
„Und was schlägst du dann vor?“ Jackson rückte sich seine Pelzmütze zurecht. „Lange halten wir das hier draußen nicht mehr aus.“
„Ach, was du nicht sagst“, knurrte Skip und schielte neidisch auf die Mütze, denn er trug nur ein Basecap, das seine Ohren dem Blizzard zum Fraß vorwarf.
Nach ihrem Rauswurf bei Brooks waren sie direkt zur örtlichen Pension gegangen, um ihre hart verdienten zwanzig Dollar in ein warmes Zimmer zu investieren. Leider war die Herberge wegen der vielen Gäste, die ihre Familienmitglieder in Cape De Ville über die Feiertage besuchten, komplett ausgebucht. Daher waren sie in der letzten Stunde durch ein von Lichterketten und Deko-Weihnachtsmännern bevölkertes Cape De Ville gestreift, hatten an unzähligen festlich verzierten Türen geklopft und um Asyl gebeten. Doch jedes Mal waren sie abgewiesen worden – wenn man ihnen überhaupt die Tür geöffnet hatte. Niemand wollte sich mit zwei Tagelöhnern herumärgern. Nicht einmal am Heiligen Abend.
Sie kamen an einem Garten vorbei, in dem die Schnauze eines Hundes aus einer verschwenderisch großen Hundehütte herausragte. Skip und Jackson blieben kurz stehen und bestaunten die trockene Hütte wie zwei hungrige Tiere ein Stück Fleisch.
„Da würden wir beide sowieso nicht zusammen reinpassen“, sagte Skip und ging seufzend weiter.
Sie schlurften durch den Schnee, den der Wind hinter den Gartenzäunen einer Häuserreihe kniehoch aufgetürmt hatte. Da Skip zwei Köpfe größer war als Jackson, ging er voraus und bahnte ihnen mit ausholenden Bewegungen des Oberkörpers einen Weg durch die Verwehungen. Mit jedem Schritt rieselte Schnee in seine Stiefel, schmolz blitzschnell durch die Wärme seiner Füße und tränkte die gestopften Wollsocken, von denen Skip je zwei an jedem Fuß trug. Eine neuerliche Gänsehaut überkam ihm, gefolgt von einer plötzlichen Müdigkeit und dem Wunsch, sich direkt hier an Ort und Stelle hinzulegen und zu schlafen.
„… klar doch! … ist es! … sind gerettet!“ Jacksons Worte gingen in dem Fauchen des Sturms teilweise unter, aber Skip verstand genug, um aus seiner frostigen Lethargie zu erwachen.
Er sah zurück über seine Schulter. „Was hast du denn?“
Jackson verließ den von Skip geebneten Pfad und trat in den Schnee gleich neben ihm. „Ich habe uns soeben das Apartment mit der besten Aussicht in der ganzen Stadt gebucht. Und es ist sogar kostenlos.“ Er deutete geradeaus auf einen Punkt irgendwo im Schneegestöber vor ihnen.
Skip kniff die Augen zusammen, um zu erkennen, was sein Freund meinte. Dann sah er die rote Spitze des Leuchtturms oberhalb von Cape De Ville hinter der Klippe hervorragen.
„Der alte Leuchtturm?!“
„Bingo.“ Jackson zeigte mit dem rechten Daumen nach oben.
Skip schüttelte den Kopf. „Keine Chance, da gehe ich nicht rein!“
„Wieso nicht?“
„Ich …“ Skip schluckte und suchte nach Worten. Er hatte seine Gründe, diesen Leuchtturm zu meiden, aber die konnte er Jackson unmöglich auf die Nase binden. Denn er wusste, dass sie albern klangen.
„Das … wäre Einbruch“, schob er als Ausrede vor. „Und wir … wir sind keine Kriminellen. Das können wir nicht tun.“
Jackson winkte ab. „Bei so einem Blizzard würden wir sicher mildernde Umstände bekommen. Außerdem: Wer soll uns denn erwischen? Solange dieser Sturm tobt, geht eh niemand freiwillig vor die Tür. Und morgen früh sind wir über alle Berge, bevor jemand etwas mitbekommt.“
„Aber …“, wollte Skip widersprechen, doch ihm fiel kein weiteres Argument ein.
„Gut, dann knobeln wir es aus“, schlug Jackson vor und streckte eine geballte Faust für eine Runde Schere, Stein, Papier aus.
„Das ist doch … Dafür haben wir keine Zeit.“ Skip seufzte.
„Genauso wenig wie für diese ganze Diskussion.“
„Also schön.“ Skip verdrehte die Augen und ballte seine Hand, was ihm bedenklich schwerfiel, da seine Finger steif gefroren waren.
Es wird wirklich Zeit, dass wir ins Warme kommen, dachte er beunruhigt. Aber muss es gerade dieser Leuchtturm sein?
Er war beinahe gewillt, seinem Freund einen Einbruch in eine Garage oder eine Gartenlaube vorzuschlagen, um ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Doch schon schwang Jackson die Faust hin und her, und Skip tat es ihm gleich.
„Schere, ha!“ Jackson lachte und schob seinen gespreizten Zeige- und Mittelfinger über Skips flache Hand. „Beim nächsten Mal hast du sicher wieder mehr Glück. Jetzt lass uns endlich von hier verschwinden.“
Obwohl Jackson fast bis zur Hüfte im Schnee versank, ging er voran. Als er merkte, dass Skip ihm nicht folgte, drehte er sich um. „Ich habe das Spiel gewonnen.“
„Mir ist die Sache einfach nicht geheuer“, brummte Skip und sah ein, dass er seinem Freund die Wahrheit sagen musste. Anders war er nicht aufzuhalten. „Ich … ich habe allerhand Geschichten über den Leuchtturm gehört.“
Jackson legte den Kopf schief. „Was denn für Geschichten?“
„Na ja …“ Skip griff mit beiden Händen in den Schnee und formte etwas davon zu einer Kugel. „Während du dich um den Anstrich des Rumpfes gekümmert hast, habe ich doch mit Brooks den Bootsmotor auseinandergenommen. Dabei hat er mir einige Dinge über Cape De Ville erzählt. Unter anderem auch, dass es bei den Bauarbeiten des Leuchtturms zu seltsamen Unfällen gekommen sei. Dass einige der Leuchtturmwärter durchgedreht wären. Und dass der letzte Wärter sogar seine ganze Familie umgebracht haben und jetzt als Geist im Turm herumspuken soll.“
„Aha.“ Jackson schaffte es, zwei Sekunden ernst zu bleiben, bevor er den Kopf in den Nacken warf und laut loslachte. „Scheiße, Mann. Sag mir bitte nicht, dass du ihm diese Geschichten abkaufst? Das ist nur dummes Gerede. Brooks hat dich verarscht.“
„Wieso sollte er das tun?“
„Was weiß denn ich? Vielleicht hast du dich beim Zusammenbau des Motors besonders dumm angestellt.“
„Ich denke …“
„Weißt du, was ich denke? Dass ich mich lieber irgendwelchen angeblichen Geistern in dem Leuchtturm da drüben stelle, als hier draußen zu erfrieren.“ Skip öffnete den Mund, um erneut zu widersprechen, doch Jackson schnitt ihm mit dem ausgestreckten Zeigefinger das Wort ab. „Pass mal auf. Wir gehen jetzt dort rein, warten diesen Sturm ab und schlagen uns dann nach Süden durch. Ins Warme. Das hätten wir schon im November tun sollen.“
„Hey, wir waren uns einig, dass wir den Job in der Fabrik in Boston bis zum Schluss durchziehen. Immerhin gab es dafür gutes Geld“, verteidigte sich Skip.
„Ja, mag sein. Aber wir waren uns nicht einig, dass wir danach weiter nach Norden ziehen. Das war allein deine Entscheidung, Skip! Und wieso? Weil du bei Schere, Stein, Papier gewonnen hattest. Jetzt bin ich der Sieger und entscheide, was wir tun.“ Jackson fuhr herum und kämpfte sich weiter durch den Schnee.
* * *
In Jacksons Augen hatten sie Glück. Skip betrachtete es eher als Pech, dass um diese Uhrzeit Ebbe herrschte und sie trockenen Fußes über einen felsigen Weg hinüber zum Leuchtturm gelangten. Dieser lag etwa zweihundert Yards vor der Steilküste und war wegen seiner roten Spitze im Schneesturm gut zu erkennen.
Bevor sie die schmale, senkrecht abfallende Treppe zum Wasser hinabstiegen, die grob in den Fels der Klippe gehauen war, blickte Skip noch einmal wehmütig zurück. Die Häuser und Straßen von Cape De Ville erstrahlten unterhalb von ihnen wie eine festliche Kleinstadt auf einer kitschigen Weihnachtskarte. Der Kontrast zu der einsamen Dunkelheit hier oben auf der Klippe hätte nicht größer sein können.
Skip und Jackson konnten sich kaum auf den Beinen halten, als sie sich an den Abstieg hinunter zum Meer machten. Hier oben biss einem der Wind noch stärker in die Haut und kam Skip viel kälter vor. Durch den Schnee und die vom Wind entfesselte See waren die Felsen nass und glitschig, und Skip rutschte einmal aus und versenkte einen Stiefel im Atlantik. Aber seine Socken und Füße waren bereits so nass und kalt, dass er keinen Unterschied spürte.
„Wir haben doppelt Glück“, stellte Jackson fest, nachdem sie den Leuchtturm auf seinem felsigen Plateau erreicht hatten und eine Treppe betraten, die hinauf zum Turm führte. „Sieh mal da. Die Tür steht offen.“
Tatsächlich schwang die eiserne Eingangstür im Sturm quietschend auf und zu und erweckte den Eindruck, als winkte der Leuchtturm sie zu sich. Als sie näher kamen, erkannten die Freunde, dass die Tür nicht wirklich offen stand. Sie besaß kein Schloss, war allerdings mit einer Eisenkette gesichert, was der Tür einige Bewegungsfreiheit im Wind ermöglichte.
„Da sollten wir doch durchpassen, oder?“
Jackson stellte seinen Rucksack ab und drückte die Tür nach innen, bis die Kette aufs Äußerste gespannt war. Es entstand ein etwa drei Handbreit weiter Spalt, durch den er sich hindurchzwängte. Sofort verschluckte ihn die Dunkelheit hinter der Tür.
„Jackson?“ Skip trat einen Schritt näher an die Tür und reckte den Hals, aber sah nichts als endlose Schwärze durch den Spalt. „Jackson? Alles klar?“
Sein Herz raste, und zum ersten Mal, seit sie von Brooks vor die Tür gesetzt worden waren, fror er nicht mehr. Im Gegenteil – das Adrenalin trieb ihm tatsächlich den Schweiß aus den Poren.
„Gib mir unsere Taschen, dann kannst du nachkommen.“
Jacksons Gesicht erschien hinter der Kette. Er steckte eine Hand durch den Spalt, woraufhin Skip ihm nacheinander ihre beiden Rucksäcke gab. Da sie stets mit leichtem Gepäck reisten und über wenig Besitz verfügten, waren die Taschen nicht allzu voll und sie konnten sie zusammenknautschen, damit sie besser hindurchpassten. Nicht ganz so leicht ging es bei Skip, der nicht nur größer, sondern auch breiter war als Jackson und sich beim Betreten des Leuchtturms den Rücken am Türrahmen aufkratzte.
„Au! Shit.“
„Pass doch auf.“
„Was glaubst du, was ich hier mache?!“ Skip biss die Zähne zusammen, rutschte unsanft das letzte Stück hindurch und landete vor Jackson auf den Knien.
„Na also. Ging doch leichter als gedacht“, sagte dieser und half Skip hoch.
„Ja, ein Kinderspiel.“ Kaum war Skip auf den Beinen, öffnete er seine Jacke, denn obwohl es überall im Leuchtturm pfiff und fauchte, war es hier drinnen überraschend warm.
„Ganz schön kuschelig“, stellte auch Jackson fest, setzte sich die Mütze ab und zog seine Handschuhe aus, bevor er aus seinem Rucksack eine Taschenlampe herausholte. „Es kommt uns sicher so warm vor, weil wir ewig draußen in der Eiseskälte ausgeharrt und uns daran gewöhnt haben.“
„Hm.“ Skip deutete auf Jacksons Schultern. „Und wieso schmilzt dann schon der Schnee auf deinem Mantel? Oder willst du mir sagen, dass du so stark schwitzt?“
Jackson untersuchte im Schein der Taschenlampe den sekündlich weniger werdenden Schnee auf seiner Kleidung und zuckte mit den Schultern. „Lieber zu warm als zu kalt.“ Er drehte sich einmal um die eigene Achse und suchte den Raum mit der Taschenlampe ab. „Ah, da haben wir die Treppe.“ Er erklomm die ersten ausgetretenen Stufen einer gewundenen Steintreppe.
„Wo willst du denn hin?“, rief Skip ihm nach.
„Na, uns einen Schlafplatz suchen.“
„Dort oben?“
„Glaubst du, ich schlafe gleich neben der offen stehenden Tür wie ein räudiger Hund? Vielleicht finden wir in den oberen Etagen ein Bett oder ein paar Decken oder so. Außerdem riecht es hier unten irgendwie komisch.“
Skip atmete durch die Nase ein und bemerkte tatsächlich einen fauligen Gestank.
Fehlt noch, dass wir hier irgendein totes Tier finden, dachte er und fühlte sich mit jeder Sekunde unbehaglicher.
„Pass auf den Riss dort im Boden auf. Nicht dass du noch darüber stolperst.“
Kurz bevor Jackson um die Biegung der Wendeltreppe verschwand und mit ihm die einzige Lichtquelle, sah Skip direkt vor seinen Füßen einen handbreiten Spalt, der den runden Betonboden zur Hälfte durchzog. Er machte einen Schritt darüber und folgte seinem Freund widerwillig die Treppe hinauf.
Je höher sie im Turm kamen, desto lauter wurde das Tosen des Windes, der durch die undichten Fenster und Risse in den Wänden strömte und schaurige Geräusche erzeugte. Mal klang es wie das verstohlene Flüstern zweier Personen, mal wie das Heulen eines Wolfes. Nichts davon steigerte Skips Lust, die Stufen weiter zu erklimmen. Aber da er nicht mitten auf der Treppe im Dunkeln zurückbleiben wollte, musste er in Jacksons Nähe bleiben.
Als sie den Raum auf der nächsten Etage erreichten, fiel Skip auf, dass die Luft hier oben viel klarer und frischer wirkte. Natürlich roch es in dem gesamten Leuchtturm modrig und nach Schimmel, doch der faulige Gestank war fast verschwunden. Dafür war es hier oben allerdings wieder kühler, denn kleine Wölkchen bildeten sich vor Skips und Jacksons Mündern, wenn sie ausatmeten.
„Du willst aber nicht ganz nach oben, oder?“, fragte Skip.
Selbst hier in der ersten Etage war schon deutlich zu spüren, wie der gesamte Turm durch den Blizzard bebte und schwankte. Skip befürchtete, dass die Mauern, die laut Mr. Brooks’ Erzählung im Jahr 1890 hochgezogen worden waren, nach dem jahrzehntelangen Kampf gegen Gezeiten und Elemente gerade heute Nacht aufgeben und zusammenbrechen würden. Trotz alledem beunruhigte ihn dieser Gedanke weniger als Brooks’ andere Geschichten, die in seinem Kopf herumspukten.
„Gut, dann hauen wir uns eben hier hin.“ Jackson deutete mit der Taschenlampe auf eine Stelle direkt unter einem der schmalen Fenster. „Dort dürfte es wohl windgeschützt sein. Ein Bett oder so sehe ich hier leider nicht.“ Er ließ seinen Rucksack von der Schulter gleiten und gab ihn Skip. „Hier, schüttele doch schon mal mein Kopfkissen auf, Darling.“
„Und was machst du derweil?“
„Ich muss pissen.“
„Aber bitte nicht hier.“
„Keine Sorge. Ich verschwinde noch mal vor die Tür.“
„Mit der Taschenlampe?“ Skip schluckte bei der Aussicht, hier oben allein in der Finsternis zurückzubleiben.
„Nein, nein. Ich will die Treppe im Dunkeln hinunterstolpern und mir auf gut Glück auf die Schuhe pissen. Natürlich nehme ich die Lampe mit! Setz dich einfach hin und halt die Füße still.“
„Warte! Du kannst mich doch nicht einfach hier …“
Ehe Skip seinen Protest ausformulieren konnte, war Jackson schon die Treppe hinunter verschwunden. Das Licht der Taschenlampe ging mit ihm.
Bevor die Finsternis ihn verschluckte, huschte Skip schnell hinüber zu der Wand, warf die Rucksäcke zu Boden und ließ sich daneben im Schneidersitz nieder. Der aus Beton gegossene Untergrund war eiskalt, weshalb Skip seinen Hintern hob und seinen Rucksack darunter schob.
Unten an der Tür rasselte die Kette, als sich Jackson nach draußen zwang. Dann kehrte Stille ein.
Erschöpft von der langen Arbeit an Brooks’ Boot, dem Marsch durch den Schnee und begünstigt durch die Dunkelheit im Leuchtturm, fielen Skip die Augen zu. Er wachte erst wieder auf, weil es einen lauten Schrei gab und der Leuchtturm zu beben schien. Erschrocken fuhr er mit dem Rücken an der Wand hoch und hielt sich schützend seinen Rucksack vor die Brust. Wie Espenlaub zitternd stand er reglos da und lauschte in die Dunkelheit, hörte jedoch nichts außer den Sturm draußen vor der Küste.
„Jackson?“, fragte er, aber erhielt keine Antwort.
Wie lange war Skip eingenickt gewesen? Hätte sein Freund nicht längst zurück sein müssen?
„Ist alles klar bei dir?“, rief er in die Dunkelheit hinein.
Noch immer keine Antwort. Auch keine Schritte. Nichts.
„Scheiße!“, fluchte Skip leise. Jede Faser seines Körpers sträubte sich dagegen, sich von diesem Ort wegzubewegen, doch er musste nach Jackson sehen.
Den Rucksack wie einen Schutzschild vor sich haltend, setzte er einen Fuß vor den anderen und rutschte Stück für Stück über den Boden, bis er glaubte, die Wendeltreppe erreicht zu haben. Oder waren es doch drei Schritte mehr? Was, wenn er einen Fuß ins Leere setzte, fiel und sich das Genick brach?
Bevor er überlegte, dieses Risiko einzugehen, hörte er einen erneuten Schrei, der ihm so durch Mark und Bein ging, dass er seinen Rucksack erschrocken fallen ließ. Bis eben hatte Skip geglaubt und gehofft, dass Jackson ihm einen Streich spielte und in der Dunkelheit erschrecken wollte. Aber als er seinen Freund jetzt unten jammern und um Hilfe winseln hörte, begriff Skip, dass das hier kein Scherz war. Jackson steckte in Schwierigkeiten.
„Halte durch, Kumpel! Ich komme“, rief Skip. Er klang nicht allzu selbstsicher, hoffte allerdings, dass seine Worte bereits ausreichen würden, um einen Angreifer in die Flucht zu jagen.
Was, wenn der Turm noch jemand anderem als Unterschlupf dient?, fragte er sich, streckte sein Bein aus und ertastete mit der Schuhspitze die oberste Stufe.
Er setzte seinen Fuß darauf und suchte sich mit dem anderen Bein die zweite Stufe. Auf diese Weise bewegte er sich zögerlich die Treppe hinunter, bis plötzlich der Lichtschein der Taschenlampe hinter einer Biegung auftauchte. Da Skip jetzt die Umrisse der Treppe vor sich sah, wurde er schneller und nahm die Stufen beinahe im Eiltempo, bis er seinen Freund entdeckte. Dessen Winseln war verstummt. Dafür entfuhr nun Skips Kehle ein langer, schriller Schrei, entstanden aus nackter Panik.
Niemand in Cape De Ville hörte den Todeskampf der beiden Freunde im Leuchtturm. Der Blizzard verschluckte ihr verzweifeltes Flehen im Angesicht des grauenvollen Todes.
Teil1
Die Gestalt
Cape De Ville, Massachusetts
Vor ein paar Jahren
Der dunkelblaue Van bahnte sich langsam seinen Weg hinauf zum Aussichtspunkt von Candle Tommy.
Obwohl der Leuchtturm seit dem Jahr 1948 außer Betrieb war, hatte sich sein inoffizieller Name bis heute gehalten. Zumindest bei den Einheimischen. Diese wisperten ihn allerdings bloß hinter vorgehaltener Hand und mieden ihn ebenso wie den Aussichtspunkt oben am Rand der Steilküste.
Auch Touristen oder Leute von außerhalb verirrten sich nicht hierher. Jedoch nicht aus Angst, sondern weil es entlang der Küste von Neuengland schönere, weitaus bekanntere und leichter zu erreichende Leuchttürme gab, die eine bessere Sicht auf den Atlantik boten als das Fleckchen Erde oberhalb von Cape De Ville.
Deswegen kümmerte sich niemand um die geschotterte Zuwegung hinauf zum Aussichtspunkt. Deswegen störte es niemanden, dass überall auf dem Weg Unkraut wucherte. Und deswegen scherte sich niemand um die Spurrinnen und Löcher, die der Regen im Lauf der Jahre hinterlassen hatte.
Nur eine Gestalt verschlug es regelmäßig hierher. Sie saß hinter dem Steuer des Vans und fuhr ihn mit einer Hand, während sie die Finger der anderen im Mund hatte und sich die bereits schmerzhaft kurzen Nägel weiter abkaute.
Obwohl sich der Van durch seine dunkle Farbe und die schwarz lackierten Felgen perfekt in das Dunkel der Nacht einfügte und gut getarnt war, ging die Gestalt wie immer auf Nummer sicher und verzichtete darauf, die Scheinwerfer anzuschalten. Auch ließ sie das Radio aus, damit das Display im Armaturenbrett nicht leuchtete. Jede Form von Licht war verräterisch und zu riskant. Gerade in einem verschlafenen Städtchen wie Cape De Ville fiel ein Auto mitten in der Nacht auf. Und nachdem die Gestalt erst vor Kurzem beinahe erwischt worden war, agierte sie heute umso vorsichtiger.
Im Rückspiegel sah sie die Straßenlaternen des Küstenstädtchens leuchten, und hinter einigen Fenstern von so manchem Haus brannte noch Licht. Der Gestalt wäre es am liebsten gewesen, wenn der ganze Ort bereits tief und fest geschlafen hätte, damit sie ihre Arbeit ohne jegliches Risiko erledigen konnte. Aber das war jedes Mal pures Wunschdenken. Wenn man einem anderen Menschen das Leben nahm – dazu noch auf diese schreckliche Art und Weise –, gab es eben immer ein gewisses Risiko, dem man sich nicht erwehren konnte.
Obwohl die Gestalt langsam fuhr, nahe ans Lenkrad gerückt war und den Weg vor sich so gut wie nie aus den Augen ließ, tauchte das Ende der Steilküste vor ihr wie aus dem Nichts auf.
„Ah, Shit!“, fluchte sie, ging vom Gaspedal und trat gleichzeitig die Bremse bis zum Anschlag durch.
Die Gestalt war diesen Weg im Lauf der Jahre schon zigmal gekommen – viel zu oft für ihren Geschmack –, trotzdem überraschte sie das abrupte Ende des Schotterweges jedes Mal aufs Neue.
Allein die weiße schäumende Brandung tief unten zwischen den Klippen verriet der Gestalt, dass sie ihr Ziel erreicht hatte. Sie stellte den Motor ab, blieb allerdings noch zwei Minuten sitzen und behielt in dieser Zeit die Stadt im Rückspiegel genau im Auge. Sie hoffte, dass niemand unten in Cape De Ville zufällig aus dem Fenster geschaut und die kurz aufflammenden Bremslichter entdeckt hatte.
Erst als noch zwei weitere Minuten vergangen waren und keiner auf den Straßen des Küstenstädtchens auftauchte, rührte sich die Gestalt. Sie öffnete die Tür, rutschte vom Sitz und huschte zur seitlichen Schiebetür, die sie leise aufzog. Der Schotter des verwaisten Aussichtspunktes knirschte unter ihren Füßen wie Scherben von zerbrochenem Glas.
Sie beugte sich ins Innere des Vans, packte mit beiden Händen das mit Klebeband geschnürte Bündel und zog es heraus. Ein Stöhnen entfuhr der mit Panzertape gefesselten und geknebelten Person, als sie unsanft auf den Schotterweg knallte.
Die Gestalt schloss die Schiebetür mit beiden Händen vorsichtig und leise, damit das Geräusch nicht vom Wind nach Cape De Ville getragen wurde. Sie packte ihr Opfer an den Füßen und zog es hinüber zu der Treppe, die vom Aussichtspunkt die Klippe hinunter zum Leuchtturm führte. Die dabei entstehenden Schleifspuren im Schotter würden womöglich nie jemandem auffallen, aber auch hier ging die Gestalt lieber auf Nummer sicher und würde sie nachher auf dem Rückweg zum Van mit den Füßen verwischen.
Wie immer ignorierte sie die rostige Metallkette mit dem daran baumelnden, verblassten Warnschild, das die nicht vorhandenen Besucher davon abhalten sollte, einen Fuß auf die in Stein geschlagene Treppe zu setzen. Die Gestalt bückte sich darunter hindurch und zog ihr menschliches Bündel über den Erdboden hinter sich her.
Als sie ihre ersten Opfer hierhergebracht hatte – das lag so lange zurück, dass ihr diese Taten wie verschwommene Albträume vorkamen –, hatte die Gestalt sie stets behutsam die Treppe hinuntergeführt; darauf bedacht, sie nicht zu verletzen. Doch inzwischen ließ sie schon ab dem Moment, in dem sie ein neues Opfer überwältigte, keine Vorsicht mehr walten. Früher hatte sie sich ausgeklügelte Methoden und Wege einfallen lassen, um sich ihrer zu bemächtigen. Heute jedoch ging sie teilweise sehr grobschlächtig, fast primitiv vor.
Warum auch nicht? Wen immer sie die Treppe hinunterbrachte, würde sie nie wieder hinaufsteigen. Alle ihre Opfer fanden dort unten im Leuchtturm ihr Ende. Wieso sollte sie sich also abmühen, sie kurz vor ihrem Tod in Watte zu packen?
Die Gestalt stieg die ersten drei Stufen hinab und zog das Bündel nach. Der Kopf des Opfers schleifte über die ausgetretenen, brüchigen Kanten der Treppe. Wieder drei Stufen; wieder zog sie das Bündel hinter sich her.
An der ersten Biegung der Treppe, die in Zickzackform in den Felsen gehauen worden war, gönnte sie sich eine kurze Verschnaufpause, streckte den Rücken durch, bis es in ihrer Wirbelsäule knackte, und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Dieser Weg war bedeutend leichter zu beschreiten gewesen, als sie noch tote Tiere und betäubte Kinder hergebracht hatte.
Tja, die guten alten Zeiten, dachte die Gestalt, und ein dünnes Lächeln umspielte ihre Lippen.
Doch diese Zeiten waren lange vorbei. Heute reichte das als Beute nicht mehr aus.
Sie bückte sich, umfasste wieder die Fußgelenke ihres Opfers und stieg weiter hinunter Richtung Meer. Es war jedes Mal ungeheuer mühsam, einen bewusstlosen, erwachsenen, menschlichen Körper zu bewegen. Selbst wenn man ihn nur wie einen Sack voller Gartenabfälle hinter sich herzog.
Wieder drei Stufen; wieder zog sie das Bündel nach.
Da sie auf halber Strecke spürte, dass ihr schon die Kräfte schwanden, wurde sie etwas schneller. Und ungehaltener. Sie verfluchte die gefesselte und geknebelte Person, als hätte sie darum gebeten, dass man sie diesen beschwerlichen Weg hinunterschleppte.
Schnaufend und stöhnend nahm die Gestalt die Stufen jetzt im Vorwärtsgehen und zog gleichzeitig das Bündel hinter sich her. Der Schädel des Opfers rutschte über die Treppe, knallte jedes Mal mit einem dumpfen Knall Stufe um Stufe auf den harten Stein und hinterließ immer größer werdende blutige Abdrücke. Darum musste sich die Gestalt keine Sorge machen, denn Gischt, Wetter und Wellen würden das Blut bis Sonnenaufgang weggespült haben.
Ab und zu stöhnte das Opfer leise, aber das waren wohl eher unterbewusste Reflexe als Geräusche von Schmerzen. Die Gestalt hatte ihm so viel Benzodiazepin verpasst, dass sie es bei lebendigem Leib häuten könnte, ohne dass es das Opfer wirklich mitbekam.
Wobei das, was ihn im Turm erwartet, noch schlimmer ist als eine Häutung, dachte die Gestalt.
Obwohl sie den Tiefpunkt der Ebbe um gut eine halbe Stunde verpasst hatte, war der Wasserpegel noch flach genug, um das Opfer über den felsigen Weg hinüber zum Leuchtturm zu ziehen. Glücklicherweise musste sie nicht das kleine Schlauchboot aufblasen, das sie für Notfälle – und nachdem sie in der Vergangenheit zweimal den Gezeitenplan falsch gelesen hatte – immer im Van mitführte. Sie durfte es sich unter keinen Umständen erlauben, ihr Werk wegen ein bisschen Wasser, das ihr den Weg versperrte, nicht zu beenden.
Am Fuß der Treppe gönnte sie sich eine zweite kleine Pause, wischte sich neuen Schweiß von Stirn und Nacken und knetete ihre Finger, bis die Knöchel knackten. Währenddessen ließ sie keine Sekunde lang den Leuchtturm aus den Augen, der in einiger Entfernung auf seinem felsigen Podest thronte wie ein Herrscher, der ungeduldig auf das Geschenk seines Untertanen wartete.
Um ihn nicht länger warten zu lassen – und weil die Flut den Wasserpegel sichtbar nach oben trieb –, nahm die Gestalt das letzte Stück des Weges in Angriff. Sie zog ihr Opfer hinüber zum Felsen, auf dem der Leuchtturm ruhte. Für die Stufen hinauf zur Tür wechselte die Gestalt noch einmal die Position, griff ihrem Opfer nun unter die Arme und hievte es die Treppe hoch. Da dem Leuchtturm noch weniger Menschen einen Besuch abstatteten als dem Aussichtspunkt, war bisher niemandem aufgefallen, dass die Gestalt das Schloss der Tür schon vor Jahren aufgebrochen und durch eines ersetzt hatte, für das sie allein den Schlüssel besaß.
Sie öffnete die Tür und bugsierte den Körper hinein in den Leuchtturm. Eine Minute später stürzte die Gestalt wieder hinaus und rannte, was das Zeug hielt, zurück zum Van.
Ein Leben für ein Leben. Es war weiß Gott kein schöner Deal, aber welcher Pakt mit dem Teufel war schon angenehm?
Xander
Cape De Ville, Frühling
Heute
Die Idee stammte nicht von mir, sondern war auf dem Mist meines Bruders Howard gewachsen.
Ich war der Ältere von uns beiden Zwillingen. Zwar hatte mich meine Mutter nur knapp drei Minuten früher geboren, aber älter ist eben älter. Daher hatte ich es bereits im Kindesalter nie eingesehen, auf meinen kleinen Bruder zu hören. Seine Ideen, seine Vorschläge, seine Pläne konnten einfach nie so gut sein wie die meinen. Was während unserer Kindheit und Jugend nichts weiter als eine Neckerei unter Geschwistern gewesen war, hatte sich später immer öfter bewährt.
Empfahl mir Howard, eine vielversprechende Aktie zu kaufen, ließ ich lieber die Finger davon. Schwor er auf seinen treuen, zuverlässigen Ford, kaufte ich mir einen BMW. Riet er mir, wegen einer Frau nicht gleich alle Zelte in Boston abzubrechen, zog ich zu ihr nach San Diego und heiratete sie. So fungierte Howard für mich unbewusst als eine Art Kontraindikator für die verschiedensten Lebenslagen.
Dass ich jetzt, im Alter von vierundvierzig Jahren, mit dieser Gewohnheit brach und erstmals einen seiner Ratschläge beherzt befolgte, zeigte mir, wie verzweifelt ich war. Doch ich hatte unzählige andere Methoden ausprobiert, von denen mir keine bei der Lösung meines Problems geholfen hatte.
Also tat ich das, was mein kleiner Bruder mir empfahl.
Keine Ablenkung. Keine Unterbrechung. Keine Anrufe. Kein Internet. Voller Fokus auf eine einzige Sache. Und das für eine ganze Woche. Bei ihm hatte es geklappt. Mehrmals sogar. Mindestens einmal jährlich zog sich Howard laut eigener Aussage in eine Waldhütte mitten in Vermont zurück, um sich ungestört über die Zukunft seiner Bostoner Maklerfirma und deren knapp vierzig Mitarbeitern Gedanken zu machen.
Ich besaß keine Mitarbeiter. Hatte keine Firma zu führen. Trotzdem trug ich Verantwortung für die Jobs einiger Leute, denn mir saß ein Verlag im Nacken, der ein neues Buch von mir erwartete, das ich schon vor zwei Monaten hätte abgeben müssen, von dem ich allerdings noch kein einziges Wort geschrieben hatte. Ich war nie der schnellste Autor gewesen und hatte in neun Jahren gerade einmal zwei Romane zu Papier gebracht, aber die Chefetage meines Verlages in New York wurde immer nervöser.
Da ich in meiner Jugend zu viele Horrorfilme gesehen hatte, um mich leichtgläubig allein in eine abgeschiedene Hütte im Wald zu verkriechen, brauchte ich einen anderen Ort der Ruhe und Einsamkeit. Hier befolgte ich zum zweiten Mal den Rat meines Bruders, der mir einen alten Leuchtturm vor der Küste von Massachusetts ans Herz gelegt hatte.
Howards Firma war vergangenes Jahr vom Essex County mit dem Verkauf des Turms beauftragt worden, nachdem der letzte Eigentümer seine Rechnungen gegenüber dem Staat nicht bezahlt und man das Objekt gepfändet hatte.
„Er ist voll möbliert, weil der Investor dort eine spezielle Art Abenteuerurlaub anbieten wollte, bei dem man den Alltag eines Leuchtturmwärters authentisch nacherleben konnte. Leider gab es dafür wohl keine allzu große Kundschaft. Er verfügt über eine eigene Strom- und Wasserversorgung, und die Aussicht ist herrlich. Oh, und ich lasse ihn regelmäßig reinigen, falls spontane Interessenten ihn besichtigen wollen. Leider kommt das nur äußerst selten vor. Natürlich ist das Gebäude schon in die Jahre gekommen, aber es schlummert darin viel Potenzial und mit wenig Geld kann man diese Perle wieder zum Glänzen …“
„Ist ja gut. Ich will nur für eine Weile darin wohnen und ihn nicht kaufen“, hatte ich gesagt, weil Howard mir das Objekt am Telefon wie einem Kaufinteressenten angepriesen hatte. Manchmal konnte er nicht aus seiner Haut.
Das war letzten Monat gewesen. Seit ich vor zwanzig Jahren aus Boston weggezogen war, beschränkte sich unser Kontakt – neben den abwechselnden Besuchen der Familie des jeweils anderen zu Weihnachten – auf wenige Telefonate.
„Länger als eine Woche darfst du aber nicht bleiben“, hatte mein Bruder mir erklärt. „Offiziell ist das Betreten des Turms untersagt.“
„Ist er etwa baufällig?“
„Nein, doch wenn jemand mitbekommt, dass der Turm für Wohnzwecke genutzt wird, dann …“
„Schon gut. Eine Woche sollte reichen.“
Länger würde ich hoffentlich nicht brauchen, um meine Schreibblockade endlich zu überwinden. Wenn ich es nicht schaffte, in dieser Woche den Plot zu knacken, musste ich wohl oder übel einsehen, dass ich das Buch nie schreiben würde. In dem Fall würde ich wenigstens Gewissheit haben und müsste mir und meinem Verlag nicht länger etwas vormachen. Dann würde offiziell feststehen, dass meine ersten beiden Bücher pure Glückstreffer gewesen waren und meine Karriere als Autor nur ein unbeabsichtigter Bluff.
Es würde sich für mich allerdings als schwierig erweisen, den hohen Vorschuss zurückzuzahlen. Denn das Geld, das mir der Verlag für mein drittes Buch überwiesen hatte, hatte ich bis auf den letzten Penny in den besten und teuersten Scheidungsanwalt von San Diego investiert. Jedes Mal, wenn ich mit verkrampfter Hand einen Scheck ausgestellt hatte, um die nächste horrende Anwaltsrechnung zu bezahlen, hatte ich mir eingeredet, dass das Geld bei meinem Anwalt besser aufgehoben war als auf dem Konto meiner untreuen Ex-Frau.
Vielleicht hatte ich mich auch deswegen für den Leuchtturm als Ort der Therapie entschieden. Die Reise in das kleine Küstenstädtchen Cape De Ville gab mir gleichzeitig die Möglichkeit, meine alte Heimat Massachusetts zu besuchen. Da meine Ex-Frau inzwischen mit ihrem Liebhaber nach Los Angeles gezogen war und meine Tochter Olivia in Harvard studierte, gab es in San Diego nichts mehr, was den Ort für mich weiterhin zu einem Zuhause machte.
Als ich meinen Debütroman geschrieben hatte, waren meine Frau und ich noch glücklich miteinander gewesen. Wir beide hatten einen Bürojob gehabt, ich hatte nur nachts an dem Buch gearbeitet, wenn sie und Olivia schliefen, und hatte mir mit dem Schreiben so viel Zeit lassen können, wie ich wollte, weil es zu dieser Zeit weder Agent noch Verlag gegeben hatte.
Bei der Arbeit an meinem zweiten Roman hatte die Sache schon ein wenig anders ausgesehen. Hier hatte ich vom ersten Satz an einen gewissen Druck gespürt. Nach dem Gewinn des National Book Awards und durch das Wissen, dass es da draußen plötzlich viele Menschen gab, die auf ein neues Werk von mir warteten, hatte ich mir selbst allerhand mentale Steine in den Weg gelegt. Diese zu überwinden, hatte mich viel Zeit und Mühe gekostet. Ich hatte dank des Erfolgs meines Debüts meinen Job aufgegeben und widmete mich seitdem Vollzeit dem Schreiben. Dennoch hatte ich für mein zweites Buch drei Jahre länger gebraucht. Drei Jahre, die ich allerdings nicht nur mit der Arbeit am Manuskript, sondern auch damit verbracht hatte, eine drohende Scheidung wie eine gefährliche Klippe zu umschiffen.
Eine Zeit lang hatten die vielen Buchtantiemen, unser neuer luxuriöser Lebensstil und ihr Liebhaber meine Frau darüber hinwegtrösten können, dass ich sie vernachlässigte. Dem Vertragsabschluss für mein drittes Buch hatten jedoch weder meine Kreativität noch meine Ehe standgehalten.
Und in einer Woche wird sich endgültig entscheiden, ob ich nicht nur als Ehemann, sondern auch als Autor versagt habe, dachte ich und kam zurück ins Hier und Jetzt.
Abrupt bremste ich meinen Mietwagen ab, denn am Straßenrand vor mir tauchte ein Hinweisschild mit einem Pfeil und der Aufschrift ‚Cape De Ville‘ auf. Zwei Sekunden später wies mich die weibliche Stimme des Navigationssystems an, rechts abzubiegen.
Ich verließ die Landstraße und folgte einer schmalen, aber durchgängig asphaltierten Straße in Richtung Küste. Die Bäume, Sträucher und Gräser auf den weiten Ebenen links und rechts des Weges reckten sich der wärmenden Nachmittagssonne entgegen. Der klare, wolkenlose Tag erlaubte eine meilenweite Sicht in sämtliche Himmelsrichtungen. Nach zwanzig Jahren im ganzjährig warmen San Diego hatte sich das Wetter Neuenglands in meiner Erinnerung als trist, grau und nasskalt manifestiert, und ich hatte völlig vergessen, wie schön es hier schon im Frühjahr sein konnte.
Erst als ich nach etwa zwanzig Minuten einsamer Fahrt die Steilküste erreichte, zogen ein paar Wolken auf und warfen einen buchstäblichen Schatten auf meine Ankunft in Cape De Ville. Der Ort lag in einer engen Bucht unterhalb der Straße, in der sich Nebelfetzen gesammelt hatten. Nachdem ich die serpentinenartige Zufahrt zur Hälfte hinter mir gelassen hatte, lüftete sich die Nebelglocke und Strahlen der tief stehenden Sonne bahnten sich ihren Weg über die Essex Bay hinein in die schmale Bucht.
Die Zufahrtsstraße mündete in der Main Street von Cape De Ville, die den Ort so schnurgerade durchzog, dass ich am anderen Ende, in etwa zwei Meilen Entfernung, einen kleinen Hafen mit einigen Booten erspähen konnte.
Direkt nach der Ankunft im Ort befolgte ich den dritten Ratschlag meines Bruders, indem ich einen Zwischenstopp einlegte und mir noch ein paar Vorräte besorgte.
„Leider hat der Leuchtturm keinen Kühlschrank. Daher wirst du in dieser Woche auf frische Lebensmittel verzichten müssen“, hatte Howard mir gestern bei unserem letzten Telefonat erklärt.
Ich sah darin kein Problem, lebte ich doch seit meiner Trennung wieder hauptsächlich von der üblichen Single-Kost, bestehend aus Konservendosen, Mikrowellen-Essen und Fast Food.
Ich fuhr die Main Street entlang, bis ich ein zweistöckiges Gebäude mit der Aufschrift ‚Cape Market‘ fand, die in großen blauen Buchstaben über eine Front aus Schaufenstern verlief. Da es vor dem kleinen Supermarkt, den mir Howard genannt hatte, keinen Parkplatz gab, stellte ich den Mietwagen auf der Straße ab.
Bevor ich mich ans Shoppen machte, schnappte ich mir mein Handy aus der Mittelkonsole und schrieb meiner Tochter. Obwohl ich ihr bereits nach der Ankunft am Logan International Airport in Boston getextet hatte, schien sie auf meine Nachricht gelauert zu haben, denn kaum hatte ich sie abgeschickt, rief sie mich an.
Ich räusperte mich. „Guten Tag. Hier spricht Xander Ripley. Erfolgreicher Bestsellerautor. Was kann ich für …“
„Lass den Unsinn, Dad.“ Olivia gab sich Mühe, ernst zu klingen, doch ich hörte ihr Grinsen durchs Telefon. „Lief die Fahrt gut?“
„Ja, alles super. Kaum Verkehr.“
„Und wie ist der Ort so?“
„Kann ich noch nicht sagen. Ich bin ja gerade erst …“
„Aber du telefonierst nicht beim Fahren, oder?“
„Nein, mein Mietwagen hat so eine neue Erfindung eingebaut. Nennt sich Freisprechanlage. Ich kenne mich ja in solchen technischen Dingen nicht so gut aus wie du, doch …“
„Haha. Ungeheuer witzig. Wenn es mit deinen Büchern nicht mehr klappt, kannst du ja zum Comedian umschulen.“
„Ich weiß nicht. Wenn ich deiner Mutter glauben soll, ist mir mein Humor in den letzten Jahren abhandengekommen.“
„Seit wann hörst du denn auf Mum? Ist ja ganz was Neues.“
Treffer. Versenkt.
Ich räusperte mich. „Na gut. Ich werde mal den Supermarkt unsicher machen und melde mich später noch mal.“
„Alles klar. Bis dann, Dad.“
Als ich auflegte, ahnte ich nicht, wie sehr ich mich schon bald nach Gesprächen mit der Außenwelt sehnen würde.
Xander
Wenn ein Makler einem von der guten Lage eines Objektes und dessen noch viel bessere Umgebung vorschwärmt, sollte man auf der Hut sein. Meist stecken hinter solchen Anpreisungen hübsch verpackte Lügen, um jeden schäbigen Ort und jedes heruntergekommene Haus schönzureden.
Aber als Howard mir am Telefon vom idyllischen Cape De Ville erzählt hatte, hatte er nicht übertrieben, wie ich nun feststellte. Während der wenigen Schritte vom Auto hinüber zum Eingang des Cape Market, übte der Ort augenblicklich eine erholsame Wirkung auf mich aus. Ich fühlte mich inmitten der kleinen, in hellen Pastellfarben gestrichenen Häuser direkt entschleunigt und behaglich.
Blasse blaue, grüne und gelbe Fassaden zierten die gesamte Main Street. Die Hecken der Vorgärten waren sauber getrimmt und die Rasenflächen vor den Häusern frisch gemäht. Überhaupt erweckte der gesamte Ort einen aufgeräumten Eindruck – ohne dabei zu steril zu wirken. Es gab keine schiefe Latte in einem der Zäune zwischen den Häusern, nirgends war ein Schlagloch in einer Straße zu sehen und zwischen den Pflastersteinen der Gehwege ragte nicht das kleinste Stück Unkraut hervor. Einzig die verschweißten Gullydeckel im Verlauf der Straße sowie die zubetonierten Einläufe am Bordstein wirkten befremdlich.
Ansonsten erinnerte mich das Küstenstädtchen an den Ort Amity aus dem Film Der weiße Hai. Nur war hier im Gegensatz zu der Stadt in Steven Spielbergs Klassiker der Tourismus nicht existent, da die Steilküste Badegästen den Zugang zum Meer versperrte und es keinen brauchbaren Sandstrand in der Nähe gab.
„Deswegen hat der letzte Eigentümer auch irgendwann sein Vorhaben aufgegeben, den Leuchtturm zu einem Ferienhaus umzubauen“, hatte Howard mir erklärt. „Obwohl er schon ein hübsches Sümmchen für die Sanierung des Turms hingeblättert und als Investor einige andere alte Türme entlang der Küste erfolgreich gekauft und umgebaut hatte. Doch irgendwann musste er einsehen, dass Touristen Cape De Ville ebenso fremd sind wie die Worte Gastfreundschaft und Willkommenskultur.“
Als ich ihn daraufhin gefragt hatte, wie das zu verstehen war, hatte Howard mir erzählt, dass die Einwohner des Ortes nicht allzu viel für Fremde übrighatten und er bei seinen wenigen Besuchen oft mürrisch und misstrauisch beäugt worden war. Offenbar hatte man in Cape De Ville etwas dagegen, dass man den Turm nutzbar machen und verkaufen wollte.
Howard erklärte sich dies vor allem damit, dass man den Ort, in dem im späten neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhundert der Fischfang floriert und die ganze Stadt ernährt hatte, nach Versiegen der Fischgründe links liegen gelassen hatte. „Seitdem kochen die Leute hier wohl lieber ihr eigenes Süppchen.“
Mir war dies relativ egal, schließlich wollte ich im Ort keine Freundschaften schließen. Mein Plan für die nächsten sieben Tage sah vor, wie ein Einsiedler zu leben und mich allein mit den Figuren meines Buches zu beschäftigen.
Und mit dem Besitzer des Supermarktes, ergänzte ich in Gedanken und betrat den Cape Market.
Kaum hatte sich die gläserne Schiebetür hinter mir geschlossen, kündigte ein kurzes Klingeln allen Anwesenden meine Ankunft an. Nur hielt sich bis auf eine junge Angestellte, die hinter der einzigen Kasse in ein Buch vertieft war, niemand hier auf.
Sie sah von ihrer Lektüre auf. „Guten Tag.“
„Hallo.“ Ich nickte in ihre Richtung, schnappte mir einen der Körbe neben einer Papptafel, die für ‚täglich frische Brötchen‘ warb, und begann meinen Einkauf.
Der Laden war klein und überschaubar, bot jedoch alles, was man zum Überleben brauchte. Howard hatte mir versichert, dass es zwei elektronische Herdplatten gab, auf denen ich kochen konnte. Also packte ich mir Nudelsuppen und Wurstgulasch als Konserven, ein paar Fertiggerichte, ein Glas Erdnussbutter, je zwei Flaschen Wasser und Cola sowie Vollkornbrot in Dosen ein. Es war sicher nicht das gesündeste Essen und glich eher der Verpflegung für einen Campingtrip, aber für eine Woche würde es schon gehen.
Als ich aus dem Gang der Lebensmittel trat und den Einkaufskorb hinüber zu den Regalen mit den Hygieneartikeln schob, ertappte ich die Kassiererin dabei, wie sie verstohlen zu mir herübersah. Als ich ihren Blick erwiderte, versenkte sie ihren Kopf wieder in ihrem Buch.
Fünf Minuten später trat ich mit vollgepacktem Korb an die Kasse.
„Hi“, sagte ich noch einmal zu der jungen Frau und packte meine Einkäufe auf das Band.
„H-hallo“, hauchte sie, räumte hastig ihr Buch beiseite und begann, die Artikel über den Scanner zu ziehen.
Trotz ihres weiten Rollkragenpullovers erkannte ich, dass sie sehr schmal, fast zu dünn gebaut war. Ich maß knapp einen Meter achtzig, aber sie war so groß gewachsen, dass sie mich um fast einen Kopf überragte. Ich schätzte sie auf Mitte zwanzig, obwohl die rosa Blume, die sie sich in ihre schulterlangen blonden Haare gesteckt hatte, sie jünger wirken ließ.
Weil ich für eine Woche nur mit Handgepäck reiste, hatte ich sämtliche Toilettenartikel zu Hause in San Diego gelassen. Der elektrische Rasierer, mit dem ich mir jeden zweiten Tag den Henriquatre-Bart stutzte, war das einzige Utensil, das aus meinem Badezimmer im Koffer gelandet war.
Die Kassiererin grinste, als sie Duschgel, Shampoo, Deo und Zahnpasta über den Scanner zog.
„Ähm … Ich fange nicht jetzt erst mit Körperhygiene an. Ehrenwort“, sagte ich, während ich die Einkäufe in Tüten packte. Als ich Zeige- und Mittelfinger anhob, um mein Versprechen mit der verschworenen Geste zu untermauern, kicherte die Kassiererin.
„Keine Sorge, das bleibt unter uns, Mr. Ripley.“
„Ähm, kennen wir uns?“, fragte ich verdutzt darüber, dass sie mich so direkt ansprach.
„Nein … Also, nicht direkt. Aber ich kenne Sie.“ Meine Gegenüber scannte den letzten Artikel – die Zahnpasta – und beugte sich dann verschwörerisch über die Kasse. „Ich bin ein großer Fan.“
„Ah. Verstehe.“
„Ich hab’ Ihre beiden Romane auf dem College verschlungen und sie seitdem sicher schon dreimal gelesen.“
„Das klingt so, als hätten sie Ihnen gefallen.“
Ich lächelte. Einerseits schmeichelte es mir, selbst hier am sprichwörtlichen Arsch der Welt erkannt zu werden. Andererseits hoffte ich, dass sich die Nachricht über meine Anwesenheit nicht zu schnell herumsprechen würde.
Sie nannte mir den Preis, woraufhin ich den Einkauf mit meiner Kreditkarte bezahlte und den Kassenbon entgegennahm.
„Soll ich … Ihnen ein Autogramm geben?“, fragte ich, weil mich die Frau weiterhin erwartungsvoll anstarrte.
„Ich … Also … Das wäre wirklich super. Leider habe ich Ihre Bücher nicht hier.“ Sie hielt das Buch hoch, das sie gerade las. „Das hier ist eines von James Patterson.“
„Ein ganz schöner Stilbruch“, bemerkte ich in Anbetracht der Tatsache, dass Patterson für seine rasanten Thriller bekannt war und ich zwei Bildungsromane geschrieben hatte.
„Das gehört nicht mir, sondern meinem Onkel. Ich lese es nur, um mir die Zeit zu vertreiben und weil ich nichts anderes zur Hand habe.“
„Verstehe. Hm. Darf ich?“ Ich griff mir ohne ihre Erlaubnis den Kugelschreiber, der neben der Kasse lag. „Verraten Sie mir Ihren Namen?“
„S-Sonja. Sonja Phillips.“
Ich strich den Kassenbon glatt und kritzelte auf die Rückseite: Für Sonja. Danke für den netten Plausch. Xander.
Als ich ihr den Bon mit meinem Autogramm hinüberschob und sie die Botschaft darauf las, klappte ihr der Unterkiefer herunter. „W-wow. V-vielen Dank, Mr. Ripley.“
„Bitte, nennen Sie mich doch Xander. Dann komme ich mir nicht so alt vor.“ Ich gab ihr den Stift zurück.
Das Angebot, mich beim Vornamen zu nennen, ließ ihre hellblauen Kulleraugen vor Freude funkeln. „Und … was verschlägt Sie hierher, X-Xander? Sind Sie auf der Durchreise?“
Ich lachte. „Das ist schwer möglich. Ich glaube, hierher kommt man nur, wenn man sich verirrt.“
„Ja, das ist wohl wahr. Cape De Ville ist sehr abgelegen.“
„Tja, genau deswegen bin ich hier.“ Jetzt war ich es, der sich zu ihr hinüberbeugte. „Unter uns: Ich möchte hier an meinem neuen Buch arbeiten. In Ruhe und ungestört. Also pst.“ Ich legte den Zeigefinger an meine Lippen.
„Ein neues Buch?!“ Unbewusst flüsterte Sonja, obwohl niemand im Laden war, der unser Gespräch belauschte. „Darauf warte ich schon ewig.“
Ich lächelte gequält. „Tja, nicht nur Sie.“
„Ich hatte schon die Befürchtung, dass es vielleicht nie wieder einen neuen Roman von Ihnen geben wird.“
„Nicht nur Sie“, wiederholte ich. „So, ich muss dann los.“
„Natürlich. Verzeihung, ich wollte Sie nicht von der Arbeit abhalten.“
„Keine Sorge. Noch habe ich damit nicht angefangen.“ Ich stellte den Einkaufskorb zurück, nahm meine Tüten und verabschiedete mich. Als die Schiebetür direkt vor mir zur Seite fuhr, blieb ich einen Moment stehen und drehte mich noch einmal zur Kasse. „Ähm, eine Frage hätte ich noch.“
Auf der Einkaufsliste in meinem Kopf standen zwei Dinge, die ich hier im Laden nicht entdeckt hatte. Ich hatte nicht danach fragen wollen, um keine unnötige Aufmerksamkeit zu erregen, aber da jetzt das Eis gebrochen war und Sonja mein Geheimnis kannte, sprach nichts mehr dagegen.
„Sie führen nicht zufällig Schreibmaterial?“
„Doch, hinten in Gang vier haben wir Druckerpapier, Patronen, Stifte und …“
„Nein, das meine ich nicht. Ich brauche … Haben Sie Pinnwände und Karteikarten?“
Sonja stutzte. „Nein, so etwas haben wir leider … Mein Gott, brauchen Sie das etwa für Ihr neues Buch?!“
Ich zuckte mit den Schultern, um das Offensichtliche nicht zu erklären.
Sie sprang auf. „Ich … Ein Moment! Hinten im Büro haben wir zwei Pinnwände aus Kork. Würde das gehen?“
„Sicher, doch Sie müssen nicht extra …“
Doch da stürzte sie schon hinter der Kasse vor und verschwand zwischen zwei Regalen.
Eine Minute später kam sie mit zwei mittelgroßen Pinnwänden unter dem Arm zurück. Im Kork beider Wände steckten einige Nadeln, und an einer Pinnwand hing noch ein Blatt Papier, das aussah wie ein Lieferantenplan.
Sonja riss den Zettel schnell ab und reichte mir die Pinnwände.
„Das kann ich wirklich nicht annehmen.“
„Ich bitte darum, Xander. Es wäre mir eine Ehre.“
„Na schön. Dann besten Dank.“
„Karteikarten habe ich aber leider nicht gefunden.“
„Schon gut“, sagte ich, weil mir inzwischen eine Idee zur Abhilfe gekommen war. „Ich kaufe einfach noch zwei Schreibblöcke und schneide mir das Papier zurecht.“
Sofort eilte Sonja in die Schreibwarenabteilung und brachte mir gleich vier Blöcke. Zwei linierte und zwei karierte. „Die gehen aufs Haus.“
„Sonja, ich kann doch nicht …“
„Bitte. Allein der Gedanke daran, Ihnen bei Ihrem neuen Buch geholfen zu haben, ist mir Lohn genug.“ Sie lächelte bis über beide Ohren.
„Dann nochmals danke. Und bitte, behalten Sie meine Anwesenheit für sich.“
„Keine Sorge. Passen Sie nur auf, dass die Petersons Sie nicht damit erwischen. Glauben Sie mir, die können nichts für sich behalten.“
Ich legte den Kopf schief. „Wer?“
„Die Petersons. Das Ehepaar, das die Pension im Ort betreibt. Sicher haben Sie dort ein Zimmer gebucht.“
„Nein. Ähm … um ehrlich zu sein, beziehe ich den alten Leuchtturm.“
„Candle Tommy?!“
Ich zuckte mit den Schultern. „Wenn er hier so heißt, dann ja.“
„Die Einheimischen nennen ihn so, weil er so ähnlich aussieht wie eine große Kerze.“ Sie strich sich ihr dünnes Haar hinters Ohr. „Ich dachte, es sei verboten, den Turm zu betreten.“
„Man muss nur die richtigen Leute kennen.“ Ich grinste. „Ein weiterer Grund, meine Anwesenheit geheim zu halten.“ Ich zwinkerte ihr zu, bedankte mich noch einmal und verließ den Laden.
Auf der Straße verfrachtete ich die Pinnwände in den Kofferraum und verstaute meine Einkäufe auf dem Rücksitz.
„Hey, Sie da!“
Ich hob den Blick und sah, dass auf der anderen Straßenseite ein schwarzer auf Hochglanz polierter Kombi gehalten hatte. Der Fahrer – ein Lockenkopf, der sein Doppelkinn erfolglos hinter einem dünnen Bart zu verstecken versucht – hatte die getönte Scheibe heruntergelassen und streckte seinen Kopf heraus.