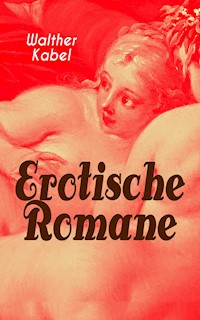Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Serie: Benu Krimi Edition
- Sprache: Deutsch
Irgendetwas stimmt nicht in dem alten Haus am Mühlengraben, in dem der junge Assessor Karl Linker eine Wohnung gefunden hat. Nachts beobachtet er finstere Gestalten, die in einem Kahn von den Grundmauern des alten Hauses aus über den Fluß setzen und getrieben von hastig bewegten Rudern eine leblose Gestalt transportieren. Von dem Mieter Reschke erfährt Linker, daß sich die unheimlichen Vorfälle in dunklen Nächten schon seit Jahren ereignen. Auch die schöne Hildegard Kunath, die Tochter seiner Hauswirtin, scheint in die mysteriösen Umtriebe verstrickt zu sein. Linker beschließt, das Geheimnis des alten Hauses zu ergründen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Der graue Hut
Die Sünde
Das Monokel
Der kleine Nachen
Der große Unbekannte
Der Herr von oben
Wie einst …
Ohnmachtsanfall
Die Patentante
Die große Leidenschaft
Verzweiflung
Bei Mutter Gundlach
Hafenpiraten
Die alte Chronik
In den Gewölben von St. Barbara
Der Heiligenschein
Impressum
Der graue Hut
Karl Linker war schon oft genug in Ixstadt gewesen, wenn auch nur immer für einige Tage. Aber daß die alte Hafenstadt so viele wirklich poetische Winkel besaß, hatte er noch nicht gewußt. Dies wurde ihm jetzt erst an diesem prächtigen, von Frühlingsahnen erfüllten Apriltage klar, als er nach einem möblierten Zimmer suchte. Die neueren Stadtteile mied er hierbei. Einmal waren ihm dort die Wohngelegenheiten zu teuer – er mußte ja nur zu sehr sparen! – dann aber entsprach es weit mehr seiner ein wenig romantisch angehauchten Natur, möglichst in einem alten Hause mit gewundenen, dunklen Treppen, kleinen Fenstern und dem ganzen nicht näher zu beschreibenden Hauche einer wechselvollen, langen Vergangenheit ein Unterkommen zu finden.
Die Kirche mit dem verwitterten, massigen Turm, vor der er jetzt stand, hatte seine Aufmerksamkeit einige Zeit in Anspruch genommen. Dann hörte er irgendwo in der Nähe ein dumpfes Rollen, Rumpeln und Brausen, ein seltsames Gemisch ineinanderfließender Töne, über deren Bedeutung er sich nicht klarzuwerden vermochte.
Vor der Kirche erweiterte sich die Straße zu einem weiten Platz, – die reine Raumverschwendung inmitten dieses ältesten Stadtteiles mit seinen engen, winkligen Gassen, schmalen, düsteren Kanälen und kleinen Häuschen, zwischen denen nur hie und da ein anderes Gebäude sich erhob, das dann stets gar nicht hineinpaßte mit seiner breiten, protzigen Front und der praktischen Nüchternheit seines Stiles in diese poesieumwobene Umgebung.
Der junge Jurist lauschte noch immer den merkwürdigen Tönen. Jetzt glaubte er zu wissen, woher sie kamen, von drüben, wo jenseits des Kirchenplatzes ein freistehendes, uraltes Bauwerk mit Spitzdächern und Türmchen sich erhob. Und nun besann er sich auch, das war ja die »Große Mühle«, eine der vielen Sehenswürdigkeiten Ixstadts, die noch aus dem fünfzehnte Jahrhundert stammte und über einem Kanal errichtet war, der mitten durch ihre untersten Räume mit künstlichem starken Gefälle hindurchströmte und die Mühlenräder in Gang setzte, die ihre Kraft hergaben, um das Getreide in staubfeines Mehl zu zerkleinern. Der dumpfe Lärm, fast dem Brausen einer Brandung vergleichbar, war nichts als die Symphonie von Wassermassen und Maschinengepolter.
Er schritt nun die schmale Straße rechts des Mühlengrabens entlang, schaute die Häuschen mit den halbblinden Fenstern und den verwitterten Türen an und blieb dann mit einem Male stehen. Vor ihm ragte ein Haus, im Baustil des Daches ähnlich der Großen Mühle, über die Nachbargebäude ein Stück hinweg. Eine ausgetretene Steintreppe mit fünf Stufen führte zu einer schweren, tief nachgedunkelten und mit eisernen Ziernägeln beschlagenen Tür empor, an deren einer Stelle eine weiße Papptafel an einem Stück Bindfaden baumelte und aufdringlich mit großen gedruckten Buchstaben verriet, daß hier ein möbliertes Zimmer zu vermieten sei. Unbeholfene Schriftzüge, mit Blaustift hingemalt unter den Druckzeilen, besagten weiter, das Zimmer wäre von sofort zu haben, auch mit voller Pension, unten rechts bei Kunath.
Karl Linker besann sich nicht lange. Zwei Stunden war er nun schon auf der Suche, vorhin hatte die Turmuhr der Kirche bereits zwölf geschlagen, und sein Magen meldete sich immer eindringlicher. Er stieg die Steintreppe empor, öffnete die Haustür, neben der zu beiden Seiten schmale, vergitterte Fenster sich befanden, und betrat den Hausflur, der mehr den Namen Diele verdiente und in einem geheimnisvollen Halbdunkel wie im Märchenschlafe dahindämmerte. Der Fliesenboden, die breiten Schnitzereien über den Türen, die rechts und links in die beiden Erdgeschoßwohnungen hineinführten, die breite Treppe mit dem altertümlichen, plumpen Geländer im Hintergrunde und ein eiserner Kronleuchter, der von der Decke tief herabhing, gaben dem Flur einen persönlichen Anstrich und benahmen ihm völlig den Eindruck der Zugehörigkeit zu einem Miethause. Außerdem herrschte hier noch ein eigentümlicher Geruch wie von Lavendel, trockenem Obst und ein wenig Moder. Vielen alten Häusern haftet ein derartiges, mit den Geruchsnerven wahrnehmbares Merkmal an als nicht gerade schätzenswerte Eigenschaft.
Der Assessor steuerte auf die rechte Tür zu. Eine glatte Messingplatte, in Augenhöhe befestigt, trug den Namen Ernst Kunath. Der vorsintflutliche Klingelzug, von Linkers Hand kräftig bewegt, weckte hinter der Tür in einiger Entfernung eine Glocke zu lautem Gebimmel, deren Ton an die Kuhglocken in den Alpen erinnerte und schnell in des jungen Juristen Gedächtnis ein paar Bilder von grünen Almen mit Felsen und Tannen als Umrahmung erstehen ließ als lebendige Eindrücke seiner einzigen Reise von der Universität Freiburg aus hinüber in die schneegekrönte Bergwelt der Schweiz.
Dann öffnete sich lautlos die Tür ein wenig, und in der Spalte wurde undeutlich der Kopf einer Frau sichtbar.
»Sie wünschen?« –
Es war eine müde, leise Stimme.
»Ich komme wegen dem Zimmer.«
»Bitte.« Die Tür ging ganz auf, nachdem eine Sicherheitskette entfernt worden war.
Hier in dem Wohnungsflur brannte an der Wand eine kleine Petroleumlampe. Eine Kommode versperrte halb den Weg. Daneben stand ein Kleiderständer. Auf der Kommode lag ein grauer Damenfilzhut mit einer Garnitur gleichfarbiger Sammetblumen.
Ein appetitlicher Bratenduft erfüllte unaufdringlich den schmalen Gang, der nach hinten zu in graue Dämmerung sich verlor.
Die Frau verschwand in dieser Dämmerung, und Karl Linker tappte etwas unsicher hinter ihr drein, indem er dachte, daß nach dem Geruche zu urteilen die Verpflegung bei Kunaths nicht schlecht sein könne, und sich ausmalte, wie angenehm es sein müßte, wenn er sich mit seinem knurrenden Magen hier gleich an den gedeckten Tisch setzen könnte.
Dann prallte er aber, geblendet von einer hellen Lichtflut, mit einem Male zurück. Die Frau hatte eine Tür geöffnet, ganz weit. Ein Zimmer lag dahinter mit zwei Fenstern, die von draußen der strahlende Mittagssonnenschein traf, so daß helle, verzerrte Vierecke sich auf dem braungestrichenen Fußboden abzeichneten.
Mit einladender Handbewegung wurde der Assessor zum Eintreten aufgefordert. Hinter ihm zog die Frau die Tür zu und blieb abwartend daneben stehen, indem sie die Hände über der blauen Wirtschaftsschürze faltete. In der ganzen Erscheinung dieses kleinen Weibleins mit dem leicht ergrauten Scheitel und dem winzigen Gesichtchen lag etwas Vertrauen erweckendes und gleichzeitig auch Mitleid erregendes. Die Falten um den Mund, auf der Stirn und um die Augen waren wie in die blasse Haut eingekerbt.
Der Blick war offen, aber traurig und fast demütig.
Linker hatte in kurzem Anschaun diese Einzelheiten erfaßt und wandte sich nun der Zimmereinrichtung zu. Alte Mahagonimöbel mit gestickten Deckchen, vergilbte Stahlstiche an den graublau tapezierten Wänden und ein großer Teppich, Persernachahmung, verliehen dem länglichen Raume im Verein mit zahlreichen Schmuckgegenständen, die mit Geschmack aufgestellt waren, die Behaglichkeit eines eigenen Heims und redeten in all ihrer spiegelnden Sauberkeit eine deutliche Sprache von des kleinen Weibleins vortrefflichen Hausfraueneigenschaften. Das Bett stand hinter einem hohen, sechsteiligen chinesischen Wandschirm aus feinem Geflecht. Jeder Teil hatte ein ovales Mittelstück in schwarzer Farbe, von der sich goldene Phantasievögel scharf abhoben.
Der Assessor nickte befriedigt, ging an das eine Fenster und schaute hinaus durch den offenen, festgehakten Flügel auf einen Kanal, in dem gelbbraunes Wasser träge dahinfloß. Der Kanal bespülte fast die Grundmauern, und, so poetisch auch dieser Wasserarm und die Aussicht auf die gegenüberliegenden Häuschen war, Karl Linker dachte doch sofort daran, daß das Zimmer vielleicht feucht sein könnte. Sonst gefiel es ihm ganz gut hier.
Bisher war zwischen ihm und der Frau noch kein Wort über den eigentlichen Zweck seines Besuchs gewechselt worden. Jetzt begann er zu fragen, – dies und jenes, bis er genügend unterrichtet war.
Frau Kunath, die Witwe eines Werkmeisters der im Besitz des Magistrats befindlichen Mühle, forderte für das Zimmer nebst voller Pension monatlich hundertzwanzig Mark, – einschließlich Bedienung und Besorgung der Wäsche, wie sie besonders betont hatte.
Der Preis war dem Assessor ein wenig zu hoch. Er durfte höchstens hundertzehn Mark anlegen.
Schließlich einigten sie sich auf hundertfünfzehn Mark, und Linker wollte dann gleich nachmittags einziehen.
Als er sich schon zum Gehen wandte, meinte die Frau noch zögernd, sie nähme nur wirklich solide Herren auf. Sie hätte eine erwachsene Tochter und einen Sohn, einen angehenden Bankbeamten, und auf beider kindliche Harmlosigkeit müßte sie Rücksicht nehmen. – Ihre Augen leuchteten stolz auf, während sie von ihren Kindern sprach. –
Überhaupt würde sie es nicht dulden, daß … na, – der Herr Assessor verstehe wohl schon.
Karl Linker nickte ihr lächelnd zu.
»Ich bin verlobt, Frau Kunath. Genügt Ihnen das?«
»Ja, ja – gewiß – natürlich!«
Der Assessor reichte ihr die Hand. »Dann wären wir einig, nicht wahr? – Ich schicke also gegen zwei Uhr durch einen Dienstmann meinen Koffer und den Schließkorb, die noch auf dem Bahnhof stehen. Ich bin nämlich morgens erst von Barten hier eingetroffen.«
Sie gab ihm noch den Haus- und den Wohnungsschlüssel, worauf er sich verabschiedete.
Nachdem er in einem Gasthaus am Bahnhof zu Mittag gegessen, ließ er sein Gepäck nach dem Mühlengraben 9 bringen und packte dann in seinem neuen Heim gemächlich aus, legte sich gegen drei Uhr nach getaner Arbeit auf das Ruhebett, das hier die Stelle eines Sofas vertrat, und schlief auch bald ein.
Den Nachmittagskaffee ließ er sich von Frau Kunath geben, plauderte mit ihr ein wenig, erfuhr so, daß die Tochter Hildegard neunzehn Jahre alt und Buchhalterin im städtischen Arbeitsvermittlungsamt war, während der junge Kunath noch seine Lehrzeit bei der Ostbank für Handel und Gewerbe durchmachte, und schickte dann seiner Braut eine Ansichtskarte.
Nachher schlenderte er durch die Hauptverkehrsstraßen und über die vielen Brücken ziellos umher, eigentlich nur, um etwas körperliche Bewegung zu haben.
In der Langgasse war’s. –
Im Straßenleben Ixstadts stellte diese Langgasse dasselbe vor wie für Berlin die Friedrichstraße, nur mit den nötigen Einschränkungen, was Länge, Lebhaftigkeit des Verkehrs und Art der Passanten anbetrifft.
Die Langgasse, an deren Südende das architektonisch so bedeutende Rathaus mit dem uralten Merkurbrunnen davor sich erhob, war heute in Wahrheit eine in eine Provinzialhauptstadt verlegte Friedrichstraße. Die »Lasterseite« war gedrängt voll. Und hier unter der in zwei Strömen auf dem Bürgersteige sich aneinander vorbeischiebenden Menge bemerkte der Assessor den grauen, schicken Filzhut mit den grauen Samtblumen.
Und er erkannte ihn sofort wieder. Schon im Flur auf der Kommode der Frau Kunath war er ihm aufgefallen. Karl Linker besaß viel Geschmack – in allem, nicht nur, was seine und seiner Mitmenschen Kleidung anbetraf, nein, auch in seiner Lebensführung. Nachher, als er von Frau Kunath über die erwachsene Tochter Hildegard so einiges gehört hatte, war ihm der Hut wieder eingefallen. Er mußte ihr gehören … Und nach diesem Hut hatte er sich dann ein Bild von Hildegard entworfen, das sehr günstig ausfiel. Er traute ihr zu, sich ein wenig raffiniert einfach anzuziehen.
Und von Hildegard und dem aparten Filzhütlein waren seine Gedanken unwillkürlich auf Lottchen übergesprungen, seiner Braut in der Heimatstadt Barten. Lotte Harrich hätte eine solche Kopfbedeckung für ihr blondes Haupt nie gewählt. Geschmackvoll bedeutete für sie eine Verbindung von teuer und auffallend. Darüber hinaus gab es für sie keine Abstufungen. In dieser Beziehung war sie eben ganz die Tochter ihrer mit einem Hange für alles Protzige behafteten Mutter – leider!
Und nun war dieser Hut in greifbarer Nähe vor dem Assessor, der sofort beschloß, sich die Besitzerin etwas genauer anzusehen.
Diese war nicht allein. In eifrigem Gespräch schritt neben ihr ein schlanker Herr, gekleidet mit einem Stich ins Geckenhafte. Die beiden schienen recht vertraut miteinander.
Noch mehr beobachtete Linker. Andere Herren schauten im Vorübergehen oft genug auf den grauen Hut. Manche grüßten. In dem Gruß kam meist eine gewisse Vertraulichkeit zum Ausdruck. Der Assessor kannte das. So grüßen Herren die Frauen, die sie nicht ganz zu den Damen rechnen.
Nein – Hildegard Kunath konnte das da vorn nicht sein! Die Mutter hatte ihm ja, als sie ihm den Nachmittagskaffee brachte, eine kurze Charakteristik ihres ältesten Kindes entworfen, froh darüber, daß sie jemand gefunden, der Verständnis für ihren Mutterstolz zu haben schien, und schnell immer mehr auftauend, immer eingehender Hildegards Vorzüge preisend, ihren Fleiß, ihre Kindesliebe, ihren Ordnungssinn, ihre Sparsamkeit und besonders ihre Zurückhaltung Herren gegenüber. Und in Bezug auf diese letztere Eigenschaft hatte sie erklärt: »Ja, ja – für meine Hilde kann ich meine Hand ins Feuer legen!« – Diese Redewendung gebrauchte sie scheinbar recht gern.
Also Hildegard konnte es nicht sein. Der graue Hut war ja sicherlich hier in Ixstadt mehrmals vertreten. Immerhin, dachte Linker, du hast ja nichts besseres zu tun … Also beobachten wir weiter …
Der graue Hut trug ein Herbstkostüm in derselben Farbe. Unter dem Rocksaum kamen ein Paar kleine Füßchen in halbhohen Lackschuhen und ein Stück Seidenstrumpf zum Vorschein, der eine zierliche Fessel eng und Haut leicht durchschimmern lassend umspannte. –
Lotte in Barten hätte dies »halbweltmäßig« gefunden. Sie spielte gern das aufgeklärte junge Mädchen, aber mehr in ihren Ausdrücken als in ihren Ansichten.
Am Nordende der Lasterseite machte das Paar kehrt, und Linker sah nun den grauen Hut von vorn.
Jetzt verstand er, weshalb so viele Herren gegrüßt hatten – so gegrüßt hatten …
Der graue Hut war nicht einmal das, was man hübsch nennt. Aber eine … Männerschönheit …! In einem zartrosigen Gesicht brannten ein paar dunkle, große Augen unter kräftigen Brauen. Das Näschen wippte keck in die Welt hinein, und der Mund schien zu glühen mit seinen vollen, roten Lippen. Von dem aschblonden Haar war nicht viel zu sehen. Aber es hatte einen seidigen Glanz und schien reich und voll zu sein. Hinzu kam eine geschmeidige Gestalt, schlank und doch üppig, weiter ein Gang, der leicht wiegend war und selbstbewußte Jugendkraft verriet …
Und dieser Gang gab dem grauen Hut ein besonderes Merkmal; in ihm lag etwas Aufreizendes, etwas Herausforderndes, vielleicht auch Trotziges; und er nahm der Gesamterscheinung so etwas den Eindruck der Dame aus guter Gesellschaft, auf die sonst die Kleidung unfehlbar hingewiesen hätte.
Linker war nun doch wieder im Zweifel, ob es nicht Hildegard Kunath sein könnte … Die Augen hatten zu große Ähnlichkeit mit denen der Mutter. Nur der Ausdruck war verschieden. Hier scheue Bescheidenheit, dort das Bewußtsein, die törichten Männer leicht beherrschen zu können …
Der Assessor wurde angesprochen.
»He, Linker, – ‘n Tag! Also schon hier? Weshalb hast du mich nicht aufgesucht? – Habe jetzt leider keine Zeit. Bitte, sei heute abend unser Gast, ganz zwanglos. Ich werde meiner Frau telephonisch Bescheid sagen.«
Rechtsanwalt Mendel war ein Verbindungsbruder des Assessors. Ein kleiner Herr, etwas zu dick, der in Haltung und Sprache stets die Person von Bedeutung zu spielen suchte.
Linker paßte die Einladung nicht recht. Er war eigentlich verpflichtet, abends an Lotte einen langen, ausführlichen Brief zu schreiben. Anderseits war Mendel wieder sein Brotherr, der ihm in Aussicht gestellt hatte, später einmal sein Teilhaber zu werden, wenn er sich erst nach dem eben bestandenen Assessorexamen eingearbeitet und auch bewährt hatte. Vorläufig zahlte Mendel ihm monatlich zweihundertfünfzig Mark, und Linker war froh gewesen, daß er auf Grund der kouleurbrüderlichen Beziehungen so schnell einen Unterschlupf gefunden hatte. Als Assessor mit dem Prädikat »genügend« hätte er noch Jahre bei der Justiz sich herumstoßen müssen, ehe er auch nur ein Kommissorium mit zweihundert Mark fürstlichem Gehalt bekommen hätte, von einer festen Anstellung schon ganz abgesehen.
So nahm er die Einladung denn mit Dank an, wobei er dachte, daß die Abhängigkeit sich also schon bemerkbar machte. Aber daran ließ sich nichts ändern. Seine Mutter dort in Barten hatte gerade nur so ihr Auskommen mit der Witwenpension und konnte ihrem Einzigen höchstens einmal ein Paket mit Eßwaren senden, wie sie dies schon früher stets getan, als der Sohn noch studierte oder später als Referendar ebenso bescheiden, aber nach außen hin ohne ins Auge fallende Dürftigkeit sich durchhelfen mußte, – eines der vielen Opfer falschen elterlichen Ehrgeizes, der für den Sohn bei allzu kargen Mitteln die richterliche Laufbahn als Ausgleich der eigenen Subalternstellung ansieht. –
Mendel verabschiedete sich. »Habe Vorstandssitzung im Verkehrsverein. Entschuldige – Wiedersehen!«
Der graue Hut war verschwunden. Linker mußte ja nun ohnehin seine Schritte heimwärts lenken. Der Brief an Lotte durfte nicht aufgeschoben werden.
Auf dem Wege nach der Mühlengasse kam er an einem großen Kaufhaus vorüber. – Richtig – eine Krawatte fehlte ihm. Und hier bei »Gebrüder Liemann« sah er den grauen Hut wieder, daneben den Herrn mit dem Stich ins Stutzerhafte. Beide standen an einem Verkaufstisch für Damentaschentücher.
Doch der Assessor schenkte ihnen jetzt weiter keine Beachtung. Der Brief an Lotte würde Zeit erfordern. Und es war bereits sechs Uhr …
Die Sünde
Die Petroleumlampe auf dem Schreibtisch beleuchtete mit rötlichgelbem Schein den vornübergebeugten Kopf Karl Linkers und zauberte auf den dunklen Haarwellen des Scheitels goldig schimmernde Reflexe hervor.
Ein Bogen war eng beschrieben. Nun noch ein halber, – das würde dann auch der Frau Schwiegermutter genügen.
Der Assessor lehnte sich in den Schreibtischsessel zurück und schaute der feinen Rauchspirale nach, die von der auf dem Aschbecher fortglimmenden Zigarette hochstieg, – gedankenverloren, wieder einmal träumend. Hätten ihn seine Bundesbruder so gesehen, so hätte einer todsicher gerufen: »Mädchen dichtet wieder!« –
Ach, das waren noch schöne Zeiten gewesen damals in Freiburg – trotz des knappen Zuschuß von daheim …
Linker lächelte ein wenig … »Mädchen« hatten sie ihn stets genannt, die Westfalen, bei denen er eingesprungen war und deren dreifarbiges Band er stets mit so viel Stolz getragen hatte. Ohne die Altherrenwürde bei der Guestphalia[1] wäre er nicht mit Mendel bekannt geworden, hätte er lange nach einer bezahlten Stelle suchen können. Es hatte sich also doch eingebracht, diese Mehrausgabe für das Verbindungsleben.
Karl Linker schrieb weiter, schilderte sein neues Heim, die ängstlich bescheidene Frau Kunath, die alte Mühle, den Kanal vor den Fenstern … Daß eine Tochter im Hause war, unterschlug er. Die Frau Schwiegermutter hätte vielleicht etwas daran auszusetzen gehabt, daß er trotzdem gemietet hatte. Sie traute den Männern nicht. Daran war der Getreidehändler Harrich schuld. Wegen seiner Seitensprünge stand er im Rufe eines Lebemannes, ein Wort, mit dem die Bartener Spießer den Begriff größter Unmoral verbanden.
Endlich kamen zum Schluß die innigen Küsse und die herzlichsten Grüße für die lieben Eltern … Der Brief war fertig. – Wo aber eine Marke hernehmen? Vielleicht konnte Frau Kunath aushelfen. –
Sie bewohnte das Vorderzimmer, dessen einziges Fenster nach der großen Mühle hinausging. Das dritte Zimmer neben dem des Assessors, ebenfalls nur einfenstrig, war Hildegards Reich. Wo der Sohn untergebracht war, entzog sich vorläufig Linkers Kenntnis.
Er klopfte, und eine Stimme rief: »Herein!«
Er stand … dem grauen Hut gegenüber …!
Die Überraschung kam doch etwas unerwartet. Leicht verwirrt stellte er sich als der neue Hausgenosse vor.
Sie neigte sehr gnädig, zu sehr die Dame heraushebend, den Kopf.
Frau Kunath hatte am Fenster vor einem Kleiderschrank gekniet und trat jetzt näher. Abermals sang sie ein Loblied auf Hildegard, bis diese sie unterbrach. »Aber Mutter …! Den Herrn Assessor dürfte das kaum interessieren.«
Das Organ war angenehm, nur die Sprechweise vielleicht etwas geziert.
Linker wollte sich mit der Haustochter von vornherein auf einen kameradschaftlichen Fuß stellen. Und daher sagte er liebenswürdig: »Ich glaube Sie heute schon einmal gesehen zu haben, gnädiges Fräulein, – nachmittags in der Langgasse und nachher bei …«
Hildegard hatte schnell den Zeigefinger auf die Lippen gelegt und den Assessor dabei warnend angesehen. Frau Kunath hantierte gerade an dem gedeckten Abendbrottisch herum.
Linker schwieg sofort, um hastig hinzuzufügen: »Wenigstens sah ich eine junge Dame mit einem grauen Filzhut …«
»Hildegard kann es nicht gewesen sein,« meinte Frau Kunath gleichmütig. »Sie hatte ja bis sieben Dienst wie alle Tage.« – –
Als der Assessor wieder in seinem Zimmer war und die Briefmarke auf den Umschlag klebte, dachte er mit Recht: »Hier stimmt etwas nicht! Dieses Fräulein Hildegard ist ein Engel mit einem starken Fragezeichen …«
Bald darauf hörte er die Flurtür klappen.
Dann klopfte es.
Es war der Engel mit dem Fragezeichen.
»Entschuldigen Sie, daß ich störe,« sagte das Musterkind kühl und förmlich. »Ich hatte heute geschäftlich in der Langgasse zu tun. Mama liebt es nicht, wenn ich mich dort zeige. Ich erspare mir und ihr gern zwecklose Erklärungen. Daher hatte ich ihr nichts erzählt.«
Linker verbeugte sich. Hildegard stand im Halbdunkel an der Tür. Er konnte ihr Gesicht nicht sehen, nahm nur einen hellen, verschwommenen Fleck wahr. Das störte ihn. Er hätte gern ihre Miene beobachtet, als sie diese etwas unklare Rechtfertigung vorbrachte. Vielleicht lächelte sie ihn dabei spöttisch-überlegen an. Er traute ihr das schon zu. Jedenfalls war sie ihm unsympathisch geworden. Ihre Mutter, eine herzensgute Frau fraglos, derart zu täuschen und die Reine, Harmlose zu spielen, – das stieß ihn ab, obwohl er durchaus kein sogenannter Tugendheld war. Und aus diesem Gefühl der schnell aufgekeimten Abneigung heraus antwortete er ihr absichtlich nicht ein Wort auf ihre nicht recht verständliche Erklärung hin, sondern verneigte sich nur knapp und wartete das weitere ab.
Sie stand noch immer neben der Tür.
Das Schweigen wurde dem Assessor peinlich; es lastete auf ihm wie ein Unbehagen verbreitender Druck. »Wenn ich wenigstens ihr Gesicht sehen könnte!« dachte er. »Warum geht sie nicht …?!«
Schon als er vorhin den Brief an Lotte geschrieben hatte, war über ihm ein schwerer Männerschritt in ruhelosem Auf und Ab hin und her gewandert. Jetzt nahm der unbekannte Bewohner des über Linkers Zimmer gelegenen Raumes seine dröhnende Promenade wieder auf. So fest trat der da oben die Dielen mit offenbar derben Stiefeln, daß die Glocke der Hängelampe zuweilen ganz fein klirrte. Schade – diese Lampe brannte nicht. Sonst hätte Linker Hildegards Antlitz ein wenig studieren können.
In dieses tappende Auf und Ab mischte sich nun plötzlich von der Tür her ein anderer Laut, ein unterdrücktes Aufschluchzen …
Der Assessor schaute schärfer hin. – Hildegard hatte beide Hände vor das Gesicht gelegt und hielt den Kopf tief geneigt.
War das nun auch Komödie wieder?! – Wie sollte er sich hierüber klar werden, wo er dieses junge Weib kaum kannte …?!
Es war lediglich der Kavalier in Linker, der sich trotzdem für verpflichtet hielt, mit ein paar schnellen Schritten vor sie hinzutreten.
Da sanken ihre Arme auch schon herab, der Kopf hob sich, und große, dunkle Augen schauten den Assessor starr an.
»Ich weiß, Sie haben von mir eine sehr ungünstige Meinung gewonnen,« sagte sie mit einer Ruhe und Klarheit, die ihn überraschte. »Ich kann daran nichts ändern.« Und nach kurzer Pause: »Mutter will nachher nochmals zu einer Bekannten gehen. Wenn Sie ein wenig zu uns ins Wohnzimmer kommen wollten … Ich möchte mit Ihnen sprechen …«
Linker überlegte blitzschnell. – Was wollte sie von ihm? – Mit ihm sprechen …? Worüber? Soeben hatte sie doch gesagt: »Ich kann daran nichts ändern …!« Also handelte es sich nicht um eine ausführlichere Rechtfertigung ihres Verhaltens der Mutter gegenüber. Um was aber sonst …?
»Leider bin ich für den Abend ausgebetet[2], gnädiges Fräulein,« erwiderte er gemessen. »Ich stehe aber gern ein andermal zur Verfügung.«
»Das ›gnädige‹ schenken Sie sich bitte, Herr Assessor,« meinte sie gleichmütig. »Nennen Sie mich Fräulein, das genügt. Vater war Werkführer der großen Mühle bis zu seinem Tode vor zwei Jahren. Und seine Tochter hat keinen Anspruch auf diese Anrede, wie sie in anderen Kreisen üblich ist. – Für alle Fälle möchte ich fragen, ob Sie noch Wünsche haben. Sie werden doch sicher spät heimkommen, wenn wir schon zu Ruhe gegangen sind.«
Linker hatte ein feines Gehör. Diese letzten Sätze wurden nicht mehr so zwanglos hingesprochen. Eine gewisse Berechnung, eine für ihn unklare Absicht lag darin.
Wollte Hildegard feststellen, wann sie mit seiner Rückkehr rechnen konnte …?! Und auch dies – wozu nur …?!
»Wünsche – hm ja,« meinte er nachsinnend. »Vielleicht darf ich um ein Kännchen Tee bitten, den Sie mir am besten in die Ofenröhre stellen … – Ach so,« verbesserte er sich, »– Ofenröhre – wir gehen ja dem Frühjahr entgegen! Ich war es in Berlin während meiner Vorbereitung zum Assessorexamen so gewöhnt, abends Tee zu trinken, hatte auch ein Zimmer mit Ofenheizung. – Nun, trotzdem, – dann trinke ich ihn eben kalt …«
»Bitte. Sie werden ihn vorfinden. – Gute Nacht.«
»Einen Augenblick, Fräulein …«
Sie hatte schon den Türdrücker in der Hand, wandte jetzt nur den Kopf nach ihm zurück.
»Sie wollten doch mit mir sprechen, Fräulein,« sagte er etwas eindringlichen Tones. Er mußte Klarheit haben, wie es um den Charakter dieses Mädchens bestellt war. Seine gelinde Abneigung hatte sich noch um ein schwaches Nebengefühl vermehrt: Mißtrauen!
»Ich wollte …!« erwiderte sie kurz. »Doch es wird wohl alles zwecklos sein,« fügte sie leiser hinzu, wie unter der Einwirkung einer traurigen Empfindung des Verkanntwerdens. Und ihre Stimme hatte auch ganz leise gezittert …
Dann war sie hinaus, ehe Linker noch Zeit fand, sie zurückzuhalten.
Und das hätte er gern getan; denn – vielleicht tat er ihr unrecht; vielleicht war sie besser, als es schien. Der wehe Klang dieses … »wohl alles zwecklos« lag noch deutlich in seinem Ohr.
Langsam ging er an den Schreibtisch in den Lichtkreis der Petroleumlampe zurück, deren grüne Arbeitsglocke wie ein Riesensmaragd leuchtete … –
Da war der Brief an Lotte … Wenn sie geahnt hätte, daß er hier gleich am ersten Abend so etwas wie ein kleines Abenteuer erlebt hatte – mit der Wirtin Töchterlein, dem grauen Hut … Oh – Lotte würde sicher eifersüchtig werden …
Lotte und Hildegard … Wie zum Scherz verglich er sie … Dort die ein wenig beschränkte Wohlanständigkeit und Nüchternheit, ein Durchschnittsgeschöpf mit einem Stich ins Reizlose für einen verfeinerten Geschmack, – und hier die lockende Sünde – – Sünde schon allein der Gang, die wiegenden Bewegungen, ganz abgesehen von den Augen und den roten, schmachtenden Lippen …
Plötzlich sagte er ganz laut »Dummheiten!« und machte sich hastig zum Ausgehen fertig. Er war unzufrieden mit sich. Was ging ihn Hildegard an …! Er würde sich überhaupt nicht mehr um sie kümmern. Das war das beste … Sie war ja nicht ganz ungefährlich, besonders wenn man vier endlose Wochen in Barten im Kreise der Familie zugebracht hatte … und Lottchens bräutliche Küsse immer schaler schmeckten …