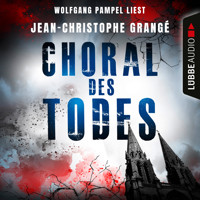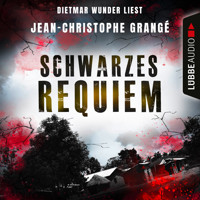7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Atemberaubende Spannung von Frankreichs Thriller-Autor Nr. 1
- Sprache: Deutsch
Eine Reise bis ans Ende der Angst.
Das Pariser Türkenviertel, wo illegal eingeschmuggelte billige Arbeitskräfte unter unmenschlichen Bedingungen leben, wird von drei bestialischen Morden erschüttert. Die Opfer: rothaarige Frauen. Die Tat eines wahnsinnigen Serienmörders? Oder stehen die Morde in einem größeren Zusammenhang?
Zur gleichen Zeit wird Anna Heymes, Gattin eines hochstehenden Pariser Polizeibeamten, im Krankenhaus neurologisch behandelt. Sie hat auf bislang unerklärliche Weise ihr Gedächtnis verloren. Gegen den Willen von Arzt und Ehemann will Anna herausfinden, wer sie wirklich ist. Doch dabei gerät sie nicht nur in Lebensgefahr - sondern gelangt auch zu einer furchtbaren Erkenntnis ...
Zwischen Paris und Istanbul, zwischen Neurologen und den 'Grauen Wölfen', einer skrupellosen türkischen Mafia-Vereinigung, bewegt sich Grangés Mega-Thriller - beklemmend nah an der Realität und von haarsträubender Spannung.
Das Imperium der Wölfe wurde mit Jean Reno in der Hauptrolle verfilmt. Weitere spannende Meisterwerke des Thriller-Genies Jean-Christophe Grangé bei beTHRILLED:
Der Flug der Störche
Der steinerne Kreis
Das schwarze Blut
Das Herz der Hölle
Choral des Todes
Der Ursprung des Bösen
Die Wahrheit des Blutes
Purpurne Rache
Schwarzes Requiem
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Eins
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Zwei
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Drei
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Vier
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Fünf
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Sechs
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Sieben
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Acht
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Neun
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Zehn
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Elf
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Zwölf
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Epilog
Über den Autor
Weitere Titel des Autors
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Das Pariser Türkenviertel, wo illegal eingeschmuggelte billige Arbeitskräfte unter unmenschlichen Bedingungen leben, wird von drei bestialischen Morden erschüttert. Die Opfer: rothaarige Frauen. Die Tat eines wahnsinnigen Serienmörders? Oder stehen die Morde in einem größeren Zusammenhang?
Zur gleichen Zeit wird Anna Heymes, Gattin eines hochstehenden Pariser Polizeibeamten, im Krankenhaus neurologisch behandelt. Sie hat auf bislang unerklärliche Weise ihr Gedächtnis verloren. Gegen den Willen von Arzt und Ehemann will Anna herausfinden, wer sie wirklich ist. Doch dabei gerät sie nicht nur in Lebensgefahr – sondern gelangt auch zu einer furchtbaren Erkenntnis …
JEAN-CHRISTOPHE GRANGÉ
DAS
IMPERIUMDER WÖLFE
Aus dem Französischen von Christiane Landgrebe
Für Priscilla
Eins
Kapitel 1
»Rot.«
Anna Heymes fühlte sich zunehmend unwohl. Die Untersuchung galt als gänzlich ungefährlich, und dennoch beunruhigte sie die Vorstellung zutiefst, dass ein fremder Mensch in diesem Moment ihre Gedanken lesen konnte.
»Blau.«
Sie lag auf einem Untersuchungstisch aus Edelstahl, in der Mitte eines schwach ausgeleuchteten Raumes, und ihr Kopf steckte in der Öffnung eines weißen zylinderförmigen Geräts. In dessen Inneren, direkt über ihrem Gesicht, war ein Spiegel angebracht, auf dem winzige Quadrate aufleuchteten. Anna brauchte nur laut und deutlich die Farben zu nennen, die sie sah.
»Gelb.«
Eine Infusion tröpfelte in ihren linken Arm, ein Radionuklid, wie Dr. Ackermann kurz und bündig erläutert hatte, mit dem man feststellen könne, wie die verschiedenen Hirnzonen durchblutet werden.
Weitere Farben zogen vorbei – Grün, Orange, Rosa –, bis sich der Spiegel verdunkelte. Anna blieb reglos liegen, die Arme dicht an den Körper gepresst, als wäre sie in einen Sarg gezwängt. Auf der linken Seite, nur wenige Meter entfernt, sah sie das diffuse, verschwommene Licht des Glasverschlags, in dem sich Eric Ackermann und Laurent, ihr Mann, aufhielten. Sie stellte sich vor, wie die beiden Männer vor den Bildschirmen standen, um die Bewegung ihrer Neuronen zu verfolgen. Sie drangen in ihre Intimsphäre ein, Anna fühlte sich beobachtet, ausgebeutet, verletzt.
Ackermanns Stimme ertönte aus dem direkt an ihrer Ohrmuschel befestigten Kopfhörer: »Sehr schön, Anna. Jetzt werden sich die Quadrate bewegen. Du musst nur ihre Bewegungsrichtung mit einem Wort beschreiben: rechts, links, oben, unten …«
Sogleich begannen die geometrischen Figuren sich zu regen, sie bildeten ein buntes, fließendes, leicht schwebendes Mosaik, ein Schwarm winziger Fische.
»Rechts.«
Die Quadrate flatterten auf den oberen Rand des Bildes zu.
»Oben.«
Die Übung dauerte ein paar Minuten, und Anna sprach langsam, eintönig. Sie spürte, wie ihr Körper immer starrer wurde, fühlte sich wie betäubt von der Wärme, die der Spiegel abstrahlte. Bald würde sie in Schlaf fallen.
»Perfekt«, sagte Ackermann. »Ich spiele dir jetzt mehrmals hintereinander eine Geschichte vor, und du hörst dir alle Versionen aufmerksam an.«
»Und was soll ich sagen?«
»Kein Wort. Du brauchst nur zuzuhören.«
Nach ein paar Sekunden ertönte eine Frauenstimme, sie redete in einer fremden Sprache, asiatische, womöglich orientalische Klänge drangen an Annas Ohr. Nach kurzem Schweigen setzte die Geschichte erneut ein, diesmal auf Französisch, allerdings schien die Syntax fehlerhaft: falsche Artikel, Verben ertönten überraschenderweise im Infinitiv, und die Aussprache stimmte nicht immer …
Während Anna versuchte, der seltsam verstümmelten Sprache zu folgen, begann eine weitere Version der Geschichte, in welcher sich absurde Worte in die Sätze einschlichen … Was hatte das zu bedeuten? Dann drang ein Schweigen an ihr Trommelfell, und sie fühlte sich noch tiefer in die Dunkelheit des Zylinders hineingestoßen.
Nach einer Weile begann der Arzt erneut: »Nächster Test. Bei jedem Ländernamen nennst du die passende Hauptstadt.«
Noch bevor Anna ihr Einverständnis signalisieren konnte, vernahm sie den ersten Namen: »Schweden.«
Ohne nachzudenken, sagte sie: »Stockholm.«
»Venezuela.«
»Caracas.«
»Neuseeland.«
»Auckland, nein, Wellington.«
»Senegal.«
»Dakar.«
Die Hauptstädte kamen ihr spontan in den Sinn, und wenn es auch reflexartige Antworten waren, so bewiesen diese immerhin, dass sie ihr Gedächtnis nicht ganz verloren hatte. Was sahen Ackermann und Laurent jetzt auf den Bildschirmen? Welche Zonen ihres Gehirns waren gerade besonders aktiv?
»Jetzt kommt der letzte Test«, kündigte der Neurologe an. »Ich zeige dir verschiedene Gesichter, und du sagst so schnell wie möglich, wen du erkennst.«
Irgendwo hatte sie gelesen, dass ein einfaches Zeichen – ein Wort, eine Geste, ein optisches Detail – Angstzustände hervorrufen kann; Psychiater nennen dies den Auslöser. Auslöser: Das war genau der richtige Ausdruck, und in ihrem Fall genügte allein das Wort Gesicht, um diese Übelkeit auszulösen. Sie glaubte dann jedes Mal zu ersticken, hatte ein Druckgefühl im Bauch, ihre Glieder wurden steif – und dieser brennende Kloß im Hals …
Das Bild einer Frau in Schwarz-Weiß tauchte auf dem Spiegel auf. Blonde Locken, Schmollmund, Schönheitsfleck über dem Mund, ganz einfach: »Marilyn Monroe.«
Auf das Foto folgte eine Radierung, düsterer Blick, kantiger Unterkiefer, krauses Haar: »Beethoven.«
Ein rundes Gesicht, glatt wie eine Melone, darin zwei Schlitzaugen. »Mao Tse-tung.«
Weitere folgten, und Anna war überrascht, dass sie die Figuren so schnell erkannte: Michael Jackson, Mona Lisa, Albert Einstein … Wie leuchtende Bilder einer Laterna magica zogen die Porträts vor ihren Augen vorüber. Sie antwortete, ohne zu zögern, und ihr Unwohlsein ließ nach, bis sie beim Porträt eines etwa vierzigjährigen, jung wirkenden Mannes mit leichten Glubschaugen stockte. Er hatte blondes Haar und blonde Augenbrauen, was sein jugendlich-unentschlossenes Aussehen unterstrich.
Die Angst durchflutete sie wie eine elektrische Welle, ein beißender Schmerz packte ihren Körper, denn diese Gesichtszüge weckten dunkle Erinnerungen. Dabei hätte sie weder einen Namen noch sonstige Anhaltspunkte seiner Identität nennen können. Ihr Gedächtnis glich einem dunklen Tunnel. Wo hatte sie dieses Gesicht bereits gesehen? Ein Schauspieler? Ein Sänger? Ein entfernter Bekannter?
Kurz darauf erschien ein längliches Gesicht mit runder Nickelbrille, und sie stieß mit trockenem Mund den Namen »John Lennon« hervor, worauf Che Guevara erschien, doch statt zu antworten, sagte Anna: »Eric, warte mal.«
Das Karussell drehte sich weiter, und während ein Selbstbildnis van Goghs in leuchtenden Farben vor ihren Augen erstrahlte, griff Anna nach dem Schaft des Mikrofons: »Eric, bitte, lass das.«
Das Bild blieb stehen, und Anna spürte, wie sich dessen warme Farben auf ihrer Haut spiegelten. Nach einer Pause fragte Ackermann: »Was?«
»Wer war der Mann, den ich nicht erkannt habe?«
Keine Antwort, stattdessen zitterten David Bowies verschiedenfarbige Augen über den Spiegel, während sie sich aufzurichten versuchte und gereizt nachfragte: »Eric, ich habe dich was gefragt: Wer war es?«
Keine Antwort.
Das Licht im Spiegel erlosch, blitzschnell gewöhnten sich ihre Augen an die Dunkelheit. Statt der Gesichter erahnte Anna auf dem schräg angebrachten Rechteck ihr eigenes blasses, knochiges Bild. Das Gesicht einer Toten.
Schließlich antwortete der Arzt: »Es war Laurent, Anna. Laurent Heymes, dein Ehemann.«
Kapitel 2
»Seit wann leidest du unter diesen Gedächtnisstörungen?«
Anna antwortete nicht. Es war beinahe zwölf Uhr mittags, und den ganzen Vormittag hatte sie Untersuchungen über sich ergehen lassen müssen – eine Computer-Tomografie, Röntgenbilder, eine Magnetresonanz-Tomografie und schließlich die Tests in dieser zylinderförmigen Maschine … Sie fühlte sich ausgelaugt, erschöpft, verloren, und in diesem engen, fensterlosen, grell ausgeleuchteten Büroraum mit stapelweise in Stahlblechschränken oder auf dem Boden verteilten Ordnern wurde es auch nicht besser. An den Wänden hingen Grafiken mit freigelegten Gehirnen, man blickte auf rasierte Schädel mit punktierten Linien, wie angesägt. Das hatte ihr gerade noch gefehlt …
Eric Ackermann fragte erneut: »Seit wann, Anna?«
»Seit über einem Monat.«
»Ich will es genau wissen. Du kannst dich doch sicher an das erste Mal erinnern.«
Natürlich erinnerte sie sich, wie hätte sie es vergessen können?
»Es war am vierten Februar. Morgens. Ich kam gerade aus dem Badezimmer. Auf dem Flur begegnete ich Laurent, der gerade zur Arbeit gehen wollte. Er lächelte mich an, und ich erschrak furchtbar, denn ich erkannte ihn nicht.«
»Überhaupt nicht?«
»Im ersten Augenblick nicht. Dann aber ordnete sich alles wieder in meinem Kopf.«
»Beschreib mir genau, was du in diesem Moment empfunden hast.«
Sie zuckte mit den Schultern, eine Geste der Unentschlossenheit unter ihrem schwarz-braunroten Schal. »Es war eine seltsame, flüchtige Empfindung, eine Art Déjà-vu. Dieses Unwohlsein dauerte nur eine Sekunde«, sie schnippte mit den Fingern, »dann fühlte sich alles wieder normal an.«
»Was hast du in diesem Augenblick gedacht?«
»Ich habe gedacht, es kommt von der Müdigkeit.«
Ackermann schrieb etwas auf einen Block, der vor ihm lag, und fuhr fort: »Hast du an diesem Morgen mit Laurent darüber gesprochen?«
»Nein, ich fand es nicht weiter schlimm.«
»Und wann hattest du die zweite Krise dieser Art?«
»In der Woche danach. Da passierte es mehrmals, Schlag auf Schlag.«
»Und es hatte immer mit Laurent zu tun?«
»Ja, immer.«
»Und jedes Mal hast du ihn am Ende wieder erkannt?«
»Ja, aber je mehr Tage vergingen, desto später … ich weiß nicht … desto länger dauerte es, bis ich ihn erkannte.«
»Und dann hast du mit ihm darüber gesprochen?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
Sie schlug die Beine übereinander und bettete ihre zarten Hände – zwei Vögel mit blassem Gefieder – auf ihren Rock aus dunkler Seide: »Ich hatte den Eindruck, darüber zu reden würde alles nur schlimmer machen. Und außerdem …«
Der Neurologe sah sie an, seine feuerroten Haare spiegelten sich auf der Wölbung seiner Brillengläser. »Und dann?«
»Es ist nicht leicht, seinem Mann so etwas zu sagen. Er …«
Sie spürte Laurents Gegenwart, er stand hinter ihr, an einen Stahlblechschrank gelehnt. »Laurent wurde für mich ein Fremder.«
Der Arzt schien ihre Verwirrung zu bemerken und wechselte das Thema: »Hast du auch bei anderen Gesichtern Schwierigkeiten, sie wieder zu erkennen?«
»Manchmal«, sagte sie zögernd. »Aber nur sehr selten.«
»Bei wem zum Beispiel?«
»Bei den Händlern in unserem Viertel. Auch bei der Arbeit, ich erkenne manche Kunden nicht, obwohl sie regelmäßig kommen.«
»Und deine Freunde?«
Anna machte eine vage Handbewegung: »Ich habe keine Freunde.«
»Deine Familie?«
»Meine Eltern sind tot. Ich habe nur ein paar Onkel und Vettern im Südwesten. Ich besuche sie nie.«
Ackermann machte weitere Notizen, seine Gesichtszüge zeigten nicht den Hauch einer Regung, sie wirkten wie erstarrt.
Anna hasste diesen Mann, ein Freund von Laurents Familie, der gelegentlich abends zum Essen vorbeikam. Von ihm ging eine gleich bleibende eisige Kälte aus, was auch immer geschah, es sei denn, man kam auf seine Forschung zu sprechen – das Gehirn, die Hirngeografie, das kognitive System des Menschen. Dann ergriff ihn eine seltsame Begeisterung, er kam ins Schwärmen, und seine länglichen, rot behaarten Hände gestikulierten wild in der Luft umher.
»Laurents Gesicht stellt also das größte Problem für dich dar?«, fragte der Arzt.
»Ja, aber es steht mir ja auch am nächsten. Ich sehe es nun einmal am häufigsten.«
»Hast du noch andere Erinnerungslücken?«
Anna biss sich auf die Unterlippe, sie zögerte erneut. »Nein.«
»Schwierigkeiten, dich zu orientieren?«
»Nein.«
»Mühe bei der Aussprache?«
»Nein.«
»Fallen dir manche Bewegungen schwer?«
Statt zu antworten, huschte ein feines Lächeln über ihren Mund: »Du denkst, ich hätte Alzheimer, stimmt ’s?«
»Ich will nur sichergehen, das ist alles.«
Es war die erste Krankheit, an die Anna gedacht hatte. Sie hatte sich erkundigt und in medizinischen Lexika nachgelesen: Gesichter nicht wieder zu erkennen war eines der Symptome von Alzheimer.
Ackermann sagte in einem Ton, als wolle er ein Kind zur Vernunft bringen: »Du bist erstens nicht im richtigen Alter, und zweitens hätte ich diese Erkrankung bereits nach der ersten Untersuchung festgestellt. Ein Gehirn, das von einer neurodegenerativen Krankheit befallen ist, weist ganz bestimmte Merkmale auf. Trotzdem muss ich dir all diese Fragen stellen, um eine vollständige Diagnose abzugeben. Verstehst du?«
Er wartete nicht auf ihre Antwort, sondern fuhr fort: »Hast du Mühe, bestimmte Bewegungen auszuführen?«
»Nein.«
»Schlafstörungen?«
»Nein.«
»Plötzliche Abwesenheiten?«
»Nein.«
»Migräneanfälle?«
»Überhaupt nicht.«
Der Arzt legte den Notizblock beiseite. Wenn Dr. Ackermann aufstand, rief er jedes Mal dieselbe Überraschung hervor, schließlich maß er, mit seinen circa sechzig Kilo, einen Meter neunzig; er wirkte wie eine Bohnenstange in einem zum Trocknen aufgehängten Kittel. Er war ein feuriger Rothaariger, sein schlecht geschnittenes krauses Haar flammte lichterloh, und unzählige Sommersprossen übersäten – einschließlich der Augenlider – sein Gesicht, das nicht zuletzt wegen dem Gestell seiner eckigen Metallbrille äußerst kantig wirkte. Obwohl er älter war als Laurent und wie ein junger Mann aussah, hatte er einen merkwürdig alterslosen Ausdruck. Auf seinem Gesicht zeigten sich erste Falten, die seine adlerhaften, scharfen, undurchdringlichen Züge kaum milderten. Aknenarben auf beiden Wangen verliehen ihm etwas Lebendiges, eine Vergangenheit.
Schweigend machte er ein paar Schritte in dem Büroschlauch, die Sekunden zogen sich unerträglich in die Länge, bis Anna es nicht mehr aushielt und fragte: »Was zum Teufel habe ich denn nun?«
Der Neurologe spielte mit einem Metallgegenstand in seiner Tasche, zweifelsohne ein Schlüssel, der mit kurzem Geklimper den folgenden Vortrag einläutete: »Lass mich dir zunächst erklären, was für Experimente wir mit dir gemacht haben.«
»Höchste Zeit.«
»Die Maschine, die wir benutzen, Spezialisten nennen sie auch PET, misst Positronen, und sie basiert auf der Positronenemissions-Tomografie. Indem man die Blutkonzentration untersucht, kann man die Tätigkeit bestimmter aktivierter Hirnzonen in Echtzeit messen. Ich wollte dich gründlich durchchecken und einige Abschnitte der Großhirnrinde auf Funktion überprüfen wie Sehvermögen, Sprache, Gedächtnis, die man allesamt sehr genau lokalisieren kann.«
Anna dachte an die unterschiedlichen Tests, an die farbigen Quadrate, an die in unterschiedlichen Versionen erzählte Geschichte und an die Namen der Hauptstädte. Welche Bedeutung die Übungen gehabt hatten, leuchtete ihr inzwischen ein, doch Ackermann war in Fahrt gekommen.
»Die Sprache zum Beispiel. All das spielt sich im vorderen Hirnlappen ab, einer Gegend, die in verschiedene Zonen unterteilt ist. Sie gelten dem Hören, dem Merken von Wörtern, der Syntax, der Bedeutung, der Metrik.« Er wies mit dem Finger auf seinen Schädel. »Das Zusammenspiel dieser Bereiche ermöglicht es uns, Sprache zu verstehen und zu gebrauchen. Durch die verschiedenen Versionen meiner Geschichte habe ich in deinem Kopf jedes einzelne dieser Systeme gereizt.«
Er ging unaufhörlich in dem engen Zimmer auf und ab. Die Grafiken an der Wand verschwanden und tauchten wieder auf, je nachdem wohin er gerade seine Schritte setzte. Anna sah eine seltsame Zeichnung, die einen farbigen Affen mit einer großen Schnauze und riesigen Händen darstellte. Trotz der Hitze des Lichts durchfuhr eine eisige Kälte ihren Rücken.
»Und?«, flüsterte sie.
Er breitete die Arme zu einer beruhigenden Geste aus: »Alles in Ordnung. Die Sprache, das Sehen, die Erinnerung, jede Region im Gehirn wird normal aktiviert.«
»Nur dann nicht, wenn man mir das Bild von Laurent vorlegt.«
Ackermann beugte sich über den Schreibtisch und drehte den Bildschirm seines Computers zu Anna, damit sie das digitalisierte Bild eines Gehirns sehen konnte, eine Profilansicht in leuchtendem Grün; im Innern war es tiefschwarz.
»Dein Gehirn im Moment, als du das Foto von Laurent betrachtet hast. Keine Reaktion. Keine Verbindung. Ein leeres Bild.«
»Und was bedeutet das?«
Der Neurologe richtete sich auf, steckte beide Hände in die Taschen und wölbte theatralisch die Brust. Der Augenblick des Urteilsspruchs war gekommen. »Ich glaube, du hast eine Schädigung.«
»Eine Schädigung?«
»Eine Schädigung in dem Bereich des Gehirns, mit dessen Hilfe Gesichter erkannt werden.«
Anna fragte erstaunt: »Gibt es eine Gesichterzone?«
»Ja, es gibt in der rechten Hirnhälfte Neuronenverbände, die speziell für diese Aufgabe bestimmt sind. Sie befinden sich an der unteren Seite des Temporallappens im hinteren Teil des Gehirns und wurden in den fünfziger Jahren entdeckt. Patienten, die in dieser Hirnregion Durchblutungsstörungen erlitten hatten, konnten keine Gesichter mehr erkennen. Seitdem kann diese Region mithilfe des PET viel besser lokalisiert werden. Man weiß zum Beispiel, dass dieser Bereich bei Menschen, die einen Blick für Gesichter entwickeln – etwa bei Türstehern und Kellnern –, besonders ausgebildet ist.«
»Aber ich erkenne doch die meisten Gesichter, bei dem Test habe ich alle erkannt«, versuchte Anna zu beschönigen.
»Alle Fotos – bis auf das Foto deines Mannes. Und das ist ein ernst zu nehmendes Zeichen.«
Ackermanns Zeigefinger umspielten seine Lippen, er dachte nach, und seine Eiseskälte wich heller Begeisterung: »Wir haben zwei Arten von Gedächtnis. Es gibt die Dinge, die man uns in der Schule beibringt, und das, was wir im Privatleben lernen. Im Gehirn lassen sich diese Gedächtnisformen voneinander abgrenzen. Ich nehme an, bei dir ist die Verbindung zwischen der spontanen Analyse von Gesichtern und ihrer Einordnung in deine persönlichen Erinnerungen gestört. Irgendeine Schädigung setzt diesen Mechanismus außer Kraft. Du erkennst Einstein, Laurent aber nicht, denn er gehört in dein Privatarchiv.«
»Kann man das behandeln?«
»Absolut. Wir werden diese Funktion in einen gesunden Bereich deines Kopfes verlegen, immerhin ist die Verformbarkeit einer der großen Vorteile des menschlichen Gehirns. Zu diesem Zweck musst du dich einer Rehabilitation unterziehen, einer Art Geistestraining, regelmäßigen Übungen, die von geeigneten Medikamenten unterstützt werden.«
Keine besonders gute Nachricht, wie dem ernsten Tonfall des Neurologen zu entnehmen war.
»Und wo liegt das Problem?«, fragte Anna.
»In der Ursache der Verletzung. Da trete ich, wie ich zugeben muss, auf der Stelle. Wir haben keinerlei Hinweise auf einen Tumor gefunden, keine neurologische Auffälligkeit. Du hast keine Schädelverletzung erlitten und auch keine geplatzte Ader, wegen der dieser Teil des Gehirns nicht mehr durchblutet würde.« Er schnalzte mit der Zunge. »Wir müssen neue, tiefer gehende Untersuchungen durchführen, um die Diagnose zu vervollständigen.«
»Was für Untersuchungen?«
Der Arzt setzte sich hinter seinen Schreibtisch, dann sah er sie an, seine Augen überzog ein seltsamer Glanz: »Eine Biopsie, bei der eine winzige Menge Hirngewebe entnommen wird.«
Es dauerte ein paar Sekunden, bis Anna begriffen hatte. Der Schreck fuhr ihr in die Glieder. Sie wandte sich Laurent zu und bemerkte, dass er mit Ackermann einvernehmliche Blicke austauschte. Wut trat an die Stelle ihrer Angst: Die beiden waren Komplizen, und das vermutlich seit heute Morgen.
Ihre Lippen zitterten, als sie anhob: »Das kommt gar nicht in Frage.«
Der Neurologe lächelte zum ersten Mal. Sein kaltes, künstliches Lächeln sollte Anna besänftigen, doch sie spürte, wie ihre Unruhe zunahm.
»Du hast nichts zu befürchten. Wir werden eine stereotaktische Biopsie vornehmen. Dabei verwendet man eine Sonde, die …«
»Ich lasse keinen an mein Gehirn ran.«
Anna stand auf und rückte ihren Schal zurecht, der sich zu beiden Seiten des Halses wie ein goldener Rabenflügel über ihre Schultern spannte. Laurent ergriff das Wort: »Das darfst du so nicht sehen, Eric hat mir versichert, dass …«
»Du bist wohl auf seiner Seite?«
»Wir sind alle auf deiner Seite«, betonte Ackermann.
Sie trat ein paar Schritte zurück, um die beiden nebeneinander stehenden Heuchler besser betrachten zu können. »Ich lasse niemanden an mein Gehirn ran«, wiederholte sie. Ihre Stimme klang kräftiger, selbstsicherer. »Lieber verliere ich mein Gedächtnis ganz oder sterbe an der Krankheit. Hierher komme ich jedenfalls nie wieder.«
Und dann schrie sie laut, von Panik ergriffen: »Niemals, habt ihr mich verstanden?«
Kapitel 3
Sie lief den menschenleeren Flur entlang, rannte die Treppe hinunter und blieb auf der Schwelle des Eingangsportals stehen. Sie spürte, wie der kalte Wind ihre blasse Haut belebte. Die Sonne beschien den Innenhof, und Anna träumte von der Helligkeit des Sommers, träumte von einem Sommer ohne Hitze und ohne Laub im Geäst der Bäume, die eine unsichtbare Hand mit einer Eisschicht überzogen hatte, um die Stimmung des Augenblicks festzuhalten.
Vom anderen Ende des Innenhofs wurde sie von Nicolas, dem Chauffeur, erkannt. Er sprang aus dem Wagen, um ihr die Tür zu öffnen. Anna schüttelte den Kopf, sie würde zu Fuß gehen, zog mit zitternder Hand eine Zigarette aus ihrer Handtasche, zündete sie an und genoss den herben Geschmack, der ihr in die Kehle drang.
Zum Becquerel-Institut gehörten mehrere vierstöckige Gebäude, die einen Innenhof umschlossen, der dicht mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt war. An den farblosen, grauen oder rosafarbenen Fassaden waren Warnschilder angebracht: Unbefugten Eintritt verboten – Zugang nur für medizinisches Personal – Achtung Gefahr! Jedes Detail in diesem verdammten Krankenhaus wirkte feindselig.
Sie nahm erneut einen tiefen Zug, der Geschmack des verbrennenden Tabaks beruhigte sie, als wäre ihr ganzer Zorn in diesem winzigen Feuer in Rauch aufgegangen. Sie schloss die Augen und genoss den betäubenden Duft.
Schritte in ihrem Rücken. Laurent überquerte den Hof und ging an ihr vorbei, ohne sie eines Blickes zu würdigen. Dann öffnete er den hinteren Wagenschlag, sein Gesicht war verkniffen, die Sohlen seiner polierten Mokassins pochten ungeduldig auf den Asphalt. Anna warf ihre Marlboro zu Boden, kam auf ihn zu und sank auf den Ledersitz. Laurent schloss die Tür, er ging um den Wagen herum und setzte sich neben seine Gattin. Nach dieser schweigsamen Zeremonie startete der Chauffeur den Wagen und glitt mit der Langsamkeit eines Raumschiffs über den abschüssigen Parkplatz.
Vor der weißroten Schranke des Tors hielten mehrere Soldaten Wache.
»Ich hole eben meinen Pass«, sagte Laurent.
Anna sah auf ihre Hände, die noch immer zitterten, nahm eine Puderdose aus ihrer Handtasche und betrachtete ihr Gesicht in dem ovalen Schminkspiegel. Sie hatte befürchtet, Spuren ihrer inneren Erregung zu entdecken, doch sie blickte in dasselbe glatte Gesicht mit den selben regelmäßigen, schneefahlen Zügen, die eingefasst wurden von den rabenschwarzen Strähnen ihrer Kleopatrafrisur. Sie erblickte dieselben mandelförmigen dunkelblauen Augen – und dieselben Lider, die sich mit der Trägheit einer Katze langsam schlossen.
Sie sah, wie Laurent zurückkam. Er beugte sich im Wind nach vorn und schlug den Kragen seines schwarzen Mantels hoch. Plötzlich durchfuhr ihren Körper eine Welle der Wärme und Lust, und sie musterte ihn eingehender: seine blonden Locken, seine leichten Glubschaugen, die Qual, die auf seiner Stirn abzulesen war … Mit unsicherer Hand umklammerte er den Saum seines Mantels, dabei wollte die Bewegung des schüchternen, vorsichtigen Jungen nicht zu dem hochrangigen Beamten passen, der über beachtliche Einflussmöglichkeiten verfügte. Wenn er einen Cocktail bestellte und in kleinsten Mengenangaben die gewünschte Mischung beschrieb, machte er dieselbe linkische Bewegung; oder wenn er seine beiden Hände zwischen ihre Schenkel legte und die Schultern hob, als sei ihm kalt oder als schäme er sich. Diese ungelenke Zartheit hatte sie seinerzeit verführt, seine Fehler und Schwächen, die so wenig zu der Macht passten, die er in Wirklichkeit besaß. Was war davon geblieben? Was liebte sie noch an ihm? Woran konnte sie sich erinnern?
Laurent sank auf die Sitzbank, während die Schranke sich öffnete, und grüßte die bewaffneten Soldaten, als der Wagen den Schlagbaum passierte. Die respektvolle Geste ließ Annas Wut erneut aufschäumen, ihre Erregung schwand, und sie fragte mit allem Nachdruck: »Was sollen all diese Bullen hier?«
»Es sind Militärs«, korrigierte Laurent. »Soldaten.«
Das Auto trieb im Verkehrsstrom davon. Die Place du Général-Leclerc in Orsay schien winzig und war doch gewissenhaft angelegt: eine Kirche, ein Rathaus, ein Blumenhändler, jede Einzelheit überdeutlich zu erkennen.
»Was sollen diese Soldaten?«, fragte sie hartnäckig.
Laurent antwortete unkonzentriert, zerstreut: »Wegen des 15O.«
»Wegen was?«
Er sah sie nicht an, seine Finger klopften gegen die Fensterscheibe. »15O, das Radionuklid, das man dir für die Untersuchung ins Blut gespritzt hat. Es ist eine radioaktive Substanz.«
»Ist ja zauberhaft.«
Laurent wandte sich ihr zu, er wollte Anna besänftigen, doch seine Pupillen konnten seine Beunruhigung kaum verbergen. »Es ist vollkommen ungefährlich.«
»Und diese Wächter sind alle da, weil es vollkommen ungefährlich ist?«
»Stell dich nicht so dumm an. In Frankreich werden alle Vorgänge, bei denen nukleares Material verwendet wird, von der CEA, der Kommission für Atomenergie, überwacht. Und bei der CEA sind nun mal Militärs, das ist alles. Eric ist verpflichtet, mit der Armee zusammenzuarbeiten.«
Anna lachte ironisch.
»Was ist los?«
»Nichts. Aber musstest du unbedingt das Krankenhaus in der Umgebung von Paris aussuchen, in dem es mehr Uniformen als weiße Kittel gibt?«
Er zuckte mit den Schultern und betrachtete die Landschaft. Der Wagen passierte längst das Bièvre-Tal, dunkle braunrote Wälder zogen zu beiden Seiten der Autobahn vorüber, und über weite Strecken stieg der Asphalt an, um kurz darauf ebenso weit abzufallen. In der Ferne versuchte ein grelles weißes Licht, sich einen Weg durch die tief hängenden Wolkenschwaden zu bahnen, der strahlende Glanz der Sonne schien in jedem Augenblick die Wolken durchbrechen und die Landschaft in helles Licht tauchen zu können.
Eine Viertelstunde fuhren sie schweigend dahin, dann begann Laurent erneut: »Du musst Vertrauen zu Eric haben.«
»Ich lasse niemanden an mein Gehirn.«
»Eric weiß, was er tut. Er gehört zu den führenden Neurologen Europas …«
»Und er ist dein Jugendfreund, das hast du mir schon hundert Mal erzählt.«
»Es ist eine große Chance, von ihm behandelt zu werden. Du …«
»Ich bin nicht sein Versuchskaninchen.«
»Sein Ver-suchs-ka-nin-chen?« Er betonte jede einzelne Silbe. »Wovon redest du bloß?«
»Ackermann beobachtet mich. Er interessiert sich für meine Krankheit. Sonst nichts. Dieser Kerl ist Forscher, aber kein Arzt.«
Laurent seufzte: »Du bist ja nicht bei Trost. Du bist wirklich …«
»Verrückt?« Annas aufgesetztes Lachen sackte in der Mitte der Sitzbank wie ein eiserner Vorhang nieder. »Das ist keine Neuigkeit.«
»Und was hast du vor? Ruhig abwarten, bis die Krankheit sich weiter ausbreitet?«
»Niemand sagt, dass meine Krankheit schlimmer wird.«
Unruhig rückte er auf seinem Platz hin und her. »Das stimmt. Entschuldige, ich rede dummes Zeug.«
Wieder herrschte Schweigen im Wageninnern.
Die Landschaft glich mehr und mehr einem Feuer aus feuchtem Gras, unwirsch, von zartem Rot umflammt, von grauen Nebelschwaden durchzogen. Einförmig erstreckten sich Wälder über den Horizont, die, je näher der Wagen kam, die Form blutiger Krallen, fein ziselierter Figuren, tiefschwarzer Arabesken annahmen … Von Zeit zu Zeit tauchte ein Dorf auf, einen Kirchturm umrahmend, oder ein Wasserschloss, dessen makelloses Weiß im flirrenden Licht verschwamm. Kaum zu glauben, dass Paris so nah war.
Laurent unternahm einen letzten Versuch, die Situation zu entspannen: »Versprich mir wenigstens, dass du noch weitere Untersuchungen machen lässt. Ohne Biopsie. Es dauert ja nur wenige Tage.«
»Wir werden sehen.«
»Ich begleite dich auch. Ich nehme mir so viel Zeit wie nötig. Wir sind auf deiner Seite, verstehst du?«
Dieses »Wir« missfiel Anna, es zeigte, wie sehr Laurent sein Wohlwollen ihr gegenüber mit Ackermann teilte. Sie war schon mehr Patientin als Ehefrau.
Als sie die Hügelkuppe oberhalb von Meudon überquerten, weitete sich der Ausblick über dem strahlenden Weiß endlos dahinfließender Dächer. Paris leuchtete in der funkelnden Klarheit des Sonnenlichts, die Stadt ähnelte einem zugefrorenen See voller Kristalle, voller Eisnadeln und Schneeschollen, und die Gebäude von La Défense glichen hohen Eisbergen.
Die blendende Pracht versetzte Anna und Laurent in stummes Staunen. Ohne ein einziges Wort zu wechseln, überquerten sie den Pont de Sèvres und passierten Boulogne-Billancourt, bis schließlich Laurent kurz vor der Porte de Saint-Cloud fragte:
»Soll ich dich zu Hause absetzen?«
»Nein, bei der Arbeit.«
»Hattest du nicht gesagt, du wolltest dir heute frei nehmen?«
Ein Vorwurf lag in seiner Stimme.
»Ich dachte, ich würde zu müde sein«, log Anna. »Und ich will Clothilde nicht allein lassen. Samstags herrscht im Laden immer sehr großer Andrang.«
»Clothilde, der Laden …«, wiederholte er in sarkastischem Ton.
»Na und?«
»Diese Arbeit ist wirklich unter deinem Niveau.«
»Du meinst unter deinem.«
Laurent schwieg, womöglich hatte er den letzten Satz überhört, und reckte den Hals: Der Verkehr auf der Ringautobahn war zum Erliegen gekommen. In ungeduldigem Ton forderte er den Chauffeur auf, er solle sie »da rausholen«. Nicolas hatte sogleich verstanden. Er zog ein Magnet-Blaulicht aus dem Handschuhfach und heftete es auf das Dach des Peugeot 607. Unter Sirenengeheul bahnte sich die Limousine ihren Weg durch den Verkehr, sie legte an Tempo zu. Nicolas nahm den Fuß nicht mehr vom Gas, während sich Laurent an die Rückenlehne des Vordersitzes klammerte und jede Bewegung des Fahrers aufmerksam verfolgte, gebannt wie ein vor einem Videospiel sitzendes Kind. Trotz aller Diplomatie, trotz seines leitenden Postens im Innenministerium konnte Laurent die Spannung am Ort des Geschehens, die Faszination der Straße nicht vergessen. Armer Bulle, dachte Anna.
An der Porte Maillot verließen sie den Boulevard Périphérique, und als sie in die Avenue des Ternes einbogen, stellte der Chauffeur die Sirene wieder ab. Anna war zurück in ihrer Alltagswelt, die die prachtvollen Schaufenster der Rue du Faubourg-Saint-Honoré und die weiten Fensterfluchten in der ersten Etage der Salle Pleyel mit ihren Tänzerinnen-Motiven ebenso umspannte wie die Mahagoniarkaden von Mariage Frères, wo sie erlesene Teesorten zu kaufen pflegte.
Bevor Anna die Tür des Peugeot öffnete, nahm sie das von der Sirene unterbrochene Gespräch wieder auf: »Es ist nicht nur ein Job, weißt du. Es ist meine einzige Chance, mit der Außenwelt in Verbindung zu bleiben. Sonst würde ich in unserer Wohnung ja völlig durchdrehen.«
Sie stieg aus dem Wagen und beugte sich noch einmal zu ihm herunter: »Entweder ich mache das, oder ich komme ins Irrenhaus, verstehst du?«
Sie tauschten einen letzten Blick und waren für einen Augenblick wieder Verbündete. Es wäre ihr nicht in den Sinn gekommen, ihre Verbindung als »Liebe« zu bezeichnen, doch waren sie Komplizen, denn da war etwas Gemeinsames auch jenseits von Lust und Leidenschaft, jenseits der durch Tage und Launen bestimmten Schwankungen. Sie waren wie ruhige, unterirdische Wasser, die sich in der Tiefe mischten, sie verstanden sich auch ohne Worte, ohne das Spiel der Lippen …
Plötzlich fasste sie wieder Mut, Laurent würde ihr helfen, würde sie lieben und stützen. Sie malte sich aus, wie die Dunkelheit umschlagen würde in ein warmes weiches Licht, als Laurent fragte: »Soll ich dich heute Abend abholen?«
Sie nickte zustimmend, hauchte ihm einen Kuss zu und trat vor die Maison du Chocolat.
Kapitel 4
Die Türglocke des Geschäfts läutete, als betrete eine gewöhnliche Kundin den Laden, und das vertraute Geräusch besänftigte Annas Gemüt. Sie hatte sich vor wenigen Monaten auf einen Aushang im Schaufenster für diese Stelle beworben. Zunächst wollte sie sich mit der Arbeit von ihren Wahnvorstellungen ablenken, doch schnell hatte sie einen Zufluchtsort gefunden, einen Bannkreis, der sämtliche Ängste fern hielt. Der Klang der Türglocke erfüllte sie mit Zuversicht.
Vierzehn Uhr, der Laden war leer, und vermutlich hatte Clothilde die Ruhe genutzt, um im Vorratsraum oder im Lager nach dem Rechten zu sehen.
Anna durchschritt das Geschäft, das selbst einer Schokoladenschachtel glich. Überall schimmerte es in Braun und Gold, und in der Mitte des Raumes stand die Theke mit den klassisch schwarzen und cremefarbenen Waren, aufgebaut wie ein Orchester: Da waren viereckige und runde Schokoladen, Schokoladen in allen Formen und Größen … Links ruhte die Kasse auf einem Marmorblock, dort, wo die Blickfänger standen, kleine ausgefallene Naschereien, die der Kunde im letzten Moment, wenn er bereits zahlte, noch hinzukaufte. Rechts lagerten allerlei Süßigkeiten wie kandierte Früchte, Bonbons, Honig- und Mandelstücke, allesamt Variationen eines einzigen Themas. Darüber, in den Regalen, leuchteten weitere Leckereien in Tüten aus Zellophanpapier, deren gebrochene Lichtreflexe die Lust nach dem Genuss der Köstlichkeiten weckten.
Anna bemerkte, dass Clothilde das Osterfenster fertig dekoriert hatte. In geflochtenen Körben lagen Eier und Hühner jeglicher Größe. Um Häuser aus Schokolade mit Dächern aus Karamell sammelten sich kleine Marzipanschweine, Küken standen auf einer Schaukel, im Hintergrund lagerten Osterglocken aus Papier.
»Toll, dass du schon da bist. Die Ware ist gerade angekommen.«
Clothilde trat am hinteren Ende des Raumes aus dem Lastenaufzug, der mit einem altmodischen Rad und einem Seil betrieben wurde, das über eine Winde lief. So konnte man die Kisten direkt vom Parkplatz am Square du Roule nach oben befördern. Sie sprang von der Plattform herunter, ging um die aufgestapelten Schachteln herum und stand mit einem Mal strahlend und außer Atem vor Anna.
Clothilde war in wenigen Wochen zu ihrer Beschützerin geworden. Sie war achtundzwanzig, hatte eine kleine rosa Nase, und immer wieder verdeckten rötlich blonde Haarsträhnen ihre Augen. Sie hatte zwei Kinder, einen Mann, der in einer Bank arbeitete, ein Haus, das sie noch abzahlten, und eine wie auf dem Reißbrett entworfene Zukunft. Mit dieser jungen Frau zusammen zu sein, die in einer Gewissheit ungebrochenen Glücks lebte, war beruhigend und irritierend zugleich. Keinen Moment konnte Anna an dieses Traumbild glauben, auf dem es weder Unebenheiten noch Überraschungen gab und das etwas Besessenes und Verlogenes an sich hatte. Dieses Bild schien unerreichbar für Anna, die mit ihren einunddreißig Jahren keine Kinder hatte und von einem bedrückenden Gefühl verfolgt wurde, das sich aus Unsicherheit und Zukunftsangst speiste und niemals von ihr abließ.
»Es ist die Hölle heute, und es nimmt gar kein Ende.«
Clothilde griff einen Karton und ging in den zwischen dem Ende des Ladens und dem Lager gelegenen Vorratsraum. Anna rückte ihr Tuch zurecht und folgte ihr. Samstags herrschte ein solcher Andrang, dass man jede ruhige Minute nutzen musste, um die Tabletts mit den Köstlichkeiten neu zu arrangieren.
Sie betraten den Vorratsraum, ein fensterloses, zehn Quadratmeter großes Zimmer, in dem kaum noch Platz war zwischen Verpackungsmaterial aus Karton und Unmengen Luftpolsterfolie.
Clothilde stellte ihren Karton ab und blies aus der vorgeschobenen Unterlippe einige Haarstränen aus der Stirn: »Ich hab dich noch gar nicht gefragt: Wie war es?«
»Sie haben mich den ganzen Vormittag untersucht, der Arzt hat etwas von einer Schädigung gesagt.«
»Einer Schädigung?«
»Ein Bereich in meinem Gehirn, mit dem man Gesichter erkennt, ist tot.«
»Das ist aber blöd. Kann man was dagegen tun?«
Anna stellte ihre Schachtel auf den Boden und wiederholte Ackermanns Worte: »Ich werde mich einer Therapie aus Gedächtnisübungen und Medikamenten unterziehen müssen, um die Hirnfunktion des geschädigten Abschnitts in einen anderen Bereich meines Gehirns zu verlagern. In einen gesunden Bereich.«
»Das ist ja toll!«
Clothilde lächelte voller Begeisterung, als hätte sie erfahren, dass Anna geheilt war; ihr Gesichtsausdruck entsprach nur in den seltensten Fällen der jeweiligen Situation, meist verriet er unverhohlen, wie gleichgültig ihr letztlich die Dinge waren. In Wahrheit hatte Clothilde wenig Sinn für das Unglück anderer, Sorgen, Angst und Unsicherheit glitten an ihr ab wie Öltropfen auf einem Wachstuch, doch in diesem Moment schien sie zu merken, dass sie in ein Fettnäpfchen getappt war.
Die Türglocke kam ihr zu Hilfe.
»Ich gehe«, sagte sie und wandte sich um. »Mach schon weiter, ich komme gleich wieder.«
Anna schob ein paar Kartons zur Seite und setzte sich auf einen Hocker. Dann begann sie, Romeos – viereckige Zuckermandelstückchen mit Kaffee – auf einem Tablett hübsch anzuordnen. Der Raum war von einem durchdringenden Schokoladegeruch erfüllt. Am Abend rochen Kleider und selbst Schweiß nach Schokolade, der Speichel war zuckerig, dabei hieß es immer, Bedienstete einer Bar würden vom Einatmen des Alkoholduftes betrunken werden. Ob Schokoladenverkäuferinnen dick wurden, weil sie Tag für Tag mit Süßigkeiten hantierten?
Anna hatte bislang kein Gramm zugenommen. Sie nahm niemals zu, denn sie achtete streng auf ihre Diät, und obendrein schien die Nahrung ihr zu misstrauen: Kohlehydrate, Fette und andere Nahrungsbestandteile machten einen Bogen um sie …
Während sie die Schokoladenstücke nebeneinander aufreihte, kamen ihr Ackermanns Worte in den Sinn. Eine Schädigung. Eine Krankheit. Eine Biopsie. Nein, sie würde nie an sich herummetzgern lassen, schon gar nicht von diesem Kerl mit den eiskalten Gesten und dem Insektenblick.
Außerdem glaubte sie nicht an seine Diagnose. Sie konnte einfach nicht daran glauben, aus dem einfachen Grund, dass sie ihm die ganze Wahrheit verschwiegen hatte.
Seit Februar waren ihre Anfälle wesentlich häufiger geworden, als sie zugegeben hatte. Sie wurde von Erinnerungslücken überrascht, hier und jetzt und in allen nur denkbaren Alltagssituationen. Beim Abendessen mit Freunden, beim Friseurbesuch oder beim Einkaufen fühlte sich Anna plötzlich von Unbekannten umgeben, selbst in der vertrautesten Umgebung war sie umringt von namenlosen Gesichtern.
Und auch die Art der Störung hatte sich weiterentwickelt, neben Erinnerungslücken und blinden Flecken überfielen sie Furcht erregende Halluzinationen. Gesichter zitterten und verflossen, ihr Ausdruck löste sich auf und begann zu verschwimmen wie klar umrissene Konturen im tiefen Gewässer. Manchmal kamen ihr solche Gesichter vor wie Figuren aus heißem Wachs: Sie schmolzen und fielen in sich zusammen oder verfinsterten sich zu teuflischen Grimassen. Dann wieder vibrierten die Gesichtszüge, bebten, zuckten, zitterten und formten sich zu einem Schrei, einem Lachen, einem Kuss. All dies bündelte sich in ein und demselben Gesicht. Der reinste Albtraum.
Um diesem Albtraum zu entkommen, senkte Anna tagsüber, wenn sie in der Stadt umherlief, den Blick zu Boden, und abends unterhielt sie sich, ohne ihre Gesprächspartner anzusehen. Allmählich verwandelte sie sich in ein unsicheres, zitterndes, angstvolles Wesen, das in den anderen nichts als das Abbild des eigenen Wahns wahrnahm. Ein Spiegel des Schreckens.
Und auch ihre Empfindungen gegenüber Laurent hatte sie Ackermann nicht klar und deutlich beschrieben. Da war eine Irritation, die nie von ihrer Seite schwand. Immer blieb eine Spur Angst zurück, es war, als würde sie ihren Mann nur teilweise erkennen, als sagte ihr eine Stimme: ›Er ist es, aber zugleich ist er es nicht.‹ Laurents Gesichtszüge hatten sich verändert, als wären sie von einem Schönheitschirurgen umgestaltet worden.
Es war einfach absurd. Dabei hatten ihre Wahnvorstellungen ein noch absurderes Gegenstück, denn während Laurent ihr zusehends wie ein Fremder vorkam, gab es im Laden einen Kunden, der in ihr ein intensives Gefühl der Vertrautheit auslöste. Sie war sicher, ihn schon irgendwo gesehen zu haben … Zwar konnte sie nicht sagen, wann oder wo sie ihn gesehen hatte, doch jedes Mal, wenn sie sich über den Weg liefen, durchfuhr ihr Gedächtnis eine Unruhe, womöglich eine elektrostatische Erregung, nie jedoch mehr als ein Funken. Eine genaue Erinnerung wollte sich nicht einstellen.
Der Mann kam zwei oder drei Mal die Woche und kaufte immer dasselbe Konfekt, Jikola, viereckige, mit Mandelcreme gefüllte Pralinés, die an orientalische Süßigkeiten erinnerten. Er sprach mit leichtem Akzent, sie tippte auf eine arabische Herkunft, war vierzig Jahre alt und trug immer die gleiche Jeans und eine bis zum Kragen zugeknöpfte, abgenutzte Wildlederjacke. Der ewige Student. Anna und Clothilde nannten ihn »Monsieur Wildleder«.
Jeden Tag warteten sie auf seinen Besuch, er verbreitete Spannung im Ladeninneren und hatte etwas Rätselhaftes an sich, das Abwechslung brachte in die öde dahinfließenden Stunden des Geschäftstages. Oft stellten sie alle möglichen Vermutungen an, denen zufolge er ein Jugendfreund von Anna oder ein früherer Flirt gewesen sein könnte – oder ein heimlicher Verführer, mit dem sie in einer Cocktailbar flüchtige Blicke getauscht hatte.
Und doch wusste Anna, dass die Wahrheit viel einfacher war, dass diese Erinnerung nichts anderes sein konnte als eine der zahlreichen Halluzinationen, die ihre Hirnschädigung auslöste. Es hatte keinen Sinn, sich mit dem, was sie sah, oder mit dem, was sie empfand, wenn sie Gesichter betrachtete, zu beschäftigen. Sie verfügte über kein festes Bezugssystem mehr.
Anna erschrak, als die Tür zum Vorratsraum aufsprang, und stellte fest, dass die Schokolade in ihren Händen zu schmelzen begann. Clothilde erschien im Türrahmen und flüsterte durch ihre Haarsträhnen: »Er ist da.«
Monsieur Wildleder stand bereits nahe bei den Jikola.
»Guten Tag«, sagte Anna eilig. »Was wünschen Sie?«
»Zweihundert Gramm wie immer.«
Sie schob sich hinter die Theke, nahm eine Zange und eine Zellophantüte und begann, die Schokoladenstücke hineinzufüllen. Gleichzeitig warf sie durch die halb geschlossenen Lider einen Blick auf den Mann. Zuerst sah sie seine Schuhe aus grobem Leder, dann die zu langen Jeans, die Falten schlugen wie ein Akkordeon, und schließlich die safrangelbe Lederjacke, die so abgenutzt war, dass sich große orangefarbene Flecken auf ihr abzeichneten.
Schließlich traute sie sich, sein Gesicht eingehender zu betrachten: struppiges, kastanienbraunes Haar und ein abstoßendes, viereckiges Gesicht, das eher an die kantigen Konturen eines Bauern erinnerte als an die feinen Züge eines Studenten. Zudem waren die Augenbrauen verkniffen in einem Ausdruck von Verärgerung oder unterdrückter Wut.
Und doch erkannte Anna, sobald sich seine Lider öffneten, lange, mädchenhafte Wimpern über violettblauen, schwarzgolden umrandeten Augen; ferner den Rücken einer Hummel, die über ein dunkles Veilchenfeld fliegt. Wo hatte sie diesen Blick bloß schon gesehen?
Sie legte die Tüte auf die Waage.
»Elf Euro, bitte.«
Der Mann zahlte, nahm die Schokolade und wandte sich zur Tür. Eine Sekunde später war er verschwunden.
Unwillkürlich folgten Anna und Clothilde dem Fremden bis zur Türschwelle und sahen, wie die Gestalt die Rue du Faubourg-Saint-Honoré überquerte und in einer schwarzen Limousine mit grau getönten Scheiben und ausländischem Nummernschild verschwand.
Sie verharrten auf dem Bürgersteig wie zwei Heuschrecken im Sonnenlicht.
»Na, wer ist es?«, fragte Clothilde. »Weißt du es immer noch nicht?«
Das Auto verschwand im Stadtverkehr. Statt einer Antwort sagte Anna leise: »Hast du ’ne Zigarette?«
Clothilde zog ein zerknittertes Päckchen Marlboro Lights aus ihrer Hosentasche. Mit dem ersten Zug stellte sich jene Entspannung ein, die Anna am Morgen der Untersuchung im Klinikinnenhof überkommen hatte. Skeptisch sagte Clothilde: »Irgendetwas stimmt nicht an deiner Geschichte.«
Anna wandte sich um, der Ellbogen schwebte in der Luft, die Zigarette zielte auf Clothilde. »Was sagst du da?«
»Angenommen, du hast den Kerl gekannt und er hat sich verändert. Kann ja sein.«
»Na und?«
Clothilde schürzte die Lippen und formte einen dumpfen ploppenden Laut, als würde der Kronkorken einer Bierflasche aufgehebelt. »Warum erkennt er dich dann nicht?«
Anna sann den Karosserien der Autos hinterher, die unter dem trüben Himmel vorankrochen, zebragleich gemustert von Lichtstreifen, hinter denen sich die Holzrahmenschaufenster von Mariage Frères abzeichneten. Ihr Blick schweifte vorbei an den kalten Scheiben des Restaurants La Maré und hinüber zum freundlichen Haus-Chauffeur, der die Wagen der Gäste parkte und sie unablässig beobachtete.
Ihre Worte gingen im bläulichen Rauch unter: »Verrückt, ich werde verrückt.«
Kapitel 5
Einmal pro Woche traf sich Laurent mit seinen »Kameraden« zum Abendessen. Die Männer, die sich anlässlich dieses unumstößlichen Rituals versammelten, waren weder Jugendfreunde noch Angehörige einer bestimmten Gruppe. Sie hatten nichts, wofür sie sich gemeinsam begeisterten, sie gehörten schlicht und einfach dem gleichen Berufsstand an. Sie waren Polizisten, hatten sich auf unterschiedlichen Karrierestufen kennen gelernt und waren heute, jeder in seinem Spezialgebiet, auf dem Gipfel der Beförderungspyramide angelangt.
Wie die anderen Ehefrauen auch war Anna von diesen Treffen ausgeschlossen, und wenn das Abendessen bei ihnen in der Avenue Hoche stattfand, wurde von ihr erwartet, dass sie ins Kino ging. Überraschenderweise hatte Laurent ihr vor kurzem vorgeschlagen, beim nächsten Treffen teilzunehmen. Zuerst hatte sie abgelehnt, vor allem, weil ihr Mann im Ton einer Krankenschwester zu ihr gesagt hatte: »Du wirst sehen, das bringt dich auf andere Gedanken.« Wenig später hatte sie ihre Meinung geändert. Sie war neugierig, die Kollegen von Laurent kennen zu lernen, sich andere hohe Beamte anzusehen. Bislang kannte sie ja nur ein einziges Modell, ihn.
Sie sollte ihre Entscheidung nicht bereuen, denn ihr waren an diesem Abend harte, faszinierende Männer begegnet, die tabulos und ohne jede Zurückhaltung miteinander sprachen. Als einzige Frau an Bord war sie sich in dieser Runde wie eine Königin vorgekommen, in ihrer Gegenwart übertrafen sich die Polizisten gegenseitig mit Anekdoten, Berichten von Schießereien und Enthüllungsgeschichten.
Seit jenem ersten Abend hatte Anna an allen folgenden Essen teilgenommen, und nebenbei hatte sie die Macken und Reize, die Fantasien und Hirngespinste dieser Männer gründlich kennen gelernt. Jedes einzelne dieser Abendessen bot ihr ein Panorama der Welt des durchschnittlichen Polizisten, eine Welt in Schwarz-Weiß, ein Universum von Gewalt und Gewissheit tat sich vor ihr auf, faszinierend und eintönig zugleich.
Es waren, bis auf wenige Ausnahmen, immer dieselben Teilnehmer. Meistens dominierte Alain Lacroux die Unterhaltung, ein groß gewachsener, hagerer, vornübergebeugter Fünfzigjähriger, der das Ende jedes Satzes mit einer Bewegung seiner Gabel oder durch ein Wiegen seines Kopfes betonte, wobei sein südfranzösischer Akzent jede Satzfolge abrunden half. Seine leicht singende Sprache, seine wiegenden Bewegungen, sein Lächeln – wer hätte hinter dieser Ausstrahlungskraft den stellvertretenden Leiter der Pariser Kriminalpolizei vermutet?
Pierre Caracilli – klein, gedrungen, nüchtern – war das genaue Gegenteil. Ständig schimpfte er über irgendetwas, dabei sprach er ungewöhnlich langsam, und seiner Stimme haftete eine hypnotische Wirkung an. Wie oft hatte diese Stimme misstrauischen Leuten Vertrauen eingeflößt oder hartgesottenen Kriminellen Geständnisse entlockt. Caracilli war Korse, und er besetzte einen wichtigen Posten bei der DST, dem Inlands-Geheimdienst.
Anders als diese beiden ging Jean-François Gaudemer weder in die Breite noch in die Höhe: Er war wie ein kompakter, geballter, starrköpfiger Felsen. Unter einer hohen und kahlen Stirn saßen lebendige tiefschwarze Augen, in denen sich Gewitter zusammenzuballen schienen. Wenn er sprach, hörte Anna seinen zynischen Reden und Furcht erregenden Geschichten stets sehr aufmerksam zu, denn er flößte seinen Zuhörern neben dem zwiespältigen Gefühl, den Schleier jeder Weltverschwörung lüften zu können, eine tiefe Dankbarkeit ein. Er war der Chef von OCTRIS, jener Institution, die gegen den illegalen Drogenhandel vorging, und galt als der Drogen-Experte Frankreichs.
Am liebsten jedoch mochte Anna Philippe Charlier, einen Koloss von einem Meter neunzig, dessen teure Anzüge aus den Nähten zu platzen schienen. Seine Kollegen nannten ihn den Grünen Riesen. Er hatte ein Boxergesicht, trug einen Schnurrbart und weißgraue Haare. Er sprach sehr laut, lachte wie ein Verbrennungsmotor und packte seine Gesprächspartner bei den Schultern, um seinen komischen Geschichten Nachdruck zu verleihen.
Man musste über einen reichlich schmutzigen Wortschatz verfügen, um ihm folgen zu können. Statt einer »Erektion« sprach er vom »Knochen in der Unterhose«, seine gekräuselten Haare nannte er stets seine »Sackbehaarung«, und bevor er von seinen Bangkok-Urlauben zu berichten anhob, stellte er fest: »Seine Frau nach Thailand mitzunehmen ist wie Bier nach München zu tragen.«
Anna fand ihn ebenso vulgär wie beunruhigend. Und doch hatte er etwas Unwiderstehliches an sich, eine animalische Macht ging von ihm aus, etwas intensiv »Bullenhaftes«. Man konnte ihn sich nur zu gut in einem schlecht beleuchteten Büro vorstellen, wie er Verdächtigen Geständnisse entriss, oder beim Einsatz, wo er Männer mit Sturmgewehren kommandierte.
Laurent hatte ihr verraten, dass Charlier im Verlauf seiner Karriere wenigstens fünf Menschen kaltblütig erschossen hatte. Sein Arbeitsgebiet war der Terrorismus, ob beim DST, DGSE oder DNAT, immer hatte er denselben Krieg geführt. Fünfundzwanzig Jahre Geheimoperationen und Gewalteinsätze. Wenn Anna nach Details fragte, fegte er die Antwort mit einer Geste vom Tisch. »Das wäre sowieso nur die Spitze eines Eisbergs.«
An jenem Abend fand das Abendessen bei ihm statt, in der Avenue de Breteuil, einer der zahlreichen von Baron Haussmann gebauten Wohnungen. Sie verfügte über einen polierten Parkettboden, und in jeder winzigsten Ecke standen Objekte, die aus den Kolonien stammen mussten: Aus Neugier hatte Anna sich in den Räumen umgesehen, doch konnte sie keinerlei Anzeichen für die Anwesenheit einer Frau erkennen; Charlier war eingefleischter Junggeselle.
Es war gegen dreiundzwanzig Uhr, die Gäste saßen – gemütlich zurückgelehnt wie am Ende einer Mahlzeit – eingehüllt in den Rauch ihrer Zigarren und überboten sich in jenem März des Jahres 2002, wenige Wochen vor den Präsidentschaftswahlen, mit Vorhersagen und Vermutungen. Man stellte sich vor, welche Veränderungen es im Innenministerium geben würde, je nach Ausgang der Wahlen. Sie schienen alle bereit, einen noch besseren Kampf zu führen, waren sich allerdings nicht sicher, ob sie daran teilnehmen würden.
Philippe Charlier, Annas Tischnachbar, flüsterte ihr vertraulich ins Ohr: »Die gehen mir auf die Eier mit ihren Bullenstorys. Kennst du den Witz von dem Schweizer?«
Anna lächelte: »Du hast ihn mir schon letzten Samstag erzählt.«
»Und den von der Portugiesin?«
»Nein.«
Charlier stützte die Ellbogen auf dem Tisch auf: »Eine Portugiesin – Sonnenbrille justiert, Knie durchgebogen, Stöcke in den Achselhöhlen – macht sich bereit, eine Skipiste in Angriff zu nehmen. Ein Skifahrer schließt zu ihr auf und fragt mit breitem Grinsen: ›Schuss? Volles Rohr?‹
›Bloß nicht‹, antwortet die Portugiesin, ›meine Lippen sind viel zu empfindlich.‹«
Es dauerte eine Sekunde, bis sie begriffen hatte und ein schallendes Lachen ausstieß. Die Witze des Polizisten spielten sich immer nur unterhalb der Gürtellinie ab, dafür hatten sie den Vorzug, stets taufrisch daherzukommen. Anna lachte noch immer, als sich das Gesicht von Charlier zu verzerren begann: Mit einem Mal verflüchtigten sich seine Gesichtszüge und umkreisten, im wahrsten Sinne des Wortes, seine Gestalt.
Anna richtete ihre Augen auf die anderen Gäste. Auch ihre Züge zitterten und verzerrten sich, um kurz darauf in einer Welle unterschiedlichster Gesichtsausdrücke über sie hereinzubrechen: entstellte Hautfetzen, starre Fratzen, grausame Schreie …
Sie zuckte zusammen und begann heftig durch den Mund zu atmen.
»Ist dir nicht gut?«, fragte Charlier beunruhigt.
»Mir … mir ist warm. Ich gehe mich frisch machen.«
»Soll ich dir zeigen, wo?«
Sie legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte: »Es geht schon, ich finde es alleine.«
Sie ging an der Wand entlang, hielt sich am Kaminsims fest und stieß gegen einen Teewagen, der ein klirrendes Geräusch von sich gab …
Auf der Türschwelle riskierte sie einen Blick in den Raum, doch das Meer der Masken bewegte sich noch immer. Ein Kommen und Gehen von Schreien und Falten, die zusammenschmolzen, zerrissene Haut, die hervorsprang und sie verfolgte. Als sie die Tür hinter sich ließ, konnte Anna ihre Tränen nur mit Mühe zurückhalten.
Die Diele war nicht erleuchtet, nur durch die offenen Türen fielen Lichtstreifen in die Dunkelheit. Die an der Garderobe hängenden Mäntel nahmen bedrohliche Formen an. Anna blieb vor einem goldgerahmten Spiegel stehen und musterte aufmerksam ihr Gesicht: eine Haut wie Pergamentpapier und eine Blässe, so kalt leuchtend wie ein Gespenst.
Sie umfasste ihre Schultern, die unter dem schwarzen Wollpullover zitterten, als plötzlich hinter ihr ein Mann auftauchte. Sie kannte ihn nicht; er war nicht beim Essen gewesen. Sie drehte ihren Kopf, um ihn anzusehen. Wer ist das? Woher kommt er? Er sieht bedrohlich aus. Sein Gesicht ist verdreht, entstellt. Seine Hände leuchten im Dunkeln wie gezückte Waffen …
Anna weicht zurück und verschwindet zwischen den aufgehängten Mänteln. Der Mann kommt auf sie zu. Sie will schreien, aber ihre Kehle brennt wie lodernde Watte. Das Gesicht ist nur noch wenige Zentimeter entfernt. Ein Reflex des Spiegels scheint ihr ins Auge, ein goldener Funke blitzt auf ihren Pupillen …
»Sollen wir jetzt gehen?«
Anna unterdrückte ein Seufzen, es war Laurents Stimme. Sogleich sah sein Gesicht wieder normal aus, sie spürte zwei Hände, die sie hielten, und begriff, dass sie ohnmächtig geworden war.
»Meine Güte«, rief Laurent, »was hast du bloß?«
»Mein Mantel, gib mir meinen Mantel«, befahl sie und befreite sich aus seinen Armen.
Das Unwohlsein hielt an, und Anna hätte schwören können, dass seine Züge andere Formen angenommen hatten, es war ein anderes Gesicht, das sein eigenes Geheimnis barg, eine dunkle Zone …
Laurent reichte ihr den Dufflecoat. Er zitterte. Zweifelsohne hatte er Angst, Angst um sie; und um sich selbst, denn er befürchtete, seine Kollegen könnten ahnen, dass ein leitender Beamter des Innenministeriums verheiratet war mit einer Verrückten.
Ihre Arme glitten in den Mantel, und Anna genoss die Berührung mit dem seidigen Futter. Am liebsten wäre sie für immer hineingeschlüpft und darin verschwunden …
Aus dem Wohnzimmer drang lautes Gelächter in die Diele.
»Ich verabschiede mich für uns beide.«
Sie hörte vorwurfsvolle Stimmen, gefolgt von erneutem Lachen. Anna warf einen letzten Blick in den Spiegel. Eines Tages, schon bald, würde sie sich bei diesem Anblick fragen: »Wer ist das?«
Laurent kam zurück, und sie flüsterte ihm zu: »Bring mich hier weg, ich will nach Hause. Ich will schlafen.«
Kapitel 6
Doch der Spuk verfolgte sie noch im Schlaf. Seit sie diese Anfälle hatte, verfolgte Anna immer wieder derselbe Traum. Bilder in Schwarz-Weiß zogen wie in einem Stummfilm in unregelmäßigem Tempo an ihren Augen vorbei.
Die Szene war jedes Mal dieselbe: Nachts warteten hungrig aussehende Bauern auf einem Bahnsteig. Ein Güterzug kam angefahren, in Dampf eingehüllt. Eine Wand öffnete sich. Ein Mann mit einer Mütze erschien und beugte sich vor, um eine Fahne zu ergreifen, die ihm jemand hinhielt. Auf der Fahne war ein seltsames Zeichen zu erkennen: vier nach den Himmelsrichtungen angeordnete Monde. Dann richtete der Mann sich auf, zog die tiefschwarzen Brauen hoch, hielt eine Rede an die Menge und ließ dabei die Fahne im Winde wehen. Seine Worte blieben unverständlich, stattdessen hob eine Art Klangteppich an: ein furchtbares Stimmengewirr, das Seufzen und Schluchzen von Kindern.
Annas Flüstern mischte sich in die herzzerreißenden Klänge dieses Chores, und sie wandte sich an die jungen Stimmen: »Wo seid ihr? Warum weint ihr?«
Statt einer Antwort fegte ein leichter Wind über den Bahnsteig. Die vier Monde auf der Fahne begannen zu leuchten, und die Szene verwandelte sich vollends in einen Albtraum. Der Mantel des Mannes öffnete sich und enthüllte einen nackten, offenen, ausgeweideten Brustkorb; dann zerfetzte ein Windstoß sein Gesicht in tausend Stücke. Von den Ohren an wurde die Haut zu Asche pulverisiert, und man erkannte schwarze hervorspringende Muskeln.
Anna fuhr aus dem Schlaf hoch. Mit weit geöffneten Augen starrte sie in die Dunkelheit, doch konnte sie weder das Zimmer noch das Bett noch den Körper erkennen, der neben ihr schlief. Sie brauchte einige Sekunden, um sich mit den fremden Formen vertraut zu machen, lehnte sich an die Wand und fuhr mit beiden Händen über ihr schweißtriefendes Gesicht.
Warum kehrte dieser Traum immer wieder? Was hatte er mit ihrer Krankheit zu tun? Der Traum konnte einzig und allein eine andere Ausdrucksform ihres Leidens sein, ein geheimnisvolles Echo, ein unerklärlicher Widerpart ihrer geistigen Verwirrung. Sie rief ins Dunkel: »Laurent?«
Ihr Mann rührte sich nicht, er hatte ihr den Rücken zugekehrt. Anna ertastete seine Schulter: »Laurent, schläfst du?«
»Jetzt nicht mehr.«
»Kann … kann ich dich etwas fragen?«
Er richtete sich halb auf, das Kissen in den Nacken gerollt: »Ich höre.«
Mit gedämpfter Stimme, die Schluchzer aus dem Traum klangen ihr noch in den Ohren, fragte Anna: »Warum …«, sie zögerte, »… haben wir kein Kind?«
Für eine Sekunde herrschte absolute Stille, dann schob Laurent die Decke beiseite und setzte sich auf den Bettrand. Die Stille schien plötzlich von Spannung und Feindseligkeit überladen.
Laurent rieb sich das Gesicht, bevor er ankündigte: »Wir fahren wieder zu Ackermann!«
»Was?«
»Ich rufe ihn an. Wir machen einen Termin im Krankenhaus.«
»Warum sagst du das?«
Über die Schulter hinweg fuhr er sie an: »Du hast gelogen. Du hast erzählt, dass du nur das Problem mit den Gesichtern und keine weiteren Gedächtnisstörungen hättest.«
Anna begriff, dass sie einen verhängnisvollen Fehler begangen hatte, denn ihre Frage offenbarte einen weiteren Abgrund ihres Erinnerungsvermögens. Sie starrte auf Laurents Nacken, auf seine wenigen Locken, auf seinen geraden Rücken und konnte ahnen, wie betroffen und zornig er war.
Seine Schulter drehte sich kaum merklich: »Du wolltest nie ein Kind. Das war deine Bedingung dafür, mich zu heiraten.«
Sein Ton wurde lauter, er hob die linke Hand: »Selbst am Abend unserer Hochzeit musste ich dir schwören, dass ich dich nie darum bitten würde. Du verlierst den Kopf, Anna. Wir müssen etwas tun. Du musst diese Untersuchung machen lassen. Damit wir begreifen, was passiert. Wir müssen es aufhalten. Verflucht noch mal!«
Anna kauerte sich ans andere Bettende. »Gib mir noch ein paar Tage. Bitte.«
Er legte sich wieder hin und deckte seinen Kopf zu: »Ich rufe Ackermann nächsten Mittwoch an.«
Sinnlos, ihm zu danken. Anna wusste nicht einmal, warum sie um Aufschub gebeten hatte. Was nützte es, die Wahrheit zu leugnen? Die Krankheit wurde immer schlimmer, Neuron nach Neuron, eine Hirnregion nach der anderen schien betroffen.
In einigem Abstand zu Laurent glitt sie unter die Decke und dachte über das Rätsel mit den Kindern nach. Warum hatte sie einen solchen Schwur von ihm verlangt? Was war damals ihr Motiv gewesen? Anna konnte die Frage nicht beantworten, sie war sich selbst zum Rätsel geworden.
In Gedanken spulte sie acht Jahre bis zum Tag ihrer Hochzeit zurück. Damals war sie dreiundzwanzig gewesen. Woran erinnerte sie sich genau? Da war ein Herrenhaus in Saint-Paul-de-Vence, Palmen, von der Sonne verbrannte Rasenflächen, ein Kinderlachen. Sie schloss die Augen und versuchte, die Empfindungen von damals in sich wachzurufen. Sie sah einen Kreis auf einer Rasenfläche, der sich in die Länge zog, sah zu Zöpfen geflochtene Blumen, weiße Hände …
Plötzlich schwebte ein Schal aus Tüll in ihre Erinnerung. Der Stoff wirbelte vor ihren Augen hin und her, störte den Kreis, legte ein Netz über das Grün des Grases und hielt das Licht in bizarren Bewegungen fest.
Der Stoff kam auf sie zu, sie spürte seine Struktur auf dem Gesicht, dann wickelte er sich um ihre Lippen. Anna öffnete lachend den Mund, aber das Netzgewebe drang ihr in die Kehle. Sie hechelte nach Luft, der Schleier hatte sich fest auf ihren Gaumen gelegt. Es war kein Tüll mehr, sondern Mull. Einfacher Operationsmull, der sie zu ersticken drohte.
Sie schrie laut in der Nacht, doch der Schrei verhallte lautlos. Sie öffnete die Augen, der Schlaf hatte sie erneut überfallen, und ihr Mund war tief ins Kissen gedrückt.
Wann würde dies endlich aufhören? Sie setzte sich auf und spürte wie zuvor den Schweiß auf ihrer Haut. Das klebrige feuchte Tuch ihres Nachthemds hatte das Gefühl des Erstickens hervorgerufen.
Sie stand auf und ging in Richtung Bad, das neben dem Schlafzimmer lag. Sie tastete sich nach vorn, spürte den Türrahmen, und bevor sie Licht anmachte, schloss sie die Tür. Sie tippte auf den Schalter und wankte zum Spiegel über dem Waschbecken.
Ihr Gesicht war voll Blut.
Rote Streifen liefen über ihre Stirn, Blutkrusten hatten sich unter den Augen festgesetzt, bei den Nasenlöchern, um die Lippen. Zuerst dachte sie, sie hätte sich verletzt, doch als sie näher an den Spiegel trat, entdeckte Anna, dass sie nur aus der Nase geblutet hatte. Bei dem Versuch, die Nase zu putzen, hatte sie sich im Dunkeln mit ihrem eigenen Blut beschmiert. Auch ihr Sweatshirt war ganz nass.
Sie drehte das kalte Wasser auf und hielt ihre Hände unter den Strahl. Kurz darauf war der Spülstein mit einem rötlichen Wasserfilm überzogen, und in ihrem Inneren machte sich die Gewissheit breit, dass das Blut ein Geheimnis zum Ausdruck brachte, das ihr Bewusstsein nicht wahrnehmen wollte, ein Geheimnis, das in einem organischen Strom aus ihrem Körper floh.
Sie hielt ihr Gesicht unter den kalten Wasserstrahl, ihre Tränen vermischten sich mit durchsichtigen Spritzern, und sie konnte nicht aufhören, dem rauschenden Wasser zuzuflüstern: »Was habe ich bloß, was ist nur los mit mir?«
Zwei
Kapitel 7
Ein kleines Schwert aus Gold. So sah er das Bild in seiner Erinnerung. In Wirklichkeit war es, und das wusste er genau, nur ein einfacher Brieföffner aus Kupfer mit einem nach spanischer Tradition ziselierten Griff. Der achtjährige Paul hatte es gerade seinem Vater aus der Werkstatt gestohlen und war damit in seinem Zimmer verschwunden. Er konnte sich ganz genau erinnern, wie sich dieser Moment angefühlt hatte, er sah die geschlossenen Fensterläden, spürte die drückende Hitze. Die tiefe Ruhe des Mittagsschlafs. Ein Sommernachmittag wie jeder andere, und doch hatten die letzten Stunden sein Leben für immer verändert.
»Was hast du in deiner Hand versteckt?«
Paul schloss seine Faust. Seine Mutter stand an der Türschwelle.
»Zeig mir, was du da versteckst.«
Ihre Stimme, aus der eine leise Neugier an sein Ohr drang, war ruhig. Paul schloss die Faust fester, als im Halbdunkel, zwischen den Lichtstrahlen, die durch die Jalousien drangen, seine Mutter auf ihn zukam. Dann setzte sie sich auf den Bettrand und öffnete sanft seine Hand: »Warum hast du diesen Brieföffner genommen?«
Er konnte ihre Züge, die im Dunkel lagen, nicht erkennen.
»Um dich zu verteidigen.«
»Gegen wen willst du mich verteidigen?«
Schweigen.
»Willst du mich gegen Papa verteidigen?«
Sie beugte sich zu ihm, und in einem Lichtstreifen konnte er ihr geschwollenes, von Blutergüssen marmoriertes Gesicht erkennen, dessen eines Auge, das Weiß getrübt von geplatzten Äderchen, einem Bullauge glich. Sie wiederholte: »Willst du mich gegen Papa verteidigen?«