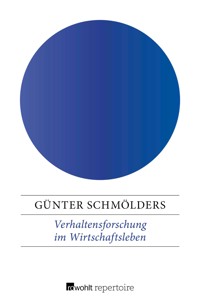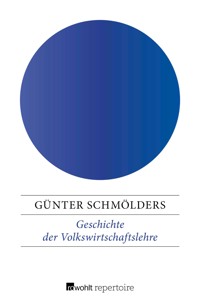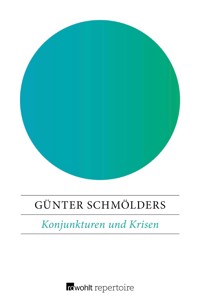14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
■Finanzwissenschaft und Psychologie ■Die Finanzpolitische Meinungs- und Willensbildung Die Dynamik der parlamentarischen Beschlußfassung Der vorparlamentarische Raum Die öffentliche Meinung ■Der Staat im Bewußtsein seiner Bürger Die Einstellung zum ‹Staat› Das staatsbürgerliche Interesse Der Anspruch auf Leistungen der öffentlichen Hand ■Steuermoral und Steuerwiderstand ‹Finanzgesinnung› und Steuermentalität Objektive und subjektive Steuerbelastung Die Steuermoral Der Steuerwiderstand ■Finanzpsychologie und Finanzpolitik Öffentlichkeitsarbeit in Staat und Gemeinde Finanzpublizität und staatsbürgerliche ‹Meinungspflege› Die Kunst der Besteuerung ■Enzyklopädisches Stichwort: Sozialökonomische Verhaltensforschung ■Literaturhinweise ■Personen- und Sachregister
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Günter Schmölders
Das Irrationale in der öffentlichen Finanzwirtschaft
Probleme der Finanzpsychologie
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
■ Finanzwissenschaft und Psychologie
■ Die Finanzpolitische Meinungs- und Willensbildung
Die Dynamik der parlamentarischen Beschlußfassung
Der vorparlamentarische Raum
Die öffentliche Meinung
■ Der Staat im Bewußtsein seiner Bürger
Die Einstellung zum ‹Staat›
Das staatsbürgerliche Interesse
Der Anspruch auf Leistungen der öffentlichen Hand
■ Steuermoral und Steuerwiderstand
‹Finanzgesinnung› und Steuermentalität
Objektive und subjektive Steuerbelastung
Die Steuermoral
Der Steuerwiderstand
■ Finanzpsychologie und Finanzpolitik
Öffentlichkeitsarbeit in Staat und Gemeinde
Finanzpublizität und staatsbürgerliche ‹Meinungspflege›
Die Kunst der Besteuerung
■ Enzyklopädisches Stichwort: Sozialökonomische Verhaltensforschung
■ Literaturhinweise
■ Personen- und Sachregister
Über Günter Schmölders
Günter Schmölders (1903–1991) war ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Finanzwissenschaftler, Finanzsoziologe und Sozialökonom.
Inhaltsübersicht
I. Finanzwissenschaft und Psychologie
Finanz und Finanzwissenschaft
Der aus dem Mittellateinischen stammende Ausdruck Finanz, Finanzen, der anfangs durch richterliches Urteil festgesetzte Zahlungen (engl. fine) und später überhaupt Geldzahlungen und -geschäfte bezeichnet, wurde im Deutschen zunächst mit der üblen Nebenbedeutung von Wucher und Betrug gebraucht; ‹wüchse der Leib und das Gras als Untreu, Finanz, Neid und Haß, so hätten die Schafe und Rinder heuer das Jahr guten Winter› (GEILER VON KAYSERSBERG1445–1510). Auch LUTHER nennt Finantzer (fynantzer) und Wucherer in einem Atem; in BASILIUS FABERS‹Thesaurus eruditionis scholasticae› von 1680 ist ein Finantzer ein ‹Landbetrieger, der die Leute umbs Geld bescheisset›.
In Frankreich kommen schon im 15. Jahrhundert die Bezeichnungen hommes de finance und financiers für die Steuerpächter und -eintreiber des Königs auf; der Plural Finanzen wird etwa in diesem Wortsinne später auch in die deutsche Sprache übernommen und verliert damit zugleich allmählich die anfängliche böse Nebenbedeutung (GRIMMs Wörterbuch). Heute bedeutet das Wort Finanzen soviel wie Vermögenslage, wobei meist in erster Linie an die öffentliche Hand gedacht ist (engl. public finance, frz. finances publiques); man spricht freilich auch von ‹Finanzierung› und ‹Finanzlage› im Bereich der privatunternehmerischen Betätigung und von der ‹Hochfinanz› (Haute finance), der internationalen Bank- und Kreditwirtschaft.
Die in Deutschland und Österreich lange vor der französischen Physiokratie und der englischen Klassik entwickelte Kameralwissenschaft, für die der preußische König FRIEDRICH WILHELM I. in Halle und Frankfurt/O. 1727 die ersten Universitätslehrstühle errichtete, befaßte sich mit dem Wirtschaftsleben der Länder und Territorien und der Wirtschafts- und Außenhandelspolitik, die für die fürstliche Schatzkammer möglichst einträglich sein sollte; ihr Kern war die ‹eigentliche Cameral- und Finanzwissenschaft› (V. JUSTI), die in Deutschland neben der seit ADAM SMITH aufkommenden Nationalökonomie gepflegt wurde und vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu hoher Blüte gelangte (LORENZ V.STEIN, ALBERT SCHÄFFLE, ADOLPH WAGNER u.a.).
Methodisch hat die deutsche Finanzwissenschaft, fernab von dem gleichzeitigen Methodenstreit der Nationalökonomie, sich den Blick für die gesamtwirtschaftliche Wirklichkeit der öffentlichen Finanzen bewahrt; heute bahnt sich die Erkenntnis an, daß auch dies nicht genügt, um der Problematik der Wechselwirkungen zwischen Finanzwirtschaft, Volk und Staat gerecht zu werden: ‹Die ältere finanzwissenschaftliche Forschung hat vielfach der Sammlung von Tatsachenmaterial mehr Gewicht als seiner Analyse beigelegt, während die neuere, wobei vornehmlich an gewisse radikale Vertreter der functional finance gedacht ist, den Zusammenhang mit der Tatsachenwelt nicht selten zu verlieren scheint. Hier den Ausgleich zu schaffen, ist die Aufgabe, vor der die Finanzwissenschaft steht; dazu aber bedarf ihre Arbeit einer methodologischen Besinnung.[*]›
Mit diesen Worten hat der zu früh verstorbene Frankfurter Finanzwissenschaftler WILHELM GERLOFF die Bedeutung der Methodenlehre als Wegweiserin jeder Forschungsarbeit, insbesondere aber der finanzwissenschaftlichen Forschung gekennzeichnet; Induktion und Deduktion, deskriptive Tatsachenbeobachtung und analytische Besinnung, historische und abstrakte Methode müssen zusammenwirken, um aus der Fülle der Einzelereignisse die Tendenzen und Regelmäßigkeiten herauszuheben und als solche verständlich zu machen. Die Eigenart dieser ‹Naturgesetze›, wie sie CHRISTIAN JACOB KRAUS genannt hat, ist in der Finanzwissenschaft deutlicher als in der Wirtschaftstheorie durch das menschliche Element bestimmt; wie alles Wirtschaften menschliches Handeln ist, so ist das Wirtschaften im öffentlichen Bereich sogar in erhöhtem Maße von den menschlich-allzumenschlichen Motivationen der dahinterstehenden Gruppen, Steuerzahler und Politiker, Gesetzgeber und ausführenden Funktionäre bedingt. Infolgedessen hat die Finanzwissenschaft den Kontakt mit dem ‹menschlichen Element›, den die Wirtschaftstheorie heute vielfach in so beklagenswertem Maße vermissen läßt, niemals verloren; geht es ihr doch nicht um ein bloßes Tatsachenwissen, sondern um ‹ein Verstehen staatsfinanzwirtschaftlichen Lebens, um die Sicht der Zusammenhänge›, wie FRITZ TERHALLE es genannt hat.
Eine Wissenschaft vom Menschen
Einer derartigen ‹verstehenden› Analyse und Erforschung sind die Erscheinungen, mit denen es die Finanzpolitik zu tun hat, in der Tat auch leichter zugänglich als die gesamtwirtschaftlichen Vorgänge auf anonymen Märkten, die Preisbildung oder die Güterproduktion und -verteilung; der Zwang zu rationaler Rechtfertigung finanzpolitischer Maßnahmen, das Zustandekommen der finanzpolitischen Willensbildung – sei es im Rampenlicht der parlamentarischen Öffentlichkeit, im Geheimkabinett der Exekutive oder in der Kulisse der Parteien, Gruppen und Interessentenverbände –, endlich die menschlichen Kräfte, Schwächen und Unzulänglichkeiten jeglicher Finanz- und Steuerpraxis lassen die Anwendung psychologischer Maßstäbe, die ein tieferes Verständnis der hier hervortretenden Erscheinungen überhaupt erst ermöglicht, nicht nur als notwendig, sondern auch in besonderem Maße als lohnend erscheinen. Es gilt, einen Schritt tiefer in den Hintergrund des Geschehens einzudringen, als dies bisher im Rahmen der Wirtschaftswissenschaft üblich war; es genügt nicht mehr, das Verhalten der Menschen grundsätzlich oder auch nur vorwiegend dem Schema der rationalen und utilitaristischen Zweckhandlung zu unterstellen, sondern es geht darum, die ganze Vielfalt der rationalen und ‹irrationalen› Motivationen privat- und finanzwirtschaftlichen Handelns wenigstens in einem ersten großen Überblick ins Auge zu fassen.
Für die Nationalökonomie hat J.MARCHAL vor kurzem die Forderung aufgestellt, sie endlich ‹von einer mechanischen Wissenschaft zu einer Wissenschaft vom Menschen› auszugestalten, die die ökonomischen Phänomene nach ihrer wirklichen Kausalität untersucht; ‹was die Wirtschaftswissenschaft uns liefert, das ist im wesentlichen eine Technik des rationellen Handelns … Es ist nun aber so, daß die Nationalökonomie eine Wissenschaft vom Menschen ist und daß es im Menschen immer ein Stück Geheimnis gibt und geben wird. Um aus der Wirtschaftswissenschaft eine Physik oder eine ökonomische Logik zu machen, müßte man den Menschen mechanisieren› und ihn ‹in einen vervollkommneten Roboter verwandeln, dessen sämtliche Reaktionen von vornherein vorauszusehen› wären[*]. Das Wesen der Wirtschaftswissenschaft ist nach MARCHALdurch die Eigenart der ökonomischen Phänomene vorgezeichnet, die sich in der Zeit abspielen, dabei fast immer diskontinuierlich und letztlich psychologischer Natur sind, so daß sie auch und gerade von hier aus der Erklärung zugänglich werden; am Beispiel des Steuerzahlers, der auf eine zusätzliche Steuerlast mit einem Nachlassen seines Erwerbsstrebens reagiert, beweist MARCHAL, daß die von der klassischen Lehre als feststehend angenommenen Ziele des menschlichen Verhaltens sich im Verlauf des ökonomischen Prozesses ändern und also alles andere als ‹Daten› sind.
Das Menschlich-Allzumenschliche
Es ist kein Zufall, daß dieses Beispiel gerade aus dem Gebiet der Finanzwissenschaft stammt. Die Finanzwissenschaft hat den Kontakt mit dem Menschlich-Allzumenschlichen, wie er hier für die gesamte Wirtschaftswissenschaft gefordert wird, in der Tat niemals verloren; man braucht nur an das in der Steuerlehre noch keineswegs zur Ruhe gekommene Problem der ‹Gerechtigkeit› mit seinen vielseitigen politisch-psychologischen Aspekten, an die Problematik des öffentlichen Kredits, der Steuermoral und des Steuerwiderstandes zu denken, um sich die traditionellen engen Beziehungen zwischen Finanzwissenschaft und Psychologie zu vergegenwärtigen und zu erkennen, welch eminente Bedeutung die Beachtung oder Nichtbeachtung psychologischer Erkenntnisse für Erfolg oder Mißerfolg jeglichen finanzwirtschaftlichen Handelns besitzt. Das Organisationsprinzip der öffentlichen Haushaltswirtschaft als einer mittels Zwangsleistungen finanzierten autoritären Planwirtschaft ist nun einmal dem der Markt- und Wettbewerbswirtschaft, die in dem eigenen Erwerbs- und Geltungsstreben der wirtschaftenden Individuen ihr bestes Hilfs- und Heilmittel erblickt, diametral entgegengesetzt, und die öffentliche Finanzwirtschaft steht daher unausgesetzt vor der Gefahr, mit ihren Planungen und Maßnahmen in elementaren Gegensatz zu der menschlichen Natur zu geraten, deren Lebensgesetze sie immer von neuem zu mißachten gezwungen ist.
‹Finanzpsychologie›
Die ‹Finanzpsychologie›, wie sie sich in den letzten Jahren aus der Erkenntnis dieser Zusammenhänge im In- und Ausland entwickelt hat, erhebt nicht den Anspruch, eine neue Wissenschaft zu sein; eher ist sie eine unter psychologischen Gesichtspunkten systematisch geordnete Zusammenfassung finanzpolitischer Erfahrungen aller Völker, Zeiten und Länder. Diese Erfahrungen zeigen unverkennbar, daß die Finanzpolitik ihre Rechnung nicht ‹ohne den Wirt machen› kann; alle am grünen Tisch erdachten Planungen bleiben erfolglos, wenn sie den Einstellungen und Verhaltensweisen der Staatsbürger nicht genügend Rechnung tragen. Hier liegt die Aufgabe der Finanzpsychologie; sie untersucht das Verhältnis des Bürgers zur Staatswirtschaft, angefangen von seiner Mitwirkung an der finanzpolitischen Meinungs- und Willensbildung über seine Einstellung zum Staat und zu den einzelnen staatlichen Institutionen und Leistungen bis zu seiner mehr oder minder ehrlichen und vollständigen Steuererklärung und den Verhaltensweisen, die sich aus diesen Einstellungen und Haltungen ergeben.
Die Finanzpsychologie nimmt diese Aufgabe auf zwei Wegen in Angriff; einmal untersucht sie die Tatsachen und Erfahrungen der Finanzpolitik, die Institutionen, Dokumente, Gesetze und Gesetzgebungsmaterialien im Hinblick darauf, welche Einstellungen und Verhaltensweisen der Staatsbürger sich in ihnen widerspiegeln, zum anderen sucht sie diese Einstellungen und Verhaltensweisen unmittelbar zu erforschen, im wesentlichen mit den Mitteln und Erkenntnissen der modernen Sozialforschung. Im ersten Fall wird das historisch vorgefundene Tatsachenmaterial nachträglich analysiert, im zweiten sucht die Finanzpsychologie darüber hinaus eigenes Primärmaterial zu gewinnen, um es mit ihren Kategorien zu interpretieren und ihre Erkenntnisse darauf aufzubauen. Auf beiden Wegen der finanzpsychologischen Forschung sind neben finanzwissenschaftlichen Erfahrungen und Erkenntnissen auch die der anderen Wissenschaften vom Menschen heranzuziehen, insbesondere der Psychologie, Soziologie und Sozialpsychologie, aber auch der Ethik, der Staatslehre, der Strafrechtswissenschaft und der Kriminologie.
Der hier vorgelegte erste Versuch einer Zusammenfassung nimmt den Prozeß der finanzpolitischen Meinungs- und Willensbildung zum Ausgangspunkt; alle Probleme der Finanzpsychologie erscheinen hier wie in einem Brennspiegel vereinigt. Bereits hier, am Ursprung aller Finanzpolitik, spielt das dialektische Verhältnis zwischen den Staatsbürgern und der Staatswirtschaft seine Rolle; methodisch sorgfältig durchgeführte eigene Untersuchungen über die Attitüden und Verhaltensweisen der Staatsbürger in ihrem Verhältnis zur öffentlichen Finanzwirtschaft bilden die Grundlage der weiteren Abschnitte, in denen zunächst die herrschende ‹Einstellung› zum Staat und zu den staatlichen Institutionen untersucht und weiterhin ermittelt wird, welche Kenntnisse und welches Interesse hinsichtlich des Staatshaushalts in den verschiedenen Schichten und Gruppen der Bevölkerung vorhanden sind. Schon hier zeigt sich das merkwürdig ambivalente Verhältnis der Staatsbürger zum staatlichen Apparat, den die meisten von ihnen gleichzeitig als Störenfried und als die für ihr Wohlergehen verantwortliche Instanz ansehen; das staatsbürgerliche Bewußtsein folgt nicht logischen, sondern psychologischen Gesetzen.
Das vierte Kapitel gelangt zum Kernpunkt aller Finanzpsychologie, nämlich zu den Attitüden und Verhaltensweisen gegenüber der Besteuerung, angefangen von der Grundeinstellung zum Phänomen der Besteuerung überhaupt bis zur ‹Steuermoral› und den legalen und illegalen Ausweichreaktionen der Steuerpflichtigen; auch hier sind die Ergebnisse der ad hoc durchgeführten Ermittlungen von besonderem Interesse. Das Schlußkapitel wendet sich wieder dem staatlichen Gegenspieler der finanzwirtschaftlichen Beziehungen zu und fragt nach den bisherigen Versuchen und künftigen Möglichkeiten, diese Beziehungen reibungsloser und in einer dem demokratischen Staat angemessenen Art und Weise zu gestalten.
Damit sind Thema, Methoden und Gedankengang der folgenden Darstellung umrissen. Seit dem Erscheinen der ‹Theorie der finanzwirtschaftlichen Illusionen› von A.PUVIANI (1903) ist eine zusammenfassende Darstellung dieser Art nicht wieder versucht worden; es erscheint an der Zeit, die auf beiden Seiten, in der Finanzwissenschaft sowohl wie in der Psychologie, in unserem Jahrhundert gesammelten Erkenntnisse in einem neuen Versuch zu verschmelzen. Tritt bei PUVIANI[*] noch unverkennbar der Einfluß von MACHIAVELLIs Staatslehre zutage, während seine Psychologie den primitiven Hedonismus seiner Zeit widerspiegelt, so sind seitdem mit dem Siegeszug der demokratisch-parlamentarischen Staatsform auf der einen, der Entstehung einer wissenschaftlichen Psychologie und Sozialpsychologie auf der anderen Seite die Voraussetzungen dafür geschaffen worden, Attitüden und Verhaltensweisen der Staatsbürger gegenüber ihrem Staat und dem Staatshaushalt psychologisch zu analysieren und beiden Seiten den Standpunkt ihres Gegenspielers verständlich zu machen; soll die Staatsform der westlichen Welt sich in der Auseinandersetzung unseres Jahrhunderts behaupten, so bedarf es dazu eines vertieften Verständnisses für die eigentümliche Dynamik, die dem Funktionieren ihrer Institutionen innewohnt, einschließlich aller ihrer Imponderabilien und ‹irrationalen› Elemente[*].
II. Die Finanzpolitische Meinungs- und Willensbildung
1. Die Dynamik der parlamentarischen Beschlussfassung
Die öffentliche Finanzwirtschaft ist ihrem Wesen nach Planwirtschaft[*]; im Gegensatz zur privatunternehmerischen, betrieblichen Einzelwirtschaft, die täglich wechselnde Entschlüsse und Entscheidungen je nach den wechselvollen Erfordernissen der Märkte und Preise treffen muß, beruht die öffentliche Einnahmen- und Ausgabengebarung bis zur letzten Amtskasse der Gemeinde auf einem festen, in Zahlen gefaßten Programm, zu dessen genauer Einhaltung jeder der beteiligten Ressortbeamten dienstlich verpflichtet ist.
Der Haushaltsplan
Da es fast keine staatliche Maßnahme gibt, die nicht Aufwendungen irgendeiner Art und Größe mit sich bringt, während andererseits der dadurch entstehende Finanzbedarf jeweils auch entsprechende Deckungsmittel in Gestalt von Steuern, Gebühren und Beiträgen oder Kreditmitteln erfordert, ist das nüchterne Zahlenwerk des Haushaltsplanes ein getreues Spiegelbild des gesamten politischen Programms der Regierung; die parlamentarische Beratung des Budgets ist infolgedessen zugleich alljährlich eine Art politischer Generaldebatte, bei der von der Außenpolitik (Haushaltsplan des Auswärtigen Amtes) über die Innen-, Wirtschafts-, Kultur- und Sozialpolitik bis zur eigentlichen Finanzpolitik hin (Einnahmeseite des Planes) alle Verwaltungszweige mit ihren Ausgaben und Einnahmen Revue passieren. Dabei wird die Bewilligung des Programms für das kommende Jahr in der Regel mit einer Kritik des in der Vergangenheit auf den einzelnen Tätigkeitsgebieten Geleisteten verbunden, so daß die Haushaltsdebatte sich zugleich zu einer regelrechten Abrechnung der Volksvertretung mit der Regierung über ihre gesamte Politik ausweitet; mit der Verabschiedung und dem Inkrafttreten des Haushaltsplanes ist andererseits für die neue Haushaltsperiode das gesamte politische Programm in seinen Grundzügen, seine Finanzierung sogar bis in die Einzelheiten hinein festgelegt. In dem Zustandekommen des Haushaltsplanes und dem Kräftespiel der ihn beeinflussenden Faktoren haben wir infolgedessen die gesamte politische, insbesondere aber die finanzpolitische Willensbildung der Nation wie in einem Brennspiegel vor Augen.
Finanzpolitische Willensbildung
Der Haushaltsvoranschlag wird in parlamentarischen Staaten nach seiner Aufstellung der Legislative zur Beratung und Beschlußfassung vorgelegt; aus der sachlichen, durch Fachwissen bestimmten Atmosphäre der Vorbereitung, aus dem Herrschaftsbereich der ‹Bürokratie›, gelangt das Budget damit vor das politische Forum, auf die offene Szene der finanzpolitischen Willensbildung in Staat und Gemeinde. Kommt infolgedessen in der vorhergehenden Haushalts- und Gesetzesinitiative ebenso wie in der späteren Durchführung der Gesetze in der Regel ein gewisses Übergewicht der Verwaltung zur Geltung, so werden doch die endgültige Fassung der Gesetze und ihr konkreter Inhalt aufs stärkste durch die besondere Dynamik der parlamentarischen Beschlußfassung mitbestimmt, die sich gerade in der finanz- und steuerpolitischen Willensbildung besonders charakteristisch ausprägt. So verschieden Art und Grad der Mitwirkung parlamentarischer Gremien an der politischen Willensbildung in den einzelnen Verfassungen geregelt sind, so ist doch die Eigenart und besondere Dynamik der kollektiven Beschlußfassung allen demokratischen Staats- und Regierungssystemen gemeinsam; in mehr oder weniger gründlichen Beratungen größerer oder kleinerer Gruppen, Versammlungen oder Körperschaften müssen gemeinschaftliche Beschlüsse gefaßt werden, deren Zustandekommen von der einfachen oder qualifizierten Mehrheit, wenn nicht von der einheitlichen Zustimmung aller Anwesenden oder gar aller Stimmberechtigten abhängt. Angefangen von der schweizerischen ‹Referendumsdemokratie›, die konkrete Gesetzentwürfe unmittelbar ihrem ‹Souverän›, nämlich der stimmberechtigten männlichen Bevölkerung, zur Entscheidung vorlegt, bis zur Delegation der politischen Willensbildung an Parlament und Regierung auf viele Jahre hinaus, wie sie sich im Verfassungsleben der großen westlichen Demokratien herausgebildet hat, steht jedes Gemeinwesen vor der Aufgabe, in großen und kleinen Fragen des Gemeinschaftslebens aus einer Vielzahl der Meinungen, Überzeugungen und Interessen zu sachlichen und innerlich von der Mehrheit gebilligten Entscheidungen zu gelangen; diese kollektive Willensbildung steht in allen Verfassungs- und Regierungsformen im wesentlichen vor den gleichen Problemen.
Kollektive Entscheidungen
Die Grundfrage, ob Kollektiventscheidungen überhaupt geeignet sind, politische Probleme in staatsmännischer Weisheit oder wenigstens im Sinn der praktischen Vernunft rational und zweckmäßig zu lösen, ist oftmals schlechthin verneint worden. ‹Jeder, sieht man ihn einzeln, ist leidlich klug und verständig; sind sie in corpore, gleich wird euch ein Dummkopf daraus.›[*] Die Massenpsychologie LE BONs spricht von der ‹verdummenden Wirkung› des Kollektivs, in dem die bewußte Persönlichkeit mit ihrer Intelligenz, ihren Hemmungen und höheren Ansprüchen unterzugehen pflege: ‹Entscheidungen über allgemeine Fragen, die von einer Versammlung hervorragender, aber verschiedenartiger Leute getroffen werden, sind solchen Entscheidungen, welche eine Versammlung von Dummköpfen treffen würde, nicht merklich überlegen.›[*]LE BON erklärt diese Erscheinung aus der besonderen ‹Kollektivseele›, die sich in jeder Masse bilde und die sich nur auf dem Niveau der niederen, also der allen gemeinsamen Qualitäten stabilisieren könne; C.G. JUNG spricht von den ‹primitiven Archetypen›, die in dieser Kollektivseele aktiviert werden und die sich mehr durch Leidenschaftlichkeit und Willensstärke als durch Intelligenz auszuzeichnen pflegen[*]. Das Gefühl der Sicherheit, das sich in jeder Masse einstellt, verbinde sich, so behauptet LE BON, mit einem Mangel an Verantwortungsgefühl und der allgemeinen ‹enthemmenden› Wirkung des In-der-Masse-Seins[*]; die Grausamkeit einer entfesselten Masse erkläre sich daraus ebenso wie ihr Heldenmut, nicht zuletzt aber auch ihre Anfälligkeit für platte Schlagworte und für den Appell an das Gefühl, an die Triebregungen der tieferen Schichten der Persönlichkeit.
Diese Erkenntnisse der Massenpsychologie, die lange Zeit hindurch als absolute Wahrheiten über die psychischen Funktionen nicht nur in der eigentlichen ‹Masse›, sondern analog auch in allen sonstigen Gruppensituationen galten, mußten zunächst als vernichtendes Urteil über jegliche Form und Prozedur demokratischer Willensbildung, ja, jeder kollektiven Beschlußfassung schlechthin erscheinen. ‹Behielte LE BON mit seinen Anschauungen recht, so würde das weitgehende Konsequenzen für eine demokratische Regierungsform haben. Veranlaßt durch die ernste Bedeutung solcher Konsequenzen wurde eine große Anzahl von Untersuchungen angestellt, in denen der Frage nachgegangen wurde, ob die Gruppensituation auf das Urteil einen günstigen oder einen ungünstigen Einfluß ausübe; die Fragestellung wurde ferner dahin erweitert, ob das Gruppenurteil, worunter das arithmetische Mittel aller einzelnen Urteile verstanden wurde, besser sei als die Urteile einzelner.›[*]
Empirische Studien
In zahlreichen experimentellen Untersuchungen fand F.H. KNOWER[*], daß zwar 85 v.H. seiner Versuchspersonen einer Beeinflussung ihres Urteils durchaus zugänglich waren, daß dabei aber sachliche und emotionale Argumente in gleichem Maße wirksam waren, wobei sich die männlichen Personen stärker durch sachliche Argumente, die weiblichen stärker durch emotionale beeinflussen ließen. Andere Versuche führten M.SHERIF[*] zu ähnlichen Ergebnissen; in der Gruppensituation entstehen zwar andere, keineswegs aber unbedingt geringerwertige Urteile, zumal nach einer Feststellung von A.JENNESS[*] die intelligenzmäßig weniger begabten Individuen dazu neigen, ihr Urteil in der Richtung derjenigen Mitglieder der Gruppe zu korrigieren, die die besseren Voraussetzungen zu einer adäquaten Urteilsbildung mitbringen.
Auf diese und eine lange Reihe weiterer in- und ausländischer Untersuchungen gestützt, entwickelt PETER R. HOFSTÄTTER ein sehr anschauliches Bild von der ‹Gruppendynamik›[*]. Er verbindet seine Darstellung mit einer eingehenden Kritik der Massenpsychologie von LE BON bis zu ORTEGA Y GASSET und ihren Nachfolgern; es geht ihm um die ‹von LE BON in Abrede gestellte Behauptung einer leistungsmäßigen Überlegenheit der Gruppe›, wobei er darauf hinweist, ‹daß LE BON die Gruppe gar nicht kennt; er sieht diese vor lauter Masse nicht›[*]. Nur wenn eine Menge, wie etwa im Falle der Panik, unstrukturiert zu handeln beginnt, ist sie eine Masse; sowie sie sich aber strukturiert, insbesondere Führerrollen herausbildet, ist sie eine Gruppe. Von diesem Ausgangspunkt her vermag HOFSTÄTTER auf Grund reichen empirischen Materials überzeugend nachzuweisen, daß sich aus der komplizierten Gruppendynamik im Regelfall für alle denkbaren Gruppenleistungen ein Leistungsvorteil der Gruppe gegenüber dem Individuum ergibt.
Die Eigendynamik von Gruppenentscheidungen
Es unterliegt demnach keinem Zweifel, daß sich die Beratungen moderner parlamentarischer Gremien nicht mit den Maßstäben messen lassen, die LE BON aus den zügellosen Exzessen der revolutionären Masse oder den Überschwenglichkeiten der ersten französischen Nationalversammlung abstrahieren zu können glaubte; nichtsdestoweniger bleibt jede kollektive Urteilsbildung von einer ihr eigentümlichen Dynamik geprägt, die sich jeweils aus der Struktur der Gruppe, dem Charakter ihrer Mitglieder und der Art der Situation sowie aus dem speziellen Inhalt der zu treffenden Entscheidung ergibt. Diese Dynamik pflegt sich in Entscheidungen über Geld- und Finanzfragen besonders eindringlich bemerkbar zu machen; nicht ohne Grund waren in der Weimarer Verfassung der Haushaltsplan, alle Abgabengesetze und die Besoldungsordnungen von der Beschlußfassung im Wege des Volksentscheids ausdrücklich ausgeschlossen, um die auf diesen Gebieten besonders naheliegende Gefahr demagogischer Umtriebe und unsachlicher Entscheidungen nach Möglichkeit auszuschalten[*].
Zu den Faktoren, die zu dieser Eigendynamik der parlamentarischen Beschlußfassung beitragen, gehören natürlich in erster Linie die Größe und die Zusammensetzung des Parlaments selbst, das je nach dem geltenden Wahlsystem ein mehr oder weniger repräsentatives Abbild der Gesamtbevölkerung darstellt. An der Wiege des modernen Parlamentarismus stand das Recht der Stände, der Krone die Erhebung von Steuern und Abgaben zu bewilligen; mit der Ausdehnung des Stimmrechts auf weite Kreise der Nichtbesitzenden verlor jedoch die Steuerbewilligung allmählich mehr und mehr den Charakter eines eigenen Opfers der Bewilligenden. Die parlamentarischen Beschlüsse über Staatsausgaben und Steuern spiegeln statt dessen seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Be- und Entlastungskämpfe der im Parlament vertretenen Gruppen und Schichten wider; die Vertreter der Massenparteien folgten der Parole, die Lasten mehr und mehr dem ‹müßigen Reichtum› aufzubürden, die staatliche Fürsorge dagegen in immer breiterem Rahmen den eigenen Anhängern zugute kommen zu lassen.
Unvermerkt führt dieser Prozeß, der mehr oder weniger ausgeprägt in allen Ländern zu beobachten ist, zu einer Umkehrung der Rollen; statt die Regierungen in ihrem finanziellen Ausdehnungsstreben zu zügeln, erliegt das Parlament unter dem Einfluß seiner Mehrheitsparteien immer häufiger der Versuchung, großzügige Sozialmaßnahmen und andere Ausgaben zu beschließen, für deren Deckung die Regierung zu sorgen hat. Die Folge ist, daß die gewählte Regierung, die doch im Grunde nur das ausführende Organ der Legislative sein soll, sich gegen die Bewilligungs- und Ausgabefreudigkeit ihrer eigenen Auftraggeber zur Wehr setzen und versuchen muß, diese Eigendynamik der parlamentarischen Beschlußfassung in Schranken zu halten; das Vetorecht der Bundesregierung gegen zusätzliche Ausgabenbeschlüsse nach Art. 113 des Grundgesetzes ist das weithin sichtbare Zeichen dieses Rollentausches[*].
In ähnlicher Weise helfen sich die Länder gegen die Ausgabefreudigkeit ihrer Parlamente. Die bayerische Verfassung sieht beispielsweise eine erneute Beratung solcher Beschlüsse des Landtages, die die im Entwurf eingesetzten Ausgaben erhöhen, auf Verlangen der Staatsregierung vor; über Angelegenheiten, die Ausgaben verursachen, für die im Haushaltsplan kein entsprechender Betrag vorgesehen ist, kann der Landtag im übrigen nur beschließen, wenn er gleichzeitig für die notwendige Deckung zu sorgen bereit ist. Auch in Hamburg besteht ein Einspruchsrecht des Senats gegen ausgabenerhöhende Beschlüsse der Bürgerschaft, die gegebenenfalls wiederholt werden müssen und dann von einer qualifizierten Mehrheit abhängig sind; die Verfassung Berlins und die der meisten anderen Länder der Bundesrepublik enthalten ebenfalls derartige Sicherheitsvorkehrungen gegen die parlamentarische Bewilligungs- und Ausgabefreudigkeit, die den erwähnten Rollentausch zwischen Exekutive und Legislative anschaulich zutage treten lassen.
Der fehlende Sachverstand
Schon diese Erscheinung verrät mancherlei über die eigentümliche Dynamik parlamentarischer Beschlüsse über Finanz- und Steuerfragen. Offenbar ist es nicht damit getan, die Regierung aus der Mehrheit des Parlaments zu bilden und in ihrem Sinne zu instruieren; die größere Aktionsfähigkeit des an Zahl kleineren Gremiums führt alsbald zu einer Verlagerung der Gewichte. Darüber hinaus unterliegt die Willensbildung der Parlamente charakteristischen Schwächen, von denen die Regierung mit ihrem starken Rückhalt an der Bürokratie nicht angekränkelt ist; dazu gehört in erster Linie der Mangel an Sachkunde, die in der komplizierten Materie der Finanz- und Steuerpolitik besonders unentbehrlich ist. Der einzelne Abgeordnete ist in verstärktem Maße in der Situation, die die moderne Psychologie als Grundlage des allgemeinen Unsicherheitsgefühls erkannt hat; da ‹die Notwendigkeit zu handeln weiter reicht, als die Möglichkeit zu erkennen›[*], fühlt sich der Mensch unserer heutigen Welt ständig vom Leben überfragt. ‹Man sieht dies leicht ein, wenn man einmal ganz schlicht überlegt, zu einem wie geringen Bruchteil der an ihn herantretenden Fragen der moderne Mensch denn überhaupt eine auf Erfahrung und eigenes Nachdenken fundierte Meinung haben kann. Heute will man von ihm wissen, ob die Einheitsschule besser sei als eine Aufsplitterung der Bildungswege; morgen, ob Planwirtschaft leistungsfähiger als das freie Unternehmertum; übermorgen, ob alle Menschen gleichwertig seien. Ein anderes Mal hat er darüber zu befinden, ob die Anlehnung der Politik seines Landes an den Nachbarn A oder B vorzuziehen sei, ob Butter oder Kanonen eine bessere Zukunft garantieren, ob der Gebrauch antikonzeptioneller Mittel zu befürworten sei usw. usw.›[*]
Das ehrliche ‹Ich weiß nicht› auf alle solche Fragen würde, wie HOFSTÄTTER betont, die ‹Leichtfertigkeit› der dennoch getroffenen Entscheidungen in eine höchst unpraktische ‹Nie-Fertigkeit› verwandeln; niemand kann sich im heutigen Leben ein Ausweichen in Lethargie und Entschlußlosigkeit leisten. Müssen infolgedessen Entschlüsse und Entscheidungen ständig ohne hinreichende Gewißheit ihrer Richtigkeit und Zweckmäßigkeit getroffen werden, so bringt dieser Zwang auf der anderen Seite ein weitverbreitetes Unsicherheitsgefühl mit sich, ein Gefühl, den Anforderungen des Lebens eigentlich nicht gewachsen zu sein; macht diese Überforderung sich schon im beruflichen und privaten Leben jedes einzelnen geltend, so in potenziertem Maße im Parlament, dessen Mitglieder nicht nur die Notwendigkeit und sachliche Zweckmäßigkeit jeder Vorlage beurteilen, sondern auch für die Koordinierung mit der Gesamtheit aller übrigen politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen sorgen sollen.