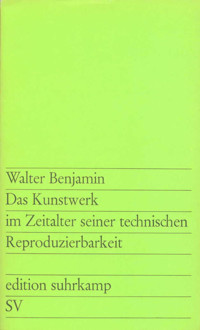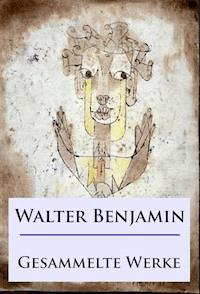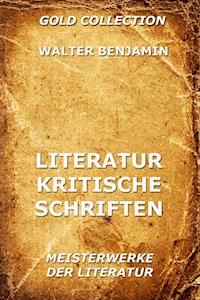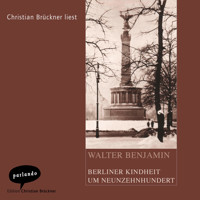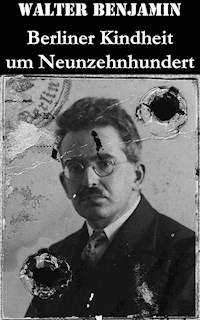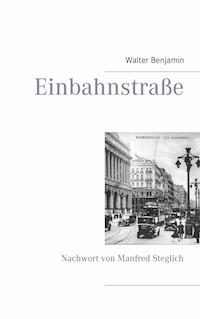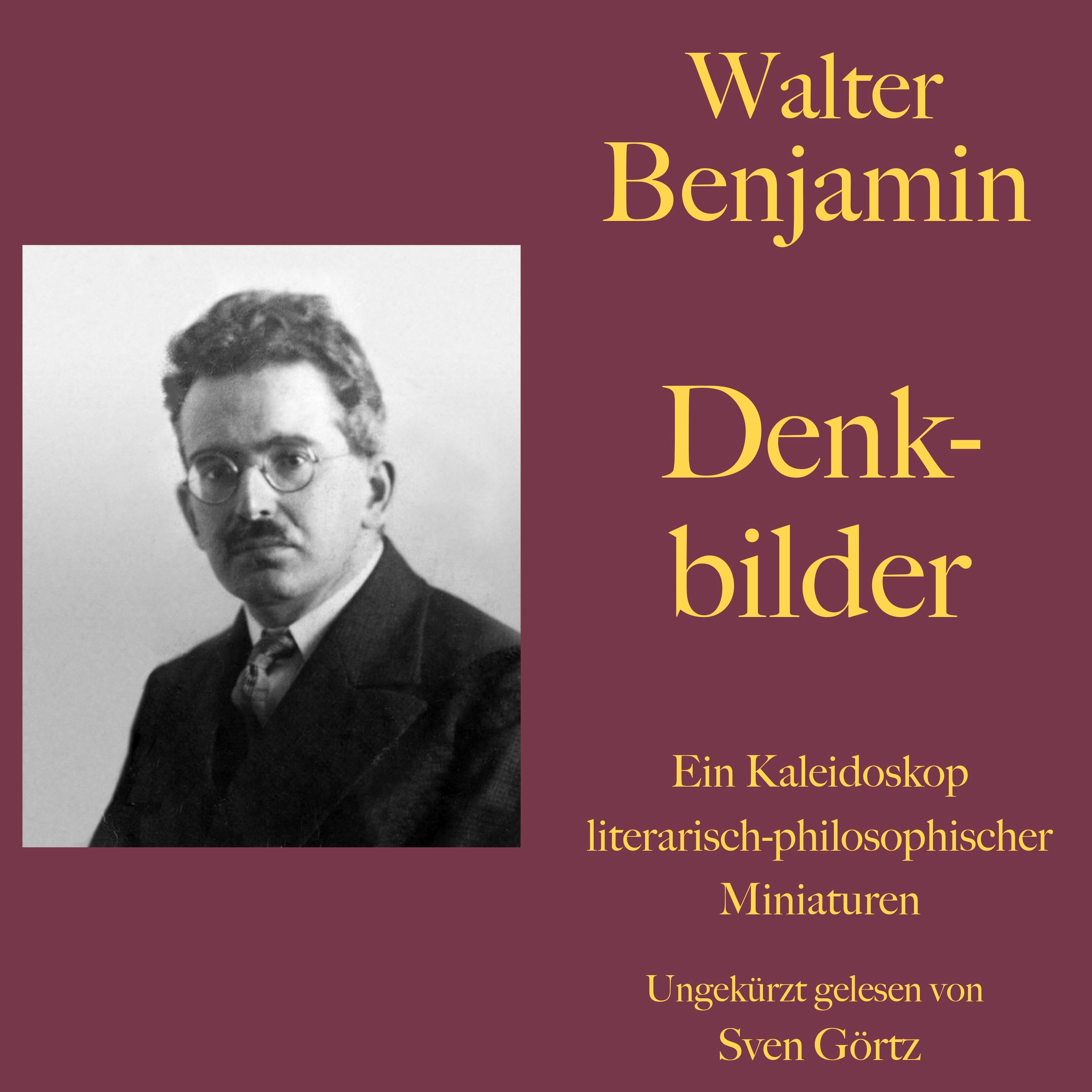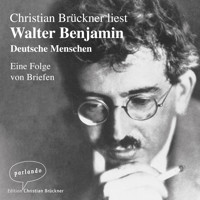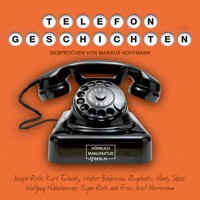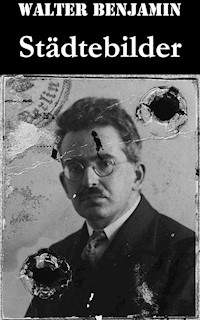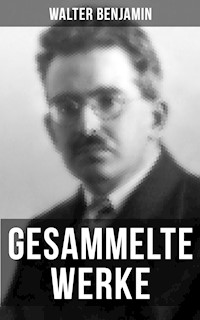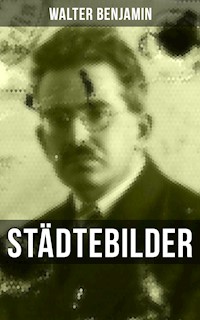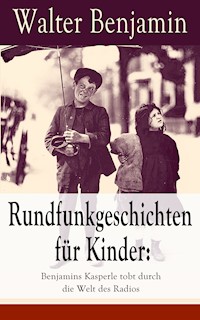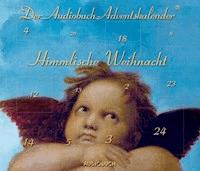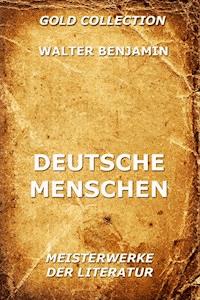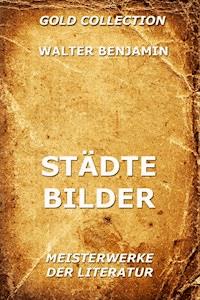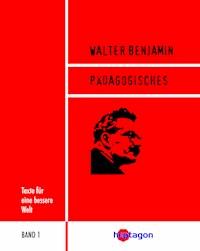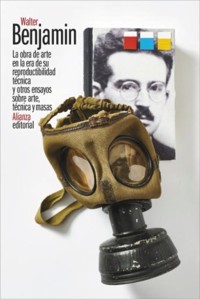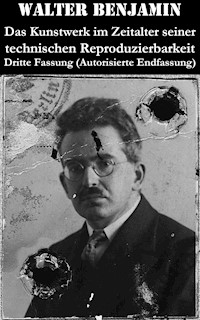
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Dritte Fassung (Autorisierte Endfassung) E-Book
Walter Benjamin
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit ist der Titel eines Aufsatzes, den Walter Benjamin 1935 im Pariser Exil verfasste. Er erschien erstmals 1936 unter dem Titel "L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée" in der Zeitschrift für Sozialforschung, in einer redaktionell überarbeiteten und gekürzten französischen Übersetzung. Benjamin vertritt darin die These, dass die Kunst und ihre Rezeption selbst, insbesondere durch die Entwicklung von Photographie und Film, einem Wandel unterworfen sind. Dies geschehe zum einen durch die Möglichkeit der massenhaften Reproduktion, zum anderen durch eine veränderte Abbildung der Wirklichkeit und damit einer veränderten kollektiven Wahrnehmung. Zudem verliere in diesen Prozessen das Kunstwerk seine Aura, was in der Folge wiederum die soziale Funktion der Medien verändere. Die durch die Reproduzierbarkeit entstehende kollektive Ästhetik biete zwar die Möglichkeit der Entwicklung hin zu gesellschaftlicher Emanzipation, berge aber auch die Gefahr der politischen Vereinnahmung, wie zeitgenössisch am Aufstieg des Faschismus deutlich werde. Benjamin bezeichnete seine Schrift als die "erste Kunsttheorie des Materialismus, die diesen Namen verdient". Während zu Benjamins Lebzeiten und in der direkten Nachkriegszeit die Rezeption des Aufsatzes begrenzt war, wurde der Text in den 1960er und 1970er Jahren wiederentdeckt. Seit Mitte der 1980er Jahre gilt er als eines der Gründungsdokumente der Kultur- und Medientheorie der Moderne. Diese letzte autorisierte Fassung wurde erstmals 1955 in dem zweibändigen Sammelwerk Schriften veröffentlicht, 1963 als eigenständige Schrift, neben den Aufsätzen Kleine Geschichte der Photographie und Eduard Fuchs, der Sammler und der Historiker, in Drei Studien zur Kunstsoziologie und 1972 im Band I der Gesammelten Schriften herausgegeben. Veröffentlichungen, Besprechungen und Rezeptionen nehmen in der Regel auf diese Fassung Bezug.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit.Dritte Fassung (Autorisierte Endfassung)
Inhaltsverzeichnis
(Zwischenblatt)
Die Begründung der schönen Künste und die Einsetzung ihrer verschiedenen Typen geht auf eine Zeit zurück, die sich eingreifend von der unsrigen unterschied, und auf Menschen, deren Macht über die Dinge und die Verhältnisse verschwindend im Vergleich zu der unsrigen war. Der erstaunliche Zuwachs aber, den unsere Mittel in ihrer Anpassungsfähigkeit und ihrer Präzision erfahren haben, stellt uns in naher Zukunft die eingreifendsten Veränderungen in der antiken Industrie des Schönen in Aussicht. In allen Künsten gibt es einen physischen Teil, der nicht länger so betrachtet und so behandelt werden kann wie vordem; er kann sich nicht länger den Einwirkungen der modernen Wissenschaft und der modernen Praxis entziehen. Weder die Materie, noch der Raum, noch die Zeit sind seit zwanzig Jahren, was sie seit jeher gewesen sind. Man muß sich darauf gefaßt machen, daß so große Neuerungen die gesamte Technik der Künste verändern, dadurch die Invention selbst beeinflussen und schließlich vielleicht dazu gelangen werden, den Begriff der Kunst selbst auf die zauberhafteste Art zu verändern.
Paul Valéry: Pièces sur l’art. Paris, o. J., p. 103/104 (»La conquéte de l’ubiquité«).
Vorwort
Als Marx die Analyse der kapitalistischen Produktionsweise unternahm, war diese Produktionsweise in den Anfängen. Marx richtete seine Unternehmungen so ein, daß sie prognostischen Wert bekamen. Er ging auf die Grundverhältnisse der kapitalistischen Produktion zurück und stellte sie so dar, daß sich aus ihnen ergab, was man künftighin dem Kapitalismus noch zutrauen könne. Es ergab sich, daß man ihm nicht nur eine zunehmend verschärfte Ausbeutung der Proletarier zutrauen könne, sondern schließlich auch die Herstellung von Bedingungen, die die Abschaffung seiner selbst möglich machen.
Die Umwälzung des Überbaus, die viel langsamer als die des Unterbaus vor sich geht, hat mehr als ein halbes Jahrhundert gebraucht, um auf allen Kulturgebieten die Veränderung der Produktionsbedingungen zur Geltung zu bringen. In welcher Gestalt das geschah, läßt sich erst heute angeben. An diese Angaben sind gewisse prognostische Anforderungen zu stellen. Es entsprechen diesen Anforderungen aber weniger Thesen über die Kunst des Proletariats nach der Machtergreifung, geschweige die der klassenlosen Gesellschaft, als Thesen über die Entwicklungstendenzen der Kunst unter den gegenwärtigen Produktionsbedingungen. Deren Dialektik macht sich im Überbau nicht weniger bemerkbar als in der Ökonomie. Darum wäre es falsch, den Kampfwert solcher Thesen zu unterschätzen. Sie setzen eine Anzahl überkommener Begriffe – wie Schöpfertum und Genialität, Ewigkeitswert und Geheimnis – beiseite – Begriffe, deren unkontrollierte (und augenblicklich schwer kontrollierbare) Anwendung zur Verarbeitung des Tatsachenmaterials in faschistischem Sinn führt. Die im folgenden neu in die Kunsttheorie eingeführten Begriffe unterscheiden sich von geläufigeren dadurch, daß sie für die Zwecke des Faschismus vollkommen unbrauchbar sind. Dagegen sind sie zur Formulierung revolutionärer Forderungen in der Kunstpolitik brauchbar.
I
Das Kunstwerk ist grundsätzlich immer reproduzierbar gewesen. Was Menschen gemacht hatten, das konnte immer von Menschen nachgemacht werden. Solche Nachbildung wurde auch ausgeübt von Schülern zur Übung in der Kunst, von Meistern zur Verbreitung der Werke, endlich von gewinnlüsternen Dritten. Dem gegenüber ist die technische Reproduktion des Kunstwerkes etwas Neues, das sich in der Geschichte intermittierend, in weit auseinanderliegenden Schüben, aber mit wachsender Intensität durchsetzt. Die Griechen kannten nur zwei Verfahren technischer Reproduktion von Kunstwerken: den Guß und die Prägung. Bronzen, Terrakotten und Münzen waren die einzigen Kunstwerke, die von ihnen massenweise hergestellt werden konnten. Alle übrigen waren einmalig und technisch nicht zu reproduzieren. Mit dem Holzschnitt wurde zum ersten Male die Graphik technisch reproduzierbar; sie war es lange, ehe durch den Druck auch die Schrift es wurde. Die ungeheuren Veränderungen, die der Druck, die technische Reproduzierbarkeit der Schrift, in der Literatur hervorgerufen hat, sind bekannt. Von der Erscheinung, die hier in weltgeschichtlichem Maßstab betrachtet wird, sind sie aber nur ein, freilich besonders wichtiger Sonderfall. Zum Holzschnitt treten im Laufe des Mittelalters Kupferstich und Radierung, sowie im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts die Lithographie.