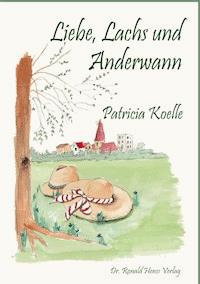9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Inselgärten-Reihe
- Sprache: Deutsch
Juna kämpft sich nach dem Tod ihres Mannes zurück ins Leben. Linnea muss sich nach einer Trennung und Turbulenzen im Job neu orientieren. Als die beiden Frauen sich begegnen und Freundschaft schließen, merken sie, wie sie sich gegenseitig Mut geben und inspirieren können. Eine gemeinsame Reise führt die beiden auf die Insel Hiddensee, wo sie das Geheimnis des goldenen Libellenanhängers lüften wollen, den Juna einst geerbt hat. Die Faszination für Libellen teilen beide ebenso wie den Wunsch, den Blick auf die kleinen, zauberhaften Dinge im Leben zu lenken. Schon bald gestalten sie auf Hiddensee einen Geschichtengarten, der nicht nur die Erinnerung an vergangene Zeiten bewahren soll, sondern auch für die Libellen und viele andere selten gewordene Lebewesen ein neues Zuhause schafft. Können die beiden Frauen durch dieses Projekt auch ihren eigenen Platz im Leben wiederfinden und ihr Herz öffnen – vielleicht sogar für die Liebe? Der zweite Band der ›Inselgärten-Reihe‹ von Bestseller-Autorin Patricia Koelle – über das Glück der kleinen, zauberhaften Momente im Leben Dieses Buch ist ein in sich geschlossener Roman, den man eigenständig lesen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Patricia Koelle
Das Lächeln der Libellen
Über dieses Buch
Juna kämpft sich nach dem Tod ihres Mannes zurück ins Leben. Linnea muss sich nach einer Trennung und Turbulenzen im Job neu orientieren. Als die beiden Frauen sich begegnen und Freundschaft schließen, merken sie, wie sie sich gegenseitig Mut geben und inspirieren können. Eine gemeinsame Reise führt die beiden vom Spreewald, über Stralsund und Rügen auf die Insel Hiddensee, wo sie das Geheimnis eines goldenen Libellenanhängers lüften wollen, den Juna einst geerbt hat. Die Faszination für Libellen teilen beide ebenso wie den Wunsch, den Blick auf die kleinen zauberhaften Dinge im Leben zu lenken. Schon bald finden Sie auf Hiddensee einen längst vergessenen Inselgarten, der nicht nur die Erinnerung an vergangene Zeiten bewahren soll, sondern auch für die Libellen und viele andere selten gewordene Lebewesen ein neues Zuhause schafft. Können die beiden Frauen durch dieses Projekt ihren eigenen Platz im Leben wiederfinden – und vielleicht sogar die Liebe?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Patricia Koelle ist eine Berliner Autorin mit Leidenschaft fürs Meer – und fürs Schreiben, in dem sie ihr immerwährendes Staunen über das Leben, die Menschen und unseren sagenhaften, unwahrscheinlichen Planeten zum Ausdruck bringt. Bei FISCHER Taschenbuch erschienen ist die Ostsee-Trilogie mit den Bänden ›Das Meer in deinem Namen‹, ›Das Licht in deiner Stimme‹ und ›Der Horizont in deinen Augen‹, außerdem der alleinstehende Roman ›Die eine, große Geschichte‹. ›Wenn die Wellen leuchten‹, ›Wo die Dünen schimmern‹ und ›Was die Gezeiten flüstern‹ sind die drei Bände ihrer Nordsee-Trilogie, die auf Amrum spielt. ›Ein Engel vor dem Fenster‹ ist eine Sammlung von Wintergeschichten, ›Der Himmel zu unseren Füßen‹ ein Weihnachtsroman und ›24 Stück vom Glück‹ eine Sammlung von stimmungsvollen Geschichten zur Weihnachtszeit. ›Die Zeit der Glühwürmchen‹ und ›Das Lächeln der Libellen‹ gehören zu ihrer Inselgärten-Reihe.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Widmung
Juna
1 Zuflucht
2 Wilhelms Auftrag
3 Feuer und Wasser
4 Das Angebot
5 Ein Zeichen
Linnea
6 Teamfähig
7 Veränderungen
Juna
8 Entschluss
Juna
9 Adrian
Juna
10 Überfahrt
11 Unvergesslich
Juna
12 Das Irrlicht
13 Am Ende hört nichts auf
Linnea
14 Allein
15 Neue Pläne
Linnea
16 Zu viel von allem
Juna
17 Neue Schritte
18 Eine Idee
Linnea
19 Beflügelt
20 Unter der Oberfläche
Juna
21 Auf dem Weg
Linnea
22 Die rote Zahl
23 Spuren der Jahrhunderte
Juna
24 Die Stimme der Insel
25 Orte wie dieser
26 Tiefe Wurzeln
Linnea
27 Spuren
Juna
28 Der Dornbuschweg
Linnea
29 Eis im Herbst
Juna
30 Auf dem Weg
Linnea
31 Das Bildnis
32 Gedankenblitze
Juna
33 Verbindungen
34 Auf dem Gipfel
Linnea
35 Treffer
Juna
36 Bruder Timmo
Linnea
37 In den Wellen
Juna
38 Weihnachtslichter
39 Hinter Fliederbüschen
Epilog
Danksagung
Leseprobe: Die Träume der Bienen
Sila
1 Sila
2 Wanda
Für alle, denen wir hoffentlich eine Welt hinterlassen, in der man noch immer mit Andacht und Staunen jene Wunder betrachten kann, von welchen hier die Rede ist.
Auch wenn es momentan nicht so aussieht, als ob uns das gelingen könnte – ich glaube daran.
Juna
Spreewald
2015
1Zuflucht
Sie hatte Wilhelm etwas versprochen.
Und jetzt gab es kein Zurück mehr, denn gestern hatten sie ihn beerdigt. Nun lag ihr das Versprechen auf der Seele wie der Nebel dieses Oktobermorgens auf der kühlen Erde.
Juna atmete tief durch. Die Luft schmeckte nach Herbst und späten Äpfeln, Erinnerungen an den Sommer und Vergänglichkeit.
Wilhelm hatte nicht von ihr verlangt, sich gleich darum zu kümmern. Gerade er hatte ihr als Einziger immer für alles so viel Zeit gelassen, wie sie brauchte.
Jetzt war sie erst einmal wieder dort, wo sie sich schon immer am sichersten gefühlt hatte. Hier im dichten Spreewald zwischen den unzähligen Wasserläufen, die ihn wie ein Labyrinth durchzogen, würde nicht einmal ihr eigenes Gewissen sie so schnell finden.
Juna wusste nicht, was sie so früh geweckt hatte. Vielleicht waren es die Rufe der Kraniche gewesen, die irgendwo hoch über den Baumwipfeln auf der Suche nach Wärme südwärts zogen. Sie fröstelte. Unschlüssig blickte sie vom Haus zum Wasser, dann wieder auf die Fußabdrücke, die ihre Schritte in dem taufeuchten Gras hinterlassen hatten. Gerade das Neblige, Stille dieses Morgens lockte sie. Außerdem musste sie die Geschehnisse von gestern erst einmal verarbeiten. Entschlossen lief sie ins Haus zurück, griff sich eine dicke Strickjacke und füllte eine Thermoskanne mit Tee.
Das Boot lag unter den Hortensienbüschen auf dem Gras, die Öffnung nach unten gekehrt. Regen hatten die verblichenen Blüten schwer gemacht, so dass sie über den Rumpf hingen. Blütenblätter klebten darauf wie blassblaues Konfetti. Rundherum stand das Gras hoch. Daran sah man, wie viele Wochen sie fort gewesen war. Juna zog das Kajak hervor und drehte es herum. Ein überraschter Grasfrosch sprang aus der Öffnung und machte sich eilig davon.
Juna schob das Kajak ins Wasser, prüfte, ob es noch dicht war, und legte das Paddel hinein, das unter Spinnweben an der Hauswand lehnte. Dann schlang sie die Schnur um einen Pfahl und holte noch den Topf mit dem Rhododendron, den sie aus einer dafür bekannten Gärtnerei in Bad Zwischenahn mitgebracht hatte. Zu dieser Jahreszeit blühte er natürlich nicht mehr, aber er war voller Knospen, ein Versprechen für das kommende Jahr. Dem Schild mit dem Foto, das an ihm hing, konnte man seine ungewöhnliche dunkelrote Farbe mit einer weißen Zeichnung in der Mitte entnehmen. Juna stellte den Topf ins Boot, setzte sich dahinter und fädelte ihre Beine rechts und links an der Pflanze vorbei.
Der Nebel hatte begonnen, sich ein wenig zu heben. Aber er war immer noch so dicht, dass er den Wald in Geheimnisse hüllte. Juna hörte einen großen Fisch springen, konnte ihn aber nicht sehen. Das Kajak glitt zwischen den treibenden Schwaden auf der schmalen Wasserfläche lautlos dahin wie über Wolken. Selbst das leise Plätschern des Paddels beim Eintauchen klang gedämpft.
Wie gut der stetige Rhythmus des Paddelns ihr tat, nach allem, was sie in den letzten Wochen und Tagen erlebt hatte! Eigentlich war sie es gewöhnt, den ganzen Tag an der frischen Luft zu sein. Neben Wilhelms Bett im Zimmer zu sitzen, seine Hand zu halten, auf seinen Atem zu hören, der manchmal auszusetzen schien und dann wiederkam, ihm konzentriert zuzuhören, wenn er aufwachte und ihm das Sprechen schwerfiel, all das hatte sie gern getan. Doch das Stillsitzen in der stickigen Luft war ihr immer schwerer gefallen.
Wilhelm fror so leicht und mochte das Fenster nicht offen haben. Durch die Scheibe konnte er auf das Hotel sehen, das er jahrzehntelang geführt hatte. Der Arzt kam regelmäßig und gab Juna genaue Anweisungen, so dass sie sich nicht allein gelassen fühlte.
Auch Anselm, Wilhelms jüngerer Bruder, der sich um alles Organisatorische und den Papierkram kümmerte, sah jeden Tag herein. Gelegentlich löste er Juna auch ab, damit sie draußen eine Runde drehen konnte. Aber es fiel ihr schwer, denn sie wollte bei Wilhelm sein. Er war schließlich auch immer für sie da gewesen, selbst in ihrer allerschwersten Zeit.
Seit Junas Großvater vor zwei Jahren gestorben war, waren Wilhelm und sie sich noch nähergekommen. Stillschweigend hatte er dessen Stelle in Junas Leben übernommen, so gut es ihm möglich war. Die beiden alten Herren waren die besten Freunde gewesen, auch wenn sie sich erst spät im Leben kennengelernt hatten.
Juna war froh, dass sie ihm bis zum Ende beistehen konnte. Besonders, da er noch diese ungeahnte, ihm so wichtige Bitte an sie geäußert hatte. Aber nun wusste sie nicht, wie sie mit der Leere umgehen sollte, die entstanden war. Seit auch Wilhelm nicht mehr da war, schien es ihr, als wäre ihr der Großvater wieder näher. So, als müsste von irgendwoher gleich seine Stimme durch den Nebel dringen.
»Hallo, Juna! Schön, dich zu sehen!«, ertönte stattdessen die Stimme Bens. Er stand auf dem Steg, den Juna angesteuert hatte. Auch wenn es sein Steg und sein Lokal war, das hinter ihm als verschwommene Silhouette aufragte, hatte sie nicht erwartet, ihn so früh hier zu sehen. Er war damit beschäftigt, etwas in einen Kahn zu laden. Es war einer der Kähne, die noch Junas Großvater gebaut hatte. Jetzt nahm Ben das Seil, das Juna ihm zuwarf, vertäute ihr Kajak und reichte ihr eine Hand, um ihr beim Aussteigen zu helfen.
»Warte, ich hab etwas für dich«, sagte sie und reichte ihm den Topf hinauf. »Als Dankeschön fürs Blumengießen und Postreinholen.«
»Ach was. Wozu hat man gute Freunde? Das ist doch selbstverständlich.«
»Ist es nicht. Es war ja eine ganz schön lange Zeit.« Juna kletterte auf den Steg und beobachtete erfreut, wie begeistert er das Etikett betrachtete und die glänzenden Blätter befühlte. Sie wusste, wie stolz er auf seinen Garten war, in dem die Gäste besonders gern frühstückten. Schließlich kannten sie sich seit über vierzig Jahren. Kaum zu glauben, dass sie nun beide dreiundfünfzig waren. Wenn sie ihn sah, war ihr immer noch manchmal, als würde hinter der nächsten Biegung ein Abenteuer auf sie beide warten.
»Jedenfalls vielen Dank für das schöne Geschenk.« Ben stellte den Topf sorgsam in eine geschützte Ecke. Dann sah er sie forschend an. »War es sehr schwer?«
Juna blickte zu Boden. »Eigentlich war es sehr friedlich. Nur die Beerdigung gestern, die muss ich noch verdauen.«
Er umarmte sie kurz. »Wilhelm war ein sehr feiner Kerl. Genau wie dein Großvater. Ich vermisse die beiden auch.«
Er ließ Juna los und legte ihr dann einen Arm um die Schultern. »Komm. Du hast bestimmt noch nichts gegessen. Ich lade dich zum Frühstück ein.«
»Ich habe Tee an Bord, und du wolltest doch gerade weg«, widersprach sie.
»Ich wollte nur eine kleine Auslieferung machen. Das eilt nicht. Ich muss dir noch etwas sagen.«
Kurze Zeit später saßen sie sich im Schutz der Hauswand an einem Gartentisch gegenüber. Ben schmierte ihr ein Brötchen und belegte es mit Käse, bevor er es ihr zuschob. Er wusste genau, was sie mochte. »Iss. Du bist ganz dünn geworden.«
Juna biss in das Brötchen, zu müde, um zu widersprechen. Es tat gut, mal selbst bedient zu werden. Sie hatte tatsächlich Appetit, stellte sie fest. »Wie läuft das Geschäft?«, fragte sie. Ben leitete den Spreefrosch, eines jener beliebten Lokale, wo die Spreewaldkähne mit den Gästen aus der Stadt anlegen konnten, wenn die Leute essen wollten oder einfach nur eine Pause brauchten.
»Ganz gut für Ende Oktober. Das Wetter war in den letzten Tagen wesentlich besser als heute.«
»Ich mag dieses Wetter.« Juna war dankbar für den Nebel, in dem sie sich so schön allein und geborgen fühlen und sogar davon ausgehen konnte, dass es niemand sah, wenn ihr eine Träne entwischte. Es passte zu ihrer Stimmung, und außerdem hatte sie den Nebel schon als Kind geliebt, wenn jede Wurzel am Ufer zu einem Märchenwesen wurde. »Was wolltest du mir sagen?«
Ben schob ein Marmeladenglas hin und her. Es war von der Feuchtigkeit in der Luft beschlagen und hinterließ ein Muster auf dem Holztisch. Sieht aus wie die Olympischen Ringe, dachte Juna. Dabei fiel ihr ein, was sie nachher machen konnte, um ihre wirren Gedanken zu sortieren, die seit Tagen hin und her sprangen wie ein Kaninchen im Käfig. Wie lange hatte sie ihren Bogen nicht mehr in der Hand gehalten? Jetzt konnte sie es kaum erwarten. Die Sehne spannen, das Ziel anvisieren, an nichts anderes mehr denken als nur an den Pfeil und seine saubere Flugbahn auf einen bestimmten Punkt hin.
Mit Mühe konzentrierte sie sich wieder auf Ben.
»Weißt du noch, als Wilhelm im Frühling noch mal hier war?«, fragte er. »Ich war erstaunt, als er einmal ohne dich auftauchte. Er hatte sich von irgendeinem vorbeifahrenden Kahn mitnehmen lassen. Er wollte mich unbedingt allein sprechen.«
»Dich? Warum das denn?«
»Er hatte sich wohl überlegt, dass ich der Einzige bin, der auf dich aufpassen wird, wenn er nicht mehr da ist.« Ben grinste unwillkürlich. »Du weißt ja, für die Großväter wird man nie erwachsen. Bevor du auf mich losgehst, ich weiß sehr wohl, dass du schon seit Jahrzehnten auf dich selbst aufpassen kannst.«
»Ich hab doch gar nichts gesagt.«
»Ja, aber ich kenne dich. Jedenfalls habe ich ihm schleunigst erst mal was zu trinken gebracht. Er sah ziemlich erschöpft aus.« Jetzt lächelte Ben zärtlich. »Er wollte unbedingt eine Spreewälder Himbeerfassbrause. Ich weiß, dass das nicht gut für seine Zuckerwerte war, aber er hat sie doch so geliebt. Und er klopfte mir auf die Schulter. ›Ist vielleicht meine Letzte, Junge‹, sagte er. ›Setz dich zu mir und stoße mit mir auf das Leben an. Es ist großartig. Ich möchte, dass du Juna immer daran erinnerst, falls sie es mal vergessen sollte.‹ Und dann saßen wir da und stießen an, und er sagte: ›Das Leben ist nämlich genau wie die Farbe dieses viel zu süßen Getränks. Und auch wie der Geschmack. Süß und bitter gleichzeitig. Und das Prickeln nicht zu vergessen! Nur wenn man es zu lange stehenlässt, ohne es zu genießen, dann wird es schal.‹ Er hielt das Glas gegen die Sonne. ›Unvergleichlich, diese Farbe‹, murmelte er. ›Dieses tiefe, glühende Rot gibt es nirgendwo anders, da kommt nicht einmal ein guter Wein mit. Aber verrate niemandem, dass ich das gesagt habe. Außer Juna natürlich.‹ Er trank aus, wischte sich den Mund, beugte sich vor und packte mich am Ärmel. ›Ben‹, sagte er, ›bitte sage Juna Folgendes: Sie soll die Summe, die ich ihr vererben werde, für sich ausgeben, für etwas, das sie wirklich gerne tun möchte. Nicht, weil irgendjemand findet, dass sie es tun sollte, zum Beispiel ihre Eltern. Ich will auch nicht, dass sie es einfach an Kris weitergibt. Kris kann sehr gut für sich selbst sorgen. Ich will, dass Juna damit etwas macht, das sie genauso sehr genießt wie ich diese Himbeerfassbrause! Ich werde es ihr auch selbst sagen, aber das wird nicht genügen.‹«
Ben sah Juna ernst an, während er ihre Tasse nachfüllte. »Was Kris betrifft, hat er recht, weißt du. Obwohl es mich natürlich nichts angeht. Aber ich musste dir doch ausrichten, worum Wilhelm mich gebeten hat.«
Juna lächelte traurig. Sie konnte sich die Szene ganz genau vorstellen. Wie Wilhelm die Brause genossen hatte, das Funkeln in seinen Augen und den Nachdruck in seiner Stimme.
»Ich weiß, dass mein Sohn sehr gut ohne mich auskommt. Ich bin stolz darauf.«
»Das kannst du auch sein.«
Kris war seinem Traum gefolgt und hatte schon in ganz jungen Jahren eine Firma mitgegründet, in der es um die Entwicklung von Sportspielen ging. Eine größere Gesellschaft in den USA hatte das Start-up aufgekauft und Kris eine Stelle als Entwickler angeboten. Er hatte sich bereits international einen Namen gemacht. Für Juna wäre das Leben, das er führte, ein Gräuel gewesen, aber sie wusste, dass er glücklich war.
»Ich weiß absolut nicht, wie ich Wilhelm diesen Gefallen tun soll. Ich bin genau da, wo ich sein möchte, und habe alles, was ich brauche«, sagte sie.
Ben nickte verständnisvoll. »Im Moment ist das hier sicher der richtige Ort für dich. Lass dir Zeit! Aber denk an die Sache mit der Brause. Wenn du das Glas zu lange stehen lässt, wird sie schal. Und dann schmeckt sie nicht, glaub mir.«
»Mir schmeckt sie nicht mal dann, wenn sie frisch ist. Aber was die Farbe angeht, verstehe ich, was Wilhelm gemeint hat.« Juna stand auf. »Danke, Ben! Du hast ihn gerade für mich ganz lebendig werden lassen, aber jetzt will ich dich nicht länger aufhalten.« Hinter ihnen in der Wirtschaft hatte das Personal begonnen, sich zu regen. Irgendjemand nahm mit Schwung die Stühle vom Tisch. In der Küche klapperte Geschirr. »Bald kommen die ersten Frühstücksgäste.«
»Macht nichts. Ich kann meine Auslieferung auch später machen. Pass auf dich auf, Juna. Wenn ich noch etwas für dich tun kann, sag Bescheid.«
Sie hatte großes Glück, einen Freund wie Ben zu haben, dachte Juna, als sie das Boot losband. Sie kannten sich schon, seit sie in den Ferien immer bei ihrem Großvater gewesen war. Unendlich dankbar war sie ihm dafür, dass er sich um ihren Garten kümmerte, wenn sie nicht da war. Um ihren sicheren Rückzugsort, den ihr der Großvater hinterlassen hatte und in dem sie mit jeder Blume befreundet war. Sie konnte nun einmal besser mit Pflanzen umgehen als mit Menschen, jedenfalls seitdem … aber darüber bloß nicht nachdenken, nicht auch noch, nicht jetzt.
Bens Brötchen hatte ihr gutgetan. Mit neuem Schwung paddelte sie los und bog in die Moorige Tschummi ein. Das war ihr Lieblingsfließ. Fließ, so bezeichnete man hier alle flachen Wasserläufe. Rechts und links an den Ufern lag nur Wald, es gab keine bewohnten Grundstücke. Uralte Sumpfzypressen ragten bis zu fünfunddreißig Meter in die Höhe, majestätisch und ein wenig bizarr. Sie waren immer da, ungerührt, verlässlich. Auch mit ihnen war sie schon seit ihrer Kindheit befreundet. Märchenbücher hatte Juna nie gebraucht. Sie lebte ja in einem echten Märchenwald, wenn sie hier sein durfte und der Großvater ihr alles über die Tiere und Pflanzen erzählte, deren Reich es war.
Den »Nyks« hatten die Leute ihn genannt. Das war die wendische Schreibweise von Nix. Der Wassermann. Der Wassermann, der gut und böse zugleich sein konnte, vor dem alle Respekt hatten, den sie sowohl verehrten als auch ein wenig fürchteten. Manche dachten, ihr Großvater könnte vorhersagen, was in der Zukunft geschehen würde. Genau wie die Sagengestalt, nach der sie ihn benannt hatten.
»Lass dir nichts einreden«, hatte der Großvater augenzwinkernd und ein wenig barsch gesagt. »Ich kenne einfach nur das Wetter besser als sie alle. Ich kann den Himmel lesen, den Zustand des Bodens und den Geruch im Wind. Daher weiß ich beizeiten, wann ein Hochwasser kommt oder eine Dürre, ein Unwetter oder wochenlanger Sonnenschein. Ich bin mit den alten Baumriesen hier vertraut und ahne, wo einer beim nächsten Sturm umfallen wird, ich höre es an seiner Sprache, an dem Knirschen, wenn er mit dem Wind kämpft. Ich bin hier gezeugt, geboren, aufgewachsen und zum Vater und Großvater geworden. Und das nicht als Erster meiner Familie. Alles, was sie Zauberei nennen, ist nur Erfahrung, Mädchen. Alles nur Lebenserfahrung! Aber lass sie glauben, was sie glauben wollen. Du kannst sie sowieso nicht davon abbringen, und wenn sie mich für den Nyks persönlich halten, hat es auch seine Vorteile.«
»Dann bist du gar nicht der richtige Nyks?«, fragte Juna.
»Nein, Kleines. Ich bin einfach nur dein Großvater, ein knorriger alter Mann, der Teil dieser Landschaft geworden ist, weil er so lange hier lebt.«
Doch Juna war sich da nicht so sicher, und sie nannte ihn bald auch nur noch den Nyks, weil alle es taten – und außerdem, wer hatte schon einen Wassermann zum Großvater?
Er beugte sich vor und klopfte ihr aufs Knie. Seine Augen unter den buschigen weißen Brauen blitzten. »Den richtigen Nyks gibt es nicht«, sagte er. »Lass dir nicht einreden, dass du dich vor ihm fürchten musst! Aber mit den Irrlichtern«, er lehnte sich zurück und tauchte wieder energisch die Paddel ins Wasser, »… mit den Irrlichtern ist das etwas anderes! Wenn du ein Irrlicht siehst, solltest du darauf achtgeben. Ein Irrlicht ist eine ernste Sache. Es hat dir etwas zu sagen.«
Seine Worte klangen auf einmal so gewichtig, dass Juna froh war, dass sie nie ein Irrlicht gesehen hatte und über den Waldboden nur Sonnenflecken huschten.
2Wilhelms Auftrag
Die steigende Sonne erfüllte den verbliebenen Nebel mit einem weichen, goldenen Licht, das immer mehr vom Wald sichtbar werden ließ. Auch die Wasseroberfläche nahm Gestalt an. Die Seerosenblätter, die sich gelb und rot verfärbt hatten und dabei waren, auf den Grund zu sinken, wirkten wie die beklecksten Paletten eines Malers. Ebenso flammend rote und gelbe Blätter rieselten von den Bäumen, trieben in der Strömung an der Seite von Junas Kajak oder lagen wie verlorene Goldmünzen in der Tiefe.
Juna bog in die Quodda ein, die ein wenig breiter war als die Moorige Tschummi. Hier gab es wieder bewohnte Grundstücke, darauf die typischen dunklen Blockhäuser von Lehde, manche mit Fremdenzimmern. Auf einem Steg kniete eine Mutter mit einem kleinen Jungen, der aufgeregt auf einen Pfahl zeigte. »Was ist das, Mama, ein kleiner Drachen? Oder ein Babydinosaurier?«
»Nicht alles, was sich bewegt, ist ein Dinosaurier, Luis«, sagte seine Mutter geduldig. Juna musste schmunzeln, als sie an die Zeit dachte, in der Kris in der Dinosaurierphase gewesen war.
»Aber was ist es dann, Mama?«, bohrte Luis nach.
»Ich glaube, das ist eine Libelle.«
»Eine Babylibelle?«
Die Mutter wirkte etwas überfordert von der Wissbegierigkeit ihres Sohnes. Juna hielt an, legte das Paddel über das Boot und hielt sich mit einer Hand am Pfahl fest. »Hallo«, sagte sie und betrachtete das Objekt, das Luis’ Neugier geweckt hatte. »Das ist keine Babylibelle. Das ist eine ganz erwachsene Libelle. Sie heißt Winterlibelle.«
»Und warum sitzt sie so still?«, fragte Luis. »Hat die Winterlibelle gar keine Angst vor uns?«
»Wahrscheinlich ist ihr noch ganz kalt von der Nacht«, sagte Juna. »Sie wartet darauf, dass die Sonne sie aufwärmt.«
»So lange können wir aber nicht bleiben«, sagte die Mutter. »Komm, Luis, wir müssen los. Der Papa wartet nämlich auch. Danke schön«, sagte sie zu Juna und nahm Luis bei der Hand.
»Tschüss«, sagte Luis und winkte ihr zu.
»Tschüss, Luis.« Die beiden verschwanden im Haus, aber Juna betrachtete weiter versonnen das kleine Insekt. Ein zerbrechlicher brauner Strich mit großen Augen, die elfenhaften Flügel auf der sonnenabgewandten Seite zusammengefaltet, damit ihr nichts von der aufkommenden Wärme verlorenging.
Die letzten Nebelfetzen hatten sich jetzt aufgelöst. Die Sonnenstrahlen fanden ihren Weg durch die Bäume und ließen die feine Zeichnung der Flügel sichtbar werden. An dem zarten Körper, dünn wie die Mine eines Kugelschreibers, glänzten kupferne Flecken. Ganz behutsam näherte sich Juna dem Wesen, das ihr so vertraut war, obwohl man es gar nicht häufig zu Gesicht bekam. Selbst wenn diese Kleinlibellen anwesend waren, übersah man sie meist, so unauffällig und bescheiden fügten sie sich in die Herbsttöne des Waldes.
Jetzt waren sie sich beide so nahe, dass sie sich in die Augen blicken konnten. Juna sah, was sie hatte sehen wollen. Das winzige, rätselhafte Lächeln, das sich durch die Anatomie des Libellenkopfes ergab.
»Warum lächeln Libellen immer?«, hatte sie ihren Großvater früher gefragt. »Sie müssen doch traurig sein, weil sie nur so kurz leben.«
Der Nyks hatte sie von klein auf alles über Libellen gelehrt. Er teilte das Jahr in die Flugzeiten der verschiedenen Arten ein, von denen es hier über achtzig gab. Der stille Spreewald mit seinen ausgedehnten Fließen, Auen und Wäldern war der ideale Lebensraum für sie. Der Flugzeitenkalender ihres Großvaters hing in der Küche an der Wand. Frühling war, wenn man die Frühe Adonislibelle entdeckte, die der Winterlibelle ähnelte, aber rot mit schmalen gelben Ringen war. Der Sommer begann, wenn all die anderen nach und nach auftauchten, auch die großen. Azurjungfer, Prachtjungfer, Granatauge, Federlibelle, Smaragdlibelle, Mosaikjungfer. Und vor allem die schönste, die Blauflügel-Prachtlibelle, deren Flügel, wie ihr Name schon sagte, dunkelblau glänzten. Im Herbst wurden es nach und nach weniger, bis nur noch Binsenjungfern und Weidenjungfern flogen. Und die Winterlibelle.
»Genau darum lächeln sie ja«, hatte der Nyks geantwortet. »Weil sie wissen, wie kostbar ein Tag ist. Weil sie das Leben unter diesem Himmel zu schätzen wissen und immer so gut fliegen, wie sie können. Warum sollten sie da nicht lächeln? Außerdem leben sie nicht kurz. Ich habe dir doch beigebracht, dass sie mehrere Jahre als Larven im Wasser verbringen, während sie heranwachsen. Es ist nur die Zeit des Fliegens, die kurz ist. Und weil sie nun endlich fliegen können, lächeln sie.«
»Aber die Winterlibelle fliegt länger«, sagte Juna und tippte mit ihrem kleinen Zeigefinger auf das Kästchen im Flugzeitenkalender, welches bewies, dass die Winterlibelle die einzige war, die man noch im November sehen konnte, und an warmen Tagen sogar im Dezember, Januar, Februar und März, bis die anderen Arten wieder hinzukamen.
»Ja«, sagte der Nyks. »Die Winterlibelle ist etwas Besonderes. Sie hat den meisten Grund zu lächeln, denn sie ist die einzige, die den Winter überlebt. Sie hört nicht auf zu fliegen, wenn alles gegen sie ist. Nicht, wenn es eigentlich zu kalt ist und zu dunkel, und auch nicht, wenn sie ganz allein ist. Sie fliegt, und sie lächelt.« Er fuhr Juna über die widerspenstigen braunen Haare, die manchmal kupfern glänzten, genau wie die Winterlibelle. »Wenn du einmal traurig bist oder den Mut verlierst, dann erinnere dich an die Winterlibelle! Sie wird dir immer Hoffnung machen. Sie ist so zerbrechlich und nimmt es trotzdem mit der Kälte und der Einsamkeit auf. Das kann uns allen Mut machen, wenn es uns nicht gutgeht. Ich mag die Winterlibelle am liebsten von allen, auch wenn die meisten sie für so unscheinbar halten. Die wenigsten Leute wissen überhaupt, dass es sie gibt.«
»Ich mag sie auch am liebsten«, hatte Juna zugestimmt. Sie fühlte sich auch oft klein und unscheinbar, doch nun wusste sie, dass sie damit nicht allein war. Vielleicht würde auch sie einmal fliegen.
»Ist schon einmal eine Libelle zu nahe an die Sonne geflogen?«, wollte sie wissen. In der Schule hatte sie die Geschichte von Ikarus gehört und war davon fasziniert gewesen. Sie sah genau vor sich, wie die Flügel des Ikarus zu schmelzen begannen und das duftende Wachs heruntertropfte, weil er sich zu nahe an die Hitze der Sonne gewagt hatte.
Der Nyks schüttelte den Kopf. »Nein, das wird nie passieren. Die Libellen wissen ganz genau, was sie tun. Sie sind die besten Flieger im Insektenreich. Sie würden sich nie so überschätzen, selbst wenn sie so weit kämen.«
Juna war beruhigt.
Und es waren am Ende auch nicht die Libellen gewesen, die abgestürzt waren.
Juna hatte oft an die Worte des Großvaters gedacht und an die Winterlibellen, wenn sie niedergeschlagen gewesen war. Immer hatten sie ihr Mut gemacht.
Doch nun betrachtete sie die Libelle zum ersten Mal mit gemischten Gefühlen. So froh sie war, das tapfere kleine Wesen heute zu sehen, es erinnerte sie doch nachdrücklich an das letzte Gespräch mit Wilhelm und das Versprechen, das sie ihm gegeben hatte.
»Gib mir noch ein Kissen, Liebes«, hatte er gebeten und sich mit Mühe etwas aufgerichtet. »Ich muss mit dir reden.« Er griff nach ihrer Hand. Es war einer seiner besseren Tage. Dennoch konnte sie sehen, wie sehr es ihn anstrengte. Hastig reichte sie ihm sein Wasser.
»Danke.« Er trank einen Schluck, räusperte sich und drückte dann ihre Hand überraschend fest. »Ich habe eine große Bitte an dich!« Sein Blick wanderte aus dem Fenster, hinüber zu dem Hotel, das er schon vor Jahren an den Sohn seines Freundes übergeben hatte. Er war sehr zufrieden mit dieser Lösung für sein Lebenswerk. Aber im Grunde war dieses Hotel eben nur ein Teil seines Lebenswerks. »Du weißt ja, dass ich vor langer Zeit aus der DDR flüchten musste und mein Hotel auf Hiddensee verloren habe. Und auch, dass ich damals Papiere auf dem Grundstück vergraben habe. Weil ich unbedingt etwas von mir dort zurücklassen wollte und um eventuell später einmal beweisen zu können, dass es mir gehört hat.«
»Ja, Wilhelm, ich weiß. Das war sehr klug von dir. Ich habe dich immer dafür bewundert, dass du in all der Eile und Aufregung daran gedacht hast.«
»Juna, da ist noch etwas, das ich bisher niemandem erzählt habe. Ich dachte immer, ich könnte mich einmal selbst darum kümmern, aber dann habe ich es aufgeschoben, bis es zu spät war. Es fiel mir einfach zu schwer, dorthin zurückzukehren. Ich wollte alles genauso in meiner Erinnerung behalten, wie es früher war. Ich war zu feige.«
Er hustete, und sie wartete besorgt, bis er wieder zu Atem kam. »Das kannst du mir auch noch morgen erzählen, Wilhelm.«
Er schüttelte den Kopf. »Ich habe nicht mehr viel Zeit. Das ist mir wichtig, Juna! Als ich damals das tiefe Loch für mein versiegeltes Kästchen gegraben habe, habe ich etwas gefunden. Es war schon beinahe dunkel, ich konnte nicht genau sehen, was es war. Etwas Hartes, aber auf der Rückseite war es weicher, und irgendetwas hat mich dazu bewogen, es in die Tasche zu stecken, anstatt es beiseitezuwerfen wie die anderen Steine, auf die ich stieß. Es schien meine Hand nicht verlassen zu wollen. Ich weiß selbst nicht, warum. Ich hatte wahrlich genug anderes zu tun. Ich habe es dann auch prompt vergessen.« Wilhelm machte eine Pause und schluckte mehrmals, bevor er seine Stimme wiederfand.
»Erst Tage später, bei meinen Verwandten im Westen, habe ich es in meiner Jackentasche wiedergefunden. Es war ein verkrusteter Klumpen lehmiger Sand, der heftig krümelte, weil er trocknete. Ich zupfte einige Wurzelfasern ab und hielt das Ding im Garten meiner Cousine, wo wir untergekommen waren, unter laufendes Wasser. Ich sah zu, wie der Sand in das fremde Gras gespült wurde und dachte: Das ist das letzte Mal, dass ich Boden aus der Heimat in der Hand spüre. Aber dann vergaß ich meine Traurigkeit, denn zum Vorschein kam eine Keramikscherbe, gewölbt, als wäre sie einmal Teil von etwas gewesen. Dafür sprach auch der gezackte Rand, es war eindeutig ein Bruchstück. In der Wölbung geborgen lag etwas, das in der Sonne glänzte wie Gold. Ich denke, es ist auch Gold, oder jedenfalls vergoldet. Ich habe es nie prüfen lassen. Es hat auf jeden Fall einen Wert, nämlich den, den es für denjenigen hatte, der es dort einmal vergraben hat, so wie ich meine Dokumente. Das berührte mich tief, dass jemand lange vorher an demselben Ort einmal in einer ähnlichen Situation gewesen sein muss wie ich.« Er schwieg. Juna ließ ihm Zeit, sich zu erholen und wieder zu Atem zu kommen, und drückte ihm noch einmal das Wasserglas in die Hand, aber jetzt war sie neugierig. Ungeduldig wartete sie, bis er mühsam getrunken hatte.
»Weißt du, ich glaube inzwischen, dass es vielleicht so sein sollte, dass ich nicht mehr dazu kam, es zurückzugeben«, sagte er versonnen und lehnte sich bequemer in seine Kissen. »Jetzt, da ich dich kenne, weiß ich, dass es wahrscheinlich zu dir finden wollte. Dein Großvater hatte ein Gespür für das Wetter, weil er das Land kannte. Aber ich habe ein Gespür dafür, was gut für die Menschen ist, die mir nahestehen. Bis jetzt hatte ich noch immer recht. Und deswegen möchte ich, dass du dich darum kümmerst! Was würde besser zu dir passen als das? Es ist, als ob es auf dich gewartet hat.«
Erschöpft, aber befriedigt schloss er die Augen, fügte aber noch hinzu: »Ich kann dich das nur bitten, weil ich weiß, wie sehr du Hiddensee liebst.«
Diese manchmal nicht nachvollziehbaren Gedankensprünge seinerseits waren häufiger geworden. Nichts Ungewöhnliches bei sehr alten Leuten. Aber diesmal wollte Juna den Zusammenhang gern verstehen.
»Wilhelm«, sagte sie sanft. »Du hast mir noch nicht erzählt, was es war.«
Er öffnete die Augen. »Oh, Verzeihung. Ich sehe es so deutlich vor mir, wie es damals in meiner Hand lag und glänzte, dass mir eben so war, als hättest du es auch gesehen. Geh einmal dort hinüber an den Schreibschrank. Die mittlere Schublade. Du musst sie ganz herausziehen. Hinten in der rechten Ecke liegt etwas, in ein blaues Taschentuch gewickelt. Bring es mir bitte.«
Als sie ihm das kleine Päckchen in die Hand legte, roch er daran. »Das Tuch duftet immer noch nach Inge«, sagte er.
Juna schossen bei der Liebe und Sehnsucht in seiner Stimme plötzlich die Tränen in die Augen. Sie hatte seine verstorbene Frau nicht mehr kennengelernt, aber sie wusste genau, wie ihm zumute war. Verstohlen wischte sie sich die Augenwinkel, doch als sie wieder aufsah, fixierte Wilhelm sie mit überraschend wachem Blick. »Siehst du!«, sagte er. »Deshalb ist es wichtig für dich. Als ich jetzt darüber nachdachte, was ich tun soll, wurde mir klar, dass sie von Anfang an für dich bestimmt war. Libellen und du, das gehört zusammen. Ich hätte längst darauf kommen müssen.« Mit einiger Mühe lockerte er den Knoten um das Taschentuch, der Stoff fiel auseinander. Wilhelm drehte die Nachttischlampe so, dass ihr Schein auf den Gegenstand fiel.
Auf Wilhelms blaukarierter Bettdecke lag eine Tonscherbe, und in ihrer Wölbung glänzte etwas. Juna beugte sich darüber.
Es war eine goldene Libelle, fast so lang wie ihr kleiner Finger.
»Nimm sie ruhig in die Hand«, ermunterte Wilhelm Juna, der es die Sprache verschlagen hatte. Behutsam hob sie die zarte Gestalt aus der Tonscherbe und betrachtete sie von allen Seiten. Sie sah so lebendig aus, als wollte sie gleich losfliegen, obwohl ihre Flügel aus Gold waren. Kein Detail war vergessen worden. Die Facettenaugen wirkten deshalb so echt, weil das ganze Tier beinahe wie aus winzigen Goldperlen zusammengesetzt schien. Und auch das Lächeln hatte der Künstler nicht vergessen. Dennoch wirkte die Libelle bei allem nicht ganz perfekt, als wäre hier jemand am Werk gewesen, der nicht oft mit diesem Material zu tun hatte. Gerade das aber machte dieses Abbild so liebenswert. Die Kante eines der unteren Flügel wies eine kleine Scharte auf, ansonsten schien sie völlig unbeschädigt von ihrem einstigen langen Schlaf in der Erde. Juna wusste jetzt, warum Wilhelm seinen Fund mitgenommen hatte, obwohl er in jener dunklen Nacht der eiligen Flucht gar nicht gesehen hatte, worum es sich handelte. Es war, als wollte auch ihre eigene Hand die Libelle nicht wieder loslassen. Hastig setzte Juna sie zurück auf die blaukarierte Bettdecke.
»Hast du herausgefunden, wer sie dort versteckt hat?«
Wilhelm schüttelte den Kopf. »Es muss schon damals lange her gewesen sein, so hart und verkrustet wie sie war. Es waren ja auch schon zwölf Jahre vergangen, seit ich das Grundstück und das Hotel gekauft hatte. Ich wollte immer die Familie ausfindig machen, von der ich das Hotel übernommen hatte, aber du weißt ja, dass das nicht ging, solange es die DDR noch gab. Und danach, als ich alles wiederbekommen und dann verkauft habe, konnte ich nur herausfinden, dass von der Familie niemand mehr dort lebte. Karow hießen sie. Albert und Josefine. Vielleicht findest du mit Hilfe des Internets mehr heraus. All die Jahre wollte ich einmal zurück und nachforschen, weil ich das Gefühl hatte, die Libelle gehöre mir nicht. Sie sollte dahin zurückgebracht werden, wo sie hergekommen war. Aber wie ich schon sagte, ich habe es aufgeschoben. Nun kann ich es nicht mehr, aber inzwischen glaube ich auch, dass sie sowieso für dich gedacht war. Wer weiß, wohin sie dich führt.«
Juna glaubte nicht an einen tieferen Sinn, aber da es ihm so wichtig war, wollte sie nicht widersprechen. »Was hat Inge dazu gesagt?«
»Sie war derselben Meinung. Ich habe sie gefragt, ob sie die Libelle nicht tragen möchte, aber sie sagte nein, sie gehöre ihr nicht und wäre für jemand anderen bestimmt, wenn die Zeit käme. Ich denke, die Zeit ist jetzt gekommen.« Er legte die Libelle zurück in die Tonscherbe, beides in Junas Hand und schloss ihre Finger darüber. »Ich möchte, dass du nach Hiddensee fährst und Nachforschungen anstellst. Ich bin mir sicher, dass du ihre Geschichte herausfinden wirst. Oder etwas anderes, was für dich von Bedeutung sein kann.« Eindringlich sah er ihr in die Augen: »Versprich es mir, Juna!«
Juna zögerte. Er verlangte mehr von ihr, als er ahnte. Aber wie konnte sie ihm das abschlagen? Daran war gar nicht zu denken. Es war die erste und die letzte Bitte, die er an sie hatte.
»Natürlich, Wilhelm. Wenn es dir so wichtig ist, verspreche ich es dir!«
Beinahe beschämt sah sie die Erleichterung in seinen Augen. Es war, als ob ihm nun sogar das Atmen leichter fiele. »Aber was soll ich damit machen, wenn ich nicht herausfinden kann, wem sie gehört oder wo sie herkommt?«, fragte sie bedrückt.
Er lächelte. »Du wirst wissen, was das Richtige ist.«
Juna wünschte sich, sie wäre sich so sicher, wie er klang. Sie drehte die Keramikscherbe um und stellte fest, dass sie auf der anderen Seite mattgrün glasiert war. Einige Stellen aber waren blau und gelblich, als wäre das Fragment Teil eines Bildes von Gras und Himmel oder vielleicht einer Blüte gewesen. Aber es war gewölbt. Vielleicht stammte es von einer Kanne? Doch dafür war der Ton zu dick.
»Ich habe die Scherbe aufgehoben, weil ich dachte, sie wäre vielleicht ein Hinweis auf die Herkunft der Libelle. Beides ist eindeutig zusammen vergraben worden«, sagte Wilhelm. »Vielleicht hilft dir dies bei der Suche.« Erschöpft schloss er die Augen. »Ich bin so froh, dass das jetzt geklärt und bei dir auf einem guten Weg ist.« Er lächelte. »Besinn dich darauf, was du an den Libellen liebst! Lass fliegen, was in dir ist, Juna!«
»Du weißt, was passiert, wenn man zu hoch fliegt.« Sie biss sich auf die Lippen. Daran hatte sie ihn jetzt wirklich nicht erinnern wollen.
Aber er lächelte immer noch. »Ja, ich weiß aber auch, was geschieht, wenn man es gar nicht erst versucht«, sagte er. Im nächsten Augenblick war er eingeschlafen. Ein Schmunzeln lag auf seinen Lippen. Juna saß noch eine Weile bei ihm, fuhr mit dem Finger über die Glasur der Keramik und betrachtete die Libelle. Diese verriet nicht das Geringste über sich. Sie lächelte nur mindestens so rätselhaft wie die Mona Lisa. Oder doch freundlicher, wie alle Libellen. Durchaus zuversichtlich, aber auch, als amüsiere sie sich über Juna. Sie wog schwerer, als sie aussah. Juna wickelte sie schließlich mitsamt der Scherbe in ein Papiertaschentuch und verstaute sie sorgfältig in ihrer Handtasche. Das blaue Taschentuch, das noch nach Inge duftete, legte sie auf Wilhelms Brust. Vielleicht würde er von ihr träumen.
Dann schlich sie auf Zehenspitzen aus dem Zimmer.
Zwei Tage später starb Wilhelm. Juna half Wilhelms Bruder Anselm, sich um alles zu kümmern. Wilhelm war katholisch gewesen, die Beerdigung fand eine knappe Woche später statt. Es kamen viele seiner früheren Angestellten, doch seine Freunde waren bereits alle vor ihm gegangen. Am Nachmittag war die Testamentseröffnung.
»Aber ich möchte das nicht«, sagte Juna hinterher zu Anselm. »Die Summe ist zu hoch. Es fühlt sich falsch an.«
Anselm legte ihr die Hände auf die Schultern. »Wilhelm hat es so gewollt. Er hatte dir doch schon selbst gesagt, was er vorhat und dass er möchte, dass du etwas Besonderes damit tust, etwas nur für dich.«
»Aber doch nicht so viel!« Juna konnte die Tränen schon wieder nicht zurückhalten.
»Es ist mehr als genug da. Alles ist gut. Nimm es an und freu dich! Er wollte es doch so. Er hat mir erzählt, dass er dich bitten wollte, noch etwas für ihn zu erledigen. Vielleicht kannst du es ja dafür verwenden?«
Juna wollte ihn nicht weiter belasten, er hatte gerade mehr als genug zu organisieren. Sie fügte sich und fuhr nach Hause.
Und jetzt hatte ihr Ben dasselbe gesagt. Wilhelm hatte hartnäckig darauf bestanden, dass sie die Summe für sich verwenden sollte. Aber was, um Himmels willen, würde sie damit machen? Sie wollte doch nichts anderes als hierbleiben! Genau hier mitten im Spreewald auf der Dolzke-Insel, auf dem Grundstück ihres Großvaters, wo sie schon immer am glücklichsten gewesen war. Juna träumte nicht von einer Weltreise. Sie wollte auch nicht nach Hiddensee.
Sie mochte nicht weg, wollte einfach nur hier leben wie die Libellenlarven unter Wasser, still und versteckt.
Jetzt erhöhte sie das Tempo, als könnte sie vor dem Versprechen und all ihren Gedanken davonpaddeln. Kurz nachdem sie das Gurkenmuseum passiert hatte, fiel ihr eine Wurzel auf, die sich irgendwo gelöst hatte und jetzt in der gemächlichen Strömung trieb. Sie kreuzte zum anderen Ufer und schnitt dem Holz den Weg ab. Als sie es ins Boot zog, verlor sie beinah ihr Paddel, so lang war ihre Beute. Juna fuhr über das glatte Holz. Eindeutig ein Stück für ihre Sammlung! Sie würde es dorthin legen, wo es trocknen konnte, zu den anderen gesammelten Fundstücken. Später musste sie es in der Werkstatt ihres Großvaters nur noch ein wenig über dem Feuer zurechtbiegen, wie sie es von ihm gelernt hatte, um etwas daraus zu machen, das sie jetzt schon genau vor sich sah.
Sie dachte daran, wie der Nyks seine Kähne gebaut hatte, seit sie denken konnte. Nur, wenn man genug Zeit und Geduld und Sorgfalt investierte, trugen einen die Spreewaldkähne mit allen Lasten und waren wasserdicht.
Mit einem Leben sollte es genauso sein, hatte sie gedacht. Sie hatte angenommen, ihres wäre so. Bis geschah, was nie hätte geschehen dürfen.
3Feuer und Wasser
Juna wünschte sich, dass es in ihrem Kopf so ruhig wäre wie in der Landschaft um sie her. Zu viele Erinnerungen, Fragen und Zweifel tobten darin herum, und über allem lag die Traurigkeit, dass sie nie wieder sehen würde, wie Wilhelm und der Nyks in diesem Garten zufrieden Rauchringe bliesen und dabei über das Leben, den besten Kaffee und ihre neueste Düngerkreation für Hortensien diskutierten.
Gegen das Chaos in ihren Gefühlen und Gedanken gab es nur ein unfehlbares Mittel. Auch dies war etwas, das ihr der Nyks beigebracht hatte, kaum dass sie groß genug dafür war. Juna schob das Kajak wieder unter die Büsche, legte ihren Holzfund zum Trocknen unter das Dach und holte ihren Bogen. Er stand immer griffbereit hinter der Tür, neben der alten Milchkanne mit den Pfeilen.
Das Ziel bestand aus einem an den Kirschbaum genagelten Strohsack, auf den mit Farbe ein tennisballgroßer schwarzer Punkt und drumherum rote und gelbe Ringe gesprüht worden waren. Juna spannte den Bogen sorgfältig, wählte einen Pfeil und suchte sich einen sicheren Stand.
Jedes Mal war ihr dabei noch immer, als ob sie die Stimme ihres Großvaters hörte. »Denk an die Bodenhaftung! Du musst die Erde spüren. Die Füße sollten ein wenig nach vorne geöffnet sein. Halte deinen Kopf gerade! Nur den Rumpf ganz leicht vorbeugen. Die Sehne des Bogens hältst du immer mit drei Fingern. Aber denke daran, den Ellenbogen etwas auszudrehen, damit der Pfeil nicht deinen Arm streift, wenn du ihn abschießt.« Juna setzte den Pfeil an, korrigierte ihre Haltung. »Nein, nicht die Schultern hochziehen! Die Schultern runter, nur den Ellenbogen hoch. Der Arm sollte mit dem Pfeil eine Linie bilden. Und mach nicht den Fehler, ein Auge zu schließen. Viele tun das, aber wir haben aus gutem Grunde zwei. Immer die Augen offenhalten, nicht nur beim Bogenschießen. Achte darauf, dass du die Sehne richtig in den Schlitz des Pfeiles legst und dass die andersfarbige Feder immer nach außen zeigt. Nein, halte den Bogen nicht so gerade, sondern gekippt auf zwei Uhr.«
Da war der Nyks streng. Sie durfte den Pfeil nicht loslassen, bevor er zufrieden war, egal, wie müde ihr Arm wurde. »Jawohl, so ist es gut. Die Haltung ist das Wichtigste am Bogenschießen, nicht das Treffen des Ziels! Das ist genau wie im Leben.«
Den letzten Satz hatte sie damals nicht verstanden, erst als sie schon viel älter war. Nichts von alledem, was er ihr beigebracht hatte, war so leicht umzusetzen. Auch jetzt noch nicht. Doch es beglückte sie, wie klar ihr Kopf dabei wurde, wenn sie sich nur auf ihre Haltung, auf das Gefühl der gespannten Sehne, auf das kleine Geräusch konzentrierte, das der Pfeil verursachte, wenn sie ihn schließlich losließ. Auf seine saubere Flugbahn, die so befriedigend war, wenn sie stimmte. Dann wieder das Geräusch, wenn er sein Ziel traf – oder eben verfehlte. In diesem Augenblick zählte nichts anderes.
Die ersten Schüsse setzte sie weit daneben, einen in die Ligusterhecke und zwei in den Holzstapel. »Das Atmen nicht vergessen! Du musst locker bleiben«, hörte sie ihren Großvater sagen.
»Lass sie doch mal in Ruhe, sie weiß es ja nun und schafft es auch ohne dich«, mischte sich Wilhelm ein.
Sie waren ihr beide so nahe, dass sie sich unwillkürlich umdrehte. Es war das Rauschen des Windes in den Erlen gewesen, und die Stimmen nur in ihrer Erinnerung. Und doch wusste sie, dass etwas von den beiden Männern für immer in den Wänden des alten Blockhauses wohnte, in den Hortensien und dem Kirschbaum, den Holzstapeln und dem moorigen Boden, auf dem sie stand. Und dass sie Juna behüteten.
Sie holte tief Luft, spürte die Erde unter ihren Sohlen, hob den Ellenbogen, fixierte das Ziel mit beiden Augen und ließ nicht nur den Pfeil los, sondern auch ihre Anspannung.
Batsch! Der Pfeil steckte mit einem dumpfen Aufschlag genau am Rand des schwarzen Mittelpunkts. Den sonnengelben Ring außen hatte er nur gestreift.
»Geht doch!«, sagte Juna laut. Beim Bogenschießen wünschte sie sich die Augen einer Libelle. Wenn eine Libelle ihre Beute nämlich einmal im Visier hatte und wusste, was sie wollte, war sie zu siebenundneunzig Prozent erfolgreich. Kein Wunder. Eine Libelle besaß bis zu dreißigtausend Facettenaugen!
Juna aber wusste noch nicht einmal, was sie wollte – außer gerade jetzt die Mitte treffen. Immerhin.
Es dauerte eine Weile, bis wenigstens jeder zweite Versuch wieder saß. Die Sonne war inzwischen verschwunden, diesmal hinter grauen Wolken. Es fing an zu nieseln. Juna legte den Kopf in den Nacken und spürte die Feuchtigkeit auf dem Gesicht wie eine Berührung. Das tat nach den Tagen in der staubigen Stadtluft gut. Wenigstens eines hatte sie den Libellen voraus: Regen konnte ihr nichts anhaben. Sie mochte ihn sogar. Wenn einer Libelle dagegen die Tropfen auf den großen Augen die Sicht trübten, musste sie notlanden, weil das auch ihr Gleichgewichtsorgan betraf.
Juna wählte den nächsten Pfeil.
Als sie zum fünften Mal hintereinander die Mitte getroffen hatte, ging es ihr besser. Jetzt tat ihr zwar der Arm weh, dafür hatte sich ihr Kopf geklärt. Ihr Handy vibrierte in der Hosentasche. Sie sah nach. Eine Nachricht von Kris.
Ich habe wieder einen Auftrag für dich, Mama. Erinnerst du dich an das Vogelhaus, das ich meinem Kollegen zur Hochzeit geschenkt habe, bevor er zurück nach North Dakota ging? Das hat dort voll eingeschlagen! Seine Nachbarn wollen beide auch eines. Kannst du das machen? Ich hab den Preis ein bisschen höhergeschraubt, das hat sie aber nicht abgeschreckt. Ich dachte, das lenkt dich auch ein bisschen ab. Tut mir wirklich leid mit Wilhelm. Liebe Grüße aus der Sonne, Kris.
Juna freute sich. Die Arbeit würde sie tatsächlich ablenken. Ihr kleines Unternehmen kam immer besser in Schwung! Vor allem, seit Kris ihr die Website erstellt hatte.
Als sie damit angefangen hatte, Vogelhäuser aus den Holzvorräten ihres Großvaters zu bauen, mit Reetdach und einem handgemachten Ständer aus Wurzelholz, war es nur ein Hobby gewesen. Das erste Exemplar hatte sie in ihren eigenen Garten gestellt, eines hatte sie Wilhelm geschenkt, eines Ben. Dann fing es an. Wilhelms Nachbar wollte auch eines. Der eine oder andere Tourist, der im Kahn vorüberfuhr und die Häuser in Bens oder Junas Garten sah, fragte nach, ob er eines bestellen könnte.
Sie entwarf verschiedene Modelle. Einige baute sie wie die traditionellen Blockhäuser, indem sie Miniaturbalken aus dem verwitterten, altersdunklen Holz kaputter Kähne schnitt. Andere bekamen runde Wände, indem sie die Bretter so zurechtbog, wie man es für die Seiten eines neuen Kahns tat. Ben half ihr schließlich, Preise festzulegen, und ehe sie es sich versah, erhielt sie mehrere Bestellungen im Jahr.
Das war auch nötig gewesen, von irgendetwas musste sie schließlich leben, seit sie sich hier »so hoffnungslos vergraben« hatte, wie ihr Vater sich auszudrücken pflegte. Seit dem Tod des Großvaters waren ja dessen Rente und das Pflegegeld weggefallen. Aber dass auch den Amerikanern die Futterhäuschen aus dem deutschen Venedig, wie sie es nannten, gefallen würden und sie nicht einmal die Versandkosten scheuten, damit hätte Juna niemals gerechnet.
Sorgsam wischte sie die Feuchtigkeit vom Bogen und hakte die Sehne wieder aus. (»Stelle deinen Bogen niemals gespannt weg, sonst verliert das Holz seine Elastizität! Es muss sich ausruhen. Das gilt für Menschen übrigens auch.«) Der Bogen war aus derselben Esche geschnitzt, aus der der Großvater die »Rudel« hergestellt hatte, die langen Stangen, mit denen man einen Spreewaldkahn vorwärts stakte. Das Holz war leicht, und das musste es auch sein. Ein Rudel war bis zu vier Meter lang, denn so tief waren die Fließe an den tiefsten Stellen.
Später sah sie sich in der Werkstatt ihres Großvaters um, die er dort eingerichtet hatte, wo früher einmal ein Stall gewesen war. Die Werkzeuge hatte er teilweise schon von seinem Vater geerbt. Es war alles immer noch so anheimelnd und vertraut! Hier hatte Juna ihre ersten Schritte gemacht, nachdem sie sich an den Beinen der Hobelbank hochgezogen hatte. Später spielte sie mit den Bauklötzen, die der Nyks ihr aus Resten zusammengesucht hatte. Bald konnte auch sie mit Hand anlegen, wenn er einen Kahn baute. Anfangs erzählte er ihr Geschichten, später erklärte er ihr genau, was er da tat. Die riesigen hölzernen Schraubzwingen, manche so lang wie Junas Arm, hingen säuberlich in Reihen an der Wand, zusammen mit Hobeln, Hämmern und Sägen. Eine Zeitlang hatte sie angenommen, ihr Großvater könne mit diesen Schraubzwingen und den anderen geheimnisvollen Dingen auch all das verbinden, zurechtschleifen, reparieren oder schön machen, was im Leben nicht in Ordnung war.
Dem Großvater hatte es nichts ausgemacht, dass seine Enkelin am liebsten zuhörte, anstatt selbst zu reden. Er stellte nicht andauernd Fragen, wie es denn in der Schule lief, verlangte nie, dass sie berichtete, was sie gerade dachte. Anders als ihre Eltern fand er Juna völlig in Ordnung, so wie sie war. Ihre Eltern und auch ihre Lehrer waren da ganz anders. Sie machten sich ständig Sorgen, weil Juna manchmal nicht die Worte fand, um all die vielen Fragen der Erwachsenen zu beantworten. Wenn sie Hausaufgaben machte oder eine Klassenarbeit schrieb, dann flossen die Worte wie von selbst aus ihrem Kopf auf das Papier, und sie hatte fast immer eine gute Note. Doch wenn sie an die Tafel oder auch nur eine Antwort geben musste, starrte sie die Lehrer mit großen Augen an und suchte vergeblich nach Worten. Sie waren in solchen Momenten einfach nicht da, saßen unerreichbar irgendwo tief in ihr wie die Schilfwurzeln in der dunklen Erde des Spreewalds.
Juna hätte das nichts ausgemacht, wenn nur die Sorgen ihrer Eltern und die Vorwürfe der Lehrer nicht so schwer auf ihr gelastet hätten. In den Pausen blieb sie lieber allein. Das Geschrei der anderen Kinder auf dem Hof erschien ihr unerträglich laut. Außerdem brauchte sie Zeit, um über die vielen Dinge nachzudenken, über die im Unterricht gesprochen worden war. Die Lehrer, ihre Eltern und der Schularzt meinten, das ginge so nicht, sie wäre vielleicht einfach noch nicht weit genug. Man müsse ihr helfen, sich zu ändern, und man überlegte, ob man sie zurückstufen sollte. Das geschah zwar nicht, aber Juna fühlte sich unzulänglich und hatte ein schlechtes Gewissen, dass sie alle so enttäuschte und irgendetwas nicht richtig an ihr war.
Nur in den Ferien bei ihrem Großvater, da war alles anders. Er hatte überhaupt nichts an ihr auszusetzen. Natürlich verlangten auch er und Oma Gerti, dass sie ihre Schuhe abstreifte, sich die Hände vor dem Essen wusch, den Nachtisch erst hinterher aß und höflich guten Tag sagte, wenn sie einen Bekannten trafen. Ansonsten aber durfte sie sein, wie sie wollte. Wenn sie lieber mit einem Buch in der Ecke saß, anstatt auf ein Dorffest zu gehen, dann störte den Nyks das nicht im Geringsten.
»Der eine mag es so, der andere so«, sagte er. »Die Menschen sind so verschieden wie die Libellen. Bei denen wundert das auch keinen. Sie sind alle schön, jede auf ihre Art. Es wäre doch sehr langweilig, wenn sie alle gleich wären.«
»Aber die Lehrer sagen …«, begann Juna.
Der Nyks wischte die Lehrer mit einer Handbewegung weg.
»Hörst du ihnen zu, wenn sie dir etwas beibringen?«, fragte er.
Juna nickte.
»Dann ist alles gut. Mach dir keine Gedanken.«
»Vielleicht haben sie noch nie die Libellen gesehen«, sagte Juna.
»Das kann sehr gut sein. Reichst du mir bitte mal den Hobel dort?« Damit war die Sache für ihn erledigt. Und darum war Juna am liebsten hier im Spreewald, beim Nyks zwischen den stillen Fließen und den hohen Bäumen, die auch schwiegen, außer wenn sie mit dem Wind flüsterten.
Oma Gerti war nicht anders gewesen, als sie noch lebte. Juna durfte ihr beim Gurkeneinlegen helfen und dabei, die Gläser mit dem Kahn zu den Kunden zu bringen. Und weder den beliebten Gurken noch Oma Gerti machte es etwas aus, wenn zu den Gewürzen nicht allzu viele Worte von Juna hinzukamen.
Was ihr noch gefiel, war, dass man in der Werkstatt mit den Händen tätig war. Mit ihren Händen hatte sie noch nie Probleme gehabt. Die arbeiteten gut mit ihrem Kopf zusammen. Dazu brauchte man nicht reden. Der Nyks hatte große, geschickte Hände gehabt, und Juna liebte es, ihm zuzusehen, wenn er aus einem Stapel langer Bretter mit all seiner Erfahrung und seinem Instinkt genau die richtigen auswählte. Sie stammten von hundertfünfzig Jahre alten Kiefern aus der Schorfheide. Es war ein feierlicher Prozess, bei dem man ihn niemals unterbrechen durfte.
Dann legte er die Bretter auf zwei Böcke und schnitt sie mit der Handkreissäge in Form. Juna konnte von dem Duft frischer Holzspäne kaum genug bekommen. An den Enden wurden die Bretter schmaler geschnitten. Dann klammerte er sie dort mit einer großen Schraubzwinge zusammen. Mit einem Handhobel, den er »Raubank« nannte, wurden die Kanten geglättet. »Da darfst du nicht schlampen, sonst wird der Kahn niemals dicht«, warnte er und zeigte ihr, wie man mit der Innenseite des Handgelenks erfühlen konnte, wo noch winzige Unebenheiten waren. »Dort, wo du auch deinen Herzschlag spürst«, erklärte er ihr.
Jetzt kam das Beste. Die Bretter, die immerhin bis zu neun Meter lang waren, wurden auf einem Karren zur Biegestelle gebracht. Juna fand diesen Ort so feierlich wie den Altar in der Kirche. Über der Biegestelle befand sich ein langes Dach zum Schutz vor Regen, und an einem Ende war eine Klemmvorrichtung. Dort wurden die Bretter vorne eingeklemmt und unter das hintere Ende Stützen gestellt.
Mit nassen Tüchern befeuchtete der Nyks nun das Holz und legte sie dann schützend über die Kanten. Dann wurde das vorher aufgeschichtete Biegefeuer angezündet. Die Flammen knisterten gewaltig, ihre Hitze breitete sich rasch aus. Juna durfte nicht zu nahe herangehen, aber sie blickte fasziniert in das gleißende Lodern, in dem so viele Farben hüpften.
Damit die Bretter nicht verbrannten, wurden sie immer wieder mit Wasser benetzt. Dazu benutzte der Nyks eine riesige Handspritze, die aussah wie die Spritzen beim Arzt, nur eben viel größer. Ben hatte ihr von Indianern und Medizinmännern erzählt. Juna wusste nicht genau, was ein Medizinmann war, außer dass er Macht hatte. Aber der Nyks sah jetzt bestimmt aus wie einer, fand sie.
Es dauerte ungefähr eine Stunde, während ihr Großvater das Feuer und die Bretter ganz genau bewachen und immer rechtzeitig mit der Spritze taktieren musste. Qualm und Wasserdampf hüllten die Szene ein. Wasserflecken und Ruß malten Muster auf seine Arbeitshose. Es zischte, als wären unsichtbare Drachen beteiligt, und auch das Holz gab gedämpfte Geräusche von sich. Juna konnte sich nicht sattsehen daran, wie der Dampf in dem bunten Licht Gespenster in die Luft sandte, die der Wind in einem langsamen Tanz auf die Fließe hinaustrug.
Ein Medizinmann war ganz bestimmt eine Art Zauberer. Oder der Großvater war doch der König der Nixen und die Handspritze sein Zepter.
Durch den Dampf und die Hitze wurde das Holz so weich, dass man es verformen konnte. Die Stützen am einen Ende wurden immer wieder durch kleinere ausgetauscht. So bog sich das Holz durch sein eigenes Gewicht. Die Schwerkraft war ein weiterer unsichtbarer Zauber, den der Nyks sich zum Gehilfen machte. Das Feuer leckte mit glühenden Zungen an den Brettern, die vor Feuchtigkeit glänzten und immer mehr Dampf am Dach vorbei in den Himmel trieben, bis der Großvater die Flammen schließlich löschte.
Über Nacht kühlten die Seitenbretter ab und trockneten im Nachtwind unter den Sternen. Mit der Bandsäge schnitt der Großvater dann auch die Zwischenbretter zurecht, mit denen der Kahn stabilisiert wurde. An diesen wurden die Seitenbretter nun angelehnt, und man konnte schon erkennen, wie das Boot einmal aussehen würde. An den Spitzen wurden die Seitenbretter dann mit zwei Stricken zusammengebunden. Mit angehaltenem Atem sah Juna zu, wie sich die Enden nur durch die Kraft des Großvaters aufeinander zubewegten und sich seine Muskeln unter dem Hemd dabei anspannten.
Nun sägte er die Bodenbretter. Mit einer Fräse, die ein ganz eigenes, heiseres Lied sang, bekamen sie an der einen Seite eine Nut und an der anderen eine Feder, so dass man sie später ineinanderstecken konnte. Wenn das Holz dann im Wasser aufquoll, wurden die Fugen dicht.
»Reich mir mal die Nägel, bitte!« Der Großvater sagte immer bitte, obwohl Juna nur ein Kind war. Sie freute sich jedes Mal darüber. Mit einem Hammer und den Nägeln befestigte er die Bretter an den Seiten. Danach wurde rundherum eine Hanfschnur in die Ritze eingefügt und mit einem Bitumengemisch eingepinselt, damit auch hier alles wasserdicht wurde. Das Bitumen roch seltsam, aber für Juna war es der Duft von Abenteuer und glücklichen Stunden. Dann wurde der Boden endgültig festgeschraubt, der Kahn noch einmal mit dem Handhobel verputzt. Nun fühlte sich alles wunderbar glatt an.
Nach alledem folgte der große Moment, in dem der Kahn umgedreht wurde, damit er nicht mehr mit dem Boden zuoberst lag. Es war wie eine Geburt. Weil er ungefähr zweihundertfünfzig Kilo wog, mussten die Nachbarn oder Freunde mit anpacken, und dann wurde gefeiert.
Fertig war er noch immer nicht. So einen Kahn zu bauen dauerte zwei Wochen. Es war etwas Großes, ein Ereignis.
Das innere Brett, das man den »Konz« nannte, und die Sitzbretter mussten jetzt auch noch montiert werden. Der Konz war sehr wichtig. Früher hatte man in dem Kasten, der an einem Ende des Bootes durch ihn entstand, die gefangenen Fische aufbewahrt. Man konnte ihn mit Wasser fluten, ohne dass der Kahn sank.
Endlich brachte man das Boot auf dem Karren nach draußen. Dort wurde es angestrichen.
»Vorsichtig!«, sagte der Großvater beim Transport. »Behandele einen Kahn immer mit Respekt und pflege ihn! Ein gutes Boot hat eine Seele.«
»Ja«, sagte Juna dann voller Verständnis, »es kann nur nicht reden.«
Der Nyks lächelte. »Genau.«
Juna liebte auch den Geruch des Teeröls, mit dem das Holz grundiert wurde. Darauf kam ein Anstrich mit dem typischen dunklen Bitumenmisch. Die dunkle Farbe gab dem Kahn etwas Majestätisches, Uriges. Wenn alles trocken war, wurden vorn und hinten noch die geheimnisvoll rasselnden Ketten angeschlagen, mit denen man den Kahn am Ufer oder am Steg befestigte.
Endlich konnte man ihn ausprobieren! Juna durfte mit dem Großvater die erste Fahrt machen, so viele Tage, nachdem er die ersten Bretter ausgewählt hatte. »Für etwas Gutes braucht man Geduld und Zeit«, sagte der Großvater. »Und für einen guten Kahn außerdem Feuer und Wasser. Das eine geht nie ohne das andere. Es ist wie mit Herz und Verstand. Das eine muss brennen, das andere kühlen. Mit beidem zusammen kannst du die richtige Form finden, ohne dass etwas bricht oder verbrennt. Das erkennst du an nichts anderem so deutlich wie an einem Spreewaldkahn.«
Nur dass dies mit dem Holz irgendwie deutlich einfacher war als bei so manch anderem. Juna musste jetzt, mit dreiundfünfzig Jahren, noch einmal ganz neu herausfinden, wofür sie brannte.
4Das Angebot
Juna war erst lange nach Mitternacht eingeschlafen. Zu viele Zweifel hatten in ihrem Kopf ein Tauziehen veranstaltet, und in der Stille des Waldes erschienen ihr sogar die eigenen Gedanken zu laut. Dafür war sie umso später aufgewacht. Jetzt stand sie mit einer Tasse Kaffee im Garten und plante das neue Vogelhaus. Spinnweben voller Tautropfen glitzerten im Gras wie Juwelen. Oben zog eine Schar Wildgänse Richtung Süden.
Sie fuhr zusammen, als sich ein merkwürdiges Geräusch näherte, ein dumpfes Wummern, das immer lauter wurde. Die Ursache entpuppte sich als ein Kahn mit etwa dreißig Leuten an Bord. Einige davon gehörten zu einer eifrig aufspielenden Blaskapelle.
»Guten Morgen und einen guten Tag«, rief der Fährmann, und Juna grüßte zurück. Sie kannte viele der Fährleute, sie fuhren ja oft genug vorbei. Er zuckte hilflos mit den Schultern, als wollte er sich für den Krach entschuldigen.
»Prost, Fräulein«, rief einer der Gäste und schwenkte sein leeres Sektglas. Juna unterdrückte ein Seufzen. Die Einnahmen waren wichtig für die Region. Aber musste es unbedingt mit Blaskapelle sein? Der Spreewald war reicher an Singvögeln als fast alle anderen deutschen Gegenden. Selbst jetzt, Anfang November, konnte man noch einige hören, wenn man nur lauschte. Die Rufe der Zugvögel, das leise Gurgeln des fließenden Wassers und der Wind in den Bäumen waren für Juna