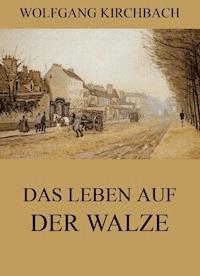
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kirchbachs Werk ist ein sozialkritischer Roman in dem ein als Wandergesellte verkleideter Wissenschaftler viele Mißstände aufdeckt.
Das E-Book Das Leben auf der Walze wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Leben auf der Walze
Wolfgang Kirchbach
Inhalt:
Wolfgang Kirchbach – Biografie und Bibliografie
Das Leben auf der Walze
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Das Leben auf der Walze, Wolfgang Kirchbach
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849629328
www.jazzybee-verlag.de
Wolfgang Kirchbach – Biografie und Bibliografie
Deutscher Dichter und Schriftsteller, geb. 18. Sept. 1857 in London als Sohn eines deutschen Malers, verstorben am 8. September 1906 in Bad Nauheim. Studierte, in Dresden vorgebildet, in Leipzig Philosophie und Geschichte, ließ sich 1879 als Schriftsteller in München nieder, unternahm eine längere Studienreise nach Italien und siedelte 1888 nach Dresden über, wo er bis Herbst 1889 die Redaktion des »Magazins für Literatur des In- und Auslandes« führte. Jetzt lebt er abwechselnd in Berlin und Paris. Nächst seinen »Märchen« (Leipz. 1879) bewährte er sein eigentümliches Talent in dem Künstlerroman »Salvator Rosa« (das. 1880, 2 Bde.), in den Novellen: »Kinder des Reichs« (das. 1883, 2 Bde.; 2. Aufl. u. d. T.: »Nord« und »Süd«, 1885), »Miniaturen und Novellen« (Stuttg. 1892) und »Die neue Religion« (Berl. 1903), in den Romanen: »Der Weltfahrer« (Dresd. 1891), »Das Leben auf der Walze« (Berl. 1892), in den »Ausgewählten Gedichten« (das. 1883) und den »Liedern vom Zweirad« (das. 1900, 2. Aufl. 1904), in den dramatischen Dichtungen: »Waiblinger« (2. Aufl., Münch. 1887), »Die letzten Menschen« (Dresd. 1890), »Des Sonnenreiches Untergang«, Kulturdrama (das. 1894), »Gordon Pascha« (das. 1895), »Eginhardt und Emma« (das. 1896), »Wein« (Berl. 1899), in den Lustspielen: »Der Menschenkenner« (Dresd. 1888), »Warum Frauen die Männer lieben« (1892) und »Jung gefreit« (Dresd. 1897). Ferner schrieb er: »Was lehrte Jesus? Zwei Ur-Evangelien« (2. Aufl., Berl. 1902). Eine Anzahl kleinerer Schriften, Reisegedanken und Aufsätze erschien u. d. T. »Ein Lebensbuch« (Münch. 1885). K. ist ein geistreicher kritischer Schriftsteller, dessen poetische Kraft jedoch unter seiner Neigung zur Konstruktion leidet.
Das Leben auf der Walze
Erstes Kapitel
Der Morgen dämmerte durch die dunstbeschlagenen Fenster des Gastzimmers einer einsamen Landherberge herein. Im Zwielicht des Raumes wurden allmählich die Umrisse eines großen Kachelofens sichtbar, um den auf hingespannter Leine einige fadenscheinige Röcke und verschiedene löcherige, schlafffallende Strümpfe hingen. Ein paar alte Beinkleider tauchten aus dem ungewissen Dämmer der Ofenecke empor, und wie das Zwielicht von der Decke des Zimmers tiefer und tiefer herabschlich, wurden zunächst auf der Ofenbank zwei schlummernde Gestalten sichtbar. Ihre Stiefel, wie es schien, benützten sie, um der größeren Bequemlichkeit willen, als Kopfkissen, denn sie hatten sie unter ihren Nacken geschoben. Statt mit einer Bettdecke waren beide mit ihren Röcken zugedeckt; um die entblößten Füße hatten sie ärmliche Lappen gewickelt; das Stiefelkopfkissen wurde durch ein Schnürbündel bei dem einen, durch eine große Ledertasche bei dem andern etwas erhöht. Wie der Morgenschein lichter wurde, erkannte man auch auf den anderen Bänken einige schlafende und schnarchende Bettlergestalten, welche in den gefährlichsten Stellungen und in augenscheinlicher Gefahr, jeden Augenblick herunterzufallen, sich liegend auf die Bänke hingezwängt hatten. In der Mitte des Zimmers lag ein langer Geselle auf der Platte eines Gasttisches; er hatte einen schwarzen Frack an, dessen Schöße zur Seite von der Holzplatte herunterfielen, während ein weißer Gummikragen, dessen Rand unregelmäßig beschnitten war, an seinem Halse aufgegangen klaffte. Angelehnt an das Tischbein, halb mit dem Rücken aufgerichtet, lag zu seinen Füßen ein anderer großer Gesell auf der Diele. Eine schwarze Haarmähne hing ihm über die Stirne herab; sein rasiertes Gesicht mit der scharf gebogenen krummen Nase und den durchgearbeiteten breiten Zügen ließ ihn als einen Schauspieler erscheinen, während seine verlotterte Kleidung ihn eher als einen Gefängnisbruder ausweisen mochte. Diejenigen, welche auf den Bänken lagen, hatten übrigens meistens eine Schütte Stroh unter sich, und sah man auf den Fußboden des Gemaches, so erblickte man verschiedene verirrte Strohhalme ausgestreut umherliegen zwischen einzelnen leeren Schnapsflaschen und hingeworfenen Mützen und Stiefeln. –
Wie es nun heller wurde und eine schnarrende Wanduhr in abgerissenen Glockenschlägen sieben Uhr schlug, öffnete sich leise die Thüre nach dem Vorsaal und der Wirt, den man an seinem Käppchen erkennen konnte, steckte lauschend den Kopf zwischen Thüre und Pfosten herein. Er nickte befriedigt, als er die schnarchenden Männerlaute vernahm, machte die Thüre ganz auf und ließ einen anständig gekleideten Mann eintreten, der in der Hand ein leinengebundenes Skizzenbuch trug und sich mit prüfendem Blicke umsah. – "Immer sachte herein, Herr Maler", meinte der Herbergsvater. "Sie schlafen und schnarchen gerade alle noch."
Der Künstler mußte einen Augenblick mit Atmen inne halten, denn die schlechte Luft des Raumes drohte ihn sofort wieder hinaus zu jagen. Er rümpfte die Nase, lächelte aber und meinte leise, indem er auf die Schläfer blickte: "Die schnarchen wie die Lastwagen im Schnee bei fünfzehn Grad Kälte. Eine recht gute Luft hier! Als ob des Teufels Großmutter eine alte Hexenschlafkammer in der Hölle zum ersten mal lüftete nach tausendjährigem Verschluß."
"Wenn Sie sich hier an den Ecktisch setzen, Herr Künstler, können Sie Ihr Bild ganz ungestört aufnehmen" flüsterte der ›Penneboos‹. Der Maler setzte sich, nachdem er eine günstige Ansicht des Bildes der schlafenden Gesellen ausfindig gemacht hatte, geräuschlos hin und begann eilig zu zeichnen, was er sah, indem er den Mitteltisch mit dem schlafenden Burschen im Frack zur Hauptgruppe machte. Der Wirt schaute ihm nachdenklich zu, und nach einer Weile meinte er bedächtig: "Ich hätte mir doch nie gedacht, daß man solche hergelaufene Stromer malen könnte, die wie ein Häufelchen Menschenkehricht hier in diesem elenden Winkel zusammengefegt liegen. Wenn ich mir einmal was malen ließe, daß müßte mindestens ein Gambrinus oder wenigstens ein totes Schneewittchen in seinem Glassarge sein. Aber so etwas. Wer kauft's denn?!"
Der Maler spitzte sich gelassen seinen Stift zurecht und sagte launig: "Heutzutage ist dies das beste Geschäft. Lumpen stehen im höchsten Preise; sie müssen aber gemalt sein. Und was mich anlangt, so arbeite ich für eine illustrierte Zeitung, die mit Vergnügen einmal solche Bilder aus dem Handwerksburschen- und Herbergenleben bringen wird. Und weil ich auf meiner Landwanderung gestern Abend in diese Eure saubere Finkenhöhle ganz gegen meine Ahnung geraten bin, so will ich, was ich sehe, auch nutzbar machen. Das wird hier in der Eile zunächst treu nach der Natur skizziert und zu Hause führt man's dann mit Muße aus."
Er schwieg plötzlich, denn der eine und andre der schlafenden Kunden fing an sich zu regen und zu dehnen. Der Maler zeichnete rascher und eifriger, um noch vor dem Erwachen der Stromer seine Skizze zu vollenden. Bald hatte er soviel in seinen Umrissen festgehalten, daß er befriedigt das Buch zusammen legen konnte, und der Wirt, der ihm schlau mit den Augen zublinzelte, sagte: "Na, und nun geben Sie 'mal acht, jetzt werde ich die Dachse ein bischen aufstöbern mit meiner Feuerzange; das ist noch viel malerischer; das ist wie die Auferstehung der Toten."
Mit diesen Worten trat er vor den schauspielerisch dreinschlummernden Gesellen, der am Tischbein lehnte, gab ihm mit dem Fuß einen derben Stoß in den Rücken, daß der Schlafende langsam nach der Seite sich umneigte, riß den, der auf die Tischplatte lag, unsanft bei den Ohren und ging im Gastzimmer auf und ab, rüttelte die Schläfer und rief dazu laut:
"Aufgestanden, ihr Ballertbrüder, ihr Berg- und Thalversetzer, ihr Kommandoschieber, ihr Himmelsfechter! 'Raus aus den Federn, 'raus aus euren Himmelbetten mit den seidenen Kissen."
Der am Tischbein lehnte, war unterdessen ganz umgefallen, wachte aber mit übernächtigem Ausdrucke auf, gähnte, blickte sich verwundert um und sprach in einer Mischung von hohlem Pathos und übermütiger Gewöhnlichkeit: "Na nu! Wat mordest du mir meinen Schlaf, oller Glamis? Ich dachte einen langen Schlaf zu thun, und nun soll Cawdor nicht schlafen mehr, Macbeth nicht schlafen mehr?! – Ach, du ganz gemeine Mordaxt du, wie kannst du dich unterstehen, an meiner Wurzel zu naschen?!" Er holte langsam aus seiner Hosentasche einen Kamm und begann sich mit theatralischer Gebärde seine schwarzen Haare zu kämmen, während er, auf der Diele sitzend, ähnliche ungeheuerliche Redensarten vor sich hinmurmelte.
"'Raus aus euren Federn, 'raus aus euren Himmelbetten mit den seidnen Kissen" wiederholte der Wirt, während ein Knecht eintrat und, ohne auf die Schläfer Rücksicht zu nehmen, mit einem großen Besen zwischen sie auf der Diele hinfegte. Auf dem Tische richtete sich der Befrackte in die Höhe, wischte sich die Augen, verlor das Gleichgewicht und fiel von der Tischkante auf die Diele herunter, wo er sich langsam aufrichtete und träumerisch verklärt sagte: "Morgen, Morgen! Ei, Strammfidel, mir träumte, ich fiele als Tropfen Morgentau in det weiche Bett einer aufgeblühten Kamelie. Herrgott, ick jloobe, der Penneboos hat mir von der Bank geschmissen." Er drohte dem Wirte mit der Faust und rief: "Na, warte, du Rabensohn, wenn du mir noch einmal vom Tische wirfst, denn ziehe ich aus hier und nehme meine Salonmöbeln mit."
Der Wirt sah ihn von oben herab an und sagte, indem er einen verständnisvollen Blick auf den Maler warf: "Stille bist du, du stellenloser Oberkellner, du abgedankter Frackvogel mit der Papierserviette." Kaum hatte er das gesagt, als der Angeredete mit einem wilden Satze aufsprang, sich vor dem Penneboos aufstellte, indem er mit einer Taschenbürste sich die Haare glättete und auf der Rückseite seines Kopfes heftig einen Kellnerscheitel abteilte. Höhnisch schrie er: "Na, denn geben Sie mir doch eine Stellung bei sich, Sie großartiger Hotelier ersten Ranges, wo die beschmorten Drescher Table d'hote halten. Was verstehen denn Sie? Ich verstehe französisch, englisch, italienisch und mir haben die adeligsten Gräfinnen nie unter'm Thaler Trinkgeld gegeben! Aber ehe ich bei Ihnen in Stellung ginge, da möchte ich doch lieber in der feinsten Hochwollee ohne anständiges Vorhemdchen bedienen." Nachdem er diesen Trumpf ausgespielt hatte, drehte der ehemalige Kellner dem Pennenwirt den Rücken zu und sagte ruhiger und mit vornehmer Herablassung: "Bringen Sie mir mein Frühstück, Schnaps und Brot, aber englisch." Der Wirt zuckte die Achseln und begab sich nach dem Schnapsschank der Gaststube, wo er sich hinter dem Tische aufstellte und langsam aus verschiedenen Glasflaschen mit den verheißungsvollen Inschriften: Kornbranntwein, Nordhäuser, Kümmel, Kirsch und wie sie alle heißen, eine Reihe von Schnapsgläsern füllte. Unterdessen begann in der Stube ein reges Leben; die Kunden sprangen von ihren Lagern auf, räumten ihre Strohschütten hinaus, und man fing an, sich zu waschen, soweit man ein Bedürfnis dazu fühlte. Der eine schrie nach Stiefelwichse und Bürste, die er auch durch den Knecht erhielt, und wichste pfeifend seine schönen neuen Schaftstiefel; ein andrer stickte seine Hosen. In der Ecke musterte ein dritter den Inhalt seines Felleisens, das er aufpackte, um zu sehen, daß ihm bei Nacht nichts gestohlen sei. Man kämmte, bürstete, flickte und putzte sich heraus, der eine anständig und sauber, um einen guten Eindruck zu machen, wenn er über Land ginge fechten und wandern; der andre suchte noch neue Löcher in seine Hosen und seinen Rock zu bringen, um so elend als möglich zu sein und erhöhtes Mitleid zu erheischen, wenn er weiter oben an der Landstraße stehen würde als armer Blinder oder als Invalid.
Unterdessen hörte man aus der Ofenecke ein dünnes Stimmchen selig und heiter singen: "Wach auf, mein Geist und schwinge dich, ja, schwinge dich." Und in hohem Diskant sprach dieselbe Stimme: "Ich grüße dich, du schönes Leben wieder!" Das war der Schneider Heinrich Henning, der eben auch erwachte und sich mit dem Gefühle inniger Dankbarkeit für seinen Schöpfer, der ihn auch diesen neuen Tag sehen ließ, fröhlich erhob. Er blickte so munter und zufrieden drin wie ein junger König, der die erste Nacht nach seiner Thronbesteigung in seinen neuen königlichen Gemächern gut und hoffnungsvoll geschlafen hat. Nicht ganz gleicher Meinung mit Heinz Henning, dem ehemaligen Herren- und Damenschneider, jetzigem landwandernden Kleiderhändler, war aber Gottlieb Weber, der wegen Streikes entlassene arbeitslose Bergarbeiter. Der rieb sich sein Kreuz, noch ungewöhnt des Schlafens auf der harten Bank und jammerte: "O Je, o Je! Mein Kreuz, mein Kreuz!" Er rief den Wirt an und sagte: "Sie hölzerner Nußknacker von einem Herbergswirt, mit was haben denn Sie Ihre Sofas aufgepolstert? O Jotte doch, ich bin so zerschlagen wie gewiegtes Rindfleisch auf der Fleischbank. Haut ihn, den Mann mit den wackeligen Bettstellen!"
Diese zarte Aufforderung schien in den Seelen der anderen Fechtbrüder ein lebendiges Echo zu finden, denn der Schauspieler Hasenklau hielt inne im Auskämmen seiner Haarmähne und rief mit dem Brustton der Überzeugung: "Jawohl, haut ihn!", während der ehemalige Oberkellner Karl Sorger herausfordernd bemerkte: "Schnallt ihn fest auf seinen Tisch und wippt ihn, daß er auch einmal weiß, was es heißt auf Holz gebettet zu sein, wo alle andern Leute auf Rosen liegen."
"Was kann ich dafür", entgegnete der Wirt, "daß ihr solche Kerle seid, die nicht einmal ein Bett bei mir bezahlen können? Oben liegt das ganze Haus voll, aber das sind anständige Leute, die haben noch die paar Groschen Schlafgeld; wer nur mit Pfennigen dienen kann, muß in der Stube auf der Bank schlafen!"
Die Aufforderung des Kellners schien nichtsdestoweniger Anklang zu finden, denn die Kunden sprangen auf, drängten nach dem Schanktisch auf den Wirt los, und man hörte, indem plötzlich ein allgemeiner Lärm entstand, Worte und Laute in einer fremdartigen Sprache: "Schnallt ihn fest den Kundenschinder! den Höllenvater! 'Ran an die Bank! 'Rauf auf den Tisch! Gib deinen Soroff 'raus aus der Schnapstonne, du Oluffbruder mit den dicken Koteletten am ganzen Leibe!"
Unter solchen Redensarten drängten die Fechtbrüder einander wechselseitig anstoßend gegen den Schanktisch, wo sie sich hin- und herschoben und mit drohenden Fäusten auf den Wirt hineinredeten. Der Maler, dem der Lärm gefährlich zu werden schien, sah, wie der lange Kellner den Penneboos bei der Schulter packte. Da wollte er eilig zur Thüre hinaus, um den Knecht zu rufen. Aber mit gelassener Kraft hatte der Wirt den Befrackten im Genick gefaßt und indem er ihm mit dem Knie einen gewaltigen Stoß in die Rückseite versetzte, warf er ihn, wie aus der Pistole geschossen, mitten in die Stube hinein, daß er gegenüber auf die Ofenbank flog, wo er sich, im Wirbel um sich selbst gedreht, schier verwundert hinsetzte. Der Penneboos trat, seine starken Arme reckend, mitten unter die gedrängte Schar der Kunden und rief, in einer Mischung von Zorn und guter Laune über seine Kraft: "Wollt ihr wohl, ihr Zitronenschleifer! Wie könnt ihr euch an eurem Penneboos vergreifen, vergreifen an dem Mann, der euer Vater, Mutter, Kammerdiener und Stubenmädchen zugleich ist?" Der Wirt wurde aufgeregter, schritt in der Stube vor, während die Fechtbrüder vor ihm zurückwichen, ihre Röcke anzogen und mäuschenstill wurden, und er donnerte die Rede unter sie hinein: "Wie könnt ihr den Respekt vor eurer Obrigkeit aus den Augen lassen? Wer kleidet euch, wer speist euch, daß ihr Pickus habt, wer schützt euch vor Klempners Karl und seinem Kittchen? Wer heißt euch hier wilden Mann machen, wo ich da bin? Ei, der Mensch soll Vater und Mutter ehren! Was dich anlangt, Fritze Hasenklau, du stehst noch mit fünf Bleiern bei mir! Habe ich dich trotzdem nicht aufgenommen und dir ein Bett an meinem Herd bereitet? Habe ich dich nicht an's Tischlein deck dich gesetzt und dir ein viertel Pfund-Brot für sechs Pfennige gratis gegeben ohne Butter und Wurst? Und du wagst dich zu vergreifen an mir? Die Polente und den Schucker über euch!"
Der also Angeredete machte ein Gesicht wie jemand, den man aufs tiefste gekränkt hat, dann aber nahm er sein Glas Schnaps, das er statt des Frühstücks genoß, goß es mit einem Zuge hinter die Binde und bemerkte anzüglich: "Jawohl, und ich würde dir die fünf Bleier gleich herausgeblecht haben, aber der hier, dieser Schatten eines Kellners, ist mir vom letzten Kümmelblättchen noch sechs Bleier schuldig!"
Von der Bank hinten klang es heiser dagegen: "Schwindel! Falsch! Falsch! Gebauernfängert hat er mir!"
Ein neuer Streit wollte beginnen, während der Wirt einzelnen Kunden ihr Frühstück auf die Gasttische stellte, Schnaps und Brot, der Knecht aber anderen aus der Küche den Kaffee brachte. Man trank und brockte sich Brot in die verschiedenen Flüssigkeiten. Hasenklau hatte verächtlich über seine Achsel weggeschaut und rief dem Kellner zu: "Wirst du silentium halten. Ich werde dir meine Freundschaft aufkündigen und jegliche Geschäftsverbindung mit dir abbrechen! Ich werde –!"
Aus dem Hintergrunde klang es noch heiserer zurück: "Und ick werde dir ollen Schmierenbruder den Standpunkt pulverisieren!"
Kaum hatte das der ehemalige Schauspieler gehört, als er sich theatralisch in die Mitte der Gaststube stellte, die linke Hand feierlich auf die Brust legte und die Rechte beschwörend gen Himmel erhob mit den Worten: "Hört! hört! Schmierenbruder nennt er mir! Ich habe den Macbeth und Lear gespielt zu meiner Zeit, und nun kommt dieser Hofnarr meiner Gunst, den ich an meinen Brüsten großgesäugt, und schlägt den gift'gen Schlangenzahn in meine Weichen!" Mit den Worten Hamlets schloß er feierlich: "Ha! ein geflickter Lumpenkönig!"
Ein gereizter Kater kann nicht ärger zischen und fauchen wie der Kellner Sorger, der auf solche Beschimpfung hin wild aus seinem Winkel auf den Schauspieler losgestürzt kam und, alle anderen zu Zeugen auffordernd, außer sich ausrief:
"Was hat er gesagt?! Was! Ein Lumpenkönig!"
Der Schauspieler aber rief noch feierlicher die Worte Hamlets aus: "Der weg vom Sims die reiche Krone stahl! Apoll bei einem Satyr!"
Diese ungeheuerliche Beschimpfung war selbst dem Wirt zu arg, denn er schlug auf den nächsten Gasttisch und sprach mit Energie: "Na, nu, man raus! Wer heißt dir hier solche unerhörte Redensarten führen, bei denen einem Christenmenschen die Gänsehaut überläuft? Sind das Worte? 'Raus mit euch! Macht eure Sachen draußen aus!" Er pfiff mit dem Munde scharf auf seinen Fingern, was der eben wieder eintretende Hausknecht sofort verstand, denn er packte zunächst den Schauspieler an den Schultern, warf ihn in schräger Linie zur Thür hinaus und faßte den Kellner bei den Ohren, um ihn etwas langsamer gleichfalls zur Thür hinauszuführen. Der Befrackte fuchtelte dabei mit den Händen in der Luft herum und jammerte: "Ich habe noch keine Krone gestohlen! Apoll bei einem Satyr hat er mir genannt, wer weiß, was das für Lumige miteinander gewesen sind, ich lasse mir so 'was nicht gefallen. Nicht einen Bleier kriegt er heraus." Seine Worte verhallten draußen auf dem Flur, denn der Hausknecht warf die Thüre hinter den beiden Kampfhähnen zu.
Es wurde nun ruhiger im Gastzimmer, die Kunden frühstückten, musterten ihre Legitimationspapiere, flüsterten zusammen und besprachen gruppenweise die Geschäfte, die sie miteinander vorhaben mochten. Die Thüre ging gelegentlich wieder auf und es kamen, sauberer geputzt, die Schlafburschen allmählich herunter, die oben in richtigen Betten gelegen hatten, reisende Handwerksburschen, die nach alter Sitte ein Jährlein auf der Wanderschaft lebten, ordentlichere Arbeiter und Handwerker, die über Land gingen, um Arbeit zu suchen, auch wohl der eine oder andre Hochstapler darunter, der still bei sich seinen neuesten Streich erwog, den er in dem nahen Landstädtchen zu vollführen dachte. Einzelne machten sich dann auf, luden ihre Felleisen auf und nahmen ihre Knotenstöcke in die Hand, um am Morgen noch ein gut Stück weiter zu kommen, die Gaststube leerte sich allmählich und als nur noch einige wenige beisammen saßen, schenkte sich der Wirt am Schanktisch selber ein Glas Branntwein voll, trank es, rieb sich behaglich den Magen, warf dem Maler, der unbeachtet in einer Ecke gesessen hatte, einen Gönnerblick zu und ermahnte seine Gäste: "An Ihre Geschäfte, an Ihre Arbeit, meine Herren! Wer dreizehn unmündige Kinder hat, wovon das jüngste noch nicht auf der Welt ist, der soll an den Thüren bitten, auf daß ihm gegeben werde. Wer blos einen Arm hat, soll den andren unter der Weste festbinden, wer blind ist, soll sich die Wimpern ausrupfen, wer taubstumm ist, soll Watte in die Ohren stopfen und jedermann soll thun, was seines Amtes ist. Denn die Welt ist voll Hartherzigkeit, man muß sie zur Barmherzigkeit erziehen. Geht, und sammelt in eure Scheuern, ihr Lilien auf dem Felde!"
Der Maler hatte unterdessen heimlich noch manche rasche Skizze in sein Buch gezeichnet ohne zu bemerken, daß man ihn an einem Tische zuletzt doch beobachtete und besorgte Worte um ihn austauschte. Ja, seine Anwesenheit bewirkte nun, daß die Gaststube binnen kurzem gänzlich leer wurde und als er den Wirt darob frug, meinte dieser: "Na, da nehmen Sie sich nur in Acht! Am Ende hält man Sie für einen Polizeispion, der für ein Verbrecher-Album arbeitet. Machen Sie, daß Sie bald weiter kommen und sehen Sie zu, daß man Ihnen im Busch nicht auflauert."
Der Maler wollte sich schon etwas beklommen erheben, als er durch die Frage des Wirtes: "Ja, was ist denn das für einer?" auf einen neuen Gast aufmerksam wurde, der eben eingetreten war und sich ermüdet an einem Tische nieder ließ. Er schien in der Morgendämmerung schon einige Stunden gewandert zu sein, legte ein schwarzleinenes Felleisen, auf dem ein paar neue Schuhe und die Bürste außen aufgeschnallt waren, neben sich auf die Bank, lehnte den Knotenstock an den Stuhl und sah sich mit leise spähenden Augen um. Dem Maler und dem Wirt fiel gleichermaßen eine gewisse Reinlichkeit der Kleidung des Mannes auf und obwohl der Hut, der seinen Kopf bedeckte, schon ziemlich verschossen war, so wies doch ein gewisser geistiger Zug um seine Augen auf etwas anderes hin, als was der Mann scheinen mochte. Der Maler grübelte über der Erinnerung an irgend ein ähnliches Gesicht aus seinem Bekanntenkreise. –
Nachdem der Fremde sich gesetzt und nachdenklich umgeschaut hatte, rief er dem Wirt zu, er solle ihm eine Portion Kaffee und etwas Schinken und Eier besorgen. Im selben Augenblicke schien er sich aber eines anderen zu besinnen, als ob ein so reichliches Frühstück Verdacht erregen könnte, und er sagte statt dessen: "Also einen Schnaps mit Brod und Dreierkäse."
Der Wirt durch dieses Verhalten noch aufmerksamer geworden, trat jetzt zu dem Fremden an den Tisch, rückte sein Käppchen und begrüßte ihn mit dem alten Gruße der fahrenden Handwerksburschen: "Kenn' Kunde! Weißlinge will er? Schnaps will er? Soll's ein Wachtmeister sein?" Der Fremde schaute etwas verdutzt zu dem Wirte auf, denn es waren in dessen Rede gleich drei Ausdrücke, die er noch nicht gehört hatte. Er schien aber ein Interesse zu haben, seine Unkenntnis zu verbergen, that, als sei ihm der Kundengruß schon lange bekannt, und als wüßte er, was ein "Wachtmeister" sei und gestattete sich nur die beiläufige Frage: "Was? Weißlinge? haben Sie solche Fische auch hier herum?"
Er mochte tüchtig vorbeigeraten haben, denn der Wirt lachte und meinte: "Na, Kunde, er hat ja doch Eier bestellt. Das nennt man auf der Penne Weißlinge. Sind wohl noch nicht lange auf der Walze?"
Der Fremde machte, als er eine solche originelle Wortbedeutung erfuhr, ein Gesicht wie jemand, der eine interessante wissenschaftliche Entdeckung mit Genugthuung verzeichnet. Da er aber mit der sonderbaren Frage, ob er schon lange auf der "Walze" sei, wiederum vor ein Rätsel gestellt war, so schwieg er und blickte mit einem geistreich leeren Blicke an dem Wirt vorüber. Dieser musterte ihn von neuem, ob man einem so verdächtigen Menschenkinde, das augenscheinlich noch gar nicht "gewalzt" hatte d. h. auf der Wanderschaft gewesen war, Unterkunft gewähren dürfe. Er kam aber mit seinem Gedankengange nicht zu Rande und frug daher etwas rasch und herrisch:
"Na, soll's ein Wachtmeister sein?!"
Die unwillige und unverstandene Anrede stimmte aber auch den Neuling etwas ärgerlich und er sagte daher aufs Geratewohl und ziemlich unwillig: "Ach was, ich bin überhaupt nicht beim Militär gewesen." Der Wirt hatte nun schon genug. Er zuckte mit einer überlegenen Miene die Achseln und bemerkte mit einer kurzen Wendung gegen den Maler hin, der ihn aber ebenso wenig wie der Fremde verstand: "Also ein Äffchen!" womit er einen Neuling im Landfahren meinte. "Noch grün wie Spinat! Ob Sie ein großes Glas Schnaps wollen, Handwerksbursch, frage ich; das heißt bei mir allerwegen ein Wachtmeister!" Es lag eine ziemliche Geringschätzung in dem Tone, mit welchem er diese Aufklärung gab.
Der Unbekannte hatte sich aber schon wieder zurecht gefunden, nahm eine Miene an, als sei er nicht im geringsten zweifelhaft über die Bedeutung der Sache gewesen, und gab es dem Wirt scharf zurück mit dem selbstbewußten Worte: "Ja, freilich, bringen Sie mir nun endlich meinen Wachtmeister."
Der Wirt ging an die Schänktafel, füllte ein großes Glas Schnaps und murmelte etwas in sich hinein, was seine erneuten Zweifel über den Ankömmling ausdrückte. Ein Polizeikundschafter konnte es nicht gut sein, denn der würde sich geschickter benommen haben; für einen Hochstapler konnte er ihn nicht halten, denn der mußte die Sprache kennen; für einen arbeitsuchenden Handwerker oder Fabriklöhner waren seine Hände nicht rauh genug, für einen Städter, der eine Landpartie unternahm, wiederum war die ganze Ausrüstung zu handwerksburschenmäßig. Der Maler unterdessen machte den Versuch den Neuling rasch und verstohlen in sein Skizzenbuch zu zeichnen; da er in der dämmernden Zimmerecke saß, konnte der Fremde ihn nicht recht erkennen, während er selbst von neuem über eine gewisse Ähnlichkeit dieses Gesichtes sich den Kopf zerbrach. Plötzlich aber bemerkte der Fremde, daß man Anstalt machte, ihn abzukonterfeien, und er drehte sich daher mit einer raschen Bewegung um, womit er dem Maler den Rücken zukehrte.
Das war nun entschieden verdächtig. Der Künstler machte dem Wirt mit der Hand einige deutliche Zeichen, daß er gesprächsweise den Fremden verführen solle ihm sein Gesicht wieder zuzuwenden; der Wirt zog die Augenbrauen hoch, stellte dem Gaste den Schnaps auf den Tisch und nach einer allgemeinen Einleitung, die darin bestand, daß er wiederholt bemerkte: "Ja, ja, Kunde, so geht's!" richtete er auf einmal die unmittelbare Gewissensfrage an den Mann: "Was ist denn eigentlich seine Religion, alter Kunde?" "Religion?" meinte der Angeredete ganz erstaunt. Daß man hier mitten im duldsamen Deutschland, im letzten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts so ohne Weiteres von einem Gastwirt nach dem Religionsbekenntnis ausgefragt wurde, schien dem Fremden denn doch ein ziemlich starkes Stück. Und er entgegnete barsch: "Religion? Was geht Sie das an, ob ich katholisch oder reformiert bin."
"Ach, wo!" warf der Wirt, statt geärgert zu sein über solche Auskunftsverweigerung, ganz gemütlich ein. "Ihre eigentliche Religion meine ich nicht. Ihr Geschäft meine ich. Was ein rechter Walzbruder ist, bei dem heißt schon seit Ritter Olims Zeiten sein Handwerk allemal seine Religion." Und anzüglich fügte der Wirt die neckische Frage hinzu: "Vielleicht ein Reisender in Unterhosen?!"
Der Gast schwieg auf diese Frage, denn augenscheinlich war er um eine neue und außerordentlich merkwürdige Erfahrung reicher. Der Wirt aber, hinter seinem Rücken durch Gebärden des Malers von neuem aufgefordert, und zu jedem Schabernack ohnedies einem solchen grünen Ankömmling gegenüber geneigt, griff zu einer List, um letzteren wieder in das Augenbereich des Künstlers zu bringen. Er neigte sich verstohlen und mit einer schlauen Miene zu dem Fremden nieder und flüsterte ihm zu: "Haben Sie denn auch schon Bekanntschaft gemacht mit dem da drüben? Das ist ja der große Falschmünzer, der lange Ede, der neulich aus dem Gefängnis entsprungen ist. Sehen Sie aber nicht so hin; Sie müssen sich ihm nur ein bischen zukehren, daß Sie ihn von der Seite beobachten können. Verstehen Sie?!"
Er erreichte wirklich, daß der Fremde sich neugierig und verstohlen nach dem Mann im Dunkel der Zimmerecke umschaute und von der Seite nach ihm hinschielte. Der Wirt aber, triumphierend über den wohlgelungenen Anschlag, schlich sich sachte zur Thüre hinaus, um in Stall und Küche nach dem Rechten zu sehen und die beiden ungewohnten Gäste ihrer wechselseitigen scharfen Betrachtung und mißtrauischen Beobachtung zu überlassen.
Es dauerte auch nicht lange, so begann der Maler von neuem in seiner dunklen Ecke eine rasche Karrikatur des Fremden in sein Skizzenbuch aufzunehmen. Indem er aber diese Züge nun mit eigener Hand nachzeichnete, stieg auf einmal eine äußerst lebhafte Erinnerung in ihm auf. Kein Zweifel, er war es doch! Eben wollte er selbst eine Frage thun hierüber, als der andere sich entrüstet erhob und die Frage stellte: "Mein Herr, wie kommen Sie dazu, mich hier, ohne meine Erlaubnis, zu porträtieren? Ich ersuche Sie, sofort diese Skizze zu vernichten!"
Die Stimme, mit welcher der Mann jetzt in der Erregung sprach, war zu unverkennbar, daß der Maler nicht mit behaglicher Geberde ihm die Zeichnung entgegengehalten und etwas anzüglich gefragt hätte: "Finden Sie nicht, mein Herr, daß diese Zeichnung einen stark retouchierten Eindruck macht? Es ist nicht meine Schuld, denn wenn man es nur mit einem retouchierten Originale zu thun hat, so ist es kein Wunder, wenn auch das Abbild zur reinen Dekorationsmalerei wird. Denn dieser Bart, Herr, ist sicher nicht das Werk der Natur, der ist beim Färber gewesen, ja, die Kleidung, die abgetragenen Stiefel, es ist alles bloße Retouche!"
Der also Angeredete erkannte jetzt wohl auch in dem aufstehenden Maler und bei hellerer Beleuchtung den alten Freund, mochte sich aber nicht so schnell ausliefern und entgegnete mit angenommener Härte: "Herr, das ist eine Unverfrorenheit sondergleichen. Ich reise als Handwerksbursche, bin ein fahrender Schlossergeselle und mein Name ist Hans Finke!"
"Still, alter Schwede!" fiel ihm der andere ins Wort. "Bist doch nur ein Öldruck, gratis im Abonnement zu einem Kolportageromane dreingegeben. Denn alter Junge, edler Hans, wunderbarer Hans Landmann, Nationalökonom, angehender Volkswirtschaftslehrer, Doktor und Privatdozent, kennst du deinen langjährigen Genossen fröhlicher Zechstunden nicht mehr, deinen Gustav Wangenheim, den malerischsten aller Maler, die jemals malten in Essig und Öl?! Wozu die Mummerei? Glaubst du, ein Maler kenne nicht die nachgemachte Anatomie deiner Erscheinung auf den ersten Blick? O Freund, wie bist du verkümmelt!"
Gegenüber einer so bestimmten Behauptung war nun freilich nichts mehr zu verbergen. Hans Landmann reichte dem Freunde mit einer schalkhaften Geberde die Hand. Man begrüßte sich aufs herzlichste und konnte sich nicht genug verwundern, unter so eigentümlichen Umständen in einer einsamen Zentralpenne auf dem Lande zusammengetroffen zu sein, wo sonst nur die "armen Reisenden", die Handwerksburschen, die Stromer und Arbeitslosen absteigen. Der Maler war ganz zufällig, nachdem er in einem nahen Landstädtchen mit der Eisenbahn angelangt war, um von da aus eine Fußpartie zu unternehmen, durch die hübsche Gegend hierher geraten. Er hatte sich am Abend verspätet und war in das einsame Gasthaus eingekehrt, ohne eine Ahnung, daß es eine Landherberge war. Dagegen erzählte der Privatdozent, daß er schon seit vierzehn Tagen auf der Fußwanderung begriffen sei und in diesem Aufzuge, in dem er dasitze, auch noch zu Fuße ein gut Stück Deutschlands zu durchwandern die Absicht habe. "Denn, Freund," setzte er hinzu, "du siehst mich in dieser Tarnkappe Studien halber."
"Dachte ichs doch," meinte der Maler lustig. "Ja, ja, schon Mahadöh, der Herr der Erde, stieg unerkannt in Menschengestalt unter die Sterblichen." Er klopfte auf den Tisch, um den Wirt hereinzurufen und bei einer Flasche Wein das flüchtige Beisammensein auszukosten. Hans Landmann aber bat ihn mit einiger Besorgnis um Ruhe, meinte, er dürfe schon deshalb keinen Wein hier genießen, um dadurch sein Inkognito als reisender Schlossergeselle nicht zu verraten, und sie müßten deshalb schon mit einem Gläschen Schnaps fürlieb nehmen, so lange sie an diesem Orte wären.
"Also, ums kurz zu machen," erklärte der falsche Handwerksbursche, "will ich dir mitteilen, daß ich mich schon längere Zeit mit dem Plane trage, ein Buch über das Stromerwesen und Landfahrertum in Deutschland zu schreiben. Ganz privatim will ich dir auch sagen, daß mir eine Professur als Volkswirtschaftslehrer an einer unserer ersten Hochschulen blüht, wenn ich die Ursachen dieser sozialen Erscheinung ins rechte Licht zu setzen weiß. Wir alle raten an dem großen Problem der Arbeitslosigkeit, das zeitweilig in unseren großen Städten, gepaart mit Nahrungsmangel, uns schwere Katastrophen droht, wie es schon zu schweren Krankheitserscheinungen am Körper des Staatslebens geführt hat. Es hilft aber nichts, mit allgemeinen Theorien die Sache abzuthun. Man muß die Erscheinungen an der Quelle studieren. Und die Leute, welche in dieser Lage sind, muß man selber sprechen, um zu sehen, wo eigentlich sie und den Staat der Schuh drückt. Ein deutscher Theologe ist vor einiger Zeit unter die Arbeiterschaft gegangen und hat als Fabrikarbeiter gedient, um dann ein Aufsehen erregendes Buch über die Zustände des deutschen Arbeiters zu schreiben. Ich will nun noch etwas tiefer herabsteigen, ich will die eigentlich Ausgestoßenen der menschlichen Gesellschaft studieren, indem ich selbst als einer der ihren über Land wandere. Das alte Handwerksburschenleben geht ja dahin."
Aus der Ferne, vom Eisenbahndamme her, der eine Viertelstunde weit von dem Gasthause über die Ackerebene in den nahen Wald führte, hörte man in diesem Augenblicke den langen, schrillen Pfiff einer Lokomotive. Der Ton verlor sich auch durch die Fensterscheiben in das Innere der Herberge und verklang leise klagend.
"Hörst du?" fuhr der Redner fort. "Da pfeift der Dampfzug vorüber. Dort rast die Kulturwelt in pfeilschnellen Wagen dahin; hunderte von geschäftlich bewegten, hoffnungsvollen Menschen durcheilen im Fluge die einsamen Länder. Die Landstraßen, wo einst die Reisenden in Postkutschen, neben langen Reihen von Lastwagen, langsam hinrollten, sind verödet, sind entvölkert. Nur der Handwerksbursche schlendert noch langsam mit seinem Bündel auf diesen Wegen uralten Verkehrs. Aber es ist nicht der alte, wohlbestallte Handwerker mehr, der, wie Hans Sachs, über Land ging, um die Welt zu sehen, seinen Anschauungskreis zu erweitern und da und dort zu arbeiten. Das sind verhältnismäßig nur noch wenige. Statt dessen belebt die Landstraßen ein anderes Volk, das Volk der gesellschaftlich Ausgestoßenen und Überzähligen, die Armen, welchen es nicht gelungen ist, zur rechten Zeit auf den Bahnhof des Lebens zu kommen, um mit in den Zug zu steigen, wo Arbeit und Lohn das Dasein ist, die vernichteten Existenzen, welche beim ungeheuerlichen Räderwälzen unseres sozialen Lebens den Anschluß versäumt haben."
Aus ganz weiter Ferne klang zwischen die Worte des Redners nochmals der klagende, verschollene Ruf der weiter entfernten Lokomotive, die mit ihrem Zuge schon tief in das Waldland hineingeeilt war. Dann war alles wieder still.
Wangenheim meinte etwas bedenklich: "Und da hast du als unverbesserlicher Anhänger der ›naturalistischen‹ Schriftsteller, als Mann der Humanität und Wissenschaft beschlossen, gleich selbst als ein solcher Stromer zu wandern, und dieses Leben und seine Ursachen zu studieren? Wünsche gute Verrichtung."
"So ist es," entgegnete der andere, indem er aus seiner Rocktasche ein Wanderbuch zog, welches seine Legitimationspapiere enthielt. Er ließ den Freund Einblick in dieselben thun, welche auf den Namen Hans Finke, Schlossergeselle aus Königsberg, ausgestellt waren. Landmann erzählte, daß ein befreundeter Polizeirat in Berlin von dem Plane dieser Fußwanderungen unterrichtet sei, und daß man ihm zu diesem Zwecke doppelte Legitimationen auf einen reisenden Handwerksburschen ausgestellt habe. Er erzählte, daß er seine Reisegelder an verschiedene Postämter postlagernd voraus gesendet habe, um nicht mit zu viel Geld beschwert zu sein für den Fall, daß der eine oder andere Fechtbruder seiner Reisebekanntschaften ihn zu bestehlen den Einfall habe. Auf seine Papiere hin erhalte er an den verschiedenen Postämtern seine Gelder ausgezahlt, und im übrigen habe er die Absicht, einige Monate lang selber gänzlich zum fahrenden "Kunden" oder Handwerksburschen zu werden, Freuden und Leiden mit seinen Reisebegleitern zu teilen, im Notfalle selbst den armen Reisenden zu machen und die Ortsgeschenke in den Dörfern einzustreichen, um alles, worüber er schreiben wolle, mit eigenen Augen zu studieren.
"Denke dir, Freund," setzte er hinzu, "nach neuesten statistischen Angaben befinden sich in Deutschland allein durchschnittlich dreimalhunderttausend stellenlose, arbeitslose Menschen auf den Landstraßen und in den Herbergen, davon zweimalhunderttausend, welche dauernd in diesem Zustande leben und als freie Fechtbrüder sich durchbringen, sage 200 000! Wenn das nicht der wichtigste Teil der sozialen Frage ist, an der die guten Deutschen herumdoktorieren! Denn diese Leute, welche an deine Thüre klopfen und unter dem Namen des "armen Reisenden" um ein Almosen bitten, sie finden sich aus allen Ständen und Klassen zusammen, mancher Schuldige, viele Unschuldige, vom Interessenkampf Aufgeriebene."
Der Maler, der auch schon einige Kenntnisse über diesen Punkt besaß, ergänzte launig: "Ingenieure, entlassene Offiziere, stellenlose Fabrikarbeiter, Handwerker und Kaufleute, Bäcker, Schuster, Schneider, verkommene Schauspieler, arme Kunstreiter, durchgefallene Studenten, Journalisten, Doktoren, Schiffer, Forstleute, Beamte und wie sie alle heißen, stimmt, Freund, aber ich warne dich, laß dich mit dem Völkchen nicht zu tief ein – sie habens fast alle hinter den Ohren!"
Hans Landmann zuckte etwas überlegen die Achseln und meinte im Bewußtsein seiner Menschenkenntnis: "O, das laß mich machen. Ich kenne meine Pappenheimer, du malst sie ja auch."
"Malen ist etwas ganz anderes. Wir Maler bleiben hübsch außen am Rande der Dinge, ihr Forscher aber müßt untertauchen in das stille Wasser des Lebens, das so tief ist – na, höre mal, nach den Proben von Verstellungskunst vorhin!"
"Lehre mich das Volk kennen!" warf Landmann etwas leichtsinnig ein. Überdies meinte er, das sei nur die Überraschung des ersten Augenblickes über die Redeweise des Wirtes gewesen. Denn hier scheine er nun endlich einmal in eine richtige Landpenne geraten, wo er das beisammen finden werde, was er suche.
Schon seit vierzehn Tagen wanderte der junge, unternehmende Gelehrte auf vereinsamten Landstraßen, bald durch weite Nadelholzwälder und durch Dörfer auf fruchtbaren Ebenen, bald im welligen Hügellande, hinter dem Haideland sich abwechselnd ausbreitete. Da er größere Städte zu vermeiden suchte, hatte er bisher nur zwei kleinere Landstädte berührt, deren altertümliche Türme ihn aus der Ferne herangelockt hatten. Die erhofften Abenteuer aber waren bisher ausgeblieben; die Handwerksburschen, denen er sich auf den Straßen angeschlossen hatte, waren junge, harmlose Bürschchen gewesen, die keinen anderen Zweck verfolgten, als auch einmal eine Art Ferienreise zu unternehmen und sich äußerlich nur noch mit dem "Berliner" und dem Knotenstock beluden, um den alten Brauch mitzumachen. In den Dörfern hatten sie ihn in den großen Gasthof mitgenommen, wo man höchst anständig sein Bier trank und seinen Braten für vierzig oder fünfzig Pfennige aß. Kam man aber gegen Abend an die nächste Eisenbahnstelle, so hatten die Reisebegleiter sich wiederholt aufs höflichste verabschiedet, waren in die Eisenbahnwagen gestiegen, um womöglich an diesem Abend noch eine zweistündige Fahrt, allerdings vierter Klasse, auszuführen, und er hatte das Nachsehen gehabt. Da er glaubte, um seines Inkognitos willen sich nur mit schmaler Kost in den Gasthöfen begnügen zu müssen, so war er auch ziemlich mißmutig geworden über dieses ewige Fasten, bei dem ihm doch gar keine nützlichen Studien und Bekanntschaften einen Ersatz boten.
"Aber jetzt, Freund, das merke ich, bin ich an der rechten Schmiede! Dieser alte verrauchte, verwetterte Gasthof scheint mir das gesuchte Eldorado meiner Wünsche. Und da ich mich hier für einige Zeit festzunisten denke, so schlage ich dir vor, wir wandern vorher ein Stückchen zurück, damit ich mich in deiner Gesellschaft in einem andern Gasthof des nächsten Dorfes noch einmal recht ordentlich satt esse mit etwas Solidem."
Wangenheim, der kopfschüttelnd den Freund betrachtete, konnte allerdings bestätigen, daß er hier endlich einmal in eine richtige Penne geraten sei, wo er sicher eine Reihe origineller Bekanntschaften machen werde, wenn er einige Zeit hier lebte. Und da der Maler nach der nächsten, zwei Stunden entfernten Landstadt zurück wollte, um mit der Eisenbahn dann noch eine dreistündige Fahrt nach Berlin zurückzulegen, so wurde beschlossen, daß Hans Landmann den Freund ein Stück begleitete, ehe er wieder in die vielversprechende Herberge zurückkehren sollte.
Der Wirt wurde bezahlt und die beiden Freunde wanderten zusammen landeinwärts gegen das Städtchen zu, welches, in der Ferne zwischen zwei sonnigen Hügeln in ein Thal hineingebaut, mit seinen weißen Mauern herüberglänzte. Ein frischer, sehr kühler Frühlingswind wehte über die weiten Ackerebenen her.
Im nächsten Gasthof wurde gerastet, und hier erstaunte Wangenheim über den Appetit des falschen Handwerksburschen, der mehrere Teller vom besten Braten verzehrte, Wein, Nachtisch nach Herzenslust genoß, um das lang Entbehrte wieder einzubringen, bevor er sich zu den neuen und diesmal unzweifelhafteren Abenteuern und Entbehrungen rüstete. Erst nachdem er eine Stunde lang gegessen, was der Wirt irgendwie auftreiben konnte, fand der ausgehungerte Gelehrte Zeit, bei einer Zigarre dem Freunde nach Berlin die wärmsten Grüße an seine Braut, ein Fräulein Emma von Arnim, aufzutragen, um zu melden, daß er den Bräutigam noch lebend und unversehrt hier gefunden, gesehen und gesprochen habe.
Über diese Braut und die Geschichte der Verlobung tauschten sie noch manches fröhliche Wort. Als sich gegen den Nachmittag die Freunde endlich verabschiedeten, meinte der Maler mit heiterer Laune nicht ohne eine gewisse warnungsvolle Besorgnis um den kühnen Volkswirtschaftler: "Nun, der große Gott des Humors segne deinen Eingang und Ausgang, edler Hans Finke. Dein Buch will ich einst lesen wie eine weltliche Bibel. Mögest du unerkannt und ungebrannt durchs Fegefeuer gehen. Mögest du zunehmen an Heiterkeit, Weisheit und Weltverstand, und vor allem: hüte dich vor allen Weinen, die gebrannt sind aus dem Geist der Kartoffel!"
Zweites Kapitel
Während unser Held am Nachmittage im milden Sonnenscheine auf der Landstraße nach der einsamen Herberge zurückschlenderte, dachte er mit einer gewissen Genugthuung über sein Unternehmen nach. Er malte es sich mit lebhaften Farben aus, wie er nach reichlichen Studien an Ort und Stelle in der Lage sein werde, ein gehaltreiches, vielleicht epochemachendes Werk zuschreiben. Er erinnerte sich, wie viele Auflagen das Werk eines Mannes erlebt hatte, der in ähnlicher Weise unter die Arbeiterschaft gegangen war, und meinte, daß die Kreise, deren volkswirtschaftliche Erforschung er sich vorgesetzt hatte, die Teilnahme nicht nur gelehrter Leute und der Staatsmänner finden, sondern auch in der großen, allgemeinen Leserschaft viele Neugier erwecken würden. Er sah im Geiste die Druckerpressen in ununterbrochener Thätigkeit, neue Auflagen seines Zukunftsbuches fertig zu stellen und begann im Stillen nachzurechnen, wie viele tausende von Markstücken aus einem so zweifellosen Buchhändlererfolg in seine Tasche fließen würden. Es war natürlich, daß diese Markstücke sich mehrten und mehrten, während gleichzeitig die Hoffnungen auf eine Professur in Berlin zusehends eine bestimmtere Gestalt annahmen. Er verfolgte diese verlockenden Gedanken des weiteren, verglich seine gegenwärtige Studierstube, die er als einfacher Privatdocent bewohnte, mit der großen Wohnung im Westen Berlins, die er dann, als Professor und Verfasser eines großen und wichtigen Werkes nehmen würde, und stattete sie in Gedanken mit jeder Behaglichkeit eines seinen Hauswesens aus. Sein Studierzimmer, seine Bücherei bekleidete er im Stile der Renaissance mit eichenholzenen Schränken und guten persischen Teppichen. Das Speisezimmer erhielt neben der Tafel und mehreren Pfühlen, die an den Wandecken angebracht waren, einen großen Tellerschrein für die Anrichtung der Mahlzeiten, die er zu geben dachte. Denn ein Haus wollte er auf alle Fälle machen, die Spitzen der Wissenschaft, Kunst und Litteratur sollten bei ihm verkehren, bei ihm, der eine Merkwürdigkeit schon durch die Erzählungen war, die er von seinem Leben als Fechtbruder machen konnte. Ein hübsches Empfangszimmer stattete er mit blauseidenen Buhlmöbeln aus und unwillkürlich sah er neben seinem Studierzimmer ein behagliches Frauengelaß mit einem Erker, worin eine Ampel hinter bunten Glasscheiben herabhing und eine stattliche, brünette junge Frau saß – ach, Emma, süßestes aller Mädchen! Meine Braut, meine Freundin, meine Gefährtin, meine Herzallerliebste. Sähest du mich jetzt auf der einsamen Landstraße einherwandern, wie ich an dich denke und alle meine Gedanken zu dir eilen!
Der Wanderer, ganz in diesen hoffnungsvollen Träumen versunken, war auf der Landstraße in den Wald hineingeschritten und, um noch ein Weilchen diesen freundlichen Bildern ungestört nachzuhängen, bog er von der Straße ab in den Wald hinein, setzte sich hinter dem Stamme einer großmächtigen Buche, die eben zu grünen begann, ins Gras und pflückte die Anemonen und Himmelsschlüssel. Und indem er sich wiederholt seinen behaglichen Zukunftshausstand ausmalte, wie er ihn gemeinsam mit der Braut einzurichten gedachte, die er heiraten wollte, sowie das Buch vollendet sei, mußte er lachen, indem er seinen gegenwärtigen Zustand betrachtete und die Komödie, die er als reisender Handwerksbursche spielte. Er konnte es nicht lassen, er mußte seinen Taschenspiegel aus dem Rocke ziehn und blickte hinein, um sein verwandeltes Bildnis des näheren zu betrachten. "Na, originell genug sehe ich ja wohl aus. So so! – Also Hans Finke heiß ich. –" Er nickte ganz leise in den Spiegel hinein, in dem er sein verwahrlostes, bartgefärbtes Gesicht und darüber den Buchenwipfel, vom Himmelsblau überwölbt, abgespiegelt sah, und dachte lächelnd: "Habe die Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen, mein Herr. Mein Name ist Dr. Hans Landmann, Privatdozent und Schriftsteller für Vagabundentum. Wie gehts, Herr Finke? hoffentlich noch Wohnungen zu vermieten? Sie wissen doch, es saugt keinen Honig aus Blüten, es bildet kein Wachs, es summt nicht und schwärmt nicht, und doch nennen wir reisenden Handwerksburschen ein Bienchen, was niedlich ist. Sie sehen mir zwar ein wenig ruppig aus, Herr Finke, indessen, es freut mich doch, daß wir im ganzen ein Herz und eine Seele sind. Halten wir fest zusammen. Bedenken Sie, Herr Finke, daß, wenn Sie Ihre Sache gut machen, Sie an dem Erlös des Buches teilnehmen werden, das ich schreibe. Gestatten Sie, Herr Finke, Ihnen zu sagen, daß ich nicht einmal eifersüchtig auf Sie sein werde, wenn Sie Fräulein Emma den Hof machen neben mir. Mögen Sie auch aussehen wie Ruppert, der Bärenhäuter, Fräulein Emma wird Ihnen gewiß gern, wenn ich es nur wünsche, ein Kosestündchen gewähren und so die vielbesungene Verbrüderung des vierten Standes mit den besitzenden Klassen verwirklichen."
Er ließ seine Gedanken in dieser Weise weiter vagabundieren, nahm eine Schere aus seinem Berliner und begann sich, in den Spiegel blickend, an der Stirn und im Nacken noch einige Haarlocken auszuschneiden in der Erwägung, daß sein Inkognito um so wahrscheinlicher werde, je schlechter und stufenmäßiger sein Haupthaar verschnitten sei. Über ihm im Buchenwipfel aber saß ein junger Finke und übte sich im melodischen Herauszwitschern aller Gefühle, die sein Herz bewegten, ein Selbstgespräch, das laut und vernehmlich durch den Wald schallte, während Hans Finkes wundersames Selbstgespräch schweigend und stumm in seinem eigenen Busen verschlossen blieb.
Hans mochte eine Welle so gelegen haben im grünen Grase, als er auf der Landstraße das Näherrollen einer Handkarre vernahm und, jeden Augenblick auf ein Abenteuer gespannt, lugte er zwischen den jungen Gräsern und den niederen Büschen, vor denen er lag, hinaus auf die Straße. Dort sah er zwei Frauen in ärmlichen und zerschlissenen Röcken einherwandern, wovon die Ältere einen Handkarren hinter sich herzog. In dem Wägelchen stand ein großer, mit Lappen zugedeckter Tragkorb, ein kleines Mädchen saß daneben in der Karre und hielt in seinem Schoß ein Kind von etwa einem Jahre, das auch nur in dürftige Läpplein eingewickelt war. Ein größerer Junge aber zog neben der älteren Frau an der Deichsel des kleinen Wagens.
Als die Frauen, welche in lebhaftem Gespräche waren und heftige Gebärden machten, näher kamen, erkannte der Lauscher, baß die Jüngere von den beiden Frauenspersonen unter dem grauen Kopftuche, welches sie umgebunden trug, ein hübsches Mädchengesicht mit ein paar großen, guten, wenn auch etwas dümmlich dreinschauenden Augen mitbrachte. Ihre Kleidung war dürftig genug, denn sie bestand nur aus einem roten Wollenrock und einem zerrissenen Leibchen aus dunkelblauer Seide, das einst wohl eine schönere und stattlichere Frau getragen haben mochte. Das Mädchen und auch die ältere Frau waren barfuß, und man sah ihre Fußspuren samt den Zehen auf der frühlingsweichen Landstraße ein gut Stück Weges hinter ihnen eingedrückt. Das Mädchen trug einen Handkorb am Arme; das schien die ganze Ausrüstung zu sein.
Die beiden waren im lebhaften Gespräche bis dicht an die Stelle der Straße gekommen, wo Hans im zufälligen Hinterhalte lag, als die ältere Frau im Fahren inne hielt, sich an der Deichsel zurückstemmte und hierauf mit belehrender Miene auf die vordere Handkarre sich niedersetzte, während das Mädchen die Arme in die Hüften stemmte und vor ihr stehen blieb.
"Na, nun sei einmal ein vernünftiges Mächen, Jette," begann die Ältere mit mütterlicher Gewichtigkeit, "und laß dir von einer erfahrenen Frau, die schon seit acht Jahren als Tippelschickse geht, ein gebildetes Wort sagen."
Hans vernahm diese Worte ganz deutlich und hörte mit einer gewissen Genugthuung das Wort "Tippelschickse" ausgesprochen, dessen Bedeutung er zufällig von einem reisenden Handwerksburschen erfahren hatte. Er wußte daraus, daß die Sprecherin eine landfahrende Bettelfrau war, denn daß "tippeln" soviel wie "wandern" sei, hatte er sich schon in sein Notizbuch geschrieben, in dem er sich ein kleines Wörterbuch der Kundensprache anlegte.
Das Mädchen drehte sich auf jene Anrede halb herum, verbarg die Hände unter ihren Rockfalten und sagte halb verschämt, halb ungehalten: "Nee, nee, ich mag nischt wissen, ich weiß ja doch, daß du mich nur zur Frau Oberkellnerin außer Dienst machen willst, und ich mag doch noch gar keenen Mann."
"Ach wo," entgegnete die andere mit einer gewissen Würde langjähriger Lebenserfahrung, indem sie sich im Sitzen auf der Karre länger streckte, "der Mann ist die Bestimmung des Weibes und das Weib ist die Bestimmung für den Mann, dat kannst du sogar gedruckt lesen."
Die Jüngere zuckte die Achseln und erwiderte mit einer Miene der Geringschätzung: "Jawohl, aber das ist denn auch allemal auf dem Gemeindeamt auf dem Dorfe ausgeschrieben und hinterdrein gedruckt von wegen das Standesamtliche, und wenn ich überhaupt 'nen Mann nehme, denn will ich so eenen standesamtlichen Mann, aber keenen Scheeks, wie deine Männer gewesen sind, mit denen du zusammen auf die Fahrt gestiegen bist und die dich haben sitzen lassen, wenn du ihnen nicht genug Brot und Schnaps und Wurst und Fettigkeit zusammengebettelt hast, Liese."
Mit dem Stolze beleidigter Frauenwürde erhob sich die Liese, warf einen zufriedenen Blick auf ihre drei Kinder um sich und entgegnete dem jungen Mädchen: "Meine Männer! Du thust ja gerade, als wenn du wüßtest, wer dein Vater und Mutter ist! Und bist doch nur'n Findelkind, wo in die Welt heringekommen ist jerade wie die Mutter Eva, die auch weiter keinen Vater hatte. Na, und hat die etwa einen standesamtlichen Trauschein gehabt? Der ist doch nur für die Reichen, aber für uns?! Und deshalb ist sie doch eine brave Frau gewesen, die im Schweiße ihres Angesichts aus dem Paradies vertrieben war und ihr trocken Brot gegessen hat, wie ich, was ihr der liebe Gott doch auch bloß zum Almosen geschenkt hat, der armen Dille mit ihren zwei unmündigen Kindern."
Auf diese Worte hin, in so kläglicher Weise an ihre Heimatlosigkeit erinnert, begann die Jette zu weinen. Es war auch zu traurig, daß sie nicht einmal wußte, wer ihr Vater und Mutter gewesen war, und daß sie in dieses landfahrende Bettelleben hineingekommen war, sie wußte nicht, wie. Sie wischte sich aber mit dem Handrücken die Thränen aus den Augen und rief rasch und hartnäckig aus: "Und wenn mir och keen Mensch hat was Ordentliches lernen lassen, deshalb mag ich doch mit keinem Pennbruder gehn und für ihn betteln und dalven und schmal machen, bloß damit er faullenzen kann und eine Frau hat, die für ihn sorgt."
Sie wollte der Frau den Rücken kehren und weiter gehn, die Liese aber legte die Hand auf ihren Arm, drückte sie leise nieder und nötigte sie mit besänftigender Gebärde, daß die Dirne sich neben sie auf einen Steinhaufen am Straßengraben hinsetzte. Und mit sanftem, etwas wehleidigem Tone erklärte sie: "Ja, das ist nun 'mal so, Jette. Du wirst doch wohl diese Welt nicht ändern und bessern wollen, welche nun 'mal so eingerichtet ist, daß die armen Schicksen eben auch einen Mann brauchen. "Denn er soll dein Herr sein!" sagte sie mit Feierlichkeit. "Und siehst du, Jette, wenn du nun mit so einem Mann gehst, der dir gut ist und dir in allen Ehren, ohne Trauschein, heiratet, gloobst du denn nicht, daß es auch ein Trost ist, wenn du den ganzen Tag bei mitleidigen Menschen gebettelt hast, und wenn du dich dann mit ihm hinter'm Dorfe ins Korn setzest. Da packst du denn deinen Bettelkorb aus und teilst mit ihm, was du bekommen hast, denn wohlzuthun und mitzuteilen, Menschen, das vergesset nicht. Und wenn du siehst, wie's ihm dann gut schmeckt, deinem eigenen Manne, der wie du kein Haus, keine eigene Stube, kein Bett, kein gar nichts hat, als bloß das nackte Leben wie die Wölfe im Walde, wo's noch welche giebt, das ist auch ein Trost für eine arme Frau. Und wenn ihr dann 'mal Kinder habt, siehst du, da geht ja det Geschäft noch viel besser, da haben die Bauerfrauen und Frauen in der Stadt doch gleich mehr Mitleid, wenn du mit so 'nem kleenen Stammhalter kommst, der deine Familie 'mal weiterführen kann. Na, und darum sag ich, stoß ihn nicht zurück, Jette, der Herr Sorger ist ein adretter Mann. Oberkellner ist er gewesen, wie er noch 'n anständiger Mensch war, und ist bloß so weit heruntergekommen, weil er in seinem Hotel in Berlin den reichen Herrn immer so viel Jeld gepumpt hat, wenn sie Hazard spielten. Sie habens ihm aber nicht wiedergegeben, und dann hat er selber mitgespielt und ist in Schulden geraten, bis sie ihn an die Luft gesetzt haben. Und eine Stellung hat er ooch nicht bekommen, weil sie in einem Auskunftsbureau seitdem nur schlechte Auskünfte über ihn gegeben haben, und da hat er eines Tages 'nen Raptus gekriegt und gesagt: "Jetzt thu ich auch nicht mehr mit." Und da hat er sich ganz einfach aufs Walzen verlegt, um Stellung auf dem Lande zu suchen, na, und weil er eingesehen hat, daß man als freier Fechtbruder eben auch noch sein anständiges Auskommen hat, ist er bei der Ausklopferei geblieben. Und so 'nen vornehmen Mann, der so 'ne tadellose Vergangenheit hat, kriegst du nicht wieder, darum, Jette, überleg dir's."
Mit gespannten Ohren hatte Hans hinter seiner Buche dieses lautgeführte Gespräch angehört. Jedes Wort prägte er sich mit einer gewissen freudigen, wissenschaftlichen Genugthuung ein. Das war ja ein Abgrund von Zuständen, der sich ihm in einem Augenblicke aufschloß. Welche Schlüsse mußte man aus diesem harmlosen Frauengespräche thun. In seine Genugthuung mischte sich aber zugleich ein tiefes Mitleid mit dem armen jungen Mädchen, das man augenscheinlich zu einer Verbindung zu bereden suchte, die ihm zuwider war, und als er gar an den Unbekannten dachte, für den die Frau das obdachlose Waisenkind zu werben suchte, mischte sich in sein herzliches Mitleid sogar eine gewisse Eifersucht. Er überlegte eben, ob er seinen Lauscherplatz aufgeben sollte, um sich ins Gespräch zu mischen, als die ältere Frau auf einmal ausrief: "Jette, sieh nur, da kommt er sogar selber. Ich will dir's nur sagen, ich hab's mit ihm ausgemacht, daß wir uns hier begegnen wollten, ehe wir in unsre Schicksenpenne fahren."
In der That kam von der andren Richtung der Straße her der Kellner gegangen, welcher am Morgen in der Herberge durch die Beschimpfung "Apoll bei einem Satyr" sich so tief beleidigt gefühlt hatte. Er hatte jetzt aber keinen Frack, sondern einen Rock an, den er sich durch ein Tauschgeschäft im Laufe des Vormittags bei einem andren Kunden erobert hatte. Ein ziemlich schäbiger Cylinder, dessen Deckel etwas nach der Seite eingeknickt war, zierte sein Haupt. Er hielt ein großes Bouquet in der Hand mit einer vergilbten Papiermanschette darunter, verneigte sich, indem er vollends herankam, vor der Jette, und sagte mit den Mienen und Gebärden des ehemaligen Weltmannes:
"Na, schöne Jette, erlauben Sie mir, daß ich die Jelegenheit benütze, Ihnen in aller Form zur Begründung eines gemeinsamen Hausstandes meine allerschönste Aufwartung zu machen. Das Bouquet ist von einer Theaterprimadonna dahinten in Neustadt; ich habe sie eigens darum angehauen."
Er wollte ihr mit einer anständigen Verneigung den Strauß überreichen. Die Jette, der wohl zum erstenmal in ihrem Leben ein Strauß angeboten wurde, machte einen raschen Griff auf denselben los, ließ aber mitten in dieser Bewegung ihre Hand sinken und blickte unschlüssig vor sich nieder und sagte: "Ach, nee doch."
"Na Jette nimm's nur. Du brauchst dir nicht zu schämen. Der Herr Sorger ist ein solider Mann, wenn der auf die Fahrt steigt, da bringt er schwere Miete heim." Die Liese warf dabei dem Fechtbruder einen verständnisvollen Blick zu.
Jette aber stand mit einem Gesicht da, in dem sich Widerwillen und Traurigkeit mischten. "Ach nee, ach nee," wiederholte sie, "und ich mag doch nicht. Die Blumen sind ja alle schon fast verwelkt – ach, ich bin so traurig."
In der That waren schon viele Blumen halb gebleicht, und die Blütenblätter hingen schlaff und faltig nieder. Das Bouquet mochte wohl von einem Offizier der Garnison der Dame vom Theater geschenkt worden sein im frischen Zustande, bis sie dem hausierenden Kellner es abgetreten hatte in dieser Gestalt. Sorger schien das aber nicht zu bemerken. Er putzte ein paar von den verwelkten Blättchen aus dem Gebinde heraus und meinte eifrig: "Nee, nee, Jette, sie sind noch nicht verwelkt; ich hab sie auch noch'n bisken gespritzt da oben am Quell; siehst du, hier ist eine ganz frische Kamelie, wo die Kamele in der Wüste Sahara fressen in ihrem Durst, und die Rose ist auch noch wie neu hier – und wenn ich mal irgend wo einen verlorenen Ring oder eine Brosche finde, denn geb ich sie dir nachträglich als Hochzeitsgeschenk –"
"Und ich will nicht, ich will nicht!" rief dagegen die Jette ganz aufgeregt aus. "Ich will ein anständiges Mächen bleiben; ich will fort aus dem Leben; ich will eine anständige Frau bleiben."





























