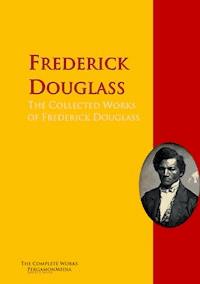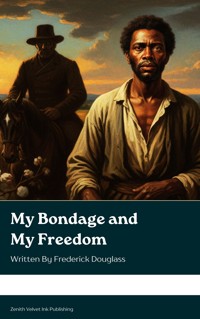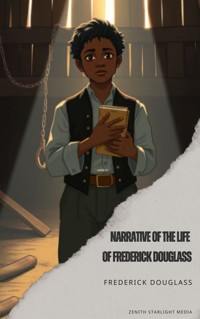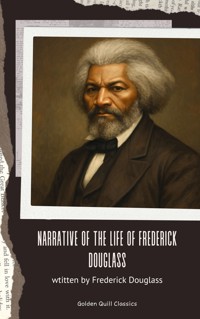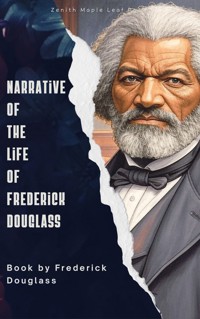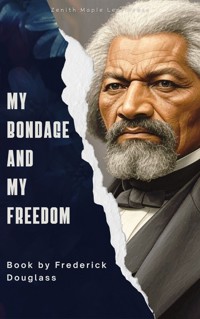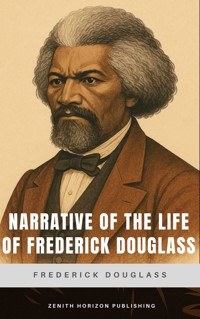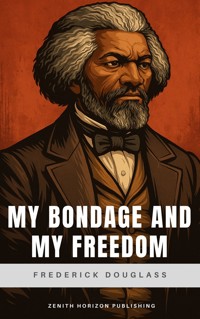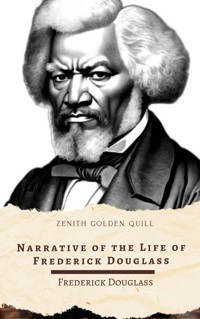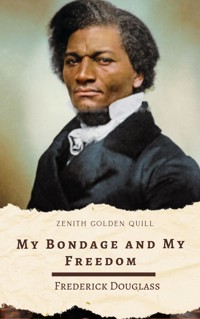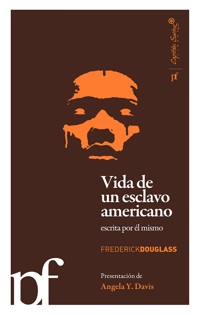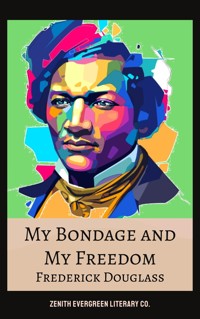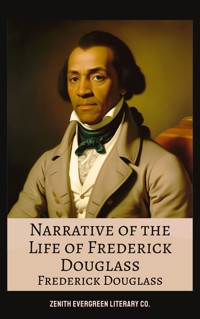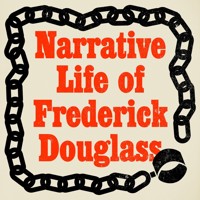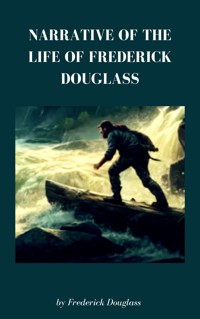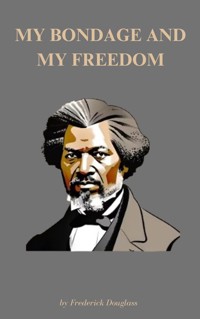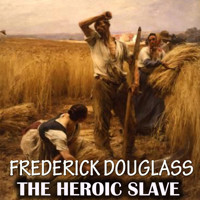Das Leben des Frederick Douglass, ein amerikanischer Sklave & Meine Knechtschaft und meine Freiheit E-Book
Frederick Douglass
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In 'Das Leben des Frederick Douglass, ein amerikanischer Sklave & Meine Knechtschaft und meine Freiheit' präsentiert Frederick Douglass eine eindringliche und bewegende Erzählung seiner Erfahrungen als Sklave und seiner anschließenden Flucht in die Freiheit. Geschrieben mit einer lebendigen und bildreichen Sprache, bietet das Werk nicht nur einen persönlichen Einblick in die Grausamkeiten der Sklaverei, sondern stellt auch Douglass' Entwicklung als Schriftsteller und Denker dar. Der literarische Stil und Kontext dieser Autobiographie platzieren sie fest in den Kanon der amerikanischen Literatur und der Abolitionistenbewegung des 19. Jahrhunderts. Frederick Douglass (1818–1895) lebte als Sklave in Maryland, bevor er die Fesseln der Knechtschaft abwarf und zu einem der bedeutendsten Abolitionisten, Schriftsteller und Redner seiner Zeit wurde. Seine eigenen Erfahrungen mit Unterdrückung und sein unnachgiebiger Drang nach Gerechtigkeit und Bildung führten ihn dazu, sein Leben und seine Freiheit in diesen ergreifenden Autobiographien zu dokumentieren. Dieses Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die ein tieferes Verständnis der amerikanischen Geschichte, der Literatur und des unermüdlichen Kampfes für Freiheit und Gleichheit suchen. Douglass' Werk bleibt nicht nur ein wichtiges historisches Dokument, sondern auch eine Quelle der Inspiration und ein Aufruf zu Gerechtigkeit und Menschlichkeits. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Das Leben des Frederick Douglass, ein amerikanischer Sklave & Meine Knechtschaft und meine Freiheit
Inhaltsverzeichnis
Das Leben des Frederick Douglass, ein amerikanischer Sklave
KAPITEL I
Ich wurde in Tuckahoe geboren, in der Nähe von Hillsborough und etwa zwölf Meilen von Easton entfernt, in Talbot County, Maryland. Ich weiß nicht genau, wie alt ich bin, denn ich habe nie eine authentische Aufzeichnung darüber gesehen. Der weitaus größte Teil der Sklaven weiß so wenig über ihr Alter, wie die Pferde über ihr Alter wissen, und es ist der Wunsch der meisten mir bekannten Herren, ihre Sklaven so unwissend zu halten. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Sklaven getroffen zu haben, der seinen Geburtstag kannte. Sie kommen ihm selten näher als zur Zeit der Aussaat, der Ernte, der Kirschen, des Frühlings oder des Herbstes. Das Fehlen von Informationen über meinen eigenen Geburtstag war schon in meiner Kindheit eine Quelle des Unglücks für mich. Die weißen Kinder konnten ihr Alter sagen. Ich konnte nicht erkennen, warum mir dieses Privileg vorenthalten werden sollte. Es war mir nicht erlaubt, meinen Herrn darüber zu befragen. Er hielt alle derartigen Erkundigungen eines Sklaven für unangemessen und unverschämt und für ein Zeichen eines ruhelosen Geistes. Nach der nächsten Schätzung, die ich abgeben kann, bin ich jetzt zwischen siebenundzwanzig und achtundzwanzig Jahre alt. Ich komme darauf, weil ich von meinem Herrn gehört habe, dass ich irgendwann im Jahr 1835 etwa siebzehn Jahre alt war.
Meine Mutter hieß Harriet Bailey. Sie war die Tochter von Isaac und Betsey Bailey, beide Schwarze, und ziemlich dunkel. Meine Mutter hatte einen dunkleren Teint als meine Großmutter oder mein Großvater.
Mein Vater war ein weißer Mann. Alle, die ich je über meine Abstammung sprechen hörte, gaben zu, dass er ein Weißer war. Es wurde auch die Meinung geflüstert, dass mein Herr mein Vater sei; aber von der Richtigkeit dieser Meinung weiß ich nichts; die Mittel, es herauszufinden, wurden mir vorenthalten. Meine Mutter und ich wurden getrennt, als ich noch ein Säugling war - noch bevor ich sie als meine Mutter kannte. In dem Teil von Maryland, aus dem ich weggelaufen bin, ist es üblich, dass sich Kinder schon sehr früh von ihren Müttern trennen. Häufig wird dem Kind, bevor es den zwölften Monat erreicht hat, die Mutter weggenommen und auf einer Farm in beträchtlicher Entfernung verdingt, während das Kind in die Obhut einer alten Frau gegeben wird, die zu alt für die Feldarbeit ist. Warum diese Trennung erfolgt, weiß ich nicht, es sei denn, um die Entwicklung der Zuneigung des Kindes zu seiner Mutter zu behindern und die natürliche Zuneigung der Mutter zu ihrem Kind abzustumpfen und zu zerstören. Das ist die unvermeidliche Folge.
Ich habe meine Mutter, um sie als solche kennenzulernen, nie mehr als vier oder fünf Mal in meinem Leben gesehen; und jedes Mal war es nur von kurzer Dauer und nachts. Sie war bei einem Herrn Stewart angestellt, der etwa zwölf Meilen von meinem Haus entfernt wohnte. Sie reiste nachts zu mir und legte die gesamte Strecke zu Fuß zurück, nachdem sie ihr Tagwerk verrichtet hatte. Sie war eine Feldarbeiterin, und eine Auspeitschung ist die Strafe dafür, bei Sonnenaufgang nicht auf dem Feld zu sein, es sei denn, ein Sklave hat eine gegenteilige Erlaubnis von seinem Herrn - eine Erlaubnis, die er nur selten bekommt und die ihm den stolzen Namen eines gütigen Herrn einbringt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich meine Mutter jemals bei Tageslicht gesehen habe. In der Nacht war sie bei mir. Sie legte sich zu mir und brachte mich zum Einschlafen, aber lange bevor ich aufwachte, war sie weg. Zwischen uns gab es nur sehr wenig Kommunikation. Der Tod beendete bald das Wenige, das wir haben konnten, solange sie lebte, und mit ihm ihre Nöte und ihr Leiden. Sie starb, als ich etwa sieben Jahre alt war, auf einer der Farmen meines Herrn, in der Nähe von Lees Mühle. Ich durfte weder während ihrer Krankheit noch bei ihrem Tod oder ihrer Beerdigung anwesend sein. Sie war schon lange tot, bevor ich irgendetwas davon mitbekam. Da ich ihre wohltuende Gegenwart, ihre zärtliche und wachsame Fürsorge nie in nennenswertem Umfang genossen hatte, nahm ich die Nachricht von ihrem Tod mit denselben Gefühlen auf, die ich wohl auch beim Tod eines Fremden empfunden hätte.
Sie wurde so plötzlich abberufen und ließ mich ohne die geringste Andeutung, wer mein Vater war. Das Geflüster, dass mein Herr mein Vater sei, mag wahr sein oder nicht; und ob es wahr ist oder nicht, ist für mein Vorhaben von geringer Bedeutung, solange die Tatsache in ihrer ganzen Abscheulichkeit bestehen bleibt, dass Sklavenhalter angeordnet und per Gesetz festgelegt haben, dass die Kinder von Sklavinnen in jedem Fall dem Zustand ihrer Mütter folgen sollen; und dies geschieht nur zu offensichtlich, um ihre eigenen Begierden zu befriedigen und die Befriedigung ihrer bösen Begierden sowohl profitabel als auch angenehm zu machen. Denn durch diese schlaue Anordnung erhält der Sklavenhalter in nicht wenigen Fällen für seine Sklaven die doppelte Beziehung von Herr und Vater aufrecht.
Ich kenne solche Fälle, und es ist erwähnenswert, dass solche Sklaven ausnahmslos größere Härten erleiden und mehr zu kämpfen haben als andere. In erster Linie sind sie ein ständiges Ärgernis für ihre Herrin. Sie ist stets geneigt, sie zu tadeln; sie können selten etwas tun, was ihr gefällt. Sie ist nie zufriedener, als wenn sie sie unter der Peitsche sieht, besonders wenn sie ihren Mann verdächtigt, seinen Mulattenkindern Gefallen zu erweisen, die er seinen schwarzen Sklaven vorenthält. Der Herr ist häufig gezwungen, diese Klasse seiner Sklaven zu verkaufen, aus Rücksicht auf die Gefühle seiner weißen Frau. Und so grausam die Tat auch erscheinen mag, wenn ein Mann seine eigenen Kinder an Menschenhändler verkauft, so ist es doch oft das Gebot der Menschlichkeit, dass er dies tut; Denn wenn er dies nicht tut, muss er sie nicht nur selbst auspeitschen, sondern auch zusehen, wie ein weißer Sohn seinen Bruder, der nur wenige Nuancen dunkler ist als er selbst, fesselt und mit der blutigen Peitsche auf den nackten Rücken schlägt. Und wenn er auch nur ein Wort der Missbilligung lispelt, wird das auf seine elterliche Parteilichkeit zurückgeführt und macht eine schlimme Sache nur noch schlimmer, sowohl für ihn selbst als auch für den Sklaven, den er schützen und verteidigen wollte.
Jedes Jahr gibt es eine Vielzahl von Sklaven dieser Art. Zweifellos hat ein großer Staatsmann des Südens im Wissen um diese Tatsache den Untergang der Sklaverei durch die unvermeidlichen Gesetze der Bevölkerung vorausgesagt. Unabhängig davon, ob sich diese Prophezeiung jemals erfüllen wird oder nicht, ist es doch offensichtlich, dass im Süden eine ganz andere Klasse von Menschen heranwächst, die jetzt in Sklaverei gehalten wird, als die, die ursprünglich aus Afrika in dieses Land gebracht wurden. Wenn nur die direkten Nachkommen Hams nach der Schrift versklavt werden sollen, ist es sicher, dass die Sklaverei im Süden bald unbiblisch werden muss. Denn jedes Jahr kommen Tausende auf die Welt, die wie ich ihre Existenz weißen Vätern verdanken, und diese Väter sind meistens ihre eigenen Herren.
Ich habe zwei Herren gehabt. Der Name meines ersten Herrn war Anthony. An seinen Vornamen erinnere ich mich nicht mehr. Man nannte ihn allgemein Kapitän Anthony - ein Titel, den er, wie ich annehme, durch das Segeln eines Schiffes in der Chesapeake Bay erworben hatte. Er galt nicht als reicher Sklavenhalter. Er besaß zwei oder drei Farmen und etwa dreißig Sklaven. Seine Farmen und Sklaven standen unter der Obhut eines Aufsehers. Der Name des Aufsehers war Plummer. Herr Plummer war ein elender Trunkenbold, ein lästerlicher Flucher und ein wildes Ungeheuer. Er war immer mit einem Kuhfell und einem schweren Knüppel bewaffnet. Ich habe ihn erlebt, wie er den Frauen so grausam die Köpfe abschnitt und aufschlitzte, dass sogar der Herr über seine Grausamkeit wütend wurde und ihm drohte, ihn auszupeitschen, wenn er sich nicht beherrschen würde. Der Herr war jedoch kein humaner Sklavenhalter. Es bedurfte schon außergewöhnlicher Barbarei seitens eines Aufsehers, um ihn zu verletzen. Er war ein grausamer Mann, abgehärtet durch ein langes Leben als Sklavenhalter. Manchmal schien es ihm großen Spaß zu machen, einen Sklaven auszupeitschen. Ich wurde oft bei Tagesanbruch von den herzzerreißenden Schreien einer meiner Tanten geweckt, die er an einen Balken fesselte und auf ihren nackten Rücken peitschte, bis sie buchstäblich mit Blut bedeckt war. Kein Wort, keine Träne, kein Gebet seines blutigen Opfers schien sein eisernes Herz von seinem blutigen Vorhaben abzubringen. Je lauter sie schrie, desto härter peitschte er, und wo das Blut am schnellsten floss, da peitschte er am längsten. Er peitschte sie aus, um sie zum Schreien zu bringen, und er peitschte sie aus, um sie zum Schweigen zu bringen, und er hörte erst auf, das blutverschmierte Kuhfell zu schwingen, als ihn die Müdigkeit übermannte. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich Zeuge dieser schrecklichen Vorführung wurde. Ich war noch ein Kind, aber ich erinnere mich gut daran. Ich werde es nie vergessen, solange ich mich an irgendetwas erinnern kann. Es war die erste einer langen Reihe solcher Schandtaten, bei denen ich dazu verdammt war, Zeuge und Teilnehmer zu sein. Es traf mich mit furchtbarer Wucht. Es war das blutbefleckte Tor, der Eingang zur Hölle der Sklaverei, durch das ich gleich gehen würde. Es war ein schrecklicher Anblick. Ich wünschte, ich könnte die Gefühle zu Papier bringen, mit denen ich es sah.
Dieses Ereignis ereignete sich sehr bald nachdem ich zu meinem alten Herrn gezogen war, und zwar unter folgenden Umständen. Tante Hester ging eines Abends aus - wohin oder wozu, weiß ich nicht - und war zufällig abwesend, als mein Herr ihre Anwesenheit wünschte. Er hatte ihr befohlen, abends nicht auszugehen, und sie gewarnt, sie dürfe sich niemals in Gesellschaft eines jungen Mannes erwischen lassen, der auf ihre Zugehörigkeit zu Oberst Lloyd achtete. Der Name des jungen Mannes war Ned Roberts, allgemein Lloyds Ned genannt. Warum der Herr so vorsichtig mit ihr war, kann man nur vermuten. Sie war eine Frau von edler Gestalt und anmutigen Proportionen, die in ihrer persönlichen Erscheinung unter den schwarzen oder weißen Frauen unserer Nachbarschaft kaum ihresgleichen hatte und noch weniger eine Vorgesetzte.
Tante Hester hatte nicht nur seine Befehle missachtet, als sie ausging, sondern war auch in Begleitung von Lloyds Ned angetroffen worden, was, wie ich aus seinen Worten während der Auspeitschung entnehmen konnte, das Hauptvergehen war. Wäre er selbst ein Mann von reiner Moral gewesen, hätte man meinen können, er sei daran interessiert, die Unschuld meiner Tante zu schützen; aber diejenigen, die ihn kannten, werden ihn keiner solchen Tugend verdächtigen. Bevor er mit der Auspeitschung von Tante Hester begann, nahm er sie mit in die Küche und zog sie vom Hals bis zur Taille aus, so dass ihr Nacken, ihre Schultern und ihr Rücken völlig nackt waren. Und dann forderte er sie auf, die Hände zu kreuzen und nannte sie gleichzeitig eine d--d b--h. Nachdem er ihre Hände gekreuzt hatte, fesselte er sie mit einem starken Seil und führte sie zu einem Hocker unter einem großen Haken, der zu diesem Zweck in den Balken eingelassen war. Er ließ sie auf den Schemel steigen und fesselte ihre Hände an den Haken. Nun stand sie für seine höllischen Absichten bereit. Ihre Arme waren ganz nach oben gestreckt, so dass sie auf den Zehenspitzen stand. Und dann sagte er zu ihr: 'Jetzt, du verdammte Schlampe, werde ich dir beibringen, wie man meine Befehle missachtet!' Und nachdem er seine Ärmel hochgekrempelt hatte, begann er, das schwere Kuhfell aufzulegen, und bald tropfte das warme, rote Blut (unter herzzerreißenden Schreien von ihr und schrecklichen Flüchen von ihm) auf den Boden. Ich war so erschrocken und entsetzt über diesen Anblick, dass ich mich in einem Schrank versteckte und mich erst wieder herauswagte, als der blutige Vorgang längst vorüber war. Ich erwartete, dass ich als nächstes an der Reihe sein würde. Das war alles neu für mich. Ich hatte so etwas noch nie zuvor gesehen. Ich hatte immer mit meiner Großmutter am Rande der Plantage gelebt, wo sie die Kinder der jüngeren Frauen aufziehen musste. Daher war ich den blutigen Szenen, die sich oft auf der Plantage abspielten, bis jetzt aus dem Weg gegangen.
KAPITEL II
Die Familie meines Herrn bestand aus zwei Söhnen, Andrew und Richard; einer Tochter, Lucretia, und ihrem Ehemann, Kapitän Thomas Auld. Sie lebten in einem Haus auf der Heimplantage von Oberst Edward Lloyd. Mein Herr war der Schreiber und Aufseher von Oberst Lloyd. Er war das, was man den Aufseher der Aufseher nennen könnte. Ich verbrachte zwei Jahre meiner Kindheit auf dieser Plantage in der Familie meines alten Herrn. Hier war es, dass ich das blutige Ereignis, das im ersten Kapitel aufgezeichnet ist, miterlebte; und da ich meine ersten Eindrücke von der Sklaverei auf dieser Plantage erhielt, werde ich eine Beschreibung davon und der dort herrschenden Sklaverei geben. Die Plantage liegt etwa zwölf Meilen nördlich von Easton im Talbot County und befindet sich am Ufer des Miles Flusses. Die Hauptprodukte, die dort angebaut wurden, waren Tabak, Mais und Weizen. Diese wurden in großer Fülle angebaut; so dass er mit den Produkten dieser und der anderen ihm gehörenden Farmen in der Lage war, ein großes Segelschiff fast ständig zu beschäftigen, um sie zum Markt nach Baltimore zu transportieren. Dieses Segelschiff hieß Sally Lloyd, zu Ehren einer der Töchter des Obersts. Der Schwiegersohn meines Herrn, Kapitän Auld, war der Kapitän des Schiffes; es wurde ansonsten von den eigenen Sklaven des Obersts bemannt. Ihre Namen waren Peter, Isaac, Rich und Jake. Diese wurden von den anderen Sklaven sehr hoch geschätzt und als die Privilegierten der Plantage angesehen; denn es war keine kleine Angelegenheit in den Augen der Sklaven, nach Baltimore sehen zu dürfen.
Oberst Lloyd hielt drei- bis vierhundert Sklaven auf seiner eigenen Plantage und besaß eine große Anzahl weiterer Sklaven auf den benachbarten Farmen, die ihm gehörten. Die Namen der Farmen, die der Heimplantage am nächsten lagen, waren Wye Town und New Design. Wye Town' stand unter der Aufsicht eines Mannes namens Noah Willis. New Design stand unter der Aufsicht eines Herrn Townsend. Die Aufseher dieser und aller anderen Farmen, von denen es mehr als zwanzig gab, wurden von den Managern der Heimplantage beraten und angeleitet. Dies war der große Handelsplatz. Es war der Sitz der Regierung für alle zwanzig Farmen. Alle Streitigkeiten zwischen den Aufsehern wurden hier geschlichtet. Wurde ein Sklave wegen eines schweren Vergehens verurteilt, wurde er unbeherrschbar oder zeigte er die Absicht zu fliehen, wurde er sofort hierher gebracht, schwer ausgepeitscht, an Bord der Schaluppe gebracht, nach Baltimore gebracht und an Austin Woolfolk oder einen anderen Sklavenhändler verkauft, als Warnung für die übrigen Sklaven.
Hier erhielten auch die Sklaven aller anderen Farmen ihr monatliches Taschengeld und ihre jährliche Kleidung. Die männlichen und weiblichen Sklaven erhielten als monatliche Zuwendung acht Pfund Schweinefleisch oder den Gegenwert in Fisch und einen Scheffel Maismehl. Ihre jährliche Kleidung bestand aus zwei groben Leinenhemden, einer Leinenhose, wie die Hemden, einer Jacke, einer Winterhose aus grobem Negerstoff, einem Paar Strümpfen und einem Paar Schuhen, die insgesamt nicht mehr als sieben Dollar gekostet haben dürften. Das Taschengeld für die Sklavenkinder wurde ihren Müttern oder den alten Frauen, die sich um sie kümmerten, übergeben. Die Kinder, die nicht auf dem Feld arbeiten konnten, bekamen weder Schuhe, Strümpfe, Jacken noch Hosen; ihre Kleidung bestand aus zwei groben Leinenhemden pro Jahr. Wenn diese versagten, blieben sie bis zum nächsten Tag nackt. Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren, beiderlei Geschlechts, könnte man zu jeder Jahreszeit fast nackt sehen.
Es gab keine Betten für die Sklaven, es sei denn, man betrachtet eine grobe Decke als solche, und außer den Männern und Frauen hatten sie keine. Dies wird jedoch nicht als sehr große Entbehrung angesehen. Sie haben weniger Probleme mit dem Fehlen von Betten als mit der fehlenden Zeit zum Schlafen. Denn wenn ihre Tagesarbeit auf dem Feld getan ist, die meisten von ihnen ihre Wäsche waschen, flicken und kochen müssen und nur wenige oder keine der üblichen Möglichkeiten haben, dies zu tun, werden sehr viele ihrer Schlafstunden damit verbracht, sich für den nächsten Tag auf dem Feld vorzubereiten; Und wenn das erledigt ist, legen sich Alte und Junge, Männer und Frauen, Verheiratete und Ledige nebeneinander auf ein gemeinsames Bett - den kalten, feuchten Boden - und decken sich jeweils mit ihren armseligen Decken zu. Hier schlafen sie, bis sie durch das Horn des Kutschers auf das Feld gerufen werden. Wenn das Horn ertönt, müssen alle aufstehen und sich auf den Weg zum Feld machen. Es darf kein Halten geben, jeder muss auf seiner Position sein. Und wehe dem, der diesen morgendlichen Ruf zum Feld nicht hört, denn wenn er nicht durch den Hörsinn geweckt wird, dann durch den Gefühlssinn: kein Alter und kein Geschlecht findet Gefallen daran. Herr Severe, der Aufseher, pflegte an der Tür des Quartiers zu stehen, bewaffnet mit einem großen Hickory-Stock und einem schweren Kuhfell, bereit, jeden auszupeitschen, der so unglücklich war, nicht zu hören oder aus irgendeinem anderen Grund daran gehindert wurde, beim Ertönen des Horns zum Aufbruch ins Feld bereit zu sein.
Herr Severe trug seinen Namen zu Recht: Er war ein grausamer Mann. Ich habe gesehen, wie er eine Frau auspeitschte, so dass ihr eine halbe Stunde lang das Blut in Strömen floss, und das inmitten ihrer weinenden Kinder, die um die Freilassung ihrer Mutter flehten. Es schien ihm Spaß zu machen, seine teuflische Barbarei zu demonstrieren. Zu seiner Grausamkeit kam noch hinzu, dass er ein Gotteslästerer war. Es reichte aus, um einem normalen Mann das Blut in den Adern gefrieren und die Haare sträuben zu lassen, wenn er sprach. Kaum ein Satz entging ihm, der nicht mit einem grausamen Schwur eingeleitet oder abgeschlossen wurde. Das Feld war der Ort, an dem er seine Grausamkeit und Gotteslästerung bezeugte. Seine Anwesenheit machte es sowohl zum Feld des Blutes als auch der Gotteslästerung. Vom Aufgang bis zum Untergang der Sonne fluchte, tobte, schnitt und schlitzte er die Sklaven auf dem Feld auf die schrecklichste Weise auf. Seine Karriere war kurz. Er starb, kurz nachdem ich zu Oberst Lloyd gegangen war, und er starb, wie er gelebt hatte, indem er im Sterben bittere Flüche und grausame Verwünschungen ausstieß. Sein Tod wurde von den Sklaven als das Ergebnis einer gnädigen Fügung angesehen.
Der Platz von Herrn Severe wurde von einem Herrn Hopkins eingenommen. Er war ein ganz anderer Mann. Er war weniger grausam, weniger gottlos und machte weniger Lärm als Herr Severe. Sein Vorgehen war nicht durch außergewöhnliche Demonstrationen von Grausamkeit gekennzeichnet. Er peitschte, schien aber kein Vergnügen daran zu haben. Die Sklaven nannten ihn einen guten Aufseher.
Die Heimatplantage von Oberst Lloyd hatte das Aussehen eines Dorfes auf dem Land. Alle mechanischen Arbeiten für alle Farmen wurden hier ausgeführt. Das Schuhmachen und -flicken, das Schmieden, das Wagenbauen, das Böttchern, das Weben und das Mahlen von Getreide wurden alle von den Sklaven auf der Heimatplantage durchgeführt. Der ganze Ort hatte einen geschäftsmäßigen Aspekt, der sich sehr von den benachbarten Farmen unterschied. Auch die Anzahl der Häuser trug dazu bei, ihm einen Vorteil gegenüber den benachbarten Farmen zu verschaffen. Es wurde von den Sklaven die Große Hausfarm genannt. Wenige Privilegien wurden von den Sklaven der Außenfarmen höher geschätzt, als das, für Besorgungen auf der Großen Hausfarm ausgewählt zu werden. Es war in ihren Köpfen mit Größe verbunden. Ein Abgeordneter könnte nicht stolzer auf seine Wahl in den amerikanischen Kongress sein, als ein Sklave auf einer der Außenfarmen auf seine Wahl, Besorgungen auf der Großen Hausfarm zu machen. Sie betrachteten es als Beweis des großen Vertrauens, das ihre Aufseher in sie setzten; und es war aus diesem Grund, sowie aus dem ständigen Wunsch, dem Feld und der Peitsche des Treibers zu entkommen, dass sie es als ein hohes Privileg ansahen, für das es sich lohnte, sorgfältig zu leben. Derjenige wurde als der klügste und vertrauenswürdigste Kerl bezeichnet, dem diese Ehre am häufigsten zuteil wurde. Die Bewerber um dieses Amt bemühten sich ebenso eifrig, ihre Aufseher zu erfreuen, wie die Amtssucher in den politischen Parteien sich bemühen, das Volk zu erfreuen und zu täuschen. Die gleichen Charakterzüge konnten bei Oberst Lloyds Sklaven gesehen werden, wie sie bei den Sklaven der politischen Parteien zu sehen sind.
Die Sklaven, die ausgewählt wurden, um zur Großes Haus Farm zu gehen, um dort die monatliche Vergütung für sich und ihre Mitsklaven zu erhalten, waren besonders enthusiastisch. Auf dem Weg dorthin brachten sie die dichten alten Wälder meilenweit mit ihren wilden Liedern zum Klingen, die gleichzeitig höchste Freude und tiefste Traurigkeit ausdrückten. Sie komponierten und sangen, während sie weitergingen, ohne Rücksicht auf Zeit oder Melodie. Der Gedanke, der aufkam, kam heraus - wenn nicht im Wort, so doch im Klang - und zwar genauso häufig im einen wie im anderen. Manchmal sangen sie das pathetischste Gefühl im schwärmerischsten Ton und das schwärmerischste Gefühl im pathetischsten Ton. In all ihren Liedern verwoben sie etwas von der Großes Haus Bauernhof. Das taten sie vor allem, wenn sie das Haus verließen. Dann sangen sie voller Freude die folgenden Worte:-
Ich gehe weg zur Großes Haus Bauernhof! Oh, ja! O, ja! O!'
Dies sangen sie im Chor zu Worten, die für viele wie ein unbedeutender Jargon erscheinen würden, die aber für sie selbst voller Bedeutung waren. Ich habe manchmal gedacht, dass das bloße Hören dieser Lieder mehr dazu beiträgt, einigen Menschen den schrecklichen Charakter der Sklaverei vor Augen zu führen, als es die Lektüre ganzer Bände der Philosophie zu diesem Thema vermag.
Als Sklave habe ich die tiefe Bedeutung dieser rohen und scheinbar zusammenhanglosen Lieder nicht verstanden. Ich befand mich selbst innerhalb des Kreises, so dass ich weder sehen noch hören konnte, was die Außenstehenden sehen und hören könnten. Sie erzählten eine Leidensgeschichte, die damals jenseits meines schwachen Verständnisses lag; es waren laute, lange und tiefe Töne; sie atmeten das Gebet und die Klage von Seelen, die vor bitterster Qual überkochten. Jeder Ton war ein Zeugnis gegen die Sklaverei und ein Gebet zu Gott um Befreiung von den Ketten. Das Hören dieser wilden Töne hat meinen Geist immer niedergedrückt und mich mit unbeschreiblicher Traurigkeit erfüllt. Ich war oft in Tränen aufgelöst, wenn ich sie hörte. Die bloße Erinnerung an diese Lieder betrübt mich auch jetzt noch, und während ich diese Zeilen schreibe, ist mir bereits ein Ausdruck des Gefühls über die Wange gelaufen. Ich verdanke diesen Liedern meine erste schimmernde Vorstellung von dem entmenschlichenden Charakter der Sklaverei. Diese Vorstellung werde ich nie wieder los. Diese Lieder verfolgen mich noch immer, um meinen Hass auf die Sklaverei zu vertiefen und mein Mitgefühl für meine Brüder in Fesseln zu wecken. Wenn jemand einen Eindruck von den seelentötenden Auswirkungen der Sklaverei bekommen möchte, dann sollte er zu Oberst Lloyds Plantage gehen und sich am Tag der Erlaubnis in die tiefen Kiefernwälder begeben und dort in aller Stille die Geräusche analysieren, die durch die Kammern seiner Seele dringen - und wenn er nicht beeindruckt ist, dann nur, weil 'kein Fleisch in seinem verstockten Herzen ist'.
Seit ich in den Norden gekommen bin, habe ich oft mit Erstaunen festgestellt, dass es Menschen gibt, die den Gesang der Sklaven als Beweis für ihre Zufriedenheit und ihr Glück bezeichnen. Ein größerer Irrtum ist nicht vorstellbar. Sklaven singen am meisten, wenn sie am unglücklichsten sind. Die Lieder der Sklaven stehen für die Sorgen ihres Herzens, und sie lindern sie, so wie ein schmerzendes Herz durch seine Tränen gelindert wird. Zumindest ist das meine Erfahrung. Ich habe oft gesungen, um meinen Kummer zu ertränken, aber nur selten, um meine Freude auszudrücken. Vor Freude zu weinen und vor Freude zu singen, war für mich in der Sklaverei gleichermaßen ungewöhnlich. Der Gesang eines Mannes, der auf eine einsame Insel verbannt wurde, könnte ebenso als Beweis für Zufriedenheit und Glück angesehen werden wie der Gesang eines Sklaven; die Lieder des einen und des anderen werden durch dasselbe Gefühl ausgelöst.
KAPITEL III
Oberst Lloyd unterhielt einen großen und fein kultivierten Garten, der neben dem Chefgärtner (Herrn M'Durmond) vier Männern fast ständig Beschäftigung bot. Dieser Garten war wahrscheinlich die größte Attraktion des Ortes. Während der Sommermonate kamen die Leute von nah und fern - aus Baltimore, Easton und Annapolis - um ihn zu sehen. Er war reich an Früchten fast jeder Art, vom widerstandsfähigen Apfel aus dem Norden bis zur zarten Orange aus dem Süden. Dieser Garten war nicht der geringste Grund für Ärger auf der Plantage. Seine exzellenten Früchte waren eine große Versuchung für die hungrigen Schwärme von Jungen und auch für die älteren Sklaven des Obersts, von denen nur wenige die Tugend oder das Laster hatten, ihnen zu widerstehen. Während des Sommers verging kaum ein Tag, an dem nicht irgendein Sklave wegen Obstdiebstahls ausgepeitscht wurde. Der Oberst musste auf alle möglichen Tricks zurückgreifen, um seine Sklaven aus dem Garten fernzuhalten. Die letzte und erfolgreichste war die, den Zaun rundherum zu teeren. Wurde ein Sklave mit Teer erwischt, galt dies als ausreichender Beweis dafür, dass er entweder im Garten gewesen war oder versucht hatte, hineinzukommen. In jedem Fall wurde er vom obersten Gärtner schwer ausgepeitscht. Dieser Plan funktionierte gut; die Sklaven fürchteten sich vor dem Teer ebenso wie vor der Peitsche. Sie schienen zu begreifen, dass es unmöglich war, Teer zu berühren, ohne besudelt zu werden.
Der Oberst verfügte auch über eine prächtige Reitausrüstung. Sein Stall und seine Kutschenhalle sahen aus wie die einiger unserer großen städtischen Livree-Betriebe. Seine Pferde waren von feinster Form und edelstem Blut. In seinem Kutschenhaus befanden sich drei prächtige Kutschen, drei oder vier Gigs, sowie Dearborns und Barouches der modernsten Art.
Dieser Betrieb stand unter der Obhut von zwei Sklaven - dem alten Barney und dem jungen Barney, Vater und Sohn. Die Betreuung dieses Etablissements war ihre einzige Aufgabe. Aber es war keineswegs eine leichte Aufgabe, denn Oberst Lloyd war in nichts so genau wie im Umgang mit seinen Pferden. Die geringste Unachtsamkeit war unverzeihlich und wurde von denjenigen, die sich um sie kümmerten, mit härtesten Strafen geahndet. Keine Ausrede konnte sie schützen, wenn der Oberst nur den Verdacht hegte, dass er seinen Pferden keine Aufmerksamkeit schenkte - eine Vermutung, die er häufig hegte und die das Amt, Büro des alten und des jungen Barney natürlich sehr anstrengend machte. Sie wussten nie, wann sie vor einer Bestrafung sicher waren. Sie wurden häufig ausgepeitscht, wenn sie es am wenigsten verdienten, und entgingen der Peitsche, wenn sie es am meisten verdienten. Alles hing davon ab, wie die Pferde aussahen und in welchem Zustand sich Oberst Lloyd befand, wenn ihm seine Pferde zum Einsatz gebracht wurden. Wenn ein Pferd sich nicht schnell genug bewegte oder den Kopf nicht hoch genug hielt, lag das an einem Fehler seiner Pfleger. Es war schmerzhaft, in der Nähe der Stalltür zu stehen und die verschiedenen Beschwerden über die Pfleger zu hören, wenn ein Pferd zum Einsatz gebracht wurde. Dieses Pferd hat nicht die richtige Pflege bekommen. Es wurde nicht ausreichend gerieben und gestriegelt, oder es wurde nicht richtig gefüttert; sein Futter war zu nass oder zu trocken; es bekam es zu früh oder zu spät; es war zu heiß oder zu kalt; es hatte zu viel Heu und nicht genug Getreide; oder es hatte zu viel Getreide und nicht genug Heu; anstatt dass der alte Barney sich um das Pferd kümmerte, hatte er es ganz unpassend seinem Sohn überlassen.' Auf all diese Beschwerden, egal wie ungerecht sie waren, durfte der Sklave kein einziges Wort antworten. Oberst Lloyd duldete keinen Widerspruch von einem Sklaven. Wenn er sprach, musste der Sklave stehen, zuhören und zittern, und das war buchstäblich der Fall. Ich habe gesehen, wie Oberst Lloyd den alten Barney, einen Mann zwischen fünfzig und sechzig Jahren, dazu brachte, seinen kahlen Kopf zu entblößen, sich auf den kalten, feuchten Boden zu knien und mehr als dreißig Peitschenhiebe auf seine nackten und mühsam geschundenen Schultern zu erhalten. Oberst Lloyd hatte drei Söhne - Edward, Murray und Daniel - und drei Schwiegersöhne, Herr Winder, Herr Nicholson und Herr Lowndes. Sie alle lebten auf der Großes Haus Bauernhof und genossen den Luxus, die Bediensteten nach Belieben auszupeitschen, vom alten Barney bis hin zu William Wilkes, dem Kutscher. Ich habe gesehen, wie Winder einen der Hausangestellten in angemessener Entfernung von ihm stehen ließ, um ihn mit dem Ende seiner Peitsche zu berühren, und ihm bei jedem Schlag große Furchen in den Rücken schlug.
Den Reichtum von Oberst Lloyd zu beschreiben, käme fast einer Beschreibung des Reichtums von Hiob gleich. Er hielt sich zehn bis fünfzehn Hausangestellte. Man sagte, er besitze tausend Sklaven, und ich glaube, diese Schätzung entspricht durchaus der Wahrheit. Oberst Lloyd besaß so viele, dass er sie nicht erkannte, wenn er sie sah, und auch nicht alle Sklaven auf den Außenfarmen kannten ihn. Es wird von ihm berichtet, dass er eines Tages auf der Straße einem Schwarzen begegnete und ihn in der üblichen Art und Weise ansprach, wie man auf den öffentlichen Straßen des Südens mit Schwarzen spricht: 'Nun, Junge, zu wem gehörst du?' 'Zu Oberst Lloyd', antwortete der Sklave. Behandelt dich der Herr Oberst gut?' 'Nein, Herr', war die Antwort. 'Was, lässt er Sie zu hart arbeiten?' 'Ja, Herr.' 'Nun, gibt er Ihnen nicht genug zu essen?' 'Ja, Herr, er gibt mir genug, so wie es ist.'
Nachdem sich der Oberst vergewissert hatte, wohin der Sklave gehörte, ritt er weiter. Auch der Mann ging seiner Arbeit nach und dachte nicht im Traum daran, dass er sich mit seinem Herrn unterhalten hatte. Er dachte, sagte und hörte nichts mehr von der Angelegenheit, bis zwei oder drei Wochen später. Und dann teilte sein Aufseher dem armen Mann mit, dass er nun an einen Händler aus Georgia verkauft werden sollte, weil er sich mit seinem Herrn angelegt hatte. Er wurde sofort angekettet und mit Handschellen gefesselt, und so wurde er ohne Vorwarnung von einer Hand, die unerbittlicher war als der Tod, seiner Familie und seinen Freunden entrissen und für immer getrennt. Das ist die Strafe dafür, die Wahrheit zu sagen, die einfache Wahrheit zu sagen, als Antwort auf eine Reihe von einfachen Fragen.
Es ist zum Teil die Folge solcher Tatsachen, dass Sklaven, wenn sie nach ihrem Zustand und dem Charakter ihrer Herren befragt werden, fast durchgängig sagen, dass sie zufrieden sind und dass ihre Herren freundlich sind. Es ist bekannt, dass die Sklavenhalter Spione unter ihre Sklaven schicken, um deren Ansichten und Gefühle in Bezug auf ihre Lage zu erkunden. Die Häufigkeit dieses Vorgehens hat dazu geführt, dass sich bei den Sklaven die Maxime durchgesetzt hat, dass eine ruhige Zunge einen klugen Kopf macht. Sie unterdrücken lieber die Wahrheit, als die Konsequenzen zu tragen, wenn sie sie sagen, und beweisen damit, dass sie Teil der menschlichen Familie sind. Wenn sie etwas über ihre Herren zu sagen haben, dann meist zu deren Gunsten, vor allem, wenn sie mit einem unerfahrenen Mann sprechen. Als Sklave wurde ich oft gefragt, ob ich einen gütigen Herrn hatte, und ich kann mich nicht erinnern, jemals eine negative Antwort gegeben zu haben. Ich habe auch nicht geglaubt, dass ich damit etwas absolut Falsches gesagt habe, denn ich habe die Güte meines Herrn immer an dem Maßstab gemessen, den die Sklavenhalter um uns herum gesetzt haben. Außerdem sind Sklaven wie andere Menschen und haben die gleichen Vorurteile wie andere auch. Sie halten ihre eigenen für besser als die der anderen. Unter dem Einfluss dieses Vorurteils halten viele ihre eigenen Herren für besser als die Herren anderer Sklaven; und das in einigen Fällen auch dann, wenn genau das Gegenteil der Fall ist. In der Tat ist es nicht ungewöhnlich, dass Sklaven sich sogar untereinander über die relative Güte ihrer Herren streiten, wobei jeder für die höhere Güte des eigenen Herrn gegenüber dem der anderen plädiert. Gleichzeitig verachten sie ihre Herren gegenseitig, wenn sie sie getrennt betrachten. So war es auch auf unserer Plantage. Wenn die Sklaven von Oberst Lloyd auf die Sklaven von Jacob Jepson trafen, trennten sie sich selten, ohne sich über ihre Herren zu streiten. Die Sklaven von Oberst Lloyd behaupteten, er sei der reichste und die Sklaven von Herrn Jepson, er sei der klügste und der beste Mann. Die Sklaven von Oberst Lloyd prahlten mit seiner Fähigkeit, Jacob Jepson zu kaufen und zu verkaufen. Die Sklaven von Herrn Jepson prahlten mit seiner Fähigkeit, Oberst Lloyd auspeitschen zu können. Diese Streitigkeiten endeten fast immer in einem Kampf zwischen den Parteien, und diejenigen, die gepeitscht hatten, glaubten, den Streitpunkt gewonnen zu haben. Sie schienen zu glauben, dass die Größe ihrer Herren auf sie selbst übertragbar sei. Es wurde als schlimm genug angesehen, ein Sklave zu sein, aber der Sklave eines armen Mannes zu sein, galt als wahre Schande!
KAPITEL IV
Herr Hopkins blieb nur eine kurze Zeit im Amt, Büro. Warum seine Karriere so kurz war, weiß ich nicht, aber ich vermute, dass ihm die nötige Strenge fehlte, um zu Oberst Lloyd zu passen. Herr Hopkins wurde von Herrn Austin Gore abgelöst, einem Mann, der in besonderem Maße all jene Charaktereigenschaften besaß, die für einen erstklassigen Aufseher unabdingbar sind. Herr Gore hatte Oberst Lloyd als Aufseher auf einer der Außenfarmen gedient und sich des hohen Postens des Aufsehers auf der Heim- oder Großes Haus Bauernhof würdig erwiesen.
Herr Gore war stolz, ehrgeizig und ausdauernd. Er war listig, grausam und verstockt. Er war genau der richtige Mann für einen solchen Posten, und es war genau der richtige Ort für einen solchen Mann. Hier konnte er all seine Kräfte voll ausleben und er schien sich hier vollkommen zu Hause zu fühlen. Er gehörte zu denen, die den kleinsten Blick, das kleinste Wort oder die kleinste Geste eines Sklaven als Unverschämtheit werten und entsprechend behandeln würden. Ihm durfte nicht geantwortet werden; einem Sklaven, der sich zu Unrecht beschuldigt sah, war keine Erklärung erlaubt. Herr Gore handelte ganz nach der von den Sklavenhaltern aufgestellten Maxime: 'Es ist besser, dass ein Dutzend Sklaven unter der Peitsche leiden, als dass der Aufseher in Anwesenheit der Sklaven eines Fehlers überführt wird.' Ganz gleich, wie unschuldig ein Sklave sein könnte - es nützte ihm nichts, wenn er von Herrn Gore eines Vergehens beschuldigt wurde. Angeklagt zu werden bedeutete, verurteilt zu werden, und verurteilt zu werden bedeutete, bestraft zu werden; das eine folgte immer dem anderen mit unumstößlicher Gewissheit. Der Bestrafung zu entgehen hieß, der Anklage zu entgehen, und nur wenige Sklaven hatten das Glück, unter der Aufsicht von Herrn Gore beides zu tun. Er war gerade stolz genug, um von den Sklaven die entwürdigendste Huldigung zu verlangen, und unterwürfig genug, um selbst vor den Füßen des Herrn zu kauern. Er war ehrgeizig genug, um sich mit nichts weniger als dem höchsten Rang eines Aufsehers zufrieden zu geben, und ausdauernd genug, um den Höhepunkt seines Ehrgeizes zu erreichen. Er war grausam genug, um die härtesten Strafen zu verhängen, listig genug, um sich zu den niedrigsten Tricks herabzulassen, und verstockt genug, um unempfänglich für die Stimme eines tadelnden Gewissens zu sein. Von allen Aufsehern war er der von den Sklaven am meisten gefürchtete. Seine Anwesenheit war schmerzhaft, sein Blick blitzte verwirrend, und selten war seine scharfe, schrille Stimme zu hören, ohne dass sie Entsetzen und Zittern in den Reihen der Sklaven hervorrief.
Herr Gore war ein ernster Mann, und obwohl er ein junger Mann war, machte er keine Witze, sagte keine lustigen Worte und lächelte selten. Seine Worte standen in perfektem Einklang mit seinem Aussehen, und sein Aussehen stand in perfektem Einklang mit seinen Worten. Aufseher gönnen sich manchmal ein witziges Wort, sogar mit den Sklaven; nicht so bei Herrn Gore. Er sprach nur, um zu befehlen, und befahl nur, um gehorcht zu werden; er ging sparsam mit seinen Worten und großzügig mit seiner Peitsche um, wobei er erstere nie dort einsetzte, wo letztere ebenso gut geeignet wäre. Wenn er peitschte, schien er es aus Pflichtgefühl zu tun und fürchtete keine Konsequenzen. Er tat nichts widerwillig, egal wie unangenehm es war; er war immer auf seiner Stelle, nie inkonsequent. Er versprach nie etwas anderes, als es zu erfüllen. Er war, mit einem Wort, ein Mann von unnachgiebiger Festigkeit und eisiger Kühle.
Seine grausame Barbarei wurde nur noch von der vollkommenen Gelassenheit übertroffen, mit der er die gröbsten und grausamsten Taten an den ihm unterstellten Sklaven beging. Herr Gore nahm sich einmal vor, einen der Sklaven von Oberst Lloyd namens Demby auszupeitschen. Er hatte Demby nur wenige Striemen verpasst, als er, um die Geißelung loszuwerden, davonlief und sich in einen Bach stürzte, wo er bis zu den Schultern in der Tiefe stand und sich weigerte, wieder herauszukommen. Herr Gore sagte ihm, dass er ihn dreimal rufen würde, und dass er ihn erschießen würde, wenn er beim dritten Mal nicht herauskäme. Der erste Anruf wurde getätigt. Demby reagierte nicht, sondern blieb auf seinem Platz stehen. Die zweite und dritte Aufforderung erfolgte mit dem gleichen Ergebnis. Herr Gore hob daraufhin, ohne sich mit irgendjemandem abzusprechen oder zu beraten, ohne Demby auch nur einen weiteren Ruf zu geben, seine Muskete zum Gesicht und zielte tödlich auf sein stehendes Opfer, und in einem Augenblick war der arme Demby nicht mehr da. Sein zerfetzter Körper sank außer Sichtweite, und Blut und Hirn markierten das Wasser, wo er gestanden hatte.
Ein Schauer des Entsetzens durchfuhr jede Seele auf der Plantage, mit Ausnahme von Herrn Gore. Er allein schien kühl und gefasst. Er wurde von Oberst Lloyd und meinem alten Herrn gefragt, warum er zu diesem außergewöhnlichen Mittel gegriffen hatte. Seine Antwort war (so gut ich mich erinnern kann), dass Demby unkontrollierbar geworden war. Er gäbe den anderen Sklaven ein gefährliches Beispiel, das, wenn man es ohne eine solche Demonstration seinerseits geschehen ließe, schließlich zum völligen Umsturz aller Regeln und der Ordnung auf der Plantage führen würde. Er argumentierte, dass, wenn ein Sklave sich weigerte, sich korrigieren zu lassen, und mit dem Leben davonkam, die anderen Sklaven das Beispiel bald nachahmen würden, was die Freiheit der Sklaven und die Versklavung der Weißen zur Folge hätte. Die Verteidigung von Herrn Gore war zufriedenstellend. Er wurde in seinem Amt als Aufseher auf der Heimatplantage bestätigt. Sein Ruhm als Aufseher ging ins Ausland. Sein abscheuliches Verbrechen wurde nicht einmal einer gerichtlichen Untersuchung unterzogen. Es wurde im Beisein von Sklaven begangen, und die konnten natürlich weder eine Klage einreichen noch gegen ihn aussagen. Und so geht der schuldige Täter eines der blutigsten und abscheulichsten Morde ungestraft von der Justiz und unbestraft von der Gemeinschaft, in der er lebt. Herr Gore lebte in St. Michaels, Talbot County, Maryland, als ich von dort wegging; und wenn er noch am Leben ist, lebt er höchstwahrscheinlich auch jetzt noch dort; und wenn dem so ist, wird er heute wie damals so hoch geschätzt und respektiert, als ob seine schuldige Seele nicht mit dem Blut seines Bruders befleckt worden wäre.
Ich spreche mit Bedacht, wenn ich sage, dass die Tötung eines Sklaven oder einer schwarzen Person in Talbot County, Maryland, weder von den Gerichten noch von der Gesellschaft als Verbrechen angesehen wird. Herr Thomas Lanman aus St. Michaels tötete zwei Sklaven, von denen er einen mit einem Beil tötete, indem er ihm das Hirn herausschlug. Er pflegte damit zu prahlen, diese schreckliche und blutige Tat begangen zu haben. Ich habe gehört, wie er dies lachend tat, indem er unter anderem sagte, dass er der einzige Wohltäter seines Landes in der Gesellschaft sei und dass, wenn andere so viel tun würden wie er, wir von den 'niggers' befreit werden würden.
Die Frau von Herrn Giles Hicks, die nur eine kurze Strecke von dem Ort entfernt wohnte, an dem ich früher lebte, ermordete die Cousine meiner Frau, ein junges Mädchen zwischen fünfzehn und sechzehn Jahren, und verstümmelte sie auf grausamste Weise, indem sie ihr mit einem Stock die Nase und das Brustbein brach, so dass das arme Mädchen wenige Stunden später verstarb. Sie wurde sofort begraben, lag aber erst wenige Stunden in ihrem vorzeitigen Grab, als sie abgeholt und vom Gerichtsmediziner untersucht wurde, der feststellte, dass sie durch schwere Schläge zu Tode gekommen war. Das Vergehen, für das dieses Mädchen ermordet wurde, war folgendes: Sie war in dieser Nacht beauftragt worden, auf das Baby von Frau Hicks aufzupassen, und während der Nacht schlief sie ein, und das Baby weinte. Da sie schon mehrere Nächte zuvor nicht mehr geschlafen hatte, hörte sie das Weinen nicht. Sie waren beide mit Frau Hicks in ihrem Zimmer. Als Frau Hicks feststellte, dass sich das Mädchen nur langsam bewegte, sprang sie aus dem Bett, ergriff einen Eichenholzstock am Kamin und brach dem Mädchen damit die Nase und das Brustbein und beendete so ihr Leben. Ich will nicht sagen, dass dieser grausame Mord in der Gemeinde kein Aufsehen erregte. Er erregte zwar Aufsehen, aber nicht genug, um die Mörderin zu bestrafen. Es wurde ein Haftbefehl gegen sie ausgestellt, der jedoch nie zur Seite stand. So entging sie nicht nur der Bestrafung, sondern auch dem Schmerz, für ihr grausames Verbrechen vor Gericht angeklagt zu werden.
Während ich über die blutigen Taten berichte, die sich während meines Aufenthalts auf Oberst Lloyds Plantage ereigneten, möchte ich kurz eine andere erzählen, die sich etwa zur gleichen Zeit wie der Mord an Demby durch Herrn Gore ereignete.
Die Sklaven von Oberst Lloyd hatten die Angewohnheit, einen Teil ihrer Nächte und Sonntage damit zu verbringen, Austern zu fischen und auf diese Weise das Defizit ihrer spärlichen Bezüge auszugleichen. Ein alter Mann, der zu Oberst Lloyd gehörte, gelangte während dieser Beschäftigung zufällig über die Grenzen von Oberst Lloyd hinaus auf das Grundstück von Herrn Beal Bondly. Herr Bondly nahm daran Anstoß, kam mit seiner Muskete ans Ufer und schoss dem armen alten Mann den tödlichen Inhalt in den Leib.
Herr Bondly kam am nächsten Tag zu Oberst Lloyd, ob er ihn für sein Eigentum bezahlen oder sich für seine Tat rechtfertigen wollte, weiß ich nicht. Jedenfalls wurde diese ganze teuflische Transaktion bald vertuscht. Es wurde nur wenig darüber gesprochen und nichts unternommen. Sogar unter den kleinen weißen Jungs war es ein gängiges Sprichwort, dass es einen halben Cent wert war, einen 'Nigger' zu töten, und einen halben Cent, einen zu begraben.
KAPITEL V
Was meine eigene Behandlung betrifft, während ich auf der Plantage von Oberst Lloyd lebte, so war sie der der anderen Sklavenkinder sehr ähnlich. Ich war nicht alt genug, um auf dem Feld zu arbeiten, und da es wenig anderes als Feldarbeit zu tun gab, hatte ich viel Freizeit. Das meiste, was ich zu tun hatte, war, abends die Kühe zusammenzutreiben, die Hühner aus dem Garten fernzuhalten, den Vorgarten sauber zu halten und Botengänge für die Tochter meines alten Herrn, Frau Lucretia Auld, zu erledigen. Den Großteil meiner Freizeit verbrachte ich damit, Meister Daniel Lloyd zu helfen, seine Vögel zu finden, nachdem er sie geschossen hatte. Meine Verbindung zu Meister Daniel war von einigem Vorteil für mich. Er wurde ziemlich an mich gebunden und war eine Art Beschützer für mich. Er ließ nicht zu, dass die älteren Jungen mich schikanierten, und teilte seine Kuchen mit mir.
Ich wurde von meinem alten Herrn nur selten gepeitscht und litt kaum unter etwas anderem als Hunger und Kälte. Ich litt viel unter Hunger, aber noch viel mehr unter Kälte. Im heißesten Sommer und im kältesten Winter wurde ich fast nackt gehalten - keine Schuhe, keine Strümpfe, keine Jacke, keine Hosen, nur ein grobes Leinenhemd, das mir nur bis zu den Knien reichte. Ich hatte kein Bett. Ich hätte vor Kälte sterben müssen, wenn ich nicht in den kältesten Nächten einen Sack gestohlen hätte, in dem das Getreide zur Mühle getragen wurde. Ich kroch in diesen Sack und schlief dort auf dem kalten, feuchten Lehmboden, mit dem Kopf drin und den Füßen draußen. Meine Füße sind vom Frost so rissig geworden, dass die Feder, mit der ich schreibe, in den Wunden liegen könnte.
Wir bekamen kein regelmäßiges Taschengeld. Unser Essen bestand aus grobem, gekochtem Maismehl. Das wurde Brei genannt. Er wurde in ein großes hölzernes Tablett oder einen Trog gegeben und auf den Boden gestellt. Und dann wurden die Kinder gerufen, wie so viele Schweine, und wie so viele Schweine kamen sie und verschlangen den Brei; einige mit Austernschalen, andere mit Kieselsteinen, einige mit bloßen Händen, und keiner mit Löffeln. Wer am schnellsten aß, bekam am meisten, wer am stärksten war, sicherte sich den besten Platz, und nur wenige verließen den Trog zufrieden.
Ich war wahrscheinlich zwischen sieben und acht Jahre alt, als ich die Plantage von Oberst Lloyd verließ. Ich verließ sie mit Freude. Ich werde nie die Ekstase vergessen, mit der ich die Nachricht erhielt, dass mein alter Herr (Anthony) beschlossen hatte, mich nach Baltimore zu schicken, um bei Herrn Hugh Auld, dem Bruder des Schwiegersohns meines alten Herrn, Kapitän Thomas Auld, zu leben. Ich erhielt diese Information etwa drei Tage vor meiner Abreise. Es waren drei der glücklichsten Tage, die ich je erlebt habe. Ich verbrachte den größten Teil dieser drei Tage im Bach, um den Schmutz der Plantage abzuwaschen und mich auf meine Abreise vorzubereiten.
Der Stolz auf mein Äußeres, auf den das schließen lässt, war nicht mein eigener. Ich verbrachte die Zeit damit, mich zu waschen, nicht so sehr, weil ich es wollte, sondern weil Frau Lucretia mir gesagt hatte, ich müsse die tote Haut von meinen Füßen und Knien entfernen, bevor ich nach Baltimore gehen könne; denn die Leute in Baltimore seien sehr sauber und würden mich auslachen, wenn ich schmutzig aussähe. Außerdem wollte sie mir eine Hose schenken, die ich nicht anziehen sollte, bevor ich nicht den ganzen Schmutz von mir entfernt hätte. Der Gedanke, eine Hose zu besitzen, war wirklich großartig! Er war fast schon ein ausreichendes Motiv, um mich nicht nur von dem zu befreien, was die Schweinehirten die Räude nennen würden, sondern auch von der Haut selbst. Ich machte mich ernsthaft an die Arbeit, zum ersten Mal mit der Hoffnung auf eine Belohnung.
Die Bande, die Kinder normalerweise an ihr Zuhause binden, waren in meinem Fall alle aufgehoben. Meine Abreise war keine schwere Prüfung für mich. Mein Zuhause war reizlos; es war nicht mein Zuhause. Als ich mich von ihm trennte, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich etwas verließ, was ich hätte genießen können, wenn ich geblieben wäre. Meine Mutter war tot, meine Großmutter lebte weit weg, so dass ich sie nur selten sah. Ich hatte zwei Schwestern und einen Bruder, die mit mir im selben Haus lebten, aber die frühe Trennung von unserer Mutter hatte die Tatsache unserer Beziehung fast aus unserem Gedächtnis gelöscht. Ich suchte anderswo nach einem Zuhause und war zuversichtlich, keins zu finden, das mir weniger gefallen würde als das, das ich verlassen würde. Wenn ich jedoch in meinem neuen Zuhause Entbehrungen, Hunger, Peitschenhiebe und Nacktheit vorfand, hatte ich den Trost, dass ich nichts davon hätte vermeiden können, wenn ich geblieben wäre. Da ich bereits im Haus meines alten Herrn mehr als nur eine Kostprobe davon bekommen hatte und sie dort ertragen hatte, schloss ich ganz natürlich darauf, dass ich sie auch anderswo und insbesondere in Baltimore ertragen konnte. Denn ich hatte etwas von dem Gefühl über Baltimore, das in dem Sprichwort zum Ausdruck kommt, dass es besser ist, in England gehängt zu werden als in Irland eines natürlichen Todes zu sterben. Ich hatte den sehnlichsten Wunsch, Baltimore zu sehen. Cousin Tom, der zwar kein fließendes Wort spricht, hatte mir mit seiner wortgewandten Beschreibung des Ortes diesen Wunsch geweckt. Ich konnte ihm nie etwas am Großen Haus zeigen, egal wie schön oder mächtig es war, aber er hatte in Baltimore etwas gesehen, das das Objekt, das ich ihm zeigte, an Schönheit und Kraft weit übertraf. Sogar das Große Haus selbst, mit all seinen Bildern, war vielen Gebäuden in Baltimore weit unterlegen. Mein Wunsch war so stark, dass ich dachte, die Befriedigung dieses Wunsches würde den Verlust an Annehmlichkeiten, den ich durch den Austausch erleiden würde, vollständig ausgleichen. Ich reiste ohne Bedauern und mit den größten Hoffnungen auf zukünftiges Glück ab.
Wir segelten an einem Samstagmorgen aus dem Miles Fluss nach Baltimore. Ich erinnere mich nur noch an den Wochentag, denn zu dieser Zeit kannte ich weder die Tage des Monats noch die Monate des Jahres. Als ich die Segel setzte, ging ich nach achtern und warf einen letzten Blick auf Oberst Lloyds Plantage, von dem ich hoffte, dass es der letzte sein würde. Dann setzte ich mich an den Bug der Schaluppe und verbrachte den Rest des Tages damit, nach vorne zu schauen und mich für das zu interessieren, was in der Ferne lag, und nicht für das, was in der Nähe oder dahinter lag.
Am Nachmittag dieses Tages erreichten wir Annapolis, die Hauptstadt des Staates. Wir hielten nur wenige Augenblicke an, so dass ich keine Zeit hatte, an Land zu gehen. Es war die erste große Stadt, die ich je gesehen hatte, und obwohl sie im Vergleich zu einigen unserer Fabrikdörfer in Neuengland klein wirken würde, hielt ich sie für ihre Größe für einen wunderbaren Ort - sogar noch beeindruckender als die Großes Haus Bauernhof!
Wir kamen am frühen Sonntagmorgen in Baltimore an und legten am Smiths Wharf an, nicht weit von Bowleys Wharf entfernt. Wir hatten eine große Schafherde an Bord der Schaluppe, und nachdem ich geholfen hatte, sie zum Schlachthof von Herrn Curtis auf Louden Slaters Hügel zu treiben, wurde ich von Rich, einem der Helfer an Bord der Schaluppe, zu meinem neuen Zuhause in der Alliciana Straße in der Nähe von Herrn Gardners Werft am Fells Point gebracht.
Herr und Frau Auld waren beide zu Hause und empfingen mich an der Tür mit ihrem kleinen Sohn Thomas, um den ich mich kümmern sollte. Und da sah ich etwas, was ich noch nie zuvor gesehen hatte: ein weißes Gesicht, das von den freundlichsten Gefühlen durchdrungen war; es war das Gesicht meiner neuen Geliebten, Sophia Auld. Ich wünschte, ich könnte die Verzückung beschreiben, die meine Seele durchströmte, als ich es sah. Es war ein neuer und seltsamer Anblick für mich, der meinen Weg mit dem Licht des Glücks erhellte. Dem kleinen Thomas wurde gesagt, dass es seinen Freddy gibt, und mir wurde gesagt, ich solle mich um den kleinen Thomas kümmern. Und so begann ich meine Pflichten in meinem neuen Zuhause mit der erfreulichsten Aussicht.
Ich betrachte meine Abreise von Oberst Lloyds Plantage als eines der interessantesten Ereignisse meines Lebens. Es ist möglich, ja sogar sehr wahrscheinlich, dass ich ohne den bloßen Umstand, von dieser Plantage nach Baltimore versetzt worden zu sein, heute in den schmerzhaften Ketten der Sklaverei gefangen wäre, anstatt hier an meinem eigenen Tisch zu sitzen, die Freiheit und das Glück der Heimat zu genießen und diese Erzählung zu schreiben. Der Umzug nach Baltimore legte den Grundstein und öffnete das Tor zu all meinem späteren Wohlstand. Ich habe es immer als die erste deutliche Manifestation jener gütigen Vorsehung betrachtet, die mich seither begleitet und mein Leben mit so vielen Gunstbezeugungen versehen hat. Ich hielt die Auswahl meiner Person für etwas bemerkenswert. Es gab eine ganze Reihe von Sklavenkindern, die man von der Plantage nach Baltimore hätte schicken können. Es gab die jüngeren, die älteren und die gleichaltrigen. Ich wurde unter ihnen allen ausgewählt und war die erste, letzte und einzige Wahl.
Man mag mich für abergläubisch und sogar egoistisch halten, wenn ich dieses Ereignis als ein besonderes Eingreifen der göttlichen Vorsehung zu meinen Gunsten betrachte. Aber ich würde den frühesten Gefühlen meiner Seele untreu werden, wenn ich diese Meinung unterdrücken würde. Ich ziehe es vor, mir selbst treu zu sein, selbst auf die Gefahr hin, den Spott anderer auf mich zu ziehen, als falsch zu sein und meine eigene Verachtung auf mich zu ziehen. Seit meiner frühesten Erinnerung habe ich die tiefe Überzeugung, dass die Sklaverei mich nicht für immer in ihrer üblen Umarmung halten würde. Und in den dunkelsten Stunden meiner Laufbahn in der Sklaverei verließen mich dieses lebendige Wort des Glaubens und der Geist der Hoffnung nicht, sondern blieben wie dienende Engel, um mich in der Finsternis aufzumuntern. Dieser gute Geist kam von Gott, und ihm gilt mein Dank und mein Lob.
KAPITEL VI
Meine neue Herrin erwies sich als das, was sie zu sein schien, als ich sie zum ersten Mal an der Tür traf: eine Frau mit dem gütigsten Herzen und den feinsten Gefühlen. Vor mir hatte sie noch nie einen Sklaven unter ihrer Kontrolle gehabt, und vor ihrer Heirat war sie für ihren Lebensunterhalt auf ihren eigenen Fleiß angewiesen gewesen. Sie war von Beruf Weberin und hatte sich durch ständigen Einsatz in ihrem Beruf vor den schädlichen und entmenschlichenden Auswirkungen der Sklaverei bewahrt. Ich war völlig erstaunt über ihre Gutmütigkeit. Ich wusste kaum, wie ich mich ihr gegenüber verhalten sollte. Sie war ganz anders als jede andere weiße Frau, die ich je gesehen hatte. Ich konnte mich ihr nicht so nähern, wie ich es von anderen weißen Frauen gewohnt war. Meine frühe Belehrung war völlig fehl am Platz. Die geduckte Unterwürfigkeit, die bei Sklaven normalerweise eine so akzeptable Eigenschaft ist, war bei ihr nicht angebracht. Ihre Gunst wurde dadurch nicht gewonnen; sie schien sich daran zu stören. Sie empfand es nicht als unverschämt oder unmanierlich, wenn ein Sklave ihr ins Gesicht sah. Selbst der gemeinste Sklave fühlte sich in ihrer Gegenwart wohl, und keiner ging, ohne sich besser zu fühlen, weil er sie gesehen hatte. Ihr Gesicht war von himmlischem Lächeln und ihre Stimme von ruhiger Musik geprägt.
Aber leider hatte dieses gütige Herz nur eine kurze Zeit, um so zu bleiben. Das tödliche Gift der unverantwortlichen Macht war bereits in ihren Händen und begann bald mit seinem höllischen Werk. Das heitere Auge, das unter dem Einfluss der Sklaverei stand, wurde bald rot vor Wut; die Stimme, die so lieblich klang, verwandelte sich in eine raue und grausame Zwietracht; und das engelsgleiche Gesicht führte keinen Weg vorbei an dem eines Dämons.
Schon bald nachdem ich bei Herrn und Frau Auld eingezogen war, begann sie mir freundlicherweise das A, B, C beizubringen. Nachdem ich dies gelernt hatte, half sie mir, Wörter mit drei oder vier Buchstaben zu buchstabieren. Als ich gerade dabei war, fand Herr Auld heraus, was vor sich ging, und verbot Frau Auld sofort, mich weiter zu unterrichten, indem er ihr unter anderem mitteilte, dass es nicht nur ungesetzlich, sondern auch unsicher sei, einem Sklaven das Lesen beizubringen. Um es mit seinen eigenen Worten zu sagen: 'Wenn Sie einem Nigger einen Zentimeter geben, wird er einen Ellenbogen nehmen. Ein Nigger sollte nichts anderes kennen, als seinem Herrn zu gehorchen - zu tun, was man ihm sagt. Lernen würde den besten Nigger der Welt verderben. Nun", sagte er, "wenn Sie diesem Nigger (ich spreche von mir) das Lesen beibringen würden, wäre er nicht mehr zu halten. Es würde ihn für immer als Sklaven untauglich machen. Er würde sofort unkontrollierbar und für seinen Herrn wertlos werden. Was ihn selbst betrifft, so könnte es ihm nichts nützen, aber sehr schaden. Es würde ihn unzufrieden und unglücklich machen.' Diese Worte sanken tief in mein Herz, weckten in mir schlummernde Gefühle und riefen einen völlig neuen Gedankengang ins Leben. Es war eine neue und besondere Offenbarung, die dunkle und geheimnisvolle Dinge erklärte, mit denen sich mein jugendlicher Verstand vergeblich herumgeschlagen hatte. Ich verstand nun, was für mich eine höchst verwirrende Schwierigkeit gewesen war - nämlich die Macht des weißen Mannes, den schwarzen Mann zu versklaven. Das war eine großartige Errungenschaft, und ich schätzte sie sehr. Von diesem Moment an verstand ich den Weg von der Sklaverei in die Freiheit. Es war genau das, was ich wollte, und ich bekam es zu einem Zeitpunkt, an dem ich es am wenigsten erwartet hatte. Während mich der Gedanke, die Hilfe meiner gütigen Herrin zu verlieren, traurig machte, freute ich mich über die unschätzbaren Lektionen, die ich durch einen glücklichen Zufall von meinem Herrn erhalten hatte. Obwohl ich mir der Schwierigkeit bewusst war, ohne einen Lehrer zu lernen, machte ich mich mit großer Hoffnung und dem festen Vorsatz auf den Weg, um jeden Preis lesen zu lernen. Die entschlossene Art und Weise, mit der er sprach und sich bemühte, seiner Frau die schlechten Folgen einer Unterweisung vor Augen zu führen, stand mir zur Seite, um mich davon zu überzeugen, dass er sich der Wahrheiten, die er aussprach, zutiefst bewusst war. Es gab mir die beste Gewissheit, dass ich mich mit dem größten Vertrauen auf die Ergebnisse verlassen könnte, die, wie er sagte, sich aus dem Leseunterricht ergeben würden. Was er am meisten fürchtete, das wünschte ich mir am meisten. Was er am meisten liebte, das hasste ich am meisten. Was für ihn ein großes Übel war, das es sorgfältig zu meiden galt, war für mich ein großes Gut, das es eifrig zu suchen galt; und das Argument, das er so vehement gegen das Erlernen des Lesens vorbrachte, stand mir nur zur Seite, um meinen Wunsch und meine Entschlossenheit zum Lernen zu wecken. Dass ich lesen lernte, verdanke ich fast ebenso sehr dem erbitterten Widerstand meines Meisters wie der freundlichen Hilfe meiner Herrin. Ich erkenne den Nutzen von beiden an.
Ich hatte nur kurze Zeit in Baltimore gelebt, bevor ich einen deutlichen Unterschied in der Behandlung von Sklaven im Vergleich zu der, die ich auf dem Land erlebt hatte, bemerkte. Ein Sklave in der Stadt ist fast ein freier Mann, verglichen mit einem Sklaven auf einer Plantage. Er wird viel besser ernährt und gekleidet und genießt Privilegien, die dem Sklaven auf der Plantage gänzlich unbekannt sind. Es gibt eine Spur von Anstand, ein Gefühl der Scham, das viel dazu beiträgt, die Ausbrüche grausamer Grausamkeiten, die auf der Plantage so häufig vorkommen, einzudämmen und zu erledigen. Er ist ein verzweifelter Sklavenhalter, der die Menschlichkeit seiner nicht sklavenhaltenden Nachbarn mit den Schreien seines geschundenen Sklaven schockieren wird. Nur wenige sind bereit, das Odium auf sich zu nehmen, das mit dem Ruf verbunden ist, ein grausamer Herr zu sein; und vor allem möchten sie nicht dafür bekannt sein, dass sie einem Sklaven nicht genug zu essen geben. Jeder städtische Sklavenhalter ist darauf bedacht, dass man von ihm weiß, dass er seine Sklaven gut ernährt. Und man muss sagen, dass die meisten von ihnen ihren Sklaven genug zu essen geben. Es gibt jedoch einige schmerzliche Ausnahmen von dieser Regel. Direkt gegenüber von uns, in der Philpot Straße, lebte Herr Thomas Hamilton. Er besaß zwei Sklaven. Ihre Namen waren Henrietta und Mary. Henrietta war ungefähr zweiundzwanzig Jahre alt, Mary etwa vierzehn; und von allen geschundenen und ausgemergelten Kreaturen, die ich je gesehen habe, waren diese beiden die schlimmsten. Sein Herz muss härter als Stein sein, der sie ungerührt betrachten konnte. Der Kopf, der Hals und die Schultern von Mary waren buchstäblich in Stücke geschnitten. Ich habe ihren Kopf oft abgetastet und festgestellt, dass er mit eiternden Wunden übersät war, die von der Peitsche ihrer grausamen Herrin herrührten. Ich weiß nicht, ob ihr Herr sie jemals ausgepeitscht hat, aber ich war Augenzeuge der Grausamkeit von Frau Hamilton. Ich war früher fast jeden Tag im Haus von Herrn Hamilton. Frau Hamilton saß in einem großen Stuhl in der Mitte des Zimmers, ein schweres Kuhfell immer an ihrer Seite, und es verging kaum eine Stunde am Tag, die nicht vom Blut einer dieser Sklavinnen gezeichnet war. Die Mädchen gingen selten an ihr vorbei, ohne dass sie sagte: 'Schneller, ihr schwarzen Schweinehunde! ', und gleichzeitig versetzte sie ihnen einen Schlag mit dem Kuhfell auf den Kopf oder die Schultern, was oft Blut kostete. Dann sagte sie: 'Nimm das, du schwarzer Idiot! ' Und weiter: 'Wenn du dich nicht schneller bewegst, werde ich dich bewegen! Zusätzlich zu den grausamen Peitschenhieben, denen diese Sklaven ausgesetzt waren, wurden sie fast halb verhungert gehalten. Sie wussten selten, was es heißt, eine volle Mahlzeit zu sich zu nehmen. Ich habe gesehen, wie Mary sich mit den Schweinen um die auf die Straße geworfenen Innereien gestritten hat. Mary wurde so oft getreten und zerstückelt, dass man sie oft eher 'pickte' als bei ihrem Namen nannte.