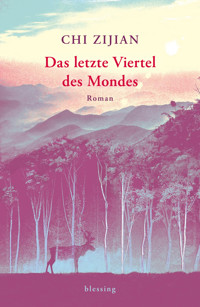
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein großes Epos von Liebe und Krieg, Widerstand und Überlebenswillen
Eine alte Frau blickt auf ihr Leben: Sie ist die Witwe des letzten Häuptlings der Ewenken, eines Nomadenvolkes an der russisch-chinesischen Grenze. Ihre Existenz und die ihres Stammes sind bestimmt von den klaren Regeln der Gemeinschaft, der engen Symbiose mit der Natur, den Rentieren, der Jagd, den Wäldern. Doch im China des 20. Jahrhunderts machen die politischen Umwälzungen auch vor der Welt der Nomaden nicht halt. Die japanische Besetzung der Mandschurei zwingt die Männer in den Krieg, der Sozialismus der Mao-Zeit die Familien in die Städte und in geschlossene Häuser. Nur die alte Frau und ihre Sippe halten unbeirrt an ihrer traditionellen Lebensweise fest.
Mit diesem außergewöhnlichen Roman setzt die preisgekrönte Schriftstellerin Chi Zijian dem Volk der Ewenken ein Denkmal und gibt Einblick in das China der Vergangenheit und Gegenwart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch
Eine alte Frau blickt auf ihr Leben: Sie ist die Witwe des letzten Häuptlings der Ewenken, eines Nomadenvolkes an der russisch-chinesischen Grenze. Ihre Existenz und die ihres Stammes sind bestimmt von den klaren Regeln der Gemeinschaft, der engen Symbiose mit der Natur, den Rentieren, der Jagd, den Wäldern. Doch im China das 20. Jahrhunderts machen die politischen Umwälzungen auch vor der Welt der Nomaden nicht halt. Die japanische Besetzung der Mandschurei zwingt die Männer in den Krieg, der Sozialismus der Mao-Zeit die Familien in die Städte und in geschlossene Häuser. Nur die alte Frau und ihre Sippe halten unbeirrt an ihrer traditionellen Lebensweise fest.
Mit diesem außergewöhnlichen Roman setzt die preisgekrönte Schriftstellerin Chi Zijian dem Volk der Ewenken ein Denkmal und gibt Einblick in das China der Vergangenheit und Gegenwart.
Zur Autorin
Chi Zijian wurde 1964 in Chinas nördlichstem Dorf, Mohe, an der russisch-chinesischen Grenze geboren. Seit ihrem literarischen Debüt »Unter den Bäumen« 1983 hat sie mehr als 40 Einzelwerke veröffentlicht und gehört zu den erfolgreichsten Autorinnen Chinas. Ihre Romane sind vielfach preisgekrönt, sie erhielt u. a. den Mao-Dun-Preis, die höchste Auszeichnung für Belletristik in China. Ihre Werke sind in viele Sprachen übersetzt, auf Deutsch ist dies die erste Übersetzung.
Zur Übersetzerin
Karin Betz übersetzt chinesische und englische Literatur, sie ist Dozentin für literarische Übersetzung, Herausgeberin, Moderatorin und DJ. Zu den von ihr übersetzten Autoren gehören Mo Yan, Liao Yiwu und Liu Cixin. Für ihre Übersetzungen wurde sie vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Helmut-M.-Braem-Übersetzerpreis 2024 und dem Special Book Award of China.
Chi Zijian
Das letzte Viertel des Mondes
Aus dem Chinesischen von Karin Betz
Blessing
Die Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel bei Beijing Publishing Group, Beijing.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Dataminings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Übersetzerin dankt dem Deutschen Übersetzerfonds e.V. für die großzügige Förderung ihrer Arbeit durch ein Stipendium.
Copyright der Originalausgabe © 2005 by Chi Zijian
Published by Beijing Publishing Group
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2025 by Karl Blessing Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Alle Rechte vorbehalten.
Redaktion: Kristof Kurz
Umschlaggestaltung: semper smile, München, nach einer Vorlage von PRHUK unter Verwendung von Bildmaterial von gettyimages / Andy Brandl und alamy
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-31912-0V001
www.blessing-verlag.de
I
Tagesanbruch
Kapitel 1
Ich bin eine langjährige Vertraute des Regens und des Schnees. Neunzig Jahre bin ich alt. Regen und Schnee haben mich alt werden sehen, und auch ich habe sie alt werden sehen.
Der Sommerregen wird heutzutage immer seltener und auch der Winterschnee Jahr um Jahr dürftiger. Sie sind wie die abgewetzte, verschlissene Rentierfellmatte unter mir, deren einst dichtes Haar wie vom Wind fortgetragen scheint. Was bleibt, sind nichts als die unzähligen Narben der Zeit. Auf meiner Matte sitzend wirke ich wie eine Jägerin, die an einer Salzlecke wacht. Doch auf mich wartet kein Rentier mit prächtigem Geweih; mich erwartet nur ein Sturmwind, der den Sand davonweht.
Gerade eben, nachdem Shiban und die anderen fortgegangen sind, ist der Regen gekommen. Bis dahin hat die Sonne uns einen halben Monat lang allmorgendlich ihr errötendes Antlitz gezeigt und ist abends goldschimmernd hinter den Bergen versunken, ohne sich im Laufe des Tags auch nur mit einer einzigen Wolke geschmückt zu haben. Ihre glühenden Strahlen haben das Flussbett beinahe trocken geleckt, und auch das Gras auf den der Sonne zugewandten Berghängen krümmt sich unter der sengenden Hitze.
Die Dürre macht mir nichts aus, aber Maksims Weinen kann ich nicht ertragen. Liusha weint auch manchmal, wenn der Vollmond scheint; Maksim dagegen verbirgt beim Anblick der langen, im Zickzack verlaufenden Risse auf dem Erdboden jedes Mal sein Gesicht in den Händen und heult, als wären sie Schlangen, die ihn fressen wollen. Mir selbst machen diese Risse keine Angst, für mich sind sie Blitzstrahlen von Mutter Erde.
Antsaur fegt im Regen unseren Lagerplatz.
»Ist Busu nicht ein furchtbar trockener Ort?«, frage ich ihn. »Hätte Shiban den Regen dann nicht besser auf die andere Seite der Berge mitnehmen sollen?«
Antsaur richtet sich auf, fängt mit ausgestreckter Zunge ein paar Regentropfen auf und strahlt mich an. Wenn er lacht, lachen auch die Fältchen in seinen Augenwinkeln und um seinen Mund herum – dann leuchten um seine Augen Chrysanthemen und auf seinen Wangen öffnen sich Sonnenblumen. Wie Tautropfen hängt der Regen in diesen blütengleichen Fältchen.
Antsaur und ich sind die Einzigen, die noch in unserem Urireng verblieben sind, alle anderen sind im Morgengrauen in die Pick-ups gestiegen und mit ihrem Hausrat und den Rentieren den Berg hinuntergefahren. Schon früher haben wir ab und zu die Berge verlassen, sind nach Uchiriowo oder in jüngster Zeit auch nach Jiliu gegangen, einem Marktflecken, wo wir Felle und Geweihe gegen Schnaps, Salz, Seife, Zucker, Tee und dergleichen tauschen, aber immer sind wir in die Berge zurückgekehrt. Doch diesmal war es für die anderen ein endgültiger Abschied. Sie sind unterwegs nach Busu, einer großen Stadt am Fuß des Gebirges mit vielen Häusern mit weißen Mauern und roten Dächern, wie Berk mir gesagt hat. Eins davon wird ihr neues Zuhause. Außerdem gibt es dort ein mit Draht umzäuntes Wildgehege, in dem fortan die Rentiere eingepfercht werden.
Ich will nicht in einem Haus schlafen, in dem man die Sterne nicht sehen kann. Mein ganzes Leben lang hat der Glanz der Sterne mich durch das Dunkel der Nacht begleitet. Blickte ich nachts, wenn ich aus meinen Träumen erwache, an eine pechschwarze Decke, würde ich blind. Und auch meine Rentiere haben nichts verbrochen, warum sollte ich sie in ein Gefängnis sperren? Hörte ich nie wieder ihre Glöckchen klingeln wie plätscherndes Wasser, würde ich taub. Meine Beine sind die holprigen Gebirgspfade gewohnt; müssten sie tagtäglich durch die ebenen Straßen einer Stadt wandern, würden sie irgendwann zu schlaff, um mein Gewicht zu tragen, und ich würde zum Krüppel. Nie habe ich etwas anderes als die reine Luft der Berge und Wiesen geatmet; zwänge man mich, die stinkenden Abgasfürze der Autos in einer Stadt wie Busu einzuatmen, würde ich ersticken. Mein Körper ist mir von den Geistern geschenkt worden, und ich möchte ihn den Geistern in den Bergen zurückgeben.
Vor zwei Jahren rief Tatjana die Leute unseres Urirengs zusammen, um uns darüber abstimmen zu lassen, ob wir aus den Bergen ins Tal ziehen sollten. Sie gab jedem von uns ein rechteckig zugeschnittenes Stück Birkenrinde. Wer einverstanden war, sollte sein Stück auf die Geistertrommel legen, die uns Nihau vermacht hat. Im Handumdrehen war dieTrommel von weißen Rindenstücken bedeckt. Als hätte der Himmel Gänsefedern auf sie schneien lassen. Ich war die Letzte, die sich erhob, doch hatte ich nicht vor, es den anderen gleichzutun. Statt zur Trommel ging ich zur Feuerstelle und warf mein Stück Birkenrinde hinein, wo es in den goldenen Flammen im Nu zu Asche verbrannte. Als ich den Shirangju verließ, hörte ich Tatjana schluchzen.
Shiban, hatte ich angenommen, würde sein Rindenstück einfach aufessen. Von klein auf hat er gerne auf Baumrinde herumgekaut, man bekam ihn gar nicht aus dem Wald heraus. Aber am Ende legte er sein Stück wie alle anderen auf die Geistertrommel. Für mich war das, als habe er damit seine Lebensgrundlage weggegeben. Früher oder später wird er verhungern. Ich nehme an, dass Shiban dem Umzug nur wegen des armen Wladimir zugestimmt hat.
Auch Antsaur hatte sein Rindenstück auf die Trommel gelegt, aber das bedeutete nichts, wussten doch alle, dass er gar nicht begriffen hatte, was man von ihm erwartete. Er wollte das Ding einfach nur schnellstmöglich loswerden, um sich wieder seiner geliebten Arbeit widmen zu können. Antsaur ist immerzu beschäftigt. An jenem Tag war ein Rentier von einer Wespe am Auge gestochen worden, und er wollte ihm gerade eine Kräuterauflage machen, als Tatjana zur Abstimmung rief. Er betrat den Shirangju, sah, wie Maksim und Suchanglin ihre Birkenrinde auf die Trommel legten, und tat es ihnen gleich, ohne groß darüber nachzudenken. Er hatte in diesem Augenblick nichts als das geschwollene Rentierauge im Sinn. Allerdings legte er sein Rindenstück nicht andächtig und weihevoll auf der Trommel ab wie die anderen, sondern ließ es beim Hinausgehen achtlos auf den Haufen fallen wie ein in der Luft kreisender Vogel, der eine Feder verliert.
Nun sind nur noch ich und Antsaur in unserem Lager, dennoch fühle ich mich kein bisschen einsam. Solange ich in den Bergen leben kann, werde ich mich niemals einsam fühlen, selbst wenn ich der letzte Mensch auf Erden wäre.
Ich gehe zurück in meinen Shirangju, setze mich auf mein Rentierfelllager und wache Tee trinkend über das Feuer.
Wann immer wir früher das Lager wechselten, niemals vergaßen wir den Zunder. Doch nun haben Tatjana und die anderen, als sie den Berg hinuntergefahren sind, den Zunder hier zurückgelassen. Ich mache mir aufrichtig Sorgen um sie, denn ohne Feuer sind die Tage kalt und dunkel. Sie beteuerten zwar, dass es in Busu in jedem Haus Feuer gebe und es nicht nötig sei, den Zunder mitzunehmen, doch das Feuer in Busu, denke ich, ist bestimmt nicht wie unseres, das man im Wald mit Flint und Feuerstahl entfacht. In den Häusern Busus brennt ein Feuer ohne Sonnenstrahlen und Mondlicht. Wie kann ein solches Feuer Auge und Herz eines Menschen erhellen?
Das Feuer, über das ich wache, ist mit mir zusammen alt geworden. Ganz gleich, ob ein heftiger Wind, ein Schneesturm oder ein Gewitter über uns hereinbrach, immer habe ich gut darauf achtgegeben, niemals habe ich es erlöschen lassen. Dieses Feuer ist mein Herzschlag.
Ich bin keine besonders gute Geschichtenerzählerin, aber nun, wo ich den Regen niederprasseln höre und in die züngelnden Flammen blicke, spüre ich das Bedürfnis, mich jemandem mitzuteilen. Tatjana ist fort, und mit ihr Shiban, Maksim und Ruscha; wem soll ich meine Geschichte erzählen? Antsaur hört so ungern jemandem zu, wie er selbst redet. Sollen also der Regen und das Feuer meiner Geschichte lauschen, denn ich weiß, dass diese beiden Erzfeinde ebenso Ohren haben, wie ein Menschen Ohren hat.
Kapitel 2
Ich bin eine Frau vom Volk der Ewenken.
Ich bin die Frau des letzten Häuptlings unseres Stammes.
Ich bin eine Wintergeborene. Meine Mutter hieß Tamara, mein Vater Rinke. Als meine Mutter mit mir niederkam, war mein Vater auf der Jagd und erlegte gerade einen großen schwarzen Bären. Um an erstklassige Bärengalle heranzukommen, hatte mein Vater eine Baumhöhle ausfindig gemacht, in der ein Bär überwinterte. Mit einem Birkenstamm weckte und reizte er das Winterruhe haltende Tier, bis es wütend aus seiner Höhle kam. Erst dann hob Vater die Flinte und schoss. Ein zorniger Bär produziert besonders viel Gallensaft, und seine Gallenblase wird prall und rund. An diesem Tag war das Glück meinem Vater hold und segnete ihn doppelt, mit üppiger Bärengalle und mit mir.
Das erste Geräusch, das ich bei meiner Ankunft in dieser Welt vernahm, war Rabenkrächzen. Jedoch nicht das von echten Raben. Wenn einer von uns einen Bären erlegte, versammelten sich sämtliche Angehörigen des Urireng zum Bärenfleischessen. Da der Bär von uns verehrt wird, stießen wir vor dem Verzehr seines Fleisches ein lautes »Krah, krah, krah« aus, damit die Seele des Bären dachte, nicht wir, sondern die Raben machten sich über ihn her.
Viele Kinder, die im Winter zur Welt kamen, wurden aufgrund der bitteren Kälte krank und starben vorzeitig, so wie mein älteres Schwesterchen. Am Tag ihrer Geburt hatte es in einem fort geschneit, und mein Vater war unterwegs gewesen, um ein verloren gegangenes Rentier wieder einzufangen. Es blies ein strenger Wind, und eine heftige Bö hob eine Ecke des Shirangjus an, das meine Mutter eigens für ihre Niederkunft errichtet hatte, sodass meine Schwester sich verkühlte. Zwei Tage darauf war sie tot. Wenn ein junges Rehkitz stirbt, hinterlässt es wenigstens ein paar hübsche kleine Hufabdrücke auf dem Waldboden, doch meine Schwester verschwand so spurlos wie der Wind, der sie getötet hatte; nur ein kurzer Schrei, dann schwieg sie für immer. Mein Schwesterchen wurde in ein weißes Säckchen gesteckt und den der Sonne zugewandten Berghang hinuntergeworfen. Meine Mutter war am Boden zerstört. Bei meiner Geburt achtete sie daher sorgfältig darauf, dass der Vorhang aus Tierfellen rings um das Shirangju dicht und fest geschlossen war – aus Furcht, der kalte Wind könne noch einmal seine gierige Zunge auf der Suche nach Menschenleben hereinstrecken und ihr Kind mit sich fortreißen.
Natürlich hat mir meine Mutter diese Geschichte erst erzählt, als ich schon größer war. Am Tag meiner Geburt, sagte sie, hätten die Leute unseres Urirengs ein Freudenfeuer auf dem Schneefeld entzündet und Bärenfleisch gegessen. Nidu der Schamane sei sogar durch die Flammen getanzt, und obwohl seine Hirschlederschuhe und der Rentierfellumhang völlig von Funken übersät gewesen seien, blieb er selbst vollkommen unversehrt.
Nidu war das Stammesoberhaupt unseres Urirengs und der ältere Bruder meines Vaters, weshalb ich ihn Egdiama nannte, das bedeutet Onkel. Meine erste Erinnerung handelt von ihm.
Außer der Schwester, die der Wind kurz nach ihrer Geburt mit sich genommen hatte, hatte ich noch eine andere große Schwester namens Lena. In einem Herbst erkrankte Lena schwer. Mit hohem Fieber lag sie bäuchlings auf der Rentierfellmatte, aß nicht und trank nicht, redete wirres Zeug, schlief nicht und war doch nicht wach. Mein Vater errichtete vor der südöstlichen Ecke des Shirangjus einen Unterstand, schlachtete ein weißes Rentier und bat Nidu den Schamanen, für Lena einen Geistertanz aufzuführen. Mein Egdiama war ein Mann, aber als Schamane trug er aus Tradition Frauenkleider. Für den Geistertanz stopfte er seine Brust aus, bis er so dick und so schwer behängt mit den Schamanenkleidern und dem Kopfschmuck war, dass ich dachte, er könne sich gar nicht mehr bewegen. Doch als er dann die Geistertrommel rührte, wirbelte er leicht und grazil herum. Er sang und tanzte auf der Suche nach Lenas Umai; so nennt man die Seele eines Kindes. Er begann in der Abenddämmerung und tanzte, bis die Sterne aufgingen. Da brach er plötzlich zusammen.
Kaum lag Nidu der Schamane am Boden, setzte Lena sich auf. Sie verlangte nach Wasser und sagte, sie sei hungrig. Als der Schamane wieder bei Bewusstsein war, sagte er meiner Mutter, ein graues Rentierkalb sei anstelle von Lena in das Reich der Schatten eingegangen.
Um die allzu sehr auf die Pilze im Wald versessenen Rentiere zur Rückkehr ins Lager zu bewegen, banden wir im Herbst die jungen Kälber dort an, damit die besorgten Muttertiere wieder nach Hause kamen. Meine Mutter nahm mich an die Hand und führte mich aus dem Shirangju. Unter dem Licht des Sternenhimmels sah ich ein gerade eben noch springlebendiges Rentierkalb reglos am Boden liegen. Ein kalter Schauder durchfuhr mich, und bebend klammerte ich mich an die Hand meiner Mutter. Das ist meine früheste Erinnerung. Ich muss damals etwa vier oder fünf Jahre alt gewesen sein.
Meine ganze Kindheit hindurch kannte ich keine anderen Behausungen als unsere regenschirmförmigen Shirangjus, wir nannten sie die »Säulen der Heiligen«. Ein Shirangju zu errichten ist ganz einfach: Man fällt zwanzig bis dreißig Lärchen und kürzt die Stämme auf eine Länge von etwa zwei Mann, entrindet sie und spitzt sie an einem Ende zu. Dann stellt man sie mit diesem Ende nach oben auf und fixiert die unteren Enden mithilfe von Kiefernholzplanken in gleichmäßigen Abständen in der Erde, bis die Stämme an einen großen Kreis aus tanzenden Beinen erinnern. Zuletzt ummantelt man sie von außen mit einer schützenden Hülle gegen Wind und Kälte – und fertig ist das Shirangju. Früher nutzten wir zum Abdecken Birkenrinde und Tierfelle, später zunehmend Filz und Segeltuch.
Ich wohne gerne in einem Shirangju. In der Mitte des Daches bildet eine kleine Öffnung einen natürlichen Rauchabzug für das Herdfeuer. Durch diese Öffnung betrachte ich nachts die Sterne. Viele sind es nicht, die man durch das Loch zu sehen bekommt, aber dafür leuchten sie außergewöhnlich hell wie eine Öllampe, die man an der Decke des Shirangjus aufgehängt hat.
Mein Vater ging nur ungern zum Shirangju des Schamanen, ich dafür umso lieber. Denn dort wohnte nicht nur ein Mensch; dort wohnten auch die Geister unseres Stammes, die wir als Malu bezeichnen. Sie wurden in einem runden Ledersack in einem Schrein direkt gegenüber dem Eingang des Shirangjus des Schamanen aufbewahrt. Bevor die Erwachsenen zur Jagd aufbrachen, fielen sie zuerst andächtig vor den Malus auf die Knie.
Dieses Ritual weckte meine Neugier. Oft bettelte ich Nidu den Schamanen an, den Ledersack für mich zu öffnen, damit ich mir die Geister ansehen konnte. Waren sie aus Fleisch und Blut? Konnten sie sprechen? Ob sie wohl nachts schnarchten, wie die Menschen es tun? Aber anstatt den Ledersack zu öffnen, griff der Schamane kurzerhand zu seinem Trommelstock und jagte mich hinaus, wenn er mich so respektlos über die Geister reden hörte.
Mein Vater und Nidu der Schamane verhielten sich überhaupt nicht wie Brüder. Sie sprachen nur selten miteinander und gingen niemals gemeinsam jagen. Mein Vater war dünn und hager, Nidu dagegen rund und dick. Mein Vater war ein geschickter Jäger, während Nidu zumeist mit leeren Händen von der Jagd nach Hause kam. Vater war sehr gesprächig, doch sein Bruder verlor selbst bei den Versammlungen, zu denen er das ganze Urireng einberief, kaum ein Wort. Am Tag meiner Geburt, so hieß es, habe er eine nie da gewesene Fröhlichkeit an den Tag gelegt und über den Durst getrunken, deshalb sei er auch ins große Freudenfeuer hineingetanzt. Und das nur, weil er in der Nacht zuvor geträumt hatte, ein weißes Kitz sei in unser Lager gekommen; was bedeutete, dass meine Geburt unter einem guten Stern stand.
Meinem Vater gefiel es, meine Mutter zu necken. Im Sommer zeigte er manchmal mit dem Finger auf sie und sagte: »Pass auf, Tamara, Ilan beißt dir in den Rock!« Ilan war unser Jagdhund. In unserer Sprache bedeutet Ilan so viel wie Sonnenstrahl, deshalb rief ich besonders gern bei Anbruch der Dunkelheit nach ihm in der Hoffnung, mit Ilan käme auch das Licht der Sonne wieder angerannt. Doch am Ende war er wie ich nur ein Schatten in der Dämmerung. Meine Mutter trug für ihr Leben gern Röcke, weshalb ihre alljährliche Vorfreude auf den Sommer nicht etwa dem sehnsüchtigen Wunsch entsprang, dass endlich die Blumen im Wald ihre Blütenkelche öffneten. Sie konnte es schlicht nicht erwarten, ihre Röcke anzuziehen. Wenn sie dann meinen Vater rufen hörte, Ilan kaue gerade an ihrem Rock, sprang sie erschrocken auf, und mein Vater lachte diebisch. Mutters Lieblingsrock war grau, mit einem grünen Zierband an der Taille, das vorne breit war und hinten schmal.
Meine Mutter war die tüchtigste Frau des Urirengs. Sie hatte wohlgeformte, starke Arme, stämmige Beine, ein Gesicht mit breiter Stirn und begegnete jedermann stets mit einem warmen, gütigen Lächeln. Während die anderen Frauen den ganzen Tag mit einem blauen Kopftuch herumliefen, ließ sie ihr volles, pechschwarzes Haar unbedeckt und steckte es zu einem Knoten auf, den sie mit einer Nadel aus mondweißem, blank poliertem Hirschhorn schmückte.
»Komm mal her, Tamara!« Mein Vater rief sie oft zu sich, genauso, wie er auch nach uns rief. Wenn meine Mutter sich dann widerwillig zu ihm gesellte, zupfte er sie oft nur lachend an der Jacke, tätschelte ihren Hintern, und sagte: »Alles in Ordnung, geh ruhig wieder!« Meine Mutter verzog das Gesicht, sagte aber kein Wort und nahm die unterbrochene Tätigkeit wieder auf.
Lena und ich lernten von klein auf alle wichtigen Fertigkeiten von meiner Mutter: Felle zu gerben, Schinken zu räuchern, Körbe und Kanus aus Birkenrinde zu flechten, Schuhe und Handschuhe aus Hirschleder zu nähen, Khleb zu backen, Rentiere zu melken, Sättel aus Rentierleder herzustellen und so weiter. Ein wenig eifersüchtig beobachtete mein Vater, wie wir ständig um meine Mutter herumschwirrten wie Schmetterlinge, die nicht von einer Blume lassen können. »Tamara«, rief er dann, »schenk mir einen Utu!« Utu bedeutet Sohn, während Lena und ich Unaji, also Töchter, waren. Meistens nannte mein Vater Lena seine große Unaji, und ich war entsprechend die kleine Unaji.
Spätnachts hörte man immer den Wind um das Shirangju heulen. Im Winter mischten sich die Schreie wilder Tiere in diesen Gesang, im Sommer waren es die Rufe der Eulen und das Quaken der Frösche. Auch innerhalb unseres Shirangju gab es windähnliche Geräusche: das Keuchen meines Vaters und das Wispern meiner Mutter. Normalerweise nannte meine Mutter meinen Vater nie bei seinem Namen, doch wenn sie in der Nacht ihren eigenartigen Windgesang anstimmten, rief sie mit bebender Stimme: »Rinke, Rinke!«. Vater dagegen erinnerte an ein sterbendes Tier, so schwer atmete er; wir fürchteten schon, sie seien krank.
Doch am nächsten Morgen gingen sie wieder munter und mit rosigen Gesichtern ihrem Tagewerk nach. Als Folge ihres Windgesangs schwoll der Bauch meiner Mutter Tag um Tag an, und bald darauf wurde mein Bruder Luni geboren.
Nun hatte mein Vater seinen Utu. Selbst wenn er ohne Beute von der Jagd heimkehrte, hellte sich seine finstere Miene beim Anblick von Lunis lachendem Gesichtchen sogleich auf. Auch Tamara liebte Luni. Sie hätte ihn während ihrer täglichen Verrichtungen bedenkenlos in seiner Wiege aus Birkenrinde lassen können, doch stattdessen trug sie ihn auf den Schultern mit sich herum. Dabei verzichtete sie auf die spitze Hirschhornnadel im Haarknoten, denn Luni versuchte immerzu, sie herauszuziehen und darauf herumzukauen, und sie hatte Angst, er könne sich daran verletzen. Mir gefiel sie aber viel besser mit der Hirschhornnadel im Haar.
Auch Lena und ich hatten Luni gern, und wir rissen uns darum, ihn im Arm zu halten. Rund und knubbelig war er, wie ein süßer kleiner Bär, und er quiekte, wobei ihm Speichel aus dem Mund und auf unsere Hälse lief, was kitzelte wie krabbelnde Raupen. Im Winter strichen wir ihm gern mit einem buschigen Eichhörnchenschwanz über das Gesicht, was ihm ein fröhliches Glucksen entlockte. Im Sommer trugen wir ihn Huckepack ans Flussufer und fingen bunte Libellen im hohen Schilfgras, um sie ihm zu zeigen.
Eines Tages, als meine Mutter gerade den Rentieren Salz gab, versteckten meine Schwester und ich Luni in dem großen Getreidefass aus Birkenborke, das vor dem Shirangju stand. Als Tamara zurückkam und bemerkte, dass Luni verschwunden war, geriet sie außer sich, suchte ihn überall vergebens und fragte uns, wo er sei, doch wir schüttelten nur den Kopf und sagten, das wüssten wir nicht, worauf sie in bittere Tränen ausbrach. Doch Mutter und Luni waren offenbar so innig verbunden, dass der zuvor noch mucksmäuschenstill in seinem Versteck in der Sonne schmorende Luni, sobald er das Weinen seiner Mutter vernahm, gleichfalls zu heulen anfing. In den Ohren meiner Mutter war sein Weinen ein Lachen. Rasch folgte sie dem Klang, schloss Luni in die Arme und schimpfte Lena und mich tüchtig aus. Noch nie hatten wir sie so wütend auf uns erlebt.
Lunis Ankunft änderte die Art und Weise, wie meine Schwester und ich über unsere Eltern sprachen. Ursprünglich nannten wir, so wie es sich für brave Kinder gehörte, unsere Mutter Eni und unseren Vater Ama. Doch da wir eifersüchtig auf die übergroße Aufmerksamkeit waren, die sie Luni zuteilwerden ließen, verweigerten wir unseren Eltern, wenn wir unter uns waren, die ihnen gebührenden Namen und nannten sie nur noch Tamara und Rinke. So halte ich es bis heute. Die Geister mögen mir vergeben.
Die erwachsenen Männer im Urireng hatten alle eine Frau. So wie Rinke Tamara hatte, hatte Hase seine Maria, Kunde hatte Evelyn, Iwan seine blauäugige und blondhaarige Nadeschda; nur Nidu der Schamane war allein. Ich stellte mir vor, dass die Geister in seinem Lederbeutel allesamt weiblich waren, warum sonst sollte er keine Frau haben wollen? Ich fand auch gar nichts dabei, dass Nidu mit einem Geist zusammen war. Nur dass sie keine Kinder bekommen konnten, war ein bisschen schade. Ein Lager ohne Kinder war wie Bäume ohne Regen, ganz und gar freudlos.
Iwan und Nadeschda und ihre beiden Töchter Jilande und Nora zogen sich ständig gegenseitig auf und kicherten dabei; Jindele, der Sohn von Kunde und Evelyn, war nicht ganz so lebhaft, aber für die beiden war er wie eine Wolke, die ihnen im Hochsommer Schatten spendete und sie heiter und gelassen stimmte. Hase und Maria dagegen, die keine Kinder hatten, machten immer betrübte Gesichter. Einmal kam Rolinsky, der russische Anda – wie wir die Händler nannten –, in unser Lager und brachte neben Tabak, Alkohol, Tee und Zucker auch eine besondere Medizin in Hases Shirangju. Doch auch nachdem Maria die Medizin eingenommen hatte, die sie von der Unfruchtbarkeit heilen sollte, bekam sie keinen dicken Bauch. Hase sah weiter so verstört drein wie die Elche, die er bei der Jagd in ein umzäuntes Gehege trieb. Oft bedeckte Maria das Gesicht mit einem Tuch und schlich mit gesenktem Kopf in Nidus Shirangju. Doch nicht dem Schamanen galt ihr Besuch, sondern den Malus. Die Geister sollten ihr ein Kind schenken.
Evelyn war meine Tante väterlicherseits. Sie erzählte gerne Geschichten. Von ihr hörten wir all die überlieferten Sagen und Legenden unseres Volks, und erfuhren sogar den Ursprung der Feindschaft zwischen meinem Vater und seinem Bruder, dem Schamanen. Während meiner Kindheit gab sie allerdings allein die alten Volkssagen an uns weiter. Die Geschichten von Liebe und Hass zwischen den Erwachsenen unseres Urirengs hörte ich erst viel später, nachdem mein Vater gestorben und erst meine Mutter und dann Nidu verrückt geworden waren. Da war ich selbst schon beinahe Mutter.
Ich habe in meinem Leben viele Flüsse gesehen. Unzählige. Schmale, breite, gewundene, gerade; in manchen strömte das Wasser wild und stark, in anderen floss es ruhig und gleichmäßig dahin. Es war unser Volk, das ihnen ihre Namen gegeben hat: Delbur Bera, Holuguya Bera, Bischiya, Bistare, Iming Do und Talyan. Die meisten sind Nebenflüsse des Arguns oder Nebenflüsse seiner Nebenflüsse.
Meine früheste Erinnerung an den Argun ist eine Wintererinnerung.
In jenem Jahr war unser weit im Norden gelegenes Lager von einer so dichten Schneedecke bedeckt, dass die Rentiere nichts mehr zu fressen fanden. Wohl oder übel mussten wir weiter nach Süden ziehen. Zwei Tage lang waren wir unterwegs, ohne Jagdbeute zu machen, und der einbeinige Dashi, der auf einem Rentier ritt, schimpfte auf die Männer, die zwei gesunde Beine hatten und doch zu nichts nütze seien. Ihretwegen sei er bereits in ein dunkles Schattenreich eingetreten, in dem er bei lebendigem Leib verhungere. Wir müssten hinunter zum Argun, sagte er, und mit dem Eisbohrer ein Loch in den zugefrorenen Fluss treiben, um Fische zu fangen.
Der mächtige Strom wirkte mit seiner weißen Decke wie ein von Menschenhand angelegtes, riesiges Schneefeld. Hase, unser geschicktester Fischer, bohrte drei große Augen in das Eis und postierte sich mit seinem Speer daneben. Die großen Fische, die tief unter der dichten Eisdecke überwinterten, dachten, der Frühling sei gekommen, und schwammen mit fröhlich zappelnden Köpfen und Schwänzen zu den Eislöchern, um das Tageslicht zu begrüßen. Sobald Hase das Wasser in einem Eisloch wirbeln sah, stieß er flink und zielsicher zu und hatte im Handumdrehen eine Menge Fische gefangen, schwarz gesprenkelte Hechte und sogar fette, fein gemusterte sibirische Lachse. Bei jedem Fang sprang ich vor Freude in die Luft und klatschte in die Hände. Lena dagegen traute sich nicht, in das dampfende Eisloch hineinzuspähen, und auch Jilande und Jindele hielten sich in sicherer Entfernung, da es ihnen nicht geheuer war. Da war mir Nora lieber, die sich, obwohl sie noch jünger war als ich, mutig über das Eisloch beugte, so tief, dass Hase sie ermahnte, Abstand zu nehmen. »Sonst fällst du noch hinein und bist Fischfutter!«, sagte er.
Nora riss ihre Rehfellmütze herunter, schüttelte energisch den Kopf, stampfte auf und rief: »Werft mich da runter! Ich schwimme jeden Tag für euch dort unten herum, und wenn ihr Fische wollt, dann braucht ihr bloß gegen das Eis zu klopfen und nach mir zu rufen, dann breche ich durch und gebe euch einen Fisch!« Hase ließ sich von ihrem Geplärre nicht beeindrucken, ihre Mutter Nadeschda allerdings rannte sofort herbei und bekreuzigte sich in einem fort vor der Brust.
Nadeschda war Russin. Zusammen mit Iwan hatte sie nicht nur zwei blonde und blauäugige Kinder in unsere Welt gesetzt, sondern auch die Riten der orthodoxen Kirche mitgebracht. Deshalb war Nadeschda die Einzige in unserem Urireng, die sowohl unseren Malu-Geistern als auch der Heiligen Jungfrau huldigte. Tante Evelyn verachtete sie deswegen. Ich fand gar nichts dabei, wenn jemand einen Gott oder Geist eifriger anbetete als einen anderen, für mich schienen sie damals alle gleich unsichtbar. Dennoch mochte ich es nicht, wenn sich Nadeschda vor der Brust bekreuzigte, denn das sah für mich aus, als wollte sie sich mit einem Messer das Herz aus dem Leib schneiden.
In der Abenddämmerung entfachten wir am zugefrorenen Argun ein Lagerfeuer. Die Hechte verfütterten wir an die Jagdhunde, die fetten Lachse teilten wir in Stücke, die wir salzten und auf Birkenstöckchen aufgespießt über dem Feuer wendeten. Im Nu erfüllte der Duft von gebratenem Fisch die Luft.
Während die Erwachsenen sich nach dem Essen einen Schnaps genehmigten, liefen Nora und ich am Flussufer um die Wette und hinterließen in der dichten Schneedecke lange Fährten wie von zwei Hasen. Ich weiß noch, dass uns Evelyn zurückrief, als wir gerade im Begriff waren, quer über den Fluss zu rennen.
»Du darfst nicht einfach so ans andere Ufer laufen!«, ermahnte sie mich. »Das gehört nicht mehr zu unserem Territorium!« Dann zeigte sie auf Nora. Sie könne dorthin gehen, denn das sei ihr altes Heimatland, sagte sie, und eines Tages würde Nadeschda mit Nora und Jilande ans linke Ufer des Arguns zurückkehren.
In meinen Augen war ein Fluss ein Fluss, zwischen dem rechten und linken Ufer war kein Unterschied. Nehmt zum Beispiel ein Lagerfeuer: Selbst wenn es am rechten Ufer brennt, färben seine Flammen auch die verschneite Wildnis des linken Ufers rot. Nora und ich kümmerten uns nicht um Evelyn und rannten weiter zwischen dem rechten und dem linken Ufer hin und her. Nora erleichterte sich sogar absichtlich am linken Ufer, nur um sogleich zum rechten Ufer zurückzurennen und Evelyn lauthals zu verkünden: »Ich habe in meiner alten Heimat Pipi gemacht!«
Evelyn bedachte Nora mit einem Blick, als wäre sie ein mit Missbildungen geborenes Rentierkalb.
In derselben Nacht verriet mir Tante Evelyn, dass auch das linke Ufer des Flusses einmal uns gehört hatte; dort liege unsere ursprüngliche Heimat, in der wir einst die Herren gewesen seien.
Vor mehr als dreihundert Jahren waren russische Truppen in das Territorium unserer Vorfahren eingefallen und hatten einen Krieg angezettelt, indem sie uns Marderfelle und Rentiere stahlen. Die Männer, die sich den Untaten der Russen entgegenstellten, hieben sie kurzerhand mit ihren Säbeln in zwei Hälften, und die Frauen, die sich gegen die Vergewaltigung wehrten, wurden mit bloßen Händen erwürgt.
Unsere einstmals so friedlichen Berge und Wälder versanken in Chaos und Elend. Jahr um Jahr gab es weniger Wild, und so sahen sich unsere Vorfahren gezwungen, das Tal des Flusses Lena in Jakutien zu verlassen, den Argun zu überqueren und an seinem rechten Ufer ein neues Leben zu beginnen. Aus diesem Grund wird unser Volk auch als »Jakuten« bezeichnet. Von den zwölf Stämmen, die unser Volk zählte, als wir noch an der Lena beheimatet waren, blieben nach der Umsiedlung an das rechte Ufer des Arguns nur noch sechs. Mit den Jahren, die den Fluss hinunterflossen, haben sich viele weitere Stämme aufgelöst und in alle Winde verstreut. Deshalb nenne ich den Namen meines Stammes nicht, und die Menschen in meiner Geschichte tragen nur Vornamen.
Die Lena ist ein mächtiger blauer Strom, über den es heißt, er sei so breit, dass ein Specht nicht von einem Ufer bis zum anderen fliegen könne. Am Oberlauf der Lena befindet sich der Lamu-See, der auch Baikalsee genannt wird, und in den acht große Ströme münden, weshalb sein Wasser von so schöner azurblauer Farbe ist. Im Lamu-See wächst eine große Zahl dunkelgrüner Wasserpflanzen, und da der See der Sonne sehr nahe ist, treibt das ganze Jahr über Sonnenlicht zusammen mit rosaweißen Lotusblüten auf seiner Oberfläche. Rings um den Lamu-See ragen stolze, hohe Gebirgszüge auf. Dort war unser Urahn, ein Ewenke mit langen, geflochtenen Zöpfen, einstmals zu Hause.
Ich fragte Evelyn, ob es am Lamu-See auch einen Winter gebe. »Dort, wo deine Vorfahren geboren wurden, gibt es keinen Winter«, antwortete sie. Doch ich wollte nicht glauben, dass es eine Welt geben könnte, in der ewiger Frühling herrschte und in der es immerzu warm war. Denn seit ich auf der Welt war, fand ich nichts so selbstverständlich wie die bittere Kälte der alljährlich wiederkehrenden, endlosen Winter.
Daher lief ich, nachdem mir Evelyn die Geschichten vom Lamu-See erzählt hatte, schnell zu Nidu, um ihn zu fragen, ob das mit dem ewigen Frühling stimme. Der Schamane konnte zwar die Legenden um den Lamu-See nicht bestätigen, aber er versicherte mir, dass unser Volk tatsächlich einst am linken Ufer des Arguns sein Jagdrevier hatte. Er erzählte mir auch, dass damals die Rentier-züchtenden Stämme der Region Nerchinsk alljährlich unserem Fürsten Marderfelle als Tribut darbringen mussten. Die großnasigen russischen Soldaten mit den blauen Augen hätten uns an das rechte Ufer des Arguns vertrieben. Ich wusste zwar nicht, wo genau die Lena und die Region Nerchinsk waren, doch dass diese verlorenen Gebiete alle auf der anderen Seite des Flusses lagen, an einem Ort also, an den wir nicht mehr zurückkehren durften, das hatte ich verstanden. Meine ganze Kindheit über hegte ich fortan einen gewissen Argwohn gegenüber der blauäugigen Nadeschda. Sie erschien mir wie eine Wölfin, die unseren Rentieren auflauert.
Iwan war der Sohn meines Egdiaya, also meines Großonkels väterlicherseits. Er war von eher kleinem Wuchs und hatte ein dunkles Gesicht mit einer auffälligen roten Zyste auf der Stirn, die fatal an eine rote Bohne erinnerte. Unsere schwarzen Bären haben eine Vorliebe für rote Bohnen, weshalb mein Vater Iwan stets im Scherz zu doppelter Vorsicht ermahnte, wenn sie auf der Jagd auf eine Bärenfährte stießen. Aber an seinen Worten war etwas Wahres dran, denn die Bären wurden bei Iwans Anblick immer wütender als bei jedem anderen, und zweimal entkam er nur um Haaresbreite dem Tod durch den Hieb einer kräftigen Bärenpranke.
Iwan hatte ziemlich gute Zähne, am liebsten aß er rohes Fleisch. Aus diesem Grund litt er furchtbar darunter, wenn auf der Jagd keine Beute gemacht wurde. Iwan mochte einfach kein Trockenfleisch, und beim Anblick von Fisch rümpfte er die Nase. Seiner Meinung nach war das ein Essen für Kinder und alte Leute mit schlechten Zähnen.
Iwans Hände waren riesig. Legte er sie flach auf die Schenkel, sahen seine Knie aus wie von gewaltigen Baumwurzeln umschlungen. Diese Hände waren unglaublich kräftig. Er vermochte Kieselsteine zu zerbröckeln und die Lärchenstämme für das Shirangju mit einem Handkantenschlag zu fällen, ohne dass er eine Axt dafür gebraucht hätte. Evelyn behauptete, Iwan habe es diesen fabelhaften Händen zu verdanken, dass Nadeschda seine Frau geworden sei.
Vor etwa hundert Jahren entdeckte man am Oberlauf des Arguns eine Goldader. Als die Russen erfuhren, dass am rechten Flussufer Gold zu finden war, übertraten sie wiederholt die Grenze, um es illegal zu schürfen. Zu jener Zeit saß der chinesische Kaiser Guangxu auf dem Thron. Der Kaiser wollte es sich nicht bieten lassen, dass das Gold des Kaiserreichs vor seinen Augen in die gierigen Hände der blauäugigen Langnasen fiel. Also befahl er seinem Minister Li Hongzhang, etwas gegen den Goldraub zu unternehmen. Dieser kam auf die Idee, in Mohe eine Mine anlegen zu lassen. Nun war Mohe ein gottverlassener Ort, an dem das halbe Jahr über dichter Schnee fiel, und keiner der hohen Beamten des Reiches ließ sich dazu bewegen, dort sein Amt anzutreten. Schließlich verdonnerte der Minister Li Jinyong, den bei der Kaiserinwitwe Cixi in Ungnade gefallenen Vizepräfekten von Jilin, zu dieser Aufgabe.
Kaum hatte die Goldmine ihren Betrieb aufgenommen, begann in Mohe auch der Handel zu florieren. Und wo es blüht, will man auch Früchte ernten, also florierten mit dem Handel auch alsbald die Bordelle. Die Gesichter der Minenarbeiter aus den chinesischen Grenzgebieten, die das ganze Jahr über kaum eine Frau zu sehen bekamen, hellten sich beim Anblick der Freudenmädchen noch mehr auf als bei dem des Goldes. Für ein bisschen Wärme und Vergnügen überschütteten sie die Frauen geradezu mit Goldstücken, und das Geschäft der Prostituierten war so ergiebig wie der Sommerregen. Die Anda witterten in der Prostitution ein großes Geschäft und brachten aus den Grenzgebieten Russlands neben ihren Waren auch blutjunge Mädchen mit, die sie an die Bordelle verkauften.
Eines Tages im Herbst, erzählte Evelyn, sei unser Stamm entlang des Flusses Keppe auf der Jagd gewesen. Der Frost hatte die grünen Wälder bereits mit gelben und roten Sprenkeln versehen. Ein russischer Kaufmann mit langem Bart hatte mit drei Mädchen im Schlepptau den Argun überquert und war nun zu Pferd auf dem Weg durch den Wald nach Mohe. Iwan begegnete ihnen auf der Jagd. Er und die anderen hatten einen Fasan erlegt, ein Lagerfeuer errichtet und ließen sich gerade das Fleisch und Wodka dazu schmecken. Iwan wusste, dass der Anda alles, was er mit sich führte, auch verkaufen wollte. Es sah also ganz so aus, als hätte man in Mohe nicht nur Bedarf an Essen und Gebrauchsgütern, sondern auch an Frauen.
Da wir öfters Handel mit den russischen Kaufleuten trieben, konnten die meisten von uns ein wenig Russisch, und auch die Andas verstanden einige Brocken Ewenkisch. Zwei der drei Mädchen im Gefolge des Kaufmanns waren wahre Schönheiten: große Augen, hoher Nasenansatz, schmale Taillen – und die Art, wie sie der Alkohol in zügelloses Lachen ausbrechen ließ, verriet, dass sie sich wohl schon frühzeitig mit ihrer Rolle als Prostituierte abgefunden hatten. Das dritte Mädchen hatte kleine Augen und war dem Anschein nach nicht vom gleichen Schlag; still und stumm trank sie ihren Becher leer, ohne den Blick von ihrem grau gemusterten Rock zu heben. Iwan war sich sicher, dass dieses Mädchen gegen ihren Willen in die Prostitution gezwungen wurde; warum sonst sollte sie so deprimiert vor sich hin starren? Bei dem Gedanken, dass schon bald zahllose Männer diesen grau gemusterten Rock lüpfen würden, zogen sich Iwan vor Mitleid die Eingeweide zusammen. Noch nie zuvor hatte ein weibliches Wesen bei ihm ein solches Mitgefühl hervorgerufen.
Iwan kehrte zum Urireng zurück, rollte zwei Otterfelle, ein Luchsfell und ein gutes Dutzend Eichhörnchenfelle zusammen, packte sie auf ein Rentier und ritt dem Anda und den drei Mädchen hinterher. Als er die Gruppe eingeholt hatte, band er vor dem Anda sein Bündel auf, zeigte auf das Mädchen mit den kleinen Augen und erklärte, dass das Mädchen Iwan und dem Anda die Pelze gehörten. Der Anda höhnte, die Felle seien ihm zu wenig, er wolle schließlich kein Verlustgeschäft machen.
Da baute sich Iwan vor dem Anda auf und zog ihm mit einer seiner großen Pranken flink den metallenen Flachmann aus der Brusttasche. Er balancierte ihn kurz auf der Handfläche, dann drückte er zu, und schon lag er verbeult in seiner Hand. Als er zum zweiten Mal die Faust darum schloss, spritzte der Alkohol nach allen Seiten, und der Flachmann war nur noch eine Stahlkugel.
Dem Anda schlotterten vor Angst die Knie. Auf einmal hatte er überhaupt nichts mehr dagegen, dass Iwan das Mädchen mit den kleinen Augen mit sich nahm. Und dieses Mädchen war Nadeschda.
Evelyn erzählte, mein Egdiaya sei außer sich vor Zorn auf Iwan gewesen. Er hatte schon längst eine Braut für ihn bestimmt und vorgehabt, sie genau in jenem Winter zur Heirat in die Familie zu holen. Wer hätte denn ahnen können, dass Iwan schon im Herbst seine eigene Braut mit nach Hause bringen würde?
Iwan hatte die Situation richtig eingeschätzt. Nadeschda war dem Anda tatsächlich von einer übel gesonnenen Stiefmutter als zukünftiges Freudenmädchen verkauft worden. Mehrmals hatte sie unterwegs Fluchtversuche unternommen und war von dem Anda immer wieder eingefangen worden, der sich an ihr vergangen hatte, um sie zu lehren, welches Schicksal sie erwartete. Als Iwan sie aus dieser furchtbaren Lage rettete, folgte ihm Nadeschda willig und unendlich dankbar, aber auch mit einem permanent schlechten Gewissen, weil sie ihm die Vergewaltigungen durch den Anda verschwieg. Allein Evelyn vertraute sie sich an. Der etwas zu erzählen bedeutete wiederum, dass es nach kürzester Zeit die Spatzen von den Dächern pfiffen, und bald gab es im ganzen Urireng keinen, der es nicht wusste. Mein Großonkel hatte Nadeschda zunächst nur wegen ihrer Herkunft abgelehnt, doch sobald er erfuhr, dass sie obendrein nicht mehr unbefleckt war, befahl er Iwan, sie unverzüglich in den Wald zu jagen. Doch Iwan jagte Nadeschda nicht fort. Er heiratete sie, und im nächsten Frühling wurde Jilande geboren.
Schon kursierten Gerüchte, der blauäugige Jilande könne womöglich das Kind des bärtigen Anda sein. Er hatte kaum das Licht der Welt erblickt, als mein Egdiaya Blut zu spucken begann. Nur drei Tage später war er tot. Es hieß, am Tag seines Ablebens hätten sich die Abendwolken im Osten blutrot gefärbt, so als hätte er auch das ausgespuckte Blut mit sich fortgenommen.
Nadeschda kannte das Nomadenleben in den Bergen und Wäldern nicht. Anfangs konnte sie im Shirangju kein Auge zutun und streifte häufig schlaflos durch die Wälder. Sie verstand sich auch nicht auf das Gerben von Fellen, das Trocknen von Fleisch oder darauf, Garn aus gekneteten Sehnen zu spinnen. Nicht einmal einen Korb aus Birkenrinde vermochte sie zu machen. Iwan hatte den Eindruck, dass meine Mutter Nadeschda gegenüber nicht ganz so feindselig eingestellt war wie Evelyn und bat sie deshalb, ihr dies alles beizubringen. So wurde Tamara zur engsten Vertrauten Nadeschdas im ganzen Urireng.
Diese Frau, die sich so gerne vor der Brust bekreuzigte, war nicht auf den Kopf gefallen. Schon nach wenigen Jahren verstand sie sich bestens auf alle Tätigkeiten, die die Frauen unseres Volks für gewöhnlich verrichten. Iwan gegenüber war sie außergewöhnlich liebevoll. Kam er von der Jagd zurück, erwartete sie ihn schon sehnsüchtig, und sobald er auftauchte, lief sie ihm entgegen und umarmte ihn stürmisch, als hätten sie sich monatelang nicht gesehen.
Nun war Nadeschda einen Kopf größer als Iwan, sodass es aussah, als würde ein großer Baum einen kleinen umarmen oder eine Bärenmutter ihr Junges. Es war zu komisch. Evelyn rümpfte verächtlich die Nase über Nadeschdas Art. »Typisch Flittchen«, pflegte sie zu sagen.
Wenn jemand den Anblick des Arguns nicht ertragen konnte, dann Nadeschda. Wann immer wir in die Nähe des Flusses kamen, begann Evelyn zu sticheln und zu spotten, als hoffte sie, Nadeschda dadurch in einen Windstoß zu verwandeln, der schleunigst wieder hinüber ans linke Ufer wehte. Nadeschda ihrerseits wähnte beim Anblick des Flusses ihren geldgierigen Peiniger nahe und begann zu zittern vor Angst, er könnte wieder auftauchen, um sie zu quälen.
Doch niemals hätten wir uns freiwillig aus der Gegend um diesen Fluss entfernt, er war der Mittelpunkt unserer Welt, und unser Platz war für immer an den Ufern seiner vielen Nebenströme. Wenn der Argun eine Handfläche ist, dann sind seine Nebenflüsse die fünf Finger, die wie zuckende Blitze in alle Richtungen von ihm fortstreben und dabei unser Leben erhellen.
Ich sagte bereits, dass meine Erinnerung an dem Tag einsetzt, an dem Nidu für Lena seinen Geistertanz aufführte, um ihre Umai einzufangen, und an Lenas Stelle ein Rentierkalb ins Reich der Schatten einging. Wenn ich in meiner Kindheit an Rentiere dachte, dachte ich deshalb lange Zeit unweigerlich an den Tod dieses Kalbs. Ich weiß noch, wie ich es – an der Hand meiner Mutter – nachts unter dem Licht der Sterne reglos daliegen sah. Es hatte mich geängstigt und mir das Herz gebrochen. Meine Mutter hatte das nicht mehr atmende Tier fortgetragen und den der Sonne zugewandten Berghang hinuntergeworfen. Bei unserem Volk ist es üblich, verstorbene Kinder in einem weißen Stoffsack die Sonnenseite der Berge hinunterzuwerfen, denn dort sprießt im Frühjahr das Gras zuerst, und auch die wilden Blumen öffnen dort zuerst ihre Kelche. Meine Mutter behandelte dieses Rentierkalb wie ihr eigenes Kind.
Ich weiß noch genau, wie am darauffolgenden Morgen die Herde zum Lager zurückkam und jene graue Rentierkuh ihr Kalb nicht mehr finden konnte. Mit gesenktem Kopf trabte sie wieder und wieder zu dem Baumstamm, an den ihr Neugeborenes angebunden gewesen war. Wie traurig ihre Augen aussahen. Von jenem Tag an versiegte ihre zuvor im Überfluss vorhandene Milch. Erst Jahre später, als Lena dem Rentierkalb ins Reich der Schatten nachfolgte, sprudelte sie wieder wie Quellwasser.
Es heißt, dass unsere Vorfahren schon Rentiere züchteten, als sie noch an den Ufern der Lena lebten. Dort gab es üppig grüne Wälder, dicht bewachsen mit den von uns Enke genannten Flechten und Awakat genannten Moosen, die den Rentieren reichlich Nahrung boten. Damals hießen Rentiere bei uns Swogdja, heute jedoch nennen wir sie Aorong. Sie haben einen Kopf wie ein Pferd, ein Geweih wie ein Hirsch, den Rumpf eines Affen und die Hufe eines Rindes. Weil sie damit vier Tieren gleichen und doch ein ganz anderes Tier sind, werden sie von den Chinesen Sibuxiang, die »Viermal Unähnlichen« genannt. Früher war ihr Fell in der Regel grau oder braun, heute kann es graubraun, grauschwarz, weiß oder gefleckt sein. Mir gefallen die Weißen am besten; weiße Rentiere sind für mich wie Wolken, die über das Gesicht von Mutter Erde driften.
Nie habe ich ein Tier von fügsamerer Natur und größerer Ausdauer gesehen als das Rentier. Trotz ihrer Größe sind sie ausgesprochen wendig, und selbst beladen mit schweren Lasten durchqueren sie mühelos Bergwälder und Sumpfland. Ihre Körper sind eine wahre Schatzkammer; ihr Fell schützt gegen Kälte, und ihre Geweihe, Sehnen, Penisse, Plazentas und sogar das nach ihrem Tod abgezapfte Herzblut galten als kostbare Medizin, die die Anda gerne gegen die von ihnen angebotenen Waren tauschten.
Der Rentiermilchtee, den wir allmorgendlich tranken, rann unsere Kehlen hinunter wie süßes Quellwasser. Auf der Jagd waren die Rentiere die Gehilfen der Jäger. Es genügte, ihnen die Beute auf den Rücken zu legen, und schon brachten sie sie zuverlässig und selbstständig zurück ins Lager. Wenn wir weiterzogen, trugen sie unsere Nahrung und Gebrauchsgegenstände. Frauen, Kinder, Alte und Schwache ritten auf ihnen.
Und dabei benötigten sie wenig Fürsorge. Sie suchten ihr eigenes Futter; der Wald war ihre Kornkammer. Im Frühling fraßen sie außer Flechten und Moosen auch das grüne Gras, Küchenschellen und die Dornensträucher dazwischen. Im Sommer kauten sie Birkenrinde und Weidenblätter, im Herbst ließen sie sich am liebsten aromatische Waldpilze schmecken.
Dabei ernährten sie sich auf genügsame Weise, knabberten auf einer Wiese nur ein wenig hier und dort, knickten kaum ein Blatt, und alles blieb so grün wie zuvor. Von den Bäumen fraßen sie immer nur wenig ab, bevor sie weiterzogen, sodass Birken und Weiden in ihrer ganzen Blätterpracht erhalten blieben. Waren sie durstig, tranken sie im Sommer aus dem Fluss und fraßen im Winter Schnee.
Solange wir ihnen eine Glocke um den Hals banden, mussten wir uns keine Sorgen machen, dass sie verloren gingen. Der Wind trug uns das Bimmeln zu und verriet uns so ihren Aufenthaltsort, außerdem verscheuchte es die Wölfe.
Ganz gewiss haben uns die Geister die Rentiere gegeben, denn ohne sie würden wir nicht existieren. Obwohl es ein Rentier war, das mir einst meinen Liebsten genommen hat, mag ich sie sehr. Ihre Augen nicht zu sehen ist, wie die Sonne des Tages oder die Sterne der Nacht nicht zu sehen; es ließe mich aus tiefstem Herzen seufzen.
Was ich kaum ertragen konnte, war das Beschneiden der Rentiergeweihe mit der Knochensäge. Zwischen Mai und Juli bildeten sie ihre Geweihe aus, und dies war auch die Zeit der Geweihbeschneidung. Im Gegensatz zur Jagd, der in der Regel nur die Männer nachgingen, wurde diese Arbeit von Frauen wie Männern ausgeübt.
Rentiere beiderlei Geschlechts bilden Geweihe aus. Typischerweise ist das Geweih eines Bullen kräftig und robust, während das der kastrierten Männchen filigraner ist.
Vor dem Absägen des Geweihs wurde das Rentier fest an einen Baum gebunden und zwischen zwei Holzpflöcke gezwängt. Das Geweih ist Teil ihres Fleisches, weshalb die Rentiere vor Schmerz mit den Hufen strampelten und stampften und die Säge vor Blut troff. Um die Blutung zu stoppen, musste die Wunde mit einem heißen Eisen kauterisiert werden. So haben wir es jedenfalls früher gemacht. Heute streuen wir weißes, entzündungshemmendes Pulver auf die Wunden, das genügt.
Maria konnte den Anblick der blutüberströmten Säge noch weniger ertragen und weinte jedes Mal, wenn die Geweihe gekürzt wurden, als ob ihr eigenes Blut vergossen würde.
»Geh nicht hin, Maria!«, ermahnte meine Mutter sie dann, aber Maria hörte nie auf den Rat anderer. Sie weinte nicht oft, nur beim Anblick von Blut strömten die Tränen summ summ aus ihr heraus wie ein Schwarm Honigbienen. Mutter behauptete, Maria weine deshalb so heftig, wenn sie Blut sehe, weil sie keine Kinder bekommen könne. Monat für Monat sah sie das Blut aus ihrem Unterleib fließen. Auch dann weinte sie hemmungslos, aus Verzweiflung, dass ihre und Hases Anstrengungen abermals vergeblich gewesen waren.
Noch mehr als Maria und Hase wünschte sich Hases Vater Dashi einen Nachkommen. Dashi hatte einst im Kampf mit Wölfen ein Bein verloren. Seitdem knirschte er nachts, wenn er ihr Heulen hörte, grimmig mit den Zähnen. Er war dürr und blass, und seine Augen tränten, sobald er ins Sonnenlicht oder in den Schnee blickte. Für gewöhnlich blieb er daher in seinem Shirangju. Zogen wir weiter, ritt er selbst an wolkenverhangenen Tagen mit verbundenen Augen auf seinem Rentier. Man konnte meinen, dass er nicht nur das Sonnenlicht, sondern auch den Anblick von Bäumen, Flüssen, Blumen und Vögeln nicht ertragen konnte. Im ganzen Urireng gab es keinen, der so bleich und so heruntergekommen war wie Dashi. Rinke erzählte, er habe sich nach dem Verlust seines Beins nie wieder rasiert oder die Haare geschnitten. Sein dünnes schlohweißes Haar und sein spärlicher Bart waren vollkommen verfilzt und bedeckten sein Gesicht wie grauweiße Flechten einen alten, verwitterten Baum.
Er war ein schweigsamer Zeitgenosse, und wenn er doch einmal den Mund auftat, dann ging es immer um Marias Bauch. »Wo ist mein Omolie?«, fragte er dann. »Wann bringt er seinem Aya sein Bein zurück?« Omolie bedeutet Enkelsohn und Aya Großvater. Wenn er nur erst einen Enkel hätte, glaubte Dashi, würde dieser den Wolf, der ihn zum Krüppel gemacht hatte, töten und ihm sein Bein zurückbringen, sodass er aufs Neue schnell wie der Wind durch die Wälder jagen könnte.
Wenn Dashi so redete, bedachte er Maria mit einem Blick, bei dem sie hastig ihren Bauch mit den Händen bedeckte, das Shirangju verließ und sich draußen weinend an einen Baum lehnte. Immer, wenn wir Maria weinend neben einem Baum sahen, wussten wir, dass Dashi wieder etwas gesagt hatte.
Aber dann kam der Falke und Dashis Schicksal nahm eine überraschende Wendung. Stets hatte er allein in seinem Shirangju gehaust, doch der Falke sorgte dafür, dass die Lebensgeister des griesgrämigen Alten mit einem Mal aufs Neue erwachten. Er richtete den Falken zu einem unerbittlichen Jäger ab und gab ihm einen Namen: Omolie.
Hase hatte den Falken mit einer Vogelfalle gefangen, die er auf einem hoch aufragenden Gebirgsfelsen platziert hatte. Die Falken, die in der Luft auf Beutejagd kreisten, hielten solche Fallen für einen geeigneten Rastplatz, stießen hinab und wurden zu Gefangenen. Hase trug den graubraunen Falken nach Hause und überließ es Dashi, ihn abzurichten; vermutlich, damit sein Vater endlich eine Beschäftigung hatte.
Die Augen des Falken hatten goldene Ränder, und seine Iris verströmte eisiges Licht. Sein spitzer, gebogener Schnabel schien bereit, jederzeit zuzustoßen, sein Brustgefieder war schwarz gemustert, und seine majestätischen Schwingen hatten einen seidigen Glanz.
Hase kettete ihn an und stülpte über seinen Kopf ein Rentierfell, das die Augen bedeckte, den Schnabel aber frei ließ. Der Falke wurde wild, reckte den Schnabel hoch und kratzte mit seinen scharfen Krallen eine tiefe Furche nach der anderen in den Boden. Wir Kinder rannten herbei, um uns den Falken anzusehen, aber Lena, Jilande und Jindele ließen Nora und mich stehen und liefen gleich wieder feige davon.
Kaum dass Dashi den Falken zu Gesicht bekam, kam Leben in ihn, und er stieß ein fröhliches Geheul aus: »Ulululu, ulululu!« Er humpelte herbei, bückte sich schwerfällig nach einem Stein vom Rand der Feuerstelle und warf ihn nach dem Vogel. Mit einem deutlichen Klacken traf er den Falken am Kopf, der daraufhin aufgebracht mit den Flügeln schlug. Selbst mit dem Fell über den Augen wusste er, woher der Stein gekommen war, flatterte auf und stieß wie ein Sturmwind in Dashis Richtung. Angekettet, wie er war, kam er nicht weit. Während der Vogel wütend kreischte, kicherte Dashi schadenfroh, was grässlicher war als das nächtliche Heulen eines Wolfs. Nora und ich huschten erschrocken aus seinem Shirangju; nicht weil uns der Falke Angst machte, sondern Dashis Lachen.
Danach sahen Nora und ich Tag für Tag dabei zu, wie Dashi den Falken abrichtete. Anfangs ließ er ihn hungern, bis der Vogel sichtlich abmagerte. Er wolle dem Falken auch noch die letzten Futterreste aus dem Magen kratzen, sagte Dashi. Er hackte frisches Kaninchenfleisch in Würfel, die er mit Ulgras umwickelte und anschließend dem Falken zu fressen gab. Da der Vogel das Gras nicht verdauen konnte, würgte er jeden Happen vollständig wieder aus, und man sah, dass ein dünner Fettfilm auf dem Ulagras klebte.
Mit dieser Methode säuberte Dashi erst gründlich die Innereien des Falken, bevor er ihm etwas gab, das der Vogel bei sich behalten konnte. Er bat mich, eine Wiege zu holen. Da Maria kein Kind bekam, hatten sie keine in ihrem Shirangju. Mein Bruder Luni konnte schon laufen und brauchte keine Wiege mehr, also trug ich unsere hinüber zu Dashi. Als Hase seinem Vater half, die Wiege aufzuhängen, wurden Marias Augen schon wieder feucht.
Ich habe im Leben kein zweites Mal einen Falken in einer Wiege gesehen. Dashi band die Flügel und die Krallen des Falken mit Stroh zusammen, sodass der Vogel reglos in der Wiege lag, die Dashi, eine Hand auf den Stock gestützt, wie verrückt hin und her schaukelte und dabei die seltsamsten Verrenkungen machte. Kein Zweifel, hätte ein Kind in dieser Wiege gelegen, wäre es von Dashis Schaukeln schwachsinnig geworden. Noch dazu stieß er, während er den Falken wiegte, unentwegt sein hohes »Ulululu« aus, als hätte sich der Wind in seinen Rachen verirrt.
»Warum tust du das?«, fragte ich ihn.
»Ich will, dass der Falke seine Vergangenheit vergisst und sich fügsam den Menschen unterordnet«, antwortete Dashi.
»Willst du, dass er die Wolken am Himmel vergisst?«, fragte ich weiter.
Dashi spuckte einmal kräftig aus. »Jawohl«, donnerte er, »ich will aus einer Kreatur des Himmels eine Kreatur der Erde machen. Ich werde den Falken in Pfeil und Bogen verwandeln, mit dem ich meinen schlimmsten Feind vernichte, diesen verfluchten Wolf!«
Nachdem Dashi die Gedärme des Falken gereinigt und ihn drei Tage lang in der Wiege herumgeschüttelt hatte, war der Vogel fraglos nicht mehr dasselbe Wesen wie zuvor.
Als Nächstes zog Dashi dem Vogel das Rentierfell vom Kopf, und ich stellte fest, dass sein Blick nicht mehr so eisig war wie zuvor, sondern verwirrt und sanftmütiger. Dashi war zufrieden. »Jetzt bist du ein gehorsamer Omolie!«, sagte er. Damit er nicht davonflog, band Dashi ihm ein Lederband um die Klauen und ein Glöckchen an die Schwanzfedern. Dann warf er sich einen Ledermantel über, setzte den Falken auf seine linke Schulter, verließ sein Shirangju und kam zu uns herüber. Er sagte, der Falke solle mit den Menschen vertraut werden; wenn er uns öfter sehe, gewöhne er sich daran, unter uns zu leben.
Dashi stützte den rechten Arm auf den Stock und streckte den linken aus, damit er dem Falken als Sitzstange diente. Wenn Dashi loshumpelte, humpelte der Falke mit ihm, wobei fortwährend das Glöckchen an seinem Schwanz bimmelte. Es war urkomisch. Hatte Dashi ursprünglich stets das Licht gemieden, scheute er auf seinen Spaziergängen mit dem Falken die Sonnenstrahlen nicht mehr, auch wenn die Tränen wie Bäche seine Wangen hinabrannen. Von da an ritt er, wenn wir das Lager wechselten, nie mehr mit Augenbinde.
Wenn man im Lager das Glöckchen bimmeln hörte, wusste man, dass Dashi mit seinem Falken im Anmarsch war.
»Sieh dir meinen Omolie an, Tamara«, sagte er, wenn er meiner Mutter begegnete. »Der macht was her, nicht wahr?« Sofort ließ Tamara alles stehen und liegen, trat auf ihn zu und bedachte den Falken mit einem wohlwollenden Nicken.
Zufrieden ging Dashi dann weiter zu Evelyn. Häufig traf er sie rauchend an. »Mach sofort die Zigarette aus!«, befahl er barsch. »Der Rauch schadet dem Geruchssinn des Falken.«
Evelyn drückte brav die Zigarette aus und begutachtete den Falken. »Ruft dein Omolie dich Aya?«, fragte sie.
»Nein, er ruft nicht Aya, er ruft ›Evelyn!‹«, gab Dashi erbost zurück. »›Evelyn hat eine krumme Nase‹, das ruft er!«
Evelyn lachte schallend. Sie hatte wirklich eine krumme Nase. Als Kind sei sie ziemlich ungezogen gewesen, hatte uns Rinke erzählt. Mit vier Jahren war sie einmal einem grauen Eichhörnchen in den Wald nachgejagt. Das Eichhörnchen war einen Baum hinaufgeflitzt und Evelyn geradewegs gegen den Stamm gerannt. Sie hatte sich das Nasenbein gebrochen.
Mir gefiel ihre krumme Nase, da sie ein kleines und ein großes Auge hatte und sich ihre Nase zum kleinen Auge hinbog, was ihr Profil ausgeglichener wirken ließ.
Dashi wurde es nicht müde, jedermann seinen Falken vorzuführen, und mit den täglichen Spaziergängen begann er, ihn auch zu füttern. Er gab ihm aber nur ein paar Bissen Fleisch, damit er dauerhaft ein wenig hungrig blieb. »Ein satter Falke ist nicht darauf aus, Beute zu jagen«, sagte Dashi.
Vor seinem Shirangju errichtete er für den Falken aus Rundholz eine Ansitzstange, die sich frei drehen ließ. Damit der Falke seine Klauen nicht am Holz verletzte, verkleidete Dashi die Stange mit Rentierhaut. »Die Klauen des Falken sind wie das Gewehr des Jägers«, sagte er. »Man muss gut darauf achtgeben.«
Obwohl der Falke inzwischen schon recht zahm geworden war, befestigte Dashi eine lange, dünne Schnur mit einem Drehwirbel am Ende an einer seiner Krallen, damit er nicht davonfliegen, sich aber auch nicht darin verheddern konnte.
Dashi strich dem Falken jeden Tag über die Kopf- und Brustfedern und stieß dabei sein schrilles »Ulululu« aus. Ich hegte den Verdacht, dass Dashi grüne Farbe an seinen Händen haben musste, denn nicht nur spreizte der Falke zunehmend die Flügel, sie bekamen auch einen dunklen Grünstich, als hätte jemand dem Vogel einen Mantel aus Moos umgelegt.
Als wir bald darauf weiterzogen, ritt Dashi mit dem Falken auf der Schulter auf einem Rentier und wirkte mit einem Mal so energiegeladen, als hätte er sein fehlendes Bein wieder. Mittlerweile musste er den Raubvogel auch nicht mehr anbinden; selbst wenn er seinen Blick zum Himmel richtete, schien er nicht die Absicht zu hegen, auf und davon zu fliegen. Es sah so aus, als ob Dashis unermüdliches Wiegen den Vogel tatsächlich vollkommen hatte vergessen lassen, dass er ein Wesen der Lüfte war.
Nur wenn wir das Lager wechselten, bekamen wir zu sehen, wie der Falke seine Beute schlug. Hase wollte ihn gern mit auf die Jagd nehmen, aber das ließ Dashi nicht zu. Sein Omolie gehörte ihm allein.
Ich weiß noch, wie ich den Falken zum ersten Mal einen Hasen jagen sah. Es war zu Beginn des Winters, als die Bergwälder noch nicht unter tiefem Schnee begraben waren. Wir folgten dem Pa Bera nach Süden. In dieser Gegend wuchsen besonders viele Arten von Flechten, und es wimmelte von Wild. Überall sah man Haselhühner über die Baumwipfel fliegen und Hasen zwischen den Bäumen ihre Haken schlagen.
Der Falke, der zunächst noch ruhig auf Dashis Schulter gesessen hatte, wurde immer nervöser. Er hob den Kopf und schlug leicht mit den Flügeln, als wollte er jeden Augenblick losfliegen. Ein Hase rannte aus einem Kiefernwald. Dashi stieß den Falken an und rief: »Dschu, dschu, Omolie!«, wobei »Dschu« so viel wie »jagen« bedeutet.
Sofort breitete der Falke seine Flügel aus, hob ab und hatte, ehe wir uns versahen, den Hasen gefangen. Zuerst packte er ihn mit einer Klaue am Hinterteil, und als der Hase sich umwandte und zur Wehr setzen wollte, schloss sich die andere Klaue um den Kopf. Im Nu hatte der Vogel seine Beute erstickt und riss ihr mit einem Ruck seines scharfen Schnabels den Bauch auf. Dampfend quollen die Innereien auf den Waldboden wie eine frische rote Blüte. Vor Begeisterung stimmte Dashi erneut sein lautes »Ulululu« an.
Auf dem Weg zu unserem nächsten Lager verschossen wir keine einzige Kugel, denn der Falke fing für uns fünf oder sechs Hasen und drei Fasane. Nachts, nachdem wir abends ein Feuer entfacht hatten, waberte der Duft von gebratenem Fleisch durch die Luft. Sobald wir unser neues Lager erreicht und dort unsere Shirangjus errichtet hatten, ließ Dashi den Falken nicht mehr für uns jagen. Stattdessen breitete er einen grauen Wolfspelz auf dem Boden aus und schrie dem Vogel den Jagdbefehl »Dschu! Dschu!« zu, damit er sich auf den Pelz stürzte.





























