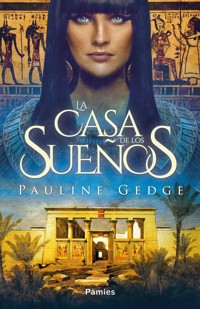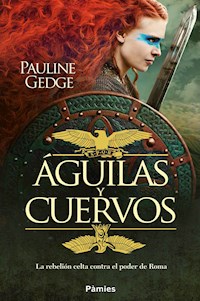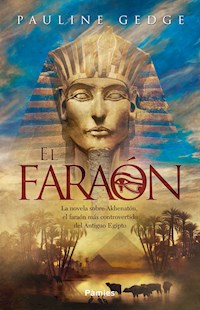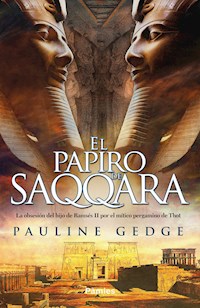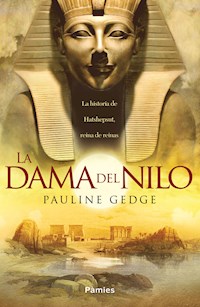4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
«Das Mädchen Thu und der Pharao» ist die Geschichte einer ehrgeizigen jungen Frau und ihres Aufstiegs von der Tochter einer Dorfhebamme zur Nebenfrau des mächtigen Ramses III. Klug nutzt sie ihre Fähigkeiten als Heilkundige und setzt all ihre Verführungskünste ein, um ins Zentrum der Macht zu gelangen. Doch als sie nicht mehr leugnen kann, dass sie in rätselhafte Mordanschläge und Intrigen am Hofe verstrickt ist, scheint ihr Schicksal besiegelt zu sein. «Eine aufregende Story aus dem Land der Pharaonen.» (Brigitte)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 745
Ähnliche
Pauline Gedge
Das Mädchen Thu und der Pharao
Roman
Aus dem Englischen von Dorothee Asendorf
Über dieses Buch
«Das Mädchen Thu und der Pharao» ist die Geschichte einer ehrgeizigen jungen Frau und ihres Aufstiegs von der Tochter einer Dorfhebamme zur Nebenfrau des mächtigen Ramses III. Klug nutzt sie ihre Fähigkeiten als Heilkundige und setzt all ihre Verführungskünste ein, um ins Zentrum der Macht zu gelangen. Doch als sie nicht mehr leugnen kann, dass sie in rätselhafte Mordanschläge und Intrigen am Hofe verstrickt ist, scheint ihr Schicksal besiegelt zu sein.
«Eine aufregende Story aus dem Land der Pharaonen.» (Brigitte)
Vita
Pauline Gedge, geboren 1945 in Auckland, Neuseeland, verbrachte einen Teil ihrer Kindheit in England und lebt heute in Alberta, Kanada. Mit ihren Büchern, die in zahlreiche Sprachen übersetzt sind, gehört sie zu den erfolgreichsten Autorinnen historischer Romane.
Kapitel eins
MEIN Vater war Söldner, ein blonder, blauäugiger Riese, den es während der Unruhen unter dem syrischen Iri-pat, dem Wesir Irsu, nach Ägypten verschlagen hatte, als Fremdlinge ungehindert das Land durchzogen und brandschatzten und schändeten. Eine Zeitlang hielt er sich im Delta auf und nahm jede Arbeit an, denn er achtete das Gesetz und wollte nichts mit den herumstreunenden, plündernden Banden zu tun haben. Er hütete Vieh, trat Trauben und schwitzte in den Tongruben der Ziegeleien. Doch als der Vater unseres Großen Gottes Ramses, Osiris Sethnacht der Ruhmreiche, dem ’verkommenen Syrer die Macht entriß, nutzte mein Vater die Gelegenheit, schloß sich den Fußsoldaten an, marschierte durch Städte und Dörfer längs des Nils und verfolgte und verjagte die vagabundierenden Plündererhorden, nahm fest, richtete hin und beteiligte sich damit an der Wiedereinsetzung der Maat, der alten Ordnung in Ägypten. Denn die war angeschlagen und fast zugrunde gerichtet, weil jahrelang Erzlumpen nach Ägyptens Thron trachteten, von denen keiner es verdiente, die Inkarnation des Gottes genannt zu werden.
Zuweilen bestand der betrunkene Abschaum, den die Schwadron meines Vaters aufrieb, aus Libyern seines eigenen Stammes, den Tamahu, und die Männer waren blondhaarig und helläugig wie er, doch sie waren nicht in die Zwei Länder gekommen, um zuzupacken oder ein ehrliches Leben zu führen, sondern um zu stehlen und zu töten. Sie glichen Raubtieren, und mein Vater brachte sie bedenkenlos um.
Eines glühendheißen Nachmittags im Monat Mesore schlug die Schwadron ihre Zelte nördlich der heiligen Stadt Theben, am Rande des Dorfes Aswat auf. Sie waren schmutzig, müde und hungrig, und das Bier war ihnen ausgegangen. Der Hauptmann schickte meinen Vater und vier weitere Soldaten aus, um beim Dorfältesten zu requirieren, was immer die Scheuern bieten mochten. Als sie an der Tür einer Lehmhütte vorbeikamen, hörten sie drinnen Tumult, Frauen kreischten, Männer johlten. Nach wochenlangen Scharmützeln war ihr Gespür geschärft, und so befürchteten sie schon das Schlimmste. Sie drangen in den kleinen, dunklen Flur ein, wo ihnen angetrunkene Männer und Frauen entgegentorkelten und vor Freude in die Hände klatschten. Jemand drückte meinem Vater einen Bierkrug in die Hand. «Den Göttern sei Lob und Dank! Ich habe einen Sohn!» übertönte eine Stimme den Trubel. Mein Vater trank gierig, drängte sich durch die Menschenmenge und stand auf einmal vor einer zierlichen Frau mit olivfarbener Haut und zarten Zügen, die ein schniefendes Leinenbündel in den blutverschmierten Armen wiegte. Die Hebamme. Meine Mutter. Mein Vater musterte sie ausgiebig über den Rand seines Kruges. Mannhaft und gelassen, wie es seine Art war, ging er mit sich zu Rate. Die Leute nahmen sie freundlich auf. Der Dorfälteste überließ der Schwadron eine großzügig bemessene Menge Korn aus den mageren Vorräten des Dorfes. Die Frauen kamen zu den Zelten und wuschen den Soldaten die schmutzige Wäsche. Aswat war schön und beschaulich, es hielt an den überlieferten Werten fest, seine Bäume spendeten Schatten, sein Ackerland war fruchtbar und die Wüste dahinter unberührt.
An dem Tag, als die Schwadron gen Süden aufbrach, suchte mein Vater das Haus auf, in dem meine Mutter mit ihren Eltern und Brüdern lebte. Er brachte ihr das einzig Wertvolle, was er besaß, einen kleinen goldenen Skarabäus an einer Lederschnur, den er im Delta im Schlamm eines Nebenarms gefunden hatte und den er seitdem um das sehnige Handgelenk geschlungen trug. «Noch stehe ich in Diensten des Vollkommenen Gottes», sagte er zu meiner Mutter und drückte ihr dabei den Skarabäus in die kleine braune Hand, «aber wenn ich meine Zeit abgedient habe, komme ich zurück. Warte auf mich.» Und sie blickte in die sanften, aber gebieterischen Augen dieses hochgewachsenen Mannes, dessen Haar so golden war wie der Sonnenschein und dessen Mund Freuden versprach, von denen sie bislang nur geträumt hatte, und nickte stumm.
Er hielt Wort. Im folgenden Jahr wurde er zweimal verwundet und schließlich aus dem Heer entlassen und ausgezahlt, und man teilte ihm die drei Aruren Land zu, um die er in der Provinz Aswat gebeten hatte. Als Söldner erhielt er die Felder unter der Voraussetzung, daß man ihn jederzeit wieder zu den Waffen rufen konnte, und er mußte den Zehnten seiner Ernte an die Schatulle des Pharao zahlen, doch er hatte, was er wollte: die ägyptische Staatsbürgerschaft, ein Stück Land und eine hübsche Frau, die aus diesem Dorf stammte und ihm dabei helfen würde, das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen.
Das alles habe ich natürlich von meiner Mutter erfahren. Ihre Begegnung, die Liebe auf den ersten Blick, der schweigsame, schlachtenmüde Soldat und das drahtige, kleine Dorfmädchen, ich bekam diese anrührende Geschichte nie satt. Die Familie meiner Mutter lebte seit vielen Generationen in Aswat, hatte die Nase nicht in anderer Leute Dinge gesteckt, war ihren religiösen Pflichten in dem kleinen Tempel Wepwawets, des Kriegsgottes mit dem Schakalkopf und Schutzgottes der Provinz, nachgekommen, und aus Geburten, Hochzeiten und Todesfällen im Dorf war ein festes Netz entstanden, das ihnen Geborgenheit und ein einfaches Leben bot. Sie wußte wenig über die Vorfahren meines Vaters, denn er sprach nie über sie. «Sie sind Libyer, von irgendwo da drüben», sagte sie und deutete mit dem Arm in Richtung Westen, denn als echte Ägypterin war ihr alles gleichgültig, was jenseits der Grenze lag. «Von ihnen hast du die blauen Augen, Thu. Vermutlich waren sie Hirten, Nomaden.» Doch das bezweifelte ich, wenn ich sah, wie der Schein der Öllampe auf Vaters glänzenden, schweißnassen, kräftigen Schultern und muskulösen Armen spielte, wenn er mit gekreuzten Beinen auf dem sandigen Boden unseres Empfangsraums saß und sich über ein landwirtschaftliches Gerät beugte, das er ausbesserte. Seine Vorfahren waren wohl eher Krieger gewesen, feurige Männer, die sich um einen barbarischen libyschen Fürsten scharten, um für ihn in einer endlosen Abfolge von Stammeskriegen zu kämpfen.
Zuweilen träumte ich mit offenen Augen, daß in den Adern meines Vaters edles Blut flösse, daß sein Vater, mein Großvater, auch solch ein Fürst gewesen wäre, der sich heftig mit Vater gestritten und ihn verbannt hätte, so daß er, der Unbehauste, der Mann ohne Freunde, den Weg ins gesegnete Land Ägypten gefunden hatte. Eines Tages würde Nachricht kommen, daß ihm vergeben war, wir würden unsere wenigen Habseligkeiten auf den Esel laden, die Kuh und den Ochsen verkaufen und an einen fernen Hof reisen, wo mein Vater mit offenen Armen und mit Tränen von einem alten Mann empfangen werden würde, den das Gold schier zu Boden drückte. Man würde Mutter und mich in lieblichen Ölen baden, uns in schimmerndes Leinen kleiden und mit Amuletten aus Türkis und Silber behängen. Alles würde sich vor mir, der so lange verschollenen Prinzessin, verneigen. Da saß ich nun im Schatten unserer Dattelpalme und musterte meine braunen Arme, meine langen, schlaksigen, ständig staubigen Beine und dachte, daß das Blut, das unmerklich in den bläulichen Adern meiner Handgelenke pulsierte, mir vielleicht eines schönen Tages Zugang zu Reichtum und Stellung verschaffen könnte. Und damit neckte mich mein Bruder Pa-ari, der ein Jahr älter und viel klüger war als ich. «Du kleine Dreckprinzessin!» sagte er lächelnd. «Du Binsenbettenkönigin! Glaubst du im Ernst, daß sich Vater mit ein paar lumpigen Aruren mitten im Nichts zufriedengeben würde oder eine Hebamme geheiratet hätte, wenn er ein Fürst wäre? Los, steh auf und bring die Kuh zur Tränke. Sie ist durstig.» Und so machten wir uns zum Fluß auf, meine Hand auf ihrer weichen, warmen Schulter, und während die Kuh das lebenspendende Naß trank, betrachtete ich mein Spiegelbild in den klaren Tiefen des Nils. Die langsamen Wirbel um meine Füße verzerrten das Bild, machten aus meinem fließenden schwarzen Haar eine verschwommene Wolke rings um mein Gesicht und aus meinen befremdend blauen Augen ein farbloses Glitzern, das geheimnisvolle Botschaften aussandte. Eine Prinzessin, ja, vielleicht. Man konnte nie wissen. Ich wagte es nicht, meinen Vater danach zu fragen. Er war liebevoll, nahm mich auf die Knie und erzählte mir Geschichten und war für jedes Thema zugänglich, nur nicht für seine Vergangenheit. Es war eine stillschweigende Absprache, aber dennoch eine Absprache. Meine Mutter, die ihn noch immer innig liebte, verspürte, glaube ich, eine ehrfürchtige Scheu vor ihm. Die Dorfbewohner ganz gewiß. Sie vertrauten ihm. Sie zählten darauf, daß er sich an der Verwaltung des Dorfes beteiligte. Er half dem Dorf-Madjai bei der Überwachung der Umgegend. Doch nie waren sie so ungezwungen-vertraulich mit ihm wie mit einem Einheimischen. Sein langes goldenes Haar, sein fester, befremdend blauer Blick wiesen immer den Fremdling aus.
Mir erging es etwas besser. Ich hatte wenig übrig für die Mädchen aus dem Dorf mit ihrem Gekicher, ihren albernen Spielen, ihrem unschuldigen, aber langweiligen Klatsch über Dorfangelegenheiten, und sie mochten mich auch nicht. Denn mit dem kindlichen Argwohn gegen jeden, der sich von ihnen unterschied, hatten sie mich ausgeschlossen. Vielleicht fürchteten sie sich vor dem bösen Blick. Und ich kam ihnen natürlich nicht gerade entgegen. Ich war zurückhaltend und unwillentlich überheblich und stellte dauernd die falschen Fragen, denn ich dachte weiter als sie. Pa-ari hatte es leichter, angenommen zu werden. Er war zwar größer und schmaler gebaut als die anderen Dorfjungen, war aber nicht mit blauen Augen geschlagen. Von meiner Mutter hatte er die ägyptischen braunen Augen und das schwarze Haar und von Vater eine angeborene Autorität, die ihn unter Gleichaltrigen zum Anführer machte. Und dabei legte er gar keinen Wert darauf. Er wollte nichts anderes, als sich mit Worten beschäftigen. Ein Söldner konnte das ihm zugewiesene Land an seinen Sohn vererben, vorausgesetzt, der Junge ergriff den Beruf des Vaters, doch Pa-ari wollte Schreiber werden. «Ich bin gern auf dem Hof, und das Dorfleben gefällt mir», sagte er einmal, «aber wer nicht lesen und schreiben kann, muß sich auf Wissen und Kenntnisse anderer verlassen. Er kann sich keine eigene Meinung über all das bilden, was nicht zu seinem schlichten, täglichen Leben gehört. Ein Schreiber hat Zugang zu Bibliotheken, er kann sich bilden, er kann die Vergangenheit würdigen und die Zukunft formen.»
Als Pa-ari vier war und ich drei, brachte Vater ihn in die Tempelschule. Vater selbst konnte weder lesen noch schreiben und mußte sich auf den Dorfschreiber verlassen, daß er die jährliche Steuer auf die Ernte errechnete und ihm sagte, was er schuldig war. Wir wußten nicht, was Vater vorhatte, als er Pa-ari an die Hand nahm und mit ihm den sonnengedörrten Pfad zu Wepwawets Tempel einschlug. Vielleicht wollte er nur, daß man seinen Erben nicht betrog, wenn dieser seinerseits die wenigen Felder bestellte, die uns ernährten. Ich weiß noch, daß ich an unserer Haustür stand und die beiden in der blanken Frische des frühen Morgens verschwinden sah. «Wohin bringt Vater Pa-ari?» fragte ich meine Mutter, die hinter mir mit einem Korb Wäsche im Arm auftauchte. Sie blieb stehen und wuchtete die Last auf die Hüfte.
«Zur Schule», erwiderte sie. «Sei so lieb, lauf ins Haus und hol das Natron, Thu. Wir müssen die Wäsche waschen, und dann muß der Teig zum Ofen gebracht werden.» Ich jedoch rührte mich nicht.
«Ich will auch zur Schule gehen», sagte ich. Sie lachte.
«Nein, du nicht», sagte sie. «Zum einen bist du zu jung. Und zum anderen gehen Mädchen nicht zur Schule. Sie lernen zu Hause. Aber jetzt beeil dich mit dem Natron. Ich will zum Fluß.»
Als meine Mutter dann die Wäsche auf die Steine am Wasser geklatscht, das grobe Leinen mit Natron bearbeitet und mit den anwesenden Frauen geschwatzt hatte, war mein Vater bereits zurück und aufs Feld gegangen. Als ich meiner Mutter nach Hause folgte, sah ich ihn gebückt zwischen den grünen Weizenschößlingen hacken, die ihm die nackten Waden kitzelten. Ich half ihr, die Wäsche auf die Leine zu hängen, die wir in unserem Empfangszimmer gezogen hatten, das sich wie alle anderen im Dorf zum Himmel öffnete, dann sah ich ihr zu, wie sie den Teig für das Abendessen knetete. Ich verhielt mich ruhig und dachte nach, denn Pa-ari fehlte mir. Wir hatten die Tage zusammen mit Spielen verbracht und kleine Abenteuer inmitten des Papyrusdickichts und im Unterholz am Flußufer erlebt.
Als sich meine Mutter zum Dorfbackofen aufmachte, rannte ich in die entgegengesetzte Richtung, verließ den Saumpfad, der sich längs des Flusses schlängelte, und folgte dem schmalen Bewässerungskanal, der Vaters wenige Aruren bewässerte. Als ich mich näherte, richtete er sich auf, lächelte und beschattete die Augen mit der breiten, schwieligen Hand. Außer Atem lief ich zu ihm.
«Ist etwas passiert?» fragte er. Ich umschlang seinen kräftigen Schenkel mit den Armen und drückte mich an ihn. Ich weiß auch nicht, warum mir dieses Bild nicht entfallen ist, sondern mir nach so vielen Jahren noch immer leuchtend und lebendig vor Augen steht. Oftmals sind es nicht die Ereignisse von großer Tragweite, die haftenbleiben, wenn wir uns sagen: Das vergesse ich meiner Lebtage nicht, sondern die kleinen, unbedeutenden Begebenheiten, die fast unbemerkt vorbeihuschen, aber wieder und wieder hochsteigen und im Laufe der Zeit immer wirklicher werden. So erging es damals auch mir. Ich spüre noch die weiche Behaarung seiner sonnenverbrannten Haut an meinem Gesicht, sehe das sacht raschelnde junge Getreide, das sich grün vor der hellgelben, sonnengleißenden Wüste abhebt, rieche seinen Schweiß und fühle mich getröstet und geborgen. Ich machte einen Schritt zurück und blickte zu ihm hoch.
«Ich möchte mit Pa-ari zur Schule gehen», sagte ich. Er bückte sich, ergriff einen Zipfel seines kurzen, staubigen Schurzes und wischte sich die Stirn.
«Nein», antwortete er.
«Nächstes Jahr, Vater, wenn ich vier bin?»
Sein bedächtiges Lächeln wurde breiter. «Nein, Thu. Mädchen gehen nicht zur Schule.» Ich musterte sein Gesicht. «Warum nicht?»
«Weil Mädchen daheim bleiben und von ihren Müttern lernen, wie man eine gute Frau wird und Kinder aufzieht. Wenn du älter bist, wird deine Mutter dich lehren, wie man Kindern auf die Welt hilft. Das wird dann deine Arbeit hier im Dorf.» Ich kräuselte verständnislos die Stirn. Dann kam mir ein Gedanke. «Vater, wenn ich Pa-ari bitte, kann der dann nicht zu Hause bleiben und Kindern auf die Welt helfen und ich gehe an seiner Stelle zur Schule?»
Mein Vater lachte selten, aber an jenem Tag warf er den Kopf zurück, und sein schallendes Gelächter hallte von den aufgereihten, verwelkten Palmen wider, die zwischen seinem Land und dem Pfad zum Dorf wuchsen. Er ging in die Hocke und umfaßte mein Kinn mit seinen großen Fingern. «Der Junge, der dich einmal heiratet, der dauert mich jetzt schon!» sagte er. «Mein kleines Schätzchen, du mußt lernen, wo dein Platz ist. Geduld, Sanftmut, Bescheidenheit, das sind die Tugenden einer guten Frau. Und jetzt sei lieb und lauf nach Haus. Begleite deine Mutter, wenn sie Pa-ari abholt.» Er drückte mir einen Kuß auf den erhitzten Kopf und wandte sich ab. Ich tat, wie mir geheißen wurde, wirbelte aber tüchtig Staub auf, denn irgendwie hatte er mich mit seinem Gelächter gekränkt, aber warum, das wußte ich nicht, dazu war ich noch zu klein.
Meine Mutter hatte einen Korb am Arm und blickte ängstlich den Pfad auf und ab, sie winkte mir ungeduldig, und dann schlugen wir den Weg längs unserer Felder ein. Nach einem Weilchen endeten die Felder, das Gebüsch zu unserer Rechten verlor sich im Nichts, und vor uns erhob sich Wepwawets Tempel mit Säulen, die hoch in den blanken, blauen Himmel ragten, während die Sonne ohnmächtig an seinen Mauern abprallte. Seit meiner Geburt war ich zu den Feiertagen des Gottes hierhergekommen, hatte zugesehen, wie mein Vater unsere Opfergaben darbrachte, hatte mich neben Pa-ari bäuchlings zu Boden geworfen, während aus dem geschlossenen Innenhof schimmernder Weihrauch hochwölkte. Ich hatte die Priester in feierlicher Prozession gesehen, und ihre Gesänge waren ehrfurchtgebietend in die stille Luft emporgestiegen. Ich hatte die Tänzerinnen wirbeln und sich beugen sehen, während die Fingerzimbeln an ihren zarten Fingern plinkeplink machten und den Gott auf unsere Gebete hinwiesen. Ich hatte auf der Bootstreppe des Tempels gesessen, die Zehen im sacht saugenden Nil, und hatte dem gepflasterten Vorhof den Rücken zugekehrt, während meine Eltern drinnen beteten. Für mich war der Tempel ein Ort von fremdartiger Rätselhaftigkeit, geheimnisumwittert und zugleich der Inbegriff der Maat und der geistliche Rahmen für unser festgefügtes Leben. Der Rhythmus seiner Feiertage war auch unser Rhythmus, ein unsichtbarer Puls, der Ebbe und Flut des dörflichen Lebens und aller Familienangelegenheiten regelte.
In der Zeit der Unruhen hatte uns eine Horde Fremdlinge überfallen, hatte im Vorhof ihr Lager aufgeschlagen und im Innenhof gewaltige Feuer entzündet. Sie tranken und zechten im Tempel, folterten und töteten einen Priester, der sich dagegen verwahrte; doch das Heiligtum zu schänden, das hatten sie sich nicht getraut, den Ort, den keiner von uns je erblickt hatte, den Ort, wo der Gott wohnte, denn Wepwawet war der Kriegsgott, und sie fürchteten sein Mißfallen. Der Dorfälteste und die erwachsenen Männer hatten in gerechtem Zorn zu den Waffen gegriffen und waren eines Nachts über die Banditen hergefallen, als diese unter Wepwawets schönen Säulen schliefen. Den ganzen folgenden Morgen säuberten die Frauen die blutigen Steine, und nie verriet einer der Männer, wo die Leichen verscharrt lagen. Unsere Männer waren stolz und tapfer und treffliche Gefolgsleute des Kriegsgottes. Der Hohepriester hatte geopfert, hatte um Vergebung gebeten und Wiedergutmachung gelobt und die heilige Stätte neu geweiht. Das war, ehe mein Vater und seine Schwadron jenseits des Dorfes lagerten und sich auf die Suche nach Bier begaben.
Ich liebte den Tempel. Ich liebte die Harmonie seiner Säulen, die das Auge zu Ägyptens weitem Himmel zogen. Ich liebte die Feierlichkeit seiner Rituale, den Duft seiner Blumen, den Staub und den Weihrauch, den so reichlich bemessenen Raum, das schöne, fließende Leinen der Priester. Damals war es mir nicht bewußt, aber ich liebte nicht den Gott selbst, sondern den Reichtum, der ihn umgab. Natürlich war ich seine treue Tochter, und das bin ich stets gewesen, doch es ging mir eher darum, einen Blick auf ein andersgeartetes Leben zu erhaschen, das mich zum Träumen verleitete.
Wir erreichten den gepflasterten Weg, meine Mutter und ich, und gelangten schließlich in den säulenumstandenen Vorhof. Dort warteten bereits mehrere Mütter, einige standen, andere saßen auf dem Pflaster und unterhielten sich ruhig. Das äußere Rund des Hofes war von Zellen gesäumt und glich einem Bienenstock, aus dessen Dämmer Jungenstimmen drangen, die sich zu einem sonoren Gesang erhoben, das zu aufgeregtem Geplapper wurde, gerade als meine Mutter und ich stehenblieben. Munter begrüßte sie die Frauen, und die antworteten mit einem Nicken. Und dann stürmten auch schon die Kinder aus dem Raum. Jedes trug eine Tasche zum Zuziehen. Atemlos rannte Pa-ari auf uns zu, und seine Augen strahlten. In der Tasche klirrte es. «Mutter, Thu!» rief er. «Es hat Spaß gemacht! Es hat mir gefallen!» Er hockte sich auf den Boden, kreuzte die Beine, und Mutter und ich hockten uns neben ihn. Mutter machte ihren Korb auf und holte Schwarzbrot und Gerstenbier heraus. Pa-ari nahm sein Mahl feierlich entgegen, und dann aßen wir. Die anderen Mütter, Söhne und die kleineren Kinder machten es wie wir. Der Hof schwirrte von Geplapper.
Ein Priester näherte sich uns. Ich konnte den Blick nicht von seinen mit schwarzem Kohol umrandeten Augen und seinem knochigen, rasierten Schädel losreißen. Er duftete sehr gut, grüßte uns freundlich und legte Pa-ari die Hand auf die Schulter.
«Du hast einen klugen Sohn», sagte er zu meiner Mutter. «Der wird ein guter Schüler. Es ist eine Freude, ihn zu unterrichten.»
Meine Mutter lächelte. «Vielen Dank», sagte sie. «Morgen kommt mein Mann mit dem Schulgeld.»
Der Priester sagte mit einem Achselzucken: «Damit hat es keine Eile. Wir laufen uns schon nicht weg.»
Aus unerfindlichen Gründen wehte mich bei seinen Worten ein kalter Hauch an. Ich streckte die Hand aus und streichelte zaghaft die breite, blaue Schärpe des Lehrers.
«Ich möchte auch zur Schule gehen», sagte ich schüchtern. Er warf mir einen Blick zu, überhörte jedoch meine Worte.
«Bis morgen dann, Pa-ari», sagte er und wandte sich ab. Meine Mutter gab mir einen kleinen Klaps.
«Thu, du mußt lernen, deine vorwitzige Zunge im Zaum zu halten», fuhr sie mich an. «Sammle die Reste ein und leg sie in den Korb. Wir müssen nach Haus. Pa-ari, vergiß deine Tasche nicht.» Dann verließen wir den Hof und gesellten uns zu den anderen Familien, die zum Dorf zurückströmten. Ich schloß mit meinem Bruder auf.
«Pa-ari, was ist in der Tasche?» fragte ich. Er hielt sie hoch und schüttelte sie.
«Meine Lektionen», prahlte er. «Die malen wir auf Tonscherben. Ich muß sie mir heute abend vor dem Zubettgehen noch einprägen, damit ich sie morgen im Unterricht wiederholen kann.»
«Darf ich mal sehen?»
Meine Mutter, die zweifellos erhitzt und gereizt war, nahm ihm die Antwort ab. «Nein, das darfst du nicht! Pa-ari, lauf vor und bestell deinem Vater, daß er essen kann. Und wenn wir daheim sind, macht ihr beide Mittagsschlaf.»
So fing alles an. Jeden Morgen ging Pa-ari im Morgengrauen zur Schule, und mittags brachten Mutter und ich ihm Brot und Bier. An Fest- und Feiertagen mußte er nicht lernen. Dann stahlen wir uns zum Fluß oder in die Wüste und spielten all die Spiele, die sich Kinder so ausdenken. Mein Bruder war gutmütig und kein Spielverderber, wenn ich ihm zusetzte, den Pharao zu spielen, während ich als seine Königin ein Stück zerfleddertes, weggeworfenes Leinen hinter mir herschleifte, mir Blätter ins Haar steckte und eine Weinranke um den Hals legte, in der aufgesammelte Vogelfedern steckten. Er hatte einen Stein als Thron und hielt von dort hof. Ich erteilte ausgedachten Dienstboten Befehle.
Als ich vier wurde, bat ich meinen Vater erneut, zur Schule gehen zu dürfen, was mir wiederum entschieden abgeschlagen wurde. Er könne kaum Pa-aris Schulgeld aufbringen, sagte er. Schulgeld für mich käme überhaupt nicht in Frage, und ohnedies hätte noch kein Mädchen außerhalb des Hauses etwas Nützliches gelernt. Ich schmollte ein Weilchen, hockte übellaunig in der Ecke unseres Empfangsraums, beobachtete meinen Bruder, wie er mit gesenktem Kopf über seinen irdenen Scherben saß und wie sich sein Schatten auf der Wand hinter ihm bewegte, wenn die Flamme in der Lampe zischte und zuckte. Er wollte nicht mehr Pharao und Königin spielen, denn er hatte sich mit ein paar Dorfjungen angefreundet, die in seine Klasse gingen, daher stand er oft nach dem Mittagsschlaf auf und verschwand, gesellte sich zu ihnen, angelte oder jagte Ratten in den Kornscheuern. Ich war einsam und eifersüchtig, aber erst mit acht Jahren kam mir die Idee, daß ich zwar nicht zur Schule kommen, die Schule jedoch zu mir kommen könnte.
Mittlerweile hatte meine Mutter mich fest im Griff. Ich lernte, wie man Brotteig ansetzte, denn Brot war unser Hauptnahrungsmittel, wie man aus Linsen und Bohnen Suppen kochte, Fisch briet und Gemüse zubereitete. Ich wusch mit ihr die Wäsche, trat Vaters Röcke und unsere groben Trägerkleider, klatschte das Leinen forsch auf die glänzenden Steine und genoß das spritzende Wasser auf meiner erhitzten Haut und den dickflüssigen Nilschlamm zwischen meinen Zehen. Ich machte Talg für die Lampen. Ich beherrschte die Kunst des Nähens mit ihren feinen Knochennadeln und flickte Vaters Röcke mit peinlicher Sorgfalt. Ich begleitete sie, wenn sie ihre Freundinnen besuchte, saß mit gekreuzten Beinen auf dem Lehmfußboden der kleinen Empfangsräume und nippte an dem einzigen Becher Palmwein, der mir zugestanden wurde, während sie schwatzte und lachte. All das gehörte zu dem Zauberbann, der mich für ewige Zeiten zu einer von ihnen machte.
Zuweilen wurde meine Mutter mitten in der Nacht zu einer Gebärenden gerufen. Ich achtete nicht weiter auf diese seltenen Störungen. Verschwommen hörte ich sie hastig ein paar Worte mit meinem Vater wechseln und das Haus verlassen, dann schlief ich erleichtert wieder ein. Aber gleich nach meinem achten Namenstag begann meine Lehre bei ihr. Eines Nachts schlug ich die Augen auf, und da beugte sie sich mit einer Kerze in der Hand über meinen Strohsack. Pa-ari hatte sich auf seiner Seite des Zimmers zusammengekuschelt, schlief fest und merkte nichts. Im Empfangsraum wurde geflüstert. «Steh auf, Thu», sagte sie freundlich. «Ahmoses Kind kommt, ich muß zu ihr. Das ist mein Beruf und eines Tages auch deiner. Du bist jetzt alt genug, du kannst mir helfen und dabei lernen, was eine Hebamme alles wissen muß. Hab keine Angst», setzte sie hinzu, als ich mühsam hochkam und nach meinem Trägerkleid tastete. «Dieses Mal geht alles glatt. Ahmose ist jung und gesund. Komm jetzt.»
Schlaftrunken stolperte ich hinter ihr her. Ahmoses Mann hockte in einer Ecke unseres Empfangsraums und wirkte beklommen, und neben ihm hockte mein Vater mit verschlafenen Augen. Meine Mutter blieb stehen und holte ihre Tasche, die immer neben der Tür bereitstand, dann verließ sie das Haus. Ich folgte ihr. Die Luft war kühl, der Mond stand hoch am wolkenlosen, dunklen Himmel, in den spitze Palmen ragten. «Das sollte uns eine lebende Gans und einen Ballen Leinen einbringen», meinte meine Mutter. Ich erwiderte nichts.
Ahmoses Haus war wie alle übrigen Häuser kaum mehr als ein nach oben offener Empfangsraum mit Stufen, die zu den hinteren Schlafräumen führten. Als wir barfuß ins Haus tappten, begrüßten uns die Mutter der Frau und ihre Schwestern mit sorgenvollen Mienen. Sie hockten an der Wand aufgereiht und teilten sich einen Krug Wein. Meine Mutter machte einen Scherz, und dann führte sie mich die Stufen zur ehelichen Schlafkammer hoch. Ein gewebter Läufer auf dem Fußboden und Wandbehänge machten den kleinen Raum aus Lehmziegeln behaglich. Neben dem Strohsack brannte eine große Lampe aus Stein, und auf dem Strohsack kauerte Ahmose in einem losen Leinenhemd. Sie sah ganz anders aus als die junge, lächelnde Frau, die ich kannte. Auf ihrer Stirn glänzte Schweiß, und ihre Augen waren riesengroß. Sie streckte die Hand aus, als meine Mutter ihre Tasche auf den Fußboden stellte und zu ihr ging.
«Kein Grund zur Panik, Ahmose», sagte sie beschwichtigend und griff nach ihren klammernden Fingern. «Leg dich jetzt hin. Thu, komm her.»
Ich gehorchte höchst unwillig. Meine Mutter nahm meine Hand und legte sie auf Ahmoses gewölbten Unterleib. «Das ist der Kopf des Kindes. Kannst du ihn fühlen? Er steht sehr tief. Das ist gut. Und das hier ist das kleine Hinterteil. Genau wie es sein sollte. Kannst du es fühlen?» Ich nickte. Die schweißglänzende und straff gespannte Haut über dem geheimnisvollen Hügel faszinierte mich und stieß mich zugleich ab. Als ich die Hand zurückzog, sah ich, wie sie sich wellte, und Ahmose keuchte und stöhnte und zog die Knie an. «Tief einatmen», befahl meine Mutter, und als die Wehe abgeklungen war, fragte sie Ahmose, wie lange sie schon Wehen hätte.
«Seit dem Morgengrauen», war die Antwort. Mutter öffnete ihre Tasche und holte einen Tontopf heraus. Als sie den Stöpsel zog, verbreitete sich erfrischender Minzegeruch im Zimmer, darauf drehte sie Ahmose flink, aber sanft auf die Seite und massierte ihr den Inhalt in das feste Gesäß. «Es beschleunigt die Geburt», sagte sie zu mir. «Jetzt darfst du dich hinhocken, Ahmose. Und ganz, ganz ruhig bleiben. Unterhalte dich mit mir. Was hört man von deiner Schwester flußaufwärts. Geht es ihr gut?»
Schwerfällig kam Ahmose auf ihrem Strohsack in eine Hockstellung und stützte den Rücken gegen die Lehmwand. Sie sprach abgehackt und schwieg, wenn die Wehen sie packten. Meine Mutter hakte nach und beobachtete sie die ganze Zeit, ob sich etwas veränderte, und ich beobachtete sie auch, sah die aufgerissenen, erschrockenen Augen, die Adern, die ihr am Hals schwollen, und den sich abmühenden, geschwollenen Leib.
Das gehört auch zu dem Zauberbann, dachte ich, und Angst überfiel mich, während mattes Lampenlicht auf der in der Ecke kauernden Gestalt spielte, die zitterte und gelegentlich einen Schrei ausstieß. Es ist ein anderes Zimmer im Gefängnis. Mit acht Jahren war ich sicher zu klein, um das Gefühl in Worte zu fassen, das mich überfiel, aber ich entsinne mich noch deutlich des Geschmacks in meinem Mund und daß mein Herz einen Schlag aussetzte. Das also war mir bestimmt, ich sollte verstörten Frauen in dämmrigen Dorfhütten mitten in der Nacht Mut machen, ihnen das Gesäß massieren und ihnen Arzneien in die Scheide einführen, wie es meine Mutter gerade tat. «Das war eine Mischung aus Fenchel, Weihrauch, Knoblauch, Sartus-Saft, Salz und Wespenkot», belehrte sie mich über die Schulter. «Die beste Arznei, wenn man ein Kind holen will. Es gibt noch andere, aber die sind nicht so wirksam. Ich bring dir bei, wie man sie mischt. Komm jetzt, Ahmose, du machst deine Sache sehr gut. Denk daran, wie stolz dein Mann ist, wenn er heimkommt und du seinen neugeborenen Sohn in den Armen hältst!»
«Ich hasse ihn», sagte Ahmose giftig. «Ich will ihn nie wieder sehen.»
Ich dachte, meine Mutter würde sich darüber entsetzen, aber sie überhörte die Worte. Mir zitterten die Knie. Ich sank auf den warmen Lehmfußboden und kreuzte die Beine. Zwei-, dreimal spähten Ahmoses Mutter und ihre Schwestern ins Zimmer, wechselten ein paar Worte mit meiner Mutter und verzogen sich wieder. Ich merkte gar nicht, wie die Zeit verging. Mir schien, ich schwebte schon ewig in diesem Vorraum zur Unterwelt, indes sich die liebe, freundliche Ahmose in ein irres Gespenst verwandelte und der Schatten meiner Mutter sich wie ein bösartiger Dämon über ihr erhob. Die Stimme meiner Mutter zerstörte die Illusion. «Komm her!» befahl sie mir. Ich kam hoch und näherte mich widerstrebend, und sie reichte mir ein dickes Leinentuch und befahl mir, es Ahmose unterzulegen. «Schau nur», sagte sie. «Der Oberkopf des Kindes. Jetzt pressen, Ahmose! Es kommt!» Mit einem letzten Aufschrei gehorchte Ahmose, und das Kind glitt in meine unwilligen Hände. Es war gelb und rot von Körperflüssigkeiten. Ich kniete wie blöde und starrte es an, und da schlug es mit den kleinen Gliedmaßen um sich. Meine Mutter gab ihm einen Klaps auf den Po, und es stieß einen atemlosen Schrei aus und fing an zu brüllen. Behutsam reichte sie es Ahmose, und die lächelte schon wieder und streckte die Arme nach ihm aus. Als sie es an die Brust drückte, drehte es den Kopf und suchte blind nach Nahrung. «Du brauchst keine Angst mehr zu haben», sagte meine Mutter, «es hat ‹ni ni› gebrüllt, nicht ‹na na›. Es bleibt am Leben. Und es ist ein Junge, Ahmose, ein wohlgeformter Junge. Du hast deine Sache gut gemacht!» Sie griff nach einem Messer, und da sah ich die pulsierende Nabelschnur in ihrer Hand. Das reichte. Ich murmelte etwas und verließ das Zimmer. Draußen sprangen die Frauen auf, als ich mich an ihnen vorbeidrängte. «Es ist ein Junge», brachte ich noch heraus, und während sie unter Jubelgeschrei die Treppe hochstürmten, tauchte ich in die kühle, allumfassende Morgendämmerung.
Ich stand an die Hausmauer gelehnt und sog den frischen Duft der Pflanzen, den Geruch staubiger Wüste und den schwachen Hauch des Flusses ein. «Niemals!» flüsterte ich zu dem von grauen Palmen gesäumten Himmel hoch. «Niemals!» Ich wußte nicht, was ich mit dem heftigen Wort meinte, aber es stand in einem wirren Zusammenhang mit Käfigen und Schicksal und den alten Traditionen meines Volkes. Ich fuhr mir mit der Hand über die knabenhafte Brust, über den flachen, kleinen Bauch unter dem verhüllenden Trägerkleid, als wollte ich sichergehen, daß mein Fleisch noch immer mir gehörte. Ich bohrte die nackten Zehen in die feine Staubschicht, die ständig von der Wüste herüberwehte. In vollen Zügen atmete ich die schwache Brise ein, die dem langsamen Aufgang von Re vorhereilte. Hinter mir hörte ich Frauenstimmen, die aufgeregtes und unverständliches Zeug schwatzten, und dazwischen das schwache Protestgeschrei des Kindes. Und dann kam auch schon meine Mutter mit der Tasche in der Hand, und im Frühlicht des Tages sah ich, daß sie mir zulächelte.
«Sie sorgt sich, die Milch könnte nicht fließen», sagte sie, als wir nach Hause gingen. «Alle Mütter machen sich die gleichen Sorgen. Ich habe ihr ein Fläschchen mit Pulver aus zerstoßenen Schwertfischknochen dagelassen, das löst man in warmem Öl auf und reibt es ins Rückgrat. Aber sie braucht sich keine Sorgen zu machen. Sie ist immer sehr gesund gewesen. Nun, Thu», strahlte sie, «was meinst du? Ist es nicht ein herrliches Erlebnis, neuem Leben auf die Welt zu verhelfen? Wenn du bei weiteren Geburten mitgeholfen hast, darfst du die Frauen auch selbst betreuen. Und ich zeige dir, wie man die Arzneien herstellt, die ich verwende. Du wirst einmal genauso stolz auf deine Arbeit sein wie ich.»
Ich blickte starr auf den stillen Pfad, der von allmählich klarer hervortretenden Bäumen gesäumt war, während sich Re bereitmachte, über den Horizont zu steigen. «Mutter, warum hat sie gesagt, daß sie ihren Mann haßt?» druckste ich. «Ich habe immer gedacht, sie sind glücklich miteinander.»
Meine Mutter lachte. «Jede Frau in den Wehen verflucht ihren Mann», sagte sie sachlich. «Weil nämlich die Männer Ursache der Schmerzen sind, denen sie nicht entrinnen können. Aber sobald der Schmerz aufhört, vergessen sie ihre Leiden und freuen sich genau wie früher, wenn die Männer ihr Bett aufsuchen.»
Nicht entrinnen können … dachte ich, und mich schauderte. Andere Frauen mögen die Schmerzen vergessen, ich sicherlich nicht. Und jetzt weiß ich auch, daß aus mir keine gute Hebamme wird, und wenn ich mir noch soviel Mühe gebe. «Ich möchte Arzneikunde lernen», sagte ich, und weiter mußte ich auch nichts sagen, denn meine Mutter blieb stehen und nahm mich in die Arme. «Das sollst du auch, mein blauäugiges Schätzchen. Das sollst du auch», sagte sie triumphierend.
Erst viel später erkannte ich, wie tief mich das Erlebnis jener Nacht berührt hatte, denn darauf richtete sich jetzt die ganze Unzufriedenheit, mit der ich gewiß schon geboren worden war. Damals war mir nur klar, daß mich das Animalische an der Geburt abstieß, daß ich Ahmose nicht beneidete, weil sie nun dauernd für das Kind sorgen mußte, und daß ich vor der panischen Angst zurückscheute, die mit diesem Ereignis verbunden war. Ich hatte Gewissensbisse, weil meine Mutter sich über mein Interesse an dem ganzen Vorgang zu freuen schien, und dabei interessierte ich mich nur für die Tränke, Salben und Absude, die sie für ihren Beruf mischen und verwenden mußte. Natürlich war ich stolz, als sie mich in das kleine Zimmer bat, das mein Vater an unser Haus angebaut hatte und wo sie ihre Kräuter abwog und ihre Absude herstellte, doch der Stolz gehörte zu meiner allumfassenden Wißbegier. Ich wollte Wissen erwerben, denn Pa-ari sagte, Wissen bedeute Macht. Das kleine Zimmer duftete nach wohlriechenden Ölen, nach Honig und Weihrauch und herben Kräutern.
Ich merkte schon bald, daß die Arbeit meiner Mutter mehr beinhaltete als lediglich Geburtshilfe. Frauen stahlen sich auch aus anderen Gründen in unser Haus, und so manche flüsterte ihr etwas ins geneigte Ohr. Und sie behielt die Geheimnisse für sich und sprach nur ganz allgemein mit mir darüber.
«Mit einer Mischung aus zerstoßenen Datteln, Zwiebeln und in Honig getränkten Akanthusfrüchten, die man auf die Scham aufträgt, kann man eine Abtreibung auslösen», sagte sie, «und nachdem man die Salbe äußerlich aufgetragen hat, sollte man ein Gebräu aus Bitterbier, Rizinusöl und Salz trinken. Hüte dich davor, das leichtfertig zu verschreiben, falls du darum gebeten wirst. Viele Frauen kommen nämlich ohne Wissen und Billigung ihrer Männer zu mir. Da ich mich aber vor allem um die Frauen zu kümmern habe, verfahre ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber du mußt das, worum sie bitten, immer für dich behalten. Es ist besser, man verhütet Schwangerschaft, als daß man hinterher den Schaden wiedergutmacht.»
Jetzt spitzte ich denn doch die Ohren. «Und wie kann man Schwangerschaft verhüten?» fragte ich und gab mir Mühe, mich nicht zu wißbegierig anzuhören.
«Das ist nicht einfach», erwiderte sie, ohne zu merken, wie wichtig mir die Frage war. «In der Regel verschreibe ich einen dicken Sirup aus Honig und Auyutharz, in dem ich Akamuratriebe eingeweicht habe. Die muß man zunächst zerstoßen und nach drei Tagen Einweichen wegwerfen, den Sirup führt man dann in die Scheide ein.» Sie warf mir einen schiefen Blick zu. «Das hat noch Zeit», sagte sie plötzlich. «Erst mußt du lernen, wie man dem Leben auf die Welt hilft, ehe du lernst, wie man es verhindert. Gib mir den Stößel aus der Schale da, dann sieh nach, ob dein Vater schon vom Feld gekommen ist und sich waschen will.»
Ich glaube, mein Vater hat sie gezwungen, sich ihrer eigenen Arznei zu bedienen, denn nicht lange nach dieser Unterhaltung hörte ich sie und meinen Vater eines Nachts streiten, als ich wegen der Schemu-Hitze nicht schlafen konnte. Was als leises Gemurmel angefangen hatte, wurde zorniger und lauter, und ich lauschte, während Pa-ari vor sich hin schnarchte.
«Wir haben einen Sohn und eine Tochter», sagte mein Vater scharf. «Das reicht.»
«Aber Pa-ari will Schreiber werden, nicht Bauer. Wer soll das Land bestellen, wenn du zu schwach dazu bist? Und was Thu angeht, die heiratet und zieht mit den Fertigkeiten, die ich ihr beigebracht habe, in das Haus ihres Mannes.» Ich bemerkte die Angst in ihrer Stimme, doch sie machte sich als Zorn Luft, und sie wurde immer schriller. «Wir haben niemanden, der sich im Alter um uns kümmert, und welche Schmach, wenn wir uns auf die Gutherzigkeit unserer Freunde verlassen müßten! Ich gehorche dir, Mann. Ich werde nicht schwanger. Und gleichwohl trauere ich um meinen leeren Schoß!»
«Sei still, Frau», befahl mein Vater mit der Stimme, die bei uns sofortigen Gehorsam bewirkte. «Meine drei Aruren werfen nicht genug ab, damit kann ich keine weiteren Mäuler stopfen. Wir sind zwar arm, aber wir haben Würde. Wenn du das Haus mit Kindern füllst, werden wir noch ärmer und opfern damit das bißchen Unabhängigkeit, das wir genießen. Außerdem …» Er wurde leiser, und ich mußte mich anstrengen, daß ich seine Worte mitbekam. «Wieso glaubst du, daß Aswat so friedlich und sicher ist, wie es den Anschein hat? Wie bei allen Frauen reicht dein Blick nur bis zum Pfad am Fluß, wohin du die Wäsche trägst, und deine Ohren hören nur den Klatsch der anderen Frauen. Und die Männer hier sind auch nicht viel besser. Die schicken die Hausierer und die Wanderarbeiter zu den Frauen, daß sie ihnen etwas abkaufen oder sie dingen, aber sie hören sich nicht an, was sie zu erzählen haben, denn sie sind engstirnig und mißtrauen allen, die nicht hier geboren sind. Ich aber habe dieses Ägypten gesehen. Ich blicke nicht auf die durchziehenden Fremdlinge herunter. Ich weiß, daß die östlichen Stämme auf der Suche nach Weideland für ihre Herden ins Delta vordringen, und dort kommt es schon zu Unruhen. Vielleicht gibt sich das alles, aber vielleicht ruft der Vollkommene Gott seine Soldaten zu den Waffen, und sie müssen ihre Felder verlassen und ihr Land verteidigen. Wie würde es dir dann wohl ergehen mit Kleinkindern, die gefüttert sein wollen, und dazu noch dein Beruf als Hebamme? Und wenn ich getötet würde, fiele das Land an den Pharao zurück, denn wie du schon gesagt hast, wird Pa-ari kaum in meine Fußtapfen treten. Denk über meine Worte nach und halte jetzt den Mund, denn ich bin erschöpft und brauche meinen Schlaf.» Ich hörte meine Mutter etwas brummeln und ergeben seufzen, danach herrschte Ruhe.
Kapitel zwei
WIE ich schon gesagt habe, war ich acht Jahre alt, als mir die Eingebung kam, wenn ich schon nicht zur Schule gehen könnte, so könnte die Schule doch zu mir kommen. Ungefähr zur gleichen Zeit fing ich an, meiner Mutter zu helfen, und verbrachte meine Tage mit pflichtschuldiger Hausarbeit, doch meine Lernbegier quälte mich unablässig, war eine Art ergebene Verzweiflung, die mir in meinen wenigen freien Augenblicken zusetzte. Mein Plan war einfach. Pa-ari sollte mich unterrichten. Der mußte doch mittlerweile alles wissen, was es zu wissen gab, schließlich trabte er seit fünf Jahren zur Tempelschule. Eines Nachmittags, als unser Haus und das ganze Dorf in Res glühender Sommerhitze dösten und Pa-ari und ich angeblich ruhten, zog ich meinen Strohsack dicht an seinen heran und spähte ihm ins Gesicht. Er schlief nicht. Er lag auf dem Rücken, hatte beide Hände unter den Kopf geschoben, und seine Augen folgten im Zwielicht meinen Bewegungen. Er lächelte, als ich mich über ihn beugte.
«Nein, ich erzähle dir keine Geschichte», sagte er laut. «Es ist zu heiß. Warum schläfst du nicht, Thu?»
«Sprich leiser», sagte ich und lehnte mich zurück. «Heute will ich keine Geschichte hören. Pa-ari, tust du mir einen ganz, ganz großen Gefallen?»
«O ihr Götter», stöhnte er, drehte sich auf die Seite und stützte sich auf den Ellbogen. «Dieser honigsüße Ton bei dir bedeutet immer Ärger. Was willst du denn dieses Mal?»
Ich musterte ihn, während er noch nachsichtig lächelte, meinen Bruder, den ich abgöttisch liebte, diesen überheblichen jungen Mann, der bereits Vaters selbstsicheren Ton anschlug, der keine Widerrede duldete. Vor ihm hatte ich keine Geheimnisse. Er wußte, wie sehr es mir mißfiel, Mutter bei Geburten zu helfen, wie fasziniert ich von ihren Tränken war, wie einsam ich mich im Dorf fühlte, da sich die Dorfmädchen hohnlächelnd und kichernd abwandten, wenn ich gelegentlich mit ihnen spielen wollte. Er wußte auch, daß ich vor lauter Einsamkeit die Tochter eines lange verschollenen libyschen Fürsten spielte. Vor ihm tat ich nicht hochnäsig, und er wiederum ging so zärtlich mit mir um, wie es unter Geschwistern sonst nicht üblich war. Ich berührte seine nackte Schulter.
«Ich möchte lesen und schreiben lernen», sagte ich und platzte beklommen und verlegen außer Atem heraus: «Bring es mir bei, Pa-ari. Ich brauche auch nicht lange, Ehrenwort!»
Erst blickte er mich erschrocken an, dann wurde sein Lächeln zum Grinsen. «Sei nicht albern», schalt er mich. «Dieses Wissen ist nicht für Mädchen bestimmt. Es ist kostbar. Mein Lehrer sagt, daß Wörter kostbar sind, daß die ganze Welt und alle Gesetze und die Geschichte selbst Äußerungen der Götter sind und daß die Hieroglyphen noch etwas von ihrer Macht bewahrt haben. Welchen Nutzen hätte solche Macht wohl für eine künftige Hebamme?»
Fast konnte ich die Dinge schmecken, von denen er sprach, ich spürte, wie aufregend es sein mußte, sie zu beherrschen. «Aber was ist, wenn ich nicht Hebamme werde?» sagte ich nachdrücklich. «Was ist, wenn eines Tages ein reicher Kaufmann in seiner goldenen Barke vorbeifährt und seine Diener einen Riemen verlieren und sie über Nacht hier, hier in Aswat bleiben müssen, und ich bin unten am Ufer und wasche Wäsche oder schwimme, und er sieht mich und verliebt sich in mich, und ich heirate ihn, und eines Tages wird sein Schreiber krank, und niemand kann Briefe für ihn schreiben? Liebste Thu, so sagt er dann wohl, übernimm du die Palette des Schreibers, und ich versinke vor Scham in den Boden, weil ich nur ein armes, ungebildetes Dorfmädchen bin, und ich sehe schon jetzt seine verächtliche Miene!» Meine Geschichte riß mich mit. Ich verspürte die Scham, sah das Mitleid meines unbekannten Ehemannes, doch auf einmal erstarb mir das Wort im Mund. Denn teilweise stimmte meine Geschichte. Ich war tatsächlich ein armes, ungebildetes Dorfmädchen, und diese Erkenntnis legte sich mir wie ein Stein auf die Seele. «Entschuldigung, Pa-ari», flüsterte ich. «Bitte unterrichte mich, denn ich möchte für mein Leben gern die Dinge verstehen, die du schon weißt. Auch wenn ich weiter nichts als Hebamme im Dorf werde, deine Mühe wird nicht vergebens sein. Bitte.»
Schweigen. Ich blickte auf meine Hände, die verkrampft auf meinem Schoß lagen, und merkte, daß sein Blick mich festhielt. Fast konnte ich ihn denken hören, so reglos war er.
«Ich bin nur ein neunjähriger Schuljunge», sagte er nach einem Weilchen ruhig und ohne sich zu rühren. «Ich bin nichts weiter als der Sohn eines Soldaten und Bauern. Und doch bin ich der Beste in meiner Klasse, und wenn ich sechzehn bin, kann ich für Wepwawets Priester arbeiten. Wenn ich will, verschafft mir das geschriebene Wort eines Tages eine Stellung als Schreiber. Aber was soll dir das geschriebene Wort nutzen?» Er griff im Dunkeln nach meiner Hand. «Du bist schon jetzt unzufrieden, Thu. Dieses Wissen würde dir nur noch mehr schaden.»
Ich ergriff seine Hand und zerrte daran. «Ich will lesen können! Ich will etwas wissen! Ich will wie du sein, Pa-ari, nicht hilflos, ohne Zukunftsaussichten und dazu verurteilt, mein Leben lang in Aswat zu bleiben! Gib mir Macht!»
Hilflos … verurteilt … Ich gebrauchte unwissentlich die Worte einer Erwachsenen. Ich weinte vor Enttäuschung und wurde lauter, und dieses Mal war es Pa-ari, der flink den Finger auf die Lippen legte und mich ermahnte, still zu sein.
Er entriß mir seine Hand und hob beide Hände zum Zeichen, daß er aufgab.
«Na gut!» zischte er. «Na gut. Mögen die Götter mir diese Dummheit verzeihen. Ich unterrichte dich.»
Ich zappelte vor Freude, und schon war mein ganzes früheres Elend vergessen. «Vielen Dank, lieber, lieber Pa-ari!» sagte ich stürmisch. «Können wir gleich anfangen?»
«Hier drinnen? Im Dunkeln?» Er seufzte. «Ehrlich, Thu, du bist lästig. Wir fangen morgen an, und das heimlich. Wenn Mutter und Vater schlafen, gehen wir an den Fluß, setzen uns in den Schatten, und ich ziehe die Schriftzeichen für dich in den Sand. Dann siehst du dir meine Tonscherben an, aber, Thu», mahnte er mich, «wenn du nicht aufpaßt, gebe ich mir nicht lange Mühe mit dir. Und jetzt schlaf.»
Glücklich und gehorsam zog ich meinen Strohsack wieder an Ort und Stelle und ließ mich fallen. Ich war so müde, als wäre ich lange, lange gegangen, und es war ein Genuß, die Augen zu schließen und mich dem Schlaf zu überlassen. Pa-ari atmete bereits tief und gleichmäßig. Oh, wie ich ihn liebte.
An jenem denkwürdigen Tag mitten im Monat Epophi lief alles glatt. Gehorsam gingen wir in unser Zimmer, saßen angespannt und warteten, daß sich unsere Eltern der Apathie der Mittagsstunde überließen. Es schien lange zu dauern, bis ihre gelegentlichen Bemerkungen verstummten und Pa-ari mir bedeutete aufzustehen, während er die Tasche mit seinen kostbaren Tonscherben vorsichtig aufhob, damit sie nicht klirrten. Zusammen stahlen wir uns aus dem Haus in die blendende, glühende Hitze, die uns von der menschenleeren Dorfstraße entgegenschlug.
Noch war der Fluß nicht angestiegen. Breit und majestätisch, braun und schlammig floß er neben uns, während wir nach einer Stelle suchten, wo uns vom Dorf und vom Weg aus, der zwischen Wasser und Häusern verlief, niemand sehen konnte. Pa-ari bog ab, denn er hatte unter einer Sykomore ein Fleckchen ohne Gras, eine Kuhle mit weichem Sand entdeckt. Er setzte sich auf die Erde, und ich tat es ihm gleich, und mein Herz hämmerte vor Aufregung. Unsere Blicke trafen sich.
«Willst du wirklich?» fragte er.
Ich nickte und schluckte, brachte kein Wort heraus, und er senkte den Kopf, zog am Zugband seiner Tasche und kippte ihren Inhalt neben sich aus.
«Zuerst mußt du die Göttersymbole lernen», sagte er feierlich. «Das macht man aus Ehrerbietung, paß also gut auf. Das hier ist das Zeichen für die Göttin Maat, die für Gerechtigkeit sorgt, und ihre Feder steht für Wahrheit und die Ausgewogenheit von Gesetz, Ordnung und Gerechtigkeit in der Welt. Man darf ihre Feder nicht mit den Doppelfedern Amuns verwechseln, der in großer Pracht und Macht im heiligen Theben residiert.» Er gab mir einen Zweig. «Zeichne das jetzt selbst.» Und ich gehorchte gebannt und hingerissen, und etwas in mir flüsterte, jetzt hast du es, Thu. Jetzt ist es in Reichweite. Aswat ist nicht mehr deine Welt.
Ich lernte schnell, saugte Wissen auf, als wäre meine Seele die sonnengedörrte, geborstene Erde Ägyptens schlechthin und Pa-aris Symbole die lebenspendenden Wasserfluten der Überschwemmung. An jenem Tag lernte ich zwanzig Götternamen, und die stellte ich mir im Geist vor, während ich meinen abendlichen Pflichten nachkam, flüsterte sie über Linsen und getrockneten Feigen vor mich hin, während ich meiner Mutter beim Kochen half, bis sie bissig meinte: «Falls du mit mir redest, Thu, so verstehe ich dich nicht, und falls du betest, so solltest du lieber warten, bis Vater die Kerzen vor dem Schrein angezündet hat. Du siehst müde aus, Kind. Fehlt dir etwas?»
Nein, mir fehlte nichts. Ich schlang das Abendessen hinunter, was mir wiederum Schelte von Vater eintrug, denn ich wollte so bald wie möglich auf meinen Strohsack und schlafen, damit es nicht so lange bis zum nächsten Nachmittag dauerte. In jener Nacht träumte ich von den Symbolen, die allesamt golden und glitzernd vor meinen Augen vorbeizogen, und ich rief sie herbei und schickte sie fort wie Dienstboten.
Meine Begeisterung hielt an. Während Tag um Tag ins Land ging, Epophi zu Mesore wurde und Neujahr und damit die segensreiche Überschwemmung nahte, stellte ich fest, daß ich nicht krank wurde, daß mich die Götter nicht für meine Anmaßung straften, daß Pa-ari mich nicht im Stich ließ, und so hörte ich auf, mir die Lektionen wie eine Wilde einzuverleiben. Pa-ari war ein geduldiger Lehrer. Das Durcheinander schöner, dicht stehender Zeichen auf seinen Tonscherben bekam allmählich einen Sinn, und schon bald konnte ich ihm die uralten Sinnsprüche und Körnchen der Weisheit vorlesen, aus denen sie sich zusammensetzten. «Die Zunge ist des Menschen Verderben.» – «Lerne vom Unwissenden wie vom Weisen, denn Kunst kennt keine Grenzen. Kein Künstler erlangt wahre Vollkommenheit.» – «Verbringe keinen Tag mit Müßiggang, sonst wirst du ausgepeitscht.»
Schreiben fiel mir schwerer. Ich hatte keine Tusche und keine Tonscherben. Pa-aris Lehrer teilte diese Dinge in der Tempelschule aus und sammelte alles, was nicht gebraucht wurde, nach dem Unterricht wieder ein, und Pa-ari weigerte sich, die Gerätschaften zu stehlen, die ich brauchte. «Ich würde Schande über mich bringen und ausgeschlossen werden, falls man mich erwischt», wehrte er sich, als ich vorschlug, er sollte ein paar übriggebliebene Stücke in die Tasche stecken. «Das mache ich nicht, nicht einmal für dich. Warum nimmst du keinen Stock und glatten, nassen Sand?» Das ging natürlich, aber ich tat es widerwillig. Und ich konnte die Schriftzeichen auch nicht mit der rechten Hand ziehen. Immer griff ich mit der Linken zu, auch nach dem Stöckchen, und als Pa-ari das Ergebnis sah, nachdem ich es mit der rechten Hand versucht hatte, gab er es auf, mich auf rechts zu drillen. Ich schrieb unbeholfen, schwerfällig, aber ich hielt durch und bedeckte das Nilufer mit Hieroglyphen, übte mit dem Finger auf Mauern und Fußböden, ja ich zeichnete sogar in die Luft, wenn ich bei Sonnenuntergang auf meinem Strohsack lag. Nichts anderes zählte mehr. Meine Mutter freute sich über meine ungewohnte Sanftmut. Mein Vater neckte mich, weil ich so oft still vor mich hin träumte. Ich war tatsächlich fügsam und still geworden, war nicht mehr ruhelos und unzufrieden, denn die Wirklichkeit meines äußeren Lebens galt nichts vor der meines Innenlebens.
Ja, und ich war hochfahrend, aber nicht weil ich mich für etwas Besseres hielt als meine geliebte Familie oder als die Frauen, die mit ihren Witzen und ihren Nöten, ihrem Mut und ihrer klaglosen Geduld in unserem Haus ein und aus gingen. Ich war anders, das war alles. Ich war schon immer anders gewesen, und auch Pa-ari war anders.
So verging die Zeit. Als Pa-ari dreizehn war und ich zwölf, wechselte Pa-ari von Tonscherben zu Papyrus und Tusche, und an jenem Tag schenkte mein Vater ihm einen Männerschurz aus schneeigem weißem Leinen sechsten Grades, das von weit her, vom Flachswebermarkt im heiligen Theben stammte. Das Leinen war so fein, daß es an meinen bewundernden Fingern hängenblieb, als ich es anfaßte. «Den darfst du zur Schule tragen», sagte Vater ein klein wenig traurig, glaube ich. «Schöne Dinge sollte man benutzen und nicht für besondere Anlässe aufsparen. Aber laß dir zeigen, wie man ihn richtig wäscht, damit er lange hält.» Pa-ari fiel unserem Vater um den Hals, dann trat er verlegen zurück.
«Es tut mir leid, daß ich die Wörter mehr liebe als die Scholle», sagte er, und ich sah, wie er hinter seinem Rücken die Fäuste ballte. Vater sagte achselzuckend:
«Laß nur. Es liegt dir im Blut, wie man so sagt. Deine Großmutter war eine Frau des Wortes, sie hat Geschichten erzählt. Falls mich der Vollkommene Gott wieder zu den Waffen ruft, bringe ich einen Sklaven mit, der das Land bestellt.»
«Wem hat sie denn Geschichten erzählt?» unterbrach ich ihn, hocherfreut über diese unerwartete Enthüllung, aber ich hätte mir die Frage sparen können. Vater lächelte sein bedächtiges, rätselhaftes Lächeln und fuhr mir durchs Haar.
«Ei, ihrer Familie natürlich», sagte er, «aber, meine Thu, bilde dir ja nicht ein, daß die Leute hier Geschichten hören wollen. Geburtshilfe und Heilen sind für eine Frau nützlichere Fertigkeiten, als Menschen zu unterhalten.»
Das fand ich wiederum nicht, wagte es aber nicht auszusprechen. Ich nahm Pa-aris Schurz und hielt ihn mir vors Gesicht. Ich staunte, wie fest Kette und Schuß waren. «Der ist wie für einen Fürsten», flüsterte ich, und das hörte mein Vater.
«Ja, das stimmt», gab er mir erfreut recht, «aber es gibt noch fünf feinere Grade als das hier, und das Leinen, das im Königshaus getragen wird, ist so hauchfein, daß die Glieder durchscheinen.» Meine Mutter rümpfte laut die Nase, mein Vater lachte und gab ihr einen Kuß, und Pa-ari schnappte sich seine Kostbarkeit, ging in unser Zimmer und legte ihn zum erstenmal an.
Später, als wir geschwommen und gegessen hatten, verließen wir das Dorf, denn wir wollten uns Res Untergang in der Wüste ansehen, und er holte seine erste Lektion auf Papyrus aus ihrer dicken Leinenhülle und breitete sie auf dem Sand vor mir aus. «Das ist ein Gebet zu Wepwawet», sagte er stolz. «Das habe ich, glaube ich, sehr sauber hinbekommen. Die Rohrfeder des Schreibers ist viel leichter zu handhaben als die dickeren Pinsel. Mein Lehrer hat mir versprochen, daß ich schon bald zu seinen Füßen vor der Klasse sitzen darf, und er diktiert mir. Und er bezahlt auch dafür! Denk nur!»
«O Pa-ari», freute ich mich, während meine Finger die glatte, trockene Oberfläche des Papiers liebkosten. «Wie schön für dich!» Die anmutigen, geraden Schriftzeichen waren schwarz wie die Nacht, und die im Westen untergehende Sonne färbte den Papyrus blutrot. Ich rollte seine Arbeit sorgsam auf und reichte sie ihm. «Aus dir wird einmal ein hervorragender Schreiber», sagte ich, «ein ehrlicher und kluger. An dir hat Wepwawet ein Kleinod gefunden.»
Er grinste, dann hob er das Gesicht in die warme Abendbrise, die aufgekommen war. «Vielleicht ergattere ich etwas Papyrus für dich», sagte er. «Wenn ich erst einmal für meinen Lehrer arbeite, bekomme ich genug zum Schreiben geliefert, und wenn ich sehr klein schreibe, fällt gelegentlich ein Blatt ab. Und wenn nicht, so kaufe ich dir etwas. Oder du kaufst dir selbst etwas.» Er griff eine Handvoll Sand und ließ ihn über seine nackten Schienbeine rieseln. «Teilt Mutter nicht zuweilen mit dir, was man ihr zahlt, jetzt, wo du so tüchtig in deinem Gewerbe geworden bist?»
Seine Frage war völlig arglos, doch auf einmal packte mich die alte, vertraute Verzweiflung, und das so rasch, daß ich anfing zu zittern. «O ihr Götter», platzte ich heraus, und Pa-ari warf mir einen scharfen Blick zu. «Thu, was ist?»
Ich konnte nicht antworten. Mein Herz hämmerte und schmerzte, meine halb im Sand vergrabenen Hände zuckten. Verbissen bemühte ich mich um Fassung, und als das Gefühl nachließ, legte ich die Stirn auf die Knie.
«Ich bin zwölf Jahre alt», sagte ich, und meine Stimme klang erstickt. «Fast dreizehn, Pa-ari. Ich habe mich in eine Traumwelt geflüchtet. Vor wenigen Monaten bin ich Frau geworden, und Mutter und ich sind mit der Opfergabe in den Tempel gegangen, und ich war so stolz. Sie auch. ‹Nun dauert es nicht mehr lange, und du hast selbst Kinder›, hat sie zu mir gesagt, und ich habe mir noch immer nichts dabei gedacht.» Ich hob den Kopf, und unsere Blicke trafen sich. «Zu was ist mir das alles nutze, diese ganze Gelehrsamkeit? Ich habe mich so davon fesseln lassen, war so froh, daß ich sie beherrschte. Die Gefängnistore öffnen sich, habe ich mir eingeredet und keinen Gedanken daran verschwendet, was danach kommt.» Ich lachte bitter. «Wir wissen doch beide, was danach kommt, nicht wahr, Pa-ari? Ein anderes Gefängnis. Bezahlung, ja. Mutter belohnt mich oft. Ich mische die Arzneien, ich sorge dafür, daß ihre Tasche wohlgefüllt ist, ich beruhige die Frauen und wasche die kleinen Kinder und binde die Nabelschnur ab, und die ganze Zeit lerne ich bei dir, ich lerne so viel …» Ich packte seinen Arm. «Eines Tages steht ein junger Mann aus dem Dorf vor unserer Tür, bringt Geschenke, und Vater sagt mir, Soundso hat um dich angehalten, er hat soundso viel Aruren und soundso viele Schafe, er ist eine gute Partie. Und was sage ich dann?»
Pa-ari entzog sich meinem Griff. «Ich weiß nicht, was mit dir los ist», begehrte er auf. «Du machst mir angst, Thu. Falls es so kommt, kannst du nein sagen, wenn du ihn nicht willst.»
«Ach», sagte ich leise. «Ich sage also nein. Und dann vergeht die Zeit, ein anderer Mann kommt, vielleicht nicht mehr ganz so jung wie der erste, und ich sage wieder nein. Wie viele Male kann ich nein sagen, bis keine Männer mehr an unsere Tür klopfen und ich eine Frau werde, die von anderen Frauen verlacht und verspottet wird? Eine vertrocknete alte Jungfer, die ihrer Familie zur Last fällt und Schande über sie bringt.»
«Dann sagst du eben irgendwann ja und fügst dich», meinte Pa-ari. «Du hast doch immer gewußt, daß es dir bestimmt ist, Hebamme im Dorf zu werden, dich zu verheiraten, wenn du Glück hast, und die Früchte deiner Arbeit mit einem guten Ehemann zu genießen.»
«Ja», sagte ich langsam. «Das habe ich immer gewußt und es gleichwohl nicht gewußt. Ist das nicht dumm, lieber Pa-ari? Etwas bis jetzt, bis zu diesem Augenblick hier im Sand nicht zu wissen. Ich halte es nicht aus.»
Er sah mich noch immer an. «Thu, was willst du denn dann?» fragte er leise. «Wozu eignest du dich sonst? Für eine Sängerin oder Tänzerin im Tempel ist es zu spät. Da muß man mit sechs Jahren anfangen, und außerdem tanzen die Mädchen, weil schon ihre Mütter getanzt haben. Schämst du dich denn gar nicht für dein Selbstmitleid? Es lebt sich doch gut im Dorf.» Ich fuhr mir zerstreut durchs Haar und seufzte. Allmählich ließ die niederdrückende Verzweiflung nach.
«Ja, das stimmt», gab ich ihm recht, «aber ich will den Rest meines Lebens nicht hier verbringen. Ich will Theben sehen, ich will feines Leinen tragen, ich will keinen Ehemann, der bei Tagesende verschwitzt und dreckig nach Haus kommt und Linsen und Fisch ißt. Es geht mir dabei nicht um Reichtum!» rutschte es mir ungestüm heraus, als ich seine Miene sah. «Ich weiß nicht recht, worum es geht, aber ich muß fort, sonst sterbe ich!»
«Jetzt übertreibst du aber. Re ist schon im Mund von Nut verschwunden», meinte er, «wir müssen heim, ehe es völlig dunkel ist. Hast du einen Plan, wie du dich aus dem ach so erstickenden Aswat befreien willst?» Jetzt neckte er mich, daher mochte ich auch nicht weiter mit ihm darüber sprechen.
«Nein, habe ich nicht», erwiderte ich kurz angebunden und schritt schlanken Schrittes vor ihm aus, zurück zu den Feldern und den verschatteten Pfad entlang, der in das abendlich stille Dorf führte.
Aber mein Hilfeschrei in der Wüste, so echt und ungeheuchelt, muß den unsichtbaren Mächten, die unser Geschick in Händen halten, nicht entgangen sein. Zuweilen dringt die schiere Not eines großen inneren Aufruhrs bis ins Reich der Götter, und dann halten sie inne in ihren himmlischen Überlegungen und wenden sich der Störung zu. Ach, das ist ja Thu, sagen sie. Was ficht das Kind an? Das ist nicht ihr übliches Gemurre. Ist sie nicht glücklich mit dem Los, das ihr beschieden ist? Dann wollen wir ihr ein anderes spinnen. Wir zeigen ihr eine andere Zukunft, damit sie wählen kann, wenn sie will. Und so dreht sich das gemächliche Schicksalsrad unbemerkt andersherum und schlägt knirschend eine andere Richtung ein, und wir merken erst nach vielen Jahren, daß wir uns von ihm einen neuen Weg haben führen lassen.
Natürlich war mir das damals nicht klar. Erst später sah und spürte ich die geheimnisvolle Veränderung, die mein verzweifelter Ausbruch in der Wüste an jenem Tag in Gang gesetzt hatte. Ich nahm meinen Unterricht bei Pa-ari wieder auf. Was hätte ich sonst auch tun sollen? Sinnlos oder nicht, er war mein Rauschmittel, der Balsam, mit dem ich meine Empörung zu beschwichtigen versuchte. Gleichwohl glaube ich, daß mein vorheriges Los von diesem Augenblick an zu welken begann wie ein Schößling, der von kräftigerem, skrupelloserem Unkraut verdrängt wird, und daß mein neues Schicksal allmählich Form annahm.