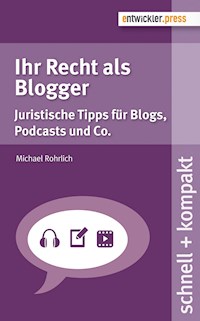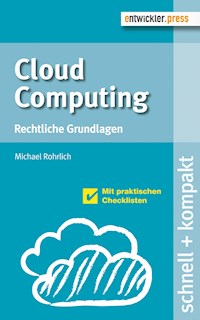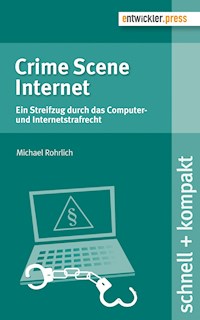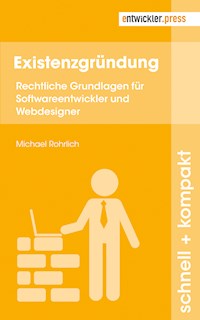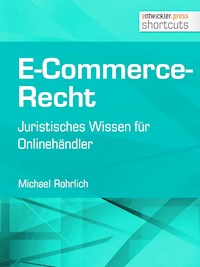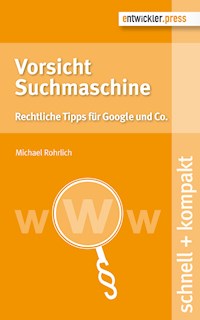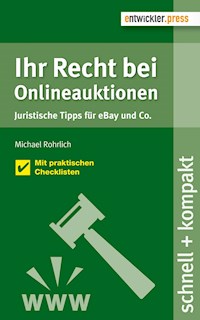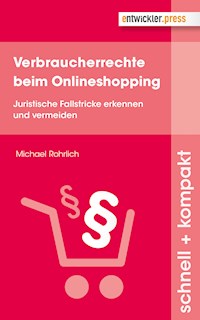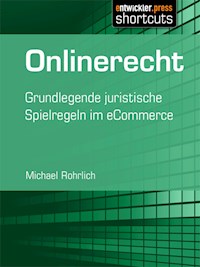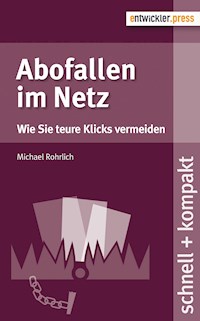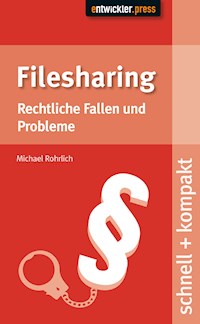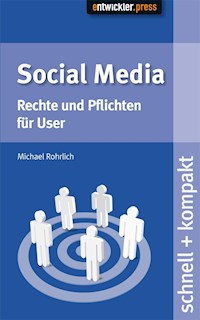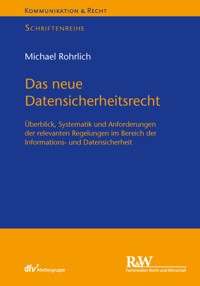
57,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fachmedien Recht und Wirtschaft
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Kommunikation & Recht
- Sprache: Deutsch
DSA, DMA, CRA, AIA, DFA, DNA, DGA, DA, DORA … Die Flut an neuen Digital-Rechtsakten aus der EU hat Unternehmen und Behörden gleichermaßen erfasst – und sorgt vielerorts für Verwirrung: Was bedeutet welche Abkürzung? Welche Regelung gilt für welchen Bereich – und für wen? Dieses Buch bringt Ordnung ins Abkürzungschaos und bietet einen strukturierten Überblick über die wichtigsten EU-Digitalgesetze sowie die dazugehörigen nationalen Vorschriften. Im Fokus stehen Regelungen, die sich – direkt oder indirekt – mit der Sicherheit von Daten und Informationen befassen: etwa im Finanz- oder Gesundheitswesen oder im KRITIS-Sektor. Trotz unterschiedlicher Anwendungsbereiche eint sie alle ein Ziel, nämlich den Schutz sensibler, digital gespeicherter Informationen. Dieses Werk bietet dafür eine einheitliche Herangehensweise – kompakt, verständlich und praxisnah.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das neue Datensicherheitsrecht
Überblick, Systematik und Anforderungen der relevanten Regelungen im Bereich der Informations- und Datensicherheit
von
Michael Rohrlich
Fachmedien Recht und Wirtschaft | dfv Mediengruppe | Frankfurt am Main
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
ISBN 978–3–8005–1989–7
© 2025 Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Mainzer
Landstr. 251, 60326 Frankfurt am Main, [email protected]
www.ruw.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Druck: Beltz Grafische Betriebe GmbH, 99947 Bad Langensalza
Printed in Germany
Vorwort
Die digitale Transformation verändert unsere Gesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung grundlegend. Mit dem rasanten Fortschritt von Technologien, wie Künstlicher Intelligenz, Cloud Computing, Internet der Dinge oder auch Quantencomputing, entstehen nicht nur neue Chancen, sondern auch erhebliche Herausforderungen für Datenschutz, IT-Sicherheit und die Regulierung digitaler Märkte. Der europäische und auch nationale Gesetzgeber reagieren darauf mit einer Vielzahl neuer und überarbeiteter Gesetze, Richtlinien und Verordnungen, die Unternehmen, Behörden und Bürger gleichermaßen betreffen.
Dieses Werk bietet einen kompakten Überblick über die wichtigsten Regelwerke, die das digitale Zeitalter in Deutschland und der Europäischen Union prägen. Ziel ist es, Orientierung zu geben und die zentralen Inhalte, Zielsetzungen und Anwendungsbereiche der relevanten Normen verständlich darzustellen. Dabei werden nicht nur allgemein geltende Gesetze betrachtet, sondern auch verschiedene branchenspezifische Regelungen, etwa für den Gesundheitssektor oder für den Finanzmarkt. Dabei werden die einzelnen Regelwerke jeweils überblicksartig dargestellt. Besonderes Augenmerk gilt einzelnen Rechtsakten, wie der KI-Verordnung, der NIS2-Richtlinie oder auch der Datenschutzgrundverordnung, da sie für eine Vielzahl von Unternehmen und Behörden von großer Bedeutung sind.
Das vorliegende Werk richtet sich an Praktiker in Unternehmen, Behörden und Kanzleien, aber auch an Studenten, Wissenschaftler und alle, die sich einen fundierten Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen des „Datensicherheitsrechts“ (im weitesten Sinne) verschaffen möchten. Es soll helfen, die Komplexität der europäischen und deutschen Digitalgesetzgebung zu durchdringen und die praktische Relevanz der einzelnen Regelungen einzuordnen.
Rechtsanwalt Michael Rohrlich (www.ra-rohrlich.de)
im Juli 2025
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
I. Einführung
1. „Leitfaden“
2. EU-Digitalstrategie/EU-Datenstrategie
3. EU-Datenräume
4. Überblick über die behandelten Gesetze
II. Sicherheit in der EU
1. Cybersecurity Act (CA)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
2. Cyber Solidarity Act (CSA)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
III. (Erweiterter) KRITIS-Bereich
1. NIS2-Richtlinie (NIS2)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
EU-Mitgliedstaaten
Einrichtungen
Leitungspersonen
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
1. NIS2-Umsetzungsverordnung (NIS2UmsVO)
2. ENISA-Leitlinien
3. NIS2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz (NIS2UmsuCG)
4. ISO/IEC 27001
5. BSI IT-Grundschutz
2. NIS2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz (NIS2UmsuCG)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
1. Risikomanagementmaßnahmen (§ 30 BSIG)
2. Meldepflichten (§ 32 BSIG)
3. Registrierungspflicht (§ 33 BSIG)
4. Unterrichtungspflichten (§ 35 BSIG)
5. Besondere Pflichten für Geschäftsleitungen
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
3. CER-Richtlinie (CER)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
4. KRITIS-Dachgesetz
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
5. IT-Sicherheitsgesetz 2.0 (IT-SiG2)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
6. BSI-Gesetz (BSIG)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
IV. Datenschutz
1. Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich Sachlicher Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
2. Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
V. Verbraucherschutz
1. Digitale-Inhalte-Richtlinie (DIRL)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
Bereitstellungspflicht und Konformitätsanforderungen
Updatepflicht
Rückgabe digitaler Inhalte
Einschränkungen bei Kontosperrung und Inhaltslöschung
Keine „As-is“-Klauseln mehr
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
2. Warenkauf-Richtlinie (WKRL)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
Pflichten der Verkäufer
Pflichten der Hersteller
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
3. Digital Fairness Act (DFA)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
4. Ökodesign-Verordnung (ÖkodesignVO)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
Hersteller als Hauptverantwortliche
Regeln für Importeure
Pflichten von Vertreibern und Händlern
Regeln für Online-Marktplätze
Digitaler Produktpass als zentrales Element
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
VI. Produktsicherheit
1. Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
2. Produkthaftungsrichtlinie (ProdHaftRL)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
3. Cyber Resilience Act (CRA)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
4. Maschinenverordnung (MaschinenVO)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
Hersteller
Importeure
Händler
Bevollmächtigte
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
5. Funkanlagen-Richtlinie (RED)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
VII. Künstliche Intelligenz
1. KI-Verordnung (KI-VO)
a) Zielrichtung
Aufbau/Struktur des Gesetzes
Gesetzlich verankerte Prinzipien
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
Bereichsausnahmen
Räumlicher Anwendungsbereich
Sachlicher Anwendungsbereich
Persönlicher Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
Einteilung in Risikoklassen
Anforderungen an Hochrisiko-KI-System; Anbieter- & Betreiber-Pflichten
Anforderungen an KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck
Transparenzpflichten
KI-Kompetenz
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
ISO/IEC 42001 (KI-Managementsystem)
ISO 31000 (Risikomanagement)
ISO/IEC 27001 (Informationssicherheitsmanagement)
IT-Einsatz-Gesetz (ITEG)
BSI AIC4
BRAK-Leitfaden zum KI-Einsatz
Leitlinien für KI-Einsatz in der Bundesverwaltung
Initiativen
GPAI Code of Practice
h) Checkliste KI-VO
2. KI-Haftungsrichtlinie (KI-HaftRL)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten
VIII. Daten(wirtschafts)recht
1. Data Act (DA)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
2. Data Governance Act (DGA)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
3. Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
IX. Finanzsektor
1. Digital Operational Resilience Act (DORA)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
Finanzunternehmen:
IKT-Dienstleister
d) Pflichten von Akteuren
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
Ergänzende EU-Regelungen
Deutsche Regelungen
MaRisk
2. Framework for Financial Data Access (FiDA)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
3. Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
Erfasste Kryptowerte
d) Pflichten von Akteuren
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
Europäische Standards
Deutsche Regelungen
4. Finanzmarktdigitalisierungsgesetz (FinmadiG)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
e) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
X. Gesundheitssektor
1. European Health Data Space (EHDS)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
Primärnutzung
Sekundärnutzung
d) Pflichten von Akteuren
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
2. Medizinprodukteverordnung (MDR)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
3. Patientendatenschutzgesetz (PDSG)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
4. Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
5. Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
XI. Plattformregulierung
1. Platform-to-Business-Verordnung (P2B-VO)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
2. Digital Services Act (DSA)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
3. Digital Markets Act (DMA)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
4. Digital Networks Act (DNA)
a) Zielrichtung
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
c) Anwendungsbereich
d) Pflichten von Akteuren
e) Sanktionen/Geldbußen
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
1https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Digitalgesetzgebung-EU-Konfliktzonen-Wege-zur-Kohaerenz.
2Vgl. „IT-Sicherheit“, 50.1., S. 73ff. in Computerrechts-Handbuch (Taeger/Pohle), 39. EL, April 2024.
3https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5251254.
4https://commission.europa.eu/document/download/84c05739-547a-4b86-9564-76e834dc7a49_de?filename=communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_de.pdf.
5https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14675-Quantum-Strategy-of-the-EU_en.
6Vgl. „Datenrecht“ (Hoeren/Pinelli), S. 8ff.
II. Sicherheit in der EU
1. Cybersecurity Act (CA)
a) Zielrichtung
Die Verordnung (EU) 2019/881 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über die ENISA (Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit) und über die Zertifizierung der Cybersicherheit von Informations- und Kommunikationstechnik und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 526/2013 (Rechtsakt zur Cybersicherheit)7, auch Cybersecurity Act (CA) genannt, stellt einen wichtigen Meilenstein in der europäischen Cybersicherheitspolitik dar und schafft einen einheitlichen Rahmen für die Cybersicherheit in der gesamten Europäischen Union.
Der CA verfolgt zwei Hauptziele: Zum einen die Stärkung der Europäischen Agentur für Cybersicherheit (ENISA) und zum anderen die Schaffung eines EU-weiten Rahmens für die Cybersicherheitszertifizierung von IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen.
Die Verordnung zielt darauf ab, ein hohes Niveau in der Cybersicherheit, bei der Fähigkeit zur Abwehr gegen Cyberangriffe und beim Vertrauen in die Cybersicherheit in der Europäischen Union zu erreichen. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer zunehmend digitalisierten Wirtschaft und Gesellschaft, in der Cyberbedrohungen immer komplexer werden und grenzüberschreitend stattfinden.
Im Kontext der EU-Strategie für einen digitalen Binnenmarkt soll der CA das Vertrauen in digitale Lösungen stärken, indem er Transparenz bezüglich der Sicherheitseigenschaften von sogenannten IKT-Produkten, also Produkten der Informations- und Kommunikationstechnologie, schafft. Dies ist besonders wichtig, da die bisher begrenzte Nutzung von Zertifizierungen dazu führte, dass individuelle, organisatorische und geschäftliche Nutzer unzureichende Informationen über die Cybersicherheitsmerkmale von IKT-Produkten und -Diensten hatten.
b) Inkrafttreten/Anwendbarkeit
Der CA ist am 27. Juni 2019 in Kraft getreten. Die Umsetzung erfolgte jedoch stufenweise:
Die Kernbestimmungen der Verordnung sind seit dem Inkrafttreten anwendbar.
Die Vorschriften über die Benennung der nationalen Behörden für die Cybersicherheitszertifizierung, die Akkreditierung und Notifikation der Konformitätsbewertungsstellen, das Beschwerderecht und das Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf sowie über Sanktionen gelten seit dem 28. Juni 2021.
c) Anwendungsbereich
Der Anwendungsbereich des CA umfasst zwei Hauptsäulen:
Die ENISA und ihre Aufgaben: Die Verordnung definiert das Mandat und die Aufgaben der EU-Agentur für Cybersicherheit, die als zentrales Kompetenzzentrum für Cybersicherheit in der EU fungiert.
Der europäische Rahmen für die Cybersicherheitszertifizierung: Dieser Rahmen gilt für IKT-Produkte, -Dienste und -Prozesse, die in der EU auf den Markt gebracht werden, und schafft ein harmonisiertes System zur Bewertung ihrer Cybersicherheitseigenschaften.
Die Zertifizierung nach dem CA erfolgt derzeit auf freiwilliger Basis, sofern dies nicht durch andere EU-Rechtsakte anders festgelegt wird. Der Anwendungsbereich wird durch ergänzende Rechtsakte, wie etwa den Cyber Resilience Act (CRA), erweitert.
Unter den CA fallen verschiedene Kategorien von IKT-Produkten, darunter:
Hardware-Komponenten
Software
Netzwerkkomponenten
Digitale Dienste und Prozesse.
d) Pflichten von Akteuren
Der CA definiert Pflichten für verschiedene Akteure:
ENISA:
Unterstützung der Mitgliedstaaten und EU-Institutionen beim Aufbau von Cybersicherheitskapazitäten
Förderung der Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten und mit dem privaten Sektor
Bereitstellung von Fachwissen und Beratung zu Cybersicherheitsthemen
Entwicklung und Pflege von Zertifizierungsschemata
Sensibilisierung für Cybersicherheitsrisiken und -maßnahmen
Unterstützung bei der Bewältigung von grenzüberschreitenden Cybersicherheitsvorfällen.
Hersteller und Anbieter von zertifizierten IKT-Produkten, -Diensten oder -Prozessen:
Zugänglichmachung relevanter Informationen zur Cybersicherheit ihrer Produkte für die Öffentlichkeit
Bereitstellung von Updates und Sicherheitspatches
Information der Nutzer über Sicherheitsrisiken und Maßnahmen
Einhaltung der in den Zertifizierungsschemata festgelegten Anforderungen.
Mitgliedstaaten:
Benennung einer oder mehrerer nationaler Behörden für die Cybersicherheitszertifizierung mit ausreichenden Ressourcen und Befugnissen
Überwachung und Durchsetzung der Regeln im Rahmen der europäischen Zertifizierungsschemata
Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedstaaten und der ENISA.
Europäische Kommission:
Erstellung und regelmäßige Aktualisierung eines mehrjährigen Arbeitsprogramms für europäische Cybersicherheitszertifizierungsschemata
Annahme von Durchführungsrechtsakten für die europäischen Zertifizierungsschemata
Förderung der internationalen Anerkennung der EU-Zertifizierungsschemata.
e) Sanktionen/Geldbußen
Der CA selbst enthält keine detaillierten Bestimmungen zu Sanktionen, sondern überlässt es den Mitgliedstaaten, die Strafen für Verstöße gegen die Verordnung und die darauf basierenden Zertifizierungsschemata festzulegen. Besonders relevant sind Sanktionen für:
Ausgabe einer Konformitätserklärung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht
Verletzung der gesetzlichen Informationspflichten.
Mit der fortschreitenden Umsetzung des CA und der Entwicklung weiterer Zertifizierungsschemata ist zu erwarten, dass die Mitgliedstaaten ihre Sanktionsregelungen weiter ausbauen und konkretisieren werden.
f) Zuständige Aufsichtsbehörden
Die Aufsicht und Durchsetzung des CA erfolgt auf zwei Ebenen, nämlich auf EU-Ebene sowie auch nationaler Ebene.
EU-Ebene
nationale Ebene
ENISA als zentrale Agentur für Cybersicherheit in der EU
nationale Behörden für die Cybersicherheitszertifizierung, die von jedem Mitgliedstaat benannt werden muss
Europäische Kommission, die die übergeordnete Aufsicht über den europäischen Zertifizierungsrahmen hat
in Deutschland ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) die zuständige Behörde
Europäische Cybersicherheitszertifizierungsgruppe (ECCG), die aus Vertretern der nationalen Behörden für die Cybersicherheitszertifizierung besteht
diese Behörden sind für die Überwachung, Aufsicht und Durchsetzung der europäischen Zertifizierungsschemata im jeweiligen Mitgliedstaat verantwortlich
Die nationalen Behörden arbeiten eng mit der ENISA und untereinander zusammen, um einen konsistenten Ansatz für die Cybersicherheitszertifizierung in der gesamten EU zu gewährleisten.
g) Ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen & Co.
Der CA wird durch verschiedene ergänzende Rechtsakte, Leitlinien, Normen etc. unterstützt und erweitert. Ein entscheidender Punkt bei der Umsetzung des CA ist die Annahme des ersten europäischen Zertifizierungsschemas (EUCC) durch die Europäische Kommission im Januar 2024. Es ist das erste System, das im Rahmen des Zertifizierungsrahmens des CA verabschiedet wurde. Es wird EU-weit auf freiwilliger Basis angewandt und konzentriert sich auf die Zertifizierung der Cybersicherheit von IKT-Produkten in ihrem Lebenszyklus, wie z.B.:
Biometrische Systeme
Firewalls (Hardware und Software)
Erkennungs- und Reaktionsplattformen
Router
Spezialisierte Software (wie SIEM- und IDS/IDP-Systeme)
Betriebssysteme
verschlüsselte Speicher
Datenbanken
Smartcards und sichere Elemente.
Das EU-Cybersicherheitszertifizierungssystem auf der Grundlage gemeinsamer Kriterien (engl.: EU Cybersecurity Certification Scheme on Common Criteria, EUCC) ist in einer Durchführungsverordnung8 festgelegt worden,die am 27. Februar 2024 in Kraft getreten und seit dem 27. Februar 2025 vollständig anwendbar ist.
Auf der EUCC-Website finden sich neben dem Text der Durchführungsverordnung noch weiterführende Informationen
Description
Abbild der ENISA-Internetseite mit Informationen und einer Kurzübersicht über das neue EU Cybersecurity-Zertifizierungsschema auf Basis der „Common Criteria“ (EUCC)
Das neue EUCC-System ist freiwillig und ermöglicht es IKT-Anbietern, die einen Nachweis ihrer Sicherheit erbringen möchten, ein EU-weit einheitliches Bewertungsverfahren zu durchlaufen, um IKT-Produkte wie technologische Komponenten (Chips, Smartcards), Hardware und Software zu zertifizieren. Das System sieht zwei Sicherheitsstufen vor, die sich nach dem mit der beabsichtigten Verwendung des Produkts, der Dienstleistung oder des Prozesses verbundenen Risiko in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit und die Auswirkungen eines Vorfalls richten. Das EUCC-Schema konzentriert sich auf Hardware- und Softwareprodukte für drei Vertrauenswürdigkeitsstufen:
„niedrig“
„mittel“
„hoch“.
Die Sicherheitsstufen enthalten eine Risikoabwägung im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit von Sicherheitsvorfällen. In der Stufe „niedrig“ können Herstellerunternehmen die Konformität ihrer Produkte und Dienstleistungen selbst bewerten. Die Stufe „hoch“ bestätigt hingegen umfangreiche Fähigkeiten, Cyberangriffe auf dem aktuellen Stand der Technik abzuwehren. Dadurch sollen letztlich private Endkunden informierte Entscheidungen treffen können. Insbesondere soll die Sicherheit von vernetzten Alltagsprodukten erhöht werden, wie etwa dem per App steuerbaren Thermostat oder dem smarten Kühlschrank.
Das BSI ist im März 2025 in Deutschland als alleinige staatliche Zertifizierungsstelle gemäß CA notifiziert worden9. Seitdem darf es Anträge von Herstellern entgegennehmen, die ein europäisches Sicherheitszertifikat für Produkte mit der Vertrauenswürdigkeitsstufe „hoch“ nach den EUCC-Anforderungen erhalten wollen.
Abgesehen davon ergänzt der Cyber Resilience Act (CRA) den CA, und zwar durch spezifische Anforderungen für alle vernetzten Produkte, die auf dem EU-Markt erhältlich sind, indem er verbindliche Mindeststandards für die Cybersicherheit festlegt. Die NIS2-Richtlinie ergänzt den CA ebenfalls, und zwar durch spezielle Anforderungen an kritische Infrastrukturen und wichtige Dienste in Bezug auf Cybersicherheitsmaßnahmen und Meldepflichten. Außerdem ist beim Umgang mit personenbezogenen Daten auch die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu nennen. Sie enthält Bestimmungen zur Sicherheit der Verarbeitung personenbezogener Daten, die mit den Cybersicherheitsanforderungen in Einklang stehen müssen.
Darüber hinaus gilt noch folgendes:
ENISA-Leitlinien: Die ENISA10 veröffentlicht regelmäßig Leitlinien und Best Practices zur Cybersicherheit, die bei der Umsetzung des CA helfen können.
Common Criteria (ISO/IEC 15408): Internationale Norm für die Bewertung der Sicherheit von IT-Produkten, die die Grundlage für das EUCC-Schema bildet.
SOG-IS-Abkommen: Ein Abkommen11 zwischen 17 EU-Mitgliedstaaten zur gegenseitigen Anerkennung von Cybersicherheitszertifizierungen, das durch den CA und das EUCC-Schema schrittweise ersetzt wird.
In Entwicklung befinden sich weitere Zertifizierungsschemata, die spezifische Bereiche abdecken werden, wie z.B. für Cloud-Dienste oder das Internet der Dinge (engl.: Internet of Things, IoT).
2. Cyber Solidarity Act (CSA)
a) Zielrichtung
Die Verordnung (EU) 2025/38 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Dezember 2024 über Maßnahmen zur Stärkung der Solidarität und der Kapazitäten in der Union für die Erkennung von, Vorsorge für und Bewältigung von Cyberbedrohungen und Sicherheitsvorfällen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/694 (Cybersolidaritätsverordnung)12 wird auch als Cyber Solidarity Act