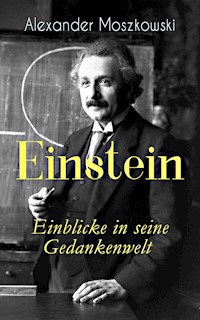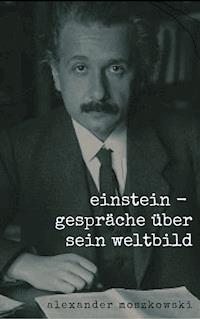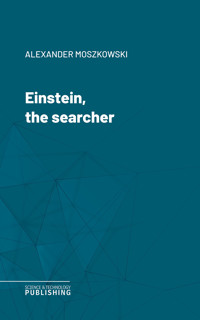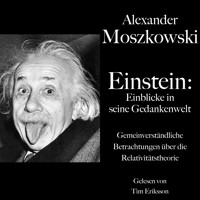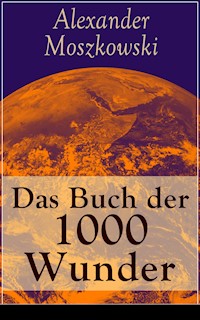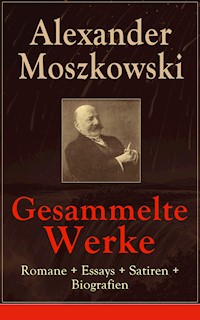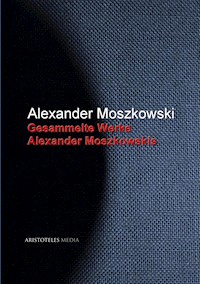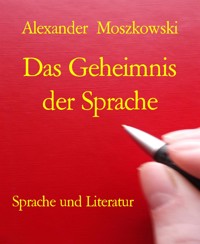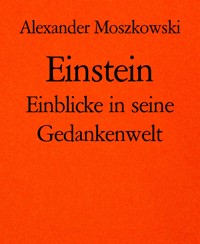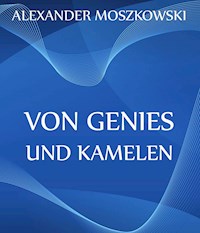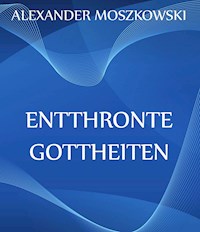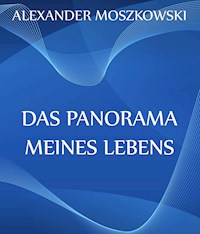
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Alexander Moszkowsk war ein deutscher Schriftsteller und Satiriker polnisch-jüdischer Abstammung. Moszkowski gehörte seit 1892 zu den Mitgliedern der Gesellschaft der Freunde. Er war eine Persönlichkeit der Berliner Gesellschaft und mit Berühmtheiten wie Albert Einstein bekannt. Moszkowski war einer der ersten, die die Relativitätstheorie einem breiten Publikum populärwissenschaftlich zugänglich machten. Dies ist seine Autobiografie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Panorama meines Lebens
Alexander Moszkowski
Inhalt:
Alexander Moszkowski – Biografie und Bibliografie
Das Panorama meines Lebens
An meine Leser
Fibel der Kindheit
Höhenrausch
Im Dienst des Lachens.
Zwischen Sumpf und Himmel
Zauber des Südens
Meine Circenses
Das Paradies von Weimar
Lichter ringsum
Das Panorama meines Lebens, A. Moszkowski
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849632168
www.jazzybee-verlag.de
Alexander Moszkowski – Biografie und Bibliografie
Deutscher Schriftsteller und Satiriker polnisch-jüdischer Abstammung. Geboren am 15. Januar 1851 in Pilica, verstorben am 26. September 1934 in Berlin. Bruder des Komponisten und Pianisten Moritz Moszkowski. Aufgewachsen in Breslau und später Umzug nach Berlin, wo er für die Satirezeitung "Berliner Wespen" arbeitete. Nach Differenzen mit dem Verleger gründete er seine eigene Zeitschrift „Lustige Blätter“, die sehr erfolgreich war. Seine Freundschaft mit Albert Einstein gipfelte darin, dass er als einer der ersten die Relativitätstheorie einem breiten Publikum populärwissenschaftlich zugänglich machte.
Wichtige Werke:
· Das Geheimnis der Sprache (Essays)
· Das Panorama meines Lebens (Autobiographie)
· Der Venuspark
· Die Ehe im Rückfall und andere Anzüglichkeiten (Satiren)
· Von Genies und Kamelen (Satiren)
· Die Inseln der Weisheit (Utopischer Roman)
· Einstein - Einblicke in seine Gedankenwelt
· Entthronte Gottheiten
· Unglaublichkeiten (Satiren)
Das Panorama meines Lebens
An meine Leser
Ich setze den Plural wunschweise und aus einem gewissen Aberglauben. Denn die Anrede soll erkennen lassen, daß ich mir sehr viele Leser vorstelle und dem Fatum die Möglichkeiten nicht verschränken möchte. Aber ich spezialisiere sofort und greife mir einen einzelnen Leser heraus, um mich mit ihm zu unterhalten.
Dem sage ich zunächst: Wenn du in diesen Denkwürdigkeiten sensationelle Enthüllungen erwartest, entsiegelte Staatsarchive, aufgedeckte Fäden in den Intrigenspielen der großen Welt, dann steht dir eine Enttäuschung bevor. Es gibt Dutzende von Memoirenwerken, die dem Bedürfnis nach politischer und gesellschaftlicher Aufregung stärker entsprechen als das vorliegende.
Das wäre nun noch keine captatio benevolentiae, und du fragst, durch welche Ermunterung ich dein Wohlwollen zu wecken beabsichtige.
Ich bin deswegen so wenig in Verlegenheit, daß ich sogar glaube, dir etwas ganz Besonderes versprechen zu können. Ich biete dir ein Leben, das wert war gelebt zu werden, dargestellt in Erinnerungen und Betrachtungen, die weit über mein Einzeldasein hinausgreifen. Du selbst wirst dich darin finden mit Tatsachen, die dir gehören, noch mehr mit Äußerungen des Unterbewußtseins, mit seelischen Geheimnissen, die du mit mir teilst.
Mein Plan war, aus den Gegebenheiten meines Lebens etwas Größeres, Allgemeingültiges zu entwickeln. Es sollte ein Panorama werden, aber nicht auf einer Fläche vorübergleitend, sondern mit den optischen Möglichkeiten einer Universalschau. Wie eine silbern spiegelnde Glaskugel in einem Garten, die, für sich genommen, räumlich klein ist, aber mit ihren Reflexen weit in die Welt reicht bis ans Firmament.
Hunderte von Leben würden sich dazu eignen, in dieser Weise zurecht geschliffen zu werden, um als Reflexträger des Allgemeinen, Weitgespannten zu wirken. So verstand es Goethe, als er die Forderung aufstellte: »Jeder Mensch sollte seine Memoiren schreiben, sie wären meist lehrreicher als wissenschaftliche Werke!« Weil nämlich jeder als Eigenbiograph ein höchst wichtiges Thema behandeln könnte, in dem er gelehrter ist als irgend ein Mensch der ganzen Welt: seine Persönlichkeit. Es fragt sich nur, ob er imstande ist, dieses von Fall zu Fall unvergleichliche Thema so zu bearbeiten, daß diese Person als ein Unikum, als ein niemals Wiederholbares hervortritt. Könnte und täte das jedermann, so stünde die Memoirenliteratur im Schrifttum ganz zu oberst. In Wirklichkeit begnügt sie sich mit einer viel bescheideneren Stufe und findet in der Mehrzahl ihrer Gebilde den Platz ganz zu unterst. Nur wenige dieser Klasse ragen hervor als Monumente. Spärlich wuchsen sie herauf, wenn der Beschreiber zum Dichter wurde, der den Menschen in sich entdeckte und ihn romanhaft erhöhte wie im »Copperfield« und »Grünen Heinrich«. Aber solche Werke zählen ja kaum zu den Denkwürdigkeiten. Da verlangt man ein deutlich erkennbares Bezugssystem, der Autor soll sich mit dem Helden decken, er soll über ihn nicht fabulieren, sondern berichten. Und dieser Aufgabe verdankt es die Gattung, daß sie fast durchweg im Handwerk stecken blieb, im Stil des Tagebuchs, des Rapports. Ich denke hier vorzugsweise an die neueren Erscheinungen, die in den letzten Jahrzehnten über uns gekommen sind, an die Überfülle der Bekenntnisse erledigter Minister, Botschafter und Generäle, die korrekt sind – wenn der Autor nicht das Dichten durchs Flunkern ersetzt, – korrekt wie ein Polizeibericht und richtig wie ein statistisches Handbuch oder eine Logarithmentafel. Was für druckerschwärzliche Nöte haben wir an diesen geschichtsklitternden Exemplaren ausgestanden, deren beste kaum über den wiedergekäuten Leitartikel hinausgingen und über das aufgeplättete Feuilleton!
Aber mir würde es noch lange nicht genügen, wenn der Darsteller eigenen Lebens bloß gut zu erzählen verstünde. Genügt es dir, Leser? Empfindest du nicht, daß eine Begebnisreihe aus irgendwelchem Leben, entweder einen Poeten verlangt oder, falls nur der Biograph zur Stelle, einen Gedankenformer?
Gewiß, du hast es dir neuerdings oft genug gesagt bei der Berührung mit den Produkten aus der Sudelküche vieler diplomierter Ich-Schreiber: das ist zwar nicht edelste Literatur, aber doch ganz interessant. Es kommen so viele hohe Herrschaften in diesen Büchern vor und Indiskretionen, und Diners und Anekdoten, und man bleibt so hübsch am Leitseil der Chronologie. Aber prüfe dich einmal, wenn du zehn solcher Bände erledigt hast, ob sie dich bereichert haben, ob dein Kopf oder dein Herz einen Gewinn davon trug.
Ich möchte deine Empfindlichkeit schärfen nach demselben Maße, wie ich mir selbst meine Aufgabe über das Marktläufige hinweg gespannt habe. Gegen die Tatsachen will ich mich gar nicht auflehnen. Die sollen in Fülle und Interessantheit das feste Skelett jedes Memoirenwerks bleiben und ihm zum Stehen und Schreiten den Halt geben. Aber wenn sein Inhalt nichts anderes bietet, als immer nur Tatsachen, dann ist es so lang wie breit ein Skelett, ein schlotterndes Gerippe. Die interessantesten Knochen verhelfen ihm nicht zum Leben, wenn ihm nicht ein pulsierendes, atmendes Gewebe von Muskeln, Sehnen und Nerven dazuwächst.
Das ist aber schon eine Unmöglichkeit in dem üblichen Schema der Memoiren, das die Einhaltung der Chronologie voraussetzt und die Tatsachen am Zeitfaden aufreiht. Fängt die Geschichte an: »Ich bin geboren in – –«, »mein Vater war – –«, so liegt bereits der Verdacht vor, daß du, Leser, mitgenommen werden sollst von Etappe zu Etappe, es läßt sich wetten, daß du Empfänger einer Chronik, wirst, aber nicht eines Lebenswerkes, in dem das Begebnis mehr bedeutet als den Zufall an diesem Ort und zu dieser Stunde.
Denn das wirkliche Leben ordnet nicht für den erkennenden Verstand, und sein Ablauf, obschon in sich streng determiniert und folgerichtig wie ein physikalisches Experiment, bietet dem Betrachter den Wirrwarr, wie ein Film, der programmlos auf der Straße aufgenommen wird. Unerkennbar bleiben in solchem Zufallskino tausend Schicksalsfäden, die sich in ihm mit strenger Logik abspinnen, aber in der Bewegung der Masse von keinem Menschenauge auseinander gehalten werden können. Das vermöchte nur ein Über-Laplace, vor dessen Scharfblick sich das Gewirr zu sinnvollen Vorgängen auflöst. Wer daher in seinen Berichten das getreue Nacheinander innehält, der kann nur Chaotisches liefern, flimmernde Filmbilder ohne höheren Bezug. Er glaubt historisch zu verfahren und verkennt dabei den Wert der Historie überhaupt, die erst anfängt eine Wissenschaft zu werden und eine Erkenntnisquelle, wenn sie aufhört, ein Speicher aufgestapelter Tatsachen zu sein.
Hieraus erfließt die Nutzanwendung für die Darstellung eines Lebens. Soll die Erkenntnis einen Platz finden, so müssen die Tatsachen aus der Speicherhaft befreit werden. Frei hinzustellen sind sie, so daß sie Durchblick gewähren von der Engnis irdischen Erlebnisses auf kosmische Gestaltungen. Und das verlangt eine besondere Kunst, die der wahren Wirklichkeit ihre Rechte läßt, ohne sich sklavisch an eine Tabelle zu binden. Diese Kunst verfährt nicht kartographisch und generalstäblerisch, sondern nach dem Prinzip eines Landschafters, der das Unwesentliche unterdrückt und das Wesentliche bildhaft steigert. Sie geht nicht darauf aus, die ganze Natur, das ganze Leben in einen einzigen Rahmen zu zwängen, sondern sie schafft Einzelbilder, von denen jedes den Betrachter in besonderem Sinn orientiert.
So zerfällt auch mein Panorama in Sonderdarstellungen, die sich räumlich und zeitlich mehrfach weit voneinander entfernen. Ihre Einheitlichkeit gründet sich auf die Einheit der Person: ich bin und bleibe darin das Objekt, allein ich begnüge mich nicht mit der Rolle eines Individuums, dessen Sehkreis sich dort begrenzt, wo das Curriculum vitae aufhört. Ich versuche, über mich hinauszugreifen und den Horizont so weit zu spannen, als es die Anlage eines Erinnerungsbuches gestattet; denn auch das Denken, das Erträumen, das Wandeln auf abseitigen Geisteswegen ist Erlebnis, und wenn ich in Erinnerung daran an Probleme gelange, so sind mir diese meist wichtiger als der Verfolg konkreter Begebenheiten. Nur in einigen Absätzen, zumal im Anfang des Buches, lasse ich die Tatsachen überwiegen, weil sie zeitlich sehr weit zurückreichen und ich für sie die Beleuchtung des Vordergrunds brauche, um sie mir selbst sichtbar zu machen. Weiterhin, wenn diese Sorge fortfällt, stelle ich sie in freier Anordnung auf die Szene, lasse ich verschiedene Lichter hineinspielen, prismatisch gebrochene, farbige, die der Darstellung ein wechselvolles Kolorit ermöglichen. Besonderen Wert lege ich auf die persönlichen Lumina, die hier in den Bildern wirken sollen, wie sie zuvor meinen Lebensweg bestrahlten; viele hervorragende Menschen lasse ich als Fackelträger über die Szene schreiten.
Und in allen Phasen meines Berichts schwebt mir ein alter ego vor, du selbst, Leser, den ich nicht nur unterhalten, sondern zum Mitwirken einladen möchte. Was mir bisweilen wie die Stimme des Unterbewußtseins klingt, soll in dir ein Mittönen veranlassen, mit Schwingungen, die sich durchaus nicht immer auf volle Konsonanz einzustellen haben. Vielmehr bleibt reichlich Platz für gegensätzliche Stimmführung, für jeden erdenklichen Kontrapunkt. Aber wenn in dir etwas Selbständiges, Ergänzendes erklingt, so würde es doch stumm geblieben sein, ohne den besonderen Ton-Anschlag, den dieses Buch dir zuführt. Und ich könnte mir vorstellen, daß die Grundklänge vorliegender Schrift in Verschmelzung mit deinen Obertönen eine ganz reizvolle Klangfarbe erzeugen werden.
Meine Erinnerungen reichen sehr weit zurück; mir sind winzige Einzelheiten im Gedächtnis verblieben, schattenhaft und doch unverwischbar, die an der Grenze des dritten und zweiten Lebensjahrs liegen müssen. Aber auf meine Urheimat vermag ich mich nicht zu besinnen. Die ist für mich paläontologisches Gebiet, irgendwo im damaligen Russisch-Polen, wo ich in einem abseitigen Nest namens Pilica – in klassischer Aussprache »Pilitza«, in vulgärer Abkürzung bloß »Pilz« – am 15. Januar 1851 mit der besten aller Welten erste Bekanntschaft machte. Ich war fünfzehn Monate alt, als meine Eltern den Wohnsitz nach Breslau verlegten; eine kostspielige und schwierige Angelegenheit, denn die Auswanderungsgebühr verschlang fünfzehnhundert Rubel, der Umzug und die Einbürgerung in Preußen fraß weitere Löcher in das schmächtige Portemonnaie meines Vaters. Eigentlich hätte sich in unserer Familie Geld befinden müssen, denn mein Großvater mütterlicherseits hatte einmal das große Los gewonnen, aber der ganze Reichtum war blöde verjuxt worden, man schaffte eine vierspännige Equipage an, fuhr mit Kind und Kegel zu luxuriösem Leben nach Karlsbad und fand weitere sinnige Methoden zur Vergeudung des Restes. Als mein Vater heiratete, stiftete man ihm eine Mitgift von 1100 Gulden damaliger polnischer Währung, was sich in 183 Taler umrechnen ließ. Dieser Größenordnung entsprechend hielten sich auch die Lebensanschauungen meiner Eltern in den allerengsten Grenzen. Eine Bildung in westeuropäischem Sinne war kaum andeutungsweise vorhanden. Allein in diesem engen Horizont befand sich ein Konzentrationspunkt für Sehnsüchte nach einer ultrapolnischen Kultur, die etwa in Myslowitz begann und sich in schlesisches Land erstreckte bis zum Kulminationspunkt Breslau. Darüber hinaus dachte man nicht, da sonstige Städte wie Berlin, Leipzig oder Wien für diese Vorstellung in anderen Planetensystemen lagen.
Nach heutigen Begriffen trug Breslau mit seinen 100 000 Einwohnern die Ausmaße einer unbeträchtlichen Provinzstadt, noch lange nicht an gewisse Vororte Berlins heranreichend, die es um die Jahrhundertwende bis zur dreifachen Seelenzahl brachten. Aber für den polnischen Kleinbürger besaß es Londoner Dimensionen und dazu einen Geistesglanz wie Athen im Altertum, zu Perikles' Zeiten, wo ja ganz Attika nicht mehr Bewohner zählte als das heutige Görlitz. Die Bildung, so schwebte es meinem Vater vor, konnte sich nicht in dem einfachen Drill der Gebetschule erschöpfen, und auf den Breslauer Anstalten, überragt von der Universität Viadrina, gab es sicherlich viele Lehrmeister, die noch mehr und besseres wußten als die Talmudisten der dunklen Heimat. Blieb ihm selbst das Wissensparadies verschlossen, so sollte es sich doch einmal dem kleinen Alex öffnen.
Über die Bestandteile solches Wissens dämmerten ganz nebelhafte Ahnungen. Sprachenkunde, das war wohl das wichtigste, irgendwelche Bücherweisheit, worin Hochdeutsch, Lateinisch und Griechisch – im Jargon hieß das »Greckisch« – vorkommen mochten. Hiermit verflochten sich ganz verworren die Namen einiger Berühmtheiten, die zufällig in jenen engen Ideenkreis eingedrungen waren. Homer, Dante, Shakespeare fehlten auf der Liste, Goethe war ein Klang, von Schiller kannte man einige Szenen und Verse, von Lessing den Nathan, und als der Hauptvertreter der Gelehrtenwelt galt Alexander von Humboldt, der ein ungeheures Buch »Kosmos« geschrieben haben sollte. Da sah man in weitester Ferne, mit verschwimmenden Umrissen ein Ziel: vielleicht war es möglich, den kleinen Sprößling der Familie auf eine Fährte zu setzen, damit er dereinst so eine Sache wie den Kosmos studieren und verstehen konnte. –
Die erste Station zur Humboldt-Höhe war eine Kleinkinder-Bewahranstalt im Dorotheengäßchen, wenige Schritte von unserer Behausung. Ich war drei Jahr alt, als man mich dort hineintat, und mein erstes Debüt lief übel ab. Natürlich gab es dort noch kein schulmäßiges Lernen; die ältliche Vorsteherin erzählte den Knirpsen allerlei, die Kleinchen waren auf Bänken aufgereiht, damit sie sich an manierliches Sitzen gewöhnten. Allein ich war sogar den Anfangsgründen des Benehmens unzugänglich und produzierte mich mitten in der Stube mit einem hydraulischen Akt, der bei gesitteten Kindern sonst nur unter Ausschluß der Öffentlichkeit vorkommt. Man hatte mich offenbar überschätzt, als man mir die moralische Reife für die Kleinkinder-Bewahranstalt zutraute, und hielt zur Vermeidung fortgesetzten Ärgernisses einen vorläufigen Besserungskursus im Hause für angezeigt; und nachdem man mir die ärgsten Springbrunnen-Phänomene ausgetrieben hatte, wurde ich zur weiteren Übertünchung mit europäischer Kultur einer Spielschule überliefert. Das war nun eine ganz lustige Angelegenheit. Die Kinder wurden von überallher früh morgens in besonderem Omnibus abgeholt, gegen Mittag ebenso heimgebracht, und mit fröhlichem Gelärm wie diese Spazierfahrt im klingelnden Wagen verlief auch der ganze spielerisch angelegte Unterricht. Es gab da nicht nur Haschemann, Kämmerchenvermieten, Seilspringen und Kreiseltreiben, sondern auch Ansätze zu Handfertigkeitsübungen und Spuren von Sprachkultur. Die Namen etlicher Pfleger sind mir noch gegenwärtig: Roedelius, der als Turnwart den Hauptbetrieb leitete, und ein schweizer Fräulein l'Ami, mit der wir ein bißchen auf französisch kauderwelschten. Man gab uns auch, ohne jede methodische Anleitung, Bilderfibeln mit Knittelversen und Prosatexten, deren Sinn den Geweckteren schnell genug aufging. Das vollzog sich wesentlich instinktiv und automatisch. Ich habe nicht die leiseste Erinnerung an ein Lesenlernen, besinne mich aber genau, daß ich rund zwei Jahre vor dem schulpflichtigen Alter mit deutscher Fraktur und mit Antiquaschrift ganz ausreichend Bescheid wußte; denn als man mich als noch nicht Sechsjährigen aufs Gymnasium gab, fand ich sogleich Unterkunft in der Oktava, mit Überspringung der untersten ABC-Klasse. Ein Jahr später, immer noch in der Vorschulabteilung, bekam ich bereits eine Menge lateinischer Vokabeln eingetrichtert, nach einem längst überwundenem vorsintflutlichen Lehrplan. Viele Begriffe gelangten an mich in Lateinworten, bevor sich der deutsche Ausdruck in meinem kleinen Schädel eingebürgert hatte. Und diese Einpaukerei wurde nicht etwa einem Bakelschwinger der Klippschule überlassen; nein, der Rektor selbst, der seinerzeit sehr berühmte Professor Fickert, der sonst nur in Prima dozierte; erschien täglich in der Septima, um die Jungchen mit ciceronianischen Mitteln zu bearbeiten, indem er lateinisch fragte und lateinische Antworten verlangte. Das mag zu allererst ganz absurd klingen, es ist und war aber durchaus nicht unmöglich: erzählt uns doch auch Montaigne in seinem Kapitel von der Kinderzucht, daß er sich mit sieben Jahren ein ganz brauchbares Gesprächslatein angeeignet habe, bevor er noch von seiner französischen Muttersprache eine rechte Ahnung besaß. Es gibt eben Verständigungswege, die in keiner Grammatik vorgezeichnet stehen, und wer für humanistische Erziehung sehr viel übrig hat, der wird am Ende auch jene prämaturierte Gymnasialmethode nicht gar so schrecklich finden.
Mit dem Deutschen freilich haperte es. Ich befand mich eingekeilt in Fickert'schem Latein, häuslichem polnisch-orientalischem Jargon und schlesischem Gassendialekt, mit seinem Gewimmel mundartlicher Brocken, von denen heut manche kaum noch in versteckten gebirgsschlesischen Winkeln in Umlauf sind. Und meine Kinderbücher waren auch nicht geeignet, mich zur wahren Germanistik zu führen, zumal ich stark zu privaten Deutungen neigte, weitab von jeder deutsch-sprachlichen Möglichkeit. So begann eine gedruckte Fabel: »Die Nachtigall ging einst auf Reisen und zur Gesellschaft nahm sie eine Lerche mit.« Der Zufall hatte das Mittelwort »Gesellschaft« an den Zeilenschluß gesetzt und durch Abteilungsstrichel in Gesellschaft zerlegt. Das kleine »schaft« bedeutete mir eine gleichgültige Partikel, während der Anfang nunmehr hieß: »Die Nachtigall ging einst auf Reisen und zur Gésell...« Folglich war die Gésell – mit dem Ton auf der ersten Silbe – ein Vogel, den die Nachtigall besuchen wollte. Und diese Deutung setzte sich in mir so fest, daß ich noch nach Jahren das gedruckte Wort Gesellschaft nicht ansehen konnte, ohne daß mir aus den ersten Silben ein ganz bestimmter Vogel, nämlich ein bunter Fink, entgegenpiepte. Dies mochte damit zusammenhängen, daß meine ganze Vorstellungswelt von gefiederten Wesen bevölkert war. Sie hießen in der Familie »Wedden« oder »Weddeles«, zärtlich verdorben aus »Vögelchen«, wir hatten stets solche Kreaturen in Käfigen, in Hecke-Vorrichtungen, Kanarienvögel, Stieglitze, Bengalisten, die wir einzeln mit hätschelnden Bezeichnungen belegten: Prinkel, Hoppenprinkel, Jeïschle, Kitschkischi, Worte, deren, Bedeutung sich viel später ins Persönliche ausdehnten, um dann sinngemäß übertragen meine Braut und Ehehälfte zu kosen. Aber der Generaltitel für das liebe Getier blieb erhalten, und als ich nach reichlichen Jahrzehnten für Harden's »Zukunft« arbeitete, erschien dort von mir eine ganz lehrreiche ornithologische Studie mit der Überschrift »Weddele«. Meine Leidenschaft für die beschwingten Kreaturen wurde von den Eltern und von meinem jüngeren Bruder Moritz – der sich später als Tonkünstler einen bedeutenden Namen gemacht hat – vollauf geteilt, ja, dieser übertraf mich sogar noch in der praktischen Auswirkung, da seine Liebe von den lebendigen Objekten offensichtlich erwidert wurde. Er verstand sich auf zärtliche Lockrufe, und es ereignete sich gar nicht selten, daß ihm im Wald und auf der Wiese Vögel auf die Hand flogen. Einen Teil seiner späteren Menagerie hat er sich selbst eingefangen, ohne die Künste eines Vogelstellers, lediglich durch die Affinität zwischen Mensch und Tier, die sich bei ihm in einer ganz erstaunlichen Fernwirkung kundgab.
Mein eigener Hätscheltrieb beschränkte sich nicht auf das Kleinformat. Wenn ich an meine Vorschulzeit zurückdenke, so tritt alsbald ein Vogel in den Vordergrund, der damals für mich mindestens die Ausmaße gezeigt haben muß, wie ein tüchtiger Schwan für einen Erwachsenen. Die Septima befand sich nämlich abseits des großen Gymnasiums zu Sankt Elisabeth in einem Seitenhäuschen, auf dessen Gehöft irgendwer eine Geflügelzucht betrieb. Dieser Hof war für die Zwischenstunden mein Tummelplatz, und hier hatte ich an einer ausgewachsenen gelbbraunen Henne eine Freundin gewonnen. Sie kam gern zu mir, und es gewährte mir ein unbeschreibliches Vergnügen, das schwere Biest auf meinen Armen zu wiegen, ja, ich trug mich sogar mit der Idee, das Huhn aus seiner Klausur zu entführen und es unserem Hausstand als Giganten-Wedde anzugliedern. Dieses opernhafte Projekt gedieh nicht zur Ausführung, weil wohl meine Muskelkräfte nicht so weit gereicht hätten, als der romantische Wunsch; ich wäre zudem mit dem Strafrecht der Anstalt in Widerspruch geraten, und in dieser Hinsicht übte Sankt Elisabeth keine Sentimentalitäten, da sie vielmehr alle Konflikte in der einfachsten Weise durch stramme Prügel auszutragen pflegte. So verblieb es bei dem liebenswürdigen Gegluckse des Tieres, ohne die Begleitmusik eines klatschenden Rohrstockes; und von Septima her ist mir der gelbliche Vogel ebenso gegenwärtig als wichtige Figur, unverlöschbar wie der Rektor selbst, dem ich die Wissenschaft verdanke, daß Huhn und Henne nur profane Ausdrücke wären für das klassische »gallina«.
*
Ich habe bereits angedeutet, daß in der häuslichen Umfriedung die Verbände mit der Urheimat keineswegs glatt durchschnitten waren. Die Sprache bewahrte vielfache orientalische Väterklänge, und die Lebensführung blieb bis zu gewissem Grade »fromm«, das heißt rituell. Nicht als ob mein Vater an die Unverbrüchlichkeit der Gesetze vom alten Stamme geglaubt hätte; er durchsprenkelte vielmehr die Regel mit bequemen Ausnahmen und ließ der Freigeistigkeit weiten Spielraum. So erschien beispielsweise zur Passahzeit das ungesäuerte Osterbrot, die Mazze, als obligatorisch, ohne daß deswegen die brave schlesische Semmel vom Tisch verbannt war. Am Versöhnungstage wurde gefastet, aber mit kleinen erquicklichen Kaffee-Episoden dazwischen. Hauptsache war, daß es in der Wirtschaft so aussah, Als Ob, denn man wurde doch beobachtet, und eine so ausgebreitete Verwandtschaft, wie wir sie besaßen, weiß sich mit ihrer Kontrolle schon durchzusetzen. Ich bin niemals dazu gelangt, auch nur annähernd zu ermitteln, wie viel Onkels, Tanten, Vettern und sonstige Anhängsel der weiteren Familie in der Welt umherwimmelten. Man war bis ins Unabsehbare versippt und verschwägert, und seit wir unsere Zelte in Breslau aufgeschlagen hatten, entluden sich Schwärme über uns, die in der Kopfzahl an die Scharen der Völkerwanderung erinnerten. Die meisten kamen aus obskuren Nestern herangeschwemmt, aus Dzialozice, Pilica, Sosnowice, Kielce, Pintschow, Olkusz, Koslow, viele aber auch Lodz und Warschau, und bei ihnen befanden sich nicht selten Weiblichkeiten von auserlesener Schönheit, heiratsfähige Jungfrauen, nach denen man Vignetten zum Hohelied »Rose von Saron« hätte bilden können. Es fehlte auch nicht an praktischen Hintergründen; die Männer kamen größtenteils geschäftlich, hauptsächlich zur Zeit des Wollmarkts, sie kitzelten auch ein bißchen an der Börse, und die Geschäfte erstreckten sich bis ins Reich Hymens mit Heiratsplänen für die mitgebrachten Huldinnen, die im allgemeinen Treffpunkt Breslau zur Schau auf den westöstlichen Diwan gesetzt wurden. Ich hörte beständig von Verlobungen reden und bevorstehenden Vermählungen, aber dabei müssen doch dramatische Verwickelungen bestanden haben, denn in den Gesprächen kamen doch noch mehr zurückgegangene Partien vor als perfekte Hochzeiten. In unserer Wohnung war ein Verhandlungsherd, ein zweiter befand sich beim Oberlandesrabbiner Tiktin, mit dessen Haus wir innige Beziehungen pflegten. Das waren die beiden Brennpunkte für die planetarischen Ellipsen, in denen sich die promessi sposi bewegten. Man blickte zum Oberhaupt der Gemeinde als zu einer Respektsperson ersten Ranges und pries ihn besonders als einen Meister der Eloquenz. Aus seinen Hochzeitspredigten sind einige Fragmente geflügelt geblieben, wie etwa: »Sie, liebe Braut, stammen aus einem Freudenhause und sind guter Hoffnung zu führen eine glückliche Ehe; und bestimmt werden Sie glücklich werden denn Ihr Bräutigam ist ein selten anständiger Mensch.« Für die Schlagfertigkeit seines Ausdrucks zeugt eine Bahnhofsszene beim Empfange des Königs Wilhelms I. Auf die huldvolle Anrede des Monarchen: »Nun, lieber Oberrabbiner, wie geht's?« erwiderte er mit sinnigem Mienenspiel: »Wie soll's gehen, Majestät – me lebt!« –
In jenen Zeiten machte ich die erste Bekanntschaft mit einer Denkweise, der ich später in Nähe der Jahrhundertwende eine berufliche Arbeit zugewendet habe. Und ich möchte in diesen Bekenntnissen verraten, daß eine erhebliche Anzahl von Scherzblüten aus dem Garten der jüdischen Humoristik tatsächlich zuerst durch mich zu Druck und Verbreitung gelangt ist. Vielfach kamen sie an mich in Erstentstehungen aus dem Munde jener besuchenden Verwandten, der kaftantragenden Männer mit Stirnlöckchen, die ihre Bemerkungen und Sentenzen hervorbrachten in losen, einem idiomfremdem Ohr ganz unverständlichen Improvisationen. Ich selbst begriff als Knabe davon nicht allzuviel, aber mein Vater war dankbarer Empfänger, und da er mein Interesse für diese seltsamen Gedankensplitter bemerkte, half er mir mit Umschreibungen nach, die sich meinem Sprachverständnis schon um einige Grade annäherten. Erst sehr viel später, als ich schon schriftstellerte und redigierte, meldete sich bei mir das frühe Gedächtnis und lieferte mir aus der Zeitverschüttung viel Versprengtes, sonst rettungslos Vergessenes. Einige dieser blinkenden Scherben haben in meinen Druckschriften Unterkunft gefunden, man kolportiert sie auch noch als autorlos, wie ganz natürlich, da ich der einzige Überlebende bin, der sich der Urheber entsinnt. Deren Geistesäußerungen sind einzeln genommen literarisch ganz wertlos, sie könnten aber doch zu literarischer Arbeit verlocken. Ich habe mich erst kürzlich anläßlich eines meiner Vorträge davon überzeugt, daß einzelne Proben, dem originalen Tonfall angenähert, noch heute sehr schlagkräftig wirken; es hat sich dabei auch gezeigt, daß es möglich ist, in die Witzmaterie analytisch einzudringen und in ihr einen quasi-philosophischen Atomkern abzuspalten. Man könnte aber auch untersuchen, wie sich die Substanz des jüdischen Witzes im Zeitenwandel gemodelt, verfeinert oder verschlechtert hat; die Geheimfäden aufdecken zwischen ihr und den Gestaltungen des klassischen Aphorismus. Man würde dann vielleicht die Höhepunkte der Veredelung in Heine und Börne wahrnehmen, die Tiefpunkte der Verelendung in Saphir und seinen wortwitzelnden Nachtretern. Als Publikum hierfür denke ich mir freilich eine Galerie von Hörern, denen von Anfang an die sprachlich gesicherte Einheit von Witz und Wissen gegenwärtig ist, und die es außerdem begreifen; daß eine sehr starke durch Druck niedergehaltene Intelligenz sich in Witzentladungen Luft macht. In diesem Betracht sind für mich jene längst vermoderten Menschen in Patriarchentracht gültige Typen geblieben; sie rebellierten unbewußt gegen ihre talmudische Verknöcherung, indem sie den Impuls zum Stöhnen durch Gelächter überwanden. –
Es gab in jener Gesellschaft noch ein anderes Mittel, um das Bewußtsein aufzumuntern: das Operieren mit Ahnentafeln. Da man staatsbürgerlich so wenig ausmachte, wollte man wenigstens genealogisch etwas bedeuten. Freilich waren beglaubigte Urkunden nur selten vorhanden, und wo sie existierten, hätten sie auf Staat und Behörden keinen Eindruck gemacht. Allein die Überlieferung wurde aufrecht erhalten, und die Stammeslinie gab Auskunft über den Grad des Adels, auf Ebräisch: »Jichuss«, dem man zugehörte. Die Rückleitung erstreckte sich in der Regel auf Gelehrte, Rabbis und Wundertäter, die in den Annalen des Volkes eine Rolle spielen. Eine seltsame Heraldik, in der keine Burggrafen und Kreuzzugsritter, sondern wesentlich synagogale Größen vom Klange der Akiba-Eger, Eybenschütz und Luria auftraten. Man bezog sich in diesem Zusammenhange oftmals auf philosophische Autoritäten, aber der Name Spinoza wurde niemals genannt. Der galt wohl als ein Abtrünniger, und man hätte lieber vom erbärmlichsten Hausierer abgestammt, als vom Träger eines Tempelfluches. Dagegen wollten einige in ihrer Ahnentafel bis auf Maimonides zurückgreifen, den »Rambam« von Cordoba, rein auf Treu und Glauben, ohne daß sie imstande gewesen wären, für ihre weitschweifende Genealogie den leisesten Anhalt zu liefern. Mein Vater vollends verfuhr beinahe mythologisch, indem er mir erzählte, wir speziell stammten »Aus des Königs Garten«; womit die Familienlegende wahrscheinlich einen Zusammenhang mit davidischer oder salomonischer Herrlichkeit konstruieren wollte. Ich bekenne, daß diese abenteuerliche Heroldskunde mich nicht recht überzeugte. Ich wußte aus Märchenbüchern wie es in und bei Palästen hergeht, ich hatte sogar schon die Schlösser Fürstenstein und Sibyllenort gesehen, und da ergab der Vergleich mit unserer Wirtschaft doch gar zu wenig Ähnlichkeiten. Von den Fenstern der Wohnstube fiel der Blick auf keinen Königsgarten, sondern auf den städtischen Marstall, ein übel duftendes Gehöft, worin den ganzen Tag mittels zweirädriger Pferdekarren Mist und Müll abgeladen wurde. Eher stimmte die Parallele in dem großen Vorderzimmer, das sich Salon nannte und mit Parkettfußboden, Pfeilerspiegel und einem prismenbehängten Kronleuchter allerdings für meine Vorstellung fürstliche Kennzeichen aufzeigte. Wie wir solchen Luxus erschwangen? Nun, es steckte nicht viel dahinter, mein Vater mußte sich sauer genug durchschlagen, mit Schmalhans-Koch als gelegentlichem Begleiter, er fand aber hin und wieder irgendwelche Geschäftsvermittelungen, deren Erträgnisse durchschnittlich für einen leidlichen, zu Zeiten ganz behaglichen Hausstand ausreichten; so daß auch noch für die Bewirtung der zahlreichen Verwandtenbesuche allerlei schmackhafte Brosamen abfielen.
Vom Standpunkt heutiger Finanzarithmetik ist das alles schlechterdings unbegreiflich. Unsere Fünfzimmerwohnung in bester Stadtlage beanspruchte eine Miete von 150 Talern, wir hatten sie dreizehn Jahr inne, ohne daß es dem Hauspascha einfiel, die Steigerungsschraube anzusetzen. Der Küchenindex ergibt sich am einfachsten aus dem Preis der Suppentauben, von denen das Stück unveränderlich einen Silbergroschen kostete, mit der Maßgabe, daß auf je 15 Tauben eine umsonst zugeliefert wurde. Die massivste Stopfgans überschritt niemals das Niveau eines Talers, und dementsprechend hielten sich alle anderen Tarife. In den trefflichen Konditoreien Engadiner Herkunft –, da steigen Namen auf wie aus einem Märchen: Perini, Manatschall! – kostete die schlaraffische Portion Schlagsahne, für mehrere Leckermäuler zugemessen, einen Groschen. Nahe beim Pennal lockte ein Tischleindeckdich, »Käseböhm« benamst, wo man für einen Sechser ein üppiges Frühstück strotzend von Butter und Emmenthaler bekam. Selbst der kupferne »Dreier« bewährte ansehnliche Kaufkraft, dafür gab es bei ambulanten Händlern eine Ladung Kinderkonfekt, in bunter Umhüllung. Lockerte man im Portemonnaie drei Groschen, so konnte man sich den lebemännischen Exzeß einer Droschken-Spazierfahrt leisten bis an Punkte der Umgebung, wo das blauromantische Gebirge herübergrüßte. Einmal nahmen wir Sommeraufenthalt im Badeort Salzbrunn, die Familie mit einem Dienstmädchen, und die gesamte Reise für fünf Köpfe sollte nicht mehr kosten als der Stadtaufenthalt für die gleiche Zeitdauer. Diesen Barbestand, eine Bagatelle, die heute noch nicht für einen Löffel Suppe genügt, steckte Vater sich ein, als Deckung für die ganze Expedition, allein es erwies sich als unmöglich, ihn aufzubrauchen. Am Schluß der Badereise stellte sich noch ein Überschuß heraus, der hinreichte, um für unsere Wohnung eine neue Einrichtung von Fenstergardinen und Wolkenvorhängen (»Rouleaux«) anzuschaffen. Wenn wir heute in Albrecht Dürers Tagebüchern die Zehrungskosten nach lumpigen Weißpfennigen notiert finden, so meinen wir wohl: Urzeiten! Fünfzehntes Jahrhundert, ganz inkommensurabel mit der Gegenwart! Aber ich erzähle hier von Zuständen, die ich selbst noch als Kind und Knabe erlebte und die sich dennoch in den Wertmaßen von den Dürer'schen nicht sehr erheblich unterscheiden. Altwerden heißt, ein Altertum erlebt haben, und die Kommentare hierzu lauten im gegenseitigen Widerspruch: »meminisse juvabit«, und »wie wir's dann zuletzt so herrlich weit gebracht!«
*
Da tut sich noch ein Kontrast auf, schwer überbrückbar, meiner Erklärung unzugänglich, aber dem Gedächtnis fest einverleibt. Ich sehe mich als Strolch, als händelsüchtigen Wegelagerer auf den Straßen, in unaufhörlichen Konflikten mit Sitte und Ordnung. Magnetisch zog es mich nach Punkten, in denen Keilereien stattfanden, im dicksten Trubel balgender Gassenjungen war ich zu finden, aktiv und häufiger noch passiv; denn ich brachte gewöhnlich Kratzwunden, Schrammen, Beulen und zerrissenen Anzug nach Hause, zum größten Verdruß meines Vaters, der mir den Teufel durch Beelzebub austreiben wollte, also die Händelsucht durch häusliche Prügel. Ich hatte auch streckenweise in der Schule üble Flecken auf der Konduitenliste, wenngleich hier bei den Lehrern die günstige Meinung überwog und mir oft wochenlang in der Rubrik »Betragen – Fleiß – Aufmerksamkeit« – die Stellung eines Musterschülers einräumen wollte. Aber zwischendurch leistete ich Extempores, die mir die gute Zensur wieder verdarben. Mitten im Silentium der Klasse verursachte ich explosive Ereignisse, mit sogenannten »Knallbriefen«, die zwar nur einen papiernen Bestand aufwiesen, aber mit Detonationen knallten wie Pistolen. Ich sehe ihn noch vor mir, den braven Zeichenlehrer Breuer, einen hinfälligen Greis, wie er am Katheder bei solcher Explosion erschreckt das Gleichgewicht verlor und umfiel. Zu diesen Bubenstreichen, die sich in einem Bilderbogen von Busch nicht übel ausgenommen hätten, gesellten sich späterhin noch andere Verstöße, in denen die Magister eine geistige Perversität witterten. Zu zweien hatten wir uns verschworen, ich und ein anderer Pennäler, dem weiterhin eine große Berühmtheit vorbehalten war: der Mitverbrecher war Kurd Laßwitz, der nach Jahrzehnten als Professor in Gotha eine Zierde der Gelehrtenwelt wurde und die Literatur durch vorzügliche Schriftwerke, wie »Auf zwei Planeten« bereichert hat. Wir grünen Jungen von Oberquarta verfaßten in Kompagniearbeit Schmähgedichte auf die Gymnasialprofessoren, Poeme von eindringlichster Unverschämtheit, die zur Kenntnis der angepöbelten Präzeptoren gelangten und sonach die beiden Pasquillanten in ein Strafverfahren verwickelten. Laßwitz, als der ältere und erfahrenere, verordnete mir zunächst prophylaktische Maßregeln zum Schutze für den meist gefährdeten Körperteil: Einreibung mit Knoblauch und eine dicke Papiereinlage zwischen Hosenboden und Gesäß. Allein, wir wurden nicht karbatscht, kamen vielmehr mit Karzer davon, vermutlich, weil man in unseren satirischen Strophen strafmildernde Spuren literarischer Begabung angetroffen hatte. Meine Missetaten standen übrigens noch lange nicht auf der Höhe der großen Kriminalfälle, in denen damals die eigentlichen Gymnasial-Rüpel exzellierten. Diese drangen mit ihren Freveln bis in die Polizeinotizen der Zeitungen, denn es handelte sich um Verführung und Entführung schulpflichtiger Mädchen, um Einbrüche in die Schularchive, ja, um handgreifliche Exerzitien gegen die Lehrer, verübt von robusten Lümmeln, die es bei Konflikten mit den Vorgesetzten auf persönliche, in Puffen und Boxen betätigte Eigenwehr ankommen ließen. Im Gesichtskreis des heutigen akademischen Geschlechts finden derlei Tollheiten gar keine Stätte, während sie damals, nicht nur in Breslau, so zur Lateinschule gehörten, wie die Exzesse des Burschentums zur Universität. Mancher Rowdy hat später den Weg zum bescheidenen Philisterium gefunden. Vor Jahren besuchte mich ein Kumpan von Anno Olim, der auf unserem Pennal einen Lehrer mit Rippenstößen in die Flucht gejagt hatte und dafür mit Verbannung von allen preußischen Schulen bestraft worden war. Er hatte sich indes irgendwelche Amnestie verschafft und konnte sich mir bei unserem Wiedersehn als königlich preußischen Regierungsrat, beamtet in Stettin, vorstellen. Offen gesagt, mir erschien er in seiner nachträglichen Würde lange nicht so imposant, wie einst in seiner raufboldigen Draufgängerei, gegen die mein bißchen Flegeltum wie das Betragen eines Unschuldsengels abstach. Die Gefahr des Geschaßtwerdens hatte mich niemals bedroht, und nach Verbüßung jener Karzerhaft leuchtete mir wieder die Gnade der Oberlehrer und des Rektors. Dreimal empfing ich bei der Versetzung zur höheren Klasse die Schulprämie in Form deutscher und griechischer Klassiker, und eine gewisse Rührung überkommt mich noch heute beim Betrachten des Aufdrucks:
»PRAEMIUM PRO STUDIO ET VIRTUTE DATUM IN GYMNASIO ELISABETANO.«
Mir ist also die »Virtus« trotz mancher Verfehlung amtlich bescheinigt. Ob am Ende Schopenhauer mit seiner Lehre von der Unveränderlichkeit des Charakters doch Recht hat? Mir selbst sind in dieser Hinsicht bisweilen Zweifel angeflogen, nicht sowohl wenn ich mir die Rauflust meiner jungen Jahre vorhalte, als in Erinnerung an gewisse Charakterzüge, die in keiner Weise beschönigt werden können. Mir war die Schadenfreude nicht fremd, und ich verstieß damit gegen den Korpsgeist, für den schon Kinder bei leidlich anständiger Gemütsverfassung ein feines Verständnis besitzen. Nach der Schulordnung saßen die besten Schüler der Klasse an der Spitze der Bank, über die sie eine Art Aufsicht ausübten, und ich mißbrauchte dieses Amt in vielen Fällen, um meine kleinen Genossen beim Klassenhäuptling anzuzeigen und zu verpetzen. Ich bewirkte dadurch Strafen wegen unerheblicher Versündigungen, die ohne meine Meldung im Dunkel verblieben wären, und ich verspürte ein Behagen, wenn mir die Vermittelung an die Strafinstanz gelang. Damit begnügte sich meine kindische Bosheit noch nicht: Sobald Arrest verhängt wurde, gab es Strafzettel, die den Eltern des Verknaxten zur Kenntnisnahme und Unterschrift vorgelegt werden mußten. Und da drängte ich mich jedesmal zum Botendienst, verlief schweißtriefend ganze Stunden bis in entlegene Vororte, versäumte darüber die häusliche Mahlzeit, bloß um den Effekt der Hiobsbotschaft bei den Angehörigen des verpönten Schülers zu erleben. In meiner Seele schwangen also Infamien, von denen ich, wie ich ebenso aufrichtig versichere, auch nicht das allergeringste in meine Jünglingszeit hinübergenommen habe. Nehme ich mich selbst als Paradigma mit meinen verjährten Abscheulichkeiten, so bin ich außerstande, in mir eine Konstanz des Charakters nachzuweisen. Nur innerhalb begrenzter Zeitphasen gewinnt er den Anschein einer Beständigkeit, nicht darüber hinaus. Wie die Substanz des Körpers sich von sieben zu sieben Jahren radikal erneuert, so erfährt auch die Seele Umwandlungen und Variationen in allen erdenklichen Graden. Ich sprach von meinem Hang zur Schadenfreude, aber vielleicht liegt hier schon ein Betrachtungsfehler zugrunde. Denn wäre dieser Zug immer wesentlich und primär gewesen, so hätte er sich auch anders geäußert, als nur in den sadistischen Vergnügungen des Denunzianten und Zettelträgers; etwa in meinem Verhalten zur Tierwelt, der gegenüber ich gar nichts anderes kannte als Zärtlichkeit. Die bravsten Jungen meiner Umgebung waren Tierquäler, wie denn dieser Trieb in weitesten Kinderkreisen grassiert; und ich erwähne, daß der sanfte und in Seelenanalyse sehr bewanderte Gottfried Keller sämtliche Kinder darunter begreift, ohne sich selbst auszunehmen, wie er im »Grünen Heinrich« mit Aufzählung seiner eigenen Schandtaten bekundet. An mir wie auch an meinem Bruder hätte er das gegenteilige Exempel erfahren können, bis zu allen Stärkegraden der Absonderlichkeit. Es gab für uns keine untere Grenze, unsere Fürsorge erstreckte sich auf alles Erreichbare bis zu den lästigen Kreaturen. Wir befreiten gefangene Mäuse aus der Falle, wir lösten Fliegen vom Klebstoff der Fliegenstöcke, wuschen ihnen mit kleinen Schwämmen die Füßchen und Flügelchen blank und brachten sie durchs Fenster außer Verfolgung; ja als wir zum erstenmal unterm Vergrößerungsglas Infusorien erblickten, fügten wir mit Eifer frische Wassertropfen zum Aufguß, damit die winzigen Lebewesen nicht durch Verdunstung zugrunde gingen. Jene Schadenfreude den Mitschülern gegenüber mag also ein kompensatorischer Ausweg gewesen sein, den die Natur verordnete, um der sonst niedergehaltenen Kinderbrutalität irgendein Ventil zu öffnen. Hält man dies auch nur für möglich, so verliert die Frage nach der Konstanz des Charakters jegliche Substanz. Alles relativiert sich, und die Taxe nach Gut und Böse der Veranlagung findet in keinem brauchbaren Maßstab einen Halt.
*
In der Fibel meiner Kindheit befinden sich auch erotische Bilder, und ich glaube, daß sie sich bei genügend starker Erinnerung zu Romanen ergänzen könnten. Die Einschränkung gilt ganz allgemein, denn das Altersgedächtnis, das die nichtigsten Zufälle oft mit erstaunlicher Beharrlichkeit festhält, bewahrt die femininen Einschläge nur in dürftigsten Resten. Was wir in gedruckten Bekenntnissen von Kinderliebschaften lesen, ist sicherlich ganz überwiegend Arbeit einer Phantasie, der die erlebte Wirklichkeit nur ganz lose Stützpunkte bietet. Gleichwohl bin ich überzeugt, daß die Erotik auch im Triebleben des Knaben eine mächtige Rolle spielt und zu seinen anderen Neigungen und Begehrungen in derselben Proportion steht, wie beim Manne; man muß dabei nur den selbstverständlichen Korrekturfaktor einsetzen, der das Unklare, Dämmerhafte aller Jugendtriebe in Rechnung setzt gegen die weit bestimmteren und an tausend Vorbildern orientierten Erregungen des Erwachsenen. Richtige, leidlich glaubhafte Kinderromane könnten sonach nur von Kindern geschrieben werden, und nur von solchen, die über Gestaltungstechnik verfügen, was eine unmögliche Voraussetzung ist. Sowie auch der Literat mit unhaltbaren Voraussetzungen arbeitet, insofern er kindliche Ereignisse beschreibt, deren seelisches Wesen von einem Altersgehirn gar nicht begriffen werden kann. Er wirtschaftet mit Erinnerungen in zweiter und dritter Potenz. Denn es gibt potenzierte Gedächtnisakte, bei denen der gesteigerte Exponent nichts anderes ausdrückt, als die wachsende Verdünnung. Es verhält sich damit wie bei Berichten über geträumte Erlebnisse, die nur dem Träumenden verständlich sind. Schon in der Minute des Erwachens verblassen die Bilder, und schreitet man zu einem Bericht, so liefert man Erinnerungen an Erinnerungen in einer Sprache, welche die Ausdrucksform jener Bilder nie erreichen kann.
Wir behelfen uns also mit Andeutungen und dazu mit der Feststellung, daß die seelische Pubertät weit früher und intensiver einsetzt, als die physiologische. Jedenfalls waren mir die Anwandlungen des Cherubim – »wenn ich nur ein Mädchen sehe ...« schon zu einer Zeit geläufig, da ich vom körperlichen Unterschied der Geschlechter keine Ahnung hatte. Ich war dauernd verliebt, dauernd in der Stimmung eines Märchenprinzen, der sich von irgendeiner Weiblichkeit etwas Köstliches verheißt, und ich spezialisierte mich dabei keineswegs auf die Einzahl, verstand das Wesen dieser beglückenden Angelegenheit vielmehr in dauerndem Plural. In den Milchgärten an der Promenade gab es vielfache Gelegenheit zu persönlicher Näherung in Kinderspielen, und es ist mir so, als wäre mir das Spiel selbst, die Betätigung des Körperlichen ziemlich gleichgültig gewesen – denn die Katzbalgereien mit den Gassenjungen standen mir doch höher – die Freude an der Gegenwart der Mädchen dagegen die Hauptsache. Ich sage »Freude«, aber mit dem Unterton des Zweifels, denn in meinen vorzeitigen Ansätzen zum Flirt schwebten Bedrängungen und Gleichgewichtsstörungen, die sich besonders bemerkbar machten, wenn ich flatternde Röckchen erblickte. Von den Physiognomien der Huldinnen ist mir nichts verblieben, aber einzelne Namen und Gewänder haben sich im Gedächtnis erhalten, und die Julie vom Blücherplatz bleibt für mich mit einem blauen Kleid, die Jenny vom Ring mit einem roten Kleid verknüpft. Im Verkehr mit einer kleinen Polin traten lyrische Betonungen auf. Petka, eigentlich Petronella, war eine Warschauer Verwandte, sie wohnte etliche Wochen bei uns und zeigte Anlagen zur Koketterie. In ihrem Kindergemüt lebte die Vorstellung davon, daß in mir etwas vorging, und sie steigerte dieses Etwas instinktmäßig durch Annahme plastischer Stellungen auf dem Sopha. Ich glaube, daß meine ersten Kußerfahrungen damit zusammenhingen, falls nicht etwa Bianca oder Regina als Kußfreundinnen die zeitliche Priorität zu beanspruchen hätten. Jedenfalls war Petka die Schönste von allen, und nicht bloß in meiner Einbildung, denn wenn ich mit ihr auf der Straße spazierte, bemerkte ich prüfende und bestätigende Blicke der Passanten, neidisches Kopfdrehen gleichaltriger Knaben, und ich fühlte mich in blähendem Stolze als der Bevorzugte. Meine Empfindungen ergossen sich aufs Papier in blöden Reimereien, die auf der poetischen Leiter etwa so hoch standen, wie die Stammelverse, mit denen die Da-da-Dichter des zwanzigsten Jahrhunderts die Poesie besudeln. Rhythmisch wie grammatisch waren sie sogar um ein Grad erträglicher, und mein Auftakt »O du Petka, Himmelsstern, o wie hab' ich dich so gern« vertrug wenigstens die Ehrlichkeitsprobe.
Wie stand es nun mit dem Sinnlich-Sexuellen? Sollten sich mir am Ende schon damals Zweige mit verbotenen Früchten entgegengestreckt haben? Ich werde nicht umhin können, einzugestehen, daß ich ein Abenteuer erlebte, das nach der Tiefe der Gedächtnisspur zu schließen, in die Unschulds-Naivität eines siebenjährigen Knirpses sehr schlecht hineinpaßt. Wir waren auf Sommerfrische in dem Vorort Scheitnig, und beherbergten als Logisgast eine eben erblühte Jungfrau aus den Ostmarken. Eines Frühmorgens huschte ich im Hemdchen durch ihr Schlafzimmer und folgte der Lockung ausgebreiteter Arme ins warme Bett. Weit davon entfernt blieb ich, wissend zu werden, aber mich befiel doch eine bebende Ahnung von ungeheuren Dingen jenseits meines Gefühlshorizontes. Eine tastende Neugier stieg in mir auf, die sich zaghaft und schämig, aber doch verlangend an schwellende Formungen heranwagte. Später hat sich das Erlebnis in seiner eigentlichen Substanz wieder verflüchtigt, und in meinem weiteren Verkehr mit jugendlichen Freundinnen trat niemals das Begehren auf, die Süßigkeit des Scheitniger Zufalls auch nur in Gedanken zu wiederholen. Der früh geweckte Trieb entschlummerte wieder, und das Beispiel libidinöser Kameraden zog mich nicht in seinen Bann. Ich hörte davon reden, staunte vor tollkühnen Exzessen, fand aber weder Anlaß noch Drang zu cytherischen Experimenten, bei denen mir die Gefahr unendlich größer erschien, als die jemals zu erhoffende Lust. Ich hatte auch nicht viel von Bedrängungen durch schlüpfrige Lektüre auszustehen, geriet indes leicht in sinnlichen Taumel, wenn mir das Aphrodisische in höherer Kunstform begegnete, namentlich, als sich mir – immer noch Jahre vor der wirklichen Pubertät – die Homerischen Gesänge offenbarten. Da meldeten sich Nachwehen des ersten Ansturms, und wenn ich mir eine Venus, eine Kalypso vorstellte, dann glitt meine Einbildungskraft zu den Rundungen der ostmärkischen Jungfrau, in denen ich ein einziges Mal das körperliche Wesen des Weibes verspürt hatte.
*
Innerhalb der häuslichen Pfähle waren erotische Themen nicht beliebt, sie wurden nur selten angeschnitten, und über ihrer Abfertigung lag der Obskurantismus. Man verstand unter Liebe das herzliche Verhältnis der Familienmitglieder unter einander, betrachtete sie aber in ihrer Beziehung zwischen den Geschlechtern wesentlich als eine Unanständigkeit, der eine breite Erörterung nicht gewidmet werden durfte. Die sexuelle Aufklärung gedieh nur unerheblich über die Storchlegende hinaus. Etwas liberaler gestaltete sich die Auffassung, wenn wir gemeinsam bei traulicher Abendlampe in guten Büchern lasen, wobei wir ja auch an Dichter gerieten, an lyrische Verse und Liebesszenen in Schauspielen. Allein da zog man doch einen Trennungsstrich, und nahm diese Dinge als unvermeidliches dichterisches Reservat, das in gewöhnliche Sphären nicht überzugreifen hatte. Wenn einer ein Tempelherr war oder ein Präsidentensohn Ferdinand, dann durfte er lieben, aber das schickte sich nicht für bürgerliche Kreise. Übrigens blieb im Lessing der Nathan mit seinen drei Ringen die Hauptsache, im Kabalestück die vergiftete Limonade und im Glockenlied verschwand der ersten Liebe goldne Zeit gänzlich hinter der aufregenden Geschichte von der Feuersbrunst. Mit der eigentlichen Lyrik wußten wir überhaupt nicht viel anzufangen, und unsere Versuche, uns mit Heines Buch der Lieder anzufreunden, verliefen im Sande.
Nichtsdestoweniger geschah etwas bei uns, das den Gepflogenheiten der dürren Lebensprosa widersprach. Wie denn überhaupt viel Unmotiviertes, Abruptes die Lebensführung der Familie durchkreuzte. In dem puritanischen Brevier klafft ein absonderlicher Riß: man brachte mich in Fühlung mit der leichtgeschürzten Muse – – man führte mir eine Ballettänzerin zu!
Der Grundgedanke war gar nicht so abwegig. Ich sollte auf dem Wege des Tanzunterrichts meine ungelenken Bewegungen überwinden und mir eine manierliche Gangart angewöhnen. Aber man verfuhr radikal und grotesk, indem man für mich allein die Prima Ballerina des Stadttheaters engagierte. Solus cum sola. Sie nahm mich in unserem parkettierten »Salon« in technische Fürsorge, als hätte es sich darum gehandelt, den Bengel zu einem Virtuosen im Pirouettieren auszubilden. Starke sinnliche Erregungen waren die keineswegs beabsichtigten aber unvermeidlichen Begleiterscheinungen dieser Methode.
Man sprach in Breslau von Fräulein Behnisch, wie ehedem in den Großstädten von der Camargo und Barberina. Ich hatte sie schon vorher auf der Bühne gesehen mit dem ganzen Überschwang meiner frühen Entzündlichkeit, und nun erschien diese Göttin im Zimmer, lüpfte ihr Kleid expreß für mich und nahm mit leibhaftiger Berührung mich in die Lehre.
Ich kann die Zeit ziemlich genau bestimmen, sozusagen astronomisch; denn man sah damals den ungeheuren, feuerglänzenden Donatischen Kometen, und meine Phantasie wob Fäden zwischen dem himmlischen und dem irdischen Wunder. Ich hörte vom bevorstehenden Weltuntergang reden, und mich beschäftigte die Frage, wie das wohl wäre, wenn wir grade beim Tanzen in den Weltenbrand verwickelt würden. Es lag ein Omen darin, bedeutungsvoll für den einen Bestandteil unseres Duetts. Denn bald darauf kam die bezaubernde Behnisch in einer Theatervorstellung der Gasbeleuchtung der Rampe zu nahe und sie verbrannte auf offener Bühne. Diese Katastrophe war die erste ungeheure Erschütterung meines Daseins.
Der Donatische Komet, der lange Zeit als schauriges Fanal drohte, weist auf das Jahresdatum 1858. Ich befand mich also im achten Lebensjahr und muß schon vorher mit theatralischen Dingen Bekanntschaft gemacht haben. Zu diesen zählten Robert der Teufel, Aubers Ehernes Pferd, Nestroys Lumpazi Vagabundus und skandalöser Weise Offenbachs Orpheus in der Unterwelt. Schillers Postulat von der Schaubühne als moralischer Anstalt wurde grimmig verletzt, da man mir die antike Sage nicht in der Erhabenheit des Originals, sondern zu allererst in lächerlicher Travestie zeigte. Wenn ich die Karikatur ohne geistigen Schaden überwand und nach wenigen Jahren ohne störenden Rückblick, ja mit elementarer Inbrunst mich in den hellenischen Götter- und Heldenmythus versenkte, so danke ich dies wohl dem Umstand, daß ich als Bub von den dargestellten Vorgängen nur die alleräußersten Umrisse wahrnahm, von der Fabel selbst aber nicht das geringste verstand, geschweige behielt. Auch die musikalischen Eindrücke vom Theater blieben in mir ohne Nachhall. Als ich weit später mit gereifterer Empfangsfähigkeit die Meyerbeersche Oper wiederhörte, war mir alles neu und gänzlich fremd, bis auf das Kirchhofsballett, aus dem noch etliche Klänge im Gehör nachspukten.
Desto nachdrücklicher umfing mich schon in frühester Zeit die Hausmusik. Meine Mutter besaß ein bescheidenes Talent, dessen Pflege einem sehr bedeutenden Musiker anvertraut war. Das war der erste Organist der Breslauer Bernhardinerkirche Adolf Friedrich Hesse, ein Meister ersten Ranges, der in London und Paris Triumphe gefeiert hatte und dort als der Sebastian Bach des neunzehnten Jahrhunderts ausgerufen worden war. In der ganzen Stadt sprach man davon, daß dieser Träger internationalen Ruhmes allwöchentlich mehrmals im Hause des Kießlingschen Bierausschanks zwei Treppen hoch emporkletterte, um der Frau eines Kleinbürgers Klavierstunde zu geben. Man kannte Hesse zudem als einen korpulenten Asthmatiker, berechnete die weiten Wegstrecken und gelangte schon dieserhalb zu immensen Honorarziffern, die indes noch hinter der Wirklichkeit zurückblieben; denn der Gewaltige liquidierte und empfing für jede Lektion die exorbitante Summe von 20 Silbergroschen, gleich zweidrittel Talern.
Meine Mutter gedieh unter seiner Leitung bis zum Vortrag klassischer und romantischer Stücke. Ich hatte schon damals die Vorstellung, daß dies keine Vollendung wäre, denn ich bemerkte die ungelösten Schwierigkeiten, allein das schmälerte nicht mein Entzücken, das sich durchaus aus den Tongebilden selbst herleitete, zumal aus dem Weberschen Konzertstück, Mendelssohns Rondo, und einigen Beethovenschen Sonaten. Die Pathétique, hundertmal geübt, ließ immer wieder eine Bezauberung auf mich strömen, ebenso auf meinen Bruder, und unsere höchste Wonne war es, wenn wir dabei auf dem Fußboden unterm Klavier liegen durften, vor Seligkeit mit den Extremitäten strampelnd. Der Kreis der Kompositionen war aufs äußerste beschränkt, Mozart war spärlich vertreten, Chopin nur mit etlichen Walzern und Nocturnos, Schumann fehlte gänzlich, aus der Opernliteratur gab es ganz vereinzelt einige leichte Arrangements nach Rossini, Donizetti und Meyerbeer. Seltsamerweise kam Bach mit keiner Note aufs Programm, trotz der Spielleitung Hesse's, der doch in Sebastians Spuren wandelte. Rückwärts blickend taxiere ich, daß er der Spielerin nicht die geeignete Kapazität für eine Musik zutraute, die ihm persönlich sakrosankt war.
Manchmal, in frohlauniger Stunde, setzten wir uns zusammen an den Flügel, der Vater und die Söhne, und droschen in Willkür darauf los, wohin es gerade treffen wollte. Wir nannten das »Symphonie machen«, und dies blödsinnige Getöse mochte auch wirklich den Anschauungen entsprechen, die wir zusammen vom symphonischen Wesen hegten; denn unsere Erfahrungen auf diesem Gebiet waren gleich Null. Von Richard Wagner war nur der Name bekannt und das Attribut »Zukunftsmusiker«, was so viel bedeutete als Verderber. Der bloße Wunsch, etwas aus Tannhäuser oder Lohengrin kennenzulernen, fiel schon ins Bereich der komischen Perversionen.
Unser Horizont erweiterte sich merklich, als wir in einige wirkliche Konzerte mit ernstem Orchester und mit Solisten gerieten, die im Saale der Bürgerressource stattfanden. In diesen Veranstaltungen ereignete sich Außerordentliches. Ein wilder Tastenvirtuos schlesischer Herkunft – er hieß Göldner – schleuderte sich aufs Podium und überfiel uns mit Hexenmeistereien auf der Tastatur. Höher im Range stand der heute fast vergessene, seinerzeit viel bewunderte Franz Bendel, bei dessen Produktionen uns zum erstenmal ein Licht darüber aufging, welche Möglichkeiten überhaupt im Klavier steckten. Und da trat auch der Junglöwe Carl Tausig auf, mit den Konzerten von Beethoven in G und Es, an die zwar unser Verständnis nicht hinanreichte, die uns aber doch einen Schimmer aus übergeordneten Tonwelten zuführten.
Der berühmte Leopold Damrosch führte den Taktstab, und wir gewannen durch ihn eine verschwommene Ahnung von symphonischer Klassizität. Diese wurden indes übertäubt durch die orchestralen Abenteuer, die Damrosch als Ultra-Fortschrittler in den Vordergrund stellte. Er brachte die Futurismen von Liszt und Berlioz, und als er einmal eine Festmusik von Hans von Bronsart auf uns losließ, da galt es uns als ausgemacht, daß dieses Tongelände wesentlich vom Teufel beherrscht werde. Wir wurden darin bestärkt durch unser Hausorakel der schlesischen Presse, dessen Hauptvertreter Max Kurnik im Geruch der Unfehlbarkeit stand. Und da lasen wir es schwarz auf weiß, daß solch eine Festmusik nur bei menschenschlächterischen Lustbarkeiten der Kannibalen am Platze wäre. Jetzt standen wir völlig gerechtfertigt da mit unserem vielhändigen Gepauke, das wir in drastischer Verallgemeinerung »Symphonie machen« benamst hatten.
Erst als im Jahre 1865 unser Wohnsitz nach Dresden verlegt wurde, gerieten wir Buben in eine reinere musikalische Atmosphäre. Dort gab es symphonische Gartenkonzerte, die wir als Zaungäste erlauschten. In der begrenzenden Strauchhecke fanden wir ein Verließ, worin wir uns verkrochen, wenn der Stadtmusikus Puffhold mit seiner dürftigen Kapelle – vier Geigen, ein Kontrabaß! – seine Herrlichkeiten anstimmte. Himmel, welche Offenbarungen wurden uns da in dem umgrünten Strauchloch! Und wie wirkten sie auf uns trotz der akustischen Verdünnung, denn wir hockten weitab vom Orchester, in dessen Nähe man nur gelangte, wenn man den stattlichen Obolus von 30 Pfennigen fürs Entreegeld aufbrachte. Das war ein Crescendo im Genuß, wenn man erst in mehrfacher Wiederholung Beethovens Fünfte hörte und die Pastorale, und Mozart's G-moll-Symphonie. Hier goß sich der heilige Geist auf uns aus, und den beiden Klang-Nassauern war es, als müßten sie vergehen in Andacht und Glückseligkeit.
*
Weit vorher, noch in Schlesien, hatte ich auch eine andere Sorte geistiger Anregungen erspäht, abseits der Kunst. Auf der Kindheitsfibel erscheinen allerlei Reflexe aus den Bezirken von Lionardo, Franklin, Congreve und Montgolfier. Zuerst wollte ich Feuerwerk machen mit Flammenrädern, die nicht rotierten, und angepappten Patronen, die nicht losgingen; wogegen mir ein Heißluftballon, eben aus Florpapier mühsam fertig geklebt, sofort wegbrannte, als er sich vielversprechend zur Kugelfigur blähte. Demnächst baute ich einen hübschen Papierdrachen, der ein bißchen Gewitter herunterholen sollte, was er aber unterließ, da er mir beim ersten Aufstiegversuch von einem handfesten Gassenlümmel geräubert wurde. Gefährlicher wurde ein Beginnen im Bade Salzbrunn, wo ich mich mit einem kräftigen Regenschirm in die Dachräume schlich, um etwas Aeronautisches zu erproben. Ich hatte mir nämlich eingebildet, dieses Werkzeug müßte in aufgespanntem Zustand das Amt eines Fallschirms übernehmen, und ich könnte damit vom Fenster des Dachbodens heil auf die Straße springen. Es hing an der einen, der nächsten Sekunde, daß ich den Saltomortale ausführte, wonach sich alles Weitere in diesem Leben erübrigt hätte. Allein ein Hausbewohner hatte Unheil gewittert, war mir nachgestiegen und riß mich im letzten Moment von der Fensterluke ins Sichere.
Meine Erkenntnisgier betätigte sich bald an weiteren Experimenten, die sich auf dem Grenzgebiet von Physik, Chemie und grobem Unfug bewegten. Ich hatte als Lausbub von Untertertia in naturkundlichen Kalenderschriften geschnüffelt, und im Zusammenhange damit brachte mir der Weihnachtsmann einen Experimentierkasten für Kinder mit allerhand gläsernem und metallenem Gerät. Da kam der Geist Lavoisiers über mich, und ich beschloß, reinen Sauerstoff zu erzeugen. Mit Überwindung einiger pekuniärer Widerstände väterlicherseits gelangte ich in den Besitz von etwas Braunstein, Natrium, Kalium, und nun konnte der Zauber losgehen.
Beim ersten Versuch schien die Sache zu glücken; es bildete sich wirklich in einem Probierglase ein gasartiges Etwas, das bei Berührung mit erhitztem Draht feuerwerkend reagierte, und ich empfand aufjauchzend alle Wonnen eines Adepten. Aber noch in derselben Stunde, als ich mit dem mirakulösem Kalium zu wirtschaften anfing, stürzte ich aus dem Feenhimmel der Wissenschaft in einen Schandpfuhl, wie ihn nur Wilhelm Busch auf seinen verwegensten Bilderbogen dargestellt hat. Also eine Explosion, die ja in chemischem Betracht ihren Wert behielt, insofern sie die Wirkungen des Knallgases verdeutlichte, allein als häusliches Erlebnis merkliche Schattenseiten aufwies. Ich wurde splitterübersät zu Boden geschleudert, hatte das ganze Gesicht voller scheußlicher Substanzen und dachte nicht mehr an Sauerstoff, sondern an Weltuntergang. Nachdem der ärgste Schaden beseitigt war, vervollständigte eine Tracht Prügel die Lektion, und damit fanden meine häuslichen Experimente ihr vorläufiges Ende.
Das Folgekapitel meiner experimentellen Erfahrungen fällt schon in die Hochregion der Sekunda und betrifft einen Mann, den Gott in seiner Gnade zum Professor und in seinem Zorn zum Experimentator gemacht hatte. Das war Magister Kambly, der uns Jünglinge in die wirklichen Geheimnisse der Physik einführen wollte mit Hilfe von Experimenten, von denen nach meiner Erinnerung auch nicht ein einziges glückte. Er brachte es nicht einmal, wie ich vordem, zu einer interessanten Explosion, es kam überhaupt nichts zustande; die Apparate blieben zu dauerndem Generalstreik verschworen, und Kambly's bloße Nähe genügte, um sie allesamt unbrauchbar zu machen. Wir sahen Elektrisiermaschinen ohne Elektrizität, Magnete ohne Magnetismus und eine Luftpumpe, bei der schon der Gedanke an ausgepumpte Luft lächerlich gewesen wäre. Selbst die gefügigen Kapillarröhrchen bockten und weigerten sich, die niedlichen Phänomene der aufsteigenden Flüssigkeit zu zeigen. Man dürfte eine Trillion gegen eins wetten, daß bei dieser Einfachheit niemals ein Versagen auftreten kann: hier hätte man die Wette verloren. Der Magister erklärte, er würde oben mit dem Munde ein bißchen nachhelfen, er begann zu saugen, zerbrach dabei das Röhrchen, und damit war das Thema der Kapillarität experimentell erledigt.
Man hatte mir später in Dresden eine kräftige Lupe geschenkt, mit der ich mir feine Federsträhnen vergrößern wollte, was bekanntlich einen reizenden Anblick gewährt. Am Schloßteich im Großen Garten fand ich die gesuchten Objekte in ausgiebigster Fülle, prachtvolle schneeweiße Daunen, mit denen die Schwäne die Ufer beschüttet hatten. Da erfaßte mich Sammelwut; ich raffte wieviel ich nur konnte und bettete den Flaumensegen in meine blaue Gymnasiastenmütze, die ich mir besitzfroh wieder auf den Kopf stülpte. Wer nie eine ähnliche Prozedur ausgeführt hat, der besitzt keine Ahnung von der Unmasse der Schwanenfedern, die zusammengebauscht zwischen Schädel und Mützentuch Platz finden. Ich trieb mich weiter im Garten herum, dachte bald gar nicht mehr an meinen Schatz und sah mich plötzlich in einem Menschenspalier, das sich dem herannahenden König geöffnet hatte. Der alte Johann, Philalethes, stand uns Kreuzschülern besonders nahe, als ein hochgelahrter Herr, der sogar bisweilen in den Klassen erschien, um den Lehrern wie Scholaren seine landesväterliche Fürsorge zu bewenden. Jetzt war der Monarch ganz nahe heran, alle Häupter entblößten sich zum Gruß – und nun begab sich unter Mitwirkung eines a tempo einsetzenden Windstoßes ein Naturphänomen, dessengleichen weder vor- noch nachher beobachtet worden ist: ein Schneegestöber über die ganze Allee hinweg, mitten im Sommer. Mein Kopf verriet sich klar genug als der fedrige Ursprung, und ich wußte gar nicht wohin, vor staunendem Entsetzen über das rätselhafte Flockengewimmel. Zum Glück war der beschneite König genau so verblüfft wie die übrige anwesende Menschheit, er stutzte, blieb stehen, wechselte Blicke mit seinen beiden Adjutanten, und ich Sünder gewann dabei Zeit, um mich aus dem Staube zu machen.
*
Ich halte mich in diesen Erzählungen nicht streng an den chronologischen Faden; denn an der zeitlichen Reihenfolge ist nichts gelegen, und ich ziehe es vor, die Geschehnisse der Pennalzeit so zu mischen, wie sie mir für die lebendige Darstellung geeignet erscheinen. Zwischendurch finde eine kurze Betrachtung Platz, die sich mir wie so manchem aufdrängt, wenn sie ihres Primordiums gedenken, vom Pferch der ABC-Schützen bis zum Maturitäts-Stall der vielgeprüften »Muli«.