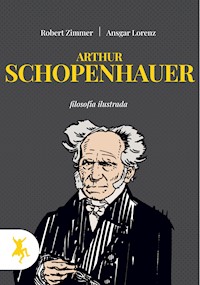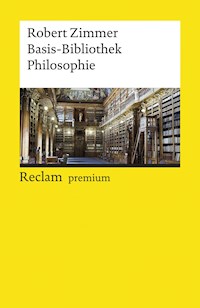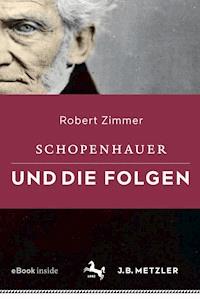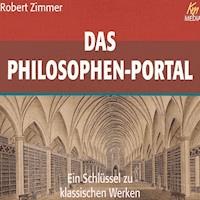
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Komplett-Media Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Gedanken beim Eintritt ins Philosophenportal Schwere Bücher leicht verpackt oder Was Sie schon immer über den Kategorischen Imperativ wissen wollten. Sie haben Geschichte gemacht und sind in den Regalen der Welt beheimatet – meist jedoch ungelesen: die Klassiker der Philosophie wie etwa Kants ›Kritik der Urteilskraft‹ oder Nietzsches ›Also sprach Zarathustra‹. Der studierte Philosoph Robert Zimmer hat sich der schwergewichtigen Bücher angenommen und sie bekömmlich aufbereitet. In einer Art Kurzbesichtigung führt er den Leser in die Räume von 16 zentralen Werken der Philosophiegeschichte, angefangen bei Platons ›Staat‹ bis hin zu John Rawls' ›Theorie der Gerechtigkeit‹. Dabei stellt er die Kerngedanken einer jeden Schrift vor, beschreibt ihren Entstehungsrahmen und macht die Verknüpfung mit Leben und Denken des Autors deutlich. Eine ebenso unterhaltsame wie informative philosophische Bildungsreise! Aus dem Inhalt: – Platon: Der Staat – Augustinus: Bekenntnisse – Machiavelli: Der Fürst – Montaigne: Essais – Descartes: Abhandlung über die Methode – Blaise Pascal: Gedanken – John Locke: Zwei Abhandlungen über die Regierung – Kant: Kritik der reinen Vernunft – Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung – Kierkegaard: Entweder – Oder – Karl Marx: Das Kapital – Nietzsche: Also sprach Zarathustra – Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus – Heidegger: Sein und Zeit – Popper: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde – Rawls: Theorie der Gerechtigkeit
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:5 Std. 53 min
Sprecher:Martin Umbach
Ähnliche
Robert Zimmer
Das Philosophenportal
Ein Schlüssel zu klassischen Werken
Deutscher Taschenbuch Verlag
Originalausgabe 2004© Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, MünchenDas Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.eBook ISBN 978-3-423-40362-7 (epub)ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-34118-9Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website www.dtv.de
Inhaltsübersicht
Gedanken beim Eintritt ins Philosophenportal
Der Traum von den Philosophenkönigen - Platon: Der Staat (zwischen 399 und 347 v. Chr.)
Bekehrung eines Intellektuellen - Aurelius Augustinus: Bekenntnisse (ca. 400)
Handbuch des Machtkalküls - Niccolò Machiavelli: Der Fürst (1532)
Aus den Papieren eines Weltweisen - Michel de Montaigne: Essais (1580–1588)
Reise ins Innere der Vernunft - René Descartes: Abhandlung über die Methode (1637)
Testament eines Gottsuchers - Blaise Pascal: Gedanken (1669/70)
Spielregeln des Rechtsstaats - John Locke: Zwei Abhandlungen über die Regierung (1690)
Grenzvermessung im Land der Erkenntnis - Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft (1781)
Der große Wurf eines jungen Pessimisten - Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung (1819)
Partitur der Lebensformen - Sören Kierkegaard: Entweder – Oder (1843)
Das Buch vom Wa(h)ren Wert - Karl Marx: Das Kapital (1867–1894)
Die Bibel des Antichristen - Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra (1883–1885)
Logik im Dienst der Mystik - Ludwig Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus (1921)
Aufruf zur Selbstverwirklichung - Martin Heidegger: Sein und Zeit (1927)
Abrechnung mit dem totalitären Denken - Karl R. Popper: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde (1945)
Sozialpakt für Fair Play - John Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit (1971)
Ich danke Yvonne Petter-Zimmer und Martin Morgenstern für die kritische Durchsicht einzelner Kapitel.
Gedanken beim Eintritt ins Philosophenportal
Ein Portal lässt uns an den Eingang in ein ehrwürdiges und stattliches Bauwerk denken. Auch das Haus der Philosophie ist in 2500Jahren zu fast unübersehbarer Größe gewachsen. Viele haben Scheu, dieses Haus zu betreten. Zu unübersichtlich sind die Gänge, zu schwierig erscheint es, auch nur mit einzelnen Teilen dieses Hauses vertraut zu werden. Ein großes philosophisches Werk ist in diesem Haus wie eine besonders kunstvoll eingerichtete Wohnung. Einige der üblichen Bewohner, die philosophisch Gelehrten, beschäftigen sich oft über Jahrzehnte nur mit einer einzigen Nische dieses Hauses. Sie werden also darauf bestehen, dass man ein klassisches Werk der Philosophie erst kennen lernt, wenn man sich lange und wiederholt damit auseinandersetzt, und sie werden jeden Anspruch zurückweisen, ein solches Buch könne auch nur annähernd erschöpfend verstanden und ausgedeutet werden.
Doch muss es erlaubt sein, auch einmal einen ersten Rundgang zu machen, in einzelne, auffallend interessante Räumlichkeiten einen Blick zu werfen und sich so eine Vorstellung von ihrer Lage, ihrer Architektur und ihrer Ausstattung zu machen. Danach sollte jeder selbst entscheiden, wohin er noch einmal zurückkehren und einige Zeit verbringen möchte.
Genau auf solch einen Rundgang wollen die vorliegenden sechzehn Essays den Leser mitnehmen. Weder Ausrüstung noch Training und schon gar keine Titel und Urkunden werden dafür erwartet. Nicht tief schürfende Analysen, sondern ein erstes Kennenlernen in lockerer Atmosphäre ist das Ziel. Ansonsten trockene und unzugängliche Bücher können sich dabei von ihrer charmanteren Seite zeigen: Sie alle haben eine eigene, sehr persönliche Geschichte und sie beschäftigen sich mit Fragen, die, vom akademischen Staub befreit, in einem interessanten und neuen Licht erscheinen.
Das Portal, so stattlich es auch erscheinen mag, ist doch der natürliche und bequemste Eingang zum Haus. Wer sich bisher davon abhalten ließ, die Schwelle zu überschreiten, wird feststellen, dass das Philosophenportal sich für jeden öffnet, der Neugier, Interesse und ein bisschen Zeit mitbringt. Er wird nach wenigen Schritten bemerken, dass die Räume dieses Hauses nicht für eine kleine Schar Auserwählter hergerichtet wurden, sondern für alle, die bereit sind, sich auf Ideen einzulassen, die auf den ersten Blick vielleicht ungewöhnlich sind, sich bei näherem Hinsehen aber als sehr bedenkenswert erweisen. Manche davon stehen unseren eigenen Gedanken vielleicht gar nicht so fern.
Es wird nicht an Experten fehlen, die auf die zahlreichen bedeutenden Werke hinweisen, die hier unberücksichtigt bleiben. In der Tat handelt es sich nur um eine kleine Auswahl, ohne Anspruch auf Exklusivität oder Vollständigkeit. Jede Auswahl dieser Art ist anfechtbar. Es wurden nicht immer diejenigen Werke ausgewählt, die im Mittelpunkt von Universitätsseminaren stehen, sondern solche, die weit über die Philosophie hinaus Einfluss ausgeübt und Leser gefunden haben, und, so ist zu hoffen, auch bei einer ersten Ansicht das Interesse neuer Leser wecken können. Das Philosophenportal ist nicht nur der Eingang zu einem großen, sondern auch zu einem offenen und lebendigen Haus.
Der Traum von den Philosophenkönigen
PLATON: Der Staat (zwischen 399 und 347 v.Chr.)
Der Mensch träumt nicht nur für sich allein. Es gibt auch kollektive Menschheitsträume. Sie malen das Bild einer befreiten, glücklichen, vom Leid erlösten Welt. Religion, Philosophie und Kunst haben diese Träume immer wieder aufgenommen und gestaltet. Zu den alten Menschheitsträumen gehört auch der vom idealen Staat als Modell einer perfekten und gerechten Ordnung des menschlichen Zusammenlebens.
Unter den philosophischen Werken, die diesem Traum eine rationale Gestalt gegeben haben, ist das Hauptwerk des griechischen Philosophen Platon, Politeia, zu Deutsch Der Staat, das berühmteste. Der Staat ist die erste uns überlieferte Staatsutopie überhaupt. Doch das Werk enthält viel mehr als eine politische Philosophie. Platon hat mit diesem Buch den ganz großen Wurf versucht. Er wollte Politik und Moral, Metaphysik und Religion, rationale Weltdeutung und Mythos miteinander verknüpfen. Mit anderen Worten: Platons Staat tritt mit dem Anspruch auf, die politische Ordnung mit den wahren, ewigen Gesetzen der Wirklichkeit zu verbinden. Er ist der erste große Systementwurf in der Geschichte der europäischen Philosophie. In dem vielstimmigen Konzert dieser Geschichte haben die Vorgänger Platons den Grundton angestimmt, Platon selbst aber hat die Ouvertüre gespielt.
Ausgangspunkt des Werkes ist die Frage nach der Gerechtigkeit. Sie führt schließlich zu der Beschreibung einer gerechten Ordnung, die auf so stabile Fundamente gebaut ist, dass sie für alle Zeiten unverändert bestehen kann. Im Mittelpunkt dieser Ordnung steht die Vorstellung, dass der Staat von den wirklich Besten regiert wird, von Herrschern, die sich gleichermaßen durch Weisheit und durch Kompetenz auszeichnen. Denn Platon träumt in diesem Buch nicht nur den Traum vom idealen Staat, sondern auch den Traum von den Philosophenkönigen, die Weisheit und Macht vereinen. Sie sind nicht nur politische, sondern auch spirituelle Führer, die den Menschen den Weg zur wahren Wirklichkeit zeigen können.
In der Geschichte der Menschheit ist dies ein ebenso verführerischer wie unzerstörbarer Traum geblieben, der bis heute eine große Faszination ausübt. Er trifft einen Nerv nicht nur bei Philosophen, sondern auch bei vielen Menschen, die das Geschehen auf der politischen Bühne als ein ewig fruchtloses Gerangel, als ein Geschacher um Posten und einen Machtklüngel auf Kosten der Bürger erleben. Ist es nicht eine verlockende Idee, in einem Staat zu leben, in dem diejenigen herrschen, die dazu am besten geeignet sind und denen man in jeder Hinsicht vertrauen kann?
Bei all dem ist Platons Staat keine trockene Abhandlung, sondern eine kunstvoll inszenierte Diskussion, in der Platons philosophischer Lehrer Sokrates zu einer literarischen Figur wird und als Erzähler und Hauptsprecher auftritt. Platon zeigt sich hier als Dichter und als Philosoph. Gleich in der ersten Zeile setzt die Stimme des Sokrates ein und der Leser fühlt sich wie in einen Roman versetzt: »Ich ging gestern mit Glaukon, dem Sohne des Ariston, in den Peiraieus hinunter, teils um die Göttin anzubeten, dann aber wollte ich auch zugleich das Fest sehen, wie sie es feiern wollten, da sie es jetzt zum erstenmal begehen.«
Platon führt hier Szenerien und Personen ein, die ihm eng vertraut waren. Sokrates hat sich von Athen zu dem mehrere Kilometer entfernten Hafen von Piräus aufgemacht, um das Fest zu Ehren der Göttin Athene mitzuerleben. In seiner Begleitung befindet sich Glaukon, einer der Brüder Platons. Als Sokrates einige Zeit später wieder den Heimweg antreten will, drängen ihn Freunde und Bekannte, darunter Adeimantos, ein weiterer Bruder Platons, und Polemarchos, der Sohn des wohlhabenden Kaufmanns Kephalos, noch in Piräus zu bleiben, gemeinsam mit ihnen zu essen, zu diskutieren und die noch folgenden Nachtfeierlichkeiten mitzuerleben. Im Haus des Kephalos entwickelt sich im Folgenden ein Gespräch zwischen Sokrates und wechselnden Diskussionspartnern, in dem Positionen zur Gerechtigkeit ausgetauscht und die Grundzüge einer gerechten gesellschaftlichen Ordnung entworfen werden.
Dass Platons Dialoge bis heute nicht nur als Philosophie, sondern auch als Dichtung gelesen werden können, trifft sich durchaus mit den Absichten des Autors. Schon vom jungen Platon ist überliefert, dass er an Dichterwettbewerben teilgenommen hat. Auch dass die Politik in seinem Werk eine solch große Rolle spielt, ist nicht zufällig. Platon war nicht nur ein Sohn Athens, der bedeutendsten Stadt des klassischen Griechenlands, sondern er gehörte auch einer der vornehmsten Familien dieser Stadt an. Er war ein Spross der traditionellen politischen Elite, deren Vormachtstellung jedoch im 5. vorchristlichen Jahrhundert durch die Reformen des großen Athener Staatsmanns Perikles beseitigt worden war. Perikles hatte die Demokratie eingeführt und den politischen Einfluss der Aristokratie beschnitten. Im Peloponnesischen Krieg schließlich, der 431 v.Chr., vier Jahre vor Platons Geburt, begann, verlor Athen seine politische Vorrangstellung innerhalb Griechenlands an den Rivalen Sparta.
In die nun folgenden turbulenten politischen Entwicklungen war Platons Familie eng verstrickt. Die alten Oligarchen der Stadt hatten eine dezidiert antidemokratische Haltung bewahrt und während des Krieges mit dem autoritären Militärstaat Sparta sympathisiert. Als die Spartaner nach dem Krieg im Jahr 404 die athenische Demokratie wieder abschafften, setzten sie ein Marionettenregime ein, das mit Angehörigen der alten Athener Oberschicht besetzt war. Darunter befanden sich mit Charmides und Kritias zwei Onkel Platons mütterlicherseits. Dieses Regime der »Dreißig Tyrannen« errichtete eine Willkürherrschaft, die aber bereits 403 von den Demokraten wieder gestürzt wurde.
In enger Verbindung zu den Demokraten stand die philosophische Aufklärungsbewegung der Sophisten. Ihr Ziel war es nämlich, Philosophie lehrbar zu machen und auch den einfachen Bürger mit Argumenten auszurüsten, mit denen er sich gegenüber den traditionellen Eliten behaupten konnte. Führende Sophisten gehörten zu den Beratern des Perikles. In der alten Oberschicht waren sie auch deswegen unbeliebt, weil sie anzweifelten, dass die Geltung der Gesetze durch Tradition begründet werden könne. Gesetze, so sagten sie, seien nichts anderes als Konventionen und könnten jederzeit geändert werden.
Der junge Platon war, aus Familientradition und Überzeugung, ein Konservativer. Er hat sowohl die Athener Demokraten als auch die Sophisten immer als seine Gegner angesehen. Er hielt daran fest, dass es in der Gesellschaft eine klare Abgrenzung zwischen »oben« und »unten« geben, dass die politische Macht von den »Besten« ausgeübt werden müsse und dass die Masse des Volkes nicht zur Herrschaft geeignet sei. Nach eigenen Aussagen hatte Platon ursprünglich große Neigung, sich aktiv in der Politik zu engagieren. Doch als seine beiden Onkel ihm während der Zeit der Dreißig Tyrannen politische Mitarbeit anboten, weigerte er sich. Die Herrschaftsmethoden der Dreißig Tyrannen stießen ihn ab. Er glaubte, dass die alte Oberschicht in ihrer Aufgabe, gerecht zu herrschen, versagt habe.
Doch der eigentliche Grund seiner Ablehnung lag in seiner Bekanntschaft mit Sokrates und seiner Hinwendung zur Philosophie. Er hatte Sokrates bereits im Alter von vierzehn Jahren kennen gelernt und gehörte ab seinem zwanzigsten Lebensjahr zu dessen Schülerkreis.
Sokrates kam ursprünglich aus den Reihen der Sophisten. Wie diese trug er die Philosophie auf die Straße und vertraute eher der Vernunft als der Tradition. Doch unterschied er sich von den Sophisten in einem entscheidenden Punkt: Er glaubte, dass es feste und allgemein gültige Maßstäbe für das menschliche Handeln gibt und dass tugendhaftes Handeln auf Erkenntnis und Wissen beruht. In den Gesprächen, die uns Platon in seinen frühen Schriften überliefert hat, fragt Sokrates nach solchen Maßstäben, doch alle diese Gesprächen enden ohne Ergebnis. Platon war einer der Schüler, die die Fragen des Sokrates aufnahmen und versuchten, eigene Antworten zu finden.
Unter diesen Schülern waren auffällig viele junge Aristokraten, was von den regierenden Demokraten mit Misstrauen beobachtet wurde. Die letzten Gründe, warum Sokrates schließlich im Jahr 399 von den Demokraten zum Tode verurteilt wurde, werden vielleicht nie geklärt werden. Der Vorwurf jedenfalls, er habe die Jugend zu fremden Göttern verführt und vom Pfad der Tugend abgebracht, ist auch ein politischer Vorwurf, da jedes griechische Gemeinwesen seinen Zusammenhalt durch einen bestimmten religiösen Kult begründete. Religion und Politik hingen auf das Engste miteinander zusammen.
Die Hinrichtung des Sokrates durch den Giftbecher war das entscheidende Ereignis und der Wendepunkt in Platons Leben. Er verstand sich nun als dessen philosophischer Nachlassverwalter. Wie viele andere Schüler des Sokrates verließ er Athen, weil er politische Verfolgung fürchten musste, und begab sich über ein Jahrzehnt lang auf Reisen. Diese Zeit des selbst gewählten Exils wurde auch eine Zeit des geistigen Austauschs und neuer Erfahrungen.
Zunächst ging er für drei Jahre in die Nachbarstadt Megara, wohin sich auch Euklid, ein weiterer bekannter Sokrates-Schüler, zurückgezogen hatte. Weitere Reisen führten ihn nach Kyrene, Tarent und Ägypten. Er begann philosophische Dialoge zu verfassen, in denen er Sokrates als Hauptsprecher auftreten lässt und in denen er die Meinung des historischen Sokrates noch weitgehend unverändert wiedergibt. Eine der ersten dieser Schriften, die Apologie, enthält die Verteidigungsrede des Sokrates vor Gericht und kann als nachträgliche Abrechnung Platons mit der Athener Demokratie gelesen werden.
Das Thema der Gerechtigkeit taucht in den frühen Schriften immer wieder auf. Während die Sophisten immer wieder betonten, dass es keine Gerechtigkeit »an sich« gebe, sondern dass sie abhängig von Nutzen und Interessen sei, enthält der Dialog Gorgias, benannt nach einem der berühmtesten Sophisten, die These des Sokrates: »Unrecht leiden ist besser als Unrecht tun.« Dass Gerechtigkeit etwas ist, was über die Bedürfnisse und Interessen Einzelner hinausgeht, war auch die Überzeugung Platons. Etwa gleichzeitig mit dem Gorgias schrieb Platon einen Dialog, den er nie als einzelne Schrift veröffentlichte und dem die Fachleute den Arbeitstitel ›Thrasymachos‹ gegeben haben. Er schildert die Auseinandersetzung zwischen Sokrates und dem Sophisten Thrasymachos um die Definition der Tugend der Gerechtigkeit. Auch hier wendet sich Platon gegen die Meinung, Gerechtigkeit könne mit Herrschaftsinteressen identifiziert werden.
Dass Platon das Thema Gerechtigkeit in einen Zusammenhang mit dem Entwurf eines idealen Staates brachte, hängt wohl mit seiner wichtigsten Reise zusammen, die ihn in das damals griechisch besiedelte Süditalien führte. Dorthin war ihm sein Ruf als philosophischer Schriftsteller schon vorausgeeilt. Hier hatte sich im 6. vorchristlichen Jahrhundert einer der größten frühgriechischen Philosophen, Pythagoras, der Begründer der pythagoreischen Schule, niedergelassen, der sich den Ruf eines gottgleichen Magiers erworben hatte. Seine Schüler beschäftigten sich intensiv mit Mathematik und Musik, da sie glaubten, in den musikalischen Harmonien und in den Zahlenverhältnissen, durch die man sie ausdrücken kann, lasse sich die Wirklichkeit in ihrer Tiefenstruktur abbilden. Auch hingen sie dem aus östlichen Meditationslehren übernommenen Glauben an die Seelenwanderung an. Diese Mischung aus rationalem und mystischem Denken übte großen Einfluss auf Platon aus und er nahm sich vor, mit den Pythagoreern zusammenzutreffen und mit ihnen zu diskutieren.
Doch die für Platon prägendste Erfahrung seiner Reise war der Besuch im sizilianischen Syrakus, einer mächtigen griechischen Kolonie, wo er im Jahr 389 v.Chr. eintraf. Dessen Herrscher, Dionysios I., hatte die Demokratie abgeschafft und durch einen Militärstaat ersetzt, der enge Verbindungen zu Sparta unterhielt. Dies traf sich mit Platons eigener antidemokratischer Grundhaltung und Sympathie für Sparta. Dionysios kokettierte auch gerne mit seiner philosophischen Bildung und es wird kolportiert, er habe seinen drei Töchtern die Namen »Tugend«, »Gerechtigkeit« und »Besonnenheit« gegeben.
Platon war für etwa zwei Jahre Gast des syrakusischen Machthabers, der sich allerdings nicht als der gerechte Herrscher erwies, den Platon sich vorgestellt hatte. Das Leben am Hof stand in offenbarem Gegensatz zu der von Dionysios gepflegten philosophischen Rhetorik. In seinen Briefen beklagt sich Platon über die ständigen nächtlichen Gelage und Ausschweifungen. Es kam zu einem klassischen Konflikt zwischen Macht und Geist. Platons Versuch, als philosophischer Politikberater Einfluss zu nehmen und Dionysios auf die praktischen Konsequenzen eines an ethischen Maßstäben orientierten Herrschens hinzuweisen, scheiterten kläglich.
Dionysios machte keinen Hehl aus seiner Verachtung für den Intellektuellen, der ihn belehren wollte, während Platon den Herrscher offen als einen Tyrannen bezeichnete. Die Wege des Diktators und des Philosophen trennten sich also zwangsläufig. Manche Quellen berichten, Dionysios habe Platons Schiff nach Ägina gelenkt, einer Stadt, die mit Athen im Krieg lag und deshalb athenische Bürger als Kriegsgefangene behandelte, was dem Status von Sklaven gleichkam. Von einem Freund soll Platon schließlich freigekauft und nach Athen zurückgebracht worden sein. Auch zwei weitere, in späteren Jahren unternommene Reisen nach Syrakus endeten in Zwist und Misserfolg.
Die ernüchternde Erfahrung, wie wenig Achtung der Philosoph von den politisch Mächtigen erwarten konnte, hielt Platon jedoch nicht davon ab, seine eigenen politischen Vorstellungen weiter auszuarbeiten. Im Jahr seiner Rückkehr nach Athen, 387, gründete er seine eigene philosophische Schule, die berühmte »Akademie«, vor den Toren der Stadt. Hier nahm nun, in den Jahren nach seiner ersten Syrakusreise, sein Hauptwerk über den Staat Gestalt an.
Es ist bestimmt von Platons Versuch, seinen Konservatismus philosophisch zu begründen und die Konsequenzen aus seinen reichhaltigen Erfahrungen zu ziehen. Er wollte das Bild einer Gesellschaft entwerfen, in der die Grenzen zwischen Herrschern und Beherrschten wieder klar gezogen waren, in der die Machtstellung der Herrschenden aber durch unverrückbare Prinzipien und nicht durch die Tradition begründet wurde. Es sollte ein Gemeinwesen sein, das von einer Elite regiert wird, die diesen Namen verdient und nicht – wie Dionysios oder die Dreißig Tyrannen von Athen – ihre Macht tyrannisch missbraucht. Der Staat wurde geschrieben als mächtiger philosophischer Schutzwall gegen die Herausforderung der sophistischen Aufklärung. Nun spricht Platon in eigener Sache. Sokrates wird zu seiner Sprechpuppe, zum Verkünder platonischer Lehrmeinungen.
Dabei baut Platon auf dem bereits vorhandenen Dialog zwischen Sokrates und Thrasymachos über die Gerechtigkeit auf, der an den Anfang des neuen Werks gesetzt wurde und als dessen Einleitung gelesen werden kann. Für Thrasymachos ist das, was durch Gesetze als gerecht festgelegt ist, in Wahrheit identisch mit dem, was den politisch Herrschenden nützt. Andererseits glaubt er, dass das, was normalerweise Ungerechtigkeit genannt wird, in Wahrheit oft als Weisheit und Tugend angesehen werden muss, weil es den eigenen Interessen dient. Thrasymachos vertritt also eine typisch sophistische Position: Normen und Werte gelten nicht von Ewigkeit her, sondern sie sind veränderbar und von Interessen und Konventionen abhängig.
Sokrates dagegen glaubt, dass Gerechtigkeit eine Kunst oder eine Fertigkeit ist, die wie die ärztliche Kunst nach bestimmten unveränderbaren Regeln und auch im Sinne der Patienten, das heißt der Bürger, ausgeübt wird. Als Tugend des einzelnen Menschen ist sie so etwas wie die Gesundheit der Seele, das heißt, die psychischen und geistigen Kräfte des Menschen müssen sich in einer bestimmten Ordnung befinden.
Diese Auffassung ist der Ausgangspunkt für Platons weitere Diskussionen im Staat: Gerechtigkeit ist für ihn eine Art feststehender Ordnung. Sie ist eine Grundtugend, die Tugend nämlich, die alle Ziele und Bedürfnisse, aber auch alle anderen Tugenden des Menschen in ein bestimmtes Verhältnis zueinander setzt. Der Staat ist der Versuch, diese Ordnung und dieses Verhältnis in Form eines Gesellschaftsmodells zu beschreiben.
Im zweiten Buch des Staates überträgt Platon den Gedanken der Gerechtigkeit als einer Ordnung der menschlichen Seele auf die Gesellschaft. In der gesellschaftlichen Ordnung lässt sich nach Platon die Ordnung der Seele wie in einem Vergrößerungsglas erkennen. Er orientiert sich dabei an der Ordnung einer griechischen »Polis«. Entsprechend lautet der Titel seines Werks Politeia, also wörtlich: die »Lehre von der ›Polis‹«. Die »Polis« war kein Staat im modernen Sinne, sondern ein Stadtstaat, vergleichbar etwa der Größe eines Schweizer Kantons. Deshalb erscheint »Polis« in deutschen Übersetzungen manchmal als »Staat« und ein anderes Mal als »Stadt«. In der »Polis« hatten nur so genannte »freie« Bürger Stimmrecht, zu denen weder Frauen noch Sklaven zählten. Sklaverei war für Platon noch eine ganz normale und unbestrittene Institution. Die Stellung der Frauen dagegen wertet er in seinem Idealstaat erheblich auf, da sie wie die Männer Zugang zur herrschenden Schicht erhalten.
Platon erläutert nun etwas genauer, was er unter der Gerechtigkeit als einer Gesundheit der Seele versteht. Die Seele, griechisch »psyche«, ist für ihn der Bereich aller geistigen und gefühlsmäßigen Kräfte. In ihr unterscheidet er drei verschiedene Vermögen: die Vernunft, den Willen und die Leidenschaften. Ihnen sind drei Tugenden zugeordnet, nämlich Weisheit, Tapferkeit und Besonnenheit. Der Mensch ist nach Platon vornehmlich ein Vernunftwesen, das heißt, der Vernunft muss Vorrang vor den anderen Vermögen gegeben werden. Die gerechte Ordnung der Seele ist dann hergestellt, wenn die Vernunft mit Hilfe des Willens die Leidenschaften beherrscht.
In ein politisches Bild gebracht, heißt dies: Die Vernunft ist der Herrscher, der Wille stellt das Dienst- und Wachpersonal und die Leidenschaften sind das beherrschte Volk. Genau dieses Bild einer Hierarchie, an deren Spitze die Vernunft steht, bestimmt Platons Vorstellung vom idealen Staat. Der Schlüssel zu seiner Gerechtigkeitsvorstellung liegt in dieser Grundidee, dass die Vernunft der natürliche Herrscher sei – sowohl im einzelnen Menschen als auch im Staat. Gerechtigkeit, Weisheit, Tapferkeit und Besonnenheit sind für Platon die vier »Kardinaltugenden«, wobei die Gerechtigkeit den harmonischen Zusammenhang zwischen diesen Tugenden festlegt.
Indem Platon bestimmte Tugenden mit bestimmten Gesellschaftsschichten in Verbindung bringt, kommt er zur Vorstellung einer Drei-Klassen-Gesellschaft: Ganz an der Spitze stehen wenige, mit königlicher Macht ausgestattete Regenten, die von einer Kriegerkaste, den so genannten »Wächtern«, umgeben sind. Übrig bleibt die große Masse der freien Bürger, die arbeitende Bevölkerung, die nicht an der Herrschaft beteiligt ist. Die Tugend der Regenten ist Weisheit: Sie treffen alle wichtigen Entscheidungen. Die Tugend der Wächter ist Tapferkeit: Sie müssen gegen äußere und innere Gefahren gewappnet sein. Die Tugend der Beherrschten schließlich ist Besonnenheit: Sie müssen ihre Leidenschaften bändigen, Mäßigung und Unterordnung üben. Die Regenten und die Wächter sind eng miteinander verbunden: Sie bilden zusammen die herrschende Schicht, werden zusammen erzogen und sind in dem Interesse vereint, die Ordnung des Staates aufrechtzuerhalten. Platons Staat ist wie Sparta ein Militärstaat mit einem stehenden Heer, das nicht nur gegen äußere Feinde schützen, sondern auch innere Unruhen unterdrücken soll.
Gerechtigkeit ist für Platon ganz eng mit Stabilität verknüpft, einer Stabilität, die – wie in der pythagoreischen Lehre – als eine mehrstimmige und doch rational organisierte Harmonie geordnet und in der jede Abweichung ein »Missklang« ist. Mehrstimmigkeit heißt, in die Sprache der Politik übersetzt, eine eindeutige und unveränderbare Hierarchie verschiedener Stände. Politischer Dissens oder gar Revolutionen sind dagegen Merkmale der Ungerechtigkeit.
In Platons Staat werden die Bürger in ihren Stand hineingeboren. Ein Aufstieg in einen höheren Stand ist nur in wenigen Ausnahmefällen möglich. Das Gerechtigkeitsprinzip Platons lautet: Jeder soll das Seinige tun, das heißt, jeder soll den ihm von vornherein zugewiesenen Platz in der vorgesehenen Weise ausfüllen. Hier wird eines der wichtigsten Anliegen Platons deutlich: Einer Demokratie, so wie sie in Athen betrieben und von den Sophisten unterstützt wurde, sollte jede Legitimation genommen werden.
Legitim ist eine Herrschaft dagegen dann, wenn sie von der Vernunft bestimmt ist, und dies kann nur gewährleistet sein, wenn die Herrschenden einer strengen Auswahl unterzogen werden. Deshalb erhalten in Platons Staat nur diejenigen den Status von Regenten, die zu den höchsten Formen der Erkenntnis Zugang haben. Die Erziehung der Regenten und Wächter ist damit von ganz wesentlicher Bedeutung. Platon empfiehlt hierfür eine Mischung aus philosophischer und wissenschaftlicher Erziehung, wie er sie selbst für seine Akademie entworfen hatte, sowie einer militärisch-asketischen Erziehung, wie er sie aus Sparta kannte. Sie wird vom Staat und nicht von den Eltern übernommen.
Doch Platon führt auch ganz neue Elemente ein. Die herrschende Klasse ist eine Art sozialistischer Ordensgemeinschaft, in der sowohl die Sexualpartner als auch der Besitz allen gemeinsam sind. Die normalen Familien- und Besitzstrukturen sind also hier aufgehoben. Frauen und Männer sind gleichberechtigt, das heißt, auch Frauen können die Funktionen von Wächtern und Regenten wahrnehmen. Doch herrscht zwischen den Geschlechtern keineswegs unbeschränkte sexuelle Freizügigkeit. Der Lebensstil der herrschenden Klasse ist eher asketisch und diszipliniert, um jede Versuchung der persönlichen Bereicherung und Machtanhäufung zu vermeiden. Entsprechend ist auch der Sexualverkehr streng geregelt, um den für den Staat besten Nachwuchs zu erzeugen. Dieser wird ebenfalls von allen gemeinschaftlich erzogen. Platon propagiert also eine politisch motivierte Eugenik, eine Lehre von der Zucht der besten Erbeigenschaften, wie sie versuchsweise auch von totalitären Staaten des 20.Jahrhunderts durchgeführt wurde.
Am Beginn der Kinderaufzucht steht eine musische Erziehung, begleitet von regelmäßigen Leibesübungen. Ziel ist es, körperlich trainierten und ideologisch verlässlichen Nachwuchs heranzubilden. Die Möglichkeiten der musischen Erziehung sind allerdings sehr eingeschränkt. Die Kunst darf nur erbauliche Inhalte vermitteln, das heißt solche, die die kriegerische Gesinnung stärken und die ideologische Festigkeit nicht gefährden. Die im antiken Griechenland so populären Epen des Homer mit ihren Schilderungen von Verrat, Grausamkeiten oder Festgelagen haben in Platons Staat keine Chance, die Zensur zu passieren. In der Musik beschränkt sich das Erlaubte auf »phrygische« und »dorische« Tonarten, welche die Tapferkeit und Besonnenheit stärken.
Während Platon die Rolle der Künste abwertet, hat er eine hohe Meinung von der Mathematik, die er wie die Pythagoreer als eine Brücke zur Philosophie ansieht. Mathematik gehört aber nicht zum Pflichtprogramm, sondern wird nur für Freiwillige angeboten. Mit ihr beginnt eine spezielle geistige Ausbildung, die schließlich die Regenten von den Wächtern scheidet. Die wenigen künftigen Regenten werden ab dem dreißigsten Lebensjahr fünf Jahre lang in Philosophie unterrichtet und müssen danach noch fünfzehn Jahre lang in untergeordneten Staatsämtern dienen. Erst im Alter von fünfzig Jahren werden die Besten von ihnen dazu ausersehen, die höchste Form philosophischer Erkenntnis, die »Idee des Guten«, zu schauen. Dann haben sie den Status des Weisen und damit des Philosophenkönigs erlangt und müssen ihr Leben teilen zwischen der praktischen Regierungstätigkeit und der philosophischen Kontemplation.
Mit der »Idee des Guten« kommt Platons Ideenlehre, seine Theorie der Wirklichkeit, ins Spiel. Sie erklärt auch, was Platon mit Weisheit und Vernunfterkenntnis meint. Platon erläutert seine Ideenlehre in dem berühmten Höhlengleichnis, einem Herzstück des Staats, in dem er die Verbindung zwischen seinen politischen sowie seinen metaphysischen und religiösen Vorstellungen herstellt.
Wie Gefangene leben die Menschen in einer Höhle, in die Schatten von Gegenständen geworfen werden, die sich im Rücken der Menschen hinter einer Mauer bewegen. Diese Schattenbilder werden von den Menschen für die Wirklichkeit gehalten. Man stelle sich nun vor, ein Gefangener befreite sich aus der Höhle, träte ins Tageslicht und erblickte mit der Sonne die wahre Wirklichkeit, kehrte dann aber wieder in die Höhle zurück und berichtete den Mitgefangenen davon. Sie würden ihm wahrscheinlich zunächst nicht glauben, weil er, von der Erfahrung der Sonne geblendet, nun auch die Schatten an der Wand undeutlicher sieht als vorher.
Die Höhle ist die Welt unserer normalen sinnlichen Wahrnehmung, deren Gefangene wir sind. Der die Höhle verlassende Gefangene ist der Philosoph. Er ist derjenige, der den Menschen Kunde von der wahren Wirklichkeit gibt. Diese wahre Wirklichkeit außerhalb der Höhle ist die Welt der Ideen. Alles, was wir wahrnehmen, hat demnach in der Welt der Ideen ein ideales Muster. Für die vielen Tische, die wir wahrnehmen, gibt es eine Idee des Tisches, ebenso wie auch für alle anderen wahrgenommenen Dinge eine Idee existiert. Der griechische Begriff für »Idee«, »eidos«, heißt eigentlich »ideale Form«. Auch die Ideen befinden sich in einer abgestuften hierarchischen Ordnung. An ihrer Spitze steht die Idee des Guten, das höchste Prinzip der Wirklichkeit, aber auch der Maßstab für Vernunft und tugendhaftes Handeln.
Für Platon gibt es vier Stufen der Wirklichkeitserkenntnis: Die niedrigste wird repräsentiert durch die Kunst, die ein Abbild sinnlich wahrnehmbarer Dinge liefert. Danach kommt die sinnliche Wahrnehmung, die selbst wiederum nur ein Abbild der Welt der Ideen ist. Als Brücke zu den Ideen sieht Platon die reine Anschauung mathematischer Strukturen. Aber erst die Erkenntnis der Ideen ist Ausweis der Weisheit und der wahren Vernunfterkenntnis. Mit dieser Stufenfolge wird schließlich auch der niedrige Rang der Kunst in Platons Staat begründet. Indem sie Abbilder von Abbildern liefert, ist die Kunst eine drittklassige und irreführende Erkenntnis und in jeder Weise geeignet, von der wahren Wirklichkeit abzulenken.
Die Welt der Ideen ist, im Gegensatz zur sinnlichen Welt, ewig und keinen Veränderungen unterworfen. In ihrer unverrückbaren Stabilität wird sie zum Vorbild für die Ordnung des Staates. Indem die Erkenntnis der Ideen den Regenten des platonischen Staats zugewiesen wird, erhalten sie das entscheidende Herrschaftswissen, das zur Begründung ihrer politischen Stellung dient. Diese Erkenntnis darf man sich aber nicht als einen rein intellektuellen Akt vorstellen. Sie ist vielmehr eine Art Vision, ein Akt der Erleuchtung. Im antiken Griechenland waren der Philosoph und der religiöse Seher noch nicht streng voneinander getrennt. Dies gilt auch für Platons Philosophenkönige. Sie stellen einerseits die »akademisch« am besten ausgebildete Elite, haben aber andererseits, wie Priester, als Einzige direkten Zugang zu einer transzendenten Welt.
Diese religiöse Dimension des platonischen Staates wird durch das Ende des Buchs bestätigt. Hier kehrt Platon nämlich noch einmal zu dem Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und der menschlichen Seele zurück. Auch wenn Gerechtigkeit nicht durch Eigennutz definiert werden darf, so gibt es doch so etwas wie einen »Lohn« gerechten Handelns im Jenseits. Schon in seinem Dialog Phaidon hatte Platon die These von der Unsterblichkeit der Seele vertreten. Nun fügt er, in der Tradition der Pythagoreer, die Lehre von der Seelenwanderung hinzu, die er in einer mythenhaften Erzählung an den Schluss seines Buchs setzt.
Die Seele durchwandert nach dem Tod die Sphäre des Himmels und büßt dort für ihre Vergehen. Danach wird ihr Gelegenheit gegeben, eine neue Lebensform, sei es als Tier oder als Mensch, zu »wählen«. Platon wollte offenbar bekräftigen, dass das gerechte Leben in Verbindung mit einer Weltordnung steht, über die wir nicht mehr mit rationaler Argumentation, sondern nur noch mit Hilfe des Mythos sprechen können.
Im 20.Jahrhundert hat ein anderer großer politischer Philosoph, Karl R.Popper, Platons Idealstaat als totalitär kritisiert. Begriffe wie »Gerechtigkeit« oder »Idee des Guten« sollten in der Tat nicht den Blick davor verschließen, dass dies ein von wenigen Auserwählten gelenkter Staat ist, in dem Zensur herrscht und der Zugang zur Bildung nur wenigen Privilegierten gestattet ist. Platon ist mit seinem elitären Konservatismus auch keineswegs repräsentativ für sein Zeitalter. Von dem vierzig Jahre älteren Philosophen Demokrit ist zum Beispiel die Aussage überliefert, dass »die Armut in einer Demokratie um so viel besser ist als das so genannte ›Glück‹ am Hofe der Mächtigen, wie die Freiheit besser ist als ein Sklavendasein«. Die politischen Meinungen gingen auch im alten Griechenland weit auseinander.
Dennoch war selbst ein so entschiedener Kritiker Platons wie Popper fasziniert von dem »Zauber«, der von diesem kunstvoll konstruierten Entwurf einer in sich geschlossenen Gesellschaft ausgeht. Platons ungeheure Wirkung in der europäischen Geistesgeschichte beruht genau auf dieser visionären Kraft. Der Staat hat das gesamte utopische Denken der europäischen Philosophie maßgeblich inspiriert. Dabei spielte auch immer wieder die Vorstellung einer weisen und zugleich asketisch lebenden Machtelite eine Rolle.
In der Renaissance wurde das Werk zum Vorbild zahlreicher Staatsutopien. Aber auch das von den Marxisten des 19. und 20.Jahrhunderts formulierte Ziel einer klassenlosen Gesellschaft trägt den utopischen Keim in sich, den Platon gepflanzt hat. Platon hat die Herausforderung angenommen, die verlangt, dass Gerechtigkeit nicht nur ein Wort oder eine Forderung sein darf, sondern auch mit der konkreten Vorstellung eines Gesellschaftsmodells verbunden sein muss. Er hat damit nicht nur die Fantasien der politischen Philosophen bis heute angeregt, er hat auch an den tief verwurzelten Traum der Menschen vom politischen Schlaraffenland gerührt.
Ausgaben:
PLATON: Sämtliche Werke, Band3: Phaidon, Politeia. Übersetzt von F.Schleiermacher. Herausgegeben von W.F.Otto, E.Grassi und G.Plamböck. Hamburg: Rowohlt 1958.
PLATON: Der Staat. Übersetzt von R.Rufener. München: dtv 1998.
Bekehrung eines Intellektuellen
AURELIUS AUGUSTINUS: Bekenntnisse (ca. 400)
Intellektuelle tun sich normalerweise schwer mit dem Ansinnen, sich einfach auf einen religiösen Glauben einzulassen. Sie sind es gewohnt, ihren Wissenshintergrund einzubringen und nach dem Warum zu fragen. Sie haben einen unstillbaren Drang nach rationaler Erklärung – während die Verfechter der Religion gerade darauf hinweisen, dass eine Religion eigentlich überflüssig wäre, wenn der Mensch alles auf rationale Art erklären könnte.
Noch komplizierter wird der Fall, wenn ein erfolgreicher und hochgebildeter Akademiker sich auf eine noch junge Religion einlässt, die von seinen Kollegen mit Naserümpfen betrachtet wird und deren Anhänger eher für ihren Rigorismus und ihre Verachtung der Philosophie bekannt sind. Eine solche Begegnung ist konfliktreich, aber häufig auch sehr intensiv: Sie verlangt von dem neu Bekehrten eine radikale Veränderung, sowohl in seiner geistigen Einstellung als auch in seiner Lebensführung. Ganz selten ist der Fall, dass die Religion selbst in den Händen des Bekehrten sich wandelt und eine neue Gestalt annimmt.
Die um die Wende zum 4.Jahrhundert entstandenen Bekenntnisse des römischen Bürgers Aurelius Augustinus sind Zeugnis einer solchen schwierigen Annäherung eines Intellektuellen an einen religiösen Glauben, bei der beide Seiten sich verändern. Aus einem Karriereakademiker wurde ein berühmter Religionslehrer. In Folge seiner Bekehrung wurde der Universitätsdozent Augustinus zu einem der bekanntesten Bischöfe seiner Zeit und ging als »Kirchenvater« in die Geistesgeschichte ein. Und die junge Volksreligion des Christentums, die sich auf Offenbarungen und Gleichnisse stützte, erhielt durch das Denken und Fragen des Intellektuellen Augustinus prägende philosophische Anstöße.
Die Begegnung des Augustinus mit dem Christentum markiert eines der wichtigsten Daten in der Entstehung der frühchristlichen Theologie. Aber auch die Philosophie nahm von da an einen völlig neuen Weg. Mit Augustinus beginnt das mittelalterliche Denken, das ganz neue Schwerpunkte setzt: Die zeitliche und vergängliche Existenz des Menschen, das Verhältnis zwischen Diesseits und Jenseits und die Rolle der Geschichte wurden nun in neuen Zusammenhängen gesehen. Mit Augustinus trat die Philosophie in den Dienst der Theologie.
Augustinus hatte sich schon vor seiner Bekehrung viele Jahre mit dem Christentum auseinander gesetzt. Seine Mutter Monnica war Christin und hatte die Hoffnung nie aufgegeben, den Sohn einmal für ihren Glauben gewinnen zu können. Auch seinen Vater Patricius, einen kleinen römischen Beamten in der nordafrikanischen Stadt Thagaste im heutigen Algerien, brachte sie schließlich dazu, sich taufen zu lassen. Doch ihr Hauptinteresse galt ihrem Sohn Aurelius. Während der Vater seine Bemühungen vor allem darauf richtete, dem Sohn durch eine gute Ausbildung eine Karriere und den sozialen Aufstieg zu ermöglichen, ging der Ehrgeiz der Mutter viel weiter: Sie projizierte ihre gesamten Lebenshoffnungen auf diesen Sohn und setzte alles daran, seine geistige und religiöse Entwicklung zu beeinflussen.
Der Ehrgeiz des Sohnes war ähnlich stark wie der der Mutter, doch er richtete sich zunächst darauf, die Sprossen der Karriereleiter zu erklimmen. Klassische Bildung war dafür eines der bevorzugten Mittel, wobei die Rhetorik als akademisches Grundlagenfach galt: Seine Sache in mündlicher, freier, argumentativ gegliederter Rede vertreten zu können, war Voraussetzung für einen Erfolg in allen gesellschaftlichen Institutionen, sei es in der Politik, im Rechtswesen oder an der Universität. Durch sein Studium der Rhetorik im benachbarten Karthago löste sich Augustinus aus dem Milieu seiner Eltern, die diese Ausbildung unter großen persönlichen Opfern finanzierten. Nach Beendigung des Studiums und einer Lehrtätigkeit in Karthago nahm er auch Abschied von der nordafrikanischen Provinz und schaffte den Karrieresprung in die Zentren des Reiches: Er ging nach Rom und schließlich an die kaiserliche Residenz nach Mailand.
Augustinus liebte den weltlichen Erfolg, aber er erwarb klassische Bildung nicht nur aus beruflicher Notwendigkeit, sondern pflegte sie auch mit Leidenschaft. Er wurde ein großer Kenner der Literatur seiner lateinischen Muttersprache. Sein Stilgefühl prägte er an Vergils Aeneis aus, einem Werk, in dem er über viele Jahre jeden Tag las. Ciceros Schrift Hortensius führte ihn mit neunzehn Jahren in die Fragen der antiken Philosophie ein. In seiner damaligen Sicht standen die christlichen Evangelien den Werken der römischen Literatur stilistisch weit nach und enthielten auch philosophisch zu viele Ungereimtheiten: Ein Gott, der zugleich auch Mensch geworden ist? Der, obwohl allmächtig und allgütig, auch das Böse zugelassen hat? Eine Welt, die »erschaffen« wurde, also irgendwann einmal »begonnen« hat?
Sehr viel überzeugender erschienen ihm die Antworten der Manichäer, einer Religionsgemeinschaft, die sich auf den persischen Propheten Mani berief und im späten Römischen Reich viele einflussreiche Anhänger hatte. Die Manichäer sahen die Welt beherrscht von einem Dualismus, das heißt von zwei unterschiedlichen, sich bekämpfenden Prinzipien: dem Prinzip des Bösen und dem Prinzip des Guten. Die Welt verstanden sie als ewigen Kampf des Reiches des Bösen mit dem Reich des Guten. Die Manichäer waren vor allem aus zwei Gründen für Augustinus attraktiv: Sie konnten das Böse in der Welt erklären, und sie standen der antiken Philosophie mit ihrer Betonung der Vernunft aufgeschlossen gegenüber.
Beides zog Augustinus an. Doch es gab noch einen weiteren Grund, weswegen er neun Jahre lang einer ihrer Anhänger blieb. Die Manichäer bildeten in römischen Institutionen das, was man eine »Seilschaft« nennen könnte: ein Netzwerk von Beziehungen, das auch Augustinus in seiner akademischen Karriere immer wieder behilflich war.
Die Verbindung zu den Manichäern war es auch, die ihm die Stelle als Rhetoriklehrer an der kaiserlichen Residenz in Mailand verschaffte. Man hoffte, er werde den Gegenpart des dort residierenden christlichen Bischofs Ambrosius einnehmen. Doch die Begegnung mit Ambrosius führte im Gegenteil zu seiner Annahme des christlichen Glaubens, nach Kräften gefördert von der Mutter, die dem jungen Akademiker inzwischen nach Italien gefolgt war.
Der aus Trier stammende Ambrosius, einer der bekanntesten Kirchenlehrer des frühen Christentums, überzeugte den Intellektuellen Augustinus durch die Art, wie er den christlichen Glauben mit philosophischen Argumenten stützte. Ambrosius war als Theologe vom Neuplatonismus beeinflusst, einer von dem Philosophen Plotin im 3.Jahrhundert geprägten Strömung, die die Philosophie Platons in eine mystische Richtung fortentwickelte. Plotin behauptete, die gesamte Wirklichkeit sei durchdrungen von dem »Einen«, einem geistigen Prinzip, das in verschiedenen Graden in die Wirklichkeit »ausströmt« und an den Dingen teilhat. Vor allem aber lieferte der Neuplatonismus eine völlig andere Erklärung des Bösen als die Manichäer: Das Böse ist danach keine selbstständige, positive Kraft, sondern ein Mangel. Böse ist das, was sich von dem geistigen Urprinzip des Einen entfernt, was am wenigsten vom Einen durchdrungen ist. Das gilt besonders für alle materiellen Dinge. Diese neuplatonische Erklärung des Bösen hat Augustinus auch noch in den Bekenntnissen vertreten, wobei er das neuplatonische Eine mit dem christlichen Gott identifiziert.
Augustinus’ Bekehrung fand im Jahr 386 statt, als er gerade zweiunddreißig Jahre alt war. Sie war ein Wendepunkt, von dem an sein Leben sich radikal veränderte. Er gab nicht nur seine Tätigkeit als Rhetoriklehrer auf, sondern wählte die von vielen frühen Christen propagierte Lebensform des Zölibats. Er entschloss sich, zusammen mit Freunden ein zurückgezogenes, beinahe klösterliches Leben zu führen. Gemeinsam zogen sie zunächst in das nördlich von Mailand gelegene Landgut Cassiciacum, um sich ganz in religiöse Inhalte zu versenken und ein neues Leben zu beginnen. Erst nach einem Jahr ließ sich Augustinus in Mailand offiziell taufen.
Das Christentum hatte sich im späten Römischen Reich von einer orientalischen Sekte zur einflussreichsten Religion des Reiches entwickelt. Unter Kaiser Konstantin war den Christen 313 zunächst staatliche Toleranz garantiert worden. 391, fünf Jahre nach Augustinus’ Bekehrung, wurde es offiziell zur Staatsreligion erklärt. Doch die römische Bildungselite sah eher verächtlich auf diese plebejische und philosophisch unausgereifte Religion herab. Gelehrte bekannten sich eher verschämt oder heimlich zu ihr. Auch im Kaiserhaus hatte das Christentum noch Gegner. Augustinus wusste, dass Christsein für eine akademische Karriere nicht unbedingt förderlich war. Er wusste aber vermutlich auch, dass mit dieser Religion eine zukünftig sehr mächtige geistige Kraft heranwuchs, die ihm selbst, einem ehrgeizigen und stolzen Intellektuellen, Möglichkeiten der geistigen Einflussnahme bot.
Diese Möglichkeiten öffneten sich ihm sehr bald nach seiner Rückkehr in seine nordafrikanische Heimat. Auf Drängen der dortigen Christen empfing er zunächst die Priesterweihe und ließ sich wenig später auch zum Bischof der Stadt Hippo Regius machen. Er war damit ein offizieller Repräsentant des Christentums geworden, der in öffentlichen theologischen Kontroversen Stellung beziehen musste. In diesen ersten Jahren als Bischof, zwischen 397 und 401, entstanden die Bekennntisse.
Sie waren Teil eines kirchenpolitischen Kampfes zur Durchsetzung des Alleinvertretungsanspruchs der katholischen Kirche gegenüber anderen christlichen Glaubensrichtungen, aber auch Teil des Kampfes, den Augustinus führte, um seine Position innerhalb der Kirche durchzusetzen. Das Buch schrieb er in seiner ohnehin knapp bemessenen Freizeit. Als Bischof hatte er nicht nur seelsorgerliche Aufgaben, er musste auch weite Strecken zurücklegen, um an Zusammenkünften vom Kirchenvertretern teilzunehmen. Bischof in einer jungen, strukturell noch nicht gefestigten Kirche zu sein bedeutete Engagement rund um die Uhr.
Zwischen dem Bekehrungserlebnis und dem Abfassen der Bekenntnisse liegen somit mehr als zehn Jahre, in denen nicht nur im Leben des Augustinus, sondern auch in seinem Denken wichtige Entwicklungen stattfanden. Aus dem klassisch gebildeten Rhetor war ein Theologe, aus dem Liebhaber der antiken Kultur ein Eiferer gegen die weltliche Bildung geworden. Der Karriere-Intellektuelle hatte sich zu einem Intellektuellen im Dienst der Kirche gewandelt.
In den Bekenntnissen setzt sich Augustinus mit seiner Lebensgeschichte bis zu seiner Bekehrung auseinander. Doch es handelt sich nicht um eine normale Autobiografie. Die letzten Kapitel des Buchs haben sogar überhaupt nichts mehr mit dem Leben des Autors zu tun und widmen sich ganz der Ausdeutung der biblischen Schöpfungsgeschichte. Die Bedeutung des lateinischen Wortes »confessio« ist vielfältig: Es meint Sündenbekenntnis im Sinne einer Beichte, Glaubensbekenntnis und Gotteslob gleichermaßen. Die Bekenntnisse umfassen alle diese Bedeutungen. Sie sind ein persönliches, religiöses und philosophisches Bekenntnisbuch, aber auch ein Missionierungsbuch, das seine eigentliche Kraft erst dann entfaltet, wenn es vor einer Zuhörerschaft laut vorgelesen wird, wie es zu Augustinus’ Zeiten auch üblich war.
Das Buch enthält mindestens drei miteinander verwobene Themenbereiche beziehungsweise Auseinandersetzungen: eine theologische Auseinandersetzung, das heißt die von Augustinus vorgenommene Deutung der christlichen Lehre; damit eng zusammenhängend die Geschichte seiner eigenen geistigen und persönlichen Entwicklung bis hin zum Bekehrungserlebnis; und schließlich philosophische Fragestellungen, die weit über die Theologie hinausreichen und die westliche Philosophie bis heute beeinflusst haben.
Die »Bekenntnisse« des Augustinus sind also Bekenntnisse aus einer bestimmten Perspektive. Die eigene Lebensgeschichte soll als theologisches Exempel dienen, um Anhänger zu gewinnen und um für eine bestimmte Sicht des Glaubens zu werben. Im Mittelpunkt des Buchs steht das Bekehrungserlebnis. Alles, was vorher war, wird auf dieses Ereignis zulaufend, und alles, was später kam, von diesem Ereignis herrührend geschildert. Augustinus beschreibt seine Hinwendung zum Christentum als einen Vorgang, der sich in langen Jahren und in schweren inneren Kämpfen vorbereitet hatte und sich in einer Art Erleuchtung Durchbruch verschaffte. Die Bekenntnisse schildern das Leben des Augustinus vor seiner Bekehrung als einen von Gott inszenierten beispielhaften Glaubensfindungsprozess.
Das Werk enthält bereits vieles von dem, was später als augustinische Lehre in die christliche Theologie Eingang fand. Großen Einfluss auf diese Lehre übten die Schriften des Apostels Paulus aus, der im 1.Jahrhundert n.