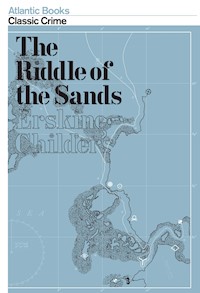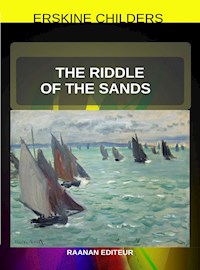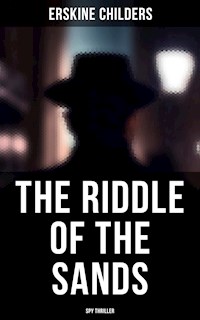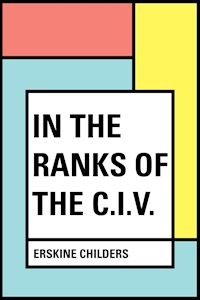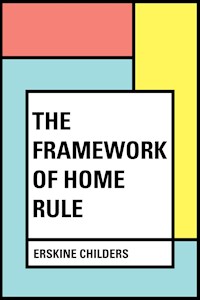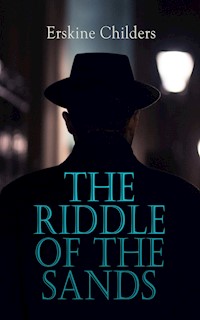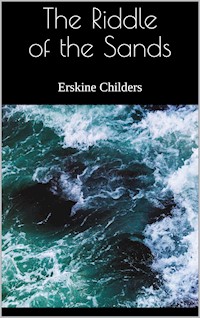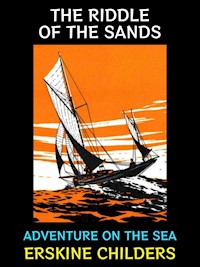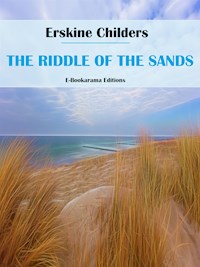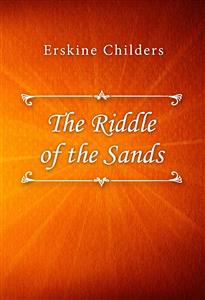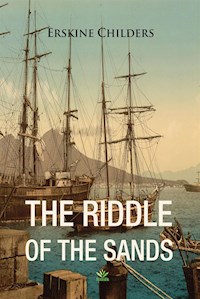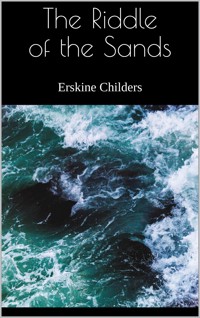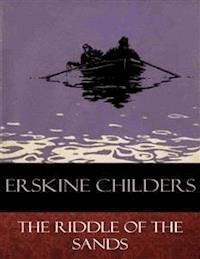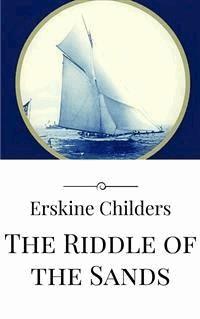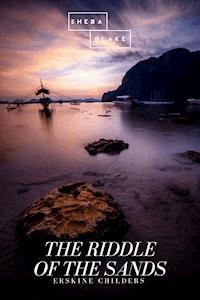19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
London Ende des 19. Jahrhunderts: Seine Perspektiven im Auswärtigen Amt sind gut, doch der Beamte Carruthers erträgt die Leere und Langeweile in seinem Leben nur schwer. Als sein Studienfreund Davies ihn zu einem Segeltörn auf der Nordsee einlädt, verliert er sich in der Phantasie von einer komfortablen Yacht mit Mannschaft. Doch Carruthers' Hoffnung auf einen erholsamen Urlaub stirbt schneller als gedacht: Die Dulcibella ist ein einfaches Segelboot, und entlang der Küste werden verdächtige deutsche Aktivitäten gemeldet. Was als harmloses Segelabenteuer beginnt, wird zu einer aufregenden Reise voller Intrigen, die tief in die gefährliche Welt der internationalen Spionage hineinführt. Unfreiwillig decken die Männer geheime deutsche Pläne zur Invasion Englands auf …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Erskine Childers
Das Rätsel der Sandbank
Kriminalroman
Aus dem Englischen und mit einem Nachwort von Wolfgang Gottschalk
Kampa
1Der Brief
Ich habe von Männern gelesen, die selbst dann eisern daranfesthielten, sich allabendlich zum Dinner umzukleiden, wenn sie für längere Zeit gezwungen waren, völlig abgeschieden von der Zivilisation zu leben, mit einer Handvoll Einheimischer als einzige Gesellschaft. Sie taten dies, um einem Rückfall in die Barbarei vorzubeugen und sich somit die Selbstachtung zu bewahren.
Unter ähnlichem Vorsatz legte auch ich eines Abends – genau gesagt an einem dreiundzwanzigsten September – in meiner Junggesellenbehausung in der Pall Mall komplette Abendgarderobe an. Zeit und Ort erwähne ich deshalb, weil ich meine, dass es eben diese Umstände waren, die mich zu einem Vergleich mit jenen Männern berechtigen, einem Vergleich, bei dem ich aus meiner Sicht sogar besser abschnitt, denn ich war schließlich nicht irgendein grobschlächtiger Verwalter irgendwo in Burma beispielsweise, sondern ein junger Mann aus besten Verhältnissen mit untadeligen Manieren, kannte die richtigen Leute, gehörte den richtigen Clubs an und hatte eine gesicherte, womöglich glänzende Zukunft im Foreign Office vor mir. Wenn man bedenkt, dass ich bei meinem Hang zur Geselligkeit dazu verurteilt war, die unsägliche Öde Londons während dieser Septembertage ertragen zu müssen, wird man mir eine gewisse Attitüde selbstgefälligen Märtyrertums nachsehen können.
Ich hatte das Gesellschaftsleben voll ausgekostet, solange es noch Einladungen und Begegnungen in Hülle und Fülle gab. Aber diese Kontakte waren seit Beginn der Ferien immer spärlicher geworden. Ein Freund nach dem anderen fuhr aufs Land zur Jagd, mit dem Versprechen, mir zu schreiben; dabei fehlte es nicht an scherzhaftem Beileid. So verließ alles das sinkende Schiff, und ich ergab mich grimmig in mein Schicksal.
Die ersten ein, zwei Wochen, nachdem sich meine Bekannten in alle Winde zerstreut hatten, genoss ich noch leidlich. Ich fand sehr bald heraus, dass es außer mir eine ganze Reihe ähnlich Unglücklicher gab. Zusammen machten wir nach Dienstschluss Bootsausflüge und dergleichen, aber ich habe die Themse mit ihrem lärmenden Pöbel noch nie gemocht, schon gar nicht zu dieser Jahreszeit. So schied ich aus dieser Frischluftkumpanei wieder aus und lehnte auch das Angebot von H. ab, in sein Landhaus am Fluss zu ziehen und von dort aus jeden Morgen in die Stadt zu fahren.
Ein paar Wochenenden verbrachte ich bei den Catesbys in Kent, aber ich war mitnichten untröstlich, als sie ihr Haus vermieteten und ins Ausland gingen, denn ich musste feststellen, dass dies alles in höchstem Maße unbefriedigend war. In der ersten Septemberwoche hatte ich schließlich alle Versuche aufgegeben und mich in den trostlosen, aber ehrbaren Trott von Büro und Häuslichkeit ergeben.
Einen Stich – auch wenn es nur ein Nadelstich war – versetzte mir meine Cousine Nesta. Sie schrieb: »Sicher ist es schrecklich für dich, jetzt in London schmoren zu müssen, aber auf der anderen Seite muss es doch ein großes Vergnügen sein, derartig interessante und wichtige Aufgaben zu haben!« Boshaftes kleines Biest! Dies nämlich war die Strafe für die – wie ich hoffe – verzeihliche, wenn auch hochstaplerische Art, in der ich meinen Verwandten und Bekannten die Wichtigkeit meiner Aufgaben dargestellt hatte, und natürlich auch den bewunderungsbereiten jungen Damen, die ich seit meinem Amtsantritt ausgeführt hatte. Beinahe glaubte ich schon selbst an mein Blendwerk. Aber die schlichte Wahrheit war einfach die: Meine Arbeit war weder interessant noch wichtig. Hauptsächlich rauchte ich Zigaretten und gab die Auskunft, Mr. Soundso sei in Urlaub, werde jedoch Anfang Oktober wieder zurück sein. Von zwölf bis zwei war ich zum Lunch, und in der verbleibenden Zeit verfertigte ich Exzerpte aus – sagen wir – weniger vertraulichen Konsularberichten, die ich sodann zu trockenen Memoranden zusammenstellte. Der Grund, warum ausgerechnet ich im Amt verbleiben musste, lag in der Laune einer hochgestellten Persönlichkeit. Dieser Mensch hatte all unsere mühsam ausgetüftelten Urlaubspläne einfach über den Haufen geworfen. Dadurch war unter anderem meine Absprache mit K. geplatzt, der sich bereit erklärt hatte, an meiner Stelle die Hundstage in Whitehall zu verbringen. So war nun das Maß meiner Verbitterung nahezu voll, und in dieser Stimmung zog ich mich an besagtem Abend zum Dinner um.
Nur noch zwei Tage, dann war meine Fron in dieser ausgestorbenen, brütenden Stadt zu Ende, und mein Urlaub begann. Jedoch, Ironie des Schicksals, wohin sollte ich dann gehen? Einladungen, die ich noch im Juli im Hochgefühl ausgeschlagen hatte, ein gefragter Mann zu sein, geisterten mir nun durch den Kopf. Zumindest die eine oder andere dieser Einladungen hätte ich wieder aufgreifen können, aber leider hatte man mich in keinem einzigen Fall erneut gebeten.
Meine Familie befand sich zurzeit wegen der Gicht meines Vaters in Aix-les-Bains, also in Frankreich. Mich ebenfalls dorthin zu begeben, wäre mir vorgekommen, als hätte ich den Notanker geworfen. Überdies beabsichtigten die Meinen, binnen Kurzem in unser Haus nach Yorkshire zurückzukehren, und bekanntlich gilt der Prophet im eigenen Lande recht wenig. Kurz und gut: Ich war am Rande der Verzweiflung.
Ein Schlurfen auf der Treppe zeigte mir an, dass es gleich klopfen würde. Wie erwartet trat Withers, der Hausdiener, ein und händigte mir auf seine blasierte Art einen in Deutschland frankierten Eilbrief aus. Zu den Dingen, die mich schon lange nicht mehr amüsierten, gehörte dieses laxe Benehmen der Dienstboten; selbst das passte zu dieser elenden Saison. Ich war gerade mit dem Umkleiden fertig und im Begriff, Geld und Handschuhe zusammenzusuchen, als ich mich in einer jähen Anwandlung von Neugier wieder setzte und den Brief öffnete. In einer Ecke des Kuverts war die verwischte Mitteilung zu erkennen: »Entschuldige, noch eine Sache: 1 Paar Wantenspanner, 1 3/8 Zoll, verzinkt, von Carey & Neilson.« Hier nun der Brief:
Yacht Dulcibella
Flensburg / Schleswig-Holstein
21. September 1903
Lieber Carruthers,
ich kann mir vorstellen, dass du überrascht sein wirst, von mir zu hören, da es ja fast eine Ewigkeit her ist, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Was ich dir vorschlagen möchte, wird dir höchstwahrscheinlich nicht zupasskommen, denn ich weiß ja nichts von deinen Urlaubsplänen. Falls du überhaupt in London sein solltest, schmeißt du dich vermutlich gerade wieder ins Geschirr und bist unabkömmlich. So schreibe ich eigentlich aufs Geratewohl, um dich zu fragen, ob du nicht Lust hast herzukommen, um ein bisschen mit mir zu segeln und – wie ich hoffe – auch Enten zu schießen. Ich weiß, du bist ein passionierter Jäger, und irgendwie meine ich mich auch zu erinnern, dass du gesegelt bist. Dieser Teil der Ostsee hier, die Förden, sind ein prächtiges Segelrevier – prima Gegend! Bald müsste es hier auch massenhaft Enten geben, sobald es kalt genug ist. Ich bin Anfang August losgesegelt, über Holland und die Ostfriesischen Inseln. Leider musste mein Kamerad weg, daher brauche ich dringend jemanden, denn ich möchte doch nicht wegen einer solchen Lappalie schon jetzt ins Winterlager gehen. Ich muss wohl nicht betonen, wie sehr ich mich freuen würde, wenn du kämst! Wenn möglich, schicke mir ein Telegramm an das hiesige Postamt. Die beste Reiseroute für dich dürfte via Vlissingen / Hamburg sein. Ich habe hier noch ein paar Dinge zu reparieren, bin aber bestimmt damit fertig, wenn du ankommst. Bring deine Flinte und reichlich Entenschrot mit, und besorge dir Ölzeug, möglichst die Sorte zu 11 Shilling, Jacke und Hose extra, nicht diesen vornehmen Yachtplunder! Ich weiß, du sprichst fließend Deutsch, das wird eine große Hilfe für mich sein. Verzeih mir diesen Wust von Aufträgen, aber ich habe das unbestimmte Gefühl, dass ich Glück habe und du kommen wirst! Wie auch immer: Ich hoffe, dass es dir und deinem Amt gut geht. Auf bald!
Dein Arthur H. Davies
P.S. Würdest du bitte noch einen Handpeiler und ein Pfund Raven-Mixture Pfeifentabak mitbringen?
Dieser Brief leitete für mich einen neuen Lebensabschnitt ein, aber davon ahnte ich noch nichts, als ich ihn in die Tasche steckte und mich lustlos auf meinen gewohnten abendlichen Leidensweg in den Club begab.
Es war ein fremder Club, dem ich zustrebte, denn meine beiden üblichen hatten gleichzeitig wegen Renovierung geschlossen. Es war, als hätte es die Vorsehung eigens darauf abgesehen, mir Unbehagen zu bereiten. Die Clubs, die man in solchen Fällen ersatzweise aufsuchen darf, wirken immer irritierend und unbehaglich. Die wenigen Besucher kommen einem merkwürdig und kauzig vor, man fragt sich, was sie eigentlich dort suchen. Das einzige Wochenblatt, das einen interessiert, ist natürlich nicht vorhanden, das Dinner unmöglich, die Belüftung eine Farce. All diese Übel deprimierten mich auch an diesem Abend. Und dennoch: Auf rätselhafte Weise begannen sich tief in mir die Lebensgeister wieder zu regen, ohne jeden ersichtlichen Grund, wie mir schien.
An Davies’ Brief konnte es nicht liegen. Segeln in der Ostsee – und das Ende September! Der bloße Gedanke ließ mich schaudern! Segeln vor unserem schönen Seebad Cowes, in angenehmer Gesellschaft und mit Hotels zum Übernachten – darüber ließe sich reden! Oder eine Kreuzfahrt auf einem Dampfschiff entlang der französischen Küste oder zu den schottischen Highlands – das wäre noch angegangen, aber im August, wohlgemerkt, nicht später! Was für eine Art von Yacht mochte das sein, mit der Davies unterwegs war? Eine gewisse Größe musste sie schon haben, sonst hätte sie eine solche Reise nicht bewältigen können.
Andererseits glaubte ich mich zu erinnern, dass Davies’ Mittel für einen solchen Luxus schwerlich reichen konnten. Das brachte mich auf den Mann selbst.
Ich hatte ihn in Oxford kennengelernt. Er gehörte zwar nicht zu meinem engeren Kreis, aber wir waren nun einmal ein geselliges College, und so hatte ich ihn des Öfteren getroffen. Mir gefiel seine Energie, die sich mit einer gewissen Einfachheit und Bescheidenheit verband. Eigentlich hatte er so recht nichts, worauf er sich etwas hätte einbilden können. Aber ich mochte ihn, in der Art, wie man in diesen Jahren der Entwicklung viele mag, die man später aus den Augen verliert. Wir hatten beide zusammen das College verlassen, drei Jahre war das nun her. Ich war anschließend nach Frankreich und Deutschland gegangen, um Sprachstudien zu treiben. Seine Bewerbung für den Öffentlichen Dienst in Indien war abgelehnt worden, worauf er in eine Anwaltskanzlei eintrat. Seither hatte ich ihn nur in größeren Abständen gesehen. Ich muss zugeben, dass er stets treu versucht hatte, den Kontakt zwischen uns aufrechtzuerhalten. Aber, wie es nun einmal in der Natur der Dinge liegt, hatten sich unsere Wege getrennt. Ich hatte eine vorteilhafte Position angenommen, und nach meinem Debüt in der Londoner Gesellschaft sahen wir uns nur noch wenige Male, wobei ich mit Bedauern feststellte, dass es zwischen uns nichts Gemeinsames mehr gab. Er kannte keinen meiner Freunde, ging nachlässig gekleidet, kurz: Ich hielt ihn für langweilig.
Sein Name verband sich für mich schon immer mit Segelbooten und Salzwasser, niemals aber mit Yachtsport. Einmal während unserer Studienzeit hätte er mich beinahe überredet, mit ihm eine Woche auf einem offenen Boot zu verbringen, das er irgendwo aufgetrieben hatte und mit dem er an der Ostküste zwischen trostlosen Schlickbänken herumsegeln wollte.
Derweil verlief das Dinner wie eine Trauerfeier. Beim Hauptgericht fiel mir plötzlich ein, dass ich erst kürzlich um sieben Ecken etwas Neues über Davies gehört hatte, aber was das war, daran konnte ich mich nicht mehr erinnern. Ehe ich noch beim Nachtisch angelangt war, hatte ich beschlossen, das Ganze einfach als Witz zu betrachten, was in gewisser Weise dann auch auf den Nachtisch zutraf. War es nicht reine Ironie, nach dem Schiffbruch meiner schönen Urlaubspläne nun als Trostpflaster die Einladung zu erhalten, den Oktober auf der kalten Ostsee zuzubringen? Und das mit einem Niemand, der mich langweilte! Doch als ich im scheußlichen Prunk des Rauchsalons an meiner Zigarre sog, kam mir die Sache von Neuem in den Sinn. Sollte ich vielleicht doch zugreifen? Viel Auswahl blieb mir wahrlich nicht!
Wie auch immer: Der Gedanke, sich zu dieser schauderhaften Jahreszeit auf die Ostsee stürzen zu wollen, hatte etwas von tragischem Heldenmut an sich.
Ich holte den Brief wieder hervor und überflog das impulsive Staccato seiner Sätze. Dabei versuchte ich geflissentlich darüber hinwegzulesen, wie viel frische Luft, gute Laune und Kameradschaft das unscheinbare Stück Papier in diesen öden Clubraum wehte. Auf der anderen Seite aber waren da einige Wendungen, die bei näherer Betrachtung nichts Gutes verhießen.
»Prima Gegend«, stand da zu lesen – aber was war mit Herbststürmen und Oktobernebel? Jeder vernünftige Yachteigner musterte jetzt seine Crew ab! »Bald müsste es hier auch massenhaft Enten geben« – vage, sehr vage! »Sobald es kalt genug ist« – Kälte und Yachtsport, diese Verbindung erschien mir geradezu ungeheuerlich! Sein Kamerad hatte ihn verlassen – warum eigentlich? »Nicht diesen vornehmen Yachtplunder« – und warum nicht? Nichts über Größe, Einrichtung und Mannschaftsstärke der Yacht – alles fröhlich übergangen, lauter weiße Flecken, einfach blödsinnig! Und dann: wozu um Himmels willen einen Handpeiler?
Ich blätterte danach noch in ein paar Magazinen herum und machte ein Spielchen mit einem freundlichen alten Knaben, der mich derart beharrlich darum anging, dass es zu viel Mühe gekostet hätte, ihn abzuwimmeln. Dann kehrte ich in meine Behausung zurück und ging zu Bett, nicht ahnend, dass ein freundliches Geschick mir zu Hilfe geeilt war.
2Die Dulcibella
Dass ich zwei Tage später, eine Fahrkarte nach Flensburgin der Tasche, das Deck des Dampfers nach Vlissingen auf und ab schritt, mag seltsam erscheinen, aber vielleicht doch nicht so seltsam, wenn man sich in meinen damaligen Zustand versetzt. Der Leser wird schon erraten haben: Ich war aufgebrochen wie jemand, der eine Strafe auf sich nimmt. Dabei war ich nicht ohne Hintergedanken: Ich malte mir die Gerüchte darüber aus, was ich vorhatte. Ein bisschen Reue, mich vernachlässigt zu haben, konnte meinen Leuten nicht schaden, während für mich immerhin die Möglichkeit bestand, mich ohne ihr Wissen zu vergnügen.
Jedenfalls empfand ich beim Frühstück am Morgen nach Erhalt des Briefes immer noch dieses unerklärliche Gefühl der Erleichterung, das ich schon erwähnt habe. Es erwies sich als stark genug, um alle Argumente für und wider das Vorhaben noch einmal durchzugehen. Ein Umstand, an den ich bisher noch gar nicht gedacht hatte, sprach für die Unternehmung: Ich würde unbestritten ein gutes Werk tun, wenn ich Davies zu Hilfe kam, denn er hatte geschrieben, er brauche einen Kameraden.
Als ich an diesem Tag ins Amt kam, hatte ich einen prächtigen Vorwand, den Bürodiener Carter anzuweisen, eine große Wandkarte von Deutschland herbeizuschaffen und darauf Flensburg zu suchen. Letzteres hätte ich ihm wohl ersparen sollen, aber es tat ihm gut, wenn er beschäftigt wurde, außerdem amüsierte mich seine geduldige Hilflosigkeit. Mit dem größten Teil der Karte war ich leidlich vertraut, denn ich hatte meine Zeit in Deutschland genutzt. Deutschlands Bewohner, seine Geschichte, Entwicklung und Zukunft hatten mich seit jeher lebhaft interessiert, und ich hatte Freunde in Dresden und Berlin. Zu Flensburg fiel mir sofort der Deutsch-Dänische Krieg von 1864 ein.
Als Carters Bemühungen endlich von Erfolg gekrönt waren, hatte ich schon fast vergessen, welche Aufgabe ich ihm gestellt hatte. Inzwischen war ich nämlich wieder ins Grübeln geraten. Nach allem, was ich wusste, war Schleswig-Holstein ein schönes Land, aber lohnte sich ein Besuch unter den gegebenen Umständen: vorgerückte Jahreszeit, wenig attraktive Gesellschaft und was es sonst noch an Schattenseiten gab?
Dennoch fehlte nur noch wenig zu meiner endgültigen Entscheidung, und ich denke, dass es die Rückkehr von K. aus der Schweiz war, die den letzten Anstoß gab. Aufreizend sonnenverbrannt begrüßte er mich: »Hallo, Carruthers! Immer noch hier? Ich denke, Sie sind längst weg! Haben Sie ein Schwein, altes Haus, gerade jetzt in Urlaub zu gehen – beste Zeit für Treibjagden und die ersten Fasane! Die Hitze da unten war einfach blödsinnig. Carter, bringen Sie mir doch mal den Bradshaw!«
Ja richtig – das Eisenbahn-Kursbuch! Ein außerordentliches Ding, dieser Bradshaw, man kann darin herumstöbern, auch wenn kein direkter Anlass vorhanden ist, genau wie Männer während der Schonzeit an ihrer Jagdausrüstung herumpusseln. Als K. den Fahrplan beiseitelegte, ließ ich ihn mir geben und begann ihn zu studieren.
Gegen Mittag war alle Unentschlossenheit von mir gewichen, und ich beauftragte Carter, ein Kabel an Davies aufzugeben, Flensburg, postlagernd, mit folgendem Wortlaut:
DANKE STOP EINTREFFE SONNABEND 2134 UHR STOP CARRUTHERS
Schon wenige Stunden später kam die Antwort:
FREUE MICH STOP BITTE MITBRINGEN RIPPINGILLE OFEN MODELL 3 STOP
DAVIES
Eine Anweisung, die mich schon im Voraus frösteln machte. Mein Entschluss geriet immer wieder ins Wanken, so zum Beispiel, als ich abends meine Schrotflinte hervorholte und an die schönen Moorhühner dachte, die ich anstelle von Enten schießen könnte, oder als ich die bunte Liste der Aufträge zusammenstellte, die in Davies’ Brief verstreut waren und die es auszuführen galt. Es wollte mir scheinen, als würde ich dadurch zum bloßen Werkzeug, während ich doch die Rolle des gönnerhaften Helfers für mich ausersehen hatte.
Zuerst besorgte ich in der Waffenhandlung Lancaster »reichlich« Entenschrot und gab Anweisung, das schwere Paket an meine Adresse zu schicken.
Sodann kaufte ich das Pfund Raven-Mixture, mit jenem Schuldbewusstsein, das sich immer dann einstellt, wenn man für andere schmuggeln soll. Wo zum Kuckuck Carey & Neilson sein sollte, fragte ich mich vergebens, doch Davies sprach von dieser Firma, als sei sie ebenso bekannt wie die Bank von England. Dabei handelte es sich vermutlich nur um irgend so einen Laden für »Wantenspanner« – was immer das sein mochte! Aber es klang, als seien sie wichtig, daher galt es, die Dinger aufzutreiben.
Im Warenhaus fragte ich nach einem »Rippingille Modell 3« und wurde prompt mit einem gewaltigen, scheußlichen Monstrum aus Eisen konfrontiert, das zwei voluminöse Brennstofftanks hatte und den Gestank von heißem Petroleum vorausahnen ließ. Überzeugt von seiner grimmigen Wirksamkeit kaufte ich den Ofen, stellte jedoch Überlegungen an, welche Bedingungen an Bord es wohl erforderlich machten, ihn eigens per Telegramm nachzubeordern.
In der Sportabteilung erkundigte ich mich nach Wantenspannern und erfuhr, sie seien nicht am Lager, ich könne sie jedoch mit Sicherheit bei Carey & Neilson erhalten, in den Minories, also im äußersten Osten der Stadt. Das bedeutete für mich eine Reise fast so weit wie nach Flensburg, bloß doppelt so ermüdend! Außerdem würde der Laden längst geschlossen haben, wenn ich dort ankam. Daher fuhr ich kurz entschlossen in einer Droschke nach Hause – einen Teil der Aufträge hatte ich ja wenigstens erledigen können. Ich unterließ es, mich zum Abendessen umzuziehen – ein epochales Ereignis! Aus der Küche im Souterrain ließ ich mir ein Kotelett kommen und verbrachte den Rest des Abends mit Packen und Schreiben, mit der Schicksalsergebenheit eines Mannes, der seinen Letzten Willen zu Papier bringt.
So ging die letzte dieser stickigen Nächte vorüber. Der erstaunte Withers sah mich schon um acht frühstücken. Um halb zehn war ich bereits dabei, Wantenspanner zu begutachten. Ich bestand nachdrücklich auf »eindreiachtel Zoll« und »verzinkt«, nahm aber ansonsten die Dinger unbesehen mit, ohne die geringste Ahnung von ihrer Funktion zu haben. Wegen des Ölzeugs zu elf Shilling wurde ich an eine Räuberhöhle in einer Seitengasse verwiesen, wo ein schmieriger, schmuckbehangener Händler mit mir um zwei übelriechende orangefarbene Pellen feilschte. Er begann bei 18 Shilling. Der Gestank der Dinger veranlasste mich, vorzeitig bei 14 aufzugeben. Danach eilte ich mit meinen beiden unansehnlichen Paketen zurück ins Amt, wo ich um elf zu erscheinen hatte. Das eine machte sich in der stehenden Büroluft dermaßen bemerkbar, dass Carter mich zuvorkommend fragte, ob er es wohl zu mir nach Hause schicken solle, und K. legte wegen dieser Pakete eine an Inquisition grenzende Neugier an den Tag. Ich gab mir jedoch nicht die geringste Mühe, ihn aufzuklären, denn ich wusste, seine neiderfüllten Kommentare würden mich ärgern und herausfordern.
Später fiel mir der Handpeiler wieder ein. Ich bestellte ihn kurzerhand telegraphisch bei Carey & Neilson, ziemlich erleichtert, dass ich auf diese Weise nicht über Details Rede und Antwort stehen musste. Die Antwort der Firma jedoch lautete:
NICHT AM LAGER STOP AN MESSINSTRUMENTENMACHER WENDEN
Dies stellte mich vor neue Schwierigkeiten, aber nun wusste ich doch wenigstens, dass das Gesuchte ein Messinstrument war!
Im Laufe des Tages verfasste ich meine letzten Memoranden und übergab sie meinem derzeitigen Vorgesetzten, dem genialisch-milden M., der mir für meinen Urlaub viel Vergnügen wünschte.
Abends gegen sieben ließ ich eine Droschke mit meinem Reisegepäck nebst einem Sammelsurium von unhandlichen Paketen beladen: dem Ergebnis meiner Besorgungen. Wegen des verdammten Handpeilers musste ich noch zwei Umwege fahren, sodass ich fast meinen Zug verpasst hätte. Aber in der Nähe der Victoria-Station fand ich endlich das Gesuchte in einem jener Läden, die von außen wie Juweliergeschäfte aussehen, in Wirklichkeit aber nichts anderes sind als ordinäre Pfandleihen. Das rätselhafte Ding entpuppte sich als ein Kompass mit einer Art Handgriff, versehen mit Kimme und Korn wie ein Gewehr und mit einer prismatischen Linse obendrauf.
Um halb neun hatte ich den Staub Londons von den Füßen geschüttelt, und um halb elf schritt ich, wie schon erwähnt, das Deck der Fähre nach Vlissingen auf und ab. Begleitet von einem westlichen Lufthauch, den ein mittägliches Gewitter abgekühlt hatte, glitt unser Schiff durch die ruhigen Wasser der Themsemündung, passierte die Reihe der funkelnden Feuerschiffe, die wie eine Postenkette um ein schlafendes Heer den Zugang zu unserer Kapitale bewachen, und entschwand schließlich in die dunkle Weite der Nordsee. Die Sterne schienen hell, Sommerdüfte, von der Steilküste der Grafschaft Kent herübergeweht, mischten sich zaghaft mit den Schiffsgerüchen. Das sommerliche Wetter schien fortzudauern. Ich hatte das Empfinden, neu geboren zu sein, wie es den neurotischen Städter ergreift, wenn er einmal die Stadtluft hinter sich gelassen hat.
Nun konnte ich die Dinge in aller Ruhe auf mich zukommen lassen. Hielt das gute Wetter an, konnte ich ein, zwei annehmbare Wochen mit Davies verbringen.
Wenn nicht, dann konnte ich mich ohne Weiteres von dieser fragwürdigen Entenjagd zurückziehen. Frostige Umstände würden Davies in jedem Fall zwingen, seine Yacht ins Winterlager zu geben, denn in dieser fortgeschrittenen Jahreszeit konnte er kaum noch daran denken, nach Hause zu segeln. Ich aber konnte dann die günstige Gelegenheit nutzen, ein paar Wochen in Dresden oder anderswo zu verbringen. Das war ein Programm, das sich sehen lassen konnte, und ich ging in meine Koje.
Die Ereignisse des nächsten Tages, eine stickige Bahnfahrt von Vlissingen nach Flensburg, sind nicht der Rede wert. Da waren Deiche, Windmühlen, stille Kanäle, später leuchtende Stoppelfelder und lärmende Städte, dann schließlich nach Anbruch der Dämmerung eine ruhige, flache Landschaft, durch die mein Zug von einer verschlafenen Station zur nächsten bummelte. Um zehn befand ich mich endlich, steif und gerädert, auf dem Bahnsteig in Flensburg und wurde von Davies begrüßt: »Großartig, dass du gekommen bist!«
»Und ich finde es fabelhaft, dass du mich eingeladen hast!«, erwiderte ich. Beide waren wir befangen. Was nun Davies betraf: Selbst im spärlichen Licht der Bahnsteiglampen konnte es mir nicht entgehen, dass er in keiner Weise meiner Vorstellung von einem Yachtsegler entsprach. Keine blütenweißen Hosen, kein adrettes blaues Klubjackett. Wo war die weiße Seglermütze, dieses Zauberding, das im Nu sogar eine Landratte in einen stilechten Segler verwandelt? Im Bewusstsein, ebendiesen imponierenden, perfekten Dress in meinem Gepäck mitzuführen, überkam mich ein gewisses Schuldgefühl, denn Davies trug eine alte Norfolkjacke, ungeputzte braune Schuhe und Flanellhosen, die möglicherweise früher einmal weiß gewesen sein mochten, sowie eine gewöhnliche Tweedmütze. Die Hand, die er mir reichte, war schwielig und mit Farbe beschmiert, die andere, in der er ein Päckchen hielt, trug einen Verband, der augenscheinlich dringend der Erneuerung bedurfte.
Einen Augenblick musterten wir uns gegenseitig, er verstohlen, jedoch durchdringend, als prüfe er: Bist du’s noch? Es war Besorgnis in diesem Blick, aber auch – man verzeihe mir! – ein Anflug von Bewunderung. Ich hingegen konnte nur feststellen, dass er sich kaum verändert hatte.
Der peinliche erste Augenblick ging vorüber. Wir schlenderten den Bahnsteig hinunter zu meinem Gepäck, wobei wir belangloses Zeug redeten.
»Übrigens«, sagte Davies plötzlich, »ich biete wohl keinen besonders salonfähigen Anblick, fürchte ich, aber es ist ja dunkel, nicht wahr? Ich habe nämlich den lieben langen Tag das Boot angestrichen und bin gerade fertig damit. Hoffentlich kriegen wir morgen ein bisschen Wind, bis jetzt war leider hoffnungslose Flaute. Mann, hast du eine Masse Zeugs mitgebracht!«
»Du hast mir aber auch einen hübschen Batzen Aufträge erteilt!«, erwiderte ich spitz.
»Ach, die Sachen meine ich doch nicht«, sagte Davies abwesend. »Vielen Dank übrigens, bei der Gelegenheit! Ah – das hier ist sicher der Ofen, und dies dem Gewicht nach die Schrotpatronen. Und – die Wantenspanner hast du hoffentlich auch gekriegt? Natürlich sind sie nicht unbedingt notwendig« – hierzu nickte ich ausdruckslos und ein wenig gekränkt – »aber sie sind handlicher als Taljereeps oder Jungfern, und hier sind sie nicht aufzutreiben. Nein, versteh mich recht – es handelt sich um das Ungetüm da!«, sagte er langsam, indem er meinen Kabinenkoffer zweifelnd musterte. »Nun ja, wir werden es versuchen. Mit der Reisetasche allein könntest du wohl nicht auskommen? Verstehst du – der Platz im Boot … und dann das enge Schiebeluk … egal, wir versuchen es! Ich fürchte, es sind keine Droschken da, aber wir haben es ja nicht weit zum Hafen, und ich hole uns Hilfe.«
Böse Ahnungen überkamen mich, während Davies einen Dienstmann herbeirief, meine Reisetasche schulterte und nach einem der Pakete griff.
»Ist denn keiner von deiner Mannschaft hier?«, fragte ich zaghaft.
»Mannschaft?« Er blickte mich verdutzt an. »Oh, natürlich hätte ich es dir schreiben sollen: Ich habe niemals eine Crew gehabt, das Boot ist nämlich ziemlich klein, weißt du? Ich hoffe, du hast keinen Luxusdampfer erwartet! Ich habe das Boot zeitweilig sogar einhand[1] gesegelt. Eine Crew wäre da nutzlos, ja geradezu eine Last!«
Diese erschreckenden Wahrheiten brachte er ganz munter hervor, wobei er jedoch aufmerksam beobachtete, wie das alles auf mich wirkte.
Unser Aufbruch geriet ins Stocken. »Ist es nicht ziemlich spät, um jetzt noch an Bord zu gehen?«, sagte ich steif. Irgendjemand löschte gerade die Gaslaternen. Der Dienstmann gähnte ostentativ. »Ich denke, ich schlafe heute lieber im Hotel!«
Eine angespannte Pause folgte.
»Tja, natürlich kannst du das«, sagte Davies sichtlich bekümmert. »Aber es lohnt doch nicht, den ganzen Kram erst zu einem der Hotels zu schleppen – die sind nämlich alle auf der anderen Hafenseite – und dann das Ganze morgen zurück zum Anleger! Glaub mir, mein Boot ist ganz komfortabel, und müde, wie du bist, wirst du bestimmt gut schlafen!«
»Aber wir könnten doch das Gepäck aufgeben und mit der Reisetasche rüberlaufen!«, wandte ich ein.
»Also – ich muss auf jeden Fall zurück an Bord«, entgegnete er. »Ich schlafe nie an Land!«
Offensichtlich wollte er mich um jeden Preis sofort auf sein Schiff verfrachten. Lähmende Resignation überfiel mich. Vielleicht war es wirklich besser, den Dingen ins Auge zu blicken und die Sache hinter mich zu bringen.
»Also los!«, sagte ich grimmig. Schwerbeladen stolperten wir über Bahngleise und Schutthaufen und erreichten den Hafen. Während ich den Dienstmann entlohnte, ging Davies voraus zu einer Steintreppe am Ufer, deren algenbewachsene Stufen sich im Dunkel verloren.
»Wenn du schon mal in das Beiboot steigen würdest, dann reich ich dir die Sachen rüber!«, sagte Davies.
Vorsichtig tastete ich mich die Stufen hinunter, als einzigen Halt eine glitschige Leine, die an einer winzigen Nussschale von Boot endete.
»Festhalten!«, rief Davies vergnügt, als ich mich am Fuß der Treppe unfreiwillig hingesetzt hatte, einen Fuß im Wasser. Bei dieser Gelegenheit stellte ich fest, dass meine Manschetten und Hosenbeine bereits beschmiert waren. Niedergeschlagen kletterte ich in das Boot und harrte der Dinge.
»Jetzt verhol mal das Boot an die Kaimauer und mach an dem Ring da fest!«, erscholl es von oben. Von dort kam auch die nasse Festmacherleine geflogen und schlug mir die Mütze vom Kopf. »Alles fest? Ist egal, was für’n Knoten!«, vernahm ich. Dann wurde ein riesiges, dunkles Etwas auf mich herabgelassen: mein Schrankkoffer. Quergelegt füllte er den ganzen Raum zwischen den Sitzbänken, den sogenannten Duchten.
»Passt er rein?«, kam die besorgte Frage von oben.
»Bestens!«
»Ist ja großartig!«
Mich an der schmierigen Mauer festkrallend, nahm ich nacheinander die Sachen in Empfang und verstaute alles, so gut ich konnte. Je höher die Ladung anwuchs, desto tiefer tauchte das Boot ein.
»Fang!«, war die letzte Anweisung von oben, und ein weiches, feuchtschweres Päckchen traf mich an der Brust. »Pass auf, das ist Fleisch! Jetzt wieder zurück zur Treppe!«
Ich gehorchte mühsam, und Davies stieg an Bord.
»Eine schöne Fracht ist das geworden«, sagte er sinnend. »Wir haben kaum noch Freibord[2], aber es wird schon gehen! Setz du dich nach achtern, und ich rudere!«
Völlig perplex fragte ich mich, wie diese riesige Pyramide gerudert werden sollte, ohne unterwegs umzukippen. Ich kroch auf die hintere Bank, während Davies die unter dem Gepäck begrabenen Ruder mit kurzen Rucken hervorholte, die unsere Nussschale besorgniserregend zum Schaukeln brachten. Wie er auf seinem Platz noch rudern wollte, war mir schleierhaft, da nur noch sein Kopf zu sehen war. Aber immerhin bewegten wir uns schwerfällig auf das freie Wasser hinaus.
Wie es schien, verließen wir den Scheitelpunkt einer schmalen Bucht. Dabei ließen wir die Lichter der Stadt hinter uns. Zu unserer Linken erstreckte sich eine langgezogene Front erleuchteter Kaianlagen. Hin und wieder wurde die Silhouette eines Schiffes schwach erkennbar. Wir passierten das letzte der Lichter und gelangten auf eine breitere Wasserfläche, auf der eine schwache Brise wehte und dunkle Höhen an beiden Ufern aufragten.
»Ich liege ein bisschen weiter die Förde runter, weißt du?«, sagte Davies. »Ich kann es nicht leiden, so nahe bei einer Stadt zu sein. Außerdem habe ich es von meinem Ankerplatz nicht weit zu einer Bootswerft. Ich bin ja gespannt, wie dir meine Dulcibella gefällt!«
Es dauerte nicht lange, und wir liefen in eine kleine, baumumstandene Bucht und näherten uns einem Licht, das vom Mast eines kleinen Fahrzeugs flackerte, dessen Umrisse nach und nach sichtbar wurden.
»Schön abhalten!«, befahl Davies, als wir längsseits gingen. Im Nu war er an Deck gesprungen, hatte die Vorderleine festgemacht und tauchte nun an meinem Ende auf. »Du gibst hoch, und ich nehme ab!«
Das war eine mühselige Arbeit, zum Glück mussten die Sachen nicht weit gereicht werden. Als alles an Bord war, folgte ich nach und glitt auf dem wabbligen Fleischpaket aus, das durch Feuchtigkeit Auflösungserscheinungen zeigte.
Bilder gingen mir durch den Kopf: meine letzte Einschiffung an Bord einer richtigen Yacht, mein untadeliger Dress, die dienstbeflissenen Matrosen, die mich an Bord gerudert hatten, das Fallreep, lack- und messingglänzend in der Augustsonne, die aufgeklarten, gescheuerten Decks und die Korbstühle achtern unter dem Sonnensegel. Was für ein Gegensatz zu diesem unerfreulichen, mitternächtlichen Herumwühlen zwischen aufgeweichtem Fleisch und einem Wirrwarr von Gepäckstücken! Das Bitterste aber war mein wachsendes Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit und Unwissenheit, das mir bisher auf Yachten niemals gekommen war.
Davies hatte inzwischen erneut über meinen Schrankkoffer nachgegrübelt, wenn auch ohne Resultat. Aufmunternd sagte er: »Ach was, ich werde dich erst einmal unten herumführen« – er sagte doch tatsächlich herumführen! –, »nachher räumen wir alles weg und gehen schlafen.«
Er tauchte die wenigen Stufen in die Kajüte hinunter, ich folgte vorsichtig. Ein penetranter Geruch von Petroleum, Küchendünsten, Tabakrauch und Teer schlug mir entgegen.
»Pass auf, dein Kopf!«, sagte Davies, während er ein Streichholz anriss und eine pendelnde Petroleumlampe anzündete. Ich hangelte mich hinunter. »Setz dich hin, dann hast du besseren Überblick!«
Es mag etwas Spott in diesem Rat mitgeschwungen haben, denn sicherlich bot ich eine lächerliche Figur, wie ich da unbeholfen und argwöhnisch um mich blickte, den Kopf eingezogen, um nicht an das Kajütdach zu stoßen, das in dem Halbdunkel noch niedriger schien, als es ohnehin war.
»Du siehst«, sagte Davies voller Stolz, »es ist massenhaft Platz, man kann aufrecht sitzen.« Das entsprach zwar der Wahrheit, nur – ich war nicht eben groß, und Davies eher klein.
»Weißt du, manche Leute legen Wert auf Stehhöhe, aber mir macht das gar nichts! Das da ist übrigens der Schwertkasten«, erklärte er, als ich mich beim Ausstrecken der Beine an einer scharfen Kante gestoßen hatte. Da dieses teuflische Hindernis unter der Tischplatte verborgen war, hatte ich es nicht bemerkt. Es verlief in Längsrichtung des Bootes, sah aus wie ein langes, flaches Dreieck und teilte den ohnehin beschränkten Kajütraum praktisch in zwei Hälften.
»Durch das aufholbare Schwert hat die Dulcibella wenig Tiefgang, verstehst du?«, erläuterte Davies. »Dadurch kannst du mit ihr fast jedes Gewässer befahren. In tiefem Wasser lässt man das Schwert runter, in flachem holt man es auf.«
Allmählich hatten sich meine Augen an das spärliche Licht gewöhnt. Ich nahm nun den Rest meiner Umgebung in Augenschein, der in wenigen Sätzen zu beschreiben ist. Die Kajüte war flankiert von zwei gepolsterten Bänken, »Sofas« genannt, an die sich nach achtern jeweils ein Schrank anschloss. Einer davon war halbhoch und sah aus wie ein Miniatur-Sideboard. Darauf stand eine Art Ofen, in dem ich sofort einen kleineren Bruder des Rippingille 3 erkannte. Davies zündete ihn an und setzte einen Wasserkessel auf. »Ich mache uns erst einmal einen richtigen Grog«, verkündete er.
Ich blickte mich weiter um. Über dem Sideboard hing ein Gestell mit Gläsern. Das Kajütdach war an den Seiten besonders niedrig, nur mittschiffs erhob es sich zu Schulterhöhe, wo ein kutschendachähnlicher Aufbau mit einem Oberlicht zusätzliche Kopffreiheit bot. Über den beiden Sofas gab es so etwas wie Gepäcknetze, die ein buntes Allerlei von Dingen enthielten: Flaggen, Karten, Zigarrenkisten, Garnknäuel und dergleichen. An der vorderen Kajütwand befand sich ein Regal mit Büchern aller Formate in krausem Durcheinander. Unter diesem Regal gab es noch einen Pfeifenständer, ein Barometer und eine Uhr, die kräftig tickte. Alles Holz in der Kajüte war weiß lackiert. Ein weniger voreingenommenes Auge als das meine hätte dies Interieur vielleicht durchaus einladend gefunden. An die Wand neben der Kajüttreppe war die Fotografie eines jungen Mädchens gepinnt.
»Meine Schwester!«, sagte Davies schnell, als er sah, dass ich das Konterfei betrachtete. »Jetzt wollen wir aber wirklich das Zeug nach unten holen!« Er schob sich die Treppenstufen nach oben, und kurz darauf verdunkelte mein Schrankkoffer den Eingang. Ein großes Schieben und Zerren setzte ein.
»Hab ich mir doch gleich gedacht, dass er nicht durchgeht!«, kam es von oben. »Tut mir leid, du musst ihn an Deck auspacken. Möglicherweise kriegen wir ihn durchgequetscht, wenn er leer ist.«
Dann kam Davies wieder nach unten und zeigte mir voller Stolz die Schlafkabine im Vorschiff. Dazu mussten wir vom »Salon« durch eine niedrige Schiebetür kriechen, was mich lebhaft an einen Karnickelstall erinnerte. Im Schein einer Kerze, die Davies anzündete, erblickte ich zwei enge Kojen mit Wolldecken – ohne Bezüge! Unter den Kojen befanden sich Schubkästen, von denen mir Davies ein paar zuwies, offenbar in der Annahme, mir damit fürstlichen Platz für meine Garderobe einzuräumen.
»Du kannst deine Sachen so, wie du sie oben auspackst, gleich durch das Oberlicht auf deine Koje werfen«, bemerkte Davies. »Ganz nebenbei – ich bin im Zweifel, ob Platz genug ist für all das, was du da angeschleppt hast. Du konntest wohl nicht …«
»Nein, konnte ich nicht!«, schnappte ich. Absurd, diese Reiberei. Das war doch, als wollten sich Ölsardinen gegenseitig den Platz streitig machen!
»Geh mal raus, damit ich vorbeikann!«, knurrte ich. Davies schien betroffen über diesen Anflug von Übellaunigkeit, aber ich quetschte mich einfach an ihm vorbei nach draußen. Im fahlen Mondlicht schnallte ich den unseligen Koffer auf und kochte dabei vor Ärger. Ich wühlte darin herum mit dem Gefühl, nun sei ohnehin alles egal, und es komme nur noch darauf an, die Sache hinter mich zu bringen. Die aussortierten Sachen warf ich durch das Oberlicht nach unten. Den Rest packte ich schleunigst wieder ein, damit Davies nicht sehen konnte, was ich alles mitgebracht hatte. Danach schnallte ich die Riemen wieder zu und setzte mich auf das lästige Prunkstück. Ich fröstelte, denn es wurde langsam Herbst. Dabei ging mir durch den Kopf, dass es ja noch viel schlimmer hätte kommen können, etwa, wenn es geregnet hätte. Also blickte ich mich erst einmal um. Die kleine Bucht lag wie ein Spiegel, Sterne oben und Sterne unten. Von einer Stelle am Ufer schimmerten weiße Häuser herüber. Im Westen sah man die Lichter von Flensburg, im Osten verlor sich die Förde in undurchsichtiger Finsternis.
Von Davies unter Deck vernahm ich gedämpftes Rumoren, dann und wann unterbrochen von einem schweren Platschen, wenn etwas aus dem Vorluk ins Wasser flog.
Wie es eigentlich kam, weiß ich nicht. War es Davies’ trauriger Blick, war es eine jener unvermittelten Einsichten, die mir meinen albernen Egoismus vor Augen führte, war es dieser unbestimmte Hauch von Abenteuer, der das ganze Unternehmen umgab, oder waren es einfach nur die Sterne und die frische Seeluft: Was nur hatte bewirkt, dass erloschene Jugendträume plötzlich in mir zu neuem Leben erwachten? Vermutlich führte all dies zusammen meinen Gesinnungswandel herbei. Kurz, meine Stimmung schlug mit einem Mal um. Die Märtyrerkrone fiel ab, die eingebildete Entsagung schwand spurlos dahin. Übrig blieb ein zwar eleganter, doch nun arg gebeutelter junger Mann, der bei Nacht und Nebel auf einem lächerlichen Koffer hockte und dem bewusst wurde, dass er neuen, fremden Lebensbedingungen ausgeliefert, nun aber entschlossen war, das Beste aus allem zu machen.
»Der Grog ist fertig!«, kam es von unten. Als ich gebeugt hinunterstieg, musste ich zu meiner Überraschung feststellen, dass auf wundersame Weise jede Spur von Unordnung in der Kajüte verschwunden war. Sie wirkte nun direkt anheimelnd und behaglich. Auf dem Tisch waren Teegläser und Zitronen, und der kräftige Duft des Grogs hatte alle vorherigen Gerüche verdrängt. Ich zeigte mich über diese Annehmlichkeiten erfreut – in Maßen, doch anscheinend genug, um Davies sichtlich zu erleichtern. Voller Stolz zeigte er mir, wie trickreich er inzwischen alles verstaut hatte, wobei er die Geräumigkeit seines schwimmenden Kabuffs pries.
»Und da steht dein Ofen, siehst du?«, schloss er. »Den alten habe ich kurzerhand über Bord geschmissen!«
Ich darf hier einflechten, dass es sich als Marotte von Davies herausstellen sollte, alle möglichen Dinge unter den nichtigsten Vorwänden über Bord gehen zu lassen. Später erhärtete sich mein Verdacht, dass der neue Ofen ebenso wenig nötig gewesen war wie die Wantenspanner. Alles nur Vorwand, um dieser seiner sonderbaren Manie frönen zu können.
Wir rauchten und schwatzten noch ein Weilchen. Dann kam das Problem des Schlafens. Nach mancherlei Püffen an Kopf und Füßen und verzweifeltem Hin- und Hergedrehe hatte ich es endlich geschafft und lag nun zwischen den kratzigen Decken. Davies, der sich mit aalgleicher Gewandtheit bewegte, war im Nu in seiner Koje.
»Ist doch recht komfortabel, nicht wahr?«, sagte er, als er das Licht im Liegen ausblies, mit einer Sicherheit, wie sie sich nur langer Übung verdanken konnte.
Es juckte mich am ganzen Körper, außerdem war da ein feuchter Fleck auf meinem Kopfkissen, dessen Herkunft sofort klar wurde, als mir ein dicker Wassertropfen ins Gesicht platschte.
»Der Kahn leckt doch nicht etwa?«, fragte ich, so sanft es ging.
»Tut mir schrecklich leid«, sagte Davies besorgt und sprang sofort aus seiner Koje. »Das kann nur von dem schweren Abendtau kommen, den wir jetzt haben. Dabei habe ich erst gestern noch eine Menge kalfatert, aber ausgerechnet diese Stelle muss ich übersehen haben. Ich lege erst einmal Ölzeug drüber.«
»Was ist eigentlich mit deiner Hand passiert?«, fragte ich, schon halb im Schlaf. »Ach, nichts, hab sie mir neulich verstaucht«, war die Antwort. Und danach, scheinbar ohne Zusammenhang, murmelte er noch in sein Kissen: »Ein Glück, dass du den Peilkompass mitgebracht hast!«
3Davies
Ich schlief sehr unruhig. Immer wieder schmerzten Ellbogen und Nacken, und beständig kroch kalte Luft durch irgendwelche Ritzen zwischen den Decken. Erst als es bereits heller Tag war, verfiel ich in jenen bleiernen Schlaf, in den ein solcher Halbschlaf meistens übergeht. Meine erste Nacht an Bord fand jedoch ein jähes Ende, denn plötzlich prasselte ein kalter Wasserguss durch das Oberlicht zu mir herunter. Ich schreckte hoch, stieß mir den Kopf und blinzelte mit schweren Lidern nach oben.
»Entschuldige! Ich schrubbe gerade das Deck. Hast du gut geschlafen?«, hörte ich Davies’ Stimme über mir.
»Ganz passabel«, grunzte ich.
»Inzwischen habe ich schon dein Mordsding von Koffer verstaut, hab einfach die Scharniere auseinandergenommen und ihn in zwei Teile zerlegt.«
Ich sprang auf und stand in einer Wasserlache. Dann taumelte ich nach oben, sprang über Bord und ertränkte schlechte Träume, Steifheit und gequälte Nerven in der schönsten aller Ostseeförden. Eine Reihe kurzer, ungestümer Schwimmstöße, dann war ich wieder zurück und suchte nun nach einer Möglichkeit, die glatte, schwarze Bordwand zu erklimmen, die trotz ihrer geringen Höhe abweisend und schlüpfrig war. Davies, in einem weiten Leinenhemd, Ärmel und Hosenbeine hochgekrempelt, ließ mir von oben ein Tauende herunter und schwatzte unbekümmert, wie leicht es sei, heraufzuklettern, wenn man nur wisse, wie. Er ermahnte mich, ja auf die frische Farbe achtzugeben. Als ich es jedoch endlich geschafft hatte, an Bord zu turnen, waren meine Knie und Ellbogen zu seiner Bestürzung schwarzgefleckt. Wie auch immer: Als ich mich abfrottierte, wusste ich, dass ich in den klaren Fluten abermals eine Kruste von Unzufriedenheit und Dünkel abgestreift hatte.
Während ich mich in Flanellhosen und Blazer warf, schaute ich über das Deck und nahm alles auf, was am Abend zuvor die Dunkelheit verborgen hatte. Die Dulcibella[3] erschien mir bei Licht besehen reichlich klein.
Wie ich von Davies erfuhr, war sie 30 Fuß[4] lang und neun breit. Das waren Abmessungen für Wochenendfahrten auf dem Solent – das heißt, für Leute, die so etwas mögen! Aber mit einer solchen Nussschale von Dover bis in die Ostsee zu segeln – das mussten Strapazen gewesen sein, die jenseits meiner Vorstellungskraft lagen.
Doch nun zur ästhetischen Seite. In meinen Augen waren Schönheit und Eleganz die Kennzeichen einer richtigen Yacht. Daher konnte mir der Anblick der Dulcibella beim besten Willen nur wenig zusagen. Der Rumpf erschien mir zu plump und der vordere der beiden Masten unproportioniert hoch gegenüber dem hinteren. Der Kajütaufbau war unförmig, und die Oberlichtkästen beleidigten mein Auge mit ordinären Eisengittern und billigem Nadelholz. Das bisschen Messing, das es an Bord gab, war von dickem Grünspan überzogen. Das Deck hatte nichts von der sanftglänzenden Gepflegtheit, die man in Cowes voraussetzt, sondern war rau und grau. Aus den Decksnähten quoll Teer, und das Wasserstag[5] war rostig. Und dann das Tauwerk: ein Trauerspiel! Zwar hatte es allem Anschein nach gerade erst Überholungsarbeiten gegeben, denn in der Luft lag ein würziger Duft von Hobelspänen und Teer, im Masttop flatterte eine neue, prächtige Flagge, und es gab auch ein paar neue Leinen, besonders an dem winzigen Mast am Heck – der übrigens völlig neu zu sein schien. Aber all dies ließ die allgemeine Unansehnlichkeit nur umso deutlicher hervortreten.
Dass das Ganze andererseits zweckmäßig und solide war, konnte selbst mir, der Landratte, nicht entgehen. Einiges an der Ausrüstung erschien mir geradezu überdimensioniert, wie zum Beispiel die Ankerkette, die über die geringe an ihr hängende Schiffslast zu spotten schien. Auch das Kompassgehäuse, ursprünglich wohl für ein weit größeres Fahrzeug gedacht, wirkte imposant, fast ein bisschen komisch. Übrigens war es das einzige Stück Messing an Bord, das geputzt war und liebevolle Pflege verriet. Zwei starke Trossen, offensichtlich viel gebraucht, die hinter dem Mast aufgeschossen waren, trugen zum wettergegerbten Aussehen des kleinen Schiffes bei. Wie Davies mir ferner berichtete, war die Dulcibella, ursprünglich ein Rettungsboot, irgendwann einmal zu einer Segelyacht umgebaut worden, indem man sie mit der nötigen Takelage, einem Kajütaufbau, Kielballast und einem Schwert versehen hatte. Wie die meisten Rettungsboote war sie diagonal-karweel mit zwei Schichten Teakholz beplankt. Das verlieh ihrem Rumpf eine außerordentliche Stärke, aber dennoch: Für meinen Geschmack war bei dem Umbau eine Art Promenadenmischung herausgekommen.
Davies’ Ruf: »Tee ist fertig!« – und nicht minder mein Hunger – trieben mich hinunter in die Kajüte, wo mein Skipper mit erhitztem Gesicht und rußigen Fingern bereits am gedeckten Frühstückstisch saß. Ein gewisser Mangel an Geschirr ließ sich nicht verheimlichen, aber der Speck war ausgezeichnet gebraten. Heiß und kross, wie er war, hätte er selbst meinen Koch in London beschämt. So hätte ich das Mahl wirklich genossen, wenn nicht Sofa und Tisch derartig niedrig gewesen wären. Man musste sich in einer Weise zusammenkrümmen, dass das Schlucken zu einer beschwerlichen Prozedur wurde und man immer wieder aufstehen und sich recken wollte, was aber jedes Mal eine Gefahr für den Kopf bedeutete.
Mir fiel auf, mit welch genüsslichem Eifer sich Davies über die Köstlichkeiten von frischem Weißbrot und Milch ausließ, die er anscheinend als wahre Luxusgüter ansah und für geeignet hielt, sie einem verwöhnten Gast als Begrüßungsmahl vorzusetzen. Als ich ihn vorsichtig darauf ansprach, erklärte er mir, man komme ja nicht immer an Land, und einmal habe er, zwischen den Ostfriesischen Inseln kreuzend, ganze zehn Tage an einem Laib Roggenbrot gegessen.
»Muss am Ende ziemlich hart gewesen sein«, bemerkte ich doppelsinnig.
»Hart schon, aber sonst noch ganz gut«, meinte er. »Danach habe ich mir beigebracht, Brötchen zu backen. Hatte erst kein Backpulver, also hab ich Fruchtsalz benutzt, aber damit gingen sie nicht auf. Und die Milch ist Kondensmilch. Hoffe, das macht nichts –«
Ich wechselte das Thema und erkundigte mich, wohin er nun eigentlich mit mir zu segeln beabsichtige.
»Weißt du was – lass uns jetzt einfach aufbrechen und die Förde runtersegeln!«, sagte er schnell.
Ich hätte gern genauere Einzelheiten von ihm gehört, aber schon mein nächster Satz ging im Geklapper des Abwaschs unter. Danach spulte sich alles mit verblüffender Geschwindigkeit ab. Davies begab sich an Deck, und mit dem bescheidenen Wunsch, mich nützlich zu machen, folgte ich ihm. Er war überall zugleich, hievte an der Ankerkette, machte Fallen und Schoten[6] klar. Mir blieb die Rolle des Clowns, der tollpatschig nachäfft, was bereits getan ist, denn meine seemännischen Kenntnisse waren höchst verschwommen und für die Praxis nutzlos. Im Nu war der Anker, ein rostiges Monstrum, oben und die Segel gesetzt, und Davies schoss zwischen Ruderpinne und Klüverschot blitzschnell hin und her, während die Dulcibella mit einer weitausholenden Verbeugung Abschied vom Ufer und Kurs auf die Förde nahm.
Leichte, umspringende Winde in Lee[7] des hohen Ufers hinter uns brachten uns anfangs nur zögernd voran, aber bald hatten wir das Fahrwasser erreicht, und eine anhaltende Brise aus Südwest nahm uns freundlich in ihre Arme. Die Dulcibella rauschte stetig die bewegte blaue Förde hinunter und geleitete mich in einen neuen Lebensabschnitt, der trotz seiner Kürze von formender Kraft für mich sein sollte.
Davies war jetzt wieder ganz er selbst, nur ab und zu wirkte er geistesabwesend, um dann blitzartig das Ruder loszulassen und ein fernes Seil in die Hand zu nehmen. Einmal machte er die Ruderpinne fest und verschwand unter Deck, um sogleich wieder mit einer Seekarte aufzutauchen, die er beim Rudergehen studierte, wenn der Wind sie auch immer wieder zuschlug. Inzwischen hatte ich Muße, mich umzusehen.
Die Förde war hier etwa eine Seemeile[8] breit. Hinter dem Ufer, von dem wir gekommen waren, stiegen steile Hügel auf. Am Fuß der Hänge gab es Grünflächen und dunkle Wälder, zwischen die sich an einer Stelle eine kleine Stadt schmiegte. Überall lagen Einzelgehöfte verstreut. Das andere Ufer, gleichsam eingerahmt zwischen Großbaum und Bordwand, war niedriger und auch schwächer besiedelt. Ich konnte es von meiner Sitzposition, in der ich schmerzlich einen bequemen Stuhl vermisste, geradeso erkennen. Ausgedehnte Weideflächen stiegen allmählich zu parkähnlichen Baumgruppen an, die einen großen Landsitz vermuten ließen. Hinter uns verlor sich Flensburg im Dunst, voraus war die Förde von Hügeln eingefasst, einige klar auszumachen, andere in verträumter Ferne. Auf allem lag der eigentümliche Zauber, den eine ländliche Idylle mit Spuren menschlicher Häuslichkeit nur im Zusammentreffen mit dem riesigen Meer entfaltet, das unseren ganzen Globus umspült.
Ich genoss den besonderen Reiz, dieses Panorama nicht etwa an Deck eines Luxusdampfers auf mich wirken zu lassen, sondern an Bord eines primitiven, kleinen Bootes, das seinen Weg bis in diesen Erdenwinkel gefunden hatte, ungeachtet aller Schwierigkeiten und Gefahren. Was seinen einzigen Passagier dazu bewogen hatte, diese Mühen auf sich zu nehmen, ließ sich dessen vagem sorglosem Gerede nicht entnehmen. Er klang, als mache er nur einen Nachmittagsausflug vor der Küste von Southampton.
Davies hatte die Karte sinken lassen und lehnte nun mit seinem sonnengebräunten Arm auf dem Ruder. Unverwandt schaute er nach vorn, nur gelegentlich warf er einen schnellen Blick in die Runde und zur Flagge am Masttop. Er schien in sich versunken. Ich betrachtete ihn so aufmerksam, wie ich es nie zuvor getan hatte. Die Offenheit und Jungenhaftigkeit seines Gesichts hatte mich schon immer beeindruckt. Diese Eigenschaften hatte es bewahrt, doch nun entdeckte ich in seinen Zügen auch Energie und Mut, ja Verwegenheit. Seine Augen hatten einen gereifteren Ausdruck. Die merkwürdigen Wechsel von heiterer Beweglichkeit zu nachdenklichem Ernst, die mich bisher bisweilen amüsiert, oft aber irritiert hatten, schienen sich nun in einer empfindsamen Zurückhaltung zu verlieren, die weder kalt noch egoistisch war, sondern dank ihrer paradoxen Offenheit sehr gewinnend. Alles in diesem Gesicht verhieß Anständigkeit, Verlässlichkeit. Eine tiefe Ahnung sagte mir, dass ich mich zwar für jemanden mit guter Menschenkenntnis und den richtigen Bekannten hielt, aber doch einiges falsch eingeschätzt hatte – wie viel wohl? Mich überkam das Gefühl, dass ein gnädiges, wenn auch unverdientes Geschick mir hier die Chance bot, einiges gutzumachen. Und doch erschienen mir die Wege dieses gnädigen Geschicks recht unergründlich, oder es schien einen hinterhältigen Humor zu haben. Denn Davies hatte mich eingeladen, offenbar ohne mich hier wirklich zu brauchen – hatte mich förmlich mit List hergelockt, da er wohl ahnte, dass ich für eine solche Fahrt nicht gemacht war. Und doch war List etwas, das zu ihm so gar nicht passte.
Vielleicht brachte mich auch meine zunehmend unbequeme Position auf solche Gedanken. Auch der Schlaf der letzten Nacht und das erfrischende Bad hatten meine Fähigkeit, scharfe Kanten und harten Untergrund zu ertragen, kaum verbessert. Plötzlich kam Davies zu sich. »Na, hast du es auch bequem? Möchtest du vielleicht etwas zum Draufsitzen?«, fragte er, legte das Ruder ein bisschen nach Luv[9], hielt es einen Augenblick, als wolle er ihm den Puls fühlen, und tauchte dann hinab in die Kajüte, von wo er mit ein paar Kissen zurückkehrte, die er mir zuwarf. Ich wurde ärgerlich und fragte: »Gibt es denn gar nichts, was ich tun könnte?«
»Ach, lass gut sein!«, erwiderte er. »Ich nehme an, du bist noch müde von der Reise. Schau mal, machen wir nicht herrliche Fahrt? Backbord voraus, das muss Ekensund[10] sein.« Er deutete unter dem Segel durch. »Dort, wo die Bäume auseinanderweichen! Willst du vielleicht mal einen Blick auf die Karte werfen?« Damit schob er sie mir herüber. Ich breitete sie mühsam auseinander, aber sobald ich eine Hand wegnahm, schlug sie wieder zu. Mit Seekarten kannte ich mich nicht aus, für mich wimmelten sie von unverständlichen Symbolen.
»Schau, da ist Flensburg!«, erklärte Davies. »Und jetzt sind wir hier.« Mit ausholender Bewegung deutete er auf einen reichlich unbestimmten Fleck der Karte. »Was meinst du – auf welcher Seite müssen wir die Boje da gegenüber der Landspitze passieren?«
Bis jetzt hatte ich noch gar nicht recht erfasst, was auf der Karte See und was Land war und noch weniger, welche Bedeutung diese Boje hatte, und da ja Davies mir ganz offensichtlich in puncto Seemannschaft nichts zutraute, machte mich dieser plötzliche Vertrauensbeweis nervös. Aber da warf er schon ein: »Lass gut sein, ich bin sicher, hier ist überall tiefes Wasser, die Tonne ist nur für die Großschifffahrt!«
Wenige Minuten später passierten wir die fragliche Boje, auf der falschen Seite, da bin ich sicher, denn plötzlich wurden unter uns mit unbehaglicher Deutlichkeit Sandboden und Tang sichtbar. Aber Davies sagte nur: »Hier ist nie Seegang, und das Schwert ist auch nicht unten, also, was soll’s!« Eine mysteriöse Rede, über die ich zweifelnd nachsann.
Er fuhr fort: »Das Beste an diesen Gewässern hier ist: Mit einem flachen Schiff kommt man hier überall hin. Navigation im eigentlichen Sinn erübrigt sich, denn …«
In diesem Augenblick war unter uns ein leichtes Schurren mehr zu spüren als zu hören.
»Laufen wir jetzt auf Grund?«, fragte ich mit großer Beherrschung.
Davies zuckte ein bisschen zusammen. »Ach was, wir schrammen drüber weg!«, sagte er. Und wie wir schrammten!
Diese unbedeutende Episode hinterließ bei Davies eine leichte Verstimmung. Ich erwähne die Sache lediglich als Beispiel seiner kleinen Eigenheiten. Er war frei von jener Schulmeisterei, die der Yachtsport leider oft in Männern weckt. So hatte er sich ohne Weiteres auf mein Kartenlesen verlassen, ohne daran zu denken, dass ich als absoluter Laie ein hervorragendes Objekt für Belehrung abgegeben hätte, ebenso wie er mir gegenüber seine Gastgeberpflichten aus reiner Gewohnheit und innerer Unabhängigkeit vernachlässigt hatte. Andererseits war er ungeachtet seiner perfekten Seemannschaft, die ich noch zu schätzen lernen sollte, gelegentlich durchaus von einer gewissen dilettantischen Sorglosigkeit, die sich auch in der Führung seines Logbuchs offenbarte, wie wir sehen werden. Wie auch immer: Diese Eigenheiten hatten, so meine ich, ihre gemeinsame Wurzel in seiner Abneigung gegen jede Art von Angeberei. Daher kam es wohl auch, dass weder er noch sein Boot in irgendeiner Weise der Yachtetikette entsprachen. Weder trug sie jemals eine Nationalflagge noch er die typische Seglerkleidung.
Wir umrundeten eine grüne Landzunge, der ich vorher keine Aufmerksamkeit geschenkt hatte.
»Wir müssen halsen[11]«, sagte Davies. »Übernimm du mal das Ruder!« Ohne auf meine Einwilligung zu warten, begann er die Großschot mit aller Gewalt dichtzuholen. Nun hatte ich zwar eine ungefähre Vorstellung vom Steuern, aber Halsen ist eine überaus kitzlige Sache. Daher wird kein Segler überrascht sein zu hören, dass der Großbaum die Gelegenheit witterte, mit Getöse überkam und die Schot sich um mich und das Ruder verwickelte.
»Patenthalse!«, war Davies’ bekümmerter Kommentar. »Du bist einfach noch nicht vertraut mit dem Schiff, es reagiert sehr schnell auf das Ruder.«
Nun fand ich es an der Zeit, ein paar Dinge klarzustellen.
»Hör mal«, begann ich, »ich bin ein totaler Trottel, was das Segeln betrifft! Du wirst mir eine Menge beibringen müssen, wenn ich nicht Bruch machen soll! Denn sieh mal, ich hatte immer eine Crew …«
»Eine Crew!«, sagte Davies verächtlich. »Wozu bloß eine Crew? Der ganze Spaß liegt doch gerade darin, alles selber zu machen!«
»Mag sein, aber ich habe mich den ganzen Morgen wie das fünfte Rad am Wagen gefühlt«, konterte ich.
»Du – das tut mir leid!« Seine reuevolle Bestürzung war direkt komisch. »Ganz im Gegenteil wirst du mir noch eine unschätzbare Hilfe sein!« Wieder verfiel er in Gedanken. Wir folgten nun dem Verlauf einer kleinen Bucht bis zu einem Einschnitt in der niedrigen Küste.
»Das ist Ekensund, lass uns mal reinschauen!«, schlug Davies vor. Wenige Minuten später drifteten wir durch eine idyllische, schmale Landenge, hinter der sich abermals eine Wasserfläche auftat. Zu beiden Seiten sah man Häuser. Einige reichten buchstäblich bis ins Wasser, andere waren durch windschiefe Holztreppen oder kleine Stege mit ihm verbunden. Heckenrosen und andere Klettergewächse überrankten die Hauswände und Veranden. An einer Stelle gab es eine roh gezimmerte Landungsbrücke mit ein paar kleinen Frachtseglern. So hatte anscheinend auch dieser Flecken seinen Handel. Eine Gartenwirtschaft war da, mit verwahrlosten Hecken und laubbedeckten Tischen. Das verwitterte Holz der Stege, die berankten Häuser und die herbstlich verfärbten Bäume dahinter bildeten ein ins Auge fallendes Farbgemisch von Rot und Bronze.
Vorbei an dieser lieblichen Wasserfront glitten wir in eine jener flachen, haffartigen Buchten, die man dortzulande Noore nennt. Unsere Segel flappten kraftlos.
»Klar zur Wende!«, befahl Davies. »Hier müssen wir wieder raus!« Langsam drehten wir mit der Nase durch den Wind.
»Warum ankern wir hier eigentlich nicht?« wandte ich ein, denn ein berückendes Panorama breitete sich vor uns aus.
»Ach, wir haben doch alles gesehen, was zu sehen war, und wir müssen die Brise draußen nutzen, solange sie anhält«, antwortete Davies. Für ihn war es allemal eine Qual, eine günstige Brise vor Anker oder gar an Land verpassen zu müssen. Das Land war für ihn ein minderwertiges Element, lediglich zur Versorgung von Nutzen.
»Lass uns Mittagspause machen!«, schlug er vor, als wir unseren Kurs die Förde hinunter wieder aufgenommen hatten. Vor meinem inneren Auge erschien das Bild von verführerischen Salaten, eisgekühlten Getränken und einem weißgedeckten Tisch mit aufmerksamem Kellner.
»Im Stauraum unter dem Steuerbordsofa findest du eine Dose Pökelzunge, und unter den Bodenbrettern im Kielraum ist Bier«, rief Davies. »Ich steuer uns erst mal um die Boje dort rum, du kannst inzwischen schon mit dem Essen anfangen.«
Missmutig gehorchte ich. Die stickige Luft der Kajüte und meine gekrümmte Haltung müssen meinen Verstand benebelt haben, denn ich öffnete fälschlich die Klappe an Backbord und bekam ein klebriges Etwas zu fassen, das sich als Teertopf entpuppte. Angewidert wich ich zurück und versuchte mein Glück auf der anderen Seite. Dabei kämpfte ich mit den Bewegungen des Schiffes und den Kanten des Schwertkastens. Ein Durcheinander modrig riechender, klammer Konservendosen aller Kaliber wurde sichtbar. Verwaschene Aufschriften auf abblätternden Etiketten kündeten von Suppen, Currys, Rindfleisch und anderen Köstlichkeiten. Ich suchte eine Dose Pökelzunge heraus, sperrte den Modergeruch wieder ein und machte mich auf die Biersuche. Es fand sich wie angekündigt im Kielraum, wo ihm die Nässe natürlich nichts anhaben konnte. Dennoch hätte ich mir einen etwas leichter zugänglichen und weniger feuchten Weinkeller gewünscht als diese Höhle zwischen schmierigem Ballast, aus der ich die Flaschen hervorzog. Missmutig und mit flauem Magen betrachtete ich die mühsam erbeuteten unansehnlichen Lebensmittel.
»Kommst du klar?«, rief Davies. »Der Dosenöffner hängt am Schott[12], Messer und Teller sind im Schrank!«
Verbissen kam ich meinem Auftrag nach. Teller und Messer rutschten mir entgegen, denn der Schrank befand sich gegenwärtig auf der Windseite. Kaum hatte ich die Tür geöffnet, da rückte mir das Geschirr in hohem Bogen zu Leibe und fiel scheppernd zu Boden.
»Das kommt vor!« hörte ich Davies’ Stimme von oben. »Mach dir nichts draus, das Zeug ist unzerbrechlich! Gleich komme ich und helfe dir.« Er überließ die Dulcibella sich selbst und kam nach unten.
»Vielleicht sollte ich lieber an Deck gehen«, sagte ich spitz. »Warum in aller Welt konnten wir nicht in Ruhe vor Ekensund essen und uns diesen Hexensabbat von Picknick ersparen? Wo zum Teufel fährt unser Kahn inzwischen hin? Und wie sollen wir an diesem abschüssigen Tisch überhaupt essen? Außerdem bin ich ganz voll Dreck und wate knöcheltief in Küchengeschirr. Da! Da geht auch noch das Bier hin!«
»Hättest es nicht auf den Tisch stellen sollen, bei der Lage«, sagte Davies beschwichtigend. »Macht aber weiter nichts, weil es in den Kielraum abfließt!« Asche zu Asche, Staub zu Staub, dachte ich bei mir.
»Du gehst jetzt am besten nach oben, und ich mache hier weiter!«, schlug Davies vor. Ich bereute, dass ich mich zu einem solchen Ausbruch hatte hinreißen lassen.
»Halt das Schiff auf Kurs, so wie es gerade läuft!« rief Davies mir nach, als ich dem Chaos entstiegen war, wobei ich die Leiter mit meinen Händen teerte. Ich klopfte mir die Hosen sauber, band das Ruder los und ließ die Dulcibella laufen.
Wir hatten eine scharfe Biegung der Förde umrundet und segelten nun eine breite, ausgedehnte Wasserfläche hinunter, die jeden Augenblick mit neuen Schönheiten aufwartete, ein Trostpflaster für die übelste Laune. Ein Marktflecken mit roten Dächern erschien zu unserer Linken, zur Rechten eine efeuumrankte Ruine nahe am Ufer, wo dösende Rinder knietief im Wasser standen. Voraus war an beiden Ufern weißer Strand zu sehen. Zu ihm herunter neigten sich bewaldete Hänge, hier und dort unterbrochen von niederen Sandsteinkliffs in warmen Rottönen, vereinzelt auch von einer bewaldeten Schlucht.
Ich vergaß allen Ärger und freute mich an den Dingen: dem verhaltenen Vibrieren der Ruderpinne, der sanften Brise und sogar – wenn auch mit gedämpftem Behagen – am Lunch, den Davies mir brachte und dessen Verzehr er besorgt verfolgte.
Später, als der Wind zu einem kraftlosen Hauch abgeflaut war, mühte sich Davies mit einem größeren Klüver und einem Topsegel ab, ich aber genoss es, den Nachmittag dahinzudösen und Leib und Seele in der lieblichen und neuartigen Atmosphäre zu baden, indem ich schläfrig verfolgte, wie der Saum des kühlen weißen Strandes immer langsamer vorbeizog.
4Der Bericht
»Hallo, aufwachen!«
Ich rieb mir die Augen – wo war ich? Dann streckte ich die schmerzenden Glieder. Auch auf Davies’ Kissen war ich letztlich nicht auf Rosen gebettet. Die Sonne war untergegangen, und die Dulcibella lag auf spiegelglattem Wasser, das sich im letzten Abendrot färbte. Eine Decke dünnen Höhengewölks breitete sich über den Himmel, und es roch irgendwie nach Regen. Wie es aussah, befanden wir uns in der Mitte der Förde, deren Ufer im schwindenden Licht ferner und höher wirkten. Unweit vor uns schienen sie aufzuhören, der Blick verlor sich in grauer Weite. Es herrschte vollkommene Stille.
»Bis Sonderburg schaffen wir es heute nicht mehr«, sagte Davies.
»Und was machen wir dann?«, fragte ich, mich zusammennehmend.
»Oh, wir ankern einfach hier irgendwo. Wir sind jetzt am Ausgang der Förde. Ich schleppe uns in Landnähe, und du steuerst etwa in diese Richtung!« Damit wies er flüchtig auf ein Fleckchen bewaldetes Kliff. Dann sprang er ins Beiboot, warf die Fangleine los, griff sich ein Tauende und begann die widerspenstige Dulcibella mit kurzen Ruderschlägen abzuschleppen.
Die beklemmende, graue Weite vor uns und mein natürliches Verlangen nach einer festen Bleibe für die Nacht drückten meine Stimmung erneut. Während meines Nickerchens hatte ich von Morven Lodge und einem Picknick auf der Heide nach glorreicher Mohrhuhnjagd geträumt, von Lachsen, die aus glitzernder Wasserfläche hochschnellten, und jetzt …
»Wirf doch mal das Lot, mal sehen, wie tief es hier ist!« übertönte Davies’ Stimme das Platschen der Riemen.