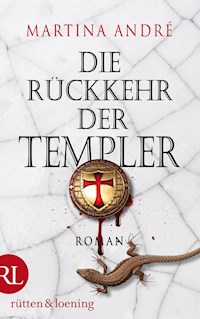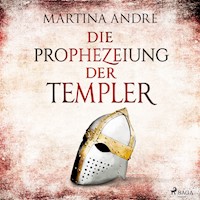12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Gero von Breydenbach
- Sprache: Deutsch
Das größte Geheimnis des Mittelalters.
Im Jahr 1156 überbringt der vierte Großmeister der Templer einen geheimnisvollen Gegenstand von Jerusalem in seine südfranzösische Heimat. „Das Haupt der Weisheit“ wie das seltsame Artefakt genannt wird, sorgt dafür, dass der Orden zu nie gesehenem Reichtum gelangt. Doch im Jahr 1307 holt der französische König zum Schlag gegen die Templer aus. Sämtliche Niederlassungen der Templer werden geschlossen, alle Mitglieder verhaftet. Gero von Breydenbach soll mit dem "Haupt der Weisheit" nach Deutschland fliehen, um das Geheimnis der Templer zu bewahren. Eine wahrhaft phantastische Reise beginnt. Plötzlich aber findet er sich im Jahr 2004 wieder – an der Seite einer jungen Frau, die ihn fasziniert und die ihm helfen soll, seine Mission zu erfüllen ...
Für alle Fans der TV-Serien "Knightfall" und "Outlander".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1185
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Über Martina Andrè
Martina Andrè, Jahrgang 1961, lebt mir ihrer Familie bei Koblenz. Im Aufbau Taschenbuch Verlag erschien von ihr der Bestseller »Die Gegenpäpstin«. Zuletzt veröffentlichte sie den Roman »Schamanenfeuer – Das Geheimnis von Tunguska« (Verlag Rütten & Loening).
Informationen zum Buch
Im Jahr 1156 bringt der Großmeister der Templer einen geheimnisvollen Gegenstand aus Jerusalem nach Frankreich. Dieses Artefakt sorgt dafür, dass der Orden zu unermesslichem Reichtum gelangt – und dass für die Templer die Grenzen von Raum und Zeit verschwinden. Als der Orden 150 Jahre später verboten wird, soll Gero von Breydenbach, ein Ritter aus Trier, dieses sogenannte Haupt der Weisen nach Deutschland überführen, um den Untergang des Ordens zu verhindern. Mit ein paar Getreuen macht er sich auf den Weg, doch plötzlich findet er sich in einer anderen Zeit wieder – in einem Dorf in der Eifel im Jahr 2004.
»Martina André erzählt die Templerlegende neu und voller Überraschungen.« RHEIN-ZEITUNG
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Martina André
Das Rätsel der Templer
Roman
Inhaltsübersicht
Über Martina Andrè
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Teil I Der Auftrag
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Teil II Center of Accelerated Particles in Universe and Time
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Teil III Tod und Ehre
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Epilog
Nachwort und Danksagung
Impressum
Dieses Buch möchte ich der ehemaligenZisterzienserabtei Heisterbach widmen,einem mystisch anmutenden Ort im Siebengebirge,mit einer wundersamen Legende über Raum und Zeit,die vor vielen Jahren meine Begeisterung fürphantastische Geschichten geweckt hat.
Im Jahre 1156 überbrachte Bertrand de Blanchefort, vierter Großmeister der Templer, einen geheimnisvollen Gegenstand von Jerusalem in seine französische Heimat, um ihn dort in einem raffiniert angelegten Versteck vor dem Zugriff Unbefugter zu verbergen. Eingeweihte nannten den unauffälligen, metallischen Kasten »CAPUT LVIII« oder das »Haupt der Weisheit«.
Bald darauf war Bertrand de Blanchefort der erfolgreichste Großmeister seiner Zeit, und unter seinem Einfluss wurde der Orden der Templer zur bedeutendsten Organisation, die das christliche Abendland bis dahin hervor gebracht hatte.
Prolog
»Die Jünger fragten Jesus:
›Wann wird die Ruhe der Toten eintreten,
und wann wird die neue Welt kommen?‹
Jesus antwortete:
›Die Ruhe, die ihr erwartet, ist schon gekommen,
aber ihr erkennt sie nicht.‹«
(Thomasevangelium 51)
Samstag, 28. Oktober 1307 – Chinon
Der Wind fegte in einer solch erbarmungslosen Strenge über die Festungsmauern von Chinon, als ob er das unbezwingbare Gemäuer mit Gewalt seiner leidvollen Bestimmung entreißen wollte. Währenddessen schoben sich riesige Wolkenberge über das Hochplateau, die mit ihrer einhergehenden Düsternis den Mittag zum Abend verurteilten und deren herabstürzende Wassermassen verlässliche Straßen in tückische Sumpfpfade verwandelten. Blitze zuckten, trotz der kühlen Witterung, und das darauf folgende ohrenbetäubende Donnergrollen bewirkte, dass sich nur draußen aufhielt, wer dazu verdammt worden war.
Heute war der Tag des Heiligen Simon und des Heiligen Judas Thaddäus. Einst waren sie zu Märtyrern geworden, nachdem sie den Zauberern des Königs Xerxes deren Unfähigkeit vor Augen geführt und diese aus Rache einen Aufstand der Priester entfacht hatten, die Simon und Judas Thaddäus gefangen nahmen und – da waren sich die Schreiber nicht einig – sie enthaupten oder zersägen ließen. Bald darauf hatte ein gewaltiges Unwetter Priester und Zauberer erschlagen und den König und sein Volk in Angst und Schrecken versetzt.
Allem Anschein nach wollte der 28. Oktober 1307 seinen Namensgebern die Ehre erweisen – zumindest was das Wetter betraf –, und auch die Märtyrer schienen nicht weit.
Ein Napf mit dünnem Gerstenbrei und eine Scheibe verschimmeltes Brot kennzeichneten für Henri d’Our, Komtur der Templerniederlassung von Bar-sur-Aube den Beginn eines weiteren Morgens in der Hölle.
An manchen Tagen ging es in den weit verzweigten Kalksteinkatakomben der Festung Chinon zu wie auf einem Viehmarkt. Gefühllose Folterknechte trieben mit Peitschen und Knüppeln ganze Heerscharen von gepeinigten Kreaturen durch ein Labyrinth von Gängen, in der Absicht, die Widerstandsfähigsten herauszusieben, nur um ihnen danach noch ein wenig heftiger zusetzen zu können. Heute jedoch war es nach der Verteilung der Essensration geradezu unheimlich still gewesen, und nur ein fernes Donnergrollen ließ weiteres Unheil befürchten.
Der eindringliche Schrei einer Frau, der diese Stille zerriss wie ein morsches Leichentuch, bestätigte Henri d’Ours finsterste Ahnungen. Zurückgezogen hockte er im hintersten Winkel seiner Zelle. Der ehemals weiße Habit ließ die ursprüngliche Farbe nur noch erahnen, und der teilweise zerfetzte Stoff schützte seinen ausgemergelten Körper nur unzureichend vor schamlosen Blicken. Das verfilzte, silberne Haupthaar und der noch bis vor kurzem gepflegte, würdevolle Bart waren mit Blut und Dreck verschmiert.
D’Ours Kiefer schmerzte so fürchterlich, dass er seinen Mund kaum zu öffnen vermochte, und mit seinen geschwollenen Augenlidern kostete es ihn einige Mühe, zu erkennen, was um ihn herum geschah. Arme und Beine, übersät mit blauen Flecken und kleinen, schmerzhaften Brandmalen, konnte er nur noch mit äußerster Kraftanstrengung bewegen.
Bislang hatte er sämtlichen Folterungen erbittert Widerstand geleistet, indem er scheinbar über den Schmerz hinausgegangen war und seinen Geist ermächtigt hatte, den Körper zu verlassen, um den unerträglichen Qualen mit Gleichmut begegnen zu können. Und doch ergriff Zug um Zug eine jämmerliche Angst von seiner Seele Besitz. Was wäre, wenn König Philipp IV. von Franzien und Guillaume de Nogaret, seines Zeichens Großsiegelbewahrer und Oberhaupt der königlichen Geheimpolizei, der sogenannten Gens du Roi, herausfinden würden, dass Henri d’Our tatsächlich zu den Eingeweihten des Templerordens gehörte und sich trotz seines bescheidenen Postens ab und an mit dem Großmeister oder dessen Vertreter in Franzien getroffen hatte? Vielleicht hatten die Gens du Roi, deren grauenhafte Folter jedem anständigen Menschen das Blut in den Adern gefrieren ließen, Spione in die wirtschaftlich unbedeutende Templerniederlassung im Osten der Champagne eingeschleust, die dem Königshof in Paris regelmäßig Bericht erstatteten?
Ein Folterknecht, hässlich wie der Teufel, kam herbeigeschlurft. Mit einem blöden Grinsen zückte er seinen schweren Schlüsselbund und öffnete das monströse Eisenschloss zu Henri d’Ours unfreiwilligem Domizil. Eine Maßnahme, die der Tatsache Hohn spottete, dass er – wie alle Gefangenen an Armen und Beinen in Ketten gelegt – wohl kaum in der Lage sein würde, das Weite zu suchen.
»So mein Guter, auf zur nächsten Runde.« Die Ironie in der Stimme des Mannes war nicht zu überhören. »Man erwartet Euch bereits.«
Rücksichtslos zerrte er Henri d’Our aus der finsteren Behausung heraus.
»Heilige Jungfrau Maria«, betete der Komtur von Bar-sur-Aube lautlos, während er Mühe hatte, auf die Beine zu kommen. »Lass mich stark bleiben in meiner Ehre und mutig im Glauben an das Gute in der Welt.«
Als er jedoch in die große, hell erleuchtete Folterkammer gelangte, war es um seinen Mut geschehen. Ein Stich fuhr ihm ins Herz, als er erkennen musste, dass mit Francesco de Salazar ein weiterer Ritterbruder seiner Komturei in die Hände der Gens du Roi gefallen war.
Und was die Sache weit schlimmer machte, war die weinende junge Frau, die an seiner Seite saß. Ohne Zweifel handelte es sich um die Schwester des ehemals stolzen Katalanen, weil sie mit den gleichen, großen Haselnussaugen zum Komtur der Templer von Bar-sur-Aube aufsah, als ob sie von ihm die himmlische Erlösung erwartete.
Francesco hing wie leblos und lediglich mit einer zerrissenen Unterhose am Leib an dem schräg gestellten Holzbrett wie Jesus am Kreuz. Dunkel verfärbte Striemen überzogen seinen flachen Bauch, und münzgroße Brandmale umkreisten seine Brustwarzen wie ein grausiger Reigen. Die Lippen, ausgetrocknet und blutverkrustet, waren dem unverwechselbaren Lachen mit den leuchtend weißen Zähnen so fern wie nie zuvor.
Wie durch einen Nebel nahm Henri d’Our die nicht weniger vornehm gekleidete, ältere Frau wahr. Da sie offensichtlich in Ohnmacht gefallen war, hatte man sie auf eine schmuddelige Matratze gebettet und ihr Haupt von dem straffen Gebende befreit, das Frauen ihres Alters gewöhnlich trugen. Die dunklen, silberdurchwirkten Locken und der olivfarbene Teint ließen auf Francescos Mutter, die Gräfin de Salazar, schließen. Ein Schauer überlief den Komtur bei dem Gedanken, dass die Inquisition nicht einmal vor verängstigten Angehörigen Halt machte, um ihre Opfer zu einer gefälligen Aussage zu zwingen.
Vornehmlich Frauen, getrieben von der Sorge um ihre Söhne und Brüder, wurden in die Verliese vorgeladen, um die bis dahin standhaften Ritterbrüder zu einem belastenden Geständnis gegen den Orden zu bewegen. Nogaret und seine Leute wussten darum, dass die gefangenen Templer die eigene Folter bis hin zum Tod ertrugen, nicht aber das Weinen und die Schreie der Frauen, die dabei zuschauen mussten.
Neben der Gräfin stand ein Medicus. Er verkehrte regelmäßig an diesem Ort des Leidens, und in seinem langen schwarzen Gewand nährte er in d’Our die Vorstellung von einem allgegenwärtigen Todesengel. Doch dann bemerkte der Komtur die Anwesenheit von jemandem, bei dem diese Bezeichnung noch passender gewesen wäre: Guillaume Imbert, Großinquisitor, Bischof von Paris und persönlicher Beichtvater Philipps IV. und zudem unseliger Verbündeter Guillaume de Nogarets.
»So sieht man sich wieder«, sagte der Mann im schwarzgrauen Surcot leise. Mit einem arroganten Lächeln entblößte er seine scharfkantigen Zähne, derweil er nervös an seinem weißen Spitzenkragen zupfte.
Der dickbäuchige Foltergehilfe hatte den Komtur von Bar-sur-Aube inzwischen auf dem Boden abgesetzt und an eine hölzerne Kiste gelehnt. Die Gliedmaßen in Ketten geschmiedet, das Genick steif wie ein Stock, traf d’Our von oben herab der vermeintlich mitleidige Blick seines Peinigers.
»Nun ja«, resümierte Imbert in spöttischem Tonfall, »Wenn Ihr Euren Hochmut überwinden könnt und endlich eine vernünftige Aussage für mich bereithaltet …«, beiläufig blickte er auf Francesco, »seid Ihr es vielleicht, der das Leben dieses Jungen zu retten vermag …«
Francescos Schwester hatte die Bemerkungen des Inquisitors mit weit geöffneten Augen verfolgt, und nun sprang sie auf und warf sich vor d’Our in den Schmutz, das Gesicht zwischen ihren ausgestreckten Armen unter einer Flut von herabfallenden Locken verborgen.
»Edler Mann«, klagte sie schluchzend, »was immer man von Euch wissen will, kann nicht so geheim sein, dass man dafür auch nur ein Menschenleben opfert! Ich flehe Euch an!«
Während ihr Körper von heftigen Weinkrämpfen geschüttelt wurde, blickte d’Our anklagend zu Imbert, der teuflisch grinsend neben ihr stand und damit seine tiefe Befriedigung anstandslos zur Schau stellte.
Der Komtur der Templer von Bar-sur-Aube würde es nicht über sich bringen, seinen Schützling zu opfern, schon gar nicht vor den Augen von Mutter und Schwester.
Ein Schatten bewegte sich hinter Imbert und räusperte sich verhalten. Es war der Medicus, der die Szene mit großem Interesse verfolgt hatte.
Imberts Augenmerk schnellte zwischen der reglos daliegenden Gräfin und dem neugierig dreinblickenden Arzt hin und her.
»Habt Ihr nicht gesagt, die Frau kommt wieder zu sich?«
Der Medicus nickte willfährig.
»Gut. Dann könnt Ihr fürs Erste verschwinden. Aber haltet Euch bereit, wie immer, falls ich Euch rufen lasse.«
Mit einem enttäuschten Zug um den Mund und einer unterwürfigen Verbeugung entfernte sich die schwarze Gestalt ebenso eilig, wie sie erschienen war.
Imbert wandte sich um und holte unter einem an der Wand stehenden, hölzernen Schreibpult einen unscheinbaren Leinensack hervor. Mit lauerndem Blick brachte er einen filigran gearbeiteten Frauenkopf aus reinem Silber zum Vorschein, der nur geringfügig kleiner war als ein echter menschlicher Kopf. Er stand auf einem kleinen Sockel, in den gut lesbar die Initialen CAPUT LVIII eingraviert waren.
»Mich interessiert weder, ob Ihr selbst gezeugte, frisch gebratene Neugeborene zum Abendmahl verspeist habt«, begann er in scharfem Ton, »noch, ob Eure Novizen ihre unkeuschen Schwänze in den Arsch des Meisters schieben mussten, bevor man sie selbst in einen weißen Mantel steckte.«
Für einen Moment weidete sich Imbert an dem bestürzten Blick der jungen Frau, die sich aufgerichtet hatte und nun zitternd auf ihren Fersen hockte.
»Ich weiß, dass Ihr etwas viel Interessanteres für mich bereithaltet.« Seine Stimme erhob sich in teuflischer Genugtuung. »Damit wir uns richtig verstehen. Mich interessiert weder Euer Gold, noch wo Ihr es versteckt habt. Das sollen andere herausfinden. Mich interessiert vielmehr, wo der Born Eures Wissens sprudelt.« Beinahe zärtlich strich er über das silbern schimmernde Gesichtchen. »Und ob dieses reizende Antlitz etwas damit zu tun hat.«
Unvermittelt setzte er die wissensdurstige Miene eines Gelehrten auf. »Warum, frage ich mich«, fuhr er mit dozierender Stimme fort, »finden wir beim Durchstöbern der Privatgemächer des Großmeisters der Templer in Paris einen silbernen Kopf, dessen nebulöse Existenz durch unzählige Verhöre geistert, darin versteckt eine Botschaft, die besagt: Geht zu H d O – nur er weiß, wie man die Stimme zum Sprechen bringt?«
Imbert lachte boshaft. »Ja, da schaut Ihr«, rief er und versah Henri d’Our mit einem triumphierenden Blick. »Wir sind in der Lage Eure geheimen Schriften zu dechiffrieren. Der Rest war ein Kinderspiel.« Wieder lachte er, diesmal leise und noch bösartiger. »Könnt Ihr mir verraten, warum diese drei Initialen nur auf einen einzigen Namen zutreffen, von den vielen, die wir in den ellenlangen Personallisten in der Ordensburg von Troyes gefunden haben?« Der Großinquisitor hielt inne. »Nämlich auf den Euren?«
D’Our blieb regungslos, bemüht darum, seinen Blick so klar zu halten wie reines Quellwasser.
»Was seid Ihr?«, fauchte Imbert ungehalten. »Ein Zauberer? Könnt Ihr dieses Ding hier zum Sprechen bringen?« Wie ein lauerndes Reptil näherte er sich seinem Opfer und ließ sich dazu herab, vor ihm in die Hocke zu gehen.
Dabei kam er d’Our so nahe, dass dessen bereits abgestumpfter Geruchssinn mühelos die unappetitliche Mischung aus fauligem Atem und teurem Parfüm wahrnehmen konnte.
»Wir haben Euren Großmeister verhört, vor vier Tagen in Corbeil«, resümierte Imbert in der ihm eigenen Selbstgefälligkeit.
Wohl eher unbeabsichtigt verriet er Henri d’Our damit, wo man das Oberhaupt der Templer zurzeit gefangen hielt.
»Auf dieses Phänomen hin angesprochen, behauptete Jacques de Molay, er sei nur ein einfacher Mann, der noch nicht einmal des Lesens und Schreibens mächtig sei, und er wisse nichts von einem Kopf, geschweige denn etwas von einem Zettel, den er zusammen mit diesem niedlichen Antlitz in das ihm völlig unbekannte Versteck gelegt haben sollte!« Imberts Stimme war immer lauter geworden, und sein ansonsten bleicher Schädel hatte vor lauter Wut die Farbe eines gekochten Hummers angenommen.
Unvermittelt heftig sprang er auf. »Wollt Ihr mich alle zum Narren halten?«
Voller Zorn warf er d’Our mit Schwung das Haupt zu, das der Komtur wegen seiner angeketteten Arme nicht auffangen konnte. So landete der kleine Kopf aus massivem Silber in d’Ours Schoß und traf dessen Hoden, die einzige Stelle seines Körpers, die man bis jetzt von den Folterungen ausgespart hatte.
Mit schmerzverzerrter Miene hielt d’Our für einen Moment die Luft an und schluckte anschließend verkrampft. Sein Mund war mit einem Mal trocken, und sein Blick wanderte unruhig hin und her, zwischen der vor ihm liegenden Frau und dem schwer gefolterten Francesco, für den er eine tiefe Verantwortung empfand.
Fieberhaft überlegte er, wie er sich aus dieser Falle herauswinden konnte. Er hatte einen minimalen Vorteil. Imbert wollte etwas von ihm, und zwar etwas, das er sich einiges kosten lassen würde. Bisher waren dessen Bemühungen nicht gerade von Erfolg gekrönt gewesen, und König Philipp würde die weitere Karriere seines Großinquisitors vermutlich von eben diesem Erfolg abhängig machen.
»Wenn Ihr mir einen Schluck Wasser geben wollt«, sagte d’Our mit einer Ruhe, die ihn selbst zum Erstaunen brachte, »dann könnte ich es mir in Eurem Sinne überlegen, mein Schweigen zu brechen.« Er senkte den Blick und versuchte anteilslos zu wirken. Imbert durfte auf keinen Fall bemerken, wie viel ihm am Leben des Jungen lag.
»Tut, was er verlangt«, sagte Imbert und wies den Kerkermeister mit einer Geste an, d’Our eine Kelle mit Wasser zu reichen.
Gierig trank er das kalte Nass, wie ein Kamel, das man wochenlang durch die Wüste getrieben hatte. Seine verbliebenen Zähne schmerzten grauenvoll, jedoch seine Gedanken klärten sich mit jedem Schluck, und seine Stimme klang fest und deutlich, als er fortfuhr.
»Ich sage Euch, was Ihr hören wollt«, begann er, und dabei schaute er den Großinquisitor von unten herauf mit einer unschuldigen Miene an. »Unter einer Bedingung.«
»Ich denke nicht, dass es an Euch ist, Bedingungen zu stellen«, erwiderte Imbert frostig und warf einen schnellen Blick auf die immer noch am Boden kauernde, junge Frau.
»Und ich denke, Ihr wollt etwas wissen, das nur ich Euch zu sagen vermag?«, erwiderte d’Our betont gleichgültig.
Das Augenmerk des Inquisitors richtete sich mehr und mehr auf Francesco, den jungen Templer.
»Ihr braucht ihn erst gar nicht ins Kalkül zu ziehen«, bemerkte d’Our’ tonlos. »Ich habe bislang auch nicht das gesagt, was Ihr hören wolltet, obwohl mir seine Schreie nicht entgangen sind.«
In Wahrheit hatte er bis jetzt nie gewusst, wer gerade geschrien hatte. Er hatte allenfalls ahnen können, welcher seiner Untergebenen gefoltert wurde.
»Dann macht es Euch bestimmt nichts aus«, erwiderte Imbert erbarmungslos. »Wenn ich ihn vor unseren Augen töten lasse.«
Die junge Frau presste sich die Fäuste auf die Ohren und schrie so laut, als ob man ihr einen Dolch in den Leib gestoßen hätte, dann klammerte sie sich schluchzend an d’Ours reglose Beine und bettelte in herzzerreißender Weise um Francescos Leben.
»Es bekümmert mich nicht«, heuchelte d’Our, während er Francescos Schwester betrachtete, als wäre sie eine arme Irre. »Aber dieser jungen Dame hier scheint das Leben des Bruders etwas zu bedeuten. Und es würde mir etwas ausmachen, wenn ich jemandem, der so herzlos ist, ein solch unschuldiges Geschöpf ins Unglück zu stürzen, ein nicht unbedeutendes Geheimnis anvertrauen sollte.«
»Was wollt Ihr?«, rief Imbert und schlug ungeduldig mit der flachen Hand auf das Schreibpult.
D’Our wusste, dass er ihn am Haken hatte. »Ich kann Euch versichern, Ihr könnt den armen Kerl dort auf dem Brett solange foltern, bis seine Seele beschließt, dass sein Körper ein zu unwirtlicher Ort ist, um darin wohnen zu bleiben. Es wird Euch nichts nützen.« Er schwieg für einen Moment und bedachte sein Gegenüber mit einem abschätzenden Blick. »Denkt Ihr ernsthaft, wir würden einem halben Kind, dessen Zunge schneller ist als sein Verstand, unsere wichtigsten Geheimnisse anvertrauen? Schaut ihn Euch doch an!«
Imbert unterzog Francesco de Salazar einer eingehenden Betrachtung. In Blut und Schweiß gebadet, dabei halb ohnmächtig vor Schmerz, hatte der junge Katalane nichts mehr von jenem stolzen Templer, der trotz seiner Jugend in einem Kreuzzug jegliche Angreifer das Fürchten gelehrt hätte.
»Übergebt ihn seiner Familie«, sagte d’Our und blickte auf die junge Frau, deren Blicke halb hoffend, halb bangend zwischen ihm und dem Scheusal im vornehmen Aufzug hin und her schnellten. »Und sobald ich Nachricht von seinen Verwandten habe, dass er wohlbehalten zu Hause angekommen ist, verrate ich Euch alles, was Ihr hören wollt.«
»Gut«, bestimmte Imbert kurz angebunden und gab seinem Folterknecht ein Zeichen. »Lasst sie ziehen!«
Mit ungläubigem Blick nahm der Kerkermeister den Befehl entgegen.
»Zwei Wochen«, schnarrte Imbert, während er ärgerlich auf d’Our herab schaute. »Und keinen Tag mehr. Dann werdet Ihr mir die wahren Geheimnisse Eures Ordens offenbaren.« Der Großinquisitor legte eine theatralische Pause ein und verengte drohend seine tief liegenden Augen. »Wenn nicht, werde ich Euch und Euren zwei übrig gebliebenen Kameraden das Fell über die Ohren ziehen. Direkt hier, bei lebendigem Leib, und noch bevor der Antichrist Eure Seelen endgültig an sich gerissen hat.«
Teil I Der Auftrag
»Hebt einen Stein auf und ihr werdet mich finden, spaltet ein Holz, und ich bin da«
(Thomasevangelium, Vers 77)
1
Mittwoch, 11. Oktober 1307 – Gregorianischer Gesang
An diesem späten, herrlich sonnigen Oktobernachmittag im Jahre des Herrn 1307 ließen nur der auffrischende Wind und die ersten fallenden Blätter vermuten, dass der Herbst Einzug gehalten hatte.
Über die helle Kalksteinstraße aus Richtung Thors kommend, wälzte sich eine dicke Staubwolke den Hügel herab, und auf dem Aussichtsturm der Templerkomturei von Bar-sur-Aube erspähte der wachhabende Bruder in der Ferne das schwarzweiße Banner seiner Mitbrüder.
Zug um Zug vereinzelte sich das unscharfe Bild in sechs kräftige Rösser und deren stattliche Reiter. Templer, allesamt gekleidet in weiße, flatternde Mäntel, mit je einem leuchtend roten Tatzenkreuz auf Schulter, Brust und Rücken, dazu Haupthaar und Bart kurz geschoren, wie es die Tradition verlangte. Die stolze Haltung der jungen Männer und deren offen zur Schau gestellte Bewaffnung mit Schwert, Schild und Messergürtel unterstrichen zudem den Eindruck eiserner Disziplin und kämpferischer Entschlossenheit.
Ein paar kleine Buben blieben für einen Moment ehrfürchtig am Wegesrand stehen, als die Kavalkade an ihnen vorbei trabte. Doch kaum hatte der letzte Reiter die Meute passiert, lärmten die Jungen johlend und wild gestikulierend hinter dem martialisch anmutenden Trupp hinterher.
Gerard von Breydenbach, genannt Gero, ein deutschstämmiger Ritter aus dem Erzbistum Trier, der die Gruppe der weißen Reiter anführte, drückte seinen Rücken noch ein wenig mehr durch als allgemein üblich, nicht wegen der Haltung, sondern wegen der leidigen Schmerzen, die ihn neben einer bleiernen Müdigkeit schon seit dem Mittag plagten. Einzig der Gedanke, dass es nicht mehr lange dauern konnte, bis er den harten Sattel gegen eine weiche Matratze eintauschen durfte, verschaffte ihm eine vorübergehende Linderung.
Er und seine Kameraden waren noch vor der Frühmesse aufgebrochen, um eine streng geheime Botschaft ins zwei Meilen entfernte Thors zu überbringen. Eigentlich hatten sie gegen Mittag zurück sein wollen, aber ihr Reiseweg hatte sich unvorhergesehen verzögert. Der Oberbefehlshaber der Baylie von Thors, wie das Hauptquartier der umliegenden Templerniederlassungen im gleichnamigen Ort genannt wurde, hatte die Brüder von Bar-sur-Aube dazu aufgefordert, noch vor ihrer Heimkehr jede einzelne der benachbarten fünf Komtureien aufzusuchen, um weitere, gesiegelte Pergamente zu überbringen, deren Auslieferung keinen Aufschub duldete.
Ein helles Auflachen riss Gero aus seinen Gedanken. Nicht weit von der Straße entfernt sammelten drei Wäscherinnen schwatzend und kichernd die weißen Leinenlaken ein, die sie am Morgen in den Auen der Dhuys zum Bleichen ausgelegt hatten. Die blonden Haare der Mädchen flatterten mit den dünnen Kleidchen in einer aufkommenden Böe um die Wette.
Während die Mönchskrieger an ihnen vorbei ritten, war eine jede versucht, die Aufmerksamkeit von wenigstens einem der jungen Männer zu erhaschen. Entgegen aller Disziplin ließ sich Gero zu einem verhaltenen Schmunzeln hinreißen, als er die Absicht der Frauen erkannte. Der spanische Bannerträger, der dicht neben ihm ritt, grinste breit, und für einen Moment waren seine schneeweißen Zähne zu sehen. Einer der nachfolgenden Ritterbrüder stieß einen anerkennenden Pfiff aus, den die jungen Frauen mit einem hinreißenden Lächeln belohnten.
»Er hat mich angeschaut«, rief eines der Mädchen und presste selig die Hände vor die Brust.
»Ich sagte es doch«, ließ eine zweite mit entzückter Miene verlauten, »der Kerl, der die Truppe führt, hat Augen so blau wie der Himmel.«
»Der mit den braunen Locken wäre mir lieber…« hallte es den Reitern hinterher.
Gelächter brandete auf. Es kam nicht von den Frauen, sondern von den nachfolgenden Kameraden.
Vielleicht hatte Vater Augustinus, der ordenseigene Kaplan doch Recht, dachte Gero und sah im Geiste den verhärmten Geistlichen vor sich, wie er in der sonntäglichen Kapitelversammlung an die Moral der Ordensritter appellierte:
»Wir halten dafür«, zitierte der Vater stets mit sauertöpfischer Miene, »dass es einem jeden Ordensmann gefährlich ist, das Angesicht einer Frau zu sehr zu betrachten, und daher nehme sich keiner von den Brüdern heraus, eine Witwe, eine Jungfrau, seine Mutter, seine Schwester, seine Tante oder irgendeine andere Frau zu küssen. Die Ritterschaft Christi soll also Frauenküsse fliehen, durch welche die Männer öfters in Gefahr zu kommen pflegen, damit sie mit reinem Gewissen und in sicherem Leben allezeit im Angesicht Gottes zu verbleiben imstande sind.«
Der Spott, den manche Kameraden verlauten ließen, sobald Augustinus sich außer Reichweite befand, hallte ebenso in Geros Gedanken wider. Wer sagt denn, dass man die Frauen küssen muss, bevor man sich mit ihnen vergnügt … und ins Gesicht schauen muss man ihnen dabei auch nicht unbedingt. Gewöhnlich folgte grölendes Gelächter, und Gero konnte nur ahnen, wie viel persönlich Erlebtes daraus sprach.
Francesco de Salazar, Geros Nebenmann, schnalzte mit der Zunge und grinste ihn an, als ob er seine Gedanken erraten hätte.
Einen Augenblick lang schloss Gero die Lider. Vielleicht weil ihn das tief stehende Licht der Nachmittagssonne blendete, vielleicht aber auch, um sein Gewissen zu reinigen. Als er sie wieder öffnete, blies der Wachhabende auf dem Turm der Komturei einmal kurz und einmal lang in ein Horn. Den Sergeanten unten im Hof war dies ein Zeichen, sogleich die schweren Eichentore zu öffnen.
Fließend tauchte der Trupp in den langen, kühlen Schatten der hohen Festungsmauern ein. Die Hufeisen der schweren Schlachtrösser donnerten über die quadratischen Pflastersteine, bevor das Geräusch schließlich verebbte, als die Reiter vor den Stallungen endgültig zum Stillstand kamen.
»Absitzen!«, befahl Gero lautstark, und fast synchron schwangen sich die überwiegend großen und breitschultrigen Männer aus ihren Sätteln.
Auf dem Hof herrschte reges Treiben. Zwischen umhereilenden Knechten und Mägden strömte eine Schar junger Bewunderer herbei. Knappen im Alter von elf bis achtzehn Jahren, die bereit standen, für ihre Chevaliers das Abschirren und Versorgen der Pferde zu übernehmen.
Matthäus von Bruch, ein schmächtiger, zwölfjähriger Lockenkopf, nahm Gero mit einem strahlenden Lächeln die Zügel des silbergrauen Percherons ab. Währenddessen entledigte sich sein Herr der eisenbeschlagenen Plattenhandschuhe und fuhr mit einer ruppigen Geste über den wuscheligen Kopf seines Knappen.
»Na, Mattes, alles klar?«
Matthäus nickte selig und führte den riesigen Kaltblüter zu den Tränken. Gero marschierte indes mit seinen Kameraden auf die Mannschaftsräume am anderen Ende des Innenhofes zu. Noch bevor sie die Unterkünfte erreichten, scherte er aus und genehmigte sich trotz seiner Eile rasch zwei Kellen Wasser aus einem der Holzeimer, die halbgefüllt am Brunnen standen. Danach hastete er mit der gesiegelten Pergamentrolle in der Linken im Laufschritt die steile Außentreppe eines dreistöckigen Sandsteingebäudes hinauf. Auf einem schmalen Absatz im ersten Stock machte er halt und öffnete unter einem leisen Knarren eine schwere, nach innen aufgehende Eichentür. Während er den langen, düsteren Gang entlang ging, überprüfte er mit einer ordnenden Geste den Sitz seiner Chlamys, jenes legendären Umhangs aus ungebleichter, heller Wolle, der nur von Rittern getragen werden durfte, die dem Tempelherrenorden ein lebenslanges Gelübde geschworen hatten.
Am Ende des Flures erwartete ihn Bruder Claudius. Mit dem Blick eines Adlers, der unvorsichtigen Kaninchen auflauert, registrierte der junge, in braun gewandete Bruder der Verwaltung jeglichen sich nähernden Besuch, der seinem Vorgesetzten galt. Ohne eine entsprechende Voranmeldung erlangte niemand Zutritt zu den Räumlichkeiten des Befehlshabers der hiesigen Komturei.
»Ihr könnt da jetzt nicht rein«, ließ Claudius vorsorglich verlauten, als er sah, dass Gero auf das Arbeitszimmer seines Komturs zuhielt. »Er sitzt zu Rate mit Vater Augustinus und will im Augenblick nicht gestört werden.« Der Bruder streckte seinen dürren Arm aus und öffnete seine Hand zu einer fordernden Geste, um die Botschaft stellvertretend in Empfang zu nehmen.
»Ich warte«, sagte Gero knapp. Claudius nickte beiläufig und wandte sich mit einer missmutigen Miene seinem Schreibpult zu, während er seinen weiß gewandeten Bruder geflissentlich ignorierte.
Wenig später öffnete sich die Tür zum Gemach des Komturs, und der Kaplan der Komturei huschte in Richtung Ausgang, ohne Gero Beachtung zu schenken. Claudius blickte kurz auf, und Gero erhielt mit einem kaum merklichen Nicken die Erlaubnis, die Räumlichkeiten seines Vorgesetzten zu betreten.
Komtur Henri d’Our war eine drahtige Erscheinung mit grau schimmernden Augen, die einem Leitwolf gleich in ständiger Wachsamkeit leuchteten und einer Hakennase, die aussah wie der Schnabel eines Falken. Zudem sorgte seine Größe von fast sieben Fuß dafür, dass man ihm uneingeschränkte Aufmerksamkeit entgegen brachte. Das dichte, weiße Haar war kurz geschnitten und voller Wirbel, was ihn auf eine sympathische Art und Weise unvollkommen erscheinen ließ. Darüber hinaus verfügte er über einen unbeugsamen Charakter und einen scharfen Verstand. Sein Herz war erfüllt von einem unnachahmlichen Sinn für Gerechtigkeit und – wenn es die Situation erlaubte – einer eigentümlichen Art von Humor.
Das Arbeitszimmer des Mannes, der sich als Herr über mehr als hundert Bewohner der hiesigen Komturei bezeichnen durfte, war nicht besonders groß. Die zwei kleinen Fenster zum Hof waren nicht verglast, sondern wurden im Bedarfsfall mit geölten Ziegenhäuten verhangen, durch die zwar kaum Licht herein drang, die aber wenigstens die Kälte abhielten. Das Mobiliar erschien karg wie überall in der Komturei; ein Bett, ein Tisch mit vier Stühlen, eine schmucklose Kommode.
Gero trat einen Schritt zurück, straffte seine Schultern und legte die Arme an den Körper an, dabei hob er kaum merklich den Kopf und sah seinem Vorgesetzten fest in die Augen. »Gott sei mit Euch, Sire!«, salutierte er. Dann überreichte er seinem Komtur die sorgsam gehütete Botschaft.
»Und mit Euch Bruder Gerard«, erwiderte d’Our freundlich, während er das gesiegelte Pergament entgegen nahm. »Schließt die Tür! Ich habe etwas mit Euch zu besprechen.« An den angespannten Gesichtszügen seines Vorgesetzten glaubte Gero zu erkennen, dass etwas nicht in Ordnung sein konnte. Und er sprach deutsch. Etwas, das Gero in den drei Jahren, die er der Komturei angehörte nur einmal erlebt hatte – anlässlich des Besuches seines Vaters, Richard von Breydenbach, der mit d’Our 1291 zusammen in Akko, im Heiligen Land, gekämpft hatte.
Zügig erbrach Henri d’Our, der dem Herzogtum Lothringen entstammte, das Siegel und überflog den Inhalt.
»Setzt Euch«, sagte er zwischen zwei Zeilen. »Unsere Unterredung wird etwas Zeit in Anspruch nehmen.«
Nachdem Gero sich niedergelassen hatte, ließ er seinen Blick durchs Zimmer schweifen. Auf einem Wandregal stand ein aufwendig verzierter Sarazenendolch, in einer Art Halterung befestigt, die es ermöglichte, das mit Juwelen geschmückte Geschenk eines sarazenischen Emirs von allen Seiten zu betrachten. Darüber hing, auf einem Holzbrett aufgezogen, eine aus Ziegenleder gefertigte, handgemalte Karte des östlichen mittelländischen Meeres. Zwei orientalische Teppiche, die den Steinboden bedeckten, waren neben den anderen Gegenständen die einzigen Luxusgüter, die sich der Komtur von Bar-sur-Aube aus seiner Dienstzeit im Outremer – den verlorenen Templerbesitzungen im Heiligen Land – zurückbehalten hatte.
D’Our ging zum Kamin und legte das Pergament sorgsam ins Feuer.
Gero fragte sich verwundert, was da vor sich ging. Papier und Pergament waren teuer, und in der Komturei wurde größter Wert auf kontinuierliche und saubere Aufzeichnungen gelegt, die man auf Jahre hinaus archivierte, und er konnte sich mit bestem Willen nicht erinnern, dass je etwas davon vernichtet worden wäre.
Ungeachtet der überraschten Miene seines Untergebenen stellte d’Our eine Karaffe mit Rotwein und zwei Becher auf den Tisch, bevor er sich ebenfalls setzte.
»Möchtet Ihr einen Schluck?« Ohne eine Antwort abzuwarten, goss d’Our den schweren, roten Rebsaft in zwei kunstvoll bemalte Steingutbecher und stellte die Karaffe zur Seite. »Ich habe erst vorgestern diesen ganz hervorragenden Tropfen aus der Provence geliefert bekommen. Wir sollten ihn kosten …« Ungewohnt vertraut erhob er seinen Becher.
Gero erwiderten die Geste, indem er ebenfalls seinen Becher hob, während ihm ein betörendes Duftgemisch von Kirschen und Brombeeren und auch ein nicht unbedeutender Anteil an Weingeist in die Nase stieg.
»Wie lange kennen wir uns jetzt?«, fragte d’Our auffordernd.
Gero zuckte mit den Achseln. »Ich gehöre dem Orden seit ungefähr sechs Jahren an, aber ich war lange Zeit in Zypern.«
»Factum ist, wir beide – Ihr und ich – kennen uns schon sehr viel länger … Ihr wart ein Kind, als ich Euch zum ersten Mal sah.«
Gero unterdrückte seine aufkommende Ungeduld. Der Komtur hatte ihn wohl kaum Platz nehmen lassen, um ihm Anekdoten aus seiner mehr oder weniger turbulenten, aber bestimmt nicht weiter erwähnenswerten Jugend zu unterbreiten.
»Ich schätze und vertraue Euch sehr, nicht zuletzt wegen Eurer Herkunft. Wie Ihr wisst, verehre ich Euren Vater als tapferen Mann, der dem Orden immer loyal zur Seite gestanden hat, und das ohne je zu den Unseren zu gehören.« D’Our trank und setzte den Becher bedacht ab. Wieder sah er Gero mit seinen steingrauen Augen an, als ob er zum Grunde seiner Seele vordringen wollte. »Ihr habt einen Eid zur Verschwiegenheit geleistet, trotzdem möchte ich Eure Zusicherung, dass das, was ich jetzt sage, hier in diesem Raum bleibt – für alle Zeiten.« Er ließ fragend seine Augenbrauen hochschnellen.
Gero nickte beflissen. »Ihr könnt Euch auf mich verlassen, bei meiner Ehre, Sire«, flüsterte er heiser.
»Also dann«, begann d’Our leise mit vielsagendem Blick. »Unsere geheimen Quellen am Hofe in Paris haben in Erfahrung bringen können, dass König Philipp in der Nacht von Donnerstag dem 12. auf Freitag den 13. einen Angriff auf all unsere Niederlassungen in Franzien plant. Die Befehle liegen angeblich bereits seit September in Guillaume de Nogarets Hauptquartier. Es war anzunehmen, dass dessen unerwartete Ernennung zum Großsiegelbewahrer nicht ohne Grund erfolgt ist. Nach allem, was wir bis jetzt wissen, liegen im ganzen Land verteilt in den Kommandanturen der königlichen Soldaten versiegelte Botschaften vor, die entsprechende Befehle enthalten und bei Androhung von Todesstrafe erst morgen Abend geöffnet werden dürfen. Somit bleibt uns wenig Zeit entsprechende Vorkehrungen zu treffen.«
Gero starrte seinen Komtur ungläubig an. »Wie ist so was möglich …?«
»Die offizielle Vermutung für das Vorhaben des Königs ist«, fuhr d’Our mit einem ironischen Lächeln fort, »dass er dringend Geld braucht, und da wir es ihm nicht freiwillig geben, sucht er einen Grund, um es sich mit einem Überraschungscoup zu holen. Bei einer angekündigten Kontrolle müsste er davon ausgehen, nicht nur auf verschlossene Türen zu stoßen, sondern auch auf verschlossene Tresore. Wegen dieser unerfreulichen Entwicklung haben wir strikte Anweisung erhalten, alle Vermögenswerte, die in den Komtureien lagern, unverzüglich an einen sicheren Ort zu bringen. Könnt Ihr mir folgen?«
Es dauerte eine Weile, bis Gero die Tragweite dieser arglos vorgetragenen Rede erfasste. Danach klopfte sein Herz aufgeregt, und eine aufsteigende Hitze durchflutete seine Adern.
»Somit erteile ich Euch den Befehl«, sprach d’Our weiter, »die fünf fähigsten unter Euren Brüdern auszusuchen und mit ihnen die uns anvertrauten Gelder und Wechselbriefe der ortsansässigen Kaufleute morgen Nachmittag in unser Depot im Wald des Orients zu verbringen. Vorab werdet Ihr Euch in Beaulieu mit Theobald von Thors treffen, der den gemeinsamen Treck aller umliegenden Komtureien anführen wird.«
»Wissen Papst und Großmeister davon?« Gero vergaß ganz, dass er keine Erlaubnis erhalten hatte, Fragen zu stellen. »In Sachen Finanzen, in der Gerichtsbarkeit, bei der Wahl des Großmeisters ist es ein dem Orden verbrieftes Recht, dass sich mit Ausnahme des Papstes niemand in unsere Angelegenheiten mischen darf, selbst wenn er ein König ist.«
»Die Befehle zum Handeln kommen direkt vom Großmeister«, erwiderte d’Our in lakonischem Tonfall. »Jacques de Molay hat uns darüber hinaus befohlen, nichts zu unternehmen, was den König warnen könnte«, bemerkte der Komtur mit zweifelnder Miene. »Trotz allem glaubt er nicht daran, dass Philipp von Franzien einen solch hinterlistigen Überfall wirklich wagen wird. Erst heute haben unser verehrter Großmeister und Raymbaud de Charon als sein Vertreter der Einladung des Königs zur Beerdigung von Philipps Schwägerin Folge geleistet. Soweit ich weiß, soll Molay in Begleitung unseres geschätzten Präzeptors von Zypern sogar den Zipfel von Catherine de Courtenays Leichentuch tragen.« D’Ours Miene verriet, dass er diesen Umstand angesichts der drohenden Katastrophe genauso merkwürdig fand wie Gero.
»Ich vermute dahinter einen gut überlegten Schachzug von beiden Seiten«, ergänzte er. »Frei nach dem Wahlspruch: Du sagst mir nicht, dass du mich hasst und ich sage dir nicht, dass ich es weiß. Ich hingegen glaube nicht, dass der König sein Ansinnen aufgeben wird, den Orden in seinen Besitz zu bringen, schon gar nicht wegen einer solch einfältigen Geste. Und was den Papst betrifft, so hat dieser längst keine eigene Meinung mehr. Er steht finanziell mit dem Rücken zur Wand – etwas, das er mit unserem schönen Philipp gemeinsam hat, und nichts schmiedet so leicht Allianzen wie geteiltes Leid. Zudem droht das Herz des Papstes in Angst zu ertrinken. Nachdem seine Vorgänger Bonifatius VIII. und Benedikt XI. so unvermittelt und rätselhaft ins Jenseits befördert wurden, wird er sich jeden Schritt, den er tut, gebührlich überlegen, um zu verhindern, dass es ihm genauso ergeht.« D’Our setzte ein ironisches Lächeln auf. »Aber das ist längst noch nicht alles«, fügte er verschwörerisch hinzu. »Es existiert eine Art Vorsehung«, erklärte er knapp. »Diese bestätigt den beginnenden Untergang des ›Ordens der armen Ritter Christi vom Tempel Salomons‹ im Herbst des Jahres 1307 und die Verhaftung aller Templer in Franzien durch König Philipp IV. an einem Freitag den 13.«
Gero blickte erschocken auf, doch d’Our vollführte eine beschwichtigende Handbewegung. »Was allerdings nicht bedeutet, dass unser Schicksal bereits besiegelt wäre. Molay weiß davon, aber er glaubt an die Rettung des Ordens durch den Allmächtigen, und sei es im letzten Augenblick. Daher bin ich weder befugt, etwas zu unternehmen, das die Angehörigen des Ordens generell in Alarmbereitschaft versetzt, noch darf ich den Befehl zur Flucht erteilen.«
»Was hat das alles zu bedeuten?« Gero spürte, wie seine Knie weich wurden.
»Habt Ihr schon einmal etwas vom ›Hohen Rat‹ gehört?«
»Selbstverständlich.« Zusehends stellte sich Gero die Frage, in welche ungeheuerlichen Geheimnisse des Ordens der einfache Komtur von Bar-sur-Aube sonst noch eingeweiht war. Unter den gewöhnlichen Ritterbrüdern wusste kaum jemand etwas über den Hohen Rat der Templer. Manche Kameraden frotzelten, er sei so geheim, dass es ihn womöglich gar nicht gäbe.
»Soweit mir bekannt ist, handelt es sich um die vertrauenswürdigsten unter all unseren Brüdern.« Gero war seine Unsicherheit anzumerken, als d’Our nicht sofort reagierte. »Nach einem speziellen Kodex auserwählt. Gesichtslose Gestalten, von denen niemand weiß, ob sie wirklich existieren. Es heißt, sie beraten den Großmeister in allen entscheidenden Fragen, die den Orden betreffen, und angeblich sollen sie über seherische Fähigkeiten verfügen, aber ich kenne niemandem, der schon einem von ihnen begegnet wäre.«
»Einer von ihnen steht vor Euch«, sagte d’Our unumwunden.
»Ihr?« Gero sah seinen Komtur entgeistert an, doch dann besann er sich augenblicklich. »Nicht, dass Ihr denkt, ich halte Euch nicht für würdig genug, aber …«
D’Our lächelte matt. »Bei der Auswahl geht es nicht nach dem Dienstgrad. Man wird nach seinen Fähigkeiten ausgewählt und zur Tarnung in ein unbedeutendes Amt eingewiesen.«
Gero nickte abwesend, während er sich überlegte, wer noch alles zum inneren Kreis gehören konnte, ohne dass auch nur irgendjemand die leiseste Ahnung davon hatte.
»Ist Euch die Bezeichnung ›Haupt der Weisheit‹ ein Begriff?« D’Our sah ihn auffordernd an.
»›Haupt der Weisheit‹? Meint Ihr das viel beschworene Haupt des Baphomet?«, fragte Gero zögernd.
»Baphomet ist aus dem Bedürfnis nach gefährlichen Halbwahrheiten entstanden, weil hohe Mitglieder des Ordens sich nicht an ihr Schweigegebot halten konnten und meinten, sie müssten mit etwas prahlen, was sie selbst nie zu Gesicht bekommen haben.« D’Ours Miene verfinsterte sich schlagartig, während ihm ein Schnauben entfuhr. »Unseligerweise haben einige dieser falschen Kopien jenes Baphomet mit dazu beigetragen, dass König Philipp es auf uns abgesehen hat.«
»Wovon sprecht Ihr?«
»Philipp IV. hat seine Witterung aufgenommen. Er glaubt schon seit längerem, all unser Wissen würde einer geheimen Magie entspringen.«
»Ist dieses Haupt etwas Heiliges?«, fragte Gero zögernd, wobei er zugleich die unbestimmte Befürchtung hegte, d’Our könne ihn für einfältig halten, weil er nichts Genaues darüber wusste. Selbstverständlich war er mit allen religiösen Lehren des Abend- und des Morgenlandes vertraut. Er hatte die streng geheime Bibel der Katharer gelesen, die in zwei erbarmungslosen Kreuzzügen fast vollständig vernichtet worden waren, unter anderem, weil sie im Alten Testament den Schöpfergott einer bösen Welt beschrieben sahen. Und er wusste um das Sefer Jezira, einer Ansammlung uralter hebräischer Texte, in denen das Geheimnis der Weltordnung in Zahlen und Buchstaben dargelegt wurde und die er unter strikter Geheimhaltung für das Scriptorium der Komturei ins Lateinische übersetzt hatte. Ein gefährliches Unterfangen, weil die christliche Obrigkeit es nicht gut hieß, wenn man sich mit dem geheimen Wissen der Juden beschäftige. Aber bisher verweigerten ihm all diese faszinierenden Einsichten einen grundlegenden Beweis ihrer Berechtigung.
»Nein«, schmunzelte d’Our. »Wie alles existiert es augenscheinlich mit Wissen des Allmächtigen, doch was seine Wirkungsweise betrifft, so könnte es vielmehr eine Erfindung des Antichristen sein, obwohl es uns immer wertvolle Dienste geleistet hat.«
»Was meint Ihr damit?« Gero fixierte seinen Komtur, als ob er eine Schlange und d’Our das Kaninchen wäre.
»Ich will mich nicht in Einzelheiten verlieren. Zudem ist es mir nicht erlaubt, Euch über das notwenige Maß hinaus in Kenntnis zu setzen. Fest steht, es hat uns die Vernichtung des Ordens prophezeit und kann gleichsam zu seiner Rettung beitragen. Doch bevor wir uns seiner bedienen, müssen wir sicher sein, ob die Prophezeiung auch wirklich eintrifft.«
»Was sollen wir jetzt tun?« Gero vergaß jeglichen Respekt. Er war aufgebracht, und die Hoffnung auf eine halbwegs befriedigende Antwort, die sein zerstörtes Weltbild wieder in ein anständiges Licht rücken sollte, hatte er noch nicht aufgegeben.
»Der Hohe Rat hat aus reiner Vernunft und gegen den Willen unseres Großmeisters bestimmt, dass wir alle Komtureien mit Ausnahme der Ordensburgen in Paris und Troyes – dort, wo der Großmeister sich zurzeit aufhält – weitgehend evakuieren, und zwar ohne Wissen der jeweiligen Bewohner.«
Gero schaute verblüfft auf. »Wie soll das vor sich gehen?«
»Die Ritter der umliegenden Komtureien werden – soweit möglich – zu Aufgaben herangezogen, die sie erst nach Mitternacht zu ihren angestammten Häusern zurückkehren lassen. Sollte es bis dahin zu einem Übergriff von Philipps Soldaten gekommen sein, besteht bei der Rückkehr immer noch die Möglichkeit zur Flucht. Die Knappen verbringen wir nach Clairvaux. Mit Ausnahme von Matthäus. Er wird mit Euch reiten. Das Gesinde verbleibt hier, um keinen unnötigen Verdacht zu erregen und auch, weil wir hoffen, dass es Philipp von Franzien nur auf unmittelbare Angehörige des Ordens abgesehen hat. Und jetzt komme ich zu Eurer eigentlichen Aufgabe.«
D’Our atmete tief durch und sah Gero ernst an. »Für den Fall, dass die Befürchtungen des Hohen Rates eintreffen, werdet Ihr Euch unverzüglich in die deutschen Lande begeben. Euer Knappe und die beiden Ordensbrüder Johan van Elk und Struan MacDhughaill werden Euch begleiten. Matthäus werdet Ihr bei den Zisterziensern in Hemmenrode in Sicherheit bringen. Ich bin sein einziger noch lebender Verwandter. Er wäre ein zu kostbares Unterpfand für König Philipp, wenn er mich und dazu noch meinen Neffen zu fassen bekäme.«
Bevor d’Our fortfuhr, trank er noch einen hastigen Schluck, stellte den Becher zur Seite und griff nach einer Karte, die neben ihm auf einem Stuhl lag. Geschickt entrollte er den erstaunlich genauen Plan.
»Zusammen mit den beiden Ritterbrüdern werdet Ihr den Rhein überqueren und Euch in die Zisterzienserabtei von Heisterbach begeben. Ich weiß von Eurem Vater, dass Euch die Örtlichkeit bekannt ist. Abt Johannes von Heisterbach dort ist im Rahmen seiner Aufgabe eingeweiht. Er wird Euch nach Bekanntgabe eines Losungswortes – es lautet ›computatrum quanticum‹ – zu unserem Mittelsmann führen. Dieser Mann ist ebenfalls ein geheimer Bruder des Hohen Rates«, sprach d’Our weiter. »Er ist wie ich in die Angelegenheit eingeweiht. Danach werdet Ihr ihn zu einer verborgenen Kammer unterhalb des Refektoriums führen. Über den sich anschließenden Gewölbekeller gelangt Ihr zu einer eisernen Tür. Sie führt zum Abwasserkanal. Öffnet sie und geht zwölf Schritte in östliche Richtung, dort macht der Gang einen leichten Knick und wendet sich Richtung Nordosten. Von dort aus sind es noch einmal zwölf Schritte, und Ihr befindet Euch direkt unter dem Klosterfriedhof. Dort wendet Ihr Euch nach rechts. Zwischen den Mauersteinen findet Ihr eine kleine Vertiefung, die sorgsam mit Lehm verputzt ist. Brecht sie auf, und ergreift den darunter liegenden Hebel. Mit ihm lässt sich eine geheime Pforte öffnen. Dahinter befindet sich die Kammer, in der das Haupt der Weisheit verborgen liegt.«
»Ich kenne den Gang«, sagte Gero leise. »Er dient den Brüdern unter anderem als Fluchtweg. Wenn die Mönche eine Verfehlung begangen haben, müssen sie zur Strafe die Rinne schrubben. Acht Latrinenlöcher führen die Exkremente direkt dort hinein.« Ihm war anzusehen, wie unwahrscheinlich er es fand, dass ausgerechnet in diesem stinkenden Abfluss eine Art Heiligtum verborgen sein sollte.
»Wenn Ihr dort angekommen seid«, fuhr d’Our unbeeindruckt fort, »eröffnet Ihr dem Mittelsmann ein weiteres Losungswort. Dafür müsst Ihr die erste Strophe des zweiten Antiphon von ›Gottes Größe und Güte‹ anstimmen … Laudabo Deum meum in vita mea … Geht Euch das zu rasch?« D’Our bedachte seinen Untergebenen mit einem fragenden Blick.
Wie betäubt schüttelte Gero den Kopf.
»Was Bruder Struan und Bruder Johan angeht, so werdet Ihr sie nur insoweit einweihen, wie es Euch notwendig erscheint. Es reicht vollkommen aus, wenn Sie darum wissen, dass sie Euch in die deutschen Lande begleiten müssen. Alles weitere erfahren sie – wie Ihr selbst – vor Ort vom Bruder des Hohen Rates.«
»Und was geschieht, wenn der Überfall auf den Orden gar nicht stattfindet?« Geros Blick offenbarte seine Ratlosigkeit.
»Dann hat unser Großmeister Recht behalten, und der angekündigte Orkan rast tatsächlich, ohne einen Schaden zu hinterlassen, an uns vorüber«, bemerkte d’Our mit einem fatalistischen Unterton in seiner Stimme. »Natürlich bleibt dann alles beim Alten. Ihr werdet nicht fliehen, und unser heutiges Gespräch hat nie stattgefunden. Deshalb ist es Euch auch nicht erlaubt, irgendjemanden in die Einzelheiten einzuweihen, bevor sich nicht abzeichnet, wohin die Reise geht. Wie ihr wisst, wimmelt es allenthalben von Spionen. König Philipp darf keinesfalls erfahren, wo unsere Quellen sprudeln.«
»Gesetzt den Fall, es kommt zur besagten Verhaftungswelle, wird man uns auch außerhalb Franziens verfolgen?«
»Das wird nicht geschehen«, erwiderte d’Our mit einer erstaunlichen Sicherheit in der Stimme. »Wenn alles so kommt, wie es sich abzeichnet, wird man den Orden in den deutschen Landen fürs Erste unbehelligt lassen. Trotz allem müsst Ihr auf der Hut sein. Und dass Ihr Euch in Franzien nicht erwischen lassen dürft, versteht sich von selbst.«
Gero nickte steif. Begreifen konnte er all das nicht, aber er war schließlich darauf gedrillt, Befehle entgegen zu nehmen, gleichgültig, ob er ihre Tragweite verstand oder nicht.
»Noch eins«, sagte d’Our. »Ich möchte, dass ab sofort alle Ritter Ihre Herkunftsnachweise mit sich führen, sobald sie die Komturei verlassen. Gebt das an Eure Brüder weiter!« Der Komtur erhob sich. »Die heilige Jungfrau soll über Euch wachen, Bruder Gerard.«
»Und über Euch, Sire«, erwiderte Gero kaum hörbar, als er sich ebenfalls erhob. Ihn schwindelte, und er musste schlucken, als er seinem Komtur in die hellen, wachen Augen sah. »Was wird aus Euch, Sire?«
»Macht Euch keine Sorgen«, erwiderte d’Our und klopfte ihm auf die Schulter.
»Ihr seid mein Garant dafür, alles getan zu haben, was dem Orden zur Rettung genügen wird. Ich weiß, ich kann mich auf Euch verlassen. Denkt immer daran, nicht nur der Orden ist in Gefahr, wenn der schöne Philipp bekommt, was er will. Die ganze Menschheit steht auf dem Spiel. Der Niedergang unseres Ordens würde Millionen das Leben kosten und Krieg, Hunger und Verdammnis in die christliche Welt bringen, und das auf Hunderte von Jahren hinaus.«
2
Mittwoch, 11. Oktober 1307, abends – Fin Amor
Mit einem Gefühl, als hätte ihn der Schlund der Hölle geradewegs auf den Treppenabsatz gespuckt, fand Gero sich draußen vor dem Gebäude wieder.
Die Ausführungen seines Komturs waren beängstigend genug, um seinem Leben schlagartig alle Freude zu nehmen. Trotzdem musste er einen kühlen Kopf bewahren.
Bevor er die exakt behauenen Stufen hinunterging, hielt er sich einen Moment lang am Gemäuer fest, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.
Ohne Umweg begab er sich dann zum Dormitorium, einem lang gezogenen Mannschaftsbau, gegenüber dem Haupthaus, der die Schlaf- und Wohnstätten der Ritterbrüder und Sergeanten beherbergte.
Dort angekommen, wandte er sich zu einem der zwölf in Reih und Glied stehenden Buchenholzbetten. Erschöpft streifte er Mantel, Schwert, Messergürtel und Kettenhemd ab. Dann ließ er sich der Länge nach auf seine Liege fallen. Auch die anderen jungen Männer hatten sich auf ihre angestammten Lagerstätten verteilt. Stiefel und Kettenhemden lagen ungeordnet auf den glatt geschliffenen Holzplanken.
Eine weitere Gruppe weiß gewandeter Männer betrat den Saal.
»Öffnet die Fenster«, rief einer der Ankommenden. Stephano de Sapin, ein großer schlanker Bursche mit einem eleganten Gang, rümpfte die Nase wie eine Parfümmischerin beim Ausschluss übel riechender Duftessenzen. Strafend warf er einen Blick auf die vereinzelt umherstehenden Trennwände aus Holz, über die einige seiner Kameraden eine größere Anzahl feuchter, ungewaschener Filzsocken zum Trocknen gelegt hatten.
Während Gero sich aufsetzte, um sich seiner Stiefel zu entledigen, fiel sein Blick auf Johan van Elk, der mit einem leisen Fluchen zur Tür hereinstolperte, weil dort jemand ein Kettenhemd hatte liegen lassen. Der rothaarige Bruder entstammte den deutschen Landen wie er selbst und war der jüngste Spross eines niederrheinischen Grafengeschlechts. Schreckliche Brandnarben entstellten das ehemals schöne Antlitz des Bruders, ansonsten war er groß und athletisch wie alle anderen, und nur anhand seiner ungelenken Bewegungen konnte man sein wahres Alter erahnen, das kaum über zwanzig lag.
»Jo«, rief Gero ihm auf Deutsch entgegen. »Da bist du ja endlich.«
Der Rotschopf richtete seine Aufmerksamkeit auf Gero, indem er ihm grinsend entgegen ging und ihm kameradschaftlich auf die Schulter klopfte. »Was ist dir denn über die Leber gelaufen?«, fragte er fürsorglich. »Du siehst ja ganz blass aus.«
Gero antwortete nicht sogleich. Wenn er Johan anschaute, musste er immer daran denken, wie schnell das Schicksal einen scheinbar unbesiegbaren Ritter in ein hilfloses Häufchen Elend verwandeln konnte. Er erinnerte sich noch gut, wie der frisch aufgenommenen Bruder vom Niederrhein bei der Aushebung eines Räubernestes im Wald von Clairvaux die unselige Begegnung mit einer Pechnase gemacht hatte. Nie würde er die markerschütternden Schreie des jungen Kameraden vergessen, als das plötzlich herabstürzende heiße Pech durch die Sichtschlitze in dessen Topfhelm gedrungen war und sich von dort aus über Wangen und Ohren verteilt hatte. Ohne nachzudenken, hatte er Johan gepackt und ihm Helm samt Haube vom Kopf gerissen. Anschließend hatte Gero nicht gezögert und den am ganzen Körper vor Schmerz zitternden Schwerverletzten zu einem angrenzenden Bach geschleppt und ihn kopfüber ins kalte Wasser gesteckt. Nur so war es möglich gewesen, die tiefen Verbrennungen zu kühlen und gleichzeitig zu reinigen, so dass eine allseits befürchtete, lebensbedrohliche Vereiterung ausgeblieben war.
»Wenn ich es so gut hätte wie du und den halben Tag im Scriptorium verbringen dürfte«, erwiderte Gero mit einem halbherzigen Lächeln, »würde es mir vielleicht besser gehen.«
Bevor Johan etwas erwidern konnte, mischte sich Francesco de Salazar, der dunkel gelockte Bannerträger, in das Gespräch ein.
»Wie wäre es, wenn Ihr das Ganze noch mal in Franzisch wiederholen würdet – Bruder Gerard? Ist Amtssprache hier, nur für den Fall, dass Ihr es vergessen habt«, dozierte der hübsche Spanier, dessen dunkel gebräunte Haut seine südländischen Vorfahren verriet.
»Francesco de Salazar, verliere du erst einmal deinen spanischen Bauernakzent«, erwiderte Johan in fließendem Katalanisch. Dabei ließ er es sich nicht nehmen, das »r« besonders genüsslich auf der Zunge zu rollen. »Bevor du anderen vorschreibst, wie sie’s miteinander halten sollen.« Einige der Umherstehenden, die Johans Replik verstanden hatten, lachten amüsiert.
Francesco, der einem angesehenen Grafengeschlecht des Königreiches Navarra entstammte, richtete sich zu voller Größe auf und entfaltete sein breites Kreuz wie die Schwingen eines Adlers, während er die Fäuste in seine schmalen Hüften stemmte. »Johan van Elk, denkt Ihr etwa, nur weil Ihr Euch glücklich schätzen dürft, dem Schoß einer katalanischen Rose entsprungen zu sein, lasse ich Euch Eure Unverschämtheiten durchgehen?« Geschickt umrundete er Geros Bett und verpasste Bruder Johan eine kräftige Kopfnuss.
Im Nu war zwischen dem Rotschopf und seinem braun gelockten Kontrahenten ein heftiges Gerangel im Gange, das jedoch einen unzweifelhaft freundschaftlichen Charakter hatte.
Gero verspürte einen plötzlichen Stich im Herzen. Niemand von den Brüdern ahnte auch nur, welch grausames Schicksal ihnen womöglich bevorstand.
Und während einige von ihnen sich auf die verbleibenden Abendstunden vorbereiteten und mit Bürsten und Leinentüchern bewaffnet das Dormitorium verließen, um sich im Waschhaus vom Staub des Tages zu befreien, schaute Gero nachdenklich in die Runde. »Hat einer von euch Stru gesehen?«, rief er über die lärmenden Männer hinweg.
»Hat einer den lausigen Schotten gesehen?«, wiederholte ein blasser, blonder Jüngling mit gehässigem Unterton. Es war Guy de Gislingham, ein englischer Bruder, der noch nicht lange der Komturei angehörte, und soweit Gero bekannt war, dachte er wohl auch nicht daran, länger zu bleiben. Es hieß, er sei der Sohn eines einflussreichen englischen Adligen und er weile in Bar-sur-Aube, um sich während seines Aufenthaltes in französischer Sprache fortzubilden und um seine Kenntnisse in der Kampfkunst der Templer im Ursprungsland des Ordens zu erweitern. Danach würde er in sein Heimatland zurückkehren. Seiner eigenen Aussage nach beabsichtigte er jedoch, später einmal einen höheren Posten im englischen Zweig des Ordens zu übernehmen. Geld hatte seine Familie offensichtlich genug, und daher würde er keine Mühe haben, in Sphären aufzusteigen, die jedem gewöhnlichen Ritterbruder aus dem ärmeren Niederadel verschlossen blieben. Trotz der kurzen Zeit seiner Anwesenheit stellte sich nicht nur Gero die Frage, warum man den hochnäsigen Kerl nicht in Paris im Hauptquartier des Ordens belassen hatte, wo er mit seinem Standesdünkel weitaus besser aufgehoben gewesen wäre.
»Dafür, dass Ihr ein Templer und damit einer von uns sein wollt, lässt es Euch auffallend an Disziplin mangeln, Bruder Guy«, sagte Gero mit gereiztem Unterton in der Stimme.
Struan MacDhughaill nan t-Eilean Ileach, wie der vollständige, gälische Name des schottischen Kameraden lautete, war nicht nur Geros Bruder im Orden, sondern zugleich sein bester Freund. Während des Überfalls feindlicher Mamelucken im Herbst des Jahres 1302 auf die Inselfestung Antarados im syrischen Meer hatte Stru, wie Gero ihn gelegentlich nannte, ihm das Leben gerettet, als er ihn vor dem todbringenden Schlag eines Feindes bewahrte. Danach hatte er Gero, schwer verletzt und ohnmächtig, auf seine Schultern gepackt und ihn im Pfeilhagel der nachfolgenden Mamelucken auf das kleine Versorgungsschiff des Ordens getragen, das ihnen noch geblieben war. Erst bei der Überfahrt nach Zypern, auf den wiegenden Planken des Schiffes, entschloss sich Geros Seele, ins Diesseits zurückzukehren. Hier erzählten ihm die wenigen anderen Überlebenden, die sich ebenfalls unter schwierigen Bedingungen an Bord geschleppt hatten, wem er – außer Gott dem Allmächtigen – seine weitere Existenz zu verdanken hatte, und warum er somit seinen Eintritt ins Paradies noch einmal verschieben durfte. Struan hatte unterdessen Geros aufgerissenen Schulterkopf mit einem blutstillenden Verband versorgt und für die Dauer der Reise die spärlichen Wasserrationen mit ihm geteilt, um das Fieber zu senken. Vier Monate nach ihrem Eintreffen in Zypern war Gero soweit genesen, dass man ihn und auch seinen Retter im Frühjahr des Jahres 1303 als Angehörige eines Austauschbataillons nach Franzien beorderte. Beide wussten es zu schätzen, dass man sie gemeinsam der hiesigen Komturei zugeteilt hatte.
Guy de Gislingham kannte diese Geschichte, aber sie beeindruckte ihn nicht – ihm war alles Schottische verhasst und ein schottischer Held undenkbar.
»In meiner Heimat weiß jeder, dass die Schotten das Waschen für überflüssig halten«, erklärte er in gehässiger Selbstgefälligkeit. »In ihren feuchten Steinbaracken ohne Fenster hausen sie wie die Wilden. Das Torffeuer in ihren Hütten verbrennen sie ohne Abzug, und am Ende sind sie geräuchert wie die Aale …« Gislinghams Bemerkungen erhielten keinerlei Zustimmung, doch anscheinend störte es ihn nicht. Im Gegenteil, die meisten Brüder schauten peinlich berührt zu Boden, oder sie versuchten sich auffällig mit anderen Dingen zu beschäftigen und entfachten damit ungewollt in ihm den Ehrgeiz, noch einen Schritt weiterzugehen.
»Wenn Ihr es nicht glaubt, Bruder Gero, dann reist doch selbst einmal hin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im Hause Breydenbach solch widerwärtige Zustände herrschen.« Guy schenkte Gero einen provozierenden Blick, der mit einem gefährlichen Aufblitzen in den sonst so überlegt wirkenden blauen Augen erwidert wurde.
»Lasst mein Zuhause aus dem Spiel und das von Struan erst recht«, zischte Gero wütend. »Hier sind wir alle gleich, falls unser arroganter Bruder das noch nicht bemerkt haben sollte.«
Guy zuckte mit den Schultern und wandte sich gelangweilt ab. Sein Desinteresse an Geros Retourkutsche unterstrich er damit, indem er akribisch die Reinigung seines Kettenhemdes fortsetzte.
»Struan hat sich krank gemeldet«, wusste Francesco zu berichten und hoffte, damit die Spannung ein wenig beizulegen.
Gero hob fragend die Brauen.
Guy de Gislingham hielt inne und drehte sich langsam um. Linkisch legte er seinen Kopf schief, während sein wissender Blick über die Anwesenden glitt. »Schon ziemlich lange krank, der Junge – hat sich wohl ein hartnäckiges Leiden eingefangen, der Arme.« Ein höhnisches Grinsen glitt über seine Gesichtszüge, die nicht unbedingt so edel waren wie seine Herkunft. Abwechselnd blickte er von Gero zu Johan, die mittlerweile nebeneinander standen. »Vielleicht sollten wir Vater Augustinus befragen, ob es die speziellen Symptome einer Krankheit sind, vor der er uns fortwährend warnt.« Guys hässliches Kichern forderte Gero geradezu heraus.
Mit zwei mächtigen Schritten war der deutsche Ritter am Bett des englischen Bruders angelangt. Seine eiserne Faust packte das Leinenhemd des Engländers und drehte es geschickt zu einem Strick. Dann riss er den unsympathischen Bruder ohne Gnade in die Höhe, geradeso, als ob er ihn an einen Haken hängen wollte.
Guy de Gislingham, der eine halbe Elle kleiner war als Gero, röchelte, während sein Gesicht blutrot anlief und sein ansonsten unscheinbarer Kopf unter der Strangulation immer weiter anzuschwellen schien. Vergeblich versuchte er sich zu befreien, indem er mit den Beinen strampelte und sich verzweifelt bemühte, mit beiden Händen Geros Faust zu lockern. Das Einzige aber, was ihm blieb, war das Sehnenspiel in den mächtigen Unterarmen seines Gegners zu beobachten. Er besaß nicht einmal genug Luft, um zu schreien. Und es hätte ihm wahrscheinlich auch niemand geholfen, hätten die Brüder nicht gefürchtet, Gero könnte den Engländer töten und dafür am Galgen landen.
Mit einem Mal spürte Gero, wie mehrere starke Arme an ihm zerrten und Johan van Elk beruhigend auf Deutsch auf ihn einredete. »Bruder, lass ihn los … du machst dich nur unglücklich und uns dazu … bitte!«
Mit einem Ruck stieß Gero seinen Widersacher zu Boden. Seine Nasenflügel blähten sich wie die eines schnaubenden Stiers, und sein Atem ging stoßweise. Es fehlte nicht viel, und er hätte vor dem immer noch nach Luft ringenden Bruder Guy ausgespuckt. Abrupt drehte er sich weg und ging zurück zu seinem Lager. Johan, der noch einen Moment verharrte und auf den verstört drein schauenden Bruder Guy herabblickte wie auf ein Stück Aas, vergaß hingegen seine gute Kinderstube.
»Arschloch!«, zischte er auf Deutsch, und als Gislingham ihn mit blöden Augen anstierte, beugte er sich zu ihm hinab und buchstabierte dem begriffsstutzigen Bruder in englischer Sprache, indem er jeden einzelnen Buchstaben betonte.
»A-s-s-h-o-l-e!«
Dann richtete er sich auf und ließ den verblüfften Bruder Guy einfach sitzen.
Dieser krabbelte mühselig wie ein Käfer, der zu lange auf dem Rücken gelegen hat, auf sein Bett, während er sich seinen strangulierten Hals massierte. Mit zusammengekniffenen Augen sah er hasserfüllt zu Gero hinüber, der nicht weit entfernt stand und ihn keines Blickes würdigte.
Die übrigen Brüder beobachteten mit Argusaugen, wie Gero auf seinem Bett offenbar unbekümmert einige Kleidungsstücke zusammenlegte und sich den Anschein gab, als ob nichts geschehen wäre.
Durch die offenen Fenster drang das Läuten der Glocken herein und rief all die Brüder zum abendlichen Vespergesang, die nicht von den Stundengebeten befreit waren. Gero zog sich rasch seinen Haushabit über und sah sich nach seinem deutschen Bruder um, der bereits neben ihm stand. »Kommst du mit zur Vesper?«
Johan nickte. »Was wolltest du von mir?«
»Ich muss im Auftrag des Komturs ein paar Brüder für einen Einsatz rekrutieren, und du bist neben Struan einer derjenigen, die dafür in Frage kommen«, antwortete Gero. »Nach dem Vespermahl werden wir im Scriptorium eine kurze Besprechung abhalten.«
Als die beiden sich wenig später anschickten, das Gebäude zu verlassen, legte jemand von hinten eine Hand auf Geros Schulter. Er drehte sich um und sah in die hämisch grinsende Miene von Guy de Gislingham.
»Gisli – es reicht dir wohl nicht, dass du überlebt hast …«, murmelte Gero und fegte mit einer entschlossenen Bewegung den Arm des Engländers hinweg, als ob er sich von einem lästigen Insekt befreien wollte.
In Guys Stimme schwang eine satanische Genugtuung, als er antwortete.
»Breydenbach, dein schottischer Freund ist geliefert, ob es dir passt oder nicht … Ich habe Beweise. Spätestens beim Kapitel am nächsten Sonntag zieht sich die Schlinge zu. Dann ist er seinen Mantel los und, wenn’s nach den Regeln geht, nicht nur das.«
»Wovon sprichst du überhaupt, du Hund?«, zischte Gero.
Gislingham grinste. »Mir ist zu Ohren gekommen, dass dein werter Freund nicht nur sein barbarisches Herz, sondern auch sein eindrucksvollstes Körperteil an eine willige Dame verschenkt hat«, säuselte der Engländer, »und ich spreche hier weder von seiner großen Nase noch von der heiligen Jungfrau, wie du dir sicher denken kannst.« Unvermittelt brach der Engländer in Gelächter aus.
Gero schlug Gislinghams schlechter Atem entgegen. Im linken Unterarm des Deutschen spannten sich die Sehnen, und die Finger der linken Hand vereinten sich wie von selbst zu einem alles vernichtenden Faustschlag.
Doch bevor es dazu kam, dass Gero sämtliche Ordensregeln vergaß und Bruder Guy alle verbliebenen Zähne ausschlug, packte Johan ihn an seinem Habit und zerrte ihn in Richtung Kapelle.