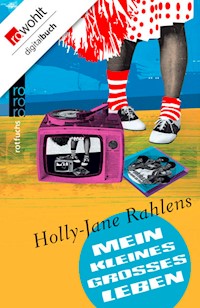9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Dass Lizzy mit ihrem Vater unbedingt an die Küste ins Hotel Ainsley Castle ziehen musste, gefällt ihr ganz und gar nicht. Noch viel weniger gefällt Lizzy allerdings ihre neue Stiefmutter, die ständig etwas an ihr auszusetzen hat. Eines Tages erhält sie unheimliche E-Mails: Irgendjemand scheint ganz genau zu wissen, wie es Lizzy geht, was sie tut und – was sie denkt! Wer ist diese Person? Als dann noch ein Mädchen namens Betty auftaucht, das Lizzy bis aufs Haar gleicht, ist klar, dass etwas ganz und gar nicht normal ist. Gemeinsam mit ihrem Freund Mack versuchen die beiden Mädchen, hinter Das Rätsel von Ainsley Castle zu kommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 276
Ähnliche
Holly-Jane Rahlens
Das Rätsel von Ainsley Castle
Aus dem Englischen von Bettina Münch
Über dieses Buch
Lizzy wohnt seit neuestem mit ihrem Vater und dessen neuer Frau an der schottischen Küste im Hotel Ainsley Castle. Die neue Situation behagt Lizzy ganz und gar nicht, denn ihre Stiefmutter ist ein echter Drachen. Außerdem hat Lizzy immer öfter das Gefühl, als hätte sie Erinnerungslücken oder seltsame Schwindelanfälle. Dann erhält sie auf einmal unheimliche E-Mails: Jemand scheint ganz genau zu wissen, wie es Lizzy geht, was sie tut und – was sie denkt! Wer ist diese Person? Als dann noch plötzlich ein Mädchen namens Betty auftaucht, das Lizzy bis aufs Haar gleicht, ist klar, dass irgendetwas ganz und gar nicht normal ist. Gemeinsam mit ihrem neuen Freund Mack versuchen die Mädchen, hinter das Geheimnis von Ainsley Castle zu kommen.
Vita
Im Berlin der 80er und 90er Jahre machte sich die gebürtige New Yorkerin Holly-Jane Rahlens mit Funkerzählungen, Hörspielen und Solo-Bühnenshows einen Namen. Mit «Becky Bernstein Goes Berlin» debütierte sie 1996 als Buchautorin, heute schreibt sie Belletristik für Erwachsene und Jugendliche. Ihre Bücher wurden in viele Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Ihr dritter Roman, «Prinz William, Maximilian Minsky und ich» (Rowohlt, 2002), ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2003 und dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik (Audiobuch), kam 2007 in einer Drehbuchadaption der Autorin ins Kino. Er gewann zahlreiche Preise im In- und Ausland und wurde für den Deutschen Filmpreis nominiert. Holly-Jane Rahlens lebt mit ihrem Mann als freischaffende Autorin in Berlin.
Für Sylvia, ein Rätsel
1. KapitelStiefmutter
Tief in der Nacht reißt mich ein Geräusch aus dem Schlaf.
Erschrocken liege ich im Bett, so still wie möglich, halte die Luft an, lausche, versuche, im Dunkeln zu sehen.
Schwaches Mondlicht scheint ins Zimmer. Nebelschwaden wabern geisterhaft durch das offene Erkerfenster. Sie formen sich, verwandeln sich in Vögel, Geier, die über mir schweben. Sie lauern darauf, dass ich endlich wieder einschlafe, damit sie –
Eine Holzdiele knarrt.
Jemand ist im Zimmer.
Lauf weg!, denke ich. Jetzt! Sofort!
Doch ich bin zu langsam. Lange, knochige Finger, zehn rasiermesserscharf manikürte Nägel, ochsenblutrot lackierte Stahlklingen greifen nach meiner Kehle.
Es ist Stiefmutter.
Ich reiße die Augen auf.
Mein Zimmer ist in blasses Morgenrot getaucht.
Ich höre jemanden atmen. Schnell. Flach.
Das bin ich selbst, wird mir klar.
Ich hebe den Kopf und schaue mich um. Mein Zimmer dreht sich. Gleich wird mir schlecht. Ich greife nach dem Bettrahmen und halte mich fest, dann falle ich wieder ins Kissen.
Sie ist immer noch hier. Stiefmutter. Irgendwo. Ich weiß es. Ich spüre es. Sie wartet auf mich in den Schatten hinter meinen Augen. Ich kneife die Lider zusammen und treibe sie zurück in die Nacht.
Ihre roten Fingernägel sind das Letzte, was ich sehe. Sie flackern wie zehn Flammen. Dann verlöschen sie. Eine nach der anderen.
Jetzt ist sie fort.
Ich bin wach.
Und in Sicherheit – hoffe ich.
Diesen Traum habe ich schon häufiger gehabt.
Und dann, wenn ich wach werde, das rotierende Zimmer.
Beim ersten Mal vor ein paar Wochen habe ich Dad von dem Schwindelanfall erzählt. Da lebten wir noch in der Stadt. Er besorgte mir einen Termin bei der Kinderärztin.
«Dad», habe ich gesagt. «Ich bin fast vierzehn. Ich bin zu alt für eine Kinderärztin.»
Er bestand trotzdem darauf, dass ich hinging. Was ich verstehe. Schließlich liebt er mich.
Und weil ich ihn liebe, bin ich hingegangen.
Die Kinderärztin konnte nichts finden, deshalb überwies sie mich zu einem Ohrenspezialisten, der ein Gleichgewichtsproblem vermutete. Er saugte mir das Wachs aus den Ohren, was kitzelte. Dann empfahl er mir eine Neurologin, die mir ein paar Übungen gegen Schwindelanfälle zeigte.
Ich machte die Übungen ein paar Mal. Aber sie sind nervig. Also ließ ich es sein.
Die Schwindelanfälle kamen wieder.
Aber ich erzähle es Dad nicht mehr.
Das Zimmer dreht sich immer noch. Ich würde gern weiterschlafen, aber der Traum hat mich zu sehr aufgewühlt.
Es ist nach neun. Normalerweise höre ich Dad um diese Zeit ein Morgenlied summen oder pfeifen. Ich stelle ihn mir in seinem Arbeitszimmer nebenan vor, auf der anderen Seite des kleinen Badezimmers, das unsere Räume verbindet. Ich sehe den lackierten Kiefernholzboden vor mir, den eleganten Schreibtisch, seinen Laptop. Ein Babyfoto von mir schwebt wie eine in Bernstein gefangene Urzeit-Biene zwischen zwei Plexiglasscheiben.
Dad ist morgens immer früh auf den Beinen. Er joggt, frühstückt und sitzt längst vor seinem Computer, wenn ich aufwache. Meistens gesellt er sich für ein zweites Frühstück zu mir nach unten. Zusammen mit Stiefmutter. Sie bildet sich gern ein, dass wir eine Familie sind. Er hätte das gern. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie das gehen soll.
Formal gesehen, ist Stiefmutter gar nicht meine Stiefmutter – jedenfalls noch nicht. «Wir schauen mal, wie es für dich läuft», hatte Dad zu mir gesagt. «Sechs Monate zur Probe.»
Klar! Als würde er mir die Entscheidung überlassen, ob er heiraten wird oder nicht. Welcher klar denkende Mann würde das tun? Seit ihrer ersten Begegnung, seit der Sekunde, in der er mich aus der Stadt hierhergebracht hat, seit dem Augenblick, als ich dieses Haus betrat, hatte ich verloren.
Ich sollte ihm sagen, wie es mir damit geht.
Aber das tue ich nicht.
Ich habe keine Erinnerungen an meine Mutter. Da ist nur so ein Gefühl. Etwas Warmes, wie die Farbe Pfirsich … Etwas Süßes mit einer leicht herben Note, wie gezuckerte Schlagsahne mit Preiselbeeren.
Wäre ich doch nur älter gewesen, als sie starb. Dann hätte ich wenigstens Erinnerungen, eine Vorstellung von ihr, etwas Reales, an dem ich mich festhalten könnte.
Aber ich war erst drei.
«Sie hat dich sehr geliebt», sagt Dad immer. «Aber sie war von Dämonen getrieben.»
Er scheint diese Formulierung zu mögen, denn er verwendet sie immer wieder. «Sie hatte eine kranke Seele», sagt er. «Sie war von Dämonen getrieben.»
Dämonen. Was soll das heißen, von Dämonen getrieben?
Ich schleudere die Decke weg, schwinge die Beine über die Bettkante und stehe auf. Schon wird mir wieder schwindelig, und ich greife nach dem Bettpfosten. Vorsichtig gehe ich zum Fenster, das nach Osten hinausgeht.
Unser Umzug hat mich aus dem Gleichgewicht gebracht. Wird mir deshalb ständig schwindelig?
Ich vermisse mein altes Leben. Mein altes Zimmer, meine Klassenkameraden. Meine Freundin Maisie. Ich vermisse sogar Dr. Goodwin, meine Therapeutin.
Am offenen Fenster atme ich in tiefen Zügen die frische Luft ein.
Ich hasse diese Insel. Sie ist zu klein. Und dieses Haus, das zu groß ist und zu zugig. Es gibt so viele Türen. So viele Menschen. Überall Personal und Gäste.
Wir leben in einem Hotel am Rande des Meeres, ganz weit oben im Norden, dort, wo der dunkelste aller dunklen Himmel auf das Ende der Welt trifft.
Hotel Ainsley Castle ist seit einigen Wochen mein Zuhause. Es ist ein riesiges, vierstöckiges Steingebäude, ein Herrenhaus, um genau zu sein, oder besser noch: ein kleiner Palast mit Türmchen und Wendeltreppen und verborgenen Türen. Stiefmutter herrscht darüber wie eine Königin über ihr Reich.
Das Hotel ist auf reiche Leute ausgerichtet, die ihre Ruhe schätzen; auf wohlhabende Familien, die ihren Kindern mit der salzigen Luft etwas Gutes tun wollen; und auf den einen oder anderen Künstler, der nach Inspiration sucht. Laut Hotelbroschüre haben sie die Auswahl unter 102 Zimmern: Einzel- und Doppelzimmern sowie Suiten der Komfort-, Premium- und Luxusklasse. Worin sie sich unterscheiden, ist mir allerdings schleierhaft. Für mich klingt das alles gleich. Außerdem gibt es in allen Zimmern die gleichen großen, flauschigen Handtücher und die gleiche strahlend weiße Bettwäsche ‹aus hochwertiger ägyptischer Baumwolle›, wie Stiefmutter gern betont.
Manche Leute kommen zum Golfspielen ins Hotel Ainsley Castle. Andere wegen des Wellnessbereichs. Einige schätzen die Küche. Fast alle lieben das Meer. Nur wegen des Regens kommt keiner her. Doch genau den kriegen sie fast immer.
Nicht weit vom Hotel entfernt steht die uralte, halb verfallene Burg Ainsley Castle. Es heißt, dass der Geist einer jungen Frau darin herumspukt – ein Mädchen, das vor Jahrhunderten als Hexe angeklagt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde.
Dad meint, die Insel wäre magisch. Wenn ich ihn frage, in welcher Hinsicht, schaut er mich ganz ernst und geheimnisvoll an und sagt: «Das wirst du schon noch sehen.»
«Was meinst du damit?», lasse ich nicht locker. «Gibt es hier Feen oder Einhörner? Oder vielleicht Hexen?»
«Wenn ich dir verraten würde, warum sie magisch ist, würde es doch keinen Spaß machen, oder, Lizzy?», sagt mein Vater dann. «Du musst die Magie schon selbst entdecken. Halte einfach die Augen offen.»
Doch wenn ich mich umschaue, sehe ich bloß den kleinen Hafen, ein paar stinknormale Geschäfte – hauptsächlich Mini-Filialen irgendwelcher großer Ketten –, viele Schafe, ab und zu ein Pony; eine felsige Küste und überall Hügel – steile Hügel, flache Hügel, Hügel, die eigentlich Berge sind. Und eine nassgraue, windgepeitschte Landschaft, hier und da geschmückt mit kleinen, aber teuren Bed-and-Breakfast-Pensionen.
Was soll daran bitte magisch sein?
Das Hotel hat Stiefmutter von ihrem ersten Ehemann geerbt, der vor einigen Jahren gestorben ist. Deshalb führt sie den Laden jetzt, auch wenn sie zweimal im Monat nach Feierabend freiwillig als Krankenschwester arbeitet. Das war früher ihr Beruf, bevor sie geheiratet hat – das erste Mal. Dad ist stolz auf sie. «Sie besucht drei Fortbildungen im Jahr!», schwärmt er. Am liebsten würde er mir alles darüber erzählen, aber es interessiert mich nicht. Was weiß ich – vielleicht war sie sogar für den Tod ihres Mannes verantwortlich! Vielleicht wollte sie das Hotel für sich allein und hat ihm eine Giftspritze mit –
Ups. Besser nicht daran denken. Dad meint, ich hätte viel zu viel Phantasie.
Was vielleicht stimmt.
Dad ist Finanzberater. Er jongliert mit den Zahlen großer Unternehmen. Und sie bezahlen ihm viel Geld dafür. Manchmal denke ich, dass Stiefmutter ihn deshalb heiraten will. Wegen seines Vermögens. Als wären ihr die 102 Komfort-, Luxus- und Premiumzimmer mit Bettwäsche aus ägyptischer Baumwolle nicht genug.
Auf jeden Fall ist das Hotel der Grund für unseren Umzug. Dad kann überall arbeiten. Aber Stiefmutter braucht ihre Zimmer und ihre Suiten und ihren Bikini Beach, den Streifen Strand am Fuß der gewundenen Steintreppe, die vom Hotel zum Meer hinunterführt.
Ich bin die Einzige, die ihn Bikini Beach nennt. Natürlich ist das ironisch gemeint. Niemand, der halbwegs normal tickt, würde dort abhängen. Schon gar nicht in einem Bikini. Niemand außer den Zimmermädchen an ihrem freien Tag. Das heißt, wenn es nicht regnet, was – ta-daa! – fast immer der Fall ist.
Unsere Wohnung auf der Rückseite des Hotels hat einen eigenen Eingang, gegenüber vom Parkplatz, auf den ich jetzt durch das Fenster schaue. Stiefmutter meint, der Blick auf den Parkplatz hätte ihr noch nie gefallen. Aber wenn ich mich aus dem Fenster lehne und den Hals recke, kann ich von hier oben im zweiten Stock immerhin auch die Ruinen von Ainsley Castle sehen, samt dem Wald, der die Burg umgibt. Ganz in der Ferne sieht man am Horizont die Nordostküste der Insel, wo das Blau des Himmels und das Grün des Meeres eins werden. Allerdings nur an sonnigen Tagen. An normalen Tagen sind das Grau des Himmels und das Grau des Meeres genau das: grau. Farblos. Abweisend.
Ich frage mich, was meine Mutter wohl von diesem Ort halten würde. Oder von Stiefmutters ochsenblutrot lackierten Fingernägeln.
Ich denke in letzter Zeit viel an meine Mutter. Sehr viel sogar. War sie jemals so weit im Norden? Hat sie jemals, so wie ich beim Spazierengehen mit Dad vergangene Woche, mit dem Wind im Gesicht am Rand der hohen Felsen gestanden und sich gefragt, wie es wäre davonzufliegen, mit den Möwen aufs Festland zu entkommen?
Ich frage mich, was ihre Dämonen waren.
Wohin haben sie Mutter getrieben?
Sind sie für ihren Tod verantwortlich?
Und ich frage mich, wie sie aussah, meine Mutter.
«Du siehst ihr sehr ähnlich», hat Dad einmal zu mir gesagt.
«Hatte sie auch einen Leberfleck unter der Nase?», wollte ich wissen.
Dad hat gelächelt, aber den Kopf geschüttelt.
Also nein. Sie hatte keinen. Das ist meine Besonderheit.
Mir wird kalt am Fenster. Ich sollte mich anziehen.
Ich gehe zum Spiegel.
Mein Pony hängt mir ins Gesicht. Ich schiebe die Locken beiseite, aber sie fallen mir sofort wieder vor die Augen. Ich muss zum Friseur.
Ich entdecke einen Pickel auf der Stirn. Er muss letzte Nacht gesprossen sein. «Die Pubertät», erkläre ich meinem Spiegelbild.
Das ist ein Witz zwischen mir und meiner Therapeutin, Dr. Goodwin. Wir geben der Pubertät die Schuld an allem.
Ich ziehe den Haarreif, den Stiefmutter mir geschenkt hat, aus der obersten Kommodenschublade. Sie meint, ich solle die Haare nach hinten tragen und Luft an meine Stirn lassen, weil sonst meine Poren verstopfen.
Hallo? Nur weil sie alle zwei Wochen Krankenschwester spielt, heißt das noch lange nicht, dass sie Pickelexpertin ist, oder?
Ich schiebe meine Locken mit dem Haarreif zurück. Er ist mit Glitzersteinen besetzt. Sie funkeln im Spiegel wie Diamanten an einem Diadem.
Ich sehe aus wie eine bescheuerte Disney-Prinzessin.
Ich werfe den Haarreif in die Schublade zurück und hebe meine Jogginghose auf. Aber wo ist mein Hoodie? Gestern lag er noch neben meinem Nachttisch, glaube ich. Ich schaue mich auf dem Boden um. Er ist das reinste Chaos, zugemüllt mit unausgepackten Umzugskisten und einem Sammelsurium aus alten Socken, Bücherstapeln, schmutziger Wäsche und einem Häufchen verknoteter Halsketten.
Den Hoodie kann ich nicht finden.
Ich ziehe die Kommodenschublade auf, in der ich einen Stapel frisch gewaschener T-Shirts verstaut habe, wie ich weiß. Vielleicht bin ich ordentlicher, als ich denke, und habe den Hoodie zusammen mit –
Fassungslos starre ich auf das Halstuch meiner Mutter, das ganz obenauf liegt. Wie um alles in der Welt ist es dort hingekommen? Es lag doch in der Kiste mit der Aufschrift Persönlich – Hände weg!, die ich noch nicht ausgepackt habe. Meine alten Zeugnisse sind in dieser Kiste. Ein paar Geschichten, die ich in der Schule geschrieben habe. Einige meiner Zeichnungen. Fotos mit meinen Freundinnen aus der Schule. Meine liebsten Bilderbücher aus der Kindheit, Bücher, die meine Mutter mir vielleicht vorgelesen hat. Und das Seidenhalstuch.
Ich gehe zu der unausgepackten Kiste hinüber.
Sie ist immer noch zugeklebt.
Die Härchen auf meinen Armen stellen sich auf.
2. KapitelMutter
Ich nehme das Halstuch und gehe zurück ins Bett, liege da und denke nach.
Unser Umzug war ziemlich chaotisch. Offenbar habe ich das Tuch woanders verstaut als in der Kiste, die mit Persönlich beschriftet ist. Wahrscheinlich habe ich es, ohne nachzudenken, ausgepackt und in die Schublade gelegt.
Das hoffe ich jedenfalls. Denn wenn nicht …?
Ich setze mich auf und lasse den seidenweichen pfirsichfarbenen Stoff liebevoll in meine linke Handfläche gleiten, dann in die rechte.
Ich breite ihn vor mir auf der Bettdecke aus.
Auf den zartorangen Untergrund sind preiselbeerfarbene Parismotive im Stil der 1950er Jahre aufgedruckt. Der Eiffelturm, eine schmale Frau mit Chanel-Taille und langen Beinen in einem Kleid mit schwingendem Rock und mit einem großen Sonnenhut, ein Pudel an der Leine, ein Café mit gestreifter Markise, ein Blumenstand, ein Kiosk.
Dad meint, Mutter hätte das Tuch in ihren Flitterwochen gekauft. Ein winziges Etikett hängt noch an ein paar letzten dünnen Fäden daran: 100 % Soie. Fabriqué en France. Sie muss es als Halstuch getragen haben, ein Streifen pfirsich- und preiselbeerfarbener Seide, wie ein Schmuckstück lose um den Hals geschlungen.
Wenn ich an meine Mutter denke, sehe ich immer die Frau auf dem Tuch vor mir. Eine hochgewachsene Frau mit einem großen Sonnenhut, die einen schicken Pudel an der Leine durch Paris führt.
Leider haben wir keine Fotos mehr aus meinen ersten Jahren. Dad sagt, sie sind alle verlorengegangen, als kurz nach Mutters Tod bei uns eingebrochen wurde. Die Räuber haben sämtliches Bargeld mitgenommen, das Silberbesteck, den Küchengrill und Dads Laptop, auf dem alle Fotos gespeichert waren. Meine Eltern hatten sie nie ausgedruckt oder Abzüge gemacht. Sagt er jedenfalls.
Allerdings frage ich mich, warum ein Babyfoto von mir in einem Plexiglasrahmen auf seinem Schreibtisch steht, wenn sie niemals Abzüge gemacht haben.
«Bist du sicher, dass du keine Sicherungskopien hast?», habe ich ihn neulich erst gefragt – aus heiterem Himmel.
Er saß am Schreibtisch und grübelte über irgendwelchen Tabellen auf seinem Bildschirm. Er hatte keine Ahnung, wovon ich sprach. «Sicherungskopien?»
«Von den Fotos», sagte ich. «Von Mutter. Von uns. Uns allen zusammen.»
Dad schüttelte den Kopf. «Es gibt keine.» Er strich mir über die Wange. «Keine Sorge. Du wirst schon Freunde finden», sagte er und widmete sich wieder seinem Bildschirm.
Erst war ich mir nicht sicher, warum er das gesagt hatte. So ohne jeden Zusammenhang.
Also war ich in mein Zimmer zurückgegangen, um weiter auf den Parkplatz zu starren. Dabei kam mir plötzlich der Gedanke, dass Dad vielleicht glaubt, ich würde in letzter Zeit deshalb so viel an Mutter denken, weil ich einsam bin und mir Sorgen mache, dass die anderen mich hier auf der Insel vielleicht nicht mögen werden. Weil ich Angst davor habe, in einer neuen Schule anzufangen. Angst habe, keine Freunde zu finden.
Und damit hat er vielleicht sogar recht.
Ich krieche wieder unter die Bettdecke und vergrabe die Nase in Mutters Halstuch.
Es ist das Einzige, was ich von ihr besitze. Jahrelang hat es immer unter meinem Kissen gelegen, bis –
Es klopft.
Irgendetwas klopft ans Fenster. Ein Ast? Ich fahre herum. Doch davon wird mir schwindelig. Das Zimmer dreht sich mit mir. Mir wird übel.
Es klopft wieder. Diesmal kommt es vom … Spiegel? Aus dem Inneren des Spiegels? Das Glas vibriert bei jedem Klopfen. Als wäre ein Geist darin eingesperrt und wolle heraus.
Ich kriege Angst.
Doch dann wird mir klar, dass das Klopfen von der Tür neben dem Spiegel kommt.
«Elizabeth», sagt Stiefmutter draußen im Flur. «Bist du wach?»
Ihre Stimme klingt wie immer arrogant. Und angespannt. Ihre Fingernägel klackern ungeduldig gegen das Türblatt. Zehn flammend rote Dolche, bereit, sich mir ins Herz zu bohren.
Ich antworte nicht.
Klack-klack-klack machen Stiefmutters Fingernägel, ruhelos, genervt.
Schließlich geht die Tür quietschend auf.
Und da steht sie, mit einem gefrorenen Lächeln im Gesicht.
«Du liegst ja noch im Bett», stellt sie fest.
«Entschuldigung, aber hatte ich gesagt, dass du reinkommen darfst?» Oje. Ich schon wieder. Die respektlose Göre.
Stiefmutter seufzt laut.
Ich kann ihr ansehen, dass ich eine Riesenenttäuschung für sie bin. Ich zerstöre ihr Glück. Auf was habe ich mich da bloß eingelassen?, fragt sie sich bestimmt.
Hoffentlich sieht sie, dass es mir mit ihr genauso geht.
«Ist Dad unten?», frage ich. «Ich habe ihn nicht gehört.»
Stiefmutter starrt mich einfach nur an.
«Hallo?», sage ich. «Dad?»
Sie sieht mich an, als hätte ich den Verstand verloren. Als hätte ich mir einen Vater nur ausgedacht. Als hätte er nie existiert. Als –
«Es ist schon spät», sagt sie bedächtig. «Du willst doch nicht den ganzen Tag verschlafen, oder?» Sie schaut sich um. «Ich wünschte wirklich, du würdest diese Umzugskisten auspacken. Es ist ein so schönes Zimmer. Du würdest dich viel wohler fühlen.»
«Meinst du, ich würde mich wohler fühlen oder du? Ich persönlich mag es nämlich unordentlich.»
«Dann mach wenigstens dein Bett!», sagt sie. «Und häng deine Sachen auf.» Ihre Augen huschen an der offenen Badezimmertür vorbei. «Das Bad ist das reinste Chaos!»
Mit einem Bein im Zimmer, mit dem anderen draußen steht sie da und funkelt mich an. «Na gut, mach, was du willst!», sagt sie schließlich und zieht sich zurück.
Ich höre die Treppenstufen knarren.
Sie behandelt mich, als wäre ich ihr Dienstmädchen!
Ich hasse mein Leben!
Ich springe wütend auf. Doch dann wird mir wieder schwindelig, und ich kippe benommen gegen die Kommode. Ich schließe die Augen und warte darauf, dass das Zimmer aufhört, sich zu drehen.
Ich gehe zur Tür, um sie zuzuknallen, doch ich bremse mich. Es ist vielleicht schlauer, kein Theater zu machen und mich nachher bei Dad über sie zu beschweren. Womöglich hat er uns in seinem Arbeitszimmer nebenan sowieso gehört.
Ich entdecke meinen Hoodie unter dem Bett, ziehe mich hastig an und gehe in den Flur hinaus. Dann klopfe ich an die Tür von Dads Arbeitszimmer.
«Frühstück, Dad?», frage ich.
Keine Antwort. Ist er schon unten?
Ich öffne die Tür. Sie führt in mein Bad.
Hä?
Ich sehe keinen Schreibtisch. Kein Babyfoto. Keinen Computer. Keinen Dad.
Und überhaupt: Seit wann hat mein Bad zwei Türen?
Es ist, als hätte Dad nie existiert.
Werde ich verrückt?
Panisch renne ich nach unten.
3. KapitelDer Junge
Ich stoße die Tür zu unserer Küche auf. Dad ist nicht da.
«Wo ist mein Vater?», frage ich Stiefmutter und gebe mir Mühe, meine Angst vor ihr zu verbergen. «Was geht hier vor?»
Stiefmutter, die mit dem Rücken zu mir vor der Arbeitsplatte steht, dreht sich um. Ihre Bewegungen sind langsam und kontrolliert. «Bitte nicht so laut», sagt sie ruhig. «Und mach die Tür zu. Es zieht.»
Ihre Stimme mag ruhig klingen, aber ihre Augen schleudern Blitze.
Ich schließe die Tür, laut, aber nicht zu laut.
Stiefmutter bleckt die Zähne. Ihre messerscharfen roten Nägel wollen mich aufschlitzen und mein Herz fürs Mittagessen herausschneiden. Mit ihrem spitzen Kinn weist sie auf die Tür zum Schmutzraum.
Gott bewahre, dass jemand, der sich im Schmutzraum die schlammverkrusteten Schuhe auszieht, mit anhört, wie wir uns streiten. Oder dass ein Lebensmittellieferant erfährt, dass wir keine glückliche Familie sind.
Der Schmutzraum hat vier Türen. Eine führt in unsere private Küche, eine nach draußen zum Parkplatz, eine führt zu einem Hotelflur, der in die Lobby übergeht (unsere Abkürzung ins Hotel). Die vierte Tür führt in die Spülküche, wo früher die Küchenhelfer den Hühnern die Köpfe abgeschlagen, die Federn ausgerupft und ihre blutigen Eingeweide herausgenommen haben.
Dad lacht, wenn ich so etwas erzähle. «Du hast zu viel Phantasie, meine Liebe», sagt er dann und streicht mir sanft über die Wange.
Die Spülküche grenzt an die Hotelküche, mit ihrem ganzen auf Hochglanz polierten Hightech-Edelstahl, und hinter der Küche liegt der Speisesaal.
«Bitte drück dich etwas genauer aus», sagt Stiefmutter vor der Küchentheke. «Was meinst du mit ‹was geht hier vor›?»
«Ich meine, wo ist Dad?», frage ich noch einmal, noch lauter diesmal.
«Psst.»
Das Küchenfenster steht offen, und draußen geht eine Frau vorüber, wahrscheinlich ein Gast auf dem Weg zum Parkplatz. Sie schaut zu uns herüber. Sie hat halblange, zerzauste blonde Haare. Als sie Stiefmutter sieht, winkt sie und geht dann ihrer Wege.
«Unser Artist-in-Residence», sagt Stiefmutter. «Die Gastkünstlerin. Ich habe sie eingeladen, hier zu wohnen und zu arbeiten.»
Einen Moment lang überlege ich, wie es wohl sein mag, eine Artist-in-Residence zu sein. Es klingt so großartig und erhaben, fast königlich. Wie der perfekte Job oder etwas, das ich eines Tages selbst gern wäre: eine Künstlerin, die irgendwo arbeiten und kostenlos wohnen darf.
Doch der Gedanke währt nicht lange, denn Stiefmutter sagt gerade: «Sie muss dich nicht meckern hören.»
«Na und», erwidere ich. «Wo ist Dad?»
«In Port Wicken. Er holt ein paar Sachen ab, die wir brauchen. Und dein neues Bücherregal. Es ist mit der frühen Fähre gekommen.»
Ich werde also doch nicht verrückt. Dad ist am Leben!
Doch schon macht mir etwas anderes Sorgen. «Mein neues Bücherregal?», frage ich.
Stiefmutter verzieht überrascht die Lippen. Sie haben die gleiche Farbe wie ihre Nägel: ein kräftiges Ochsenblutrot. Und eine doppelte Schicht Lipgloss.
Doch dann dämmert es mir: «Ach ja, richtig. Mein neues Bücherregal.»
Sie nickt. «Du hast deinem Vater versprochen, deine Kisten auszupacken. Und zwar heute. Weißt du noch?»
Ich schnappe mir ein Croissant aus dem Brotkorb auf dem Tisch und beiße hinein. Ich kaue langsam, um mir eine Antwort zu überlegen.
Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich Dad um des lieben Friedens willen versprochen habe, meine Bücher auszupacken. Und jetzt fällt mir auch wieder ein, dass sein Arbeitszimmer hinter dem Empfang in der Lobby liegt, hinter der Rezeption, gleich neben Stiefmutters Büro. Wieso hatte ich denn gedacht, es ist oben? Anscheinend hat der Albtraum mein Erinnerungsvermögen durcheinandergewirbelt.
Als ich mich zu Stiefmutter umwende, beginnt sich vor meinen Augen wieder alles zu drehen. Ich greife nach dem Tisch, um mich festzuhalten.
Ein äußerst merkwürdiges Gefühl überkommt mich. Als hätte ich mich … verirrt. Als wäre ich auf der falschen Bühne gelandet und wüsste weder, welche Rolle ich zu spielen habe, noch wie mein Text lautet.
«Ist was?», fragt Stiefmutter.
«Alles gut», sage ich, verärgert darüber, dass sie meine Verwirrung spürt.
Sie schüttelt seufzend den Kopf. «Warum bist du nur immer so mürrisch, Schatz? Die meisten Mädchen würden auf der Stelle mit dir tauschen. Du lebst hier doch wie eine Prinzessin.»
Ich gebe keine Antwort, sondern gieße mir stattdessen aus einer Karaffe ein Glas frisch gepressten Orangensaft ein.
Es klopft an die Tür zum Schmutzraum. Wahrscheinlich jemand vom Personal. Die Tür ist von der anderen Seite mit einem elektronischen Zahlenschloss gesichert. Um sie zu öffnen, muss man einen Code eingeben.
Da ich näher an der Tür stehe als Stiefmutter, mache ich sie auf.
Es ist ein Junge. Ich erkenne ihn sofort. Er ist ungefähr so alt wie ich, vielleicht ein bisschen älter. Ich habe ihn schon ein paar Mal von weitem gesehen, als er im Speisesaal bediente, oder bei den Carricks, auf der zwei Meilen entfernten Schaffarm seiner Familie. Ich war neulich Nachmittag mit Dad dort, um Käse abzuholen. Hinter der Scheune spielte jemand mit einem Hund Stöckchenholen. Das war er gewesen, der Junge aus dem Speisesaal. Ich hatte ihm einen Moment lang zugesehen. Sein seidiges, rötlich blondes Haar glänzte in der Sonne wie eine goldene Krone. Und vor ein paar Tagen, auf meinem Spaziergang mit Dad, habe ich ihn von einer niedrigen Klippe springen sehen.
Er stand einfach da. Am Rand der Felsen. Und ich sah zu, wie er die Arme hob, sich mit den Füßen abstieß und ins Meer sprang.
Also, ja, ich habe ihn schon häufiger gesehen, aber noch nie so nah vor mir. So wie jetzt, an der Tür zum Schmutzraum.
«Sie wollten mich sehen?», sagt er zu Stiefmutter, und ich bemerke einen leicht schief stehenden Eckzahn.
«Ja, Mack», sagt Stiefmutter. «Komm bitte herein.»
Ich mache Platz, und er kommt in die Küche.
Er heißt also Mack. Vielleicht eine Abkürzung für Macaulay. Oder Macbeth. Schreckliche Namen.
Er sieht sich verlegen um.
«Kennst du Elizabeth schon, Mack?», fragt Stiefmutter ihn.
«Lizzy», verbessere ich sie schnell.
Ihre Nase zuckt fast unmerklich. Sie mag es nicht, wenn man sie verbessert. Und aus irgendeinem Grund mag sie auch meinen Spitznamen nicht.
Der Junge dreht sich zu mir um.
Mein Magen zieht sich zusammen. Aber auf angenehme Weise. Wie wenn man mit einem superschnellen Aufzug im Erdgeschoss ankommt, der Magen aber noch im 25. Stock hängt.
Mack nickt mir zu – allerdings ziemlich gleichgültig.
Ich lächle ihn trotzdem an. Ich kann nicht anders. Es ist ein Reflex. Doch schon im nächsten Moment frage ich mich, ob ich vielleicht Croissantkrümel zwischen den Zähnen habe.
Ich schließe den Mund.
Mack murmelt etwas in meine Richtung. Dann dreht er sich wieder zu Stiefmutter um.
«Ich wollte mich noch einmal persönlich bei dir bedanken, dass du uns gestern bei diesem Computerproblem geholfen hast», sagt sie zu ihm. «Du hast uns gerettet. Wirklich. Elizabeths Vater hat mir alles erzählt.»
«Lizzys Vater», werfe ich ein.
Der Junge sieht mich verwundert an und richtet den Blick dann wieder auf Stiefmutter.
«Er hat gesagt, du bist ganz schön schlau», sagt sie.
«War keine große Sache», sagt der Junge achselzuckend.
«Du bist nur bescheiden.» Stiefmutter wendet sich an mich. «Mack ist ein echter Computerprofi.»
Auf seinen Wangen bilden sich rote Flecken.
Einen Moment lang herrscht peinliches Schweigen. Erwartet Stiefmutter, dass ich irgendetwas sage?
«Cool!», sage ich zu Mack. «Ich hatte eigentlich vor, den Hotelcomputer mit einem Schadprogramm zu infizieren. Du kannst mir gern helfen.»
Macks Augen weiten sich, und mir fällt auf, wie unglaublich grün sie sind.
«Elizabeth!», schimpft Stiefmutter. «Also wirklich!»
Mack spürt die dicke Luft zwischen uns. Er schaut von Stiefmutter zu mir. Dann wieder zu ihr. «Brauchen Sie noch irgendwas?», fragt er diplomatisch. Offensichtlich will er sich vom Acker machen.
«Nein, vielen Dank, Mack», sagt Stiefmutter ein wenig verlegen. «Bitte grüß deine Eltern von mir.»
Mit einem Nicken wendet er sich um und geht zur Tür. Ich will gerade einen schlauen Spruch loslassen, so etwas wie Adiós, Amigo, wir sehen uns im Darknet, als er mir zuvorkommt – und mich mit einem Lächeln überrascht. Vielleicht lese ich zu viel hinein, aber es liegt etwas Verschmitztes in der Art, wie er die Mundwinkel hochzieht, etwas Verstohlenes, als wären wir Komplizen. Als teilten wir ein großes Geheimnis.
Schön wär’s.
4. KapitelDad
Die Tür fällt hinter Mack ins Schloss.
Stiefmutter schäumt. Ihre Augen ziehen sich zu dunklen Schlitzen zusammen. «Wir mögen nicht immer einer Meinung sein, Elizabeth, aber widersprich mir bitte nicht in Gegenwart der –»
Draußen, in unserem privaten Eingang, wird es laut. Ich höre Schlüssel klirren und die Stimme meines Vaters: «Ich bin wieder da!»
Die Küchentür geht auf, und Dad kommt herein. Hinter ihm sehe ich einen großen flachen Karton an der Treppe lehnen. Die Sonne ist herausgekommen, und helles Licht fällt ins Wohnzimmer. Es ist ein schöner, offener Raum. Wenn man von oben die Treppe runterkommt, hat man den Überblick über die zwei hübschen kleinen Sitzinseln.
«Guten Morgen, Prinzessin», sagt er und gibt mir ein Küsschen, ehe er zu Stiefmutter geht. Er streichelt ihren Nacken und vergräbt die Nase in ihrem Haar.
Ich kann dieses Geschmuse nicht ausstehen. Gruselig!
Stiefmutter dreht sich zu Dad um, und er nimmt sie in den Arm. Das gefällt mir noch weniger.
Sie haben offenbar komplett vergessen, dass ich da bin.
Ich schleife einen Stuhl über den Steinfußboden. Das macht höllischen Krach. Ich setze mich hin.
Erschrocken lassen Dad und Stiefmutter voneinander ab. Dad sieht kurz so aus, als wolle er mit mir schimpfen, aber dafür ist er viel zu lieb.
Mein Vater ist wirklich ein toller Vater. Er ist gutherzig und geduldig, und dazu sieht er auch noch gut aus. Eigentlich wundert es mich, dass er so lange gebraucht hat, eine neue Frau zu finden.
Dad schaut auf die Küchenuhr. Jetzt hat er es eilig. Er gießt sich einen Becher Kaffee ein, gibt Milch dazu und geht dann in Richtung Schmutzraum, um die Abkürzung ins Hotel zu nehmen. Er hat eine dringende Telefonkonferenz, entschuldigt er sich, die den Rest des Vormittags dauern wird. Er ist bereits spät dran.
Gerade als sich die Tür des Schmutzraums wieder schließt, fällt mir mein Versprechen wieder ein. «He! Was ist mit meinem Regal?», rufe ich, aber er ist schon weg.
Ich. Hasse. Mein. Leben.
Der Hausmeister hat keine Zeit, mir zu helfen, den schweren Karton mit meinem Regal nach oben zu schaffen. Im Westflügel gibt es einen Notfall, irgendein geplatztes Wasserrohr. In den nächsten Stunden kann ich mit keiner Unterstützung rechnen.
Stiefmutter würde mir ja liebend gern helfen, das Bücherregal aufzubauen, behauptet sie, aber sie hätte eine Besprechung nach der anderen mit den Leuten aus dem Wellnessbereich, der Buchhaltung, dem Restaurant und der Hauswirtschaft. Und jetzt auch noch der Rohrbruch im Westflügel. «Ich denke, du kriegst das allein hin», sagt sie zu mir.
Oh-oh. Ich weiß, wohin das führen wird.
«Und räum bitte dein Frühstück weg», fügt sie auf dem Weg aus der Küche hinzu. «Damit meine ich auch die Croissant-Krümel auf dem Fußboden.»
Dort, wo ich vorhin gestanden habe, sehe ich ein Häuflein Krümel auf den Fliesen.
Ha. Ich weiß genau, wohin das führen wird. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie mir befiehlt, in der Spülküche zu schlafen, mit nichts als Mäusen und Küchenschaben zur Gesellschaft.
Ich wiederhole: Ich. Hasse. Mein. Leben.
Ich habe gerade die Krümel aufgefegt, als es an der Vordertür klingelt. Es ist noch mal Mack. Anscheinend hat Dad ihn irgendwo erwischt und ihn gebeten, mir mit dem schweren Karton zu helfen.
Mir fällt auf, dass Mack jetzt schwarze Sneaker mit orangefarbenen Sohlen anhat und nicht mehr die schwarzen Lederhalbschuhe, die er beim Kellnern trägt. Seine Schicht ist also zu Ende.
Wir schleppen den Karton die zwei Treppen hinauf.
Meine Zimmertür ist zum Glück geschlossen. Mack soll das Chaos da drinnen nicht sehen. «Wir können es hier draußen lassen», sage ich zu ihm.
«Echt? Direkt vor der Tür?»
«Ja.»
«Dann stolperst du aber vielleicht drüber.»
Ich zucke die Achseln.
Wir legen den Karton ab.
«Danke», sage ich und lächle ihn an.
Er lächelt zurück, wobei mir sein schiefer Eckzahn entgegenlinst.
Ich überlege, wie es sich wohl anfühlt, mit der Zunge über einen schiefen Eckzahn zu fahren.
Vielleicht kann er Gedanken lesen, denn er wird rot.
Ich ebenfalls.
«Du … äh … du hast da was unter der Nase», sagt er.
Ich fahre mit den Fingern unter der Nase entlang, doch da ist nichts. Dann wird mir klar, was er meint.
«Das ist ein Leberfleck», sage ich.
5. KapitelJemand beobachtet mich
Ich gehe ans Fenster und schaue nach Norden. Ich sehe ein paar Autos, die langsam die Straße entlangtuckern, und … ja … vielleicht jemanden auf einem Fahrrad. Ich hole mein Fernglas. Ich habe es vor zwei Wochen am Bikini Beach gefunden, hinter ein paar Felsen, halb versteckt unter einer Lage Seegras. Es ist ein bisschen verrostet. Dad meinte, dass es eine ganze Weile dort gelegen haben muss. Aber es funktioniert.
Ich richte das Fernglas aufs Fahrrad. Es ist Mack. Genau kann ich ihn nicht erkennen, aber die orangefarbenen Sohlen seiner Sneaker schon. Er trägt eine schwarze Jacke, die sich hinter ihm im Wind bläht.
Ich schaue Mack eine Weile durchs Fernglas nach – bis er plötzlich stehen bleibt und in seiner Jacke herumsucht. Er zieht sein Handy heraus. Wahrscheinlich hat ihn jemand angerufen. Er telefoniert, dann sieht er sich um, als wolle er sich orientieren. Er dreht sich zum Hotel um und schaut geradewegs zu mir.