
Das Reich der Schatten, Band 1: Her Wish So Dark (High Romantasy von der SPIEGEL-Bestsellerautorin von "One True Queen") E-Book
Jennifer Benkau
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Verlag GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Reich der Schatten
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
In dieser Welt werden Wünsche wahr. Und nichts könnte schlimmer sein. Wie alle Bewohner von Nemija fürchtet Laire den grausamen Lord der Schatten, der seit jeher Menschen in sein verfluchtes Reich entführt. Als Laires Verlobter ihm zum Opfer fällt, muss sie vor dem Thron des Lords um Gnade bitten. Doch in seinem Reich herrscht eine wilde, tödliche Magie. Will Laire überleben, braucht sie ausgerechnet die Hilfe des einen Menschen, den sie nie wiedersehen wollte: Alaric, der ihr Herz in tausend Stücke gerissen hat … So episch, herzzerreißend und atemberaubend wie "One True Queen" Band 1 der romantischen High-Fantasy-Reihe von Bestsellerautorin Jennifer Benkau Jennifer Benkaus Romantasy-Reihen "One True Queen", "Das Reich der Schatten" und "The Lost Crown" spielen in derselben Fantasy-Welt, können aber unabhängig voneinander gelesen werden. Sie sind in dieser Reihenfolge erschienen: One True Queen, Band 1: Von Sternen gekrönt One True Queen, Band 2: Aus Schatten geschmiedet Das Reich der Schatten, Band 1: Her Wish So Dark Das Reich der Schatten, Band 2: His Curse So Wild The Lost Crown, Band 1: Wer die Nacht malt The Lost Crown, Band 2: Wer das Schicksal zeichnet New-Adult-Romance von Jennifer Benkau: A Reason To Stay (Liverpool-Reihe 1) A Reason To Hope (Liverpool-Reihe 2)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 663
Sammlungen
Ähnliche
Als Ravensburger E-Book erschienen 2021
Die Print-Ausgabe erscheint im Ravensburger Verlag
Copyright © 2021 by Jennifer Benkau
© 2021 Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Lektorat: Sarah Heidelberger (www.sarah-heidelberger.de)
Umschlaggestaltung und Vorsatzkarte: Carolin Liepins
Verwendete Bilder von © Aleshyn Andrei, © Ironika, © BestPhotoStudio, © Bokeh Blur Background und © Ukki Studio, alle von Shutterstock
Alle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg.
ISBN 978-3-473-47147-8
www.ravensburger.de
Ich verlange von mir die Erfüllung meiner Träume.
INTRO
Es heißt, in einer Zeit, bevor die Zeit gezählt wurde, lange vor dem Zeitalter der Clans und selbst vor der Zeit der Königinnen, lebte unter den Menschen ein Mann, der die Magie beherrschte. Kein Zauberkünstler, der mit Geschick für Illusionen sorgte, sondern ein Magier, der einzige vielleicht, der alle Magie beim Namen kannte und zähmte, sodass sie tat, wie er verlangte.
Er sah Gutes in den Menschen, die seine Wege kreuzten, doch auch Schlechtes. Und wo immer etwas Schlechtes geschah, da sah er es Wurzeln schlagen und sich ausbreiten. Und so schmiedete er den Plan, das Schlechte an ebenjenen Wurzeln auszureißen und an einen anderen Ort zu bringen, wo es kein Leid verursachen konnte.
Er wanderte nach Lyaskye, und dort angekommen sagte er zu ihr, der Herrscherin aller Länder: »Gute Mutter, ich komme, um Euch von den Schlechtigkeiten zu befreien. Alles, was ich benötige, ist ein Stück Land von Euch, Land mit unüberwindlichen Grenzen, wohin ich die Schlechten verbannen kann.«
Lyaskye jedoch war nicht einverstanden. Das Schlechte zu nehmen, schwäche das Gute, ließ sie den Magier wissen. Und wer träfe die Entscheidung, was gut sei und was nicht und wie viel Schlechtigkeit es brauche, um eine Verbannung zu rechtfertigen?
Und so kam es, dass Lyaskye dem Magier verweigerte, was er begehrte.
Dies erzürnte den Magier, und so rief er die Magie vom Himmel herab, auf dass Lyaskye sah, was geschah, wenn ihren geliebten Menschen so viel Macht zuteilwurde. Wie Regen fiel Magie vom Himmel, benetzte Tiere, Pflanzen und Steine und sickerte in die Erde, wo neue Magie aus ihr entstand.
Die Magie aber war wild und stark, und kaum ein Mensch verfügte über die Kraft, die es brauchte, sie zu zähmen.
Hilflos musste Lyaskye mit ansehen, wie ihre geliebten Menschen an der Magie zugrunde gingen, ganze Generationen fielen und ihre Körper zu Erde wurden.
Als nur mehr wenige Familien übrig waren, sprach der Magier ein zweites Mal zu Lyaskye: »Bist du nun bereit, mir zu geben, wonach ich verlange?«
Und Lyaskye tat, was sie nie zuvor getan hatte; etwas, von dem sie nicht wusste, dass sie dazu fähig war.
Sie gab nach.
Aus tiefster Verzweiflung riss sie einen Teil aus sich selbst heraus und überreichte ihn dem Magier. Eine klaffende Wunde blieb zurück, in der ihr Kummer bis heute schwelt: die Abyssschlucht.
Auch der Magier riss ein Stück aus sich heraus: die Macht, die Magie zu beherrschen. Er brach sie in fünf Teile, legte jeden davon in die Hände einer überlebenden Familie und schuf so die Clans.
Der Magier aber ging fort und nahm das Land mit sich, welches Lyaskye ihm gegeben hatte, verbarg es in den Falten der Dimensionen, wo es unsichtbar wurde, und schuf darin sein Reich der Verdammnis, in dem ein jeder Mensch, der es betritt, seine Seele lässt und zur Daema wird.
Den Schuldigsten unter ihnen, den Herren aller Schlechtigkeiten, ernannte er zum Lord der Daema.
Und die Kunde von dem Reich zwischen den Welten verbreitete sich in allen Landen, und die Mutigen und die Verzweifelten teilten miteinander das Geheimnis vom Lord der Daema und dass es nicht mehr brauchte als seinen Namen, um ihn in die eigenen Dienste zu zwingen, auf dass er jene, die einem übel mitspielten, zu sich nahm und zu seinen Sklaven machte.
Wie alle Geschichten, die wahr sind, geriet auch diese in Vergessenheit. Wunden verheilen, Tränen trocknen, und auf Gräbern wachsen Feld und Wald.
Doch einen Ort gibt es, an dem die Erinnerungen überdauerten, denn dorthin zog der Magier sich zurück. Ein Land, in dem es keine Menschen gab zu jener Zeit und damit niemanden, der die Magie gesammelt und gezähmt hätte.
Ein Land, dessen junges Volk die Berge seine Familie nennt und die Winde seine Freunde.
Willkommen in Nemija.
KAPITEL 1
LAIRE
Die Nacht drohte mir davonzuhuschen.
Entschlossen schob ich das Schmuckkästchen zurück in sein Versteck unter der losen Bodendiele. Das Armband aus rotem Achat blieb zurück. Auf meiner Mission brauchte es keinen Schmuck, erst recht nicht diesen, der vor Erinnerungen glühte. Nur den erbsenkleinen, kugelrunden Stein, der unter meinem Leinenhemd an einem Lederband um meinen Hals hing, würde ich mitnehmen. Als Glücksbringer hatte er bisher versagt, aber wer konnte schon wissen, ob unser beider Zeit nicht vielleicht noch kam. Zurücklassen wollte ich ihn nicht. Die Magie darin war kaum zu spüren, aber sie war mehr als genug, um Mutter in Schwierigkeiten zu bringen, sollte ihn jemand hier finden.
Zunächst hatte sich das Warten endlos angefühlt, aber jetzt, da ich endlich meine Sachen zusammengepackt hatte – Proviant für mehrere Tage, Wasser, Wechselkleidung, einige Heilmittel sowie die Anemonenlampe, die still und friedlich in meinem Rucksack vor sich hinglomm, als wäre alles wie immer –, musste ich mich sputen, wenn ich das Senketal vor dem ersten Licht des Morgens verlassen haben wollte. Die anderen würden früh genug merken, dass ich verschwunden war. Und sobald der Fürst, der einst so viel mehr für mich gewesen war als nur mein Fürst, davon Wind bekam, hätte ich die Garde Nemijas im Nacken. Doch ich war bereit, weitaus größere Gefahren auf mich zu nehmen, um Desmond zu befreien. Ich war bereit, dem Lord der Daema und all seinen Kreaturen gegenüberzutreten. Was sollten Menschen mir im Vergleich zu ihnen schon antun?
Etwas erregte meine Aufmerksamkeit, und ich lauschte in die Dunkelheit, hörte aber nichts mehr. Vielleicht war bloß Zugluft durch die Bretterwände gekommen? Das leise Schnarchen meiner Mutter hatte aufgehört, in unserer Schlafkammer war es grabesstill.
Irgendwann würde diese Stille ewig andauern.
Der Gedanke erzeugte ein Gefühl von Leere in meiner Brust, in der jeder Herzschlag von einem Echo begleitet wurde. Am liebsten wäre ich zu meiner Mutter gestürmt, hätte sie wachgerüttelt und so fest umarmt, wie ich konnte. Dumme, naive Gedanken. Ich würde ihr bloß wehtun. Sie war so schwach geworden. Die Schmerzen in ihren Gliedmaßen fraßen sie langsam, aber sicher auf. An guten Tagen kam sie noch bis zum Brunnen, um sich zu waschen, an schlechten brauchte sie sogar Hilfe, um vom Bett bis zum Sessel zu gelangen. Es galt als seltene Ausnahme, wenn Menschen vor dem Greisenalter an der Welke erkrankten. Meine Mutter hatte es schon als junge Frau erwischt, und mit jedem Winter wurde es schlimmer.
Ich fühlte mich eisig kalt wie der Nordwind Myr, weil ich sie allein ließ. Zwar hatte ich unsere Nachbarin Anken gebeten, für Mutter zu sorgen, und ich wusste, dass sie es gewissenhaft tun würde. Aber wie konnte ich gehen, ohne sicher zu wissen, dass ich jemals zurückkehren würde? Wie lange würde Anken warten? Wann würde sie durchschauen, dass ich gelogen hatte und meine Reise nichts damit zu tun hatte, seltene Kräuter für eine Medizin zu suchen?
Still kniete ich an der Kleiderkiste nieder und stemmte den Deckel hoch. Ganz weit unten, unter Tüchern, Hemden, Kitteln und groben Hosen für die Stallarbeit – Sachen, die ich früher niemals hätte tragen dürfen –, lag mein letztes Ballkleid. Das smaragdgrüne, das wir weder verkauft noch zu etwas Praktischerem umgenäht hatten, nachdem wir ins Dorf verbannt worden waren. Mutter war immer der Meinung gewesen, dass ich es noch brauchen würde. In gewisser Weise hatte sie recht, denn verborgen in den Rockfalten wartete mein Myrodem, die traditionelle Waffe der Nema, die zu tragen ich nicht mehr würdig war, weshalb ich sie verstecken musste. Ich zog die gebogene Klinge, schon vor Tagen hatte ich sie geschliffen und poliert sowie den Hüftgurt der Lederscheide gereinigt und geölt. Er schmiegte sich an meinen Körper und positionierte die Waffe so ausbalanciert an meiner Seite, als wäre sie ein Teil von mir. Der Rucksack dagegen war schwer. Nur noch die Handschuhe überstreifen, ohne die ich unsere Hütte niemals verließ. Noch einmal blickte ich zurück, ließ meinen Blick über die Schemen von Schrank und Truhe gleiten, über mein Bett und das, in dem Mutter schlief. Mehr Platz bot unsere Hütte nicht. Im zweiten Raum, der Küche, stießen wir aneinander, wenn wir uns gleichzeitig dort aufhielten.
»Laire?«
Ich schloss die Augen und seufzte lautlos, als ich die schwache Stimme meiner Mutter hörte. Nun musste ich mich doch verabschieden und konnte die Erklärung nicht dem Brief überlassen, den ich auf den Tisch neben ihrem Bett gelegt hatte.
»Luilaire, bist du wach? Kannst du mir etwas Wasser bringen, bitte?«
»Natürlich.« Ich huschte zum Küchentisch, wo die Karaffe stand, und füllte einen Becher. Meine Hand zitterte beim Einschenken, ich ließ die verschütteten Tropfen auf dem Holz zurück, wo sie zu Flecken werden würden, und brachte Mutter das Wasser. Sie griff nach meiner Hand und drückte sie.
»Danke, mein Liebes. Entschuldige, dass ich dich aufscheuche. Ich hätte mich früher darum kümmern müssen, du brauchst doch deinen Schlaf.«
»Ist schon gut«, unterbrach ich sie. »Ich war ohnehin wach.« Bemerkte sie gar nicht, dass ich angezogen war? Dass ich eine Linnenhose und sogar die Lederhandschuhe schon trug? In schlechten Zeiten schlug ihr die Krankheit auf die Sinne und sie nahm alles wie durch einen Schleier wahr. Aber dass ihr nicht einmal der wollene Umhang auffiel, der meine Silhouette in der Dunkelheit in einen formlosen Schatten verwandelte, erschreckte mich. Konnte ich denn gehen, wenn sie sich in einem so schlimmen Zustand befand?
Ich half ihr beim Trinken und griff nach einem Tuch, um wegzuwischen, was ihr aus dem Mund tropfte. Sie sah schlecht aus, ihre Haut schien grau. Die Antwort lag klar wie ein Sternhimmel vor mir. Ich musste gehen. Nicht nur für Desmond, auch für sie.
»Ich werde ein paar Tage lang fort sein«, flüsterte ich. »Aber ich möchte, dass du dir keine Sorgen machst, in Ordnung? Anken wird sich gut um dich kümmern.«
Zu meiner Verwunderung lächelte sie, im Schein des Mondes, der durchs Fenster auf ihr eingefallenes Gesicht fiel, sah ich es genau. »Gehst du zur Burg, Laire? Wirst du deinen Liebsten treffen?«
Wie gut, dass sie nicht bemerkte, wie sich meine Augen mit Tränen füllten. »Ja, Mama. Ich gehe zu Desmond.« Zur Burg nicht, denn mein Verlobter war nicht länger dort. Er war an einem vollkommen anderen Ort. »Ich sorge dafür, dass die Hochzeit nicht noch einmal aufgeschoben wird. Im Spätsommer, Mama, wirst du wieder auf der Burg leben, im Flügel von Desmonds Familie. Du wirst nicht mehr frieren müssen, wenn der Herbst mit seinen Regenstürmen und der Winter mit Myr und Kälte kommen, und die besten Heilerinnen kümmern sich dann um dich. Nach der Hochzeit wird alles besser.« Gut nicht, das würde es niemals wieder werden. Aber besser.
»Hauptsache, ich seh dich dort tanzen, Laire.«
Ich zwang mich zu einem kleinen Lachen. »Dir zuliebe tanze ich dann jeden Tag.«
An ihrem Bett wartete ich, bis ihr seufzender Atem verriet, dass sie wieder eingeschlafen war, und beugte mich über sie, bis meine Lippen ihr Haar berührten. »Sei mir nur nicht böse, Mama. Du wirst es nicht gutheißen, aber ich tue es für dich.«
Dann schulterte ich den schweren Rucksack, nahm meine Lederstiefel in die Hand und trug sie bis zur Tür. Leise nun, leise.
Nachdem ich mich durch einen Spalt nach draußen geschoben hatte – trotz des frühen Sommers war es kühl –, zog ich die Tür Millimeter für Millimeter ins Schloss. Es klackte wie ein geheimes Signal, und erstarrt wartete ich darauf, dass hinter den Fenstern der benachbarten Häuser Lichter entflammt wurden, dass Türen aufgingen und Gardisten die Straße entlanggaloppiert kamen.
Reiß dich zusammen, schalt ich mich und bat die Berge stumm um ein wenig Schutz in ihren Schatten. Ich hatte mit kaum jemandem über mein Vorhaben gesprochen und mich unauffällig verhalten. Als vor wenigen Tagen die ersten Gerüchte um Desmonds Verfluchung das Dorf erreichten, hatte ich es wie alle anderen zunächst nicht wahrhaben wollen. Doch dann hatte ich plötzlich den Beweis vor mir gehabt, einen Beweis, der keinen Raum für Zweifel ließ. Die Briefe, die Desmond mir geschrieben hatte, waren in meinen Händen zu Asche zerfallen. Jedes Kind in Nemija wusste, was folgte, wenn der Lord kam und einen Menschen mit sich nahm: Er vernichtete alles, was dieser Mensch geschaffen hatte. Kein Mensch, der in seinem Leben nicht ein Stückchen Unsterblichkeit schuf. Der Lord nahm dieses Stückchen mit und vernichtete es.
Doch erst nachdem die Verkündung, Desmond es Yafanna, der Sohn und Erbe des Obersten Ministers, sei von Unbekannten verflucht und vom Lord der Daema geholt worden, verlesen worden war, hatte ich meinen Tränen freien Lauf gelassen. Jeder im Dorf verstand mich, schließlich hatte ich gerade meinen Verlobten verloren. Dass ich mich nun aufmachte, das verwunschene Reich der Daema zu finde, um vor ihren Lord zu treten und zu verlangen, er möge Desmond freigeben – das erwartete jedoch niemand hier. Nicht von mir, der stillen, zurückhaltenden und stets unauffälligen Laire.
Im Dorf kannte man mich als Bücherwurm, weshalb man sich das Maul darüber zerriss, was ein Mann wie Desmond es Yafanna nur an mir fand, war ich doch ganz und gar gewöhnlich – von dem hässlichen Umstand abgesehen, dass ich eine Verstoßene war.
Seit fünf Jahren sorgte ich für mich und meine Mutter, indem ich Käse unserer Ziegen und Eier unserer Hühner verkaufte. Darüber hinaus handelte ich mit Wild- und Heilkräutern, die ich in den Bergen sammelte, wo sich nur wenige hinwagten. Mehr wusste hier niemand über mich. Sie kannten weder den wahren Grund, aus dem ich in die Berge ging, noch wussten sie von den Umwegen, die ich auf mich nahm, um die Waren zu verkaufen, von denen ich keinem erzählte. Nicht einmal meine Mutter ahnte, wovon ich die Medizin gegen ihre Erkrankung bezahlte, und hätte sie es gewusst – oh, sie war seit Jahren nicht mehr in der Lage, mich zu züchtigen, aber in diesem Fall hätte sie sich über ihre geschwundenen Fähigkeiten hinweggesetzt und mich windelweich gehauen. Sie war in anderen Belangen nie grob zu mir gewesen, nicht einmal streng. Nur in einer einzigen Hinsicht kannte Mutter keinerlei Gnade mit mir. Denn es gab Gesetze in Nemija, und meine Mutter hatte sehr gründlich dafür Sorge getragen, dass niemals jemand erfuhr, dass ich eines davon mit meiner puren Existenz brach.
Warum nur war ich jetzt, da ich im Mondlicht zwischen den einfachen Holzhäusern hindurchschlich, so sicher, jemand würde mir folgen? Ich war allein auf den staubigen Wegen, das einzige Lebenszeichen war der Geruch von Rauch, der Tag und Nacht aus der nahen Schmiede drang. Selbst in den Verschlägen der Hühner herrschte Ruhe, die wenigen Geräusche kamen vom Wald, auf den ich zuhielt. Die Winde ließen die Blätter murmeln, und irgendwo rief ein Uhu.
Zwischen den Bäumen mit ihren ausladenden Kronen hüllte mich Finsternis ein, und wenn ich den Weg nicht verfehlen wollte, musste ich das Leuchtglas hervorholen. Eine grün-goldene Flussanemone schwamm darin im Wasser und gab buttriges, weitreichendes Licht ab, mit dessen Hilfe ich den schmalen Pfad fand und mir nicht den Kopf an Ästen aufschlug. All das aber, was mein Licht nicht erreichte, versank in Schwärze. Ich hörte es in der Schwärze knacken und knistern, als würden sich Schritte an mich heranpirschen. Doch wenn ich verharrte und lauschte, war sogleich alles wieder still.
Erst als nach Stunden bleiches Licht durch die Baumkronen drang und vom frühen Morgen flüsterte, wurde mir klar, dass niemand hinter mir herschlich außer meinen Schuldgefühlen.
KAPITEL 2
DESMOND
In den Liedern sangen sie, der Tod wäre schön. Warm und friedlich und voller Licht und wohlklingender Melodien; immerhin führte einen das Sterben in die Arme von Lyaskye.
Alles gelogen.
Desmond bereute, nie vertraut und stattdessen immer diese zweifelnden Fragen gestellt zu haben, woher die Priester und Gelehrten denn vom Tod wissen wollten, waren sie selbst doch allesamt quicklebendig. Denn hätte er ihnen geglaubt, wüsste er nun, dass er noch lebte.
Eine gefühlte Ewigkeit blieb er mit geschlossenen Augen liegen, sein Körper taub vor Kälte, sein Mund ausgetrocknet und das Gesicht in etwas Klebrigem, Eisigem, Nassem. Es stank bestialisch, als hätte man sein Innerstes nach außen geholt und ihn hineingeworfen, damit er darin verfaulte. Aber solange er nicht versuchte, die Augen zu öffnen, um nachzusehen, ob er wirklich tot und in der Ewigkeit angekommen war, bestand noch die Aussicht, dass es eine Erklärung gab. Einen Weg aus dieser Kälte hinaus.
Er konnte sich an nichts Besonderes erinnern. War er nicht schlafen gegangen, ganz normal, wie an jedem Tag? Er entsann sich, Hemd und Hose über den Stuhl gehängt zu haben. Durch das blaue Fensterglas hatte der Nachthimmel hell ausgesehen, dabei war es spät gewesen, fast schon wieder Morgen. Warum war er so spät zu Bett gegangen? Er erinnerte sich an Musik. An Tänze auf einer Terrasse, wo die Lieder der Streicher und Sänger nur gedämpft zu hören waren. Ihm war kalt gewesen, aber er wollte – wieso denn nur? – nicht mehr in den Ballsaal zurückkehren, dabei warteten dort alle auf ihn. Stattdessen schlich er sich an etlichen Menschen vorbei, ging in sein Zimmer, warf ein Kristallglas an die Wand und kippte sich Weinbrand direkt aus der Flasche in den Mund. Beim Myr, der aus dem Norden kam – er hatte Weinbrand aus einer Flasche getrunken! Ein Glas geworfen! Aber warum? War er zornig gewesen? Frustriert? Traurig? Es schien alles wie ausradiert. Er war schlafen gegangen, seine letzte Erinnerung das weiche, warme Fell seines Jagdhundes Bo, der sich an seine kalten Fußsohlen geschmiegt hatte.
Einen Moment lang drifteten seine Gedanken davon; fast wäre er in seine Erschöpfung gestürzt und eingeschlafen. Doch rechtzeitig erinnerte er sich wieder an die Träume, die ihn in jener Nacht gequält hatten und ihn nun wieder mit sich zu reißen drohten. Albträume von monströsen Gestalten mit langen Schnauzen, Reißzähnen hinter zurückgezogenen Lefzen, Flügeln mit spitzen Krallen am Ende jedes Knochens und lederner Haut dazwischen. Sie hatten ihn an den Armen, an den Füßen, im Genick und am Haar gepackt und mit sich durch tiefste Dunkelheit gezerrt. Oh, da war er lieber hier, in der Kälte, im Gestank, als zurück in diese Träume zu sinken.
Es half nichts, er musste sich dem stellen, was hinter der Dunkelheit seiner geschlossenen Lider wartete.
Vorsichtig zwang er die Augen auf. Sie waren verklebt, und er musste sich mit klammen Fingern Verkrustungen aus den Wimpern reiben. Erschüttert stellte er fest, dass er halbnackt auf einer löchrigen Schicht aus schmutzigem, schimmligem Stroh lag. Hatte man ihn ausgeraubt und in eine Gosse geworfen? Er trug bloß die knielangen Unterhosen, mit denen er zu Bett gegangen war, sie hatten sich mit der Feuchtigkeit vollgesogen, die in den Fugen der Pflastersteine stand. Erschrocken keuchte er auf, als sein sich langsam aufklarender Blick im diffusen Licht flackernder Wandfackeln auf die Gitterstäbe traf. Dies war ein Kerker. War er vielleicht …? Er stemmte sich hoch, kam mit zitternden Muskeln auf die Knie und kroch an das Gitter. Die Zelle, in die man ihn gesperrt hatte, unterschied sich nicht groß von jeder anderen: gepflasterter Boden, drei steinerne Wände sowie eine aus Bronzegittern. Neben dem bisschen Stroh gab es einen Blecheimer, vermutlich für körperliche Bedürfnisse. Es schüttelte ihn. Nein, dies waren nicht die Kerker der Burg es Retneya, in der er zu Hause war. Oft genug war er als Kind mit Laire und Vika verbotenerweise dort hinuntergeklettert, auf der Suche nach Banditen, Schmugglern und Abenteuern. Gefunden hatten sie unter den Gefangenen allerdings nur gebrochene, arme Schlucker, die ihnen für ein Stück Käse oder Speck sicher die Füße geküsst hätten.
Desmond erinnerte sich gut genug, um zu wissen, dass es in keinem Kerker der Burg Gitterstäbe aus Bronze gab. Er legte seine Hände um das kühle Metall, hielt sich daran fest und kämpfte sich auf die Füße. Seine Knie waren so nachgiebig, dass er fast gestürzt wäre.
Ein leises Lachen erklang von außerhalb seiner Zelle. »Sieh an. Der Prinz ist erwacht.«
»Ihr denkt, ich wäre ein Prinz?« Desmond hätte gern zurückgelacht, um den Schein zu wahren, er hätte keine Angst. Doch allein die wenigen Worte fielen ihm schwer. Seine Zunge war aufgequollen wie ein toter Fisch in der Sommerhitze.
»Für ihn bist du es«, antwortete die Stimme eines jungen Mannes, vielleicht noch ein Bursche. »Für den Lord.«
»Dein Lord hat einen Fehler gemacht«, erwiderte Desmond tonlos und wischte die feuchten Strohhalme fort, die ihm an der nackten Brust klebten. Wer auch immer dein Lord sein mag.
Der andere schwieg eine Weile. Dann sagte er heiser: »Du solltest vorsichtig sein mit dem, was du sagst. Wenn sie dich hören …«
Wer, verdammt?
»Wenn der Lord dich hört …«
Der Lord, der Lord. Das einzelne Wort wirbelte in seinen Gedanken so wild umher, dass ihm schwindelig wurde. Natürlich hatte er einen Verdacht, wen der Mann – es musste ein anderer Gefangener sein – damit meinte. Nur ein einziges Wesen trug diesen Titel. Doch Desmond hatte nichts getan, was es rechtfertigte, in den Kerkern des Daemalords zu landen. Er hatte nichts … Entsetzen ballte sich zu einem Eisklumpen in seiner Brust zusammen, als ihm gewahr wurde, dass Teile des gestrigen Abends in seiner Erinnerung fehlten. Er war wütend gewesen … wütend auf … er bekam es einfach nicht zu fassen. Zu viel Weinbrand? Da war mehr gewesen.
Himmelskraut – er hatte Himmelskraut verbrannt und sich an dem Rauch berauscht. Es hatte ihn beruhigen sollen, aber in Verbindung mit dem Weinbrand und einem Gefühl ewiger Kälte war es nicht gelungen. Er schürfte tiefer in seinen Gedanken, aber da war nur noch der bittere Nachgeschmack von Zorn. Hatte er sich mit jemandem gestritten? Aber mit wem? Und warum?
Was war geschehen? Er begann wieder zu zittern, weniger aus Kälte diesmal, sondern mehr aus der Furcht heraus, was er getan haben mochte. Es musste etwas Unentschuldbares sein, wenn er aus diesem Grund verflucht worden war.
»Sie kommen«, flüsterte der andere Mann, plötzlich bebte seine Stimme vor Furcht. »Schon wieder. Sie haben dich gehört, du hättest schweigen sollen.«
Auch Desmond vernahm Schritte durch die Gänge hallen, klappernde Füße von vielen Sohlen, die sich unisono bewegten, als gehörten sie zu einem einzigen Wesen.
Ein leiser werdendes Schaben in der Zelle neben ihm verriet, dass der andere Gefangene sich bis an die hintere Wand zurückzog.
Desmond aber straffte die Schultern und blieb an den Gitterstäben stehen.
Ja, sie kamen. Sie kamen, um ihn zum Verhör zu holen. Er würde erfahren, was man ihm zur Last legte. Sollte er eine Schuld auf sich geladen haben, würde er sie begleichen. Nichts, keine Strafe und kein Urteil, konnten annähernd so schlimm sein wie seine Vorstellung, etwas Unentschuldbares getan zu haben und nicht zu wissen, was.
Denn für nichts anderes als etwas Unentschuldbares wurde man mit einem Daemafluch belegt.
KAPITEL 3
ALARIC
»Spielst du noch einmal das Feuerlied von zu Hause?«
Bowen gab ein genervtes Grunzen von sich, lächelte jedoch unter seinem Bart in sich hinein. Niemand schlug Caleja einen Wunsch ab, erst recht nicht ihr mürrischer alter Leibwächter, auch wenn er permanent darüber schimpfte, wie verwöhnt das Mädchen doch war.
Alaric verkniff sich das Grinsen und senkte den Blick zurück auf seine Zeichnung, während Bowen die Mundorgel an die Lippen führte und dem kleinen Instrument seine glucksenden Laute entlockte, die kein bisschen zu dem wilden Feuerlied und erst recht nicht zu einem alternden Krieger wie Bowen passten. Doch auf ihrer Reise hatten sie kein anderes Instrument dabei – und Bowen hätte auch kein anderes spielen können.
Auf die Kohlestriche konzentriert, das Knistern des Feuers in den Ohren und seinen flackernden Schein im Gesicht, ließ Alaric die Gedanken treiben. Noch einen Vollmond, vielleicht zwei, dann waren sie wieder zu Hause, und bislang hatte er nicht herausfinden können, ob er sich freute, seine Eltern nach der langen Reise wiederzusehen, oder ob die Furcht überwog. Als die Zwillinge mit Bowen aufgebrochen waren, um den Kontinent zu bereisen, wie es für Fürstenkinder von Keppoch üblich war, waren sie zehn gewesen. Nun waren sie zwölf, und man erwartete die Stärke, die Vernunft und den Mut von Erwachsenen, wenn sie an den Hof ihrer Heimat zurückkehrten. Ob er das schaffen würde? Noch immer träumte er manchmal schlecht und konnte dann den ganzen Tag nicht aufhören zu denken, der Traum wäre ein böses Omen. Erst letzte Nacht hatte er wieder einen solchen Albtraum gehabt. Im Morgengrauen hatte er Caleja seine Sorgen anvertraut, etwas Schlimmes würde passieren, er spürte es doch! Sie hatte ihn ausgelacht, seine wilde Zwillingsschwester mit dem Feuerhaar und den Eisaugen. Aber sie musste auch nicht befürchten, Vaters Erwartungen zu enttäuschen. Caleja war Vaters ganzer Stolz, all das, was ein Keppochaner sich von einem Kind wünschen konnte. Klug und stark war sie, und ungestüm mit glutrotem Haar. Alarics Haar dagegen war schwarz wie das seiner Mutter, nur das Tageslicht ließ ein paar dünne Strähnen dunkelrot leuchten. Nicht gerade ein Zeichen besonderer Stärke. Sie waren in der gleichen Flamme geboren, Caleja und er, aber die Flamme musste ihre Hitze ungerecht verteilt haben.
Um das Lager herum zog sich Dunkelheit zusammen, und die Winde, von denen in Nemija jeder einen eigenen Namen trug, lärmten und tobten in den Ästen wie Tiere im Verborgenen. Alaric bemerkte, dass auch Caleja näher an das wärmende Feuer rückte. Nächte unter freiem Himmel waren immer noch eine aufregende Ausnahme.
»Hast du Angst?«, fragte er. »Wenigstens ein bisschen?«
Seine Schwester sah ihm mit Stolz in die Augen. »Wovor sollten wir uns denn fürchten, du und ich?«
Er zuckte mit den Schultern. »Wir sind zwei Jahre gereist, und du weißt die Antwort immer noch nicht?«
Sie lächelte. »Ich habe einen Plan. Ich will sie niemals finden, diese Antwort, nie.«
In diesem Moment durchschnitt ein scharfes Zischen das keppocher Feuerlied und es verstummte. Mit ihm die Kinder, mit ihnen die Geräusche der Tiere und mit ihnen selbst die Winde, als hielten sie den Atem an.
»Was war das?« Alaric schämte sich dafür, dass seine Stimme vor Schreck so hoch klang, aber nur kurz, denn dann erreichte sein Blick Bowen, der noch immer an den Baum gelehnt dasaß. Die Mundorgel fiel ihm in den Schoß, seine Hand sank einen Augenblick später nieder. In der Stirn des Leibwächters steckte ein Pfeil. Ein dünnes Rinnsal Blut lief Bowen über den Nasenrücken und die Wange wie eine Träne. Das Rot schimmerte im flackernden Feuer.
»Alaric!«, schrie Caleja aus voller Kehle. »Alaric!«
Aber was sollte er tun?
Natürlich nahm er das Schwert, natürlich stand er vor seiner Schwester, als die Räuber kamen. Natürlich rief er das Feuer, bat es, flehte. Die Flammen schlugen aus, aber sie erreichten nicht die Kraft, die Feinde zu versengen. Er war nicht stark genug. Natürlich griff er an, ohne zu zögern.
Es wurde ein kurzer, harter Kampf, der Bowen stolz gemacht hätte, und am Ende war der Angreifer schwer verletzt und Alaric atmete noch – das war es, was zählte. Aber es kamen weitere Gegner, und während Alaric das schwere Schwert herumwirbelte, nicht sicher, wie lange er es noch halten konnte, hatten sie Caleja längst gepackt. Einer von ihnen drehte sich noch einmal um und streckte Alaric beiläufig mit einem Faustschlag nieder, als wäre er nichts weiter wert als eine Maulschelle.
Während er das Bewusstsein verlor, dachte er an nichts anderes als seine Schwester, und ohne sein Zutun breitete sich eine Gewissheit in ihm aus: Das Leben, das er kannte, war nun vorbei. Alaric Coljas aus Keppoch war zwölf Jahre alt geworden. Nun gab es ihn nicht mehr.
Mit einem Stöhnen kam Alaric zu sich und rieb sich die Stirn. Wann immer er diesen Traum hatte, erwachte er mit dröhnenden Kopfschmerzen, als wäre es gestern gewesen, dass ihn die Männer niedergeschlagen und seine Schwester entführt hatten. Dabei war es zehn Jahre her.
Ihm war übel, und er konnte sich nicht entscheiden, aus welchem Grund.
Das Gebräu, das ihm die Nema in ihren Kaschemmen günstig anboten, solange sie ihn für einen Gast aus Lyaskye hielten, und das er gestern Abend hatte trinken müssen, um Schlaf finden zu können, war sicher nicht unbeteiligt.
Dazu kam das Bild des guten alten Bowen. Es hatte sich so tief in Alarics Gedanken gefressen, dass er es nach dem Traum stets wochenlang nicht aus dem Kopf bekam. Wohin er auch sah, die dunkle Blutlinie in dem fast erstaunt wirkenden Gesicht war immer da. Er konnte die Leichen nicht zählen, die er seit jener Nacht gesehen hatte. Einigen hatte er selbst das Leben genommen; Leuten, die er kaum oder gar nicht kannte, Leuten, die ihm nichts getan hatten. Und obgleich Alaric die Schuld mit sich genommen hatte, ihre Gesichter hatte er verloren, allesamt irgendwo verloren – bis auf Bowens.
Was ihm noch größere Übelkeit verursachte, war die Tatsache, dass seine Träume tatsächlich schlechte Omen waren, wie er es damals befürchtet hatte. Sie kamen nie ohne einen Grund. Wann immer er diesen Traum hatte, den vom Feuerlied, von Calejas Entführung und Bowens Tod, bedeutete das, dass der Bote nach ihm suchte, der Bote seines Schuldherren, dem Alaric sein Leben in die Hände gelegt hatte. Er hatte Caleja damals von seinen Vasallen entführen lassen, und es war Alaric bis heute ein Rätsel, warum dieser Unbekannte, der stets nur über Boten mit ihm kommunizierte, das Lösegeld nicht von ihren Eltern, sondern von ihm forderte.
Nun ja, bei genauerer Betrachtung war es vielleicht bloß folgerichtig. Wer auch nur halbwegs Ahnung von den Sitten des Keppochaner Fürstenhauses hatte, der wusste, dass man ihnen viele Schwächen nachsagen konnte, doch eines waren sie gewiss nicht: erpressbar. Mit nichts und niemandem – und ein Balg, das schwach und dumm genug war, sich entführen zu lassen, ohne sich selbst befreien zu können, brauchte in Keppoch ohnehin niemand.
Was ein erneuter Beweis dafür war, dass Alaric kein würdiger Nachfolger seines Vaters war. Denn er sah das anders. Er brauchte seine Schwester.
Zehn Schuldhölzer hatte der Schuldherr für Calejas Freiheit geboten, und Alaric – dummer Junge, der er gewesen war – hatte zugestimmt, sich die magischen Bänder anlegen lassen und kaum erwarten können, die Schuld zu erfüllen. Bis das zehnte Schuldholz zerbrochen war, gehörte Caleja dem Schuldherrn. Doch das Erste, was brach, war nicht etwa eines der Hölzer, sondern Alarics naive Hoffnung, er könne die Aufgaben in wenigen Wochen oder einigen Monaten erledigen.
Es zerriss Alaric bis heute jeden Tag aufs Neue, nicht zu wissen, wo seine Schwester war, was in der Gefangenschaft mit ihr geschah und wie es ihr ging.
Neun Schuldhölzer waren inzwischen gebrochen, er hatte das Fragenstellen und Verhandeln aufgegeben und im Auftrag des Schuldherren Leben in beinah jedem Land des westlichen Kontinents zerstört. Indes war er vom Jungen zum Mann geworden, und jede einzelne seiner körperlichen Veränderungen hatte ihn in gewisser Weise entsetzt. Seine Schultern waren breit geworden, Arme und Beine lang und kräftig, und seine Züge hatten alles Kindliche schon vor Jahren abgelegt. Sein Erscheinungsbild gefiel den Menschen, und sie zeigten es ihm deutlich, vor allem hier in Nemija, wo sein dunkles Haar zu den blauen Augen etwas Besonderes war. Er hasste dieses Gefühl aus tief in Abscheu getränkter Seele. Denn Caleja und er waren in der gleichen Flamme geboren. Und wenn er nun ein attraktiver Mann war, dann bestand wenig Zweifel daran, dass seine Schwester mit den Feuerhaaren und den Eisaugen eine mindestens ebenso anziehende Frau geworden war. Alaric war Mann genug, um sehr genau zu wissen, was Männer mit schönen Frauen taten, die ihnen ganz allein gehörten.
Ein Schuldholz war übrig, bis Caleja freikommen würde. Oder das, was nach all den Jahren noch von ihr übrig war.
Was würden sie beide dann tun? Zurückkehren? Nach … Hause? Der Gedanke lag nah und doch fern, so alt und blass war die Erinnerung an Keppoch inzwischen geworden. Er war in all den Jahren nicht in Keppoch gewesen, galt wie seine Schwester schon lange als tot und vergessen, und man würde ihn im Palast nicht willkommen heißen. Er würde die Erwartungen nicht erfüllen. Er würde schon daran scheitern, dass er jenen vergeben musste, die ihn auf diese gefährliche Reise gesandt hatten. Seiner Familie.
KAPITEL 4
LAIRE
Ich war ein Huhn, das mitten durch den Fuchsbau schlich. Schutzlos hielt ich auf Volarian zu, den Berg, in den die trutzige Burg es Retneya gebaut worden war. Die Burg, in der auch ich einst gelebt hatte und – wenn ich Desmond retten konnte – bald wieder leben würde. Sie stand seit Hunderten von Jahren und wurde doch nie fertig, wuchs beständig wie ein uralter Baum und wurde mit jedem Jahr größer und größer. Tiefgrau und unübersehbar hoben sich ihre Gemäuer vom hellen Grauton des Berges ab, und der Himmel über es Retneya schien immer besonders blau zu leuchten, als täte er es ihr zu Ehren.
Ich durfte auf dem Weg in Richtung Burg nicht erkannt werden, man würde Fragen stellen und mich aufhalten. Noch immer hielt man mich für das Eigentum des Fürsten und unterrichtete ihn über alles, was ich tat. Doch jeder andere Weg als der direkte in Richtung der Gebrochenen Brücke, die mich an mein Ziel bringen würde, kostete zu viel Zeit. Ich musste es vor Neumond bis zum Lord schaffen. Einen Morgen zu spät, und Desmond war verloren, würde in einen Daema verwandelt und zu einem Sklaven ihres Herrschers werden. So hieß es in den Büchern. Und auch, dass, wer mit Liebe im Herzen um das Leben eines Verfluchten bat, bessere Chancen hatte als die stärksten Krieger, wenn sie aus dem falschen Antrieb heraus vor den Daemalord traten: der Grund, aus dem ich ging.
Selbst im Schein der Vormittagssonne glaubte ich, schon jetzt überall Schatten der Daema zu sehen, so wie ich sie aus Büchern, Gemälden und von den schwarzen Vulkanglasskulpturen im Tempel kannte: riesig, mit Raubtierzähnen, Schlangenaugen und dornenbesetzten, peitschenden Schwänzen.
Auf den ersten bangen Blick hielt ich sogar die Reiter – ich machte zwei und ein Packpferd aus, die sich im Galopp näherten – für Daema. Sie kamen zum ungünstigsten Zeitpunkt, denn ich hatte das bewaldete Hügelland verlassen und befand mich auf freiem Feld, ausgerechnet auf dem Streifen meines Wegs, auf dem es keinen Schutz für mich gab. Links und rechts von mir lagen Rüben- und Kartoffelacker sowie Felder, auf denen Kohl, Hafer und Dinkel mir bestenfalls bis zum Knie reichten. Zudem hatten mich die Reiter sicher längst gesehen. Nun galt es, nicht aufzufallen. Vielleicht bemerkten sie nicht, dass sich vor Anspannung Schweiß auf meinen Schläfen bildete, womöglich hielten sie mich für eine harmlose Dörflerin auf dem Weg zur Burg. Den Myrodem allerdings würden sie kaum übersehen. Ob ich ihn ins Feld werfen und mir zurückholen sollte, wenn sie fort waren? Meine zitternden Finger tasteten bereits nach der Schnalle der Scheide, als mir an dem linken Reiter etwas auffiel.
Ich … kannte diese Silhouette.
Schlagartig schlug meine Angst in Erleichterung um, die sich jedoch schnell in Fassungslosigkeit wandelte. Auf dem lackschwarzen Pferd saß meine Freundin Vika; es bestand kein Zweifel. Die zierliche Gestalt, das wie immer eng an den Kopf geflochtene helle Haar und zuletzt: Vikas Lachen, das ihr vorauseilte, als sei sie auf dem Weg zu einem Fest. Ich kannte sie gut genug, um zu wissen, dass es pure Erleichterung war, mich noch gefunden zu haben. Vika war die Einzige, die wusste, dass ich zum Lord der Daema ging. Doch den Zeitpunkt hatte ich ihr nur ungefähr genannt.
Neben ihr ritt ihr Leibwächter, das Gesicht hinter einem Staubschleier verborgen.
»Was tust du denn hier?«, rief ich Vika entgegen, während sie das Pferd durchparierte. Die Hufe wirbelten Staub zu einer Wolke auf, und Vika sprang mitten hinein, ließ die Zügel los und zog mich in eine Umarmung, die mich erst nach Luft schnappen und dann mein Gesicht an ihrer Halsbeuge verbergen ließ, damit sie mich nicht heulen sah.
»Du hast doch nicht wirklich geglaubt, ich würde dich allein losziehen und Daema verprügeln lassen, Laire.«
»Vika …« Ein Kloß machte meine Kehle eng, und ich wusste nicht, ob er aus Erleichterung bestand, dass sie hier war, oder aus nackter Panik. Ich war nie ängstlich, wenn Vika bei mir war. Ihr Mut setzte etwas in mir frei, das stärker war als jede Androhung der schlimmsten Strafen.
Doch nun bewirkte das kämpferische kleine Grinsen in ihren feinen Gesichtszügen, dass mir ganz anders wurde.
Der zweite Reiter nahm den Schleier ab, und sein Gesicht weckte eine Ahnung in mir, die meine Gefühlswelt völlig überforderte.
»Jero?« Warum fragte ich denn? Ich hatte ihn seit sieben Jahren nicht gesehen, damals war ich ein Kind gewesen, gerade einmal zwölf, und meine Welt noch in Ordnung. Inzwischen hatte sich alles geändert. Nicht aber Jeros strahlend hellblaue Augen, wenn sich auch einige Fältchen um sie herum gebildet hatten. Er musste inzwischen das dreißigste Jahr weit überschritten haben, und seine harten Züge ließen vermuten, dass das Leben nicht ausschließlich gut zu ihm gewesen war.
Früher hatte er zu den Paladinen gehört, den höchsten unter den Kriegern Nemijas. In ihren Akademien wurde das Wissen gelehrt, das es brauchte, um das Reich der Daema zu überleben. Für das Ziel, jemanden aus den Verliesen des Lords zurückzuholen, wurden sie ausgebildet, und auch wenn sich nur selten Gelegenheit bot, war die Erfüllung dieses Auftrags für sie die größte Ehre, nach der sie zeit ihres Lebens strebten.
Jero trug Marschgepäck sowie seinen Myrodem, und mir war klar, was das bedeutete. Sie hatten Pläne geschmiedet.
Er stieg aus dem Sattel, warf Vika die Zügel des dritten Pferdes zu, ließ seines einfach stehen und kam zu mir.
Ich hatte so viele Fragen an ihn. Warum war er damals vom Hof verschwunden? Warum ohne eine Erklärung? Immerhin war er über Jahre nicht nur Vikas Leibwächter gewesen, sondern darüber hinaus auch ein Freund und vermutlich mehr Familie für sie als ihre eigenen Eltern.
»Warum bist du zurück?«, fragte ich mit einem Zittern in der Stimme, so gerührt war ich, ihn zu sehen.
»Bin ich das?« Er lächelte verschmitzt. »Oder bin ich nur ein Schatten, der über Nemija hinweghuscht, auf dem Weg zu seiner Bestimmung?«
»Du willst mit mir kommen?« Hilfe suchend sah ich zu Vika. Das war zweifelsfrei ihre Idee. Aber konnte ich das annehmen? Es war eine Sache, das eigene Leben zu gefährden, aber einen anderen diesem Risiko auszusetzen … Ich würde mir nie verzeihen, wenn Jero dabei etwas zustieß.
Vika lächelte mich verhalten an. Das tat sie sonst nie, und es machte mich misstrauisch. Ihr Gesicht war normalerweise offen und ehrlich. »Laire«, sagte sie zögerlich. »Wir beide werden mit dir kommen.«
Hatte ich mich verhört? »Nein, Vika. Auf keinen Fall, das geht nicht.«
Meine Freundin sah mich ernst an. »Ich frag dich nicht um Erlaubnis. Ich habe das entschieden.«
»Hast du den Verstand verloren?«, entfuhr es mir. Ich konnte mich nicht erinnern, je so mit meiner besten Freundin gesprochen zu haben. Mein Herz raste, in meinen Ohren rauschte das Blut. Die Vorstellung, am Ende auch noch Vika zu verlieren, war unerträglich. »Verstehst du nicht, wie gefährlich das ist?«
Vika ließ die Zügel der Pferde einfach los und umarmte mich ein zweites Mal ganz fest. Ihre Gelassenheit bekam Risse, ich spürte ihr Zittern. »Eben weil es so gefährlich ist«, flüsterte sie, »lass ich dich erst recht nicht allein gehen. Ich habe die ganze Nacht mit Jero darüber gesprochen, ich kenne die Risiken besser als du. Und ich will dich trotzdem begleiten. Desmond mag dein Verlobter sein, ich weiß. Aber er ist auch mein bester Freund. Wir gehören zusammen, wir drei. Mit der Waffe bin ich ohnehin geschickter als du. Und mit Jero zusammen, der die Ausbildung der Paladine hat, können wir es tatsächlich schaffen.«
Ich blickte zu ihm. Ruhig stand er da und wartete auf unsere Entscheidung.
»Arbeitet Jero wieder für deine Familie?«, fragte ich Vika.
Sie schüttelte den Kopf. »Er hat seine eigenen Gründe, uns begleiten zu wollen. Er ist als Freund hier, nicht als Leibwache und nicht als Söldner.«
Jero nickte. »Ich wurde auf diese Aufgabe vorbereitet, solange ich denken konnte. Was soll ich sonst mit diesem Leben«, er legte sich eine Hand auf die Brust, »anstellen, wenn nicht, mein Schicksal zu erfüllen?«
Ich schluckte, denn die Geschichte der Paladine war mir bekannt. Die Jungen und Mädchen waren Waisen oder wurden ihren Müttern regelrecht von der Brust gerissen und dann nach Eshrian verschleppt, wo in der Tempelschule ihre Erziehung stattfand. Die Familien bekamen ihre Kinder niemals wieder. Irgendwann kehrten sie als Paladine nach Nemija zurück, aber bis dahin waren sie längst erwachsen und trugen neue Namen. Selbst wenn Eltern ihre Kinder aufgrund von Ähnlichkeiten erkannten, stand ihnen jemand Fremdes gegenüber, dessen Lebensinhalt darin bestand, die Anweisungen der Obrigkeit zu befolgen.
»Laire, ich war immer ehrlich zu dir«, fuhr Jero fort, »und daran hat sich nichts geändert. Ich weiß, dass du deine Chance darin siehst, dass du Liebe für Desmond empfindest, und ich halte es durchaus für möglich, dass es dir gelingen wird, ihn zu retten. Nach allem, was wir über den Lord wissen, liebt er es, mit Gefühlen zu spielen. Das bedeutet allerdings auch, dass du jemanden brauchst, der einen kühlen Kopf bewahrt. Jemanden, der das Reich versteht und die unterschiedlichen Daema kennt.«
»Es gibt unterschiedliche?« Ich wusste jetzt schon, dass ich die Antwort lieber gar nicht hören wollte.
Jero sah mich fest an. »Wir wissen von zwei Dutzend Arten. Und wir wissen, dass wir recht wenig wissen.«
Ich schluckte. Es gab selbst in der Universitätsbibliothek nur vage Informationen über das Daemareich, lediglich ein paar Legenden und Geschichten. Zu wenige brachen auf, und noch weniger kehrten zurück. Und wenn sie es taten, dann waren sie oft … verändert. Ihr Geist war nicht mehr wach, ihre Worte wurden langsam und träge, und sie vergaßen im Satz, was sie sagen wollten. »Lebende Kadaver«, nannte meine Mutter die zurückgekehrten Paladine. Sie wurden als Helden verehrt. Und wussten allesamt nicht, warum.
»Du brauchst uns«, sagte Vika. »Und wir brauchen dich, denn ohne dich und deine Liebe zu Desmond sinken unsere Chancen.«
Ich hob die Augenbrauen, und Vika nickte. »Ich meine es, wie ich es gesagt habe: Wenn du nicht mit uns zusammen gehst, gehen wir ohne dich. Aber wir gehen.«
Jero rieb sich verlegen den Nacken, wo die fingerdicke Narbe inzwischen verblasst, aber immer noch so gut erkennbar war, dass mir kurz schummrig wurde. Dass Vika so schnell klare Tatsachen schuf, behagte Jero offenbar nicht, aber er widersprach nicht.
Bei den Bergen. Wäre ich doch früher aufgebrochen. Ich glaubte nicht, die Schuld ertragen zu können, wenn einem von ihnen etwas zustieß. Doch Vika machte nie leere Versprechungen. Trotzdem suchte mein Verstand fieberhaft nach einer Möglichkeit, meine Freundin zu beschützen. Und sie spürte das.
»Laire.« Vika nahm meine Hand. »Du weißt, wie lieb ich Desmond habe. Aber das ist es nicht allein. Ich werde im Winter zwanzig Jahre alt. Meine Eltern lassen sich nicht länger hinhalten. Ich werde diesen Sommer einen Ehemann präsentiert bekommen und heiraten müssen.« Etwas Bitteres färbte ihre Stimme. »Mein Mann wird vermutlich kein Desmond sein, er wird Erwartungen hegen. Mit etwas Pech habe ich im nächsten Jahr schon ein Kind im Bauch, ohne auch nur einen meiner Träume verwirklicht zu haben.«
»Das, was vor uns liegt, ist aber keine von den abenteuerlichen Reisen, von denen du träumst«, warf ich ein.
»Nein. Es ist etwas Bedeutsames. Etwas Großes. Wir retten einen Freund, den wir lieb haben. Den besten, den wir haben, und den Mann, der wiederum dich retten wird. Wir vollbringen eine Heldentat. Lass uns zusammen gehen.«
Ich sah sie vor mir, wie sie als Kind dastand, auf der Mauer vor dem Burggraben, einen aus Holz geschnitzten Myrodem in die Luft gereckt, sich selbst und uns allen das Versprechen machend, eine Heldin zu werden, die jenseits der Berge all die Kriege beendete, die uns ängstigten wie in den dunkelsten Winkeln auf der Lauer liegende Tiere.
»Wer bin ich, dir etwas zu erlauben oder zu verbieten? Du bist wie der Wind, Vika, du bist frei, zu tun, was du kannst und willst.« Aber ich wünsche mir so sehr, du würdest es nicht wollen.
»Wie der Wind? Das sagt man allen Nema-Kindern«, murmelte meine Freundin. »Aber sie meinen es nicht so. Nicht uns Mädchen gegenüber.«
»Ich meine es so.«
»Es wird eine lebensgefährliche Reise«, sagte Jero und griff nach den Zügeln seines Pferdes, einer ungewöhnlich großen Stute mit goldbraunem Fell und martialisch wirkender Lederpanzerung an Stirn, Nasenrücken, Brust und Flanken. »Ich kann euch nur eines versprechen: Auch mich wird das Daemareich vor Herausforderungen stellen, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Niemand weiß, ob wir zurückkehren; ich kann euch nicht einmal sagen, ob wir das Reich finden und die Grenzen überwinden können. Und sollte es uns gelingen, werdet ihr euch wünschen, wir hätten es nicht geschafft. Und doch denke ich, dass wir Erfolg haben könnten. Meine Ausbildung, Vikas Kampfgeist und Laires … besonderes Talent – diese Kombination könnte der Schlüssel zum Erfolg sein. Wenn ihr wollt, dann bin ich auf eurer Seite. Heute wie damals.«
Damals … Er spielte auf den Tag vor neun Jahren an, an dem ich ihm die Wunde in seinem Nacken geschlagen hatte.
»Denkt an die neue Technik, die ihr gelernt habt, wenn ihr mich angreift. Aber der Reihe nach, und lasst alle Gliedmaßen an mir dran.«
Desmond und ich grinsten uns an, während Vika ihren Myrodem hob und ihren ersten Vorstoß versuchte. Jero hätte sie unbewaffnet und mit verbundenen Augen besiegen können, doch das ließ er uns nie merken, was vor allem Vika zu Höchstleistungen anspornte. Ihre Eltern hätten sie über alle Berge gejagt, hätten sie gewusst, dass der junge Paladin, den sie für Vikas Leibwache teuer bezahlten, ihr und uns, ihren besten Freunden, Unterricht im Kampf mit dem Myrodem gab. Vikas feste Überzeugung, das Leben sei sicherer, wenn jeder sich selbst verteidigen konnte – erst recht jedes zehnjährige Mädchen –, war bei ihrem Leibwächter auf fruchtbaren Boden gefallen; wobei Desmond behauptet hatte, dass Jero bloß gelangweilt und dankbar über die Abwechslung war. Eigentlich brauchte Vika als Tochter reicher Kaufleute keine Leibwache, zumal keinen Elitekrieger. Meine Mutter hatte dazu gesagt: »Es geht darum, zu zeigen, dass man es sich leisten kann.« So ganz verstand ich es nicht, aber um darüber nachzugrübeln, war es mir zu lieb, dass Jero mit uns übte. Ich mochte ihn, und wenn ich auch nicht so ungeduldig auf das Kampftraining hinfieberte wie Vika und nicht ganz so ehrgeizig war wie Desmond, machte es mir trotzdem Spaß – wie eigentlich alles, wenn meine Freunde dabei waren. Wenn wir zusammen waren, kam ich mir weniger falsch vor, weniger fremd als mit den anderen Kindern, die mich meist komisch fanden, weil ich oft träumte, in meinen eigenen Gedanken versank oder schwieg, wenn ich nicht wusste, was zu sagen das Richtige war.
»Ich habe eine Idee«, flüsterte mir Desmond zu, während Jero gerade voll auf Vika konzentriert war. »Eine Idee, wie wir ihn schlagen können.«
»Vielleicht, wenn wir ihn im Schlaf fesseln«, gab ich amüsiert zurück. »Wobei ich glaube, Jero lässt sich nicht fesseln. Nicht mal, wenn er schläft.«
»Ich habe einen ziemlich guten Plan gemacht. Bist du dabei?«
Neugierig sah ich Desmond an. Er war groß geworden. Die anderen Mädchen, sogar die etwas älteren, kicherten, wenn wir an ihnen vorbeiliefen, erst recht, wenn er sie anlächelte und seine grünen Augen dabei funkelten. Das taten sie jetzt auch – wie immer, wenn er eine seiner Ideen hatte. Oft endeten sie mit Ärger, aber meistens war der Spaß jeden Ärger wert. Und Jero hatte uns schließlich neulich erklärt, dass in einem Kampf nicht nur Kraft und Technik entscheidend waren, sondern vor allem ein guter Plan. Typisch für Desmond, dass er dies umsetzte, bevor es verlangt wurde. So war er auch in der Universität: Während Vika noch über die Aufgaben nörgelte, die sie nicht einmal begonnen hatte, und ich noch in den Texten versank, weil ich mir immer alles bildlich vorstellte, versuchte er bereits zu erahnen, was unsere Professoren wohl als Nächstes verlangten, um es gleich mitzuerledigen. Er dachte stets einen Schritt voraus. Ich war sicher, er würde ein fabelhafter Oberster Minister werden, wenn er den Posten irgendwann von seinem Vater erbte. Spätestens dann würde es wohl vorbei sein mit den Ideen, die Ärger verursachten.
»Was hast du vor?«, fragte ich. Die Erwartung kribbelte in mir.
Desmond beugte sich zu mir und flüsterte mir etwas ins Ohr. Mein Herz schlug immer schneller. Ich war vielleicht nicht so wagemutig wie Vika und Des, aber immerhin geübt darin, meine Ängste zu überwinden.
»Machst du es?« Desmond grinste bereits. Er wusste, dass ich nicht kneifen würde.
Natürlich nickte ich.
»Laire, was ist los?«, rief Jero mir zu.
Ich hatte gar nicht gemerkt, dass ich schon an der Reihe war.
»Willst du nicht? Wenn du keine Lust auf das Training hast, bringe ich euch gern zum Tanzunterricht.«
Vika machte mit herausgestreckter Zunge das Geräusch einer Nachtkatze, die einen Fellballen hervorwürgte. Sie hasste die Tanzstunden und alles, was damit zusammenhing. Dabei gab es vermutlich nichts, was ihre Mutter so glücklich machte, wie Vikas Flechtfrisuren zu lösen, sodass die goldblonden Locken über ihren Rücken fielen, und Vika in hübsche Kleider zu stecken, die ihr beim Tanzen um die Knöchel schwangen.
Rasch lief ich zu Jero, kontrollierte, ob meine Füße so standen, wie er es uns gezeigt hatte, und hob den Myrodem. Im Training nutzten wir echte Waffen, keine Holzattrappen wie im Spiel, und auch wenn sie verglichen mit anderen Schwertern schlank und leicht waren, fiel es mir schwer, die Klinge lange erhoben zu halten. Jero überprüfte meine Haltung, wies mich allein mit einem Blick an, mehr Körperspannung aufzubauen, und nickte dann, als Zeichen, dass ich loslegen sollte. Ich wirbelte meine Klinge in Richtung seiner unbewaffneten Seite, und Jero nutzte seine Größe, hob die Schwerthand und neigte die Klinge nach unten, um meine nach außen zu schieben. Allein diese Paradetechnik, die ich noch nie gesehen hatte, beeindruckte mich so sehr, dass ich spontan nicht mehr wusste, wie ich weitermachen sollte – zumal ich durch meine geblockte Klinge trotz der Waffe in der Hand so gut wie unbewaffnet war. Jero hatte nun leichtes Spiel mit mir.
Es war Desmond, der mich rettete, denn der begann in diesem Moment zu kreischen, als wäre er nicht elf, sondern fünf. Seinen Myrodem hielt er in der Hand. Dunkelrote Flüssigkeit rann am Stahl entlang und tropfte auf den Boden, wo sie eine Pfütze bildete.
»Desmond!«, rief Jero erschrocken. »Was ist passiert? Hast du dich geschnitten?«
Jero stürzte dicht an mir vorbei, und ich packte blitzschnell zu und griff den Dolch, der an seinem Rücken in einem Halfter hing. Die Waffe zitterte in meiner Hand, als hätte sie ein Eigenleben. Zuerst schob ich es auf meine Aufregung, doch dann breitete sich ein Geschmack von Salz und Eisen in meinem Mund aus. Zu spät begriff ich, was ich da in meiner Hand hielt.
Magie. Der Dolch war voller Magie! Sie jagte wie ein Wind durch meinen Körper und weckte ein unverständliches Flüstern in meinen Gedanken.
Jero war so besorgt um Desmonds Hand, dass er den dreisten Diebstahl gar nicht bemerkte. Desmond aber warf die aufgebrochene Schale der Beerfleischfrucht, deren blutroter Saft für das Massaker verantwortlich war, zur Seite und begann ohne zu zögern seinen Angriff. Und während Jero nur einen Augenblick verdutzt schien, dann lachte und Desmond in kurzen, harten Attacken eine kleine Lektion in Sachen Tricks erteilen wollte, kam ich zum Einsatz. Desmonds Plan lautete, dass ich mich hinter Jero schlich, ihn die Klinge seines Dolches behutsam durch sein Hemd spüren ließ und ihm erklärte, er sei besiegt. Desmonds Plan war gut und würde aufgehen, ich hatte keinen Zweifel – ich konnte das. Normalerweise.
Doch normalerweise hielt ich nicht eine solche Magie in der Hand. Eine Magie, die nach Salz und Eisen schmeckte und mir etwas einflüsterte, was mein Kopf nicht verstand, mein Herz jedoch …
Ich hob den Dolch über meinen Kopf. Schwang ihn.
Warum ich das tat, wusste ich nicht. Der Dolch wollte es so. Die Magie verlangte danach. Sie war eingesperrt, und obgleich ich über Jahre gelernt hatte, sie auszublenden und zu ignorieren, so zu tun, als gäbe es sie gar nicht, gelang mir das in diesem Moment nicht. Die Magie war stärker als ich. Sie konnte mit mir tun, was immer sie wollte. Und obwohl ich gegen das Gefühl ankämpfte, spürte ich ein seltsames Glück dabei.
Etwas wuchs aus der Klinge hervor, eine Art Rauchsäule. Sie formte ein Seil, das über mich hinwegschwang und sich dann unvermittelt ausstreckte.
»Nein!«, kreischte ich, als ich bemerkte, wohin die Magie schlagen wollte. »Desmond! Runter!«
Jero war schneller als Desmond. Er packte ihn an der Schulter und schleuderte ihn fort, hob dann die freie Hand und senkte den Kopf. Ich verstand nicht, was vor sich ging, nur, dass dies keine Kampfgeste war. Jero beruhigte, beschwichtigte. Zähmte. Er zähmte die Magie.
Doch die Magie war wild und stark und entriss mir, ohne zu fragen, weitere Kraft, die sie für sich beanspruchte. Tief in meinem Inneren war sie groß – und ich mit ihr, egal wie viel Angst es mir machte und wie wenig ich all das wollte. Sie bildete eine Art Schweif, der peitschte wie bei einer nervösen Katze. Mit einem Mal fühlte ich eine schreckliche Furcht, dieser Schweif würde Jero treffen. Und dann, als die Angst sich auf ihren Höhepunkt gesteigert hatte, geschah genau das. Mit weit aufgerissenen Augen musste ich hilflos mit ansehen, wie die Magie nach dem Paladin schlug und er vor Schmerzen so stark zusammenzuckte, dass er ein Stück in die Knie sackte.
Ich wusste nicht, wie es mir gelang, aber plötzlich riss ich meine Hand, die den Dolch hielt, nach unten und schleuderte die Waffe von mir. Klappernd rutschte der Dolch über den Steinboden des Innenhofs und blieb schließlich liegen. Ich wich vor ihm zurück, als würde er mich jeden Moment anspringen. Die Magie flüsterte längst nicht mehr nach mir – sie schrie.
Jero rannte zu dem Dolch, umfasste ihn, und im gleichen Moment ließ das Schreien nach und die Magie verstummte. Blut rann aus Jeros Nacken und versickerte in seinem Hemd.
Ich war allein, so allein wie noch nie in meinem Leben. Was hatte ich nur getan? Wie konnte ich um Verzeihung bitten? Was würden Desmond und Vika sagen? Die beiden standen nebeneinander und starrten abwechselnd Jero und mich schockiert an.
»Ich … ich weiß nicht, was da passiert ist«, stammelte ich, dabei wusste ich es genau. Es war geschehen, was Mutter immer befürchtet hatte. Das, weshalb sie mir Unsinn wie diesen streng verbot. Weshalb ich nicht in Zorn geraten durfte, sondern immer einen kühlen Kopf bewahren musste. Die Magie war ans Licht gekommen. Alle wussten nun, dass ich sie spürte. Und mehr noch – sie hatte mich gespürt, sie hatte auf mich reagiert und mich regelrecht benutzt.
Auf dem Markt, gar nicht weit von hier, legten sie die Regelbrecher, die sich mit Magie einließen, unter einen Berg von Steinen und holten sie erst wieder hervor, wenn kein Funken Magie mehr im Körper war – und auch kein anderer Funken Leben. ›Es gibt keine Ausnahmen‹, hatte Mutter mir gesagt. ›Glaube nicht, sie würden Gnade zeigen, weil du deines Vaters Tochter bist. An dich haben sie noch höhere Erwartungen als an andere. Man verzeiht dir Skandale und Liebschaften – aber niemals Magie. Niemand verzeiht Magie.‹
Jero trat auf mich zu, langsam, als wäre ich ein halbwildes Tier. Und tatsächlich war mein Drang zu flüchten fast überwältigend. Allein die Scham hielt mich zurück. An Jeros Hals, vom Nacken bis zur Schulter, prangte eine knallrote Wunde, fingerdick, an den Rändern geschwollen und in der Mitte aufgeplatzt. Das Blut lief noch immer. Ich allein trug Schuld an dieser Verletzung, ich musste mich verantworten. Bloß waren in meinem Mund keine Worte.
»Laire«, sagte Jero leise, kam noch einen Schritt näher und nahm meine Hand. »Bist du in Ordnung, Mädchen? Bitte sag etwas.«
Ich konnte nur auf die Wunde starren. »Es tut mir so leid.«
»Das war nicht deine Schuld, Laire, das war der Dolch. Geht es dir wirklich gut?«
Er log. Die Magie war in dem Dolch, ja. Aber bei jedem anderen wäre sie auch darin geblieben. Er wollte mich trösten. Ich zitterte am ganzen Leib.
»Vika, Desmond«, rief Jero. »Kommt her.« Er stellte uns eng nebeneinander, und ich erwartete, dass meine Freunde sich nun abwendeten, vor mir davonliefen und nach ihren Eltern riefen. Sie wirkten allerdings nur unsicher und versuchten verlegen, mich mit einem Lächeln zu trösten.
»Ihr habt gerade etwas ganz Besonderes gesehen«, sagte Jero, als ginge es um ein großes Geheimnis, in das meine Freunde nun eingeweiht wurden. »Laire ist etwas Besonderes. Sie kann Dinge, die andere Menschen nicht können. Wie lange weißt du das schon, Laire?«
Die ersten Tränen lösten sich aus meinen Augen, und mit ihnen fiel ein wenig Druck von mir ab und ich konnte leichter atmen. »Schon lange. Es war eigentlich immer schon so. Ich darf es aber niemandem sagen. Niemandem. Nicht einmal euch. Mutter …« Mir brach die Stimme, bevor ich ihnen verraten konnte, was Mutter mit mir anstellen würde, sollte sie je erfahren, was ich getan hatte.
»Und das ist auch richtig so«, bestätigte Jero. »Was passiert ist, wird für immer unser Geheimnis bleiben, in Ordnung?«
Ich konnte meinen Blick nicht von seiner Wunde lösen. »Aber …«
»Das erkläre ich schon, Laire, mach dir keine Sorgen. Man verletzt sich manchmal im Kampfunterricht. Ich denke mir etwas aus. Wir vier sind die Einzigen, die wissen, was wirklich geschehen ist. Und das muss so bleiben.« Ernst sah er jeden von uns an. »Ihr wisst, warum.«
Desmond schluckte so schwer, dass man es hören konnte, und Vika zog die Nase hoch. Sie kannten die Steinhaufen ebenso gut wie ich. Das Grauen, das einem kalt in den Nacken zog und sich dort festhielt, wenn man die Schreie, das Flehen oder das Stöhnen noch hörte.
Es gab viele Verbote in Nemija. Aber nichts wurde so erbarmungslos bestraft wie die Magie.
»Könnt ihr das? Ein Geheimnis bewahren?«
Desmond nickte entschlossen. »Natürlich! Tut mir leid, Laire. Ohne meine blöde Idee wäre das nie passiert.«
Vika umarmte mich, und obwohl sie ein gutes Stück kleiner war als ich, hielt sie mich ganz fest. »Keiner wird dir was tun. Wir beschützen dich. Und passen gut auf dein Geheimnis auf.«
Jero lächelte. »Solange ihr so fest zusammenhaltet, kann nichts passieren. Ich bin sehr stolz auf euch.« Sein Blick glitt zurück zu mir. »Aber du musst vorsichtiger werden, Laire. Der Unsinn, den Desmond und Vika ungestraft anstellen können, könnte dich das Leben kosten. Vielleicht trägst du besser fortan Handschuhe. Und wenn du wie in diesem Dolch in irgendeinem Gegenstand Magie spürst, dann lass die Finger davon und geh fort. Halte dich fern von ihr. Nur so kannst du verhindern, dass sie dich überlistet und Besitz von dir ergreift.«
Ich senkte den Blick. Die Widerworte, die mir auf der Zunge lagen, schluckte ich runter. Mich fernhalten von der Magie, das konnte ich nicht.
Sie war doch überall.
Eigenartig, dass der damals schlimmste Tag meines Lebens mir rückblickend nun ein Lächeln entlockte. Wir hatten uns über die Jahre verändert, wir alle. Vika war kämpferisch geworden, nicht mehr so verspielt. Ich nahm die Dinge heute ernster und grübelte viel. Und Desmond … über Desmond schwebte seit wenigen Jahren ein seltsamer Schleier, der ihm sein Strahlen nahm, was außer uns jedoch niemand zu bemerken schien und er selbst nicht erklären konnte. Doch all unsere Veränderungen, die guten und die schlechten, hatten uns bloß fester zusammengeschweißt.
»Es scheint mir, dass ich euch so einfach nicht loswerde«, sagte ich zu Vika und Jero.
»Ganz richtig«, stimmte meine Freundin zu.
Ich seufzte. »Dann lasst uns wenigstens nicht noch mehr Zeit verlieren. Je länger ich darüber nachdenke, desto schlechter fühle ich mich.«
Vika reichte mir die Zügel des dritten Pferdes, ein hübscher junger Wallach mit kastanienbraunem Fell. »Ich verstehe. Du hattest dich schon so darauf gefreut, den ganzen Weg zu laufen und allein durchs Reich der Ungeheuer zu spazieren.«
Was sollte ich darauf erwidern? Aber durfte ich mich freuen, nicht allein sein zu müssen? Ich tat es insgeheim, natürlich. Aber ich schämte mich dafür, weil ich meine Freunde in Gefahr brachte.


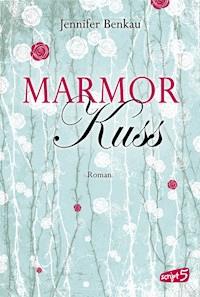















![Die Seelenpferde von Ventusia. Wüstentochter [Band 2 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/951159023fcc1fbce23b219e5bb9ea3d/w200_u90.jpg)
![Die Seelenpferde von Ventusia. Windprinzessin [Band 1 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/25fb250af2dc0456b6868226a45dcce5/w200_u90.jpg)









