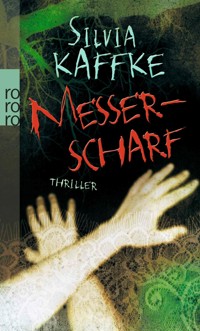9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Lina-Kaufmeister-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ruhrort, 1854. Das Zeitalter der Industrialisierung ist angebrochen: Fabrikanlagen wachsen aus dem Boden, der Handel mit Rohstoffen blüht. Arbeiter strömen aus allen Richtungen herbei, die Stadt ist im Wandel. Die 35-jährige Carolina Kaufmeister ist fest entschlossen, die Zeiten des Umbruchs zu nutzen, um auch ihr Leben zu verändern. Ihr Vater, ein angesehener Spediteur und Reeder, liegt im Sterben. Wohl wissend, dass ihr als Unverheiratete nur ein Platz im Haushalt des Bruders Georg bleibt, träumt sie dennoch davon, sich ihren Unterhalt als Kleidermacherin zu verdienen. Zu ihrer großen Freude erteilt ihr der Vater auf dem Sterbebett die Erlaubnis - doch Georg verweigert ihr das elterliche Erbe. Mittellos und allen Konventionen zum Trotz kämpft Lina um ihre Selbständigkeit. Als sie eines nebligen Abends auf die grausam zugerichteten Leichen zweier Mädchen stößt, bietet sich ihr ein Bild des Entsetzens: Beiden raubte man die Herzen, dem älteren sogar ein Kind aus dem Leib. Wer kann diese schrecklichen Morde begangen haben? Ein Mensch - oder handelt es sich etwa um das Werk des Teufels? Während die Bürgen der Stadt in Untätigkeit verharren, findet man weitere Frauenleichen ohne Herz. Gemeinsam mit Robert Borghoff, dem neuen Commissar der Stadt, begibt sich die mutige Lina auf die Spur des Mörders. Doch der hat sie längst im Visier. Je näher die beiden der Wahrheit kommen, desto enger schließt sich der Kreis ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 648
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Silvia Kaffke
Das rote Licht des Mondes
Historischer Kriminalroman
In Erinnerung an Katharina Maria Kaffke, geb. Römer – meine Oma Käthe
Prolog
28.Oktober 1854
Der helle Tag war längst zu Ende gegangen, erwärmt von der Spätherbstsonne. Vom Rhein und von der Ruhr her zog feuchte Luft auf, und nun, einige Stunden nach Sonnenuntergang, wurde es so kühl, dass man den nahen Winter erahnen konnte. Die Arbeiter der Kohlenlager, Packhäuser und Speditionsbetriebe waren längst nach Hause gegangen oder vergnügten sich in den zahlreichen Kneipen der Altstadt, ihre Arbeitgeber trafen sich in der vornehmen Gesellschaft Erholung bei Zigarren und Wein. Nur nördlich der Stadt erhellte dann und wann ein roter Schimmer die Dunkelheit, und laute Schläge waren zu hören. Das Phoenix-Werk, obwohl noch nicht fertiggestellt, hielt seine Schmelzöfen auch in der Nacht unter Feuer.
Die Altstadtstraßen waren belebt, Gruppen von Männern waren auf dem Heimweg aus den Gasthäusern oder suchten sich einen neuen Platz zum Trinken. An vielen Ecken boten sich ihnen Frauen an, wer noch Lohn in der Tasche hatte, ging vielleicht auch in eines der Bordelle.
Niemand bemerkte die beiden kleinen Mädchen, die von Norden her in die Altstadt gekommen waren. Sie waren gerannt, den ganzen langen Weg vom Neuen Hafen um die obere Schleife des Inselhafens herum, aber nun, beim letzten Schlag der Kirchturmglocke, hielt die Ältere die Kleine zurück.
«Es ist zu spät», sagte sie, völlig außer Atem. «Acht Schläge. Die Türen sind zu.»
«Das kommt davon, weil du so langsam bist, Lene.» Auch die Kleine rang nach Atem. Die Türen des Armenhauses wurden pünktlich um acht Uhr geschlossen, dies sollte verhindern, dass die Insassen sich nachts draußen herumtrieben, tranken oder Schlimmeres taten. Der Vorsteher würde zwar öffnen, wenn sie anklopften, aber sie und ihre ganze Familie würden bestraft. Und da es nicht das erste Mal war, riskierten sie, auf die Straße gesetzt zu werden.
«Mir ist kalt», jammerte die Kleine.
Lene überlegte. Sie hatten einmal ein geschütztes Plätzchen bei den Kohlenlagern auf der Mühlenweide gefunden. Damals war es Sommer gewesen, da hatten sie die Nacht unter freiem Himmel gut überstanden. Jetzt würden sie wohl auch dort bitterlich frieren. Aber sie hatten keine Wahl. «Komm, Hanna», sagte sie und zog die Kleine hinter sich her.
Sie waren in die Kasteelstraße eingebogen, eine der wenigen breiteren Straßen, die durch die Altstadt führten. Trotzdem mussten sie sich eng an eine Hauswand drängen, um einer Kutsche Platz zu machen. Der Kutscher hielt. «So spät allein unterwegs?», fragte er.
Lene nickte. «Wir können nicht heim.»
«Heim?», fragte der Mann und sprang vom Kutschbock. «Das Armenhaus, was?»
«Ja.»
Er lächelte. «Wie wäre es mit einem warmen Plätzchen zum Schlafen?»
Hanna zupfte Lene zaghaft am Kleid. «Keine Kutschen», erinnerte sie ihre Schwester. «Denk dran, was Mutter gesagt hat.»
«Willst du weiter hier frieren?», sagte Lene nur.
«Ich bringe euch nicht von Ruhrort weg, versprochen.» Er zog etwas aus seiner Tasche und beugte sich lächelnd zu Hanna hinunter. «Schau, was ich hier habe! Ich schenke es dir, wenn du einsteigst.»
Er gab Hanna eine kleine Puppe, nicht größer als eine Kinderhand, nur ein Stückchen Holz mit einem Kopf, das mit weißem Stoff umwickelt war. Verzückt sah sie das Spielzeug an.
«Können wir jetzt einsteigen? Es ist kalt!» Lene wurde ungeduldig.
«Sicher.»
Er öffnete die Wagentür und hob erst Hanna, dann Lene in den Wagen.
«Guten Abend, meine Hübschen.»
Die Kinder zuckten zusammen. In der Dunkelheit hatten sie den Mann in der Kutsche gar nicht bemerkt. Doch die Stimme klang freundlich.
Langsam fuhr die Kutsche los. Hanna kuschelte sich an Lene und wiegte das Püppchen in ihrem Arm.
Schon kurze Zeit später hielten sie wieder an, und der Kutscher öffnete die Tür. «Sind die richtig?», fragte er.
«Die sind genau richtig», sagte der Mann, dessen Gesicht im Dunkeln blieb.
Erster Teil
3.November 1854
1.Kapitel
Der Tuchladen der Witwe Dahlmann in der Neustadt war ein beliebter Treffpunkt von Ruhrorts Damen, angefangen bei der feinen Gesellschaft bis hinunter zu den Frauen der Handwerker, Hafenarbeiter und Fuhrknechte. Für Letztere gab es eine kleine Kammer mit einfachen, groben Stoffen für Arbeits- und Alltagskleidung. Ein Regal bot billig genähten Konfektionen, Arbeitsjacken und Hosen Platz, sie waren bei den Fabrikarbeitern recht beliebt.
Der Rest des Ladens war den schlichten, aber ausgesucht guten Tuchen für die Familien der Händler und Reeder vorbehalten, die als strenge Protestanten zumindest im Alltag grau-schwarz-weiße Einfachheit bevorzugten. Aber es fehlten natürlich nicht die feinen Kattuns, Spitzen, Seide und Samt, denn Ruhrort war reich geworden, seit man Fettkohle für die Eisenschmelzen tief aus der Erde holte und Stahlwerke und Eisengießereien direkt neben den Zechen baute. Hier war der Ausgangspunkt für die Verschiffung von Eisen, Kohle und auch hochwertiger Eisenwaren nach Holland und von dort in alle Welt. Und wie konnten die Damen den Reichtum, den ihre Männer erarbeiteten, besser repräsentieren als mit der Mode? Längst galt es auch hier in der protestantischen Provinz nicht mehr als unschicklich, auf den Herbstbällen und den Sonntagsvisiten die neuesten Pariser Modelle zu tragen, auch wenn ein Ruhrorter oder Duisburger Kleidermacher sie aus Dahlmanns Tuchen genäht hatte.
«Josef Dahlmann sel. Witwe» stand auf dem Schild am Ladeneingang. Das war schon seit mehr als zwanzig Jahren so, denn unter ihrem eigenen Namen durfte Clara Dahlmann nach dem frühen Tod ihres Mannes das Geschäft nicht führen. Sie hatte damals, im Jahr 1829, etliche Kaufangebote und Heiratsanträge abgewehrt, hatte den richtigen Instinkt gehabt und den Laden von der reinen Ausrichtung auf Arbeitskleidung zu einem feinen Tuchladen für Damen- und Herrenmode geführt.
Reichtümer hatte sie nicht ansammeln können, die wirklich wohlhabenden Familien kauften auch in Crefeld, Düsseldorf oder Cöln, manche gar in London und Paris. Aber den immer wieder drohenden Bankrott, der ihrem Mann den Magen ruiniert und ihn schließlich zu Tode gebracht hatte, hatte sie schon lange abgewendet und es zu bescheidenem Wohlstand gebracht. Da die kurze Ehe kinderlos geblieben und das Haus, das Josefs Eltern einige Jahre nach dem Siebenjährigen Krieg an der Harmoniestraße in der Neustadt gebaut hatten, groß genug war, konnte Clara noch dazu vermieten: im ersten Stock hatte der Lehrer Reichert zwei kleine Räume angemietet, in der Mansarde lebte seit kurzem der neue Polizeicommissar Borghoff. Beide Mieter brachten ihr noch ein paar zusätzliche Thaler im Jahr ein, die sie in schlechteren Zeiten besser schlafen ließen.
Bis zum frühen Nachmittag war es ungewöhnlich ruhig im Laden gewesen. Waren noch vor vier Wochen die Klagen über das ungewöhnliche Niedrigwasser groß gewesen, wodurch die Schifffahrt auf Ruhr und Rhein stark eingeschränkt war, so hatte in den letztenTagen ein Dauerregen dieTrockenheit abgelöst. Bei diesem Wetter ging nur der vor die Tür, der unbedingt musste.
Aber Clara Dahlmann machte sich keine Sorgen um ihr Geschäft. In wenigen Wochen war Hochsaison für Feines und Teures, denn die Zeit vor und nach Weihnachten war die Zeit der Bälle und Gesellschaften, und die reichen Damen brauchten neue Kleider.
An diesem trüben Novembertag hatten sich nur ein paar Schifferfrauen eingefunden, die grobes Leinen und Baumwolle für Kinderkleidung gekauft hatten. Eine hatte sich ein kleines Stück weißen Kattun geleistet, um Kragen davon zu nähen. Clara stand aufrecht hinter der Theke mit den Taschentüchern und Spitzen und schaute den wenigen vorbeieilenden Gestalten nach, dem Boten des Handelshauses Haniel, dem Schreiber der Borgemeisters, der zur Mittagszeit nach Hause zum Essen ging, dem Hausmädchen der Liebrechts, das wohl eine Besorgung hatte machen müssen. Und es gab auch wieder größere Gruppen von wallonischen Arbeitern, die auf der Baustelle des Phoenix-Hüttenwerkes arbeiten wollten. In diesen Tagen schallte einem auf den Straßen Ruhrorts häufiger Französisch als Ruhrorter Platt entgegen.
Von weitem näherten sich zwei Frauen dem Laden. Die eine von ihnen erkannte Clara auch aus dieser Entfernung sofort, denn sie hinkte unübersehbar – das war Carolina Kaufmeister, die jüngste Tochter einer angesehenen Händlerfamilie. «Fräulein Lina», wie alle sie nannten, war aufgrund ihres Gebrechens, einer steifen Hüfte, unverheiratet geblieben und lebte bei ihrem Vater und der Familie ihres Bruders in einem großen neuen Haus an der Carlstraße. Seit dem Tod ihrer Mutter führte sie dort den Haushalt und pflegte den kranken Vater.
Clara Dahlmann freute sich immer, wenn Lina in den Laden kam, denn das bedeutete meist ein gutes Geschäft. Die Kaufmeisters engagierten nie eine Hausschneiderin oder einen der örtlichen Meister, alle Näharbeiten übernahm Lina, die ein untrügliches Auge für Mode hatte, selbst. Es genügte ihr, ein Kleid anzusehen, und sie konnte es nachschneidern mit allen Verzierungen und Raffinessen. Doch dann erkannte Clara enttäuscht, das Lina in Begleitung der Lehrerin Luise Brand war. Sie trug nur Kleider aus schlichten schwarzen oder grauen Stoffen und besaß höchstens zwei oder drei davon.
Clara ging zur Tür, um sie den Damen zu öffnen. Draußen fiel ein feiner Nieselregen, der sich trotz aufgespannter Regenschirme auf die Mäntel und Schutenhüte von Lina und Luise gelegt hatte. Luise eilte die drei Stufen hinauf, um ins Trockene zu kommen, Lina kam langsam, Stufe für Stufe hinterher. «Guten Tag, liebe Frau Dahlmann», begrüßte sie die Inhaberin. Diese nahm ihnen die Schirme ab und wie gewöhnlich auch Linas schlichten Krückstock mit dem Silbergriff, den sie nur außerhalb des Hauses benutzte.
«Guten Tag. Möchten die Damen ablegen?», Clara hoffte, dass sie sich länger hier aufzuhalten gedachten.
«Gern. Wir haben uns einiges anzusehen», antwortete Lina.
Clara rief ihren Gehilfen Wilhelm, der Mäntel und Hüte der Damen ins Hinterzimmer brachte. Die Lehrerin trug wie erwartet ein schlichtes schwarzes Kleid, dessen praktische, aber unmodisch schmale Ärmel schon etwas dünn schienen. Auch Lina war in Schwarz gekleidet, doch Clara entdeckte sofort die kleinen Paspelungen und Raffungen und die teure Spitze, aus der der Kragen und die durchbrochenen Pagodenärmel gearbeitet waren.
Jetzt, nachdem Lina ihre einfache altmodische Schute abgesetzt hatte, war ihr tiefrotes Haar zu sehen, das sie in mehreren dicken Zöpfen um den Kopf gewunden hatte. Keine neckischen Lockenbüschel lenkten von ihren klaren Gesichtszügen mit der feinen, schmalen Nase und den vollen Lippen ab. Sie war jetzt Mitte dreißig, eine alte Jungfer, was zu ihrer Schönheit gar nicht zu passen schien.
Zunächst inspizierte Lina die Auslagen. Sie kam oft her, neue Ware fiel ihr sofort ins Auge, und Clara sorgte stets dafür, dass sich Woche für Woche etwas in ihren Auslagen änderte. Gerade hatte Wilhelm die auf der Leipziger Herbstmesse erworbenen Seidenstoffe für Ballkleider aus dem Lager geholt, und die weckten sofort Linas Interesse. Sie prüfte eine schwere, dunkelgrüne Atlasseide, die gut zu ihren roten Haaren passte. Aber was wollte Lina schon mit einem neuen Ballkleid? Tanzen?
Luise war an der Theke mit den Spitzen stehen gelieben und knetete verlegen ihre Hände. «Kann ich Ihnen helfen, Fräulein Brand?», fragte Clara.
«Nein, wir wissen schon, was wir brauchen», nahm Lina ihrer Freundin die Antwort ab. Zielsicher ging sie hinüber zu dem Tisch mit den dunklen Baumwollstoffen. «Haben Sie noch etwas von dem Dunkelgrauen aus der Duisburger Fabrik?», fragte sie.
Clara seufzte unhörbar. Genau diesen Stoff hatte die Lehrerin Luise vor zwei Jahren erstanden und auch in den Jahren davor. Clara ahnte, dass die geschickte Lina plante, die Garderobe ihrer Freundin billig aufzubessern: mal ein verschlissenes Oberteil hier zu ersetzen, mal dort einen Rock. Das tat sie auch häufig bei der Familie ihres geizigen Bruders Georg.
«Er wird nicht mehr hergestellt», sagte sie, in der Hoffnung, dass Lina sich damit zufriedengeben würde. «Ich habe einen ganz ähnlichen hier…» Sie kam zu dem Tisch herüber und deutete auf einen Ballen von einer guten, dickeren Qualität. «Wie wäre es denn damit?»
Lina befingerte den Stoff und nickte kurz. «Das ist sehr gute Ware. Aber der ist doch sicher viel teurer als der alte?»
Es schien sie nicht zu kümmern, dass Luise rot anlief, und sie fuhr fort: «Sagten Sie nicht letztes Jahr, Sie hätten sechs Ballen von dem Dunkelgrauen in Duisburg gekauft, weil er so gut sei?» Sie kam zu Clara um den Tisch herum und sah sie prüfend an. «Da waren im Frühjahr doch noch drei Ballen… Sie haben also alles verkauft?»
Clara wand sich ein wenig. «Er ging sehr gut.»
«Frau Dahlmann! Ganze drei Ballen über den Sommer, wo die meisten Damen helle Stoffe tragen?»
Clara gab auf. «Wir haben vielleicht noch einen halben Ballen im Lager. Ich schicke Wilhelm nachsehen.»
Kurze Zeit später schleppte Wilhelm einen Ballen dunkelgrauer Baumwolle herein und warf ihn auf den Tisch. Lina befingerte ihn. «Ja, das ist der richtige. Ein Groschen die Elle?»
«Zwölf Pfennige», verbesserte Clara. «Vieles ist teurer geworden…»
«Aber Frau Dahlmann, das ist doch nur noch ein Rest.» Lina ging um den Tisch herum und strich prüfend über einen anderen dunkelgrauen Stoff. «Nun, dieser hier ist doch sehr ähnlich. Kostet er nicht acht Pfennige?»
Clara Dahlmann gab schnell auf. Mit Lina Kaufmeister konnte man nicht handeln. Scharfsinnig und scharfzüngig wie sie war, zog bei ihr jeder den Kürzeren. «Gut. Lassen wir es bei zehn Pfennigen.» Sie holte den Maßstab und ihre Schere. «Weil Sie es sind, Fräulein Lina.»
«Schön.» Lina lächelte Luise an. «Dann könnten wir noch etwas Blusenstoff nehmen.»
Clara sah, wie Luise kaum merklich zusammenzuckte. «Ach, Lina, ich denke, der graue Stoff wird für ein Kleid doch reichen…»
«Wir nehmen noch vier Ellen von dem weißen dünnen Kattun für zwei Groschen.»
«Vier Ellen?», stieß Luise hervor. Dann errötete sie. «So viel Geld habe ich nicht bei mir…»
Bevor Clara etwas von Anschreiben sagen konnte, fiel Lina ihr ins Wort: «Ich lege es für dich aus.» Sie runzelte einen Moment die Stirn und hinkte dann zu dem Wandregal mit den feinen dunklen Stoffen. Sie befühlte einen grauen Seidenstoff. «Dann können wir auch noch zwei Ellen hiervon nehmen.»
«Aber…»
«Der ist für mich, Liebes.»
Clara Dahlmann hatte begonnen, die ausgesuchten Stoffe abzumessen und zu schneiden. «Wie viel von dem Duisburger Grauen?», fragte sie.
«20Ellen.» Lina sagte das so bestimmt, dass Luise nicht zu protestieren wagte. «Kann Wilhelm es morgen zur Höheren Töchterschule liefern?»
«Sicher. Brauchen Sie noch Garn?»
Lina schüttelte den Kopf. «Davon ist noch genug da.»
Wie auch nicht, dachte Clara, wenn Luise immer nur Grau und Schwarz trug.
Lina griff nach ihrer Geldbörse in ihrem Täschchen. Rasch zählte sie drei Thaler und acht Groschen ab, die Clara hinter der Theke verschwinden ließ. Ganz so schlecht war das Geschäft heute doch nicht gewesen.
Als Wilhelm die Schirme, Mäntel und Hüte brachte, griff Lina nach ihrem Stock. Kurz darauf waren sie und ihre Freundin auf dem Weg in die Altstadt, wo Luise bei ihrer Tante wohnte. Schicklich war das für eine ehrbare Lehrerin nicht, denn die verwinkelten und verbauten Gassen der Altstadt mit ihren vielen Schifferkneipen und Absteigen galten als Sündenpfuhl schlechthin, ganz abgesehen von den schlechten hygienischen Verhältnissen dort. «Tönnekesdrieter» schimpften die Meidericher Bauern, deren Dorf zur Bürgermeisterei Ruhrort gehörte, die Städter, weil dort die Fäkalien in kleinen Tonnen abtransportiert wurden – wenn sie nicht verbotenerweise im nahen Hafenbecken landeten. So hatten sich in den letzten fünfzig Jahren die meisten Bürger, die es sich leisten konnten oder kein Geschäft in der Altstadt betrieben, in der Neustadt mit ihrem schmucken kleinen Markt, den geraden Straßen und großzügigeren Häusern niedergelassen.
Fast hundert Jahre war es jetzt her, dass Jan Willem Noot, der Großvater von Franz Haniel, Ruhrorts angesehenstem Bürger, das erste Haus außerhalb der Ruhrorter Stadtmauern hatte bauen dürfen. Inzwischen waren viele Straßenzüge hinzugekommen, und seit einigen Jahren wurde die so entstandene Neustadt eifrig erweitert. Auch die Kaufmeisters waren aus dem fünfzig Jahre alten Wohn- und Packhaus an der Dammstraße in ein neues, dreistöckiges Haus gezogen und nutzten das alte Haus nur noch als Kontor und Lager.
Luise hatte zunächst geschwiegen, dann platzte sie heraus: «Lina, ich kann es kaum fassen, du hast mich mehr als zwei Thaler ausgeben lassen.»
Lina schmunzelte nur, während sie konzentriert auf das grobe Pflaster sah, um nicht ins Stolpern zu kommen. «Liebe Luise, davon wirst du ganze vier neue Kleider bekommen – ein neues Oberteil, und wir können die alten Röcke durch neue Volants und Raffungen wie neu erscheinen lassen, selbst den, in den du dir den Winkel gerissen hast. Die zerschlissenen Ärmel der anderen Blusen entfernen wir, und dann bekommst du endlich Ärmel, die der Mode entsprechen. Und mit der Seide…»
«Ich denke, die ist für dich.»
Lina blieb stehen. «Es wird ein wenig davon für dich abfallen, ein paar Verzierungen und Paspeln. Und wenn du dir ein wenig Mühe gibst mit deinen Stickereien…»
«Aber du hast doch selbst kein Geld…»
«Du vergisst, dass ich die Herrin über das Haushaltsgeld bin. Mein Bruder wird gar nicht merken, wenn ein halber Thaler fehlt.»
Zwei Stunden später saßen sie in Luises gemütlichem Zimmer in dem kleinen schmalen Altstadthaus, wo ihre Tante einen Putzmacherbetrieb unterhielt. Sie hatten sich von der Magd Tee bringen lassen und wärmten sich auf.
«Nächste Woche schneide ich dir die Teile auf dem großen Tisch in der Schule zu», sagte Lina. Sie hatte es sich auf dem Sofa bequem gemacht, das Luise von ihren verstorbenen Eltern geerbt hatte. Wenn sie mit ihrer Freundin allein war, konnte sie das tun: sich schräg in eine Sofaecke setzen und das Bein mit dem versteiften Hüftgelenk halb auf das Sofa legen. Auf Stühlen und in anderer Gesellschaft war das Sitzen eher unbequem für sie. Vor Luise musste sie auch den hässlichen Schnürstiefel, dessen Sohle der Schuster trotz eines hohen Absatzes für sie noch hatte erhöhen müssen, auch nicht verstecken.
Sie liebte diese Nachmittage bei ihrer Freundin. Einmal in der Woche – immer donnerstags – ihre täglichen Aufgaben im Kaufmeister’schen Haushalt hinter sich zu lassen, nicht ständig das Personal an seine Pflichten erinnern zu müssen, keine Ausgaben im Auge behalten, keine Mahlzeiten für sechs Personen und häufige Gäste planen zu müssen und vor allem den Nörgeleien und dem Jammern des quengelnden, kranken Vaters entkommen zu können – das war für sie ein Stückchen Glück, an dem sie eisern festhielt, trotz der vorwurfsvollen Blicke ihrer Schwägerin. Selbst für diesen einen Nachmittag der Woche war Aaltje die Pflege des Schwiegervaters lästig.
Luise, die jeden Pfennig umdrehen musste bei ihrem schmalen Lehrerinnengehalt und der bescheidenen Rente, die ihr das kleine Erbe ihrer Eltern eingebracht hatte, konnte sich nicht vorstellen, wie sehr Lina sie um ihr Leben beneidete.
Die beiden kannten sich aus dem dreijährigen Lehrerinnenseminar der Diakonie in Kaiserswerth, dessen Besuch Lina bei ihrer Familie hatte durchsetzen können. Sie hatte damals argumentiert, dass ohnehin kein Mann eine hinkende Frau heiraten würde und sie dort für alle Fälle ein paar nützliche Dinge lernen könnte. Damals schon hatte sie es im Schneidern zu ihrer jetzigen Meisterschaft gebracht.
Tatsächlich hatte sie sich nach Abschluss der Ausbildung ohne Wissen ihres Vaters und Bruders an mehreren Schulen, aber auch um Privatstellen beworben, war aber jedes Mal aufgrund ihres Gebrechens abgelehnt worden. Als dann noch ihre Mutter starb, war ihr zukünftiger Lebensweg besiegelt. Und auch die Frau ihres Bruders hatte ihre Rolle innerhalb der Familie nie in Frage gestellt.
So wie Luise leben, als Lehrerin an der kleinen privaten Höhere-Töchter-Schule, bescheiden zwar, aber von niemandem abhängig, das war ein Traum, der in den letzten Jahren in weite Ferne gerückt war. Die schwere Erkrankung ihres Vaters hatte es ihr endgültig unmöglich gemacht, das Elternhaus zu verlassen. Ganz abgesehen davon, dass sie als alleinstehende Frau unter der Vormundschaft ihrer Familie stand.
«Und wie geht es deinem Vater?», fragte Luise und riss Lina damit aus ihren Gedanken.
«Nicht gut. Das Zimmer hat er jetzt seit Wochen nicht mehr verlassen, nicht einmal an seinem Geburtstag. Mal zittern ihm alle Glieder, dann ist er für Stunden wie erstarrt. Aber geistig ist er ganz klar und bekommt sein Elend mit. Neulich hat er mich angefleht, ihm Gift zu besorgen.»
Lina sah Luises entsetzten Blick. «Natürlich habe ich das abgelehnt, was denkst du. Und vorsichtshalber habe ich auch Georg nichts von Vaters Wunsch gesagt…» Um ihren Mund spielte ein süffisantes Lächeln.
«Lina! Was sagst du denn da über deinen Bruder!»
«Er kann es doch gar nicht mehr abwarten. Und ich verstehe ihn sogar. Die Zeiten ändern sich so rasch, und wenn ein Geschäftsmann zögert, kann das sein Untergang sein. Georg will weg vom reinen Handel und Transport. Aber Vater mischt sich immer noch in alles ein. Er verweigert Georg und Bertram die nötigen Gelder, die sie flüssigmachen müssten, um mit den anderen mithalten zu können. Denk an die Haniels und die Stinnes, die früh auf Kohle und Eisenproduktion gesetzt haben. Wenn Georg nicht bald in die Industrie investiert, wird das große Geschäft ohne ihn gemacht.»
Ihre direkte Art hatte Lina nicht immer Freunde eingebracht, und in ihrer eigenen Familie war ihre scharfe Zunge gefürchtet. Luise wusste, dass Lina gelernt hatte, Verstand und Witz einzusetzen, um Verletzlichkeit zu verbergen.
«Er wird das Geschäft schon früh genug bekommen.» Luise dankte Gott dafür, dass keiner ihrer Eltern hatte lange leiden müssen. «Was sagen die Ärzte?»
«Sie können nichts für Vater tun. Aber wie lange es sich noch hinziehen wird, kann keiner sagen.» Lina nahm noch einen Schluck Tee, und ihr Gesicht bekam plötzlich einen ungewohnt verträumten Zug. «Wenn er… wenn er mal nicht mehr ist, dann kann ich mir vielleicht eine kleine Wohnung mieten. Er hat mir 5000Thaler und eine lebenslange Rente zugesagt, zusätzlich zu der, die ich aus Mutters Nachlass bekomme. Ich war dabei, als er das Testament änderte. Reich wäre ich dann nicht, aber für ein Leben ohne Georg und seine bigotte Frau wäre es genug.»
«Lina, dein Bruder würde dich nie in die Mündigkeit entlassen. Es schickt sich nicht, wenn eine Frau ohne Not allein lebt. Ich bin Waise und ohne Geschwister. Aber du würdest dich selbst und deinen Bruder vor der ganzen Gesellschaft Ruhrorts unmöglich machen.»
«Ja, für ihn ist das eine bequeme Lösung. Nach außen hin ist er der großzügige Bruder, der seiner verkrüppelten Schwester ein Heim bietet, sie kleidet und ernährt. In Wirklichkeit spart er sich das Geld für eine Haushälterin und noch dazu das, was seine Frau durch ihre Unfähigkeit, einen Haushalt zu führen, verschleudern würde.»
«Ach, Lina, jetzt übertreibst du aber!»
Lina stand umständlich auf. «Nein, keineswegs. Aaltje gibt mir oft zu verstehen, wie dankbar ich sein muss.»
Obwohl Luise merkte, dass es Lina sehr ernst war, musste sie unwillkürlich lächeln. Linas Schwägerin war eine große, dicke Holländerin mit einem unfein geröteten Gesicht und den Zügen einer wohlgenährten Bäuerin. Sie überragte Lina um mehr als einen Kopf, aber wenn sie und Lina sich in einem Raum befanden, schien Aaltje zu schrumpfen. Und da Aaltje auch nur unbeholfen Deutsch sprach, zog sie gegen Lina immer den Kürzeren. «Sie hat Angst vor dir, Lina. Das hat sie seit dem Tag, als sie in euer Haus kam und du das Regiment nicht aus der Hand gegeben hast.»
Lina lachte. «Ich konnte ihr doch den Haushalt nicht überlassen. Sie mag wie eine fette Köchin aussehen, aber von Hausfrauenpflichten hatte dieses verwöhnte Kind nie etwas gehört. Es gibt nur zwei Pflichten, denen sie nachkommt: Beten und schwanger werden.» Sie machte mit der Hand die Geste eines gewölbten Bauches.
«Sei nicht so niederträchtig», sagte Luise scharf.
«Warum? Weil ich denke, dass mein lieber Bruder sich nach einer Geburt oder Fehlgeburt einmal eine Weile aus dem Bett seiner Frau fernhalten sollte, damit sie sich vielleicht so weit erholen kann, um endlich wieder ein kräftiges, gesundes Kind zur Welt zu bringen?»
Von Aaltjes bisherigen zehn Schwangerschaften hatten nur zwei Kinder, der zehnjährige Karl und die siebenjährige Elisabeth, überlebt. Es hatte nicht nur den Eltern, sondern auch Lina jedes Mal das Herz gebrochen, wenn ein oft nur wenige Tage altes Würmchen starb. Am schlimmsten war es, als der jüngere Sohn Josef im Alter von vier Jahren an Typhus starb. Damals hatten sie geglaubt, er wäre aus dem Gröbsten heraus, doch es war nie vorauszusehen, ob ein Kind überlebte und heranwuchs. Georg stürzte sich danach in seine Arbeit, und Aaltje trauerte. Mit noch mehr Gebeten als gewöhnlich und dem guten Kuchen der Köchin Helene – und versuchte, möglichst schnell wieder schwanger zu werden.
«Uns beiden alten Jungfern ist es nicht erlaubt, darüber zu urteilen.» Luise war ebenfalls aufgestanden und ging zum Fenster. Lina wusste, dass es nicht der Lebenstraum ihrer Freundin gewesen war, als unverheiratete Lehrerin zu enden, doch als nur spärlich vermögende Waise hätte sie unter Stand heiraten müssen.
«O nein», rief Luise plötzlich.
«Was ist denn?», fragte Lina und trat ebenfalls zum Fenster. An diesem trüben Tag war es ohnehin so düster gewesen, dass sie eine Kerze angezündet hatten, und nun war es schneller dunkel geworden als erwartet. Lina hasste den Winter, der ihre freien Nachmittage noch kürzer werden ließ. Der Regen hatte aufgehört, doch draußen hatte sich dichter Nebel über die Altstadt gelegt. Noch vor neun Jahren hatte auf diesem Platz die Altstadtkirche gestanden, aber man hatte sie abgerissen, nachdem in der Neustadt die Jakobuskirche gebaut worden war. Nun gab es hier einen Marktplatz, der von wenigen Laternen und dem Licht aus zwei Schenken spärlich beleuchtet wurde. Der Nebel war so dicht, dass man die Häuser auf der anderen Seite des kleinen Platzes nicht sehen konnte.
«Ich muss sofort nach Hause», sagte Lina und nahm ihren Mantel.
«Lina, du kannst nicht allein im Dunkeln durch die Altstadt gehen. Was, wenn du überfallen wirst oder…»
«Oder Schlimmeres?»
«Es schickt sich einfach nicht», entschied Luise. «Ich rufe den Hausdiener, er soll dich heimbringen.»
Angesichts des Nebels willigte Lina ein. Kurze Zeit später verabschiedete sie sich an der Haustür von Luise. Simon, der knapp sechzehnjährige Hausknecht, stand schon unten an der Treppe mit einer kleinen Handlaterne, die erschreckend wenig Licht gab. Er machte ein mürrisches Gesicht, denn sie hatten ihn aus einem Nickerchen geweckt, das er sich vor seinen zahlreichen abendlichen Pflichten gegönnt hatte.
Während Lina langsam die Treppe hinabstieg, fiel sein Blick auf ihren unförmigen Schuh. Er sah sofort in die andere Richtung.
«Gehen wir», sagte sie zu dem Jungen. «Du weißt, wo die Carlstraße ist?»
Er nickte, aber Lina war sich nicht sicher, ob er die Wahrheit sagte.
Sie gingen über den Platz, und Lina war erleichtert, als vor ihr plötzlich der Eingang einer Gasse auftauchte.
«Heho!», rief Simon und schwenkte die kleine Laterne. Die meisten von Ruhrorts Altstadtgassen waren so eng, dass keine zwei Personen aneinander vorbeikamen und einer umdrehen und dem anderen den Vortritt lassen musste. Lina hätte diese Gasse nie benutzt, aus Angst, sich das Kleid zu ruinieren, aber sie wollte Simon nicht noch mehr verärgern.
Simon ging vor, und Lina konnte ihm, behindert durch den weiten Rock, kaum folgen. «Warte doch, Simon», rief sie ihm hinterher. Dann sah sie das Licht und kurz darauf auch den Jungen, der sie ärgerlich ansah. «Ich kann nicht so schnell.»
Sein Blick fiel auf ihren Gehstock, und er nickte.
«Nicht deswegen, Simon», sagte Lina. «Sieh dir mein Kleid an! Die nächste Gasse sollte etwas breiter sein.»
Er brummte etwas, das sie nicht verstand, und sie folgte ihm. Er ließ tatsächlich eine der engen Gassen links liegen und brachte sie zu einer anderen. Lina selbst hatte die Orientierung für den Moment völlig verloren. Sie hoffte, dass sie Richtung Weidetor gingen, das kürzlich abgerissen worden war und der alten, längst lückenhaften Stadtmauer ein weiteres Loch beigebracht hatte.
Der Nebel wurde noch dichter und schien alles Leben in Ruhrort zu lähmen. Nur eine Kutsche war auf der sich nun verbreiternden Straße unterwegs. Sie beschleunigte und überholte Lina, die zur Seite treten musste. Die Geräusche entfernten sich rasch.
Lina musste sich sputen, um mit dem voranstürmenden Simon mitzuhalten, der schon nach wenigen Metern nicht mehr zu sehen war. Sie wusste, dass im Nebel Geräusche anders klangen, mal ferner, mal näher als vermutet. Doch sie war sich sicher, am Inselhafen angekommen zu sein. Leise klatschte das Wasser an die am Kai liegenden Schiffe. Lina blieb stehen und versuchte, etwas zu erkennen, aber sie sah nur ein paar Lichter von Schiffslaternen durch die Schwaden flackern. Da bei dem Nebel nicht gearbeitet werden konnte, war es ungewöhnlich still. Lina merkte, dass sie den Hafen nun hinter sich gelassen hatte, und das war der falsche Weg. Zu allem Unglück schien Simon unverdrossen weitergegangen zu sein, um sich der lästigen Pflicht schnell zu entledigen.
Lina hoffte, dass er seinen Irrtum irgendwann selbst bemerkte und umkehrte, denn die Ludwigstraße war die letzte Möglichkeit, ohne einen noch größeren Umweg zur Carlstraße zu gelangen. Aber war sie überhaupt noch auf der Hafenstraße, oder war dies schon die breite Meidericher Chaussee?
Auch wenn Lina trotz ihres Gebrechens recht schnell zu Fuß war, auf der unebenen, ungepflasterten Straße musste sie achtsam gehen, und einholen würde sie den Jungen nicht mehr. Die Ludwigstraße, in diesem Bereich wenig mehr als ein Feldweg, lag jetzt sicher schon hinter ihr, die andere Straßenseite war völlig vom Nebel verschluckt. Jetzt gab es nur noch Weiden und Ackerland und die große Chaussee. Sie hoffte, Simon war nicht in Richtung Meiderich abgebogen.
«Simon», rief sie, so laut sie konnte. «Simon. Warte!»
Endlich antwortete er, im Nebel hörte es sich so an, als hielte er sich einen Schal vor den Mund. «Fräulein Lina! Wo sind Sie denn?»
Das war ein ganzes Stück weiter vorn. Sie wollte weitergehen, als sie plötzlich Kutschgeräusche hörte. Die Kutsche raste mit großer Geschwindigkeit direkt auf sie zu und knapp an ihr vorbei. Lina hatte einen Satz zur Seite gemacht. Ihr Herz begann zu klopfen. Für einen Moment glaubte sie, auf der anderen Seite die Gärten oberhalb der Ludwigstraße zu sehen. Aber Simon konnte sie nicht entdecken.
«Fräulein Lina!» Das klang schon näher.
Langsam ging sie auf ihn zu, und schließlich sah sie das spärliche Licht seiner Laterne. «Hier bin ich, Simon.»
Sie trafen sich etwa fünfzig Meter weiter. Simon sah unglücklich auf den Boden, eine Standpauke erwartend, weil er das Fräulein in die Irre geführt hatte.
Aber Lina war nicht nach Schimpfen, sie war viel zu erleichtert, den Jungen wiedergefunden zu haben. «Gut, du hast dich vor der Kutsche in Sicherheit bringen können», sagte Lina, als sie ihm endlich gegenüberstand.
«Als ich umkehrte, hat die Kutsche etwa hier gehalten. Ich kam von dort hinten auf sie zu. Und dann ist sie losgerast, als wäre der Teufel hinter ihr her.»
Ein leichter Wind kam auf, der Nebel begann, sich ein wenig zu lichten. Ein paar Schritte hinter Simon konnte man eine Mauer erkennen, das war der Friedhof. «Und wann hättest du gemerkt, dass du mich verloren hast? Wenn du in Meiderich oder beim Phoenix-Werk angekommen wärst? Das ist ein großer Umweg, Simon.»
Simon sah verlegen auf seine Fußspitzen. «Es tut mit leid, Fräulein Lina. Aber ich… ich war so wütend.»
Lina keuchte immer noch ein bisschen von dem Schreck, den ihr die Kutsche eingejagt hatte. Simon leuchtete sie mit der Lampe an.
«Mir geht es gut, Simon…», dann brach sie ab, denn die Augen des Jungen hatten sich vor Schreck geweitet. Er deutete auf den Boden direkt neben ihr. Sie blickte hinunter, und dann sah auch sie, was Simon so geängstigt hatte. Dort lag ein großes Bündel, ein merkwürdiges Knäuel. Auf den ersten Blick sah es wie ein Haufen Lumpen aus, den jemand hier verloren hatte, aber dann sah sie, was Simon erschreckt hatte: eine kleine, weiße Hand ragte daraus hervor.
Lina nahm dem Jungen die Laterne ab und leuchtete dorthin. Im schwachen Lichtschein konnte sie erkennen, was da lag: Es waren zwei Kinder, Mädchen in ärmlicher Kleidung. Das kleinere lag über dem größeren, beide hatten weizenblonde Locken, das Gesicht der Kleinen konnte Lina nicht erkennen, weil sie auf dem Bauch lag. «Hilf mir mal, Simon», sagte Lina entschlossen und stellte die Lampe vorsichtig auf den Boden.
Widerwillig half Simon, das kleinere Mädchen umzudrehen und von dem größeren wegzuziehen. Lina hatte insgeheim gehofft, sie würden noch leben, doch jetzt sah sie, dass hier niemand mehr helfen konnte. Die gesamte Vorderseite der Mädchen war in Blut getaucht, das bereits getrocknet war. Am Oberkörper war die Kleidung ganz aufgerissen, und in der nackten Brust der Mädchen klafften Löcher, mehr als zwei Fäuste groß.
Simon würgte, und auch Lina verspürte Brechreiz. Sie sah nicht zum ersten Mal ein totes Kind, aber das hier war etwas anderes. Hinter sich hörte sie, wie Simon sich erbrach.
Lina trat ein paar Schritte zur Seite und suchte in ihrer Tasche nach einem Taschentuch und dem Riechsalz. Der Junge war zwar nicht ohnmächtig, aber Riechsalz schien ihr hier das richtige Mittel zu sein. Er stand keuchend auf dem Feld. Sie trat von hinten an ihn heran, um ihr Kleid nicht zu verschmutzen, und reichte ihm das Taschentuch.
«Damit kannst du dich säubern, Junge.» Dann hielt sie ihm das Fläschchen unter die Nase. Er hustete, es schien aber zu nützen.
«Simon, du musst zurück in die Altstadt. Der Sergeant macht dort irgendwo seine Runde. Du musst ihn finden und herbringen, hörst du?»
Er nickte, machte aber keine Anstalten, loszulaufen. «Was ist mit Ihnen, Fräulein Lina? Sie können doch nicht allein bleiben mit… mit…»
«Simon, die Mädchen sind tot. Sie werden mir nichts mehr tun.»
Erst als sie Simon im Nebel verschwinden sah und mit ihm die Laterne, kam ihr der Gedanke, dass zwar nicht die Mädchen, aber doch ihr Mörder ihr gefährlich werden könnte.
Sie umklammerte fest ihren Stock, entschlossen, ihn als Waffe zu gebrauchen, falls sich ihr jemand näherte. Sie schätzte, dass mehr als eine halbe Stunde vergangen war, bis sie das Licht von mehreren Laternen näher kommen sah. Immer noch konnte man nur wenige Meter weit sehen, aber bald schälten sich die Umrisse mehrerer Menschen aus dem Nebel.
Einer war Simon, der andere der lange, dürre Polizeisergeant Ebel. Sein Kollege Thade, der Meidericher Dorfpolizist, der wohl gerade zum wöchentlichen Rapport in Ruhrort war, begleitete ihn. Hinter ihnen folgte eine große Menschenmenge, die meisten in einfacher Kleidung. Lina vermutete, dass Simon den Polizisten in einer Schenke gefunden hatte und dass die Gäste dort sich den grausigen Anblick nicht entgehen lassen wollten.
Die beiden Polizisten leuchteten mit ihren Laternen die toten Kinder aus, so gut es ging. Lina konnte sehen, wie sie erbleichten. Trotz des lebhaften Hafenbetriebs und der vielen Menschen, die in Ruhrort lebten oder durchreisten, waren Morde hier selten. Tote und Verletzte bei Wirtshausschlägereien, das waren die häufigsten Gewaltverbrechen.
Die Menge drängte heran. «Das sind die Töchter vom Michel», rief plötzlich einer.
«Du kennst die Kinder?», fragte Ebel.
Der Mann nickte und trat noch näher. «Die haben noch bis letztes Jahr in Essenbergs Weberei gearbeitet. Als die bankrott war, kam die Familie ins Arbeitshaus.»
«Michel Hensberg?» Ebel schien den Namen zu kennen.
Der Mann nickte. «Die Kleine heißt Hanna und die größere Lene. Sie müssten jetzt…» Er überlegte. «Zehn und dreizehn müssten sie sein.»
«Wir sollten den Commissar holen, er ist beim Bürgermeister», sagte Ebel, und Thade nickte.
«Na, dann gehen Sie schon!», herrschte Ebel ihn an und ließ keinen Zweifel daran, wie die Rangordnung zwischen Stadt und Land war.
Er wandte sich an Lina. «Fräulein Kaufmeister, vielleicht möchten Sie jetzt nach Hause gehen?»
Lina schüttelte energisch den Kopf. «Ich bleibe, bis der Commissar hier ist.» Sie stemmte energisch ihren Stock in die Wiese und stützte sich darauf, das lange Stehen strengte sie an. Dann spannte sie ihren Regenschirm auf, denn der Nieselregen hatte wieder eingesetzt.
Wenig später war Thade mit Ruhrorts oberstem Polizisten zurück. Lina kannte den Mann nicht, er hatte das Amt erst seit kurzem inne. Sie wusste aber, dass er bei der königlichen Polizei in Berlin gewesen war. «Jetzt wird hier endlich Ordnung herrschen», hatte ihr Bruder Georg gesagt, und er hatte nicht das Verbrechen damit gemeint, sondern die politischen Umtriebe der inzwischen versprengten Revolutionäre von 1848. «Seltsam, dass du dich so über die Revolution echauffierst, lieber Bruder, wo sie hier doch gar nicht stattgefunden hat», hatte Lina gespottet und den Vers rezitiert, der an die preußische Königin gerichtet war: «Lisbeth, Lisbeth, weine nich, du hast ja noch Duisburg, Ruhrort und Meiderich.» Alle drei Gemeinden hatten unverzüglich nach Ausbruch der Revolution ihre Steuern überwiesen, um den Kampf des Königs zu unterstützen.
Borghoff, der ebenfalls eine Laterne trug, trat heran. Er war nur mittelgroß, der lange Sergeant Ebel überragte ihn um mehr als einen halben Kopf, zumal der Commissar leicht vorgebeugt ging. Im Schein der Laterne konnte Lina einen ergrauten Schnurrbart erkennen. Er sah sich die Mädchen genau an. «Die Leute sollen nach Hause gehen», sagte er ruhig und stellte seine Laterne so ab, dass sie die Mädchen beleuchtete.
«Ihr habt es gehört, Männer. Das ist eine polizeiliche Anordnung.» Ebel tat wichtig und trat mit ausgestreckten Armen auf die Männer zu, als wolle er sie wegschieben. «Ich kann euch auch alle festnehmen. Denkt daran, ich kenne jeden von euch.»
«Und wo willst du uns unterbringen?», höhnte einer von hinten. Seit das Weidetor abgerissen war, von dessen Türmen einer als Polizeigefängnis gedient hatte, gab es in Ruhrort kein Gefängnis mehr, und das Gewahrsam im angemieteten Haus am Neumarkt reichte kaum für mehr als zwei oder drei Betrunkene.
Borghoff richtete sich wieder auf. «Da wird sich schon etwas finden lassen.» Seine ruhige Stimme strahlte weit mehr Autorität aus, als die sich vor Aufregung überschlagenden dünnen Töne Ebels.
Murrend zog die Gruppe ab, Simon wollte sich anschließen, aber Lina hielt ihn zurück.
Borghoff wandte sich ihr zu. «Und Sie, gnädige Frau?»
«Das ist Fräulein Kaufmeister. Sie hat die Leichen gefunden.» Ebel klang immer noch wichtig.
«Entschuldigung, Fräulein Kaufmeister.» Borghoff musste früher einmal gut ausgesehen haben, fand Lina. Jetzt verlief allerdings eine Narbe über sein rechtes Auge, dessen Lid herunterhing.
«Ich dachte, Sie wollten mich und Simon vielleicht gleich sprechen.»
«Nun, das hätte auch bis morgen Zeit gehabt. Aber wenn Sie nun schon einmal da sind…»
Er wandte sich wieder den Leichen zu. «Lagen Sie so, als Sie sie gefunden haben?»
«Nein.» Lina war ein wenig verärgert, dass ihre Einlassung offensichtlich unwichtig für ihn war. «Die Kleinere lag über der Größeren, als wären sie… als hätte man sie einfach weggeworfen. Ich dachte, vielleicht leben sie noch und man könnte helfen. Aber dann…»
Borghoff nickte. Er zog seinen Säbel, und Lina konnte sehen, wie er vorsichtig das Kleid der Älteren auseinanderschob. Lina war gar nicht aufgefallen, dass nicht nur das Oberteil, sondern auch der Rock aufgeschlitzt war. Borghoff wich zurück, und Lina konnte sehen, was ihn so erschreckt hatte.
Waren schon die geöffneten Brustkörbe ein Schock gewesen, so war dieser Anblick noch schlimmer: ein tiefer Schnitt verlief mittig über den gesamten Unterleib des Kindes, als hätte man es regelrecht aufgeklappt. Simon hatte sich schon vorher abgewandt und hinter die Polizisten gestellt. Lina starrte genauso entsetzt wie Borghoff auf die Leiche mit der riesigen klaffenden Wunde. Sie schwankte.
Borghoff fing sie auf und führte sie ein Stück weg. «Zu viel Neugierde wird bestraft, mein Fräulein.» Bei einem anderen Mann hätte dieser Satz einen falschen Beigeschmack gehabt, aber Borghoff meinte es ernst.
Trotzdem fühlte Lina sich bemüßigt, in gewohnter Schärfe zu antworten. «Ich bemerke auch Ihr Entsetzen, Herr Commissar, und ein Mann wie Sie hat sicher schon ganz andere Dinge gesehen.»
Er hob die Braue des gesunden Auges. «Trotzdem sollten Sie jetzt nach Hause gehen. Der Junge war Ihre Begleitung?»
Sie nickte. «Er ist der Hausdiener meiner Freundin.»
«He, Junge, wie heißt du?», rief er zu Simon hinüber.
«Simon Weber.»
«Dann komm mal her, Simon Weber.»
Simon kam folgsam zu ihnen herüber.
«Ich möchte, dass du das Fräulein sicher nach Hause bringst. Und morgen früh meldest du dich auf der Dienststelle zu einer Vernehmung.» Er bemerkte, wie der Junge erbleichte, und lächelte. «Keine Angst, dir wird dabei nichts passieren. Wir schreiben nur auf, was du gesehen hast.»
Simon nickte, doch wirklich erleichtert wirkte er nicht.
Lina ging nochmal zu den Leichen hinüber, um ihren Stock aus der Wiese zu ziehen. Sie konnte nicht umhin, wieder einen Blick auf die schreckliche Wunde zu werfen, die noch immer von Borghoffs abgestellter Laterne erleuchtet wurde. Der Anblick brannte sich in ihr Gedächtnis.
«Gehen wir», sagte Lina und versuchte, ohne Zittern zu sprechen. «Ich werde morgen auch zu Ihnen kommen.» Sie sah Borghoff direkt ins Gesicht. Er nickte.
Borghoff blickte ihnen nach, bis Lina und Simon im Nebel verschwanden.
«Wichtige Familie, die Kaufmeisters?», fragte er Ebel.
Der nickte. «Sie sind ziemlich reich geworden in den letzten Jahren. Aber einen Mann haben sie der krummen Lina nicht kaufen können.»
«Krumme Lina?»
«Na ja, wir haben sie als Kinder so genannt, wenn sie über die Straße hinkte.»
Borghoff sah zu den Leichen hinüber. «Lassen Sie die Kinder in den Rathauskeller bringen. Und sorgen Sie dafür, dass Doktor Feldhaus gleich morgen die Leichenschau vornimmt.»
Er beugte sich hinunter, um das Kleid wieder zusammenzulegen. «Dreizehn war die Ältere?»
«Wenn der Johann Müller recht hat, dann ja.» Ebel wurde bleich. «Alt genug für eine Schwangerschaft, meinen Sie?»
Borghoff griff nach der Laterne und richtete sich auf. «Weisen Sie den Doktor auf diese Möglichkeit hin, Ebel.»
Er wandte sich an Thade. «Bleiben Sie hier, bis die Leichen weggebracht worden sind. Das ist doch die Straße nach Meiderich?»
Thade nickte.
«Danach können Sie nach Hause gehen. Aber ich brauche Sie morgen wieder hier. Es gibt viel Arbeit. Und Ihr Dorf kommt sicher ein paar Tage ohne Sie aus.»
Die Fenster des Kaufmeister’schen Hauses in der Carlstraße waren hell erleuchtet, als Simon und Lina dort ankamen. Für einen Moment dachte Lina, dies wäre ihretwegen geschehen, aber dann hörte sie erregte Stimmen aus den Fenstern des kleinen Salons dringen, der zur Straße lag.
Lina klingelte an dem großen Tor, durch das Kutschen und Fuhrwerke in den Hof fahren konnten. Um diese Zeit war es bereits verschlossen. Kurz darauf öffnete ihr der Hausdiener Heinrich.
«Ich geh dann jetzt», sagte Simon, der mit seiner Laterne auf der Straße stand. Gerade in diesem Moment erlosch sie.
«Nein, Simon, du wirst dich erst hier aufwärmen. Ich schreibe dir einen Zettel für deine Herrschaft, damit du keinen Ärger bekommst. Heinrich, nimm den Jungen mit in die Küche. Helene soll ihm etwas Suppe geben und seine Laterne auffüllen.»
Als sie die eigentliche Haustür öffnete, schallten ihr aus der halbgeöffneten Tür des Salons laute Stimmen entgegen, die zu debattieren schienen. Die eine, höhere Männerstimme gehörte ihrem Bruder Georg, die andere ihrem Schwager Bertram. Zunächst dachte Lina, die beiden hätten geschäftliche Zwistigkeiten. Linas Vater hatte damals ihre ältere Schwester Guste mit Bertram Messmer verheiratet, weil ihm die Verbindung seines damals noch recht kleinen Handelshauses mit der Messmer-Reederei günstig schien. Die Reederei hatte sich bei der Umstellung von Börtschiffen auf Dampfschiffe übernommen und konnte Gustes großzügige Mitgift gut gebrauchen, um sich wieder zu sanieren. Gemeinsam hatten Bertram, der Witwer und gut zwanzig Jahre älter war als Guste, und der alte Kaufmeister durch die Vereinigung ihrer Geschäfte ein großes Vermögen angehäuft, das Georg mit einigen Neuerungen nun auszuweiten gedachte. Aber der konservative Vater stand ihm dabei im Weg, und Bertram, obwohl eher Georgs Linie zugeneigt, war nicht gewillt, sich seinem alten Wohltäter offen entgegenzustellen. Darüber hatte es mehr als einmal Streit zwischen den Schwagern gegeben.
Aber diesmal schien sich alles um ein anderes Thema zu drehen. Doch bevor Lina näher kommen konnte, um zu hören, um was es ging, kam ihre Schwester Guste die Treppe aus dem oberen Stockwerk herunter, gefolgt von der massigen Gestalt ihrer Schwägerin Aaltje.
«Kommen Sie auch mal nach Hause», rief diese Lina zu. «Uw Vader voelt zich niet goed.»
Guste, die die hagere Figur des Vaters und zu ihrem Leidwesen auch dessen Gesichtszüge geerbt hatte, besah sich ihre Schwester. «Meine Güte, Lina, du bist ganz durchnässt!»
Das Hausmädchen steckte ihren Kopf aus der Küche, um zu hören, was im Flur vor sich ging, und noch bevor sie die Tür schnell wieder schließen konnte, ließ Lina ein scharfes «Finchen» hören.
Finchen, mit gerade vierzehn Jahren die jüngste Bedienstete im Kaufmeister’schen Haushalt, kam vorsichtig heraus. Lina hatte inzwischen Mantel und Hut ausgezogen und gab ihr beides. «Lauf nach oben und bring mir ein anderes Paar Schuhe.» Erschöpft setzte sie sich auf die große Truhe.
«Was ist denn passiert? Dein Kleidersaum und deine Schuhe sind ja voller Dreck!» Guste und Aaltje hatten sich vor ihr aufgebaut.
«Ich habe nahe am Friedhof zwei tote Kinder gefunden», sagte Lina knapp.
«Ja, das kommt davon, wenn Sie sich im Dunkeln draußen herumtreiben, Schwägerin», sagte Aaltje. «Een vrouw hoort thuis – eine Frau gehört ins Haus.»
Guste starrte sie entgeistert an. «Wurden sie denn ermordet?»
«Daran besteht wohl kein Zweifel.» Lina beschrieb den beiden den Zustand der Leichen.
Guste und Aaltje waren noch ganz benommen von der grausigen Erzählung, als es auf der Treppe polterte. Finchen fiel fast die Treppe herunter, so sehr hatte sie sich beeilt. Wie alle Bediensteten im Haus hatte sie großen Respekt vor Lina. Ungefragt kniete sie sich hin, um ihrer Herrschaft mit den Schuhen zu helfen, wie sie es meistens morgens tat. Lina hatte ihren Stolz, was ihr Gebrechen betraf, aber bei den Schuhen dauerte es ihr einfach zu lange, wenn sie sie selbst anzog.
Mit spitzen Fingern zog Finchen ihr die verdreckten Schnürstiefel aus, um ihr dann in die anderen, gleich aussehenden zu helfen.
«Was ist da drin los?», fragte währenddessen Lina ihre Schwester.
Die seufzte. «Ich habe heute einen Brief von Mina erhalten. Sie hatte wohl Angst, dass Georg ihn liest, wenn sie ihn an dich schickt.»
Wilhelmine, genannt Mina, war Linas Zwillingsschwester. Ihr Mann Justus war Abgeordneter der Nationalversammlung gewesen und hatte nach dem Scheitern der demokratischen Kräfte nicht wie andere sein Fähnchen nach dem preußischen Wind gehängt. Es hatte jedoch eines Pressvergehens in Form eines kritischen Zeitungsartikels bedurft, um ihn endgültig der Willkür der Geheimen Polizei auszusetzen. Er und seine Familie hatten manche Repressalien zu erleiden. Schließlich waren sie Mitte letzten Jahres nach Brüssel geflohen, um der drohenden Verhaftung zu entgehen.
«Was schreibt sie?»
«Sie bittet uns um Geld. Justus hat mit den letzten Ersparnissen eine Passage nach London bezahlt, weil er dort hofft, bessere Arbeit zu bekommen – du weißt, er spricht kaum Französisch. Und Mina sitzt mit den Jungen nun mittellos in einer fremden Stadt.»
«So weit ist es also gekommen.» Lina hielt ihre Röcke etwas höher, damit Finchen die Schuhe oben ordentlich schnüren konnte. «Nichts gegen Justus’ Gesinnung, aber der Artikel im Leipziger Grenzboten war wirklich eine große Dummheit.»
«Weiß Georg, dass du das Blatt im Haus hast?»
«Nein, aber ich habe es von deinem Mann, Guste.»
Guste seufzte und sah sich nach Aaltje um, in der Hoffnung, dass die Schwägerin nicht alles verstanden hatte. «Mina hofft, etwas Klavierunterricht geben zu können. Aber sie muss ein paar Schulden bezahlen. Und die Trennung von Justus drückt sie sehr.»
«Georg hat immer gesagt, diese Heirat war een ongeluk», warf Aaltje ein.
«Ach, halten Sie doch den Mund.» Linas Umgangston der Schwägerin gegenüber war selten freundlich, aber doch höflicher als jetzt in der Sorge um ihren Zwilling.
Mina, die immer mit dem Kopf durch die Wand wollte, hatte die Trauer des Vaters um die Mutter ausgenutzt, um blutjung den Assessor Justus Bleibtreu zu heiraten, den Georg, dessen politische Gesinnung damals noch eine ganz andere gewesen war, mit ins Haus gebracht hatte. Während Georg sich zum königstreuen Preußen gewandelt hatte, waren Bleibtreus Ansichten immer radikaler geworden. Aber Lina wusste, dass Mina ihren Mann abgöttisch liebte.
«Und wieso seid ihr damit zu Georg gekommen, statt ihr einfach Geld zu schicken?»
«Weil wir der Meinung sind, dass sie in ihr Elternhaus zurückkehren sollte, wenn ihr Mann weg ist. Hier ist genug Platz, und sie braucht sich keine Sorgen um ihr Auskommen zu machen. Als Frau eines politischen Verbrechers…»
«Guste! Justus ist doch kein…»
Das strenge Gesicht der älteren Schwester wurde noch eine Spur härter. «Ich weiß, dass du mit Justus’ Ansichten sympathisierst, Lina, aber nach dem Gesetz ist er ein Landesverräter. Jedenfalls werden sie es so hinstellen. Mina sollte dann in Sicherheit sein.»
Finchen hatte den zweiten Stiefel geschnürt. «Danke», sagte Lina. «Hat der Junge in der Küche Suppe bekommen?»
Finchen nickte und wurde ein wenig rot. Der kleine Simon hatte ihr wohl gefallen.
«Komm mit.» Lina erhob sich von der Truhe und ging hinüber in die Bibliothek, wo sie sich an einem kleinen Sekretär einen Platz für die im Haushalt nötigen Schreibarbeiten eingerichtet hatte.
«Der Vater hat nach Ihnen gefragt», ließ sich Aaltje noch einmal vernehmen.
«Ich gehe nachher zu ihm», sagte Lina und schrieb den versprochenen Zettel für Simon. Sie drückte ihn Finchen in die Hand.
«Der ist für den Jungen.»
Dann ging sie Richtung Salon, die Schwester und die Schwägerin hinter sich.
«Lina, ich denke, das sollten die Männer unter sich…», warf Guste zaghaft ein, doch Lina hatte die Salontür schon weit geöffnet.
Georg und Bertram saßen sich am Kamin gegenüber. «Ich weiß gar nicht, was du willst, lieber Georg, wie jede Tochter hat Mina doch eine kleine Rente aus dem Vermögen der Mutter, das wird für ihren Unterhalt hier im Haus doch reichen…»
«Und ich setze den guten Ruf der Kaufmeisters aufs Spiel, wenn die Frau des Justus Bleibtreu…»
«Den du in dieses Haus gebracht hast, Bruder», sagte Lina mit Nachdruck. «Bertram, schreibe ihr, sie ist willkommen. Ich werde das Gästezimmer für sie herrichten, und die Jungen können in der freien Dienstbotenkammer unter dem Dach schlafen.»
«Lina, in meinem Haus bestimme immer noch ich…»
Lina funkelte ihren Bruder an. «In Vaters Haus bestimmt er, wer hier willkommen ist. Ich werde nachher mit ihm reden, und ich bin sicher, er wird meiner Meinung sein.»
Georg war aufgesprungen. Sein rundliches Gesicht lief rot an. Seine Frau schien sich hinter ihre Schwägerin ducken zu wollen. Lina lehnte sich auf ihr gesundes Bein zurück und schien zu wachsen. «Sie ist unsere Schwester, Georg. Und wenn sie uns braucht, dann sind wir für sie da. Wie kannst du dich erdreisten, sie des Hauses zu verweisen?»
«Sie hat recht, Georg», sagte Bertram leise. «Der Ruf der Familie würde weit mehr leiden, wenn sich Mina in Brüssel allein durchschlagen müsste.»
«Ihr werdet anders reden, wenn die Geheime Polizei erst einmal hier im Haus ist», zischte Georg. «Unseren Geschäftsfreunden wird das gar nicht gefallen.» Er sah in die entschlossenen Gesichter seiner Schwestern und seines Schwagers. «Nun gut. Wenn ihr es so wollt, dann lasst sie herkommen. Aber sagt nicht, dass ich euch nicht gewarnt hätte!» Damit verließ er den Salon, und Aaltje folgte ihm.
Auch Bertram stand auf und begrüßte Lina. «Bis hier in Ruhrort mal ein Polizist aus Düsseldorf oder gar Berlin auftaucht…», sagte er.
«Das weiß Georg auch. Aber er ist so geizig, dass ihm jeder Teller mehr in der Seele weh tut.» Nicht nur Georg, auch Lina konnte sehr zornig werden.
«Beruhige dich, Lina. Wenn es Probleme gibt mit dem Geld für Minas Einzug hier, dann sag Bescheid.»
Lina sah in Bertrams Gesicht mit dem grauen Bart und den freundlichen Augen. – Guste hätte es schlechter treffen können – dachte sie nicht zum ersten Mal. «Ich muss jetzt nach Vater sehen.»
«Der Vater hat nach Ihnen gefragt», ahmte Guste Aaltjes Stimme und ihren starken holländischen Akzent nach. Alle drei mussten lachen.
Ein starker Husten schüttelte den alten Kaufmeister. Er saß in seinen warmen Schlafrock gehüllt im Sessel am Fenster. Lina würde mit ihm schimpfen, weil er sich geweigert hatte, sich von Guste und seiner Schwiegertochter ins Bett bringen zu lassen. Er blickte auf seine zitternden Hände und spürte, wie ihm wieder der Speichel aus dem Mund rann. Als er versuchte, ihn mit einer Hand wegzuwischen, wurde aus dem Zittern ein Schlagen gegen die Sessellehne. Ein sabbernder Greis, dachte er. Ein sabbernder Greis mit zweiundsechzig Jahren. Wenn es nur bald vorbei wäre mit mir.
Draußen auf dem Flur konnte er den unregelmäßigen Gang von Linas festen Schuhen hören. Endlich kümmerte sich jemand um ihn. Jede Predigt seiner scharfzüngigen Jüngsten war ihm lieber als das besorgte hilflose Gesäusel von Guste oder der angewiderte Blick von Aaltje, die ihm voller Ekel die Speichelfäden vom Kinn wischte. Lina war nicht sentimental. Sie wusste, was es hieß, krank zu sein. Er hustete wieder, aber diesmal war es der angesammelte Speichel, an dem er sich verschluckt hatte.
Lina hatte den Hustenanfall schon von draußen gehört und eilte ins Zimmer. Sie klopfte ihrem Vater auf den Rücken, und langsam beruhigte er sich und konnte wieder atmen. Sie wischte ihm das Gesicht ab.
«Du hättest mich ersticken lassen sollen», nuschelte er. Er sprach inzwischen immer leiser und undeutlicher, aber Lina verstand ihn.
«Den Gefallen tue ich Georg nicht», sagte sie mit spöttischem Lächeln. Sie wollte nicht, dass der Vater bemerkte, wie besorgt sie war. Diese Erstickungsanfälle, die von seinen Schluckbeschwerden ausgelöst wurden, häuften sich in der letzten Zeit. Er durfte eigentlich nicht mehr allein gelassen werden. Vielleicht würde sie ihre freien Donnerstagnachmittage nun streichen.
«Warum sind Sie nicht ins Bett gegangen?», fragte sie ihn.
«Konnte nicht. Nicht bewegen.» Er versuchte wieder eine Bewegung, aber die Schüttellähmung verursachte ein weiteres unkontrolliertes Schlagen. Lina wich etwas zurück, bis es sich ein wenig beruhigt hatte.
«Kommen Sie, versuchen Sie aufzustehen, Vater.»
Sie stützte ihn. Er hatte durchaus noch die Kraft, selbständig aufzustehen, war dann aber immer in Gefahr, hinzufallen. Mit Lina an seiner Seite schaffte er es. Er ließ es geschehen, dass Lina ihm seinen Schlafrock auszog. Das Nachthemd darunter hatte er befleckt, als Guste versucht hatte, ihn zu füttern. Lina legte eine seiner Hände auf die Sessellehne, damit er sich festhalten konnte.
Sie nahm ein frisches Nachthemd aus der Wäschekommode und zog ihm das schmutzige Hemd aus. Als sie ihm das andere über den Kopf gezogen hatte, sah sie, dass er begonnen hatte zu weinen. Immer noch schämte er sich vor seiner Tochter.
Für einen kurzen Moment versuchte sie, sich an früher zu erinnern, an sein Lachen, seinen Zorn, seine laute Stimme. Etwas drängte sie, ihn zu trösten, zu streicheln, aber dann wischte sie ihm entschlossen das Gesicht ab und verlor kein Wort über seine Tränen.
Es dauerte eine kleine Ewigkeit, bis es ihrem Vater endlich gelang, sich überhaupt in Bewegung zu setzen, um dann in kleinsten Trippelschritten, ängstlich auf sie gestützt, bis zur anderen Seite des Zimmers zu gehen und sich auf das Bett zu setzen. Wenigstens die Kissen hatten Schwester und Schwägerin aufgeschüttelt. Vorsichtig ließ er sich auf dem Bett nieder. Das Zittern war nach der Anstrengung zunächst stärker, Lina wartete ab, bis es wieder etwas ruhiger wurde.
«Ich muss etwas mit Ihnen besprechen, Vater.» Nur an seinen Augen konnte Lina erkennen, dass er aufmerksam zuhörte.
Sie erzählte ihm von Mina und ihren Problemen.
Seine Hände zitterten wieder stärker. Seinem kleinen Mädchen ging es schlecht, und er konnte ihm helfen. «Natürlich nehmen wir sie und die Jungen auf. Und wenn du es willst, werde ich es Georg persönlich sagen.»
Lina nickte zufrieden. Sie wusste, dass Georg Gespräche mit dem Vater hasste, weil er ihn kaum verstand. Der Verfall seines Vaters war für Georg eher peinlich, als dass er ihn bedrückte. Die beiden hatten zuwenig gemein, um einander zu lieben.
Der Vater hustete wieder. Lina beobachtete besorgt, ob er sich wieder verschluckt hatte, aber das war nicht der Fall.
«Halsschmerzen», murmelte er.
«Soll ich Ihnen Tee bringen und einen Umschlag machen?», fragte Lina.
«Nein. Wird schon wieder besser. Bisschen erkältet.»
Sie setzte sich neben ihn auf das Bett, fühlte seine Stirn, aber er schien kein Fieber zu haben. Der Speichel tropfte ihm wieder aus dem Mund, und sie wischte ihn ab.
Er ließ sich helfen, sich ganz ins Bett zu legen, obwohl von Liegen schon längere Zeit nicht mehr die Rede sein konnte. Lina hatte so viele Kissen in seinem Rücken aufgetürmt, dass er fast saß.
«Lina, ich will dir etwas schenken.» Er bemühte sich mehr denn je, deutlich zu sprechen. «Du magst doch den großen Atlanten?»
Sie nickte. «Ich bin immer mit dem Finger darin herumgereist. Und damals, bevor ich mit Mutter nach Italien fuhr, habe ich mir jeden Ort unserer Reise vorher eingeprägt.»
«Ich will, dass du ihn bekommst. Aber stell ihn nicht in die Bibliothek, nimm ihn mit in dein Zimmer. Versprich mir das.» Er schien aufgeregt, denn nun zitterten auch seine Beine. Es gelang ihm, ihre Hand zu nehmen. «Nimm ihn noch heute Abend mit.»
«Ja, das tue ich. Versprochen.» Sie griff nach seiner Hand, legte sie zwischen ihre, und er lehnte sich weiter in die Kissen zurück. Das war die einzige zärtliche Berührung, die er zulassen konnte, ohne das Gefühl zu haben, noch mehr Würde zu verlieren.
«Vater…» Lina nahm all ihren Mut zusammen. «Würden Sie etwas für mich tun?»
«Was kann ich denn noch tun?»
«Würden Sie ein Schreiben unterzeichnen, das mir die Mündigkeit gibt und erlaubt, mir eine Wohnung zu mieten?»
Sie konnte schwören, dass die Augen in seinem starren Gesicht ängstlich schauten. «Nein, keine Angst. Ich werde Sie nicht verlassen, niemals. Aber wenn Sie…» Sie stockte.
«Wenn ich tot bin», sagte er erschreckend deutlich.
«Ich kann nicht weiter in diesem Haus hier leben und für Georg und Aaltje die Hausmamsell sein. Wenn Sie es erlauben, dann kann ich gehen. Bitte, Vater.»
Es dauerte für Lina eine Ewigkeit, bis er antwortete. Mit geschlossenen Augen schien er lange darüber nachzudenken. Schließlich sagte er: «Es gehört sich nicht.»
«Aber wenn ich keinen Bruder hätte…» Lina kamen tatsächlich die Tränen.
Der Vater ließ einen Seufzer hören. «Du würdest von keinem Menschen hier mehr gegrüßt werden, Lina.»
«Das nehme ich in Kauf. Ich… ich…» Sie versuchte, die aufsteigenden Tränen zu unterdrücken. «Ich halte es einfach nicht mehr aus, Vater.»
«Ich ja auch nicht, Kind, ich auch nicht.»
«Ach, Vater, es geht nicht um Sie. Ich tue das gern für Sie, das wissen Sie. Aber ich will nicht die geduldete alte Tante hier im Haus werden.»
Sein Gesicht blieb wie üblich ausdruckslos, als er sagte: «Setz das Schreiben auf, Kind.» Er hustete wieder.
Lina legte seine Hand sanft zurück auf das Kissen. «Ich hole Ihnen besser einen Tee.» Ihre Augen leuchteten, als sie das Zimmer verließ.
Er hustete wieder und sank im Bett noch ein bisschen mehr zusammen. Dieses Kind! Da hatte sie sich etwas in den Kopf gesetzt, was er ihr kaum ermöglichen konnte. Natürlich würde er das Papier unterzeichnen, um ihr eine Freude zu machen, doch was war es wert, wenn erst Georg das Familienoberhaupt war?
Er dachte an Mina, die immer sein Lieblingskind gewesen war. Georg war ein blasser und strebsamer Junge gewesen, ein seinem Vater ergebener Sohn, aber kaum ein wirklich liebenswertes Kind. Die stille Guste, deren Gesichtszüge seinen eigenen so ähnlich waren, dass er sie niemals hätte verleugnen können, war zu einer langen, dürren Frau mit blassroten Haaren, Sommersprossen und schiefen Zähnen herangewachsen und immer ein Rätsel für ihn geblieben. Aber in die Zwillinge, diese bildhübschen kleinen Mädchen, war er vom ersten Tag an vernarrt gewesen.
Sie waren beide wild und verwöhnt, wussten dem stolzen Vater zu schmeicheln und bekamen immer, was sie wollten. Gleich gekleidet waren sie kaum zu unterscheiden.
Dann plötzlich, einige Zeit nachdem sich beide Mädchen von einer lebensbedrohlichen Lungenentzündung erholt hatten, begann die kleine Lina von einem Tag auf den anderen zu hinken. Sie wurde immer stiller, das Hinken verstärkte sich, und irgendwann weigerte sie sich ganz zu laufen, da sie große Schmerzen hatte.
Die Ärzte schlugen schließlich eine Operation vor und fanden das Hüftgelenk fast zerstört. Heute nannte man die Krankheit Hüfttuberkulose. Wenn der Vater daran zurückdachte, was das knapp achtjährige Mädchen durchgemacht hatte, kamen ihm noch manchmal die Tränen. Ja, Lina wusste, was Leiden und Schmerzen waren. Die Operation hatte sie fast umgebracht. Und es sollten weitere folgen. Um sie von den fortdauernden Schmerzen zu befreien, mit denen es ihr unmöglich war zu gehen, musste das Gelenk völlig versteift werden. Josef Heinrich Kaufmeister hatte die besten Ärzte dafür konsultiert. Es gelang. Danach reiste Lina mit ihrer Mutter für mehr als ein Jahr nach Italien, um sich zu erholen, und lernte dort mühsam wieder laufen.
Die Krankheit hatte das kleine Mädchen besiegt, als sie mit fast zehn Jahren zurückkehrte, aber das versteifte Gelenk verkürzte das Bein, und der schiefe Gang drohte das Rückgrat zu verkrümmen. In mehreren gymnastischen Anstalten wurde über Jahre mit Apparaten und Übungen versucht, Linas Körper trotz des Gebrechens zu begradigen. Und fast war das auch gelungen, als sie schließlich mit fünfzehn Jahren endgültig nach Hause zurückkehrte.
Doch sosehr sich Ärzte und Orthopäden auch bemüht hatten, nun konnte man die Zwillinge gut unterscheiden. Lina war kleiner geblieben, hinkte, und eine Schulter war fast unmerklich hochgezogen. Der einstige Stolz des Vaters war der Sorge gewichen, was aus seiner verkrüppelten Tochter werden sollte.