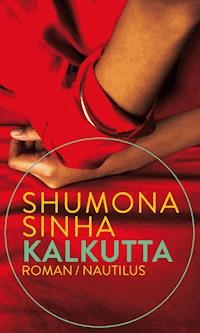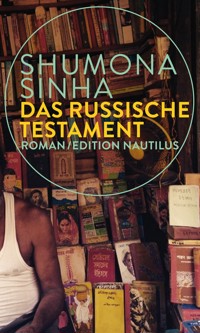
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tania wächst in den 1980er Jahren in Kalkutta auf. Ihren russischen Vornamen hat sie von ihrem Vater, der eine kleine Buchhandlung betreibt. Von ihrer Mutter ungeliebt und auch von ihm nicht beschützt, findet sie Zuflucht in Büchern. Im kommunistischen Westbengalen ist die russische Kultur überall, und so verschlingt Tania erst russische Kinderbücher und träumt später von der Welt Tschechows und Gorkis. Erst als Studentin gelingt es Tania, sich von ihrer Familie zu befreien und ihrer Sehnsucht nach der fremden Kultur zu folgen: Fasziniert spürt sie dem Schicksal des jüdischen Journalisten und Verlegers Lew Kljatschko nach, der seinen Verlag Raduga in der Stalinzeit schließen musste und nur dank einer Intervention Maxim Gorkis dem Todesurteil entging. Bei Raduga waren in den 1920er Jahren surrealistische, unideologische Bücher für Kinder und Erwachsene erschienen, übersetzt in die ganze Welt, so auch ins Bengalische. Kljatschko starb schon 1933, doch Tania nimmt Kontakt zu seiner inzwischen über achtzigjährigen Tochter auf, die in einem Altenheim in Sankt Petersburg lebt, und die beiden ungleichen Frauen, die doch ähnliche Kämpfe durchlebt haben, nähern sich einander an. Kraftvoll, poetisch und farbenreich erzählt Shumona Sinha von drei Menschen im Bann der Literatur, die für sie nichts weniger als Freiheit bedeutet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SHUMONA SINHA
DAS RUSSISCHE TESTAMENT
ROMAN
AUS DEM FRANZÖSISCHENÜBERSETZTVON LENA MÜLLER
Die Originalausgabe des vorliegenden Bucheserschien unter dem Titel Le testament russe,
© Éditions Gallimard, Paris, 2020
Dieses Buch erscheintim Rahmen desFörderprogrammsdes Institut Français
Editorische Notiz:
Ossip Mandelstam wird zitiert nach Das Rauschen der Zeit, Zürich 1985, aus dem Russischen von Ralph Dutli. Alle anderen Literaturzitate übersetzt von Lena Müller aus dem französischen Original des Romans.
Edition Nautilus GmbH
Schützenstraße 49 a
D - 22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten
© Edition Nautilus GmbH 2020
Deutsche Erstausgabe September 2021
Umschlaggestaltung:
Maja Bechert
www.majabechert.de
1. Auflage
EPUB-ISBN 978-3-96054-261-2
Zeit, du scheue Chrysalide, mehlbestäubter Kohlweißling, junge Jüdin, die du dich ans Schaufenster des Uhrmachers schmiegst – schau lieber nicht her!
Ossip Mandelstam,
Die ägyptische Briefmarke
Die Welt entwickelt sich allein durch Häresien weiter, durch diejenigen, die die Gegenwart verwerfen, so unerschütterlich und unfehlbar sie auch scheinen mag. […] Nur die Häretiker, die die Gegenwart im Namen der Zukunft verwerfen, sind der ewige Gärstoff des Lebens und sorgen dafür, dass das Leben sich ewig vorwärtsbewegt.
Jewgeni Samjatin,
zitiert nach Jorge Semprúns Vorwort
zur französischen Ausgabe
seines Romans Wir
Inhalt
Prolog
Tania
Adel
Der Brief
Das Treffen
Dank
Quellen
Prolog
Gestern erst habe ich ihn wieder gesehen. Im Dunklen ist er auf der Straße aufgetaucht, am Waldrand, den Kopf schräg über dem kleinen Körper, unentschlossen über den weiteren Weg, zögerlich, ob er die Straße überqueren oder zurück in die samtige Finsternis sollte. Die Scheinwerfer meines Taxis erleuchteten nur die linke Straßenseite, die Baumstämme und seinen Kopf. Er schien so weiß wie das Licht, strahlend wie eine Schneegestalt, sein gesträubtes Fell rahmte glitzernd sein Gesicht. In seinen Augen drehten sich Räder in Blau und Grau, er wusste nicht, ob er Angst haben sollte oder nicht.
Auf dieser Strecke begegne ich oft kleinen Wölfen, wenn ich, aus Parnas kommend, den Weg zu meinem Refugium in Pargolowo durch den Schuwalow-Park abkürze. Es gibt dort auch stromernde Wildschweine, aber über sie kann ich nichts sagen. Angesichts ihrer unförmigen Körper und ihrer Dickköpfigkeit, mit der sie immer geradeaus stürmen, auch wenn der Instinkt ihre Flanken krümmt, ist mein Herz hart wie Stein.
Mitten im Wald taucht plötzlich der See auf, verliert sich hinter den Bäumen, die sich wie schlaflose Soldaten kaum noch aufrecht halten können, und stößt dann wieder an die Straße. Das herrschaftliche Backsteingebäude mit den hellen, vom Jugendstil inspirierten Säulen und Glockentürmen wurde Anfang der neunziger Jahre von der Stadt Sankt Petersburg als Altersheim errichtet.
Ich komme von einer Sitzung bei meinem Therapeuten. Die Heimleitung hat mir diese Besuche seit einigen Monaten verordnet. Meine Enkelin, die die unbequeme Verantwortung auf sich genommen hat, meine allererste Reise zu ihr in die Vereinigten Staaten zu organisieren, sie dem russischen Verwaltungsapparat abzutrotzen, konnte nichts dagegen tun. Ich weiß nicht, ob es die Begeisterung über das neue Jahrtausend war, die sie dazu brachte, mein Leben in die Hand zu nehmen, mich von meinem Sockel, aus meiner Stadt zu holen und mich ins Ausland zu schicken.
Ich hatte mich auf die Behauptung verstiegen, dass uns, wenn es Pontius Pilatus nicht gegeben hätte, die Shoah erspart geblieben wäre, der Erste Tempel den Zeloten offen gestanden hätte und das Judentum und das Christentum zwei Strömungen derselben Religion gewesen wären. Zuerst haben sie getan, als würden sie mir zuhören. Mir als betagter russischer Jüdin begegnen die Leute immer mit einer Art respektvoller Vorsicht. Dann begannen sie, sich über mich lustig zu machen, mit Nachsicht, wohl weil sie dachten, ich würde betrunken vor mich hinplappern, traumatisiert wie sie vom Ende der Sowjetunion. Schließlich, angesichts meiner Besessenheit von dieser angeblichen Schnapsidee, ist ihnen das Lachen vergangen. Sie verstummten, sobald sie mich sahen.
Das Heim beherbergt die Gespenster der Vergangenheit, die Schlafwandler, die sich weigern aufzuwachen. Die Leitung weiß nicht, dass wir nicht das Gedächtnis verloren, sondern bloß das teilweise, punktuelle Vergessen gewählt haben, um uns Tag und Nacht in diesen wattigen Schlaf zu flüchten. Weil niemand damit rechnet, dass ein Gespenst redet. Weil wir uns in unseren Träumen verkriechen wollen, um nicht gestört zu werden. Ein Traum braucht keine Berechtigung, er muss nur alt genug sein, um uns in Blut und Knochen überzugehen.
Die Reifen des Wagens zermalmten die glatten Kiesel wie Taubeneier. Ich nahm den Seiteneingang zum Treppenhaus, auch wenn ich in der abendlich leeren und dunklen Halle im Erdgeschoss niemanden gestört hätte. Dann verließ ich mein Zimmer nicht mehr, weder zum gemeinsamen Abendessen, noch zur Bridgerunde. Den ganzen heutigen Tag habe ich hinter verschlossener Türe verbracht. Meine Keksdosen und die in Schwarztee eingelegten Kirschen helfen mir über diese Momente der selbstgewählten Isolation.
Ich schlafe wenig. Die weißen Samen der Schlafmittel können nichts ausrichten, sie lösen sich im feuchten Atem meiner Nächte auf. Aus den Alkovenfenstern meiner Mansarde schaue ich auf den See, der nie ganz dunkel ist, auch nicht mitten in der Nacht. Die Lichtpunkte vom anderen Ufer ziehen sich waagerecht über die Wasseroberfläche und zerfallen am Fuß des Waldes zu winzigen silbrigen Schuppen.
Der Brief erwartete mich auf dem Nachttisch. Ich habe ihn wieder und wieder gelesen, und bei jedem Lesen ist meine Verwirrung größer geworden. Ich weiß nicht, wie mich diese junge Frau ausfindig gemacht hat. Ich bin erstaunt über die Entschlossenheit, mit der sie über drei Kontinente hinweg die unsichtbaren und meist längst vergessenen Punkte verbunden hat. Ihr Brief, den sie wohl ins Russische übersetzen ließ, ist nach Boston zu meiner Enkelin gegangen, bevor er hierher zu mir nach Sankt Petersburg weitergeleitet wurde.
Sie hat mir die Geschichte des kleinen Mädchens in Erinnerung gerufen, in einem der Bücher im Verlag meines Vaters, das rostige Uhren aus dem Sand ausgrub, statt Reisig zu sammeln. Die Kinder- und Jugendliteratur der meisten Verleger jener Zeit war der sowjetischen Propaganda verschrieben. Die Autoren nahmen ihre Figuren als Geiseln und benutzten sie als Maulesel für ihre politische Botschaft. Aber mein Vater, der den Raduga-Verlag schon ohne die Erlaubnis des sowjetischen Machtapparats gegründet hatte, ist nie hinter dieser roten Linie geblieben.
Ich lese den Brief nicht gern bei Tag: Der Name meines Vaters wirkt darin so blass, fast banal. Das Sonnenlicht lässt die Worte schwächlich und durchsichtig scheinen, während sie in der Nacht gehaltvoll, wie mit einem riesigen Kolben destilliert sind. Ihre Schrift in blauer Tinte zeigt, dass sie sich Mühe gegeben hat mit dem Namen meines Vaters, Lew Moisejewitsch Kljatschko, und ich stelle mir vor, wie sie kaum merklich über ihn stolpern würde, müsste sie ihn in meiner Gegenwart aussprechen. Sie erzählt auch viel von sich, von ihrer Kindheit und Jugend, um ihre Neugier auf die Wahrheit über meinen Vater, über sein Lebensende zu rechtfertigen. Sie schreibt, wie betroffen sie war, als sie erfuhr, dass er an Tuberkulose gestorben sei. Im Winter 1933. Wie soll ich ihr erklären, dass mein Vater sich glücklich schätzen konnte, drei Jahre vor den Moskauer Prozessen aus dem Leben zu scheiden? Der Tod zerfraß ihn von innen heraus, die Tyrannei hat ihn nicht in den Schmutz zerren können.
Dieses Mädchen aus einem weit entfernten Land, wo Kühe mehr wert sind als Frauen, lässt meine Nächte beben, der Boden unter meinen Füßen bekommt Risse und ich weiß nicht, ob ich Angst oder Freude spüre, während ich ihr dabei zusehe, wie sie das Grab öffnet. Noch weiß ich nicht, ob es ein gewöhnliches Wildschwein ist, das sich, angelockt vom Gestank, durch den Schmutz wühlen wird, oder um einen Wolf, unbeweglich inmitten meiner Nacht.
Tania
Als Erstes fiel ihr sein Oberlippenbart auf, der ihm wie schwarzer Rotz unter der Nase klebte. Das gescheitelte Haar über seinem teigigen Gesicht hatte etwas Schmieriges und Lächerliches. Tania hatte noch nie jemanden wie ihn gesehen, weder in ihrem Viertel, noch in der Schule in ihrem Geschichtsbuch. Sie betrachtete den Umschlag dieses Buchs, das nach Benzin und Rauch stank und ihr fast in den Händen brannte. Die vorher vergilbten Ränder der Seiten waren jetzt verkohlt.
Sie schaute sich um. Die Brandstifter waren mit ihren Benzinkanistern und Fackeln weitergezogen. Die anderen Buchhändler hatten die Eisengitter heruntergelassen und sich aus dem Staub gemacht. Im schummrigen Licht der Straßenlaternen konnte Tania ihren Vater sehen, der mitten auf der von Straßenbahnschienen geriffelten Straße auf dem Boden saß, neben einem Haufen Asche. Prakash hörte auf zu weinen. Er schniefte von Zeit zu Zeit und wischte sich mit dem Ärmel die Nase, während er lose Seiten, Umschläge und das ein oder andere vollständige Buch aufsammelte.
Prakash verbrachte sein Leben in seiner Höhle aus Büchern. Wie bei seinen Nachbarn stapelten sie sich bis unter die Decke, als wären sie zusammengeschraubt, um den Eingang, den Verkaufstresen, die Decke und die Wände zu bilden. Hunderte von Buchhändlern verbrachten so ihre Tage nebeneinander in ihren Höhlen an der College Street, im Schutz der Mauern der ältesten und berühmtesten Universitäten der Stadt, in die sie noch nie einen Fuß gesetzt hatten.
Prakash verkaufte ausländische Literatur – vor allem russische, aber auch französische, deutsche, italienische und spanische –, übersetzt ins Bengali.
Er hatte sein Geschäft nie als illegal verstanden, auch wenn für viele Werke nie Urheberrechte an die Originalverlage bezahlt worden waren. Die Gebirge und Ozeane wie auch die Unwissenheit des Westens in dieser Angelegenheit schützten ihn und die anderen Buchhändler vor juristischen Klagen. Kalkutta war ein Raumschiff, das durch die Galaxis und über Grenzen hinweg reiste, um heimlich in fremden Ländern zu landen und die Archive der Vergangenheit und der erträumten Zukunft mitzunehmen, sodass sich in der Vorstellung der Leserschaft aus der College Street der Duft von Lotos mit Lavendel mischte, der Regen nach Schnee schmeckte und manchmal die Schatten weißer weiblicher Silhouetten über ihr Begehren huschten.
Als man ihm Mein Kampf anbot, hatte Prakash nicht abgelehnt, er verkaufte immerhin auch Das Kapital und die Biografien von Gandhi, Subhash Chandra Bose und Martin Luther King. Er hatte darin bloß ein Zeichen für die Vielfalt politischer Ideologien gesehen, und dass es sich um Bestseller handelte. Der Genozid fremder Völker hatte ihn nie berührt. Die politischen Krisen Indiens ebenso wenig: Streiks, Demonstrationen, Aufstände, er zählte sie nur in sabotierten Werktagen.
Die Kommunisten hatten mit einigen Aktivisten aus den NGOs seit Anfang Januar seinen Stand in der College Street im Visier gehabt. Das Jahr 1983 hatte schlecht begonnen. Sie waren eines Nachmittags aufgetaucht. Hatten einige Bände aus den Stapeln gezogen, als ob sie einen Tempel niederreißen würden, sehr höflich, ohne zu fluchen. Nach ein paar Slogans hatten sie einen Haufen Bücher mitten auf der Straße angezündet. Im Eifer des Gefechts hatten sie nicht zwischen einem Band von Rilke und der Nazibibel unterschieden. Ihre Energie war, zusammen mit den Flammen, so beeindruckend gewesen, dass niemand sich gerührt hatte. Auch sie hatten einen Augenblick regungslos verharrt, bevor sie weitergezogen waren.
Prakash wandte sich zum Gehen, sein Zuhause lag unweit der Verkaufsbude im Labyrinth der kleinen Gassen hinter der College Street. Seine Tochter beachtete er kaum, nickte ihr zerstreut zu.
Tania blies auf das Buch, wischte es mit der Hand sauber und steckte es unter ihren gelben Pullover, der eng an ihrem zierlichen, verschreckten Körper lag. Sie wusste nicht, ob sie es eines Tages lesen würde. Sie wusste auch nicht, ob das, was sie tat, ihrem Vater noch mehr Ärger einhandeln würde. Das verkohlte Buch hatte ihre Neugier geweckt, sie wollte es retten und an einen sicheren Ort bringen.
Nach der Geburt von Tania, ihrem ersten Kind, war Mira blutleer gewesen, aufgerissen, im Unterleib verwüstet. Das nahm sie ihrer Tochter übel. Solange Tania in ihrem Bauch war, konnte Mira sich vorstellen, Mutter zu werden, aber sie verzieh ihr nie, herausgekommen zu sein, noch dazu mit solcher Gewalt. Sie sah es als Verrat.
Ihr Groll wurde zu Wut, als ihre Schwiegereltern sie belächelten, weil sie keinen Jungen auf die Welt gebracht hatte. Sie kümmerte sich nicht um den Säugling und beäugte ihre Schwägerinnen misstrauisch, wenn sie das Kind fröhlich plappernd in den Arm nahmen und behaupteten, es würde bald einen Bruder bekommen. Als Mira versuchte zu stillen, nahm die Kleine bloß die Brustwarze in den Mund und verharrte reglos, verträumt. Mira lachte auf, wurde dann wütend und legte sie auf dem Boden ab. Einmal so heftig, dass ihr Kopf gegen den Betonboden schlug. An jenem Tag ohrfeigte Prakash sie.
Er fühlte sich als stolzer Vater eines entzückenden Babys und beschloss, ihm einen russischen Namen zu geben, auch wenn seine schwarz glänzenden Locken und sein winziger lehmfarbener Körper nichts gemein hatten mit den weißen Babys, dick und rund wie Gänse, aus diesem fernen, fast unwirklichen Land. Prakash ließ sich von seiner Kundschaft und deren Begeisterung für russische Literatur inspirieren. Die kommunistischen Aktivisten und Intellektuellen kannten die politischen Strategien, die die indische Regierung verfolgte, um sich mit den sowjetischen Machthabern gutzustellen, ohne die diplomatischen Bemühungen in Richtung der Vereinigten Staaten zu vernachlässigen. Russland gehörte quasi zur Familie, zu ihrem Leben. Sie erinnerten sich stolz daran, dass die Kommunistische Partei Indiens nicht etwa in Indien, sondern in Taschkent von dem Bengalen Manabendra Nath Roy gegründet wurde, der von Lenin zum zweiten Kongress der Komintern nach Moskau eingeladen worden war. Slawische Namen gingen ihnen leicht über die Lippen, wenn sie in den Buden am Straßenrand Tee mit Milch tranken und nach Dieselabgasen stinkende, frittierte Teigtaschen mit Auberginen und Kartoffeln aßen, während die Busse und Lastwagen hupend ihre Stimmen übertönten. Sie fühlten sich allem Russischen zugehörig, ihre politischen Kämpfe und ihre existentialistische Suche orientierten sich an den Vorkämpfern der zwanziger, dreißiger Jahre, der Zweite Weltkrieg schien ihnen interessant nur im Lichte von Stalins Eingreifen. Sie liebten das Bolschoi-Ballett, gingen mit ihren Kindern in den russischen Zirkus und feierten die Siege von sowjetischen Athleten bei den Olympischen Spielen im Namen eines Patriotismus ohne Grenzen. Es war nicht ungewöhnlich, im Kalkutta der siebziger und achtziger Jahre Kindern zu begegnen, die auf die Namen Karl, Gogol, Pawel oder gar Bulganin hörten.
Mira hatte sich in sich selbst zurückgezogen. Ihr Bauch war ein ausgebrannter Ofen, wo es zwischen Kohle und Asche keine Liebe und kein Begehren mehr gab. Sie hatte den Vornamen Tania gehasst, dessen fremder Klang das Baby noch weiter von ihrer inneren Welt entfernt hatte. Mit zwei Silben, zwei Tropfen Zaubertrank hatte ihr Mann ihr das Kind entrissen und es in die Ferne entführt.
Ihre Gefühle zu ihrem Kind hatten etwas Unbeholfenes. Die spärliche Zuneigung, die sie für es empfand, war vermischt mit Zorn, und wenn sie gekonnt hätte, hätte sie es genommen und zurück in ihren Bauch geschoben. Sehr bald vergaß sie, es zu lieben.
Im Heranwachsen entwickelte Tania eine instinktive Wachsamkeit ihrer Mutter gegenüber, deren Wut sie jeden Moment unvermittelt treffen konnte, und eine traurige Liebe zu ihrem Vater, der sie mit Zuneigung nur heimlich bedachte, stets in Angst, den Zorn seiner Frau auf sich zu ziehen.
Als ihre Tochter sieben oder acht Jahre alt war, wurde Miras Abneigung zu Hass. Anstelle ihres niedlichen Gesichtchens bekam die Kleine immer männlichere Züge. Um sie zu bestrafen, brachte Mira sie eines Tages zum Männerfriseur auf dem Markt. Auf dem mit grünem Kunstleder bezogenen Holzstuhl, den man mit ein paar Backsteinen aufgebockt hatte, weinte Tania stille, heiße Tränen. Der Friseur schreckte vor der Forderung der Mutter zurück, kannte aber ihre Streitlust, beugte sich ihrem Willen und schor den kleinen Kopf kahl. Die Folgen dieses Besuchs waren jedoch erfreulich: Tanias Haar wuchs dichter und länger als bisher, umspielte ihr Gesicht und fiel wie sonnenreife Trauben auf ihre Schultern.
Aber Tania kannte den Grund für die Härte ihrer Mutter und schämte sich ein wenig. Es war ihr unangenehm für ihren Vater, denn man warf ihr vor, ihm zu ähneln. Sie wurde vertrieben aus jenem glücklichen Garten, in dem die Frauen sich gegenseitig die Spiegel hielten. Heimlich beobachtete Tania ihren Vater. Sie empfand ihm gegenüber eine immer stärkere heimliche Zärtlichkeit, sie war stolz, ihm ähnlich zu sein. Sie betrachtete sich im Licht einer Sturmlaterne im Spiegel und sah in ihren Zügen eine Stärke pulsieren.
Sehr schnell lernte sie, das zu lieben, was ihrem Vater heilig war: seinen Bücherstand. Wenn sie von ihrer Mutter ausgeschimpft wurde, fand sie dort Zuflucht und vergaß die Schreie, Drohungen, Beleidigungen, sie vergaß die Stunden, die vergingen, getragen von ihrer Hängematte aus Worten. Die Sätze umschlangen sie wie Lianen, hüllten ihren Körper ein, nahmen ihren Atem in sich auf. Umgeben von einem fremden Duft, beschienen von dem sanften Leuchten eines fernen Landes, tauchte sie wieder auf. Lesen war wie schweben. Ein Flug über die baufälligen Dächer und den Gestank von Schlamm und Gewürzen. Immer winziger, immer ferner verschwand Kalkutta aus ihrem Blickfeld wie ein ungeliebter Planet. Sie war ein Kind vor einer fremden Welt. Nichts war realer als Bücher. Tania lebte am Rand, wie die Gänseblümchen, die zwischen den Gleisen wachsen, zu unwichtig und zu zäh, um von der brüllenden Lokomotive zermalmt zu werden.
Tania betrat das Haus hinter Prakash, ging in ihr kleines Zimmer und zog einen der Schuhkartons unter ihrem Bett hervor. Dort versteckte sie ihre Bücher, die sie sich im Laden ihres Vater geliehen hatte, ein paar Münzen, die sie vom Altar geklaut hatte, Krimskrams, Spielzeug, ein Bild von Jesus Christus und eines von Björn Borg, aber auch die Katzenbabys, die sie auf der Straße zwischen Müllbergen aufsammelte, auch wenn ihr Maunzen schnell Mira alarmierte, die mit einem eisernen Pfannenwender aus der Küche gerannt kam und die verängstigten Tierchen mit Fußtritten in die andere Ecke des Zimmers beförderte.
Tania versteckte das verbrannte Buch unter den anderen Büchern. Mehr als Traurigkeit spürte sie Scham für ihren Vater. Sie spürte, dass er sich einer Sache schuldig gemacht hatte, die sie nicht verstand. Tania fühlte sich verraten von den Büchern, um die doch ihr Leben kreiste. Sie war sprachlos angesichts ihrer zerstörerischen Macht, obwohl sie ihr doch über das Unglück ihrer Geburt hinweggeholfen hatten. In den langen Jahren, in denen das Lesen ihre Rettung gewesen war, hatten sich Wahrheiten und Lügen grausam vermischt, um die innere Matrix der Menschheit zu bilden.
In der Woche nach der Bücherverbrennung wurde Tania krank. Eine schwere Angina hinderte sie daran, zur Schule zu gehen. Und so lernte sie hinter der geschlossenen Tür ihres Zimmers die Vorzüge des Fiebers kennen: Es war eine großartige Gelegenheit zum Lesen. Ihr Vater überraschte sie eines Abends, als er in ihrem Zimmer Licht machen wollte. Er betrachtete sie amüsiert und reichte ihr eine Schale mit dünnen Apfelspalten. »Verdirb dir nicht die Augen!«, sagte er und zog die Tür wieder zu.
Unter ihrer Bettdecke, die nach Schweiß und Gemüsesuppe roch, las sie einen Roman von Tschechow, den sie einige Tage zuvor heimlich eingesteckt hatte. Ganz weit oben war er im Laden ihres Vaters versteckt gewesen. Tania hatte auf den Verkaufstresen klettern müssen, um ihn sich zu angeln.
Mit jedem Zentimeter, den sie wuchs, verschwanden bei ihrem Vater und anderswo Bücher von weiter oben. Mascha und das Kissen von Galina Lebedewa, Die erste Jagd von Witali Bianki und andere Bilderbücher, die den milchigen Duft von Amulspray verströmten, und die Märchen von Baba Jaga, bei denen sie an die schmutzigen, feuchten Lappen in der Küche denken musste, hatten für sie ausgedient. Auf das Magazin Mischa zu Monatsbeginn wartete sie immer noch ungeduldig. Der Geruch der frischgedruckten Seiten kitzelte ihren Gaumen, als handelte es sich um Bonbons aus Schnee, auf dem Hirsche ihre Spuren hinterlassen und Birken ihre Umrisse gemalt hatten und die jemand vorsichtig in eine Zauberschachtel aus lackiertem Holz gelegt hatte. Neben den Abenteuern von Kindern, die sich stets durch vorbildliche Großzügigkeit und besonderen Mut auszeichneten, gab es zwei Seiten zum Russischlernen. Von der ersten Lektion an trug Tania überall ihren Namen in kyrillischen Buchstaben ein, in alle Schulbücher und Hefte. Allein in ihrem Zimmer redete sie manchmal auf Fantasie-Russisch mit sich selbst, die slawischen Worte purzelten ihr durch den Mund und stießen an ihre Milchzähne, während sie sich einen sonnigen Tag mit ein wenig Regen wünschte, der sie weder verbrannte noch durchweichte und auf ihren Handflächen nur den Geruch von Glanzpapier zurückließ.
Jetzt suchte sie Bücher, deren Worte schwer auf den Seiten wogen, sich wie Hindernisse vor ihr aufbauten und ihr das Gefühl gaben, in die Welt der Erwachsenen einzutreten.
Sobald sie einen Fuß vor die Tür setzte, waren die Buchhändler in Aufruhr. Sie wussten, dass Tania bei jedem beiläufigen Gespräch Bücher klauen konnte, vor allem solche, die nicht für sie bestimmt waren. Sie wussten nicht, wo sie sie verstecken sollten, und räumten ihre Auslagen jeden Monat um. Es war ein stillschweigendes Versteckspiel.
Während sie bei manchen Büchern diese Kontaktsperre verstand, wenn ihr zwischen den Seiten aus einer dunklen Quelle der heiße Dampf der Schuld entgegenschlug, schockierte sie Tschechows Roman eher wenig, eine keusche Geschichte über zwei junge Schwestern aus dem untergehenden Adel, deren Vater die Abwesenheit der verstorbenen Mutter durch eine gleichermaßen überbordende wie zerstreute Zuneigung auszugleichen versuchte. Die Ältere hütete den vergehenden Glanz der Familie, während die Jüngere schwer zu bändigen war. Sie verschmähte aufwändige Garderoben, den Nachmittagstee und andere gesellschaftliche Anlässe. Ihr lag nichts an einem porzellanweißen Teint. Sie streifte durch die Wälder, kletterte auf Hügel, biss in noch bittere Früchte.
Nach vielen Seiten aber stieß Tania auf die grünen Brüste der jüngeren Schwester, wie Äpfel aus dem Garten des Herzogs. Da hatte sie eine unglaubliche Vision. Brüste waren bisher weiß, schwarz, golden oder lehmfarben gewesen. Die Erinnerung an die Brüste ihrer Mutter war mittlerweile blasser als eine Milchwolke, es blieben ihr die Göttinnen, sinnlich und stolz, behangen mit seidenen Saris und klimperndem Schmuck. Die Brüste einer jungen russischen Frau tauchten auf und warfen ihren grünen, köstlichen Schatten auf diese trockene Erde.
Dann wurden ihr Russland und der Rest der Welt auf andere Weise nähergebracht, in der Schule, einer Einrichtung für Mädchen, bei der auch die Lehrerschaft ausschließlich aus Frauen bestand. In herrliche Saris gehüllt, die Haare zu langen Zöpfen geflochten oder zu schweren Knoten gebunden, den goldenen Schmuck stolz zur Schau tragend, schritten die Lehrerinnen mit königlicher Erhabenheit über den Campus.