
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: bloomoon
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Adib und Karl. Der eine ein junger Flüchtling aus Afghanistan, der andere ein alter Mann, der in seiner Jugend aus seiner schlesischen Heimat vertrieben wurde. Beide sind geprägt von den Erlebnissen ihrer Flucht und beide haben Verlust, Angst und Verfolgung kennengelernt. Und trotzdem hat keiner von beiden aufgegeben. In Berlin kreuzen sich die Wege von Adib und Karl. Die Geschichte einer besonderen Freundschaft zwischen zwei Menschen, die ein gemeinsames Schicksal teilen, beginnt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Daniel Höra
Das Schicksal
der Sterne
Vollständige eBook-Ausgabe der Hardcoverausgabe
bloomoon, München 2015
© 2015 bloomoon, arsEdition GmbH, Friedrichstr. 9, 80801 München
Alle Rechte vorbehalten
Text: © Daniel Höra. Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb.
Lektorat: Susanne Weber
Covergestaltung: Grafisches Atelier arsEdition unter Verwendung von Bildmaterial von Thinkstock
Zitat S. 5: »Under the Milky Way«, The Church © Steve Kilbey and Karin Jansson with kind permission by Ground Control Music Management,
PO Box/1576 Toowong, QLD 4066, Australia
Umsetzung eBook: Zeilenwert GmbH
ISBN eBook 978-3-8458-1093-5
ISBN Printausgabe 978-3-8458-0758-4
www.bloomoon-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Zitat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Danksagung
Über den Autor
And it’s something quite peculiar
Something shimmering and white
It leads you here despite your destination
Under the Milky Way tonight
»Under the Milky Way«
The Church
1
An einem Tag im Juli wurde Adib, mitten in Berlin, von einem schwarzen Loch verschluckt. Einfach so. Während sich die Welt draußen unbeirrt weiterdrehte, verschwammen zuerst die grauen Wände vor Adibs Augen, dann kam der Fußboden näher und schließlich krachte er auf den ausgetretenen Linoleumboden. Doch das merkte er schon nicht mehr. Sein Bewusstsein war mit Lichtgeschwindigkeit in das Zentrum der Dunkelheit gereist. Dorthin, wo nichts existierte außer dem Vergessen.
Seine Mutter Nuria stürzte sich mit einem Aufschrei auf den leblosen Körper und schüttelte ihn. Ein dünner Blutfaden schlängelte sich von der Stirn des Jungen hinab und tropfte auf den Boden. Adibs Bruder Tahir stand neben den beiden, unfähig zu reagieren. Nurias Aufschrei hatte den Hausmeister alarmiert, der ins Zimmer gestürmt kam, den leblosen Jungen dort liegen sah und davoneilte, um Hilfe zu holen.
Als Adib im Schneckentempo wieder zu sich kam, war es ihm, als würde eine sanfte Macht ihn zurück ins Licht ziehen. Er blinzelte, schlug die Augen auf, sah das vertraute Gesicht seiner Mutter und wusste, dass er in Sicherheit war.
Schritte näherten sich, eine Frau kniete plötzlich neben Adib und befühlte seinen Puls. Er lächelte schief, so wie man eben lächelt, wenn man gerade von einer anstrengenden Reise zurückkehrt. Die Frau lächelte und klebte ein Pflaster auf den Riss auf seiner Stirn.
Adib sah sich in dem kleinen Zimmer um: vier Etagenbetten, ein Tisch, vier Stühle, vier Metallschränke. Sonst nichts. Das also sollte seine neue Heimat werden.
Adib dachte zurück an seine alte, die er vermisste, wie ihm jetzt bewusst wurde. Doch gleichzeitig war er erleichtert, in Berlin zu sein, in dieser großen, strahlenden Stadt mit ihren breiten Straßen und ihrem goldenen Himmel, der durch die Fensterscheiben schimmerte. Adib dachte an die vergangenen Monate zurück, an die dunklen Straßen, die sie durchwandert, an das schäumende Meer, das sie mit dem kleinen Boot durchfahren hatten. Er dachte an die Polizisten mit den Gewehren und den vom Schreien heiseren Stimmen. Wie in einer Parade marschierten die zahllosen Uniformierten vor seinem geistigen Auge auf.
Sieben Monat waren sie unterwegs gewesen. Sieben Monate voller Angst. Angst, es nicht zu schaffen, zurückzumüssen. Angst, zu sterben oder verrückt zu werden. Angst, für immer in einem schwarzen Loch zu verschwinden. Adib lächelte.
»Es geht ihm gut«, sagte die Heimleiterin zu Adibs Mutter, die zwar die Worte nicht verstand, jedoch deren Sinn.
Tahir half ihm auf die Beine. Adib setzte sich auf einen Stuhl und sah aus dem Fenster. Er war fest entschlossen anzukommen, hier in diesem fremden Land.
2
Karl ging langsam, bedächtig, einen Fuß vor den anderen setzend.
Ein alter Knacker, der sich wie in Zeitlupe bewegte. Das war ihm unangenehm. Vor allem, wenn ihm die Leute auf der Straße mitleidige Blicke zuwarfen.
Früher war er mit schnellen Schritten durchs Leben gegangen. Wie auf der Flucht, hatte er manchmal gedacht, wie auf einer ewigen Flucht, und er hatte sich gezwungen, langsamer zu gehen, die Dinge gelassener zu betrachten. Doch nach einer kurzen Weile hatte er seinen Schritt wieder beschleunigt. War mit Lichtgeschwindigkeit durch all die Stationen seines Lebens gehastet. Jetzt ging es eben zwangsläufig langsamer. Hin und wieder blieb er stehen und wischte sich mit dem Ärmel über die Stirn. Die Sonne nervte ihn. Musste es im Mai schon so heiß sein? Er wartete auf die Kühle der Nacht, und überhaupt vermisste er ihre schützende Dunkelheit. Hier im Sonnenlicht war man so präsent, die Konturen waren zu klar umrissen. Ein leichtes Ziel, eine leichte Beute. Karl schüttelte den Kopf. Es war doch alles so lange her, und trotzdem schien es ihm, als sei es erst gestern gewesen.
Mist, dachte er. Einfach Mist. Da lebte man so lange, und alles, was blieb, waren Erinnerungen. Vor allem die schlechten. Karl schüttelte erneut den Kopf, um die Bilder zu vertreiben. Er dachte an Emmi. Er dachte an die Reisen, die sie zusammen unternommen hatten. Bis nach Thailand waren sie gekommen, damals in den Achtzigern, als dort noch niemand hinwollte. In Indien waren sie gewesen, in Ägypten, in Kanada. Und in …
Viehwaggons. Zack! Da waren sie. Tauchten einfach auf. Schoben sich wie ein Filter über seine anderen Erinnerungen. Über die schönen.
»Blödes Gedächtnis. Macht, was es will«, schimpfte er laut.
Eine Frau ging lächelnd an ihm vorbei, aber Karl beachtete sie nicht, wie er vieles um sich herum nicht mehr beachtete. Er spürte, dass er auf dem Weg war. Auf dem Weg zu Emmi. Vielleicht konnte man da drüben ja auch Reisen unternehmen, überlegte Karl. »Schwachsinn«, sagte er zu sich selbst. »Da drüben ist gar nichts. Feierabend! Der Tod ist tot.«
Es würde eine ewige Reise in die Dunkelheit werden. In die schützende. Obwohl er insgeheim hoffte, Emmi dort wiederzutreffen.
Am Kanal angekommen, setzte er sich auf die graffitiverschmierte Bank und holte sein Buch hervor. Er las ein paar Sätze, konnte sich aber nicht konzentrieren. In der Nähe stritt ein Entenpaar. Karl sah von seinem Buch auf, las noch einen Satz, drehte es um, las den Titel, drehte es wieder zurück und klappte es zu. Der Schweiß lief ihm in dicken Strömen über das Gesicht.
Irgendetwas stimmte hier nicht. Das Licht war ungewöhnlich grell. Als hätte jemand die Sonne durch ein Flutlicht ersetzt. Er schirmte mit einer Hand die Augen ab und klappte das Buch erneut auf.
Zu heiß zum Lesen, beschloss er, stand mit dem Buch in der Hand auf und wartete einen Augenblick, um das Gleichgewicht zu finden. Was war denn das für ein Stechen?, dachte Karl noch und fiel im selben Moment um.
3
Adib trank seinen Tee und las in einem der beiden Bücher, die seinen einzigen Besitz darstellten, abgesehen von zwei Hosen, einer Jacke, ein Paar Turnschuhen, drei T-Shirts sowie Unterwäsche und Strümpfen, die er sich in der Kleiderkammer des Heimes hatte aussuchen dürfen. Aber das waren nicht seine eigenen Sachen. Nur diese Bücher, die er während der ganzen langen Monate mit sich getragen hatte.
Tahir lärmte um ihn herum, Nuria lag auf dem unteren Bett und döste. Sie hatte einen Arm über die Augen gelegt. Ob sie wohl an Vater dachte? Manchmal in der Nacht hörte Adib sie leise schluchzen und den Namen ihres Mannes flüstern. Als ob sie ihn auf diese Weise beschwören könnte, zu ihr zurückzukommen. Doch wie sollte das funktionieren? Von dem Ort, an dem sein Vater war, war noch niemand wiedergekommen. Zumindest hatte Adib noch von keinem gehört, auch wenn die Geistlichen und irgendwelche Spinner etwas anderes behaupteten.
Sein Vater lag in der Erde verscharrt, und da würde er wohl noch eine Weile bleiben, es sei denn, Gott, oder wer auch immer, entschloss sich, die Toten auferstehen zu lassen.
Der Gedanke, dass seine Mutter so litt, machte ihn wütend. Adib ballte die Fäuste. Manchmal würde er der Welt am liebsten ins Gesicht schreien, dass sie eine ungerechte Hure sei, die sich dem Meistbietenden hingebe. Dabei sollte sie lieber wie eine Mutter sein, sich kümmern und sorgen.
*
In den Tagen nach ihrer Ankunft rannten sie von einer Behörde zur anderen, beantworteten Fragen, unterschrieben Papiere, machten Deutschkurse und richteten sich, so gut es ging, in ihrem neuen Leben ein. Nuria fiel es schwerer als den beiden Jungs. Alles war zu fremd für sie. Sie war unsicher und wusste oft nicht, wie sie sich verhalten sollte.
Adib war meist nur zum Schlafen im Wohnheim. Er konnte die Leute dort nicht ertragen; lauter müde Gesichter, die auf ein besseres Leben warteten. Adib erkundete lieber seine Umgebung oder fuhr mit dem Bus durch die Stadt. Einfach nur dasitzen und gucken, das gefiel ihm.
Eine seiner Lieblingsstellen war an der Havel, gleich neben der Spandauer Altstadt. Dort war eine Bank, halb verdeckt von einer riesigen Weide. Auf der Bank war man regelrecht versteckt und sah doch alles, was um einen herum vorging. Auf dem Weg dorthin wunderte sich Adib wieder einmal über den Himmel. Heute war er blaugrün wie das Meer. Überhaupt war das Licht dieser Stadt anders, als er es sich vorgestellt hatte. Gold und Blau waren die beherrschenden Farben, nicht Tiefgrau, nicht Steingrau, nicht Eselgrau, nicht Schimmelgrau – überhaupt nicht Grau, von ein paar Häusern abgesehen. Viele Gebäude waren gelb oder ocker oder orange oder grün. Adib hatte nicht erwartet, dass es hier so bunt war. Und auch die Autos waren farbig und glänzten. In seiner Heimat hatte es nur schwarze oder weiße Autos gegeben und alle waren sie verbeult gewesen.
An der Havel herrschte ziemliche Aufregung. Ein Krankenwagen stand mitten auf dem Rasen, genau neben Adibs Lieblingsplatz. Leute hatten sich versammelt und sahen zu, wie Sanitäter gerade einen alten Mann auf ihre Trage hievten, zudeckten und zum Wagen trugen. Adib sah wirres graues Haar unter der Decke hervorquellen und eine spitze Nase. Der alte Mann bewegte sich nicht.
Als der Sanitätswagen abgefahren war und die Leute sich verstreut hatten, setzte sich Adib auf seine Bank und sah zwei streitenden Enten zu. Nach einer Weile merkte er, dass sein Blick immer wieder über einen Gegenstand streifte, der erst jetzt in sein Bewusstsein drang: ein Buch. Es war aufgeschlagen und lag mit den Seiten nach unten im Gras, halb verdeckt von einem Busch. Er griff danach und entzifferte den Titel: Geheimnisse des Universums. Auf dem Umschlag war ein Sternenhaufen abgebildet, durch den ein Lichtstrahl wie ein scharfes Messer schnitt.
Wie oft hatte er während der sieben Monate in den Himmel gestarrt? Wie oft hatten sie unter freiem Himmel schlafen müssen, und wie oft hatte sich Adib vorgestellt, dass die Sterne sie leiten, sie beschützen würden?
Ob das Buch dem alten Mann gehörte? Auf der Suche nach einem Namen blätterte er die ersten Seiten durch. Nichts! Erst hinten wurde er fündig: Karl Riedberger stand dort sowie eine Adresse. Er kramte seinen Stadtplan hervor: Die Straße war ganz in seiner Nähe, direkt in der Altstadt.
Das Haus war schon alt und bestand aus löchrigem gelbem Stein. Adib fuhr mit dem Finger die Klingelschilder ab, drückte auf den Namen und wartete. Als sich nichts tat, wollte er woanders klingeln, doch dazu kam es nicht. Eine ältere Frau, die ein grünes Kleid und rote Schuhe trug, kam heraus. Adib erinnerte sie an einen Papagei.
»Was willst du denn?«, fragte sie schroff.
Adib hielt das Buch hoch und sagte: »Karl Riedberger.«
Die Frau blickte ihn unter ihrem grauschwarzen Pony böse an und sagte: »Wenn du nicht verschwindest, hole ich die Polizei.«
Adib verstand sie nicht. »Das Buch«, sagte er und hielt es der Frau hin. Diese trat einen Schritt zurück, als hätte sie Angst vor ihm.
»Mann ist gefallen«, sagte Adib. »Doktor«, fügte er noch hinzu. Im Gesicht der Frau sah Adib widerstreitende Gefühle. Statt etwas zu sagen, holte sie ein Handy hervor, klappte es auf, drückte ein paar Knöpfe und hielt es sich ans Ohr. Nachdem sie eine Weile gelauscht hatte, klappte sie es wieder zu und sagte: »Geht nicht ran.« Sie sah in die Ferne, als würde sie nachdenken.
»Wo ist Karl denn?«, fragte sie nach einer Weile. Adib zeigte Richtung Kanal. »Ist ihm etwas passiert?«, fragte die Frau.
Er sagte noch einmal »Doktor« und hatte die Idee, der Frau den Ort zu zeigen, von wo sie den alten Mann abgeholt hatten. Er winkte ihr, ihm zu folgen. Die Frau zögerte, nach einer Weile ging sie jedoch hinter Adib her, wobei sie ihr Handy in der Hand behielt.
Am Kanal zeigte Adib ihr die Stelle, wo der alte Mann gelegen hatte. »Karl?«, fragte sie.
Er nickte und machte ihr vor, wie die Sanitäter den alten Mann auf die Trage gehievt hatten.
Als er das Geräusch der Sirene nachmachte, lächelte die Frau zum ersten Mal. Adib zeigte ihr, wo er das Buch gefunden hatte. Sie schlug es auf.
»Ich weiß nicht, was passiert ist«, sprach sie betont langsam, damit Adib sie verstehen konnte. »Aber ich werde das rausfinden.« Sie drehte das Buch um und besah sich den Umschlag. »Er mag diesen Weltraumkram«, sagte sie wie zu sich selbst, den Blick auf das Buch gerichtet. Als Adib, der sie nicht verstanden hatte, nachfragte, sah sie auf und sagte: »Karl wird sich sicherlich bei dir bedanken wollen, dass du ihm sein Buch gebracht hast. Vielleicht gibst du mir deine Adresse?«
Er nannte ihr seinen Namen, den des Heimes und die Straße. Die Frau klemmte sich nach einem kurzen Gruß das Buch unter den Arm und stapfte davon. Adib sah ihr noch eine Weile nach, vielleicht würde sie sich ja umdrehen und ihm winken. Doch sie lief einfach weiter.
4
Karl träumte: Er stand mit den anderen auf der Brücke und sah den Feuerschein. Er hörte den Geschützdonner, er roch den stechenden Qualm, der aus den Geschützrohren wallte und der wie dichter Nebel über den Bäumen aufstieg und in ihre Richtung wehte.
»Sie kommen!«, rief eine Frau panisch und rannte weg. Sie war die einzige. Die anderen Menschen um Karl herum blieben wie gebannt stehen und sahen auf das Aufblitzen der Geschütze nicht weit von der Stadt entfernt. In ein paar Stunden würden sie da sein.
Man konnte das Rasseln der Panzerketten schon hören, das Brummen der Motoren. Die Handvoll Soldaten, die ebenfalls auf der Brücke stand und dafür sorgen sollte, dass die Russen nicht rüberkamen, sah genauso ängstlich aus wie der Rest der Bevölkerung. In diesem Moment dankte Karl stumm seiner Mutter, die ihm verboten hatte, sich zum Volkssturm zu melden. »Du bist noch zu jung«, hatte sie gesagt und ihn dabei streng angesehen. Wenn sie diesen Blick aufsetzte, gab es keinen Widerspruch, das wusste Karl. Seine Mutter war eine harte Frau, die sich durchsetzen konnte. Auch mit handfesten Argumenten, wenn es sein musste.
Er hörte sie seinen Namen rufen und sah sich nach ihr um. Sie stand neben Karls Schwester Hannah und Frau Kerb von nebenan und winkte ihm, ihr zu folgen. Zu viert gingen sie zurück in die Stadt, zu ihrer Wohnung, wo sie anfingen zu packen.
Als es klingelte, schraken alle zusammen. Es war Herr Levke von unten. »Frau Riedberger«, sagte er, wobei er seine Hände knetete. »Frau Kerb hat mir erzählt, dass sie packen.«
»Und?«, fragte sie und wollte die Tür schließen, aber Herr Levke schob seinen Fuß dazwischen. »Das sollten Sie nicht tun. Sie kennen doch den Tatbestand der Wehrkraftzersetzung. Nach Paragraf fünf der Kriegssonderstrafrechtsordnung …«
»Jaja, Herr Levke.«
»Das ist Feigheit«, schimpfte er.
»Ich nenne es Vernunft, Herr Levke«, sagte Karls Mutter, gab ihm einen Stoß und schloss schnell die Tür.
»Ich werde das melden. Darauf steht die Todesstrafe«, rief er draußen auf dem Flur. Sie hörten seine Schritte die Treppe hinunterpoltern. Seine Mutter lehnte schwer atmend an der Tür, Karl sah, wie ihre Hände zitterten.
»Und wenn er die Gestapo holt?«, fragte er.
Sie sah ihn aufmunternd an. »Das traut er sich nicht«, sagte sie.
»Aber im letzten Jahr hat er sie auch geholt. Und dann haben sie Herrn Schweigert abgeholt, weißt du noch, Mutti?« Sie nickte langsam mit geschlossenen Augen.
»Ja, aber diesmal hat er gar keine Zeit, jemanden zu holen.« Sie sah ihren Sohn an. »Die Russen stehen vor Waldenburg, mein Junge. In ein paar Stunden wird hier nichts mehr so sein, wie es war.«
»Aber wenn er doch die Gestapo holt«, warf Karl ein.
»Ich schätze mal, dass die Gestapo gerade selber ihre Sachen packt.« Damit ließ sie ihn stehen und ging wieder ins Schlafzimmer, um weiterzupacken. Karl folgte ihr.
»Wir können doch nicht einfach abhauen«, sagte er. Seine Mutter drehte sich zu ihm um. Sie waren etwa gleich groß, der Fünfzehnjährige und seine Mutter.
»Du suchst jetzt deine HJ-Uniform raus und dann verbrennen wir sie.«
»Verbrennen?«, brachte Karl mühsam hervor. »Du kannst doch nicht meine Uniform verbrennen.«
Sie drehte Karl an der Schulter zu sich. »Wenn die uns mit dieser Uniform erwischen, dann geht es uns schlecht. Was glaubst du, was sie mit den Leuten machen, die dem Führer gedient haben?«
Er war geschockt. Obwohl ein Teil von ihm wusste, dass Mutter recht hatte, weigerte sich ein anderer Teil, das Unausweichliche zu akzeptieren. Man konnte doch seine Vergangenheit nicht einfach verbrennen und ein anderer werden.
»Ich weigere mich, das ist Verrat!«, schrie er und spürte im gleichen Moment die schwielige Hand seiner Mutter auf der linken Wange und das Brennen, das sich sofort wie ein Feuer ausbreitete und seine Augen tränen ließ.
»Karl«, sagte sie versöhnlich und versuchte ihn in den Arm zu nehmen. »Der Krieg ist verloren. Niemand wird uns retten. Das müssen wir jetzt selbst in die Hand nehmen.«
Karl entzog sich ihr und ging in sein Zimmer, wo er sich aufs Bett hockte. Vor ein paar Monaten noch war sein Leben ganz anders gewesen. Normaler. Alles hatte seinen Platz gehabt. Jetzt war alles in Unordnung geraten. Er wusste ja, dass Mutter recht hatte, aber er wollte widersprechen, mit Worten die Ordnung wiederherstellen. Karl fragte sich, wo sie nun hingehen sollten. In Hamburg lebten Tante Elfriede und Onkel Walter. Doch die waren ausgebombt worden und lebten jetzt in einer Sammelunterkunft vor den Toren der Stadt. In Hannover wohnte Onkel Gernot mit seiner Tochter. Aber zu denen hatten sie kaum Kontakt.
Als es leise klopfte, rief Karl: »Herein.« Es war seine Mutter. Sie setzte sich neben ihn aufs Bett. Zusammen schwiegen sie eine Weile, bis sie sagte: »Es wird nicht mehr lange dauern. Wir müssen sehen, dass wir vorbereitet sind.« Karl nickte.
Doch es kam anders. Die Ausgänge der Stadt waren dicht. Niemand kam mehr raus. Und plötzlich brannte es an allen Ecken und Enden der Stadt. Karl sah die dunklen, rußigen Schwaden, die wie Schwärme grauschwarzer Vögel über den Himmel zogen. Er roch verbranntes Gummi, Holz, Öl, kokelndes Menschenfleisch, glühendes Metall. Er hörte das Rasseln der Kettenfahrzeuge auf dem Asphalt. Russische Soldaten waren plötzlich überall. Die fremde Sprache war in den Gassen zu hören und aus den geöffneten Fenstern der Häuser.
Wo kamen die plötzlich her?, fragte sich Karl.
Die Idee des Endsieges lag noch immer wie eine Schlammschicht in den Köpfen der Leute, und bei privaten Treffen hörte man sie verstohlen flüstern: »Ich habe gehört, dass der Führer noch ein Ass im Ärmel hat. Es wird nicht mehr lange dauern, dann werden diese Untermenschen wieder in ihre Höhlen zurückgejagt.«
Auch Karl klammerte sich an diesen Gedanken.
Eines Abends polterte es vor ihrer Tür, Gelächter war zu hören, dann hämmerte es, als schlüge jemand mit einem Gewehrkolben gegen das Holz. Mit einem Mal waren die Soldaten in der Wohnung, rissen Schränke auf, zerfetzten das Bettzeug auf der Suche nach Schätzen, schrien die Mutter an, schubsten Karl und strichen der kleinen Hannah über den Kopf. Die drei hatten sich aneinandergedrängt, hielten sich fest. In diesem Moment hätte keine Macht der Welt sie voneinander lösen können.
Nachdem die Soldaten alles auf den Kopf gestellt hatten, zogen sie wieder ab. Gepolter im Treppenhaus. Von unten hörten sie Herrn Levke, der wie ein Tier schrie. Dann ein Klatschen, Schluchzen, Türenknallen, Stille. Die drei sahen sich an, Tränen in den Augen, sie zitterten.
In den nächsten Tagen blieben sie in der Wohnung und trennten sich kaum; sie schliefen in einem Bett, saßen beieinander, gingen gemeinsam von einem Zimmer ins andere; selbst aufs Klo, das eine Etage tiefer war, marschierten sie zu dritt. Dann standen zwei vor der Tür und passten auf, während der andere auf der Brille hockte.
Zum Glück hatten sie Gläser voll Eingemachtes, sodass sie nicht hungern mussten. Stundenlang hockten sie am Fenster und sahen hinaus. Auf der Straße spielten sich unbeschreibliche Szenen ab: Russische Soldaten schlugen einem Mann, den sie gerade durchsucht hatten, mit dem Gewehrkolben gegen den Kopf. Es klang wie ein Knall. Der Mann hielt sich die blutige Stirn und taumelte weg. Menschen versuchten, einen weiten Bogen um die Soldaten zu machen, aber die waren einfach überall und nahmen sich, was sie wollten. Immer wieder drang Geschrei zu ihrer Wohnung hoch. Männergeschrei, Frauengeschrei, Kindergeschrei. Manchmal alles durcheinander, begleitet von den barschen Anweisungen der Russen. Über die Gehwege verstreut lagen Kleidungsstücke, als wäre ihren Besitzern plötzlich ungewöhnlich heiß geworden und sie hätten sich ihrer entledigt.
Gegenüber der Wohnung war die Sparkasse. Obwohl die Russen seit drei Tagen dort ein und aus gingen und die Tresore längst leer sein mussten, stiegen sie immer wieder durch die eingeschlagene Tür, über die Glassplitter hinweg, und durchsuchten lärmend die Räume. So ging es auch in den Geschäften, deren Schaufenster die drei von ihrer Wohnung aus sehen konnten. Wenn die Russen nichts fanden, wüteten sie lautstark und zerschlugen den Rest des Mobiliars.
Am dritten Abend sahen sie vier Soldaten, die eine splitternackte Frau durch die Straßen hetzten. Die Mutter befahl Karl und Hannah, sich die Augen zuzuhalten, aber sie hörten die Schreie der misshandelten Frau, die schon bald nicht mehr menschlich klangen.
Am vierten Tag kamen erneut russische Soldaten in die Wohnung und nahmen alles mit, was ihre Vorgänger verschmäht hatten, selbst das angeschlagene Porzellan sowie Vaters kaputten Wecker.
Am sechsten Tag standen wieder Soldaten vor der Tür. »Alles weg«, sagte Karls Mutter müde und machte eine hilflose Geste. Doch diesmal waren die Soldaten nicht zum Plündern gekommen, sie überbrachten einen Befehl: Die Familie sollte die Wohnung am folgenden Tag verlassen, eine polnische Familie würde einziehen. Glücklicherweise standen die Koffer mit dem Nötigsten gepackt im Keller und warteten auf ihren Abtransport. Die Schlüssel sollten von den Türen abgezogen und zusammengebunden auf den Küchentisch gelegt werden. Auf einem Zettel sollten sie notieren, welcher Schlüssel zu welcher Tür passte.
»Die sind ziemlich gründlich«, kommentierte seine Mutter die Anweisung und lächelte Karl schief an. Er lächelte zurück, dabei war ihm eher zum Weinen zumute.
Es war die letzte Nacht in ihrer Wohnung. Karl sah sich in seinem Zimmer um. Da, wo der helle Fleck an der Tapete zu sehen war, hatte bis vor wenigen Tagen ein Foto von Erwin Rommel gehangen, Karls Idol. Sie hatten das Bild hinten im Hof vergraben, genau wie Karls Messer von der Hitlerjugend mit der Gravur Blut und Ehre. Ebenso würden Karls Bücher dort vermodern. Die Bücher von Hans Grimm, die Bücher über die Bauernkriege, die Ostkolonisation, die Siedlerromane. Karl hatte das für übertrieben gehalten, aber seine Mutter hatte darauf bestanden. Sie wollte jede Verbindung zum Nationalsozialismus auslöschen. Er spürte, dass das nicht funktionieren würde. Sie waren und blieben Deutsche, ob sie sich nun als Hitler-Gegner oder -Freunde bezeichneten. Man würde sie büßen lassen. Polnische und auch russische Soldaten machten da keine Unterschiede.
Für ein paar Tage kamen sie bei einer Kollegin von Karls Mutter unter. Dreizehn Menschen in zwei Zimmern, dazu die bettlägerige, weggetretene Großmutter, die unentwegt schrie und davon überzeugt war, dass Karl ihr verstorbener Mann sei. Sie versetzten Schmuck, Geschirr, Betttücher, Tischdecken – ihre letzten Wertsachen –, um damit schimmeliges Mehl und faulige Äpfel zu überteuerten Preisen zu kaufen. Nach ein paar Tagen bekamen sie Lebensmittelkarten, aber das Essen wurde nicht besser.
Weil er es in der Wohnung nicht aushielt, trieb Karl sich tagsüber in der Stadt herum, was seine Mutter gar nicht gern sah. Doch die Erwachsenen waren zu beschäftigt, das Überleben zu organisieren, und so waren die Kinder auf sich allein gestellt.
Karl traf meist seine Freunde Adi und Mantsche auf dem Alten Markt. Ringsum waren die Häuser zerbombt, und die Ruinen standen da wie Gespenster, nur noch eine Ahnung ihrer früheren Existenz.
Die Freunde sprachen möglichst wenig miteinander, und wenn, dann nur leise. Denn manchmal wurden die fremden Soldaten wütend, wenn sie die deutsche Sprache hörten.
»Man sagt, dass die Russen alle hübschen Frauen in ihre Unterkünfte holen, und dann …« Mantsche ließ den Rest des Satzes offen.
»Und dann?«, fragte Adi und sah Karl an.

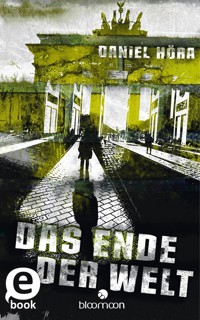
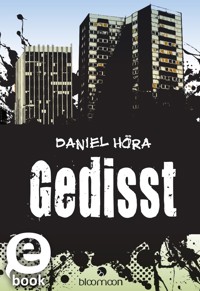













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












