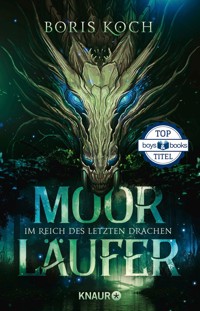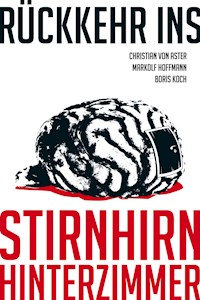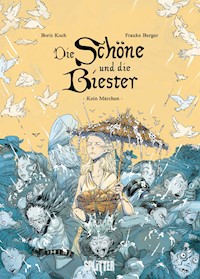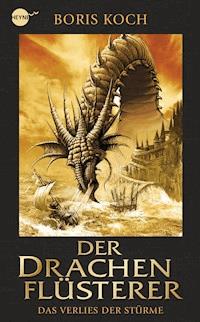14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Einst war die Rückseite der Wirklichkeit ein sicherer Ort …
Als die Brüder Leo und Felix nach einem Streit mit ihren Eltern aus der Welt gerissen werden, finden sie sich plötzlich allein auf einem gewaltigen Schiff in tiefster Nacht wieder. Die verwinkelten Korridore scheinen verlassen, doch schon bald müssen sie feststellen, dass grausame Monster das Schiff beherrschen und Hunderte Kinder und Jugendliche versklavt haben. Und immer noch wissen Leo und Felix nicht, wie sie eigentlich hierhergelangt sind, auf die Rückseite der Wirklichkeit. Eine Reise voller Schrecken beginnt, auf der sich die beiden gemeinsam mit neuen Freunden dem Grauen und der Finsternis stellen müssen, die das Schiff der verlorenen Kinder regieren – immer auf der Suche nach einem Weg zurück, heraus aus der Dunkelheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 696
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Buch
Als die Brüder Leo und Felix nach einem Streit mit ihren Eltern aus der Welt gerissen werden, finden sie sich plötzlich allein auf einem gewaltigen Schiff in tiefster Nacht wieder. Die verwinkelten Korridore scheinen verlassen, doch schon bald müssen sie feststellen, dass grausame Monster das Schiff beherrschen und Hunderte Kinder und Jugendliche versklavt haben. Und immer noch wissen Leo und Felix nicht, wie sie eigentlich hierhergelangt sind, auf die Rückseite der Wirklichkeit. Eine Reise voller Schrecken beginnt, auf der sich die beiden gemeinsam mit neuen Freunden dem Grauen und der Finsternis stellen müssen, die das Schiff der verlorenen Kinder regieren – immer auf der Suche nach einem Weg zurück, heraus aus der Dunkelheit.
Der Autor
Boris Koch, Jahrgang 1973, wuchs auf dem Land südlich von Augsburg auf und leistete Zivildienst in einer Kinderpsychiatrie. Später brach er das Studium von Geschichte und Literatur zugunsten des Schreibens ab und hat seitdem über dreißig Bücher veröffentlicht. Er war Mitbegründer der Berliner Lesebühne Das StirnhirnhinterZimmer und textet Comics. Heute lebt er zusammen mit der Autorin Kathleen Weise und der gemeinsamen Tochter in Leipzig. Seine Werke wurden in mehrere Sprachen übersetzt und mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Krefelder Preis für Fantastische Literatur 2023.
Mehr über Boris Koch und seine Werke finden Sie auf boriskoch.de und instagram.com/autorboriskoch.
Boris Koch
Das Schiff
der verlorenen
Kinder
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 by Boris Koch
Copyright dieser Ausgabe © 2025 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktion: Kathleen Weise
Umschlaggestaltung und -motiv: Markus Weber, Guter Punkt, München,
mit einer Illustration von Iman Zeherovic
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-32662-3V002
www.heyne.de
Für Frauke Berger, die der Rückseite der Wirklichkeit ein erstes Gesicht gegeben hat
Für Martin und Mecki, für die Sommernächte auf dem Atelier und überhaupt
Und für alle, die sich nach der Nimmersee sehnen
I
Nacht
»Exit light Enter night Take my hand We’re off to never-never land«
Metallica, Enter Sandman
»Natürlich war das Nimmerland damals nur Einbildung gewesen. Aber nun war es wirklich. Es gab keine Nachtlichter, und es wurde mit jedem Augenblick finsterer …«
James M. Barrie, Peter Pan
»Kurz scheint das Leben dem Glücklichen, doch wer im Elend, dem scheint selbst eine Nacht unendlich lange zu währen.«
Lukian von Samosata, Epigramme, Nr. 5
EINS
Nichts
1
Nichts deutete an jenem verregneten Oktobernachmittag darauf hin, dass in wenigen Minuten zwei Kinder spurlos verschwinden würden. Und schon gar nicht, wie dies geschehen sollte.
Sie würden weder von sich aus davonlaufen noch von Verbrechern oder Verwandten entführt werden – und natürlich würden sie sich auch nicht einfach so in Luft auflösen.
Letztlich könnte man es vielleicht als eine Mischung aus alldem bezeichnen, doch die Wahrheit würde niemand vermuten, nachdem das Verschwinden der beiden endlich bemerkt werden würde. Stunden nachdem sie in ihr Zimmer gegangen waren, um in Ruhe zu spielen, wie der Vater der Polizei mitteilen würde. Er war angetrunken und wütend auf der Suche nach einem Schuldigen.
Das Zimmer läge verlassen da. Als sei es ohne die Kinder nur halb vorhanden, eine abgestreifte Hülle, eine leblose Kopie ohne Seele.
»Sie waren so ruhig«, würde die aufgelöste Mutter ergänzen. »Ich dachte einfach, heute streiten sie mal nicht und sind brav.«
»Streiten sie oft?«, würde die Polizei nachhaken, aber es wäre mehr ein Stochern im Dunkeln als das Verfolgen einer konkreten Spur.
»Es sind Brüder«, würden die Eltern einhellig antworten, als wäre das Erklärung genug. »Aber Felix tut niemandem etwas und Leo seinem Bruder nichts. Sie haben auch keinen Grund, davonzulaufen.«
Man würde davon ausgehen, dass die beiden sich trotzdem rausgeschlichen hatten, eine dumme Idee gelangweilter Kinder (»Rotznasen«, würde der Vater sie nennen) oder die Lust auf ein Abenteuer. Alle würden sich an die Hoffnung klammern, dass die beiden nicht Opfer eines Verbrechens geworden waren, sondern nur bei irgendeinem verbotenen Spiel die Zeit vergessen hatten.
Entgegen aller Hoffnung würden die Brüder in dieser Nacht jedoch nicht zurückkehren. Und auch nicht am nächsten Tag. Trotz aller Bemühungen würde die Polizei nicht die geringste Spur finden, und alle würden sich ganz langsam an den Gedanken herantasten, dass den beiden das Allerschlimmste zugestoßen war.
2
Noch aber waren die beiden nicht verschollen, noch schien es ein ganz normaler stürmischer Samstag zu sein. Der Wind warf den Regen in Böen gegen die Fensterscheiben der Wohnung, und Leo Pfeiffer trug sein struppiges Bärenfell über den Schultern. Er hatte sich ins Bad zurückgezogen, um in der Wanne nach Lachsen zu fischen.
Eigentlich wusste er, dass er mit seinen zwölf Jahren zu alt für solche Spiele war, das hatte sein Vater ihm oft genug gesagt. Doch wenn ihn niemand aus der Schule sah und er Lust dazu hatte, tat er es manchmal trotzdem. Er mochte Bären und liebte das Fell. Es war ein Erbstück seines Opas und echt. Sollte ihn irgendwann jemand beim Spielen erwischen, konnte er jederzeit seinen zweieinhalb Jahre jüngeren Bruder Felix vorschieben und behaupten, dass er nur mit ihm spielen würde. Dann wäre es nicht peinlich, sondern Leo wäre ein guter älterer Bruder. Etwas, das er gern und auch meist war.
Obwohl Leo nach dem König der Tiere benannt worden war, wollte er im Spiel immer ein Bär sein – nicht nur, weil er das passende Fell besaß. Er bewunderte die Größe des Grizzlys und sein Geschick beim Fischen, die Wucht eines angreifenden Eisbären und dessen Unempfindlichkeit gegen Kälte. Egal wie behäbig Bären wirkten, sie waren flink und konnten trotz ihres Gewichts auf Bäume klettern, das hatte er in Dokumentationen gesehen. Ihre Zähne und Klauen waren mächtige Waffen, und das dichte Fell bot gegen fast alles Schutz, nicht nur gegen die Kälte. Sie waren geschickt genug, um Honig zu stehlen, und zäh genug, die Stiche wütender Bienen auszuhalten. Bären waren oft Einzelgänger und konnten so vieles, während Löwen einfach nur als besonders mutig galten.
Dabei zweifelte Leo diese sprichwörtliche Tapferkeit auch noch an. Denn wer weithin der Stärkste war, der anerkannte König der Tiere, die unangefochtene Spitze der Nahrungskette, der benötigte keinen Mut, um laut zu brüllen und über die Savanne zu herrschen. Jedes Tier auf seiner Speisekarte braucht mehr Mut als er, war Leo überzeugt.
Der Ursprung seiner Faszination für Bären war Opa Erwins altes Fell gewesen, das im Wohnzimmer seiner Großeltern gehangen hatte. Als Leo fast vier gewesen war, starb sein Opa, aber Oma Sabine hatte das Fell hängen lassen. Sie wollte an der Wohnung nichts verändern und gab nur heraus, was ihre Kinder mit Vehemenz für sich beanspruchten. Opas silberne Taschenuhr, die er selbst von seinem Vater geerbt hatte, die Münzsammlung, die Briefmarken und alles andere, was möglicherweise Wert besaß. An dem alten Fell hatte damals niemand außer Leo Interesse gezeigt.
Bei jedem Besuch hatte er es anfassen wollen, sobald er in die Wohnung gekommen war. Sanft hatte er es gestreichelt, fast scheu, als könnte der Bär jederzeit wieder lebendig werden und nach ihm schnappen. Das Fell schien ein Fremdkörper in dieser sauberen, aufgeräumten Wohnung zu sein, es passte viel eher in eine Abenteuergeschichte aus einer anderen Zeit.
Leos Erinnerungen an Opa Erwin verblassten schon bald, er war einfach zu jung gewesen, als dieser gestorben war. Doch während aus der Wohnung der Großeltern bald Omas Wohnung wurde, aus dem Schlafzimmer Omas Schlafzimmer und aus den Möbeln Omas Möbel, blieb das Fell weiterhin Opas Fell, und damit blieb auch etwas von ihm zurück.
Als Oma Sabine knapp sechs Jahre später, inzwischen gebeugt und dement, ins Heim gekommen war, und die verbliebene Einrichtung verteilt, verkauft oder weggeschmissen werden sollte, hatte Leo sich sofort das Fell gegriffen und hoch und heilig geschworen, Oma habe es ihm schon lange versprochen.
»Sie hat es nur vergessen; sie vergisst doch alles! Bitte!«
Da sein Vater das Fell nicht selbst wollte, hatte er mit den Schultern gezuckt und gesagt: »Meinetwegen.« Ihm war nur wichtig, dass seine Geschwister es nicht bekamen. »Es ist nicht viel wert.«
»Darum geht es doch nicht!«
»Wenn du meinst. Aber du trägst es selbst.«
Glücklich hatte Leo es sich über die Schultern gelegt, während Felix noch immer die Bücher und das Spielzeug in der Hoffnung auf einen besonderen Fund durchwühlte.
Das Fell stammte von einem Schwarzbären und war alt und zottig; der Kopf fehlte, seit Leo denken konnte. Da, wo es das Herz bedeckt hatte, prangte ein daumendickes rundes Einschussloch. Als Leo alt genug gewesen war, um zu fragen, wie das Fell in Opas Besitz gekommen war, hatte die Vergesslichkeit Oma Sabine schon zu fest im Griff.
Mit einem entschuldigenden Lächeln hatte sie gesagt: »Von seinen Reisen, da war ich nicht dabei.«
Also hatte sich Leo die Reisen ausgemalt, Abenteuer um Abenteuer, und jedes einzelne machte den Großvater zu einem Helden und das Fell zu Leos wertvollstem Besitz, ganz gleich, was ein anderer dafür bezahlt hätte.
Jedes Mal, wenn er es sich überwarf, verwandelte er sich in einen Bären. Nicht in den, den sein Opa vielleicht erschossen hatte, sondern einen, der besonders wild und frei und am Leben war. Und egal was die Eltern sagten, Leo wusste, dass er nicht zu alt war, um davon zu träumen, wild und frei zu sein.
3
Am Nachmittag des Verschwindens war Leo so vertieft in die Jagd auf Lachse, dass er das laute Prasseln des Regens kaum wahrnahm, auch nicht die aufgeregten Rufe des Fußballkommentators aus dem Wohnzimmer. Wieder und wieder schlugen seine Hände wie schwere Tatzen ins Wasser und schnappten nach Shampooflaschen und Duschgeltuben, die als Fische durch die volle Wanne flutschten. Welle um Welle schwappte über den Rand heraus ans Ufer, und so tobte drinnen bald ein wilderer Sturm als draußen.
Die Zähne hungrig gefletscht, kniete Leo auf den harten Fliesen, und für ihn waren es Felsen am Fluss. Das Badezimmer um ihn herum verblasste, mächtige Bäume ragten in den geträumten Himmel, die Welt war weit und einsam, ganz ohne Menschen, sogar ohne jeden Gedanken an sie. Dabei durchnässte Leo die Handtücher am Waschbecken ebenso wie den dicken Bademantel seiner Mutter am Haken hinter sich an der Wand. Die Lachse waren flink und glitschig, und die Wellen schlugen immer höher.
Fauchend richtete sich Leo auf den Felsen auf, er war der Herr der Klippe. Weit holte er mit den mächtigen Tatzen aus – zu weit. Mit dem Handrücken fegte er zwei Zahnputzbecher mit Bürsten von der Ablage des Waschbeckens, dazu den Rasierer seines Vaters samt Pinsel, den dieser zum Geburtstag bekommen hatte. Laut prallte alles auf den Boden, die Becher rollten in großem Bogen davon, Bäume und Himmel fielen in sich zusammen.
Von einem Augenblick auf den nächsten war Leo wieder von Wänden umgeben, und Vaters Stimme drang zu ihm herein. »Was ist da los, verdammt noch mal?« Lauter als der Fernseher.
»Nichts!«, versicherte Leo schnell und wandte sich zur Tür. Sie war nur angelehnt, und er verfluchte sich selbst dafür, sie nicht geschlossen zu haben. »Gar nichts!«
Aber es war zu spät, er war zu laut gewesen.
Die Tür wurde aufgerissen, der Vater stand im Rahmen, ein Bier in der Hand. Es war nicht das erste, obwohl der Anstoß vor gerade mal einer Viertelstunde erfolgt war. Samstags musste er nicht in den Betrieb, und die Bundesligaübertragung war sein festes Ritual, bei dem er nicht gestört werden wollte. Auch heute schaute er, obwohl seine Eintracht bereits gestern verloren hatte, und schimpfte auf Schiedsrichter, Söldner und die ganzen Scheißmillionäre.
»Nichts?«, wiederholte der Vater, die Augen vor Wut verkniffen, die dichten Brauen zusammengezogen.
Er hatte das gleiche dünne braune Haar wie Leo, nur nicht ganz so kurz geschnitten, und erste Anzeichen von Geheimratsecken zeigten sich auf seiner Stirn. Die Schultern schienen stets herabzuhängen, alles an ihm wirkte merkwürdig unterdrückt; Freude, Gedanken, sogar die unentwegt in ihm brodelnde Wut.
Doch die konnte jederzeit ausbrechen, wenn er nur einen Grund erhielt, das wusste die ganze Familie. Wer störte, bekam Ärger. Alle anderen wurden in Ruhe gelassen und ignoriert, bis der Vater sie brauchte.
Rasch duckte sich Leo. Nun war er wieder ein Junge, sogar jünger und kleiner, als er tatsächlich war. Das Bärenfell hing ihm lose um den Hals wie eine zu große Verkleidung.
Doch alles Ducken half nicht, der Vater packte ihn hart am Nacken und drückte ihn noch weiter nach unten. Ein Schluck Bier schwappte aus der Flasche.
»Nichts?«, schrie der Vater, tief über Leo gebeugt, den Mund ganz nah an seinem Ohr. »Das nennst du nichts?« Er presste Leos Gesicht beinahe in die Pfütze auf den Fliesen, die Nase direkt vor den Rasierer und Felix’ leuchtend blaue Zahnbürste mit den zerkauten Borsten.
Leo spannte die Muskeln an und versuchte, dem Druck des Vaters etwas entgegenzusetzen, sich hochzustemmen, aber nur für einen Augenblick. Es war kein richtiger Widerstand, mehr ein vorsichtiges Ausloten der Chancen, ein Vergleichen der Kräfte, wie er es immer wieder tat. Noch war er zu schwach für einen echten Kampf, er träumte nur davon, wieder und wieder. Er wuchs und wartete – und lernte einzustecken. Seine drahtigen Arme zitterten vor Anstrengung und Angst, in die Klinge des Rasierers gedrückt zu werden. Leo wusste nicht, wie tief ein Schnitt gehen würde.
»Du hebst das alles auf!« Sein Vater verstärkte den Druck, und Leos Gesicht knallte knapp neben der Klinge auf die Fliese. »Sofort!«
»Ja.« Seine Stimme war dünn, er fühlte sich schwach und gedemütigt. Er sehnte sich danach, endlich stark genug zu sein, um sich wehren zu können.
»S O F O R T!«, wiederholte der Vater nachdrücklich, weil er das immer tat, als würde irgendwer ihm nicht sofort gehorchen. »Und was kaputt ist, bezahlst du von deinem Taschengeld.«
»Ja«, wiederholte auch Leo, weil sein Vater auch jede Unterwerfung doppelt hören wollte.
»Und dann wischst du hier trocken!« Er versetzte Leo einen kräftigen Klaps auf den Hinterkopf, weil das noch niemandem geschadet hätte, wie er meinte; im Gegenteil, das wäre gut für das Gedächtnis, denn so würde man seine Aufgaben nicht vergessen, und auch nicht den Respekt, den man seinen Eltern schuldete.
Im Wohnzimmer wurde in Dolby Surround gejubelt, und der Vater knurrte: »Verflucht! Jetzt habe ich das wegen dir verpasst.« Nach einem erneuten Klaps ließ er von Leo ab, um auf die Couch zurückzukehren. Dabei drohte er: »Wenn du trödelst, macht deine Mutter dir Beine!«
Das tat er so laut, dass Leos Mutter es hörte und auch ohne direkte Ansprache wusste, was sie zu tun hatte.
Doch noch bevor sie sich auf den Weg machte, Leo zu überwachen, war schon Felix da, um nach seinem Bruder zu sehen. Das dichte dunkelblonde Haar verstrubbelt, der Blick der blaugrünen Augen besorgt. Sein Gesicht war runder als Leos, alles an ihm schien weicher.
»Schnell, komm her!«, verlangte Leo und versuchte, wieder zu einem Bären zu werden, wild und frei und mächtig.
»Bist du in Ordnung?«
Leo überging die Frage. Nichts war gebrochen, in Nacken und Gesicht würden blaue Flecken bleiben, aber dafür würde er schon eine Erklärung finden. Das tat er immer. Er hatte ständig irgendwelche Blessuren, ging jedoch aufrecht und erzählte in der Schule lässig von Siegen gegen ältere Jungs irgendwo in der Stadt, von Sportunfällen und coolen Stürzen mit dem Bike. Weil er drahtig und zäh war, groß gewachsen und von Gleichaltrigen nicht leicht einzuschüchtern, wurden seine Lügen auch geglaubt. Oder zumindest wie eine Wahrheit akzeptiert.
Hastig warf er seinem Bruder drei eingedrückte Lachse vom Boden aus zu. »Los, bring sie in Sicherheit.« Er würde weiterspielen, egal was der Vater sagte, und sei es nur aus Trotz. Er würde mit Felix spielen, der freute sich meist darüber und legte dafür sogar seine geliebten Bücher zur Seite, was er sonst nur selten tat. Oft las er sogar auf der Toilette weiter, um nur ja keine Sekunde zu verschwenden.
Gehorsam stopfte sich Felix die nassen Shampooflaschen unter den Pullover und huschte gebückt davon, während sich dunkle Wasserflecke auf der Wolle abzeichneten. Würde er erwischt werden, bekäme er von allen Seiten Ärger.
Doch die Mutter war viel zu sehr in ihr Handy vertieft, um ihn zu beachten. Nicht ein einziges Mal hob sie den Blick vom Display, während sie sich langsam dem Bad näherte. Die unauffällige neue Brille war ihr ein Stück die Nase hinuntergerutscht, das ließ ihr schmales Gesicht weniger streng wirken. Doch das täuschte. Die aufeinandergepressten Lippen und hängenden Mundwinkel täuschten hingegen nicht.
»Du hast deinen Vater gehört!«, fuhr sie Leo an. »Also beeil dich, ich habe Besseres zu tun, als dich zu beaufsichtigen.«
»Ja«, brummte er. Schweigend wischte er das Wasser auf und wrang Lappen um Lappen über der Wanne aus. Darin schwammen nun keine Lachse mehr, nur halb leere Plastikbehälter. Der Regen klatschte weiter gegen das Fenster, die Bäume an der S-Bahn-Linie gegenüber rauschten, und auf Leos Stirn bildete sich eine Beule.
Sein Magen knurrte, die Arbeit und die Gedanken an Lachse hatten ihn hungrig gemacht.
Seine Mutter wischte ungeduldig über das Smartphone, überflog hier und da die ersten zwei Sätze und tippte hastig kurze Kommentare (oft auch nur ein, zwei Emojis) oder teilte Bilder. Bilder waren schneller als tausend Worte. Abgesehen davon ließ die Zeichenbeschränkung für Postings sowieso keine tausend Wörter zu. In ihrem Gesicht zuckte es, manchmal presste sie die Lippen missbilligend aufeinander, manchmal nickte sie zustimmend, wenn auch seltener. Zustimmung lag weder in ihrer Natur noch in ihrem Algorithmus.
Als der Boden trocken war, erhob sich Leo und stellte Zahnputzbecher, Rasierer und Pinsel zurück an den Rand der Ablage. Daneben standen Vaters Deo und das Parfum, das er Mutter geschenkt hatte. Leo war froh, es nicht auch runtergeworfen zu haben. Wäre die Flasche zerbrochen, hätte es noch mehr Ärger und Vorträge über Geld gegeben, obwohl der Vater das Parfum immer im Sonderangebot kaufte.
Aber der Rabatt wird an den Ärger und die Vorträge nicht weitergegeben, schoss es Leo durch den Kopf.
Noch bevor er den Putzeimer aufräumen konnte, befand seine Mutter: »Wenn du schon dabei bist, kannst du eigentlich gleich die ganze Wohnung wischen.«
»Davon hat Papa nichts gesagt.«
Zum ersten Mal hob sie den Blick. »Aber ich sage das.«
»Bären putzen nicht für andere!«, erwiderte Leo trotzig und trocknete sich die feuchten Hände an der Hose ab.
»Nun, dann kann der feine Bär sich gern in seine Höhle verziehen!«
»Aber …«
»Ab ins Zimmer! Keine Widerrede!«
Das war nicht schön, aber besser, als die Wohnung zu wischen. Sein Magen knurrte wieder, und so stapfte Leo kurz entschlossen in Richtung Küche, um sich noch irgendetwas Essbares zu holen, einen Landjäger, Schokoriegel oder Apfel, egal was. Beim Gedanken an einen saftigen grünen Apfel lief ihm das Wasser im Mund zusammen, und er hoffte, der Apfel wäre richtig sauer, so mochte er sie am liebsten.
Er war jedoch noch keine drei Schritte weit gekommen, als die Mutter hinter ihm blaffte: »He! Was glaubst du, wohin du gehst?«
»Ich hol mir nur schnell …«
»Nichts! Du holst dir nichts!«
»Aber ich habe …«
»Das ist mir egal! In dein Zimmer, habe ich gesagt!« Ihre Stimme war durchdringend und vibrierte, als würde sie sich gleich überschlagen, aber das tat sie nie. Die Mutter wusste, wie man schrie.
»Was ist denn jetzt schon wieder, verdammt noch mal?«, drang Vaters Stimme herüber, und das beendete alle Diskussion und Widerworte.
»Nichts!«, rief Leo und drehte ab, bevor die Mutter antworten und ihn verpetzen konnte. Bevor sein Vater aufstehen und herüberkommen würde, weil die Wut ihn stärker packte als das Spiel. Bevor alles noch viel schlimmer wurde. Vielleicht hatte Felix ja noch irgendwo im Zimmer eine Tüte Gummibären versteckt.
Doch vermutlich war da nichts, Felix aß seinen Süßkram schnell und gründlich.
Nichts. Das war das Wort, das sie in ihrer Familie am häufigsten verwendeten.
Nichts war, wenn man gefragt wurde.
Nichts galt.
Nichts kümmerte irgendwen.
Nichts stand einem laut dem Vater zu.
Nur Streit und Ärger gab es zuhauf, und die Mutter sagte immer, das zeige nur, dass die Kinder dem Vater nicht egal seien. Aber Leo war davon überzeugt, dass sie dem Vater vollkommen gleichgültig waren, solange sie ihn, seinen Ruf und seinen Frieden nicht störten. Dabei wusste sein Vater mit Frieden gar nicht viel anzufangen. Was er verlangte, war lediglich Ruhe zu seinen Bedingungen.
»Knall nicht die Tür!«, rief die Mutter Leo hinterher, als er durch den kurzen, überfüllten Flur stürmte.
Dort balancierten Pfandflaschen auf Altpapiertürmen, Felix’ graugrüne Windjacke war von der Garderobe gefallen, drei Rücksendungen warteten darauf, zur Post gebracht, und zwei Dutzend andere Dinge darauf, auf die Zimmer verteilt oder weggeworfen zu werden. Bis dahin wuchsen sie an den Wänden in die Höhe wie Unkraut und verdeckten längst die Hälfte der Familienfotos, die dort hingen; die älteren aus dem Urlaub am Meer waren gerahmt, immer Italien zum Abschluss der Ferien, weil sich die Eltern da schon auskannten.
Natürlich schmetterte Leo die Tür hinter sich so fest zu, wie er nur konnte. Extra für die Mutter. Mit einem lauten Knall fiel sie ins Schloss, und draußen grollte der Donner lang und tief wie der Vorbote von Unheil in einem Horrorfilm.
Ich wollte doch nur einen Apfel!, schimpfte Leo in Gedanken. Sein Magen knurrte, und er trat gegen die Tür.
Der Regen wurde stärker, die Wolken wurden dunkler. Sie tauchten das Zimmer immer tiefer in Dämmerlicht.
Felix hatte die Lachse mitten auf dem Teppich zwischen den Betten abgelegt. Sie lagen kreuz und quer, zwei Deckel waren aufgeklappt, aus einem quoll dickflüssiges blaues Blut.
»Ich habe gesagt: Nicht knallen!«, drang es herein. »Zur Strafe bleibst du den ganzen Tag im Zimmer! Ich will nichts mehr hören und dich heute nicht mehr sehen!«
»Ich dich nie wieder!«, schrie Leo voller Zorn zurück, und das war befreiend. Nie wieder!
Manchmal stellte er sich vor, er würde an seinem achtzehnten Geburtstag ganz früh aufstehen, viel früher als alle anderen, und dann würde er noch im Dunkeln gehen, einfach nur fort, frei wie ein Bär in der Wildnis, irgendwohin.
Aber Leo wusste, das würde er in der Wirklichkeit nicht tun. Er würde Felix nicht allein bei ihnen zurücklassen, weil der dann alles abbekäme, und Felix war nicht so zäh wie Leo. Gut möglich, dass der Kleine daran zerbrechen würde. Und so träumte Leo genauso oft von Felix’ achtzehntem Geburtstag, auch wenn der noch ferner lag, und davon, mit ihm zusammen in der Morgendämmerung zu verschwinden.
»Dann bleibst du eben für immer da drin!«, schrie die Mutter, während sie sich entfernte.
»Mir doch egal! Wir haben Lachse!«
Sie sollte nur nicht glauben, dass der Hunger ihn heraustrieb. Leo würde nicht betteln und einknicken, diesmal nicht, das schwor er sich. Eher würde er aus dem Fenster klettern und sich und Felix vom Geld aus der Spardose einen Döner oder Pommes holen. Die Wohnung lag im ersten Stock, das Risiko eines Sturzes schien ihm überschaubar. Für einen kurzen Moment dachte er daran, die Tür zu verbarrikadieren, denn wenn er nicht mehr rausdurfte, durfte sie auch nicht rein. Einen Schlüssel für das Zimmer besaßen sie nicht, den hatte der Vater mit allen anderen für die Wohnung einbehalten.
Es donnerte erneut, diesmal kurz und brechend laut, sodass die Fensterscheibe wackelte. Vor Schreck zuckte Felix zusammen, und Leo dachte: Das muss direkt über unserem Haus sein.
Im nächsten Moment herrschte Stille.
Eine vollkommene Stille, wie sie Leo noch nie erlebt hatte. Selbst der Regen vor dem Fenster war auf einen Schlag verstummt. Alle Geräusche, der Fernseher ebenso wie der Verkehr vor dem Haus. Der Wind pfiff nicht mehr, kein Vogel schrie, kein Kind rief, kein Hund bellte, kein Nachbar tat irgendetwas, keine Diele knarzte.
Dieser Moment der vollkommenen Stille war so unheimlich, dass sich die Härchen auf Leos Armen wie elektrisch geladen aufstellten und Felix sich gehetzt umsah wie ein in die Ecke gedrängtes Kaninchen.
Die Stille hielt nicht länger als einen Augenblick an, trotzdem schien sie Leo ewig und überwältigend. Sein Herz raste, seine Handflächen wurden klamm. Instinktiv hielten Felix und er die Luft an, und Leo war ganz sicher, dass gleich etwas geschehen würde. Irgendetwas, das …
4
Wie aus dem Nichts erhob sich plötzlich ein Knirschen um sie herum, es schien aus den Wänden zu kommen, tief aus dem Mauerwerk, aus dem Boden und der Decke.
Ein Knirschen wie von einem fallenden Baum, wenn das letzte Holz splitterte; und Leo glaubte sofort, irgendetwas würde zerreißen.
Etwas Großes.
Er erstarrte.
Ein Zittern durchlief das Zimmer, stärker, als wenn die Waschmaschine nebenan im Schleudergang lief. So wie damals, als die Straße der Großeltern aufgerissen worden war, um ein Rohr zu verlegen.
Es gab einen leichten Schlag, und Leo dachte an zwei Züge, die im Bahnhof aneinandergekoppelt wurden. Dann erklang ein lautes doppeltes Klicken, als würde eine große Mechanik, wie die einer Kirchturmuhr, einrasten. Aber der Bahnhof und die nächste Kirche waren fern. Ratlos starrte er Felix an, und der sah zurück, verwirrt und verängstigt.
Wieder erklang das Knirschen, doch diesmal nicht gedämpft, und Leo war sich sicher, dass etwas zerbrochen war, etwas Großes. Ein Riss in der Mauer einer gewaltigen Festung, die vor einem Erdbeben einknickte. Das Knirschen war laut und deutlich zu lokalisieren, und die Brüder wirbelten herum, die Arme schützend hochgerissen.
Doch nichts konnte sie vor dem Anblick schützen, der sich ihnen bot.
Das Fenster über dem Schreibtisch war verschwunden, und an seiner Stelle saß – wie selbstverständlich – ein riesiges rundes Bullauge.
Der umlaufende Bronzerand war breit und das Glas fest mit ihm verbunden; es gab weder Scharniere noch einen Griff, um es zu öffnen. Im Verputz hatten sich kleine Risse gebildet, doch auf dem Boden lag kein bisschen Staub.
Auch jenseits des Bullauges hatte sich alles verändert, der graue Nachmittag samt Regen, Wind, Wolken und Donner war verschwunden, draußen herrschte plötzlich Nacht. Tief am Himmel hing ein gewaltiger Vollmond, viel größer, als Leo ihn je gesehen hatte.
Für einen Moment setzte sein Herz aus, dann schlug es viel zu schnell. Kein Wort kam ihm über die Lippen, doch er dachte: Das passiert nicht! Das kann nicht passieren, nichts davon!
Nichts!
Nichts!
Nichts!
Verzweifelt klammerte er sich an das Wort seiner Familie, doch es half nichts. All das – was auch immer es war – war bereits geschehen.
Alles.
Das Gegenteil von Nichts.
Weder das Bullauge noch die Nacht lösten sich wieder auf, nur das Knirschen war verstummt.
Der Baum ist gefallen.
5
Felix fand als Erster die Sprache wieder, aber viel brachte er nicht heraus, lediglich: »Was … ist das?« Dabei drängte er sich an Leo, zitternd vor Angst.
»Ich weiß nicht«, erwiderte Leo und hielt Felix fest.
Auch er hatte Angst, aber nicht genug, flüsterte etwas in ihm. Müsste er nicht schreien vor Entsetzen, sich in die Hand beißen, in Ohnmacht fallen oder blindwütig um sich treten? Doch er tat nichts dergleichen. Vielleicht war es der Schock, vielleicht riss er sich einfach nur für Felix zusammen. Er war der Ältere, ein Löwe dem Namen nach und ein Bär in den eigenen Träumen.
Er fragte sich, was ein echter Bär in einer solchen Situation tun würde, aber er wusste es nicht. Er wusste nicht, was irgendwer in einer solchen Situation tun würde, denn solche Situationen konnte es nicht geben. Es kam ihm vor, als wäre die Wirklichkeit auseinandergefallen. Wie ein aufgebrochenes Ei lag sie vor ihm.
Und doch waren das Bullauge, der Mond und die Nacht hier. Er klammerte sich an die Hoffnung, dass sie von einem Moment auf den anderen wieder verschwinden würden, einfach so, wie sie auch gekommen waren.
Aber tief im Innersten wusste er, dass das nicht geschehen würde.
Es geschah auch nicht.
Leo spürte, wie sich Felix immer fester an ihn klammerte und stärker zitterte, und er zog seinen Bruder noch fester an sich.
»Komm«, flüsterte er und ging langsam mit Felix die fünf Schritte zum Bullauge hinüber. Den Schreibtisch davor schoben sie zur Seite.
Er musste wissen, wie die Menschen auf der Straße auf die unvermittelt hereingebrochene Nacht und den gewaltigen Mond reagierten. Er wunderte sich, weshalb nicht schon längst Schreie und Hupen erklangen. Vielleicht war die Scheibe des Bullauges so dick, dass sie jedes Geräusch schluckte.
Felix drängte sich so dicht an ihn, dass Leo seinen Herzschlag durch die Kleidung spüren konnte. Gemeinsam sahen sie hinaus.
Draußen schrie und hupte deshalb niemand, weil dort niemand war.
Die Straße war verschwunden wie die Sonne und der Tag, ebenso die dicht gedrängten Nachbarhäuser, die überfüllten Parkbuchten und der begrünte Damm mit den S-Bahn-Schienen, die mickrigen Bäume in den beschmierten Betonkästen und die hohen grauen Straßenlampen. Nichts war geblieben von ihrer Straße, ihrem Viertel, der ganzen Stadt.
Nichts.
Unter dem unnatürlich großen Mond erstreckte sich ein dunkles Meer bis zu einem Horizont, der in der Dunkelheit nicht auszumachen war. Irgendwo mussten Wasser und Himmel aufeinanderstoßen, doch wo, verlor sich in der undurchdringlichen Schwärze.
Im Nichts.
6
Sie pressten die Stirnen gegen die Scheibe und blickten hinab, aber auch da war nur das Meer zu erkennen, bestimmt zwanzig Meter unter ihnen, vielleicht auch dreißig. Sie befanden sich viel höher als im ersten Stock, in dem sie wohnten, und die Scheibe war wärmer, als es ihr echtes Fenster gewesen war, wenn auch nicht so heiß wie an einem brütenden Sommertag. Welle um Welle rollte heran, der sich spiegelnde Mond glitzerte auf dem schwarzen Wasser, in bleiche, zitternde Splitter zerbrochen.
Felix murmelte: »Es sieht fast aus, als hätten die Wellen Zähne …«
»Unsinn!«, widersprach Leo sofort. »Du hast zu viel Fantasie. Wellen beißen nicht.« Wenigstens daran wollte er noch glauben, auch wenn er nicht wusste, was sonst noch galt, jetzt, da die Nacht sie verschlungen hatte wie ein lebendig gewordener Albtraum.
»Wir haben auch kein Meer vorm Haus!«
»Ich weiß, verdammt!« Leo konnte den Blick nicht vom Wasser abwenden, das nicht hier sein durfte, unter einem knochenbleichen Mond, der viel zu groß war und zu nah. So als würde er schon bald auf die Erde stürzen und sie alle unter sich begraben.
Das ist es, das Ende der Welt.
Aber das sagte Leo nicht, stattdessen murmelte er: »Wir sind nicht mehr daheim …«
»Aber wo sind wir dann?« Felix drehte sich um, ohne sich ganz von Leo zu lösen. »Das ist unser Zimmer! Oder nicht?«
»Doch, schon …«
»Dann müssen wir auch daheim sein, oder?«
Felix hatte zahlreiche Bücher gelesen, in denen die Helden einen Weg in andere Welten oder in eine magisch verborgene Gasse fanden, und er hatte sie in Gedanken begleitet, hatte mit ihnen mitgefiebert, war selbst zu ihnen geworden. Doch in diesen Geschichten waren die Helden stets selbst durch das Tor oder den Schrank oder das Kaninchenloch gegangen, nur Dorothy und Toto waren samt ihrem Haus von einem Wirbelsturm erfasst und fortgetragen worden. Aber auch diese beiden hatten sich wie alle anderen von hier nach da bewegt; die andere Welt war nicht einfach vor ihrem Fenster aufgetaucht und hatte sie verschlungen, während sie nichts getan hatten.
Felix begriff nicht, warum sie nicht mehr daheim waren.
»Ich weiß es nicht!« Leo schlug mit der Faust gegen die Scheibe; es klang dumpf.
Waren sie mitsamt dem Haus geflogen, so wie Dorothy?
Schwebten sie wie ein Ballon?
Hingen sie irgendwie in der Luft, oder befanden sie sich in einem Turm an einem Ufer? Aber wie sollten sie – samt ihrem Zimmer – so plötzlich dort hingekommen sein?
Es schien Leo, als würde sich ihr Zimmer leicht hin und her bewegen, aber das konnte auch Einbildung sein. Oder mir ist ganz schwindlig von alldem, dachte er, und das wäre auch kein Wunder. Es ist mein Kopf, der wankt.
Noch einmal schlug er zu, so fest diesmal, dass ihm die ganze Hand wehtat, und dann noch einmal. Es war, wie sich im Traum zu zwicken: Wer Schmerz fühlte, schlief nicht, Schmerzen waren ein Zeichen dafür, dass man nicht träumte, Schmerzen weckten einen auf.
»Hör auf!«, schrie Felix. »Du tust dir nur weh!«
Er schnaubte. »… um aufzuwachen.«
Felix blinzelte, dann schlug auch er gegen die Scheibe und unterdrückte einen Schrei.
Doch so fest sie auch schlugen, sie wachten nicht auf, sie waren bereits wach, nichts von alldem war ein Traum. Unten rollte eine schwarze Welle nach der anderen heran, oben auf dem Mond waren die Krater so deutlich zu erkennen wie durch ein Teleskop.
»Wenn es kein Traum ist, ist es vielleicht ein Trick?«, fragte Felix hoffnungsvoll, das Gesicht weiß und der Blick fiebrig. »Und das da draußen ist einfach nur ein Film.«
»Quatsch. Das Bullauge ist kein Film, das Glas ist echt. Und es hat auf einen Schlag unser Fenster ersetzt. Was soll denn das für ein Trick sein? So was funktioniert nur in deinen Büchern.« Er schüttelte den Kopf. »Und wer sollte sich solche Mühe für uns geben? Selbst wenn es möglich wäre, kostet es Milliarden. Wer gibt das für uns aus? Und warum?«
Felix wandte sich vom Meer ab und rutschte in sich zusammen, den Rücken gegen die Wand gedrückt. In seinen Augen glänzten Tränen. »Aber das kann alles nicht sein! Sind wir tot und in der Hölle? Weil …« Seine Stimme klang ganz dünn.
»Nein!« Leo ging vor ihm in die Hocke und packte ihn fest an den Schultern. »Hörst du? Das sicher nicht! Dein Herz schlägt noch, und du atmest. Außerdem gibt es die Hölle nicht!«
»Das kannst du nicht wissen!«
Nein, konnte er nicht. Leo wusste nicht mehr, was es gab und was nicht. Die Nacht vor dem Fenster hatte auch sein Weltbild verschluckt.
»Aber ich weiß, dass du nicht in die Hölle kommst, niemals! Also kann sie es nicht sein, oder?« Er sah seinem Bruder fest in die Augen.
Felix schniefte. »Ich habe aber Angst«, murmelte er kleinlaut und senkte den Blick, als schämte er sich für dieses Eingeständnis.
»Ich weiß.« Leo nickte. Seine eigene Angst verschwieg er, weil Bären das nicht zugaben – und große Brüder auch nicht. Stattdessen drückte er Felix, dann verharrten sie schweigend; verloren, aber zusammen. Ihre Herzen schlugen noch immer viel zu schnell, doch das war in Ordnung. Leo hatte jeden Hunger vergessen.
Nach einer Weile wischte sich Felix mit dem Ärmel über die Nase. »Meinst du, Papa gibt uns die Schuld daran, dass wir hier sind?«
»Mir, nicht uns«, antwortete Leo bitter und erhob sich.
Daran hatte er noch gar nicht gedacht. Die Eltern mussten doch längst bemerkt haben, wie sich alles vor dem Haus verändert hatte. Warum waren sie nicht gekommen, um nach ihnen zu sehen? Oder beharrte ihre Mutter trotz allem auf der Strafe und wollte ihn auch jetzt noch nicht aus dem Zimmer lassen? Hatten sie es vielleicht noch gar nicht bemerkt, den Blick und die Gedanken stur auf Fernseher und Handy gerichtet?
Langsam trat er zur Tür. Er drückte die Klinke, um nach den Eltern zu sehen und aus den anderen Fenstern zu schauen, ob auch vor dem Wohnzimmer und dem Bad das Meer lag.
Aber die Tür ließ sich nicht öffnen.
»Hey!« Wütend rüttelte er an ihr, doch das brachte gar nichts. Verwirrt drehte er sich zu Felix um. »Abgeschlossen.« War das das Klicken gewesen, das er zuvor gehört hatte? So laut?
»Das kann nicht sein, die Eltern sperren nie ab!« Felix rappelte sich auf. Sie hatten schon oft Stubenarrest bekommen, aber nie hatten die Eltern dafür den Schlüssel vom Haken genommen und sie tatsächlich eingeschlossen.
»Irgendwer hat es getan«, knurrte Leo. Als die Mutter gesagt hatte, er solle für immer im Zimmer bleiben, hatte sie das doch nicht wörtlich gemeint.
Oder?
Wütend pochte er mit der Faust gegen die Tür. »Mama! Papa! Hallo! Lasst uns raus!«
Niemand reagierte, ihr Zimmer blieb verschlossen wie die Zelle in einem Gefängnis. Erneut rüttelte Leo an der Klinke, trat mit Wucht gegen die Tür und rief noch einmal, lauter diesmal, aber noch immer bekamen sie keine Antwort – nicht einmal eine Ermahnung des Vaters, endlich leise zu sein, erfolgte.
Das konnte nur bedeuten, Leo wurde nicht gehört. Wie war das möglich?
Hinter ihm nannte Felix zögerlich seinen Namen.
Leo drehte sich nicht um, er ging an der Tür in die Knie und presste das Auge gegen das Schlüsselloch. Er sah nur einen hellen Fleck, das einzige Stück freie Wand vermutlich, jedoch keine Bewegung. Das Licht im Flur brannte also.
»Leo, die Lachse …«
»Pst!« Leo presste das Ohr gegen die Tür und lauschte. Er hörte nichts, gar nichts. Nicht einmal den Fernseher oder Vaters vertrautes Schimpfen.
»Aber die Lachse …«
»Lass das! Wir spielen jetzt nicht mehr.« Mit der flachen Hand hämmerte er gegen die Tür. »Hey, Mama! Lass uns raus!«
»Leo!«, rief Felix noch einmal, drängender diesmal. »Die Lachse spielen auch nicht mehr.«
»Was?« Verwirrt blickte er sich um.
»Sie sind echt.« Felix kniete auf dem Boden mitten im Zimmer.
Dort, wo kurz zuvor noch die Shampooflaschen gelegen hatten, lagen nun drei tote Fische. Jeder so lang wie Leos Arm, die Schuppen silbrig und von dunklen Punkten überzogen, das Maul geöffnet, die Augen starr. Auf dem Bauch wiesen sie grobe Bissspuren auf, blutige Innereien quollen heraus und hinterließen Flecke auf dem Teppich. Nicht blau wie das Shampoo, sondern rot.
»Das kann nicht sein.« Fassungslos kauerte sich Leo neben seinen Bruder und betrachtete entsetzt die toten Tiere. Vorsichtig berührte er eins mit der Fingerspitze, es war fest und kühl und wirklich.
Diese Verwandlung schien ihm viel schlimmer als alles, was vor dem Fenster lag. Weil es hier drin geschehen war, in ihrem Reich. Weil es sein eigenes Spiel gewesen war. Wie konnte das sein? Bedeutete das, er war schuld an allem? Würde er sich jeden Moment in einen Grizzly verwandeln, weil er das auch gespielt hatte? Ein hungriges, wildes Tier. Würde er dann Felix angreifen?
Nein! Das werde ich nicht! Entschlossen schüttelte er die Vorstellung ab. Er fühlte sich noch immer wie er selbst, er war noch immer ein Mensch. Die Welt hatte sich verwandelt, er nicht. Daran hielt er fest, auch wenn ihm die Fragen die Kehle zuschnürten.
Bevor er weiter überlegen konnte, was hier geschah, trafen ihn Felix’ Hände plötzlich an der Brust. Er verlor das Gleichgewicht und fiel auf den Hintern.
»He! Was soll das?«
»Es ist deine Schuld!«, brach es aus Felix hervor, die Angst hatte sich in Wut verwandelt. »Nur deine! Deinetwegen sind wir hier!«
»Was?« Leo rappelte sich halb auf, ebenso zornig und vom Vorwurf härter getroffen als von Felix’ Händen. Dabei hatte er das eben selbst gedacht.
»Ja! Mama hat mich gar nicht gemeint!« Wieder schlug Felix nach ihm, diesmal blockte Leo den Angriff jedoch ab. Er war größer und stärker und hatte Dutzende Streits an vielen Orten ausgefochten, oft für und manchmal auch gegen Felix.
»Das soll Mama gemacht haben?«, schrie Leo. Er begriff überhaupt nichts mehr und stieß Felix mit Wucht zu Boden. »Du spinnst doch!«
»Wer denn sonst?« Schniefend setzte sich Felix auf, er griff nicht wieder an. »Die Tür ist zu! Und sie hat gesagt, dass du für immer drinbleiben sollst! Sie war es!«
»Aber …«, setzte Leo zu einer Widerrede an, fand aber nicht die richtigen Worte, und sein Bruder ließ ihn nicht ausreden.
»Sie hat es gesagt!«, beharrte Felix voller Zorn und fasste den Bruder fest in den Blick, dem er die Schuld gab, weil es immer einen Schuldigen geben musste.
Felix las den halben Tag lang Bücher, viel mehr, als er besitzen durfte, denn der Vater meinte, ein Regal reiche vollauf, später würde er den Kinderkram doch sowieso nicht mehr anschauen. Also stapelte Felix zweireihig und übereinander, um jeden Zentimeter des Regals zu nutzen, aber der Platz reichte schon längst nicht mehr, es gab zu viele Welten zu entdecken.
Jede Woche durchforstete er die Bibliothek nach neuen Geschichten. Er versteckte sich darin, wenn er sein Leben vergessen wollte, und führte das Gelesene im Spiel und in Tagträumen weiter.
Dann stellte er sich vor, wie er einen Brief erhalten würde, der ihn an die uralte Schule für Zauberei in einer riesigen Burg berief, die für die Augen normaler Menschen unsichtbar war. Oder er würde eine erlösende Wahrheit über sich und seine wahre Herkunft erfahren, dass er vielleicht sogar der Sohn eines griechischen Gottes sei, vielleicht Apollon oder Hermes (und damit nicht mehr seines Vaters Sohn). Oder er würde eine Geheimtür in der Rückwand des Schranks oder auf dem Grund eines Kaninchenbaus entdecken, die in eine andere Welt führte.
Er wurde selbst zu einem Helden – und blieb dabei doch stets er selbst.
Aber das waren Bücher und Tagträume gewesen, die er jederzeit bestimmen oder unterbrechen konnte. Das hier hingegen war die Wirklichkeit. Trotzdem versuchte er, ihre Situation mit der Schlüssigkeit einer solchen Erzählung zu verstehen, weil es ihm einfach naheliegend erschien. Während Leo sich noch bemühte, eine Erklärung zu finden, die sich annähernd im Rahmen der Naturgesetze bewegte (oder sich zumindest an ihnen orientierte), nahm Felix ihre Situation so hin, wie sie sich ihnen darstellte. In seinen Überlegungen spielten die Naturgesetze nur eine untergeordnete Rolle, ihm erschien als Erklärung alles plausibel, was auch in einer Geschichte vorkommen konnte.
»Aber davon hat sie nichts gesagt!« Leo zeigte auf das Bullauge und alles, was sich jenseits davon befand. »Wie erklärst du dir das da draußen?«
»Sie hat es trotzdem gesagt!«, beharrte Felix stur, obwohl er das Meer und den Mond mit der Magie seiner Mutter nicht erklären konnte. Trotzdem war er davon überzeugt, dass alles mit der verschlossenen Tür und der Wut ihrer Mutter zusammenhing.
»Sie sagt viel …«, brummte Leo, aber dann verstummte er, weil er selbst keine Erklärung für das alles hatte.
Schweigend saßen sich die Brüder gegenüber. Wieder hatte Leo den Eindruck, der Boden würde leicht wanken, und nun glaubte er auch, er könnte das Meer riechen.
»Meinst du, wir kommen irgendwann wieder aus dem Zimmer heraus?«, fragte Felix und umschlang mit den Armen die Knie.
Sooft er auch davon geträumt hatte, in einer anderen Welt zu landen, lag der Ursprung dieser Träume doch stets im Wunsch nach Freiheit. Nun, da er tatsächlich an einem anderen Ort gelandet war, war er ein Gefangener, noch dazu im eigenen Zimmer.
Nur, wessen Gefangene waren sie?
Ihm kamen die böse Hexe des Westens und geflügelte Affen in den Sinn, die Herzkönigin, grausame Piraten und der Große Ork unter den Nebelbergen.
»Natürlich«, antwortete Leo fest auf Felix’ Frage. Er weigerte sich, die Worte seiner Mutter als unabänderlichen Fluch hinzunehmen. Selbst wenn sie die Jungen eingesperrt hatte, würde sie doch wieder aufsperren, sobald sie sich vom Schock erholt hatte, plötzlich hier gelandet zu sein –, wo immer dieses Hier auch war. Dann würden sie gemeinsam einen Weg zurück suchen.
»Bevor wir verhungert sind?«, hakte Felix nach.
»Aber ja.«
»Und wenn ich vorher mal muss?«
»Du musst mal?«
»Noch nicht.«
»Dann verkneifst du es dir.« Jetzt, da Felix es ausgesprochen hatte, spürte auch Leo plötzlich seine Blase. Er erhob sich, um irgendein Gefäß zu finden, das im Fall der Fälle groß genug und dicht war. Zunächst trat er jedoch zum Bullauge und sah erneut hinaus, als könnte er dort Antworten finden.
Felix stellte sich neben ihn, und Leo legte ihm den Arm um die Schultern. Sie waren Brüder, sie begruben ihren Streit meist schnell und wortlos, und an diesem Ort ging es noch schneller. Denn hier und in diesem Augenblick hatten sie nur sich.
7
Kein einziger Stern war am Himmel zu sehen, der gewaltige Mond überstrahlte alles mit seinem fahlen Licht. Unten im Meer ließen sich dunkle Schemen erahnen, und Leo dachte an große, hungrige Haie und kleine U-Boote, und beides gefiel ihm nicht.
Da sich das Bullauge nicht öffnen ließ, konnten sie nicht erkennen, was sich rechts und links von ihnen befand.
»Meinst du, wir sind am Meer oder auf ihm?«, fragte Felix.
»Keine Ahnung.« Leo presste die Stirn an die Scheibe, um gerade nach unten zu sehen, aber der Rahmen des Bullauges war im Weg. »Machst du mal das Licht aus? Wenn es drinnen dunkel ist, kann ich draußen mehr sehen.«
Felix ging zur Tür hinüber und streckte die Hand schon nach dem Schalter aus, als er plötzlich, einer inneren Eingebung folgend, nach der Türklinke griff. Obwohl es keinen vernünftigen Grund gab, anzunehmen, die Tür sei nicht mehr verschlossen, drückte er die Klinke hinunter. Zu seiner Überraschung klickte es leise, und die Tür glitt einen Spaltbreit auf. Hastig hielt Felix sie fest, er hatte Angst, was hinter ihr lag.
»Wie hast du das gemacht?«, fragte Leo, der das Geräusch gehört hatte, und löste sich vom Bullauge.
»Ich habe nur die Klinke gedrückt, sonst nichts.«
»Aber es war zu! Abgeschlossen!«
»Ich weiß.«
»Irgendwer muss aufgesperrt haben.«
»Nein, das hätten wir gemerkt.« Felix schüttelte den Kopf, die Hand noch immer auf der Klinke. »Das war Mama mit ihrem Wunsch, ich weiß es«, flüsterte er und schaute nervös auf den Spalt zwischen Tür und Rahmen. »Sie hat gesagt, dass du nicht mehr rausdarfst. Für mich galt das nicht, darum kann ich …«
»Das ist doch Unsinn!«
»Nein … Magie.«
»Aber Mama kann nicht zaubern!«, rief Leo mit erhobenen Händen.
»Und wie erklärst du dir das alles sonst?«
»Magie ist keine Erklärung!«, beharrte Leo, und noch eine halbe Stunde zuvor wäre er auch fest davon überzeugt gewesen, dass das stimmte. Aber jetzt ergriff ihn die Furcht, dass Felix recht haben könnte.
Denn würde das nicht bedeuten, dass nur Felix das Zimmer verlassen konnte, er selbst jedoch nicht? Dass er tatsächlich für immer ein Gefangener im eigenen Zimmer bleiben würde? Ihm brach Schweiß aus, der Mund wurde trocken.
»Wenn es keine andere Erklärung gibt, dann schon«, blieb Felix stur. »Und wenn du mir nicht glaubst, können wir Mama fragen.«
Aber das konnten sie nicht.
Als Felix die Tür vorsichtig aufzog, erstreckte sich davor nicht der unaufgeräumte Flur ihrer Wohnung, sondern ein fremder, verwinkelter Korridor wie in einem alten Hotel. Rechts wie links führte er nach wenigen Metern um einen Mauervorsprung, und schräg gegenüber lag eine geschlossene Tür aus weiß lackiertem Holz. Alles war hell erleuchtet, doch Anzeichen von Leben gab es nicht. Niemand war zu sehen, niemand zu hören. Felix hatte noch nie einen Ort gesehen, der ihm verlassener vorgekommen war. Nichts daran erinnerte an ihr Zuhause. Das war verschwunden, und mit ihm auch die Eltern.
Felix und Leo waren allein.
ZWEI
Im Korridor der hundert Zimmer
1
»Wo sind wir hier?«, fragte Felix, obwohl er keine Antwort von Leo erwartete.
Die Erklärung, die er sich für die verschlossene Tür zurechtgelegt hatte, half ihm nun nicht mehr weiter. Die Mutter hatte zwar gesagt, Leo solle für immer im Zimmer bleiben, aber sie hatte nie den ganzen Raum fortgezaubert.
War daheim jetzt einfach eine Leere in der Wohnung, wo ihr Zimmer gewesen war? Ein Nichts? Oder waren auch die anderen Räume irgendwo gelandet, vielleicht sogar das komplette Haus?
Felix erkannte den Ort nicht, er konnte sich nicht erinnern, jemals hier gewesen zu sein. Auch nicht, ihn in einer Serie gesehen oder von ihm gelesen zu haben.
Der Korridor war mit einem weichen roten Teppich ausgelegt und verlassen. Nur um eine verzierte Deckenleuchte flatterten zwei große Nachtfalter und stießen mit den Flügeln immer wieder gegen das milchige Glas.
Soweit er erkennen konnte, fanden sich auf beiden Seiten des Korridors Türen, die alle – ganz untypisch für ein Hotel – völlig unterschiedlich aussahen. Sie waren geschlossen, kein Geräusch drang auf den Flur, alles wirkte unheimlich.
Die Welten, in die sich Felix träumte, waren oft gefährlich, zugleich aber schön und voller Wunder. Sie verhießen Abenteuer, die bestanden, und Heldentaten, die gewagt werden konnten. Hier hingegen sah Felix keine unmittelbaren Gefahren, aber auch keine Wunder und Schönheit; die Leere des Korridors wirkte unheimlich, das Licht kalt. Wäre das hier ein Buch, wäre es keine Welt, in die er sich gern geträumt hätte.
Sie ist untergegangen, schoss es ihm plötzlich durch den Kopf, und es lief ihm kalt den Rücken hinunter. Ohne Weiteres konnte er sich vorstellen, dass der Korridor aus einer seiner Fantasiewelten stammte, nachdem diese zerstört worden war. Als wäre ein Roman wider Erwarten schlecht ausgegangen, und das wären die Überreste nach dem Ende. Kein Happy End für niemanden.
Angespannt blickte Felix den Flur entlang. Die Nachtfalter stürzten sich ins Licht wie Lemminge sich in den Abgrund.
Leo schob ihn unsanft zur Seite. Er konnte nicht glauben, dass seine Mutter ihn mit bloßen Worten eingesperrt hatte, doch die Angst, er würde das Zimmer nicht verlassen können, packte ihn noch stärker. Dass die Tür vor seiner Nase zuschlagen oder eine unsichtbare Barriere ihn halten würde. Dass er die Schwelle nicht überschreiten und eine körperlose Stimme verkünden würde: Du nicht! Du hast sie gehört. (Eine Stimme, die wie sein Vater klang.)
Mit rasendem Herzen holte Leo einmal tief Luft, dann schob er den rechten Fuß ganz langsam vor. Jeden Augenblick erwartete er, gegen ein unsichtbares Hindernis zu stoßen. Doch dann glitt der Fuß anstandslos über die Schwelle hinweg, und Erleichterung erfasste Leo. Er atmete stoßweise, und die hochgezogenen Schultern sackten wieder nach unten.
»Ich wusste es!« Einen Fuß draußen, einen noch im Zimmer, drehte er sich mit geballter Faust zu Felix um. »Sie kann nicht zaubern.«
»Oder ich habe den Zauber gebrochen, weil ich die Tür geöffnet habe«, erwiderte sein Bruder. »Und du kannst nur meinetwegen raus.«
»Wenn du meinst, Kleiner.« Leo lachte und fuhr ihm mit der Hand durchs Haar. Die Erklärungen waren ihm egal, es war nur wichtig, dass er nicht eingesperrt blieb. Dann wurde er wieder ernst. »Kommst du mit?«
»Wohin?«
»Uns umschauen. Rausfinden, wo wir sind.«
»Und wo? Rechts oder links?«
Leo blickte in beide Richtungen, sie schienen sich nicht groß zu unterscheiden. Auf den zweiten Blick wirkte der Flur heruntergekommen; wie der eines Hotels, das die besten Tage bereits hinter sich hatte. Ein Hotel in einer ehemals bedeutenden Stadt, fast vergessen vom Rest der Welt. Der Teppich war abgewetzt und fleckig, nirgends hing ein Bild, die Wände waren kahl und glatt und wirkten irgendwie seltsam. Leo dachte an die unvermittelt hereingebrochene Nacht und den gewaltigen Mond vor dem Bullauge, und plötzlich erschien ihm der Flur nicht nur heruntergekommen, sondern auch bedrohlich. Ihm wurde mulmig.
Hastig trat er zurück ins Zimmer, zog die oberste Kommodenschublade auf und nahm sein Taschenmesser heraus, das er zum achten Geburtstag bekommen hatte. Es verfügte über Klinge, Säge, Schraubenzieher, Flaschenöffner, Lupe und Pinzette. Den Zahnstocher aus beigem zerbissenen Plastik hatte er längst verloren, aber den brauchte er auch nicht. Jetzt ging es sowieso nur um die Sicherheit, die die Klinge versprach.
Er schob das Messer in die Hosentasche und fühlte sich augenblicklich besser. Er nahm es auch immer mit, wenn er mit Maik, Roberto, Alex und den anderen am Bahnhof herumhing. Aufgeklappt hatte er es dort noch nie, aber die anderen Jungen waren älter als er, und er fühlte sich auch älter und härter, wenn er das Gewicht des Messers in der Tasche spürte.
»Wozu brauchst du das?«, fragte Felix.
»Nur zur Sicherheit.«
»So ein Mist, meins liegt im Flur.«
Felix hing nie am Bahnhof herum und nutzte das Messer nur zum Schnitzen oder um eine Flasche zu öffnen.
Damit er trotzdem etwas mit sich trug, was ihm Sicherheit versprach, kramte er die Zwille aus der Schublade, die er aus einer dünnen Eisenstange selbst zurechtgebogen hatte. Dazu steckte er eine Reihe von bunten Glaskugeln ein.
»Meine hat Vater konfisziert«, murmelte Leo, aber er erwartete sowieso nicht, dass er eine Schleuder brauchen würde.
Das Bärenfell ließ er um, obwohl er längst nicht mehr spielte. Er kam gar nicht auf den Gedanken, es abzulegen, ganz selbstverständlich hing es über seinen Schultern.
Gemeinsam traten die Jungen auf den Flur hinaus, und als sie die Tür hinter sich zuzogen, bemerkten sie zwei Dinge.
Auch wenn die Wohnung verschwunden war, das Schild, das sie sich zu Weihnachten gegenseitig geschenkt hatten, hing noch immer über dem langen Kratzer im Lack.
Eltern müssen draußen bleiben!!!
Das erste Ausrufezeichen gehörte zur Schrift, das zweite hatte Leo hinzugefügt, das dritte Felix.
Rechts und links neben der Tür schlossen sich direkt zwei verzierte halbrunde Beschläge aus Metall an, die in der Höhe etwa zwanzig Zentimeter maßen. Aus jedem ragte eine stählerne Hand, die an einen feingliedrigen Ritterhandschuh erinnerte und den Türrahmen fest umklammerte. Die Fingerspitzen hatten sich tief in das Holz gekrallt, als würden sie auf keinen Fall loslassen wollen. Neben jeder Hand fand sich ein Schlüsselloch im Beschlag und darunter eine eingravierte Zahl, rechts wie links die 4213.
»Was soll das?« Felix zeigte darauf.
»Keine Ahnung.« Leo schüttelte den Kopf und ging in die Hocke, um durch das Schlüsselloch zu schauen. Doch es führte nirgendwohin, er sah nur undurchdringliche Schwärze und richtete sich wieder auf. Dabei stützte er sich an der Wand ab, und ihm wurde bewusst, was ihm an ihr seltsam vorgekommen war. Sie bestand aus weiß gestrichenem Metall, nicht aus verputztem Stein.
Ohne groß darüber nachzudenken, blickte er nach rechts und links. Hier wie da konnte er kein Ende des Korridors ausmachen, und noch immer erschien er ihm hier wie da unheimlich. Unbewusst legte er die Hand auf das Messer und dachte: Bären kennen keine Furcht. Die Einsamkeit nagte an ihm, und dann fiel Leo ein, dass es mitten in der Nacht war. Natürlich schliefen um diese Zeit die meisten Leute, und Flure waren verlassen. Das war nichts Ungewöhnliches.
Dieser Gedanke beruhigte ihn ein wenig, und er wandte sich spontan nach rechts. Beide Richtungen erschienen ihm gleichermaßen vielversprechend. »Los, Kleiner. Irgendwo muss jemand sein, der uns das erklären kann.«
Doch sie riefen nicht laut »Hallo«, als sie sich auf den Weg machten, im Gegenteil. Sie traten leise auf und sprachen nur im Flüsterton miteinander, als wollten sie nicht bemerkt werden.
Sie selbst bemerkten auch niemanden, nur immer wieder große dunkle Nachtfalter, die aufgeregt um das kalte Deckenlicht flatterten. Obwohl die Luft nach Meer roch, wirkte sie abgestanden. Das passte zur Atmosphäre im Korridor. Als wäre die einstige Gastfreundschaft dieses Ortes von etwas anderem gekapert und überlagert worden.
Alles erinnerte Leo an die alte, halb verfallene Gründerzeitvilla mit den gesichtslosen Wasserspeiern gleich hinter dem Bahnhof, an der er manchmal vorbeilief. Von ihr hieß es, dort hätte sich ein verrückter Serienmörder aus Angst vor der Rache der Toten erhängt, und nun spukten dort noch immer die Toten, hungrig nach einer Rache, die ihnen verwehrt worden war, weil sie dem Mörder nicht selbst das Herz hatten herausreißen dürfen.
Das war natürlich Unsinn, das wusste Leo, aber die Villa wirkte, als könnte es stimmen. Wenn er an ihr vorbeiging, starrte er sie immer an, um sich zu beweisen, dass er kein Angsthase war, vor allem bei Dunkelheit, wenn das Licht der Laternen undeutliche Schatten an die Fassade warf. Reingegangen war er allerdings nie, auch Maik und die anderen nicht.
Doch hier hatte er keine Wahl.
Schon nach wenigen Schritten den Korridor hinab sagte Felix: »Diese komischen Schlösser sind überall.«
Schweigend nickte Leo. Es änderte sich auch auf dem weiteren Weg nicht. Jede Tür verfügte über zwei identische Hände, eine rechte und eine linke, und unter beiden war jeweils dieselbe Zahl eingraviert. Diese zählten zunächst nach unten, neben ihrem Zimmer kam die 4212, dann die 4211, 4210, 4209 und so weiter, bis sie bei 4204 an einen Abzweig kamen. In der Sackgasse links von ihnen ging es mit 4200 weiter, geradeaus mit 4198, ein klares System war nicht mehr zu erkennen.
Die Brüder dachten an die Zimmernummern in Hotels und wie diese üblicherweise gebildet wurden, aber sie konnten unmöglich im zweiundvierzigsten Stockwerk sein, so tief lag das Meer nicht unter ihnen, und ein Gebäude konnte doch nicht über viertausend Räume verfügen. Oder doch?
»Kabinen«, rief Felix auf einmal. »Bullaugen gibt es nur auf Schiffen!«
Aber auch in dem Fall schienen ihnen über viertausendzweihundert viel zu viele zu sein.
Das Auffälligste an den Schlössern war jedoch, wie sehr sie sich in ihrer Form unterschieden. Bei Nummer 4213 waren es die stählernen Knochenhände eines Skeletts, dann folgten die langfingrigen Hände eines Aliens mit dicken Gelenken, die Handschuhe eines Falkners, geschuppte Klauen mit sichelförmigen Krallen, die am ehesten zu einem Drachen passen mochten, die zarten Hände einer Märchenprinzessin und halb zerfallene Zombiepranken. Kein Paar glich dem anderen, doch sie alle hatten sich tief in die Türrahmen gegraben.
Auch die Türen selbst waren so unterschiedlich wie die Schlösser an ihren Rändern, mal größer, mal kleiner, mal glatt und weiß gestrichen, mal mit profilierten Kassetten aus Holz und farblos lackiert. Manche Türen wirkten alt und schwer, andere billig und beschädigt, und irgendwo fand sich sogar eine graue Feuerschutztür.
An einem Teil der Türen hingen Poster oder Schilder, hier eine eingerissene Fußballmannschaft, da ein geknickter Popstar und ein Stück weiter die eingerissene Actionszene aus einem Computerspiel. Eine Tür war mit Graffiti und Tags vollgekritzelt, eine zeigte in Kopfhöhe tiefe Kratzspuren wie von einer Gartenharke, und immer wieder fanden sich verschiedene Schilder, Poster oder Aufkleber.
Der Kleingeist hält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos!
Oder: Nicht stören!
Oder zusammen mit dem Bild eines zähnefletschenden Orks: Hier wache ich!
Und am häufigsten Varianten von: Draußen bleiben!
Die Türen wollten nicht recht in diesen Flur mit dem dunkelroten Teppich passen, der weder Poster noch sonst irgendwelche Unterschiede erwarten ließ. Es war der Flur eines vergessenen Grandhotels, eines vor langer Zeit auf Grund gelaufenen Kreuzfahrtschiffs oder der eines weitläufigen Rathauses einer ehemals bedeutenden Großstadt – weit nach Büroschluss.
Fenster gab es keine, und der Flur verlief auch nicht schnurgerade. Mal sprang er zwei Meter nach links, um nach wenigen Schritten drei Meter nach rechts versetzt zu werden. Er folgte einem Zickzackkurs, der wohl in der unterschiedlichen Größe der Zimmer begründet liegen mochte. Niemand mit Verstand hätte ein Gebäude (oder auch ein Schiff) auf diese Weise geplant und schon gar nicht gebaut. Als hätte ein kleines Kind sich wahllos Legosteine gegriffen und die Wände mit dem errichtet, was ihm in die Hände fiel. Zufall und Chaos mussten hier Architekt gewesen sein.
Darüber machten sich Leo und Felix Gedanken, während sie voranschlichen. Auf ein Ergebnis kamen sie allerdings nicht, zu viele Eindrücke und Fragen besetzten ihre Köpfe. Die Antworten darauf erhofften sie sich von jemand anders.
Vorsichtig klopften sie hier oder da an einer Tür, doch niemand reagierte. Irgendwann drückte Leo sogar eine Klinke herunter, aber die Tür war verschlossen.
Ebenso die nächste.
Felix presste lauschend das Ohr gegen ein Türblatt, doch nicht das geringste Geräusch war zu vernehmen. In die Stille hinein fragte er: »Wie kann es sein, dass plötzlich Nacht ist?«
Erneut schüttelte Leo den Kopf. »Vielleicht wurden wir in eine andere Zeitzone versetzt. Irgendwo ist immer Nacht.«
»Aber wie ist das möglich?«
»Ich weiß es doch nicht«, knurrte Leo. Der Anblick des leeren, scheinbar endlosen und unübersichtlichen Flurs nagte an ihm, die unheimliche Atmosphäre, die sich nicht recht fassen ließ, dazu Felix’ ständige Fragen, die ihn zwangen, seine eigene Verlorenheit zuzugeben.
»Meinst du, wir kommen wieder heim?« Felix klang, als würde er gleich weinen, deshalb blieb Leo stehen und hielt ihn an der Schulter fest.
»Ja«, sagte er nachdrücklich. »Ganz sicher.« Auch wenn er daran zweifelte, Felix musste es hören – und er selbst auch.
»Und wie?«
»Das finden wir heraus. Irgendwie sind wir schließlich hergekommen, dann muss es auch einen Weg geben, der uns zurückbringt.«
2
Langsam gingen sie weiter, folgten dem Flur um einen weiteren Vorsprung und noch einen, vorbei an mehreren in der Wand festgekrallten Türen. Bis sie auf eine stießen, die von tiefen Kratzern übersät war und schief im Türstock hing. Irgendwer schien sie eingetreten zu haben, die untere Angel war herausgerissen.
»Halt«, zischte Felix und hielt Leo zurück.
Sie lauschten, hörten jedoch nichts. Leise und angespannt näherten sie sich der kaputten Tür und drückten sich neben ihr gegen die Wand. Wieder lauschten sie angestrengt, wieder konnten sie nichts hören. Kein Reden, keine Schritte, keine laufenden Geräte.
Nichts.
Vorsichtig lugten sie in den Raum. Auch er war verlassen, die Deckenlampe ausgeschaltet. Durch ein großes Bullauge an der hinteren Wand schien der Mond, das helle Flurlicht fiel durch die Tür hinein, und so lag der Raum in einer Art Dämmerlicht.
Langsam traten sie ein und sahen sich um. Es handelte sich um ein Kinderzimmer, das spärlich mit älteren Möbeln aus massivem dunklem Holz eingerichtet war. An der Wand hingen zwei Bilder vom Meer, keine Poster. Auf einer Kommode saß ein hellbrauner Teddy mit rauem Fell, daneben stand eine gerahmte Schwarz-Weiß-Fotografie von einem ernsten Jungen in knielanger Hose und mit Schultüte. Auf dem Boden lagen ein Kreisel, mehrere Blechautos und eine Eisenbahn aus bemaltem Holz.