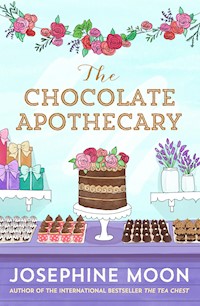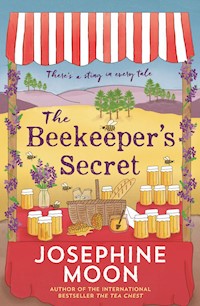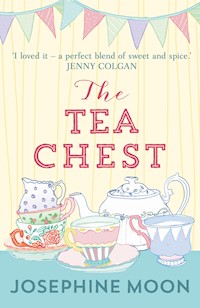8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn einem das Leben Kakaobohnen gibt, sollte man Schokolade daraus machen ...
Christmas Livingstone glaubt fest an zehn Regeln für ein glückliches Leben. Eine lautet: Mit etwas Schokolade kann eigentlich alles nur besser werden. Das beweist Christmas jeden Tag mit den Köstlichkeiten, die sie in ihrer "Schokoladenapotheke" verkauft und denen viele sogar Heilkräfte zuschreiben. Regel Nr. 1 der jungen Frau – keine romantischen Beziehungen! – ist da schon schwerer umzusetzen. Christmas hat nämlich nicht mit Lincoln van Luc gerechnet, einem Botaniker und Weltenbummler mit strahlenden blauen Augen, einer bezaubernden Großmutter und einem treuen Findlings-Hund ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Seit drei Jahren verkauft Christmas Livingstone in der Schokoladenapotheke selbst gemachte Köstlichkeiten, denen manche sogar Heilkräfte zuschreiben. Sie liebt ihr geordnetes, überschaubares Leben und genießt es, die Menschen mit ihren Kreationen jeden Tag ein wenig glücklicher zu machen. Doch dann sorgen unvorhergesehene Ereignisse für Turbulenzen. Ihre beste Freundin hat Christmas heimlich für ein Stipendium in Frankreich angemeldet – für einen Kurs bei dem so berühmten wie exzentrischen französischen Chocolatier Maître Le Coutre. Doch noch bevor Christmas sich überlegen kann, das Stipendium anzutreten, platzt ein junger Mann in ihr Leben: Lincoln van Luc, ein Botaniker mit strahlend blauen Augen. Lincoln arbeitet an einem Buch über Kakao und könnte dabei etwas Hilfe gebrauchen. Am besten von jemandem, der etwas von Schokolade versteht, sich der Materie aber von einer anderen Seite nähert. Jemand wie Christmas …
Dass es bereits bei ihrem ersten Zusammentreffen gefunkt hat, will Christmas sich nicht eingestehen. Schließlich wäre das gegen ihre wichtigste Lebensregel: Keine romantischen Beziehungen! Aber vielleicht sind manche Regeln einfach dazu da, um gebrochen zu werden …
Autorin
Die Australierin Josephine Moon hat sich ihren Traum vom Leben als Schriftstellerin erst nach einigen Umwegen erfüllt. Sie arbeitete in unzähligen Jobs, wobei ihre längsten Anstellungen zwischen drei und vier Jahren währten – als Lehrerin und als Lektorin. Außerdem gründete und leitete sie eine Pferderettungsstation in Queensland, liebt Tiere, und zu den Höhepunkten ihres Lebens zählt, dass sie einmal im Meer vor Tonga mit Buckelwalen schwimmen durfte. Josephine schreibt am liebsten Geschichten, die etwas mit Essen zu tun haben, und hofft, dass ihre Romane auch Seelennahrung sind. Hätte sie geahnt, dass sie einen der Recherche dienenden High Tea von der Steuer absetzen kann, hätte sie sich diesen Themenbereich schon viel früher gesucht. Josephine Moon lebt mit ihrem Mann, ihrem Sohn und diversen Tieren an der Sunshine Coast in Queensland, Australien. Sie ist überzeugt, den schönsten Beruf der Welt zu haben.
JOSEPHINE MOON
DasSchokoladen-versprechen
Roman
Aus dem Englischenvon Ulrike Laszlo
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »The Chocolate Promise« bei Allen & Unwin, Australien
Der Roman erschien in England unter dem Titel »The Chocolate Apothecary« bei Allen & Unwin, c/o Atlantic Books, London
Deutsche Erstausgabe Februar 2017
Copyright © der Originalausgabe 2015 by Josephine Moon
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Friederike Arnold
AB · Herstellung: Str.
Layout: Rebecca Notter
Kapitelvignette: shutterstock
Satz: DTP Service Apel, Hannover
ISBN 978-3-641-19140-5V002
www.goldmann-verlag.de
Für meinen Dad Brian und meine Stiefmutter Pamela,die mir so viel von Tasmanien gezeigt haben.Ich möchte die vielen Familienerinnerungen aus dieser Zeitnicht missen.
1
Christmas Livingstones zehn wichtigste Regelnfür ein glückliches Leben
1. Tu, was du liebst, und liebe, was du tust.
2. Lass dich niemals von Hunger quälen.
3. Es gibt fast nichts, was sich nicht mit Schokolade verbessern ließe.
4. Nutze jeden Tag alle deine fünf Sinne.
5. Teile deine Freude mit anderen, umso stärker wirst du sie empfinden.
6. Eine Massage ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit.
7. Frage dich, was Oprah tun würde.
8. Dein Schicksal ist nicht vorbestimmt, es liegt in deiner Hand.
9. Hör niemals auf zu suchen.
Und das Wichtigste:
10. Keine romantischen Beziehungen!
❉
Es war Donnerstag, genau gesagt Gründonnerstag – der Tag vor dem langen Osterwochenende, an dem am Samstag die Gartenausstellung in Evandale stattfinden würde –, und in der Schokoladenapotheke war die Hölle los. An Ostern, am Valentinstag und am Muttertag lief das Geschäft am besten, und in diesem Jahr wurde der Muttertag schon eine Woche nach Ostern gefeiert.
Cheyenne und Abigail arbeiteten im Laden; sie verkauften und bedienten, als hinge ihr Leben davon ab, und trugen Silbertabletts hin und her, schwer beladen mit heißer Schokolade, Mokka, Teekannen, Apfelkuchen mit Schlagsahne, Schokoladenfondants, mit Schokolade überzogenen Himbeeren, Brownies und Pralinen. Biscotti. Makronen. Baiser. Der Duft all dieser Köstlichkeiten vermischte sich zu einem magischen, berauschenden Parfum und drang hinaus auf die Straße, wo einige Leute wie hypnotisiert stehen blieben und dann den Laden betraten.
In den Osterferien waren immer viele Besucher in der Stadt, und anscheinend fanden sich alle irgendwann in Christmas Livingstones stattlichem georgianischem Haus ein, um dem wechselhaften Wetter zu entfliehen. Sie stand in der Küche, hinter den Schwingtüren, wischte sich die Hände an der Schürze ab und spähte in den Laden. An dem langen Gemeinschaftstisch in der Mitte des Lokals war kein Platz mehr frei, und die Gäste unterhielten sich lautstark miteinander.
Sie würde die ganze Nacht brauchen, um die Schokoladenwaren und das Gebäck, das heute verzehrt wurde, morgen wieder anbieten zu können. Vielleicht sollte sie sich Hilfe holen. Aber wen? Sie konnte wohl kaum von Cheyenne oder Abigail erwarten, dass sie nach ihrer Tagesschicht noch bis spät in die Nacht blieben. Vielleicht ihre Schwester? Val konnte zwar nicht kochen und verstand auch nichts davon, wie man Schokolade temperierte, verarbeitete und anschließend verzierte, aber sie war wunderbar pragmatisch. Sie würde abspülen, sauber machen, kehren und Regale einräumen. Und sie würde Christmas bei Laune halten, wenn sie erschöpft war. Aber Val musste sich um ihren Mann und ihre drei Jungen kümmern.
Also blieb eigentlich nur Emily übrig. Sie arbeitete zwar heute, aber sie hatte sicher nichts dagegen, sich die Nacht um die Ohren zu schlagen. Christmas musste es ihr nur als eine Art Pyjama-Party verkaufen, wie sie es aus ihrer Kindheit kannten, und sie mit einem Glas Sekt locken, dann würde sie bestimmt kommen. Das war eines der Dinge, die sie an Emily so mochte – sie war immer hilfsbereit.
Christmas zog ihr Telefon aus der Tasche und zögerte einen Moment. Sie bat nicht gern jemanden um einen Gefallen, selbst wenn sie mit einer positiven Reaktion rechnete. Aber der Kundenstrom ließ nicht nach und schien sogar noch stärker zu werden.
»Tu es einfach«, befahl sie sich und tippte eine SMS.
Emily antwortete sofort. Natürlich. Das kommt genau zur richtigen Zeit! Ich habe eine tolle Überraschung für dich. Kann es kaum erwarten!!!
Eine Überraschung? Christmas konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, was das sein sollte. Und sie kam auch nicht länger dazu, darüber nachzudenken, denn soeben hielt der Paketbote mit quietschenden Reifen am Zaun vor der Eingangstür.
»Ausgezeichnet«, sagte sie laut. Sie schob die Schwingtüren zum Laden auf, wich einem kleinen Jungen aus, der einen Spielzeugzug über den Boden schob, und ging um die Rollatoren neben den kleinen runden Tischen herum, an denen einige ältere Gäste vor ihren heißen Getränken saßen. Sie hatte vorsichtshalber per Express ein paar Kilo Kakaobutter bestellt, und nun war sie ausgesprochen froh darüber. Rasch sprang sie die beiden letzten Stufen vor dem Eingang hinunter und begrüßte den Paketboten, der bereits eine Kiste mit der Aufschrift Achtung: schweres Paket aus seinem Lieferwagen hievte. Nachdem er es auf den Boden gestellt hatte, holte er die Lieferpapiere und den elektronischen Scanner hervor, auf dem sie unterschreiben musste.
Gordon Harding sauste auf seinem Hochrad vorbei, den Kopf zum Schutz gegen den Wind tief gesenkt und wegen der Kälte die Weste bis oben zugeknöpft. Sie winkte ihm fröhlich zu. Das war eines der Dinge, die ihr am Leben in Evandale so sehr gefielen – die Hochräder, die aus einer anderen Zeit stammten, aber dem Fortschritt und der Technologie trotzten und auf den Straßen immer noch nostalgischen Charme versprühten.
»Hier unterschreiben.« Der Paketbote hielt ihr das klobige Gerät und den elektronischen Stift entgegen. Sie kritzelte ihre Initialen auf das Display, bedankte sich und wartete, ob er ihr anbieten würde, die Kiste in den Laden zu tragen – vergeblich. Nachdem er in seinem Wagen davongebraust war, überprüfte sie das Gewicht. Auf dem Aufkleber waren fünfzehn Kilo angegeben. Sie war stark genug, um es hochzuheben, aber sie trug einen Rock, daher war es nicht so einfach, ihre Beine in die richtige Position zu bringen. Und die Kiste war groß und die Kartonverpackung glatt. Sie hob sie ein kleines Stück an, bevor sie ihr entglitt und mit einem dumpfen Aufprall wieder auf dem Gehsteig landete. Peinlich berührt, aber auch in der Hoffnung, dass ihr jemand zu Hilfe kommen würde, warf sie einen Blick in den Laden. Abigail und Cheyenne waren jedoch beide beschäftigt, und die meisten der männlichen Gäste waren älter als ihr früherer Stiefvater Joseph.
Sie dachte nach, als ein orangefarbenes Taxi an der Stelle hielt, wo soeben noch der Paketwagen gestanden hatte. Durch das Fenster sah sie, wie ein Mann dem Fahrer einige Scheine in die Hand drückte. Dann stieß er die Tür auf, stieg aus und zog einen abgewetzten Reiserucksack hinter sich her, der schon bessere Tage gesehen hatte und jeden Augenblick aus allen Nähten zu platzen drohte. Der Mann richtete sich auf, zog den Schulterriemen einer Laptoptasche zurecht und schlug die Tür zu. Das Taxi brauste los.
Er trug einen dunklen Bart, der zwar zerzaust und ein wenig ungepflegt war, aber auch urwüchsig und anziehend wirkte. Aber es war das Lächeln, bei dem seine atemberaubend blauen Augen aufleuchteten, das Christmas beinahe umwarf. Ihr verschlug es den Atem, und einen Moment lang war sie sprachlos und starrte ihn nur stumm an.
»Hi. Ist das der Schokoladenladen?« Er ließ seinen Rucksack auf dem Gehsteig stehen, kam auf sie zu und spähte durch das Fenster. »Ich habe am Flughafen einen Werbeprospekt gefunden. Kaum zu glauben, dass ich noch nie hier war.«
Christmas fand endlich ihre Sprache wieder. »Sie leben hier?« Okay, das klang nicht sehr einfallsreich, aber es war besser, als ihn weiterhin wortlos anzustarren.
Er drehte sich immer noch lächelnd zu ihr um. Sein Hemd steckte nur auf einer Seite in der Hose und hing auf der anderen heraus, und aus irgendeinem Grund bekam Christmas bei diesem Anblick weiche Knie. »Ich komme aus Tasmanien, aber ich habe in den letzten Jahren meistens in Übersee gearbeitet und zwischen meinen Aufträgen hier im Haus meiner Großmutter gewohnt.«
»Ich habe meinen Laden vor drei Jahren eröffnet.«
»Das ist Ihr Geschäft? Großartig. Vielleicht können Sie mir helfen, Schokolade für meine Großmutter auszusuchen. Sie lebt in einem Altenheim und ist ganz verrückt nach Süßigkeiten. Hier oben«, er tippte sich gegen die Stirn, »ist noch alles bestens, aber ihr Körper lässt sie im Stich. Ich bin auf dem Weg zu ihr. Und außerdem habe ich großen Hunger, also dachte ich, ich könnte hier auch eine Kleinigkeit essen.«
Christmas wusste nicht, wohin sie den Blick richten sollte. Sie konnte ihn nicht länger anschauen, denn seine Gegenwart löste merkwürdige Reaktionen in ihr aus. Ihn umgab eine gewisse Aura, die sie beinahe magnetisch anzog. So etwas hatte sie schon seit Langem nicht mehr gespürt – wenn überhaupt schon jemals zuvor.
Und das war nicht erlaubt. Die Regel Nummer zehn lautete: Keine romantischen Beziehungen!
Das ging gar nicht.
»Kommen Sie herein, wir werden sicher etwas für Sie finden«, murmelte sie mit gesenktem Kopf und marschierte zur Eingangstür.
»Warten Sie, ist das Ihre Kiste?«
Als sie sich umdrehte, hatte er die Kiste bereits auf die Schulter gehievt wie ein Gnu, das er soeben erlegt hatte und nun zur Zubereitung einer Mahlzeit nach Hause trug.
»Ja. Danke.«
»Ich bin übrigens Lincoln.« Er folgte ihr in den Laden, bahnte sich den Weg an den Tischen und Schaukästen vorbei hinter die Theke und durch die Schwingtüren in die Küche.
»Es tut mir leid, dass es hier so unordentlich aussieht.« Christmas ließ den Blick über die mit Schokolade verschmierten Arbeitsflächen gleiten. Auch an den Kühlschranktüren und am Boden waren Spuren von Schokolade. Eigentlich sah der gesamte Raum so aus, als hätte sich hier ein Graffitikünstler ans Werk gemacht – allerdings mit leckerer Schokolade.
»Ich komme gerade aus dem südamerikanischen Dschungel. Glauben Sie mir, hier herrscht keine Unordnung. Wo soll ich die Kiste hinstellen?«
»Wie? Oh! Irgendwo auf die Arbeitsfläche. Danke.«
Lincoln stellte die Kiste mit einem dumpfen Aufschlag ab. Dann blieb er ruhig stehen und lächelte sie an, als würde er auf etwas warten.
Sie trat von einem Fuß auf den anderen und kratzte mit dem Fingernagel einen Schokoladenfleck von der Arbeitsplatte. »Sind Sie Musiker?«, fragte sie, weil er zuvor von seinen Aufträgen gesprochen hatte.
»Botaniker. Aber das wäre eine gute Alternative, falls ich mal einen neuen Job brauchen sollte.«
Fasziniert von seinen Augen schwieg sie einen Moment lang. »Danke fürs Reintragen. Und nun kümmern wir uns um Schokolade für Sie. Und sollten Sie nicht Ihren Rucksack holen?« Ihr war plötzlich eingefallen, dass er sein Gepäck auf dem Gehsteig zurückgelassen hatte.
Lincoln zuckte die Schultern. »Schon in Ordnung.«
Christmas wünschte, ihr Herz würde nicht so heftig pochen. »Also …?«
»Sie haben mir Ihren Namen noch nicht verraten.« Er legte die Hand auf ihren Arm, und ein Stromschlag durchfuhr sie, als hätte er einen Nerv berührt. Flirtete er etwa mit ihr? Das war unglaublich. Niemand flirtete mit ihr. Nicht hier in dem alten, verschlafenen Städtchen Evandale. Hier fühlte sie sich sicher vor romantischen Verstrickungen. Bei nur eineinhalbtausend Einwohnern gab es einfach nicht genug Leute für eine Romanze.
»Christmas Livingstone«, erwiderte sie so sachlich wie möglich.
Er stieß einen Pfiff durch die Zähne aus. »Das gefällt mir.«
Meine Güte, sie musste diese Situation beenden. »Kommen Sie, wir sollten schnell etwas zu essen für Sie und Schokolade für Ihre Großmutter besorgen, bevor nichts mehr übrig ist. Heute herrscht großer Andrang. Sie wollen doch nicht leer ausgehen.« Sie drehte sich auf dem Absatz um und marschierte in den Laden, ohne einen Blick zurückzuwerfen. Allerdings versuchte sie zu erspüren, wie nah er hinter ihr war und ob er vielleicht gegen sie prallen würde, wenn sie abrupt stehen blieb.
Nicht dass sie das tun würde.
Zumindest nicht mit Absicht.
Die Regeln, rief sie sich ins Gedächtnis. Die Regeln waren zu ihrem Schutz gedacht. Sie hatten ihr gute Dienste geleistet und sie in den letzten drei Jahren auf Kurs gehalten. Jetzt war nicht der passende Zeitpunkt, um sie zu missachten. Sie musste sich zusammenreißen.
Emily traf nach Ladenschluss ein, zupfte sich einige Herbstblätter aus den langen, zerzausten Haaren und schniefte, als wäre sie erkältet. Aber sie lächelte.
»Bist du krank?«, erkundigte sich Christmas, stapelte einige Schüsseln und Teigspateln in die Spüle und drehte den Wasserhahn auf.
Emily schniefte noch einmal, hängte ihre Handtasche an den Kleiderhaken neben der Tür und zog ihre Lederjacke aus. »Ich glaube, ich habe Heuschnupfen. Kann man den auch im Herbst kriegen?«
»Den kann man sich zu jeder Jahreszeit einhandeln. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Du hast etwas gut bei mir.« Christmas ging zum Kühlschrank und holte eine Flasche Sekt heraus.
»Unsinn. Betrachte es als Dankeschön für deine Hilfe an Neujahr bei meinem Umzug in das Reihenhaus.«
»Oh, ja.« Als Christmas an dem Korken drehte, löste er sich mit einem lauten Knall und flog an die Decke. »Das war wirklich harte Arbeit.« Sie lachte. Tatsächlich hatte sie eine Woche gebraucht, um sich davon zu erholen. Emily war eine unverbesserliche Sammlerin, und während die meisten Menschen einen Umzug als Gelegenheit ansahen, sich von einigen Dingen zu trennen, schien sie noch mehr gehortet zu haben. In ihrem Haus standen immer noch Dutzende Umzugskisten, die noch nicht ausgepackt waren.
Sie hoben die Gläser und stießen an. »Prost!«
»Also, worum geht es bei dieser Überraschung?« Christmas lehnte sich gegen die Arbeitsplatte. »Ich bin schon gespannt.«
Emilys Gesicht erhellte sich, und sie stieß einen quietschenden Laut aus. »Eigentlich wollte ich damit warten, bis wir mit unserer Arbeit fertig sind, aber das halte ich nicht aus.«
Sie stellte ihr Glas auf die Arbeitsfläche, holte ihre Handtasche und fischte ein Kuvert heraus. Dann drehte sie sich zu Christmas um und hielt es an den oberen Ecken hoch. »Du hast doch in letzter Zeit oft von Maître Le Coutre gesprochen.«
Christmas runzelte verwirrt die Stirn. Das hatte sie nicht erwartet. Maître Le Coutre war ein weltberühmter französischer Chocolatier, bekannt für sein großes Können, seine Exzentrik und seine jährlich stattfindenden Stipendiumkurse. Interessierte aus der ganzen Welt konnten sich dafür bewerben, eine Woche mit ihm zu verbringen und von seiner Größe zu profitieren. Seine Arroganz war unbeschreiblich, und der Kampf um eines dieser Stipendien uferte in Hysterie aus. Das Kursprogramm wechselte von Jahr zu Jahr, und keiner der Bewerber kannte es vorher. Ehemalige Teilnehmer berichteten von Dichterlesungen, Überraschungsflügen zu Kakaoplantagen in Afrika, Schlafentzug und nächtelanger Schokoladenverarbeitung, Lektionen über Opern und Zelten unter dem Sternenhimmel, bei dem Maître Le Coutre am Lagerfeuer dozierte und über den offenen Flammen in einem Topf geschmolzene Schokolade rührte; manche behaupteten sogar, sie hätten ihn während ihres Aufenthalts kein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Er sei verrückt, sagten sie. Andere bezeichneten ihn als grausam. Viele hielten ihn für ein Genie. Aber nichts, was er tat, hielt die Leute davon ab, sich für seine Kurse zu bewerben. Je merkwürdiger er sich verhielt, umso mehr Anmeldungen gab es. Und da niemandem etwas Konkretes für diese Woche versprochen wurde und die Teilnehmer keine Gebühren zahlen mussten, konnte sich auch niemand wirklich beklagen. Er war ein Mysterium, und alle seine begeisterten Anhänger, einschließlich Christmas, hingen bei jedem seiner charismatischen Äußerungen hingebungsvoll an seinen Lippen.
»Ja, schon«, erwiderte sie vorsichtig und hörte plötzlich das Blut in ihren Ohren rauschen. Sie hatte oft mit Emily über ihn gesprochen und ihr die Zeitschriften gezeigt, in denen jedes Jahr die Anzeigen für die Stipendien abgedruckt wurden. Und sie hatten gemeinsam über Maître Le Coutres bizarres Verhalten gelacht.
»Und würdest du dorthin fahren?«, hatte Emily sie öfter gefragt. »Wenn du die Möglichkeit dazu hättest?«
Christmas hatte mit den Schultern gezuckt. »Klar, warum nicht?« Aber sie hatte sich nie ernsthaft darüber Gedanken gemacht, weil sie nicht vorhatte, sich für einen dieser Kurse zu bewerben. Ganz gleich, wie brillant Maître Le Coutre auch war – bei einer Reise nach Frankreich ging es nicht nur um berufliche Weiterbildung, sondern auch um etwas ganz Persönliches.
Emilys Augen leuchteten auf. »Du bist dabei«, flüsterte sie.
»Was?«
»Du hast einen Platz für den diesjährigen Stipendiumkurs!« Emily umarmte sie und drückte sie so fest, dass Christmas nach Luft schnappte.
»Oh, tut mir leid!« Emily trat lachend einen Schritt zurück und gab Christmas das Kuvert. »Lies!«
»Aber ich habe mich nicht dafür beworben.« Christmas starrte sie verblüfft und beunruhigt an.
»Das weiß ich. Ich habe in deinem Namen eine Bewerbung losgeschickt und einen langen Brief dazugelegt. Den zu verfassen hat eine Weile gedauert«, sagte Emily so atemlos, als koste sie selbst die Erinnerung daran einige Anstrengung.
»Was hast du denn geschrieben?«
Emily fuhr mit der Hand durch die Luft. »Oh, dies und das. Ich habe dich so oft darüber reden hören, dass du davon träumst, Schokolade als Medizin einsetzen zu können, da fiel es mir nicht schwer, deine Worte zu wiederholen.« Sie legte den Kopf zur Seite. »Das Bewerbungsformular ist seltsam. Sie scheinen nicht viel Wert darauf zu legen, ob man bereits Erfahrung mit der Herstellung und Verarbeitung von Schokolade hat, aber ich habe natürlich Fotos von deinen besten Stücken beigelegt«, versicherte sie Christmas rasch. »Aber vor allem habe ich über deine Leidenschaft für Schokolade und neue Erfahrungen damit berichtet.« Mit dramatischer Stimme fügte sie hinzu: »Du wirst nach Frankreich reisen! Endlich!« Emily umarmte Christmas noch einmal ungestüm.
Christmas war sprachlos. Nur eine Handvoll Bewerber pro Jahr ergatterten einen Platz in Maître Le Coutres Stipendiumkurs. Es wäre verrückt, dieses Angebot nicht wahrzunehmen. Aber der Kurs fand in Frankreich statt, einem unbekannten Land, von dem sie schon immer träumte, für das sie schwärmte und vor dem sie sich trotzdem fürchtete. Schon ihr ganzes Leben lang. Vor einigen Jahren war sie beinahe schon so weit gewesen, sich auf den Weg zu machen. Doch dann waren in Sydney die Ereignisse über sie hereingebrochen, und sie hatte diese Idee verworfen, ebenso wie ihre Träume von einer Liebesbeziehung und von Kindern. Sie hatte ihr Leben verändert, das nun beständig und vorhersehbar war.
Frankreich war die Heimat ihres Vaters, den sie nie kennengelernt hatte. Das Land lag auf der anderen Seite der Erde, und sie quälte sich seit Ewigkeiten mit dem Gedanken, es zu erforschen, und mit der Angst, wohin das führen könnte. In Anbetracht ihrer Vergangenheit und ihrer Familiengeschichte fiel ihr die Entscheidung nicht leicht, das Unbekannte in ihr perfekt geordnetes Leben zu lassen.
Aber jetzt, wo die Reise ihr praktisch aufgezwungen wurde, blieb ihr wohl nichts anderes übrig, als zumindest darüber nachzudenken.
2
Eine kleine Lektüre über Schokoladenmagie
Von Peter O’Donell
Ist Schokolade gut für Sie?
In der Schokoladenapotheke wird diese Frage mit einem eindeutigen Ja beantwortet. Christmas Livingstone, die Gründerin und Besitzerin des Ladens, geht sogar noch einen Schritt weiter. Für sie ist Schokolade nicht nur gut, sondern sogar ein Heilmittel.
Von außen betrachtet könnte man glauben, dass es sich nur um einen der vielen Schokoladenläden mit Köstlichkeiten handelt, für die Tasmanien berühmt ist. Aber, wie der Name schon sagt, ist die Schokoladenapotheke viel mehr als nur ein reizendes, französisch angehauchtes Lädchen, in dem Eigenkreationen verkauft werden.
Dort findet man eine Fülle von zauberhaften Verführungen, mystische Weisheit und Heilmittel in der Form von zarter belgischer Schokolade und hausgemachten Rosenblätter-Baisers und köstlichem Tee und Kaffee.
»Ich möchte, dass meine Gäste das Gefühl haben, etwas Heilsames zu sich zu nehmen«, sagt Livingstone.
Diese Heilmittel werden nach einer »Schokoladen-Konsultation« verabreicht, bei der die verschiedenen Bestandteile der Schokolade und die botanischen Extrakte, die Livingstone damit kombiniert, auf das Wesen oder die Lebensumstände des Gastes zugeschnitten werden.
Mit der Schokoladenapotheke hat sich Ms Livingstone, eine ehemalige PR-Managerin in Sydney, die durch ihre stürmische Romanze mit Tennisspieler Simon Barton in die Schlagzeilen geriet, einen lang gehegten Wunsch erfüllt.
Ms Livingstone stammt aus Hobart, Tasmanien, und scheint sich hier in dem kleinen Städtchen Evandale gut eingelebt zu haben. Und das mit großem Erfolg. Ihr Terminkalender für private Schokoladen-Konsultationen ist fast jede Woche voll. Sie blüht auf, wenn sie das vollbringt, worauf ihr Name bereits hindeutet – ein kleines bisschen Magie.
Auf die Frage, was ihr den Antrieb dazu gibt, antwortet sie: »Eine der Regeln für mein Leben lautet, zu tun, was ich liebe, und zu lieben, was ich tue. Ich setze mir jeden Tag das Ziel, mich und andere Menschen glücklich zu machen. Das ist eine ungeheure Motivation. Wir leben in einer gestressten Gesellschaft und haben die Fähigkeit verloren, die einfachen Freuden des Lebens zu genießen, und besitzen oft nicht mehr die Weisheit, zu schätzen, wie wichtig sie sind. Kann es also einen schöneren Beruf geben?«
Nun ja, einen gäbe es da vielleicht noch: Ms Livingstone ist nicht nur die Eigentümerin einer Schokoladenapotheke, sondern sie hat auch noch eine Nische gefunden, in der sie als »gute Fee« tätig ist.
»Ich habe diese Website vor Jahren aus einer Laune heraus ins Netz gestellt. Zum Teil, um an einem Projekt zu arbeiten, das mir während einer schwierigen Änderungsphase in meinem Leben Kraft gab«, erklärt sie. »Schon bald wurde ich mit Anfragen überschüttet. Die Schokoladenapotheke verschlingt viel Zeit, daher kann ich mich nur um eine begrenzte Anzahl der Wünsche kümmern, was mir sehr leidtut. Einige Leute bezahlen mich für meine Dienste – zum Beispiel, wenn ich ihnen dabei helfe, eine Überraschungsparty auszurichten oder jemandem anonym etwas Gutes zu tun –, und einige Wünsche erfülle ich unentgeltlich. Ich tue, was in meinem kleinen Rahmen möglich ist, aber mein Ziel ist es, mithilfe der zahlenden Kunden eine Assistentin in Teilzeit einzustellen, damit ich mehr Wünsche erfüllen kann. Es gibt so viele Menschen, die dringend Hilfe brauchen.«
Im Moment handelt es sich für Ms Livingstone nur um einen Nebenjob, der ihr jedoch sehr viel Freude bereitet. »Das macht mir großen Spaß«, sagt sie. »Und natürlich bekommt jeder als Dreingabe Schokolade geschenkt. Denn jeder Tag, der mit einem Stück Schokolade endet, ist ein guter Tag.«
Als Reisejournalist kann ich mich da nur anschließen. Also setzen Sie einen Besuch der Schokoladenapotheke ganz oben auf Ihre Liste, wenn Sie diesen wunderschönen Inselstaat bereisen.
Was: Die Schokoladenapotheke
Wo: Russell Street, Evandale, Tasmanien
Wann: Geöffnet dienstags bis sonntags von 9.00 – 16.00 Uhr
Anfahrt: Evandale liegt nur zehn Minuten mit dem Auto vom Flughafen Launceston entfernt.
Christmas wählte Peters Nummer.
»Christmas Livingstone, wie ich annehme.« Seine dröhnende, warme Stimme rief eine alte Sehnsucht in ihr wach.
»Ich habe gerade den Artikel in dem Bordmagazin gelesen, das du mir geschickt hast. Es war schon gestern in der Post, aber ich habe erst jetzt Zeit gefunden, es mir anzuschauen. Der Artikel ist wunderbar, vielen Dank. Es ist immer nervenaufreibend, wenn jemand etwas über mich schreibt; meistens kommt einiges nicht so richtig rüber. Aber dieser Artikel ist der beste, den ich bisher über die Schokoladenapotheke gelesen habe.«
»Traue niemals einem Journalisten«, erwiderte er. »Gerade du solltest das wissen.«
Sie hörte an seiner Stimme, dass er lächelte. Er fehlte ihr. Peter, beständig und zuverlässig – einer der wenigen Menschen, die wussten, warum sie Sydney vor drei Jahren verlassen hatte. Er war ein Journalist alter Schule, der schon längst hätte in Rente gehen können, für den das Leben jedoch noch viel zu aufregend war. »Du bist einfach genial und ein wirklich guter Freund. Ich sollte dir einen Anteil von dem zusätzlichen Gewinn abtreten, den dieser Artikel mir sicher bringen wird.«
»Unsinn. Gib es einem armen Kind, das dringend einen Teddybär braucht.«
»Was ist dein nächstes Reiseziel?«
»Kambodscha. Wie ich höre, soll es dort ausgezeichnete Nudelgerichte geben.«
»Viel Spaß, und iss eine Portion für mich mit.«
»Das werde ich machen.« Er lachte. »Mach’s gut, Kleine.«
»Du auch. Und komm vorbei, wenn du wieder in Tasmanien bist.«
»Na klar.«
Sie legte lächelnd auf und steckte ihr Telefon in die Tasche ihrer blauen Schürze. Das Gespräch mit Peter hatte ihr den nötigen Auftrieb gegeben. Letzte Nacht hatte sie sich stundenlang Emilys begeisterte Ausführungen über das Stipendium in Frankreich angehört und versucht, Dankbarkeit und Begeisterung zu heucheln. In gewisser Weise empfand sie beides sogar, aber es war so überraschend gekommen, und sie hatte sich kaum auf ihre Arbeit konzentrieren können. Schließlich hatte sie sich bei Emily entschuldigt und ihr gesagt, dass sie nicht die halbe Nacht aufbleiben und sich mit ihr unterhalten könne, weil sie ein anstrengendes Wochenende vor sich habe. Emily hatte natürlich dafür Verständnis gezeigt, aber Christmas hatte danach etliche Stunden wach in ihrem Bett gelegen, auf Emilys tiefe Atemzüge von der Klappcouch auf der anderen Seite des Zimmers gelauscht und beunruhigt über eine Reise nach Frankreich nachgedacht.
Aber jetzt, aufgemuntert durch Peters Worte, sah sie sich in ihrem schönen Laden um und freute sich darüber, am Karfreitag allein hier zu sein und ihrer Fantasie freien Lauf lassen zu können. Ihr Blick blieb an dem Logo hängen.
In der Grundschule war es eine Zeit lang für die Mädchen in ihrer Klasse der letzte Schrei gewesen, einen Schwamm in schwarzen Kaffee zu tauchen und damit über ein weißes Blatt Papier zu streichen. Wenn die Flüssigkeit getrocknet war, zündeten sie ein Streichholz an und verkohlten die Ränder des Blatts. Der Geruch nach Kaffee und Rauch, den das Papier dann verströmte, war berauschend und gab Christmas das Gefühl, bereits erwachsen zu sein. Mit Tinte schrieben sie dann etwas auf das Blatt, um einen Brief aus alten Zeiten vorzutäuschen.
Die Erinnerungen daran hatten sie inspiriert, als sie das Logo für die Schokoladenapotheke entworfen hatte; das Ergebnis war ein tintenfarbenes Rechteck mit abgerundeten, schwarz umrandeten Ecken. Darüber stand in Schnörkelschrift Die Schokoladenapotheke. Darunter befand sich die Zeichnung einer Frau in einem viktorianischen Kleid auf einem Hochrad – ein Tribut an die Stadt, die für ihre jährlichen Hochradrennen bekannt war. Der Korb in der Hand der Frau quoll über von Kräutern und Blumen – ihre Heilmittel –, und ihr Haar fiel ihr locker über den Rücken und stand im scharfen Gegensatz zu ihrer steifen viktorianischen Kleidung. Trotz des strengen viktorianischen Stils harmonierte das Design mit dem georgianischen Gebäude, in dem ihr Geschäft lag.
Als Christmas den Laden entdeckt hatte, ragte aus dem überwucherten Rasen vor dem Gebäude ein Pfahl mit einem handgeschriebenen Schild, auf dem es hieß: Vom Eigentümer zu verkaufen oder zu vermieten. Sie hatte zwar während ihrer Tätigkeit in der Werbebranche genügend Geld beiseitegelegt, um eine Anzahlung zu leisten, aber ohne regelmäßiges Einkommen würde ihr die Bank keinen Kredit für einen Kauf bewilligen. Also einigte sie sich mit dem Besitzer auf einen Mietvertrag, der ihr die Möglichkeit zu einem Kauf offenließ, in der Hoffnung, den Laden eines Tages ihr Eigen nennen zu können. Deshalb waren solche Artikel wie der von Peter so wichtig für sie. Sie machte sich auf eine Durststrecke gefasst und durfte sich keine Fehler erlauben.
»Die meisten Geschäfte gehen im ersten Jahr pleite«, hatte ihre Mutter Darla wenig hilfreich verkündet, als Christmas ihr von der Eröffnung ihres Ladens erzählt hatte. »Na ja, ich denke eben praktisch«, hatte sie sich verteidigt, als sie Christmas’ bestürzten Gesichtsausdruck bemerkt hatte.
Aber nach drei Jahren war Christmas immer noch hier.
Sie hatte von Anfang an gewusst, dass sie mit einem abwechslungsreichen Angebot aufwarten musste, wenn sie bestehen wollte, vor allem in diesem verschlafenen Städtchen abseits der Touristenpfade. Und sie konnte, obwohl ihr das am meisten am Herzen lag, ihren Lebensunterhalt nicht nur mit dem Verkauf von Schokolade verdienen. Hier konnte man sich in jedem örtlichen Supermarkt eine große Tafel Schokolade zu einem Fünftel des von ihr verlangten Preises kaufen. Deshalb musste sie die Kunden mit einem überwältigenden Sinneserlebnis anlocken. Sie nahm ein paar hübsche Nippsachen in ihr Sortiment auf und gab einigen anderen kleinen Geschäftsleuten aus der Gemeinde die Möglichkeit, ihre Waren an diesem schönen Ort zu verkaufen oder ihre Dienstleistungen dort anzubieten. Nun stand in goldener Schrift an der Eingangstür: Schokolade * Blumen * Haushaltswaren * Massage.
Beim Renovieren des vorderen Raums in dem alten Gebäude hatte sie versucht, das Ursprüngliche der früheren Apotheke zu erhalten, aber gleichzeitig frischen Wind und französischen Charme hineinzubringen. Wegen der Vorschriften für den Denkmalschutz musste sie einige Anträge beim Gemeinderat stellen, bevor sie die massiven Holztüren am Eingang durch eine Glastür, die Passanten in den Laden locken sollte, ersetzen durfte. Eine Reihe von Lampen und zwei Kronleuchter sorgten nun für warmes Licht im Verkaufsraum.
Die alte Apothekerkommode mit vierundzwanzig Fächern aus dunklem Holz hatte sie hinter die Verkaufstheke gestellt. Einige der muschelförmigen Griffe aus Messing waren noch erhalten, andere im Laufe der Zeit durch silberfarbene Nachbildungen ausgetauscht worden. Auf die Kommode hatte sie drei hohe weiß getünchte Regale gestellt. Die Theke war mit einer Marmorplatte versehen, auf der man die verschiedenen Inhaltsstoffe mahlen, kleinhacken und mischen konnte, um sie dann in einem Mörser weiter zu zerkleinern. Hier stand auch eine Bank für die Kunden, die eine Schokoladen-Konsultation wünschten.
Auf dieser Bank hatte sie Tu Pham kennengelernt. Der Laden war erst seit wenigen Wochen geöffnet gewesen, und Christmas hatte hochfliegende Pläne über Schokolade als Heilmittel gehabt, ohne sich sicher zu sein, dass daraus etwas werden würde. Tu war in die Schokoladenapotheke gekommen, um sich von der guten Fee etwas für den dreizehnten Geburtstag ihrer Nichte zu wünschen.
Christmas hatte gerade eine Mousse gemacht. Sie fand es sehr befriedigend, aus unappetitlichem Eiweiß und Zucker einen cremigen, luftigen und schneeweißen Schaum zu schlagen. Während Christmas mit dem Schneebesen hantierte, erzählte ihr Tu, dass ihre Nichte Lien bei ihr lebte, seit ihre Eltern vor fünf Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren. Und als wäre das noch nicht schlimm genug, litt Lien auch noch unter juveniler Arthritis. Ihre Gelenke waren steif und geschwollen und schmerzten, sie hatte kräftezehrende Fieberschübe und fühlte sich oft unwohl und erschöpft. Sie war ein kluges Mädchen und ein großer Fan von irischem Tanz. Wenn ihre Medikamente gut anschlugen und ihre Arthritis unter Kontrolle war, nahm sie Tanzstunden.
Christmas hörte Tu mitfühlend zu und stellte sich einen Moment lang vor, wie ein vietnamesisch-australisches Mädchen begeistert einen irischen Tanz übte.
»Aber vor Kurzem hat sie einen Rückfall erlitten. Ihr Körper reagiert nicht mehr auf den Medikamentencocktail. Ich würde ihr sofort alle Schmerzen abnehmen, wenn ich das könnte.« Tu wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel.
Christmas schob Tu eine Kristallschale mit frisch zubereiteter Erdbeermousse hin, in die sie einen Tropfen ätherisches Geraniumöl gegeben hatte.
»Danke.« Tu nahm einen Silberlöffel und tauchte ihn in die schimmernde Mousse.
»Sicher fehlen ihr ihre Schulfreundinnen«, meinte Christmas. »Dreizehn ist ein schwieriges Alter.«
»Allerdings. Ihre beiden besten Freundinnen besuchen sie nach der Schule, aber sie ist völlig erschöpft. Depressiv. Und wer könnte das nicht nachvollziehen? Sie sollte jetzt eigentlich mit ihren Freundinnen abhängen, sich überlegen, was sie zum Schulball anziehen soll, und an Jungs denken. Stattdessen ist sie fast ständig ans Bett gefesselt wie ein alter Mensch.«
Tu leckte den Löffel ab und riss begeistert die Augen auf. »Mmm! Das schmeckt hervorragend!«
»Danke. Es ist ein Experiment.«
»Nun, da spiele ich gern das Versuchskaninchen.«
Normalerweise hätte Christmas sich mehr über das Kompliment gefreut, aber sie musste an Lien denken. Das war nicht fair. Ein dreizehnjähriges Mädchen sollte nicht von solchen Schmerzen geplagt sein. Und sie war deprimiert. Christmas wusste nur zu gut, wie sehr eine Depression einen nach unten zog – man fühlte sich nur noch leer und verzweifelt. Schließlich schottete man sich von allem ab, bis das innere Feuer erlosch und einem alles zu viel wurde.
Eine Frau in einem hellgelben Anorak kam an die Theke und riss sie aus ihren Gedanken. »Bitte entschuldigen Sie mich einen Moment.« Christmas tätschelte Tus Hand.
Sie bediente die Kundin, legte ein Dutzend hausgemachter Pralinen in eine Schachtel und verschnürte sie mit einer Schleife. Als sie zurückkehrte, hatte Tu die Hälfte der Mousse verzehrt und wirkte viel fröhlicher.
»Das ist wirklich gut!«, schwärmte sie und fuhr mit dem Löffel durch die Luft.
»Warten Sie, ich gebe Ihnen etwas für Lien mit.« Christmas lief in die Küche, löffelte ein wenig von der Mousse in einen Kaffeebecher aus Pappe und verschloss ihn mit einem Deckel.
Sie ging durch die Schwingtüren zurück an der Theke. »Eine schönere Verpackung habe ich leider nicht gefunden.« Christmas reichte ihr den Becher.
»Das ist wunderbar. Sie wird sich sehr darüber freuen«, erwiderte Tu.
»Was kann ich tun, um Ihnen zu helfen?«
Tu wippte nervös und offensichtlich peinlich berührt mit dem Fuß. »Eine große irische Tanzgruppe ist im Augenblick auf Tour in Australien und wird nächste Woche in Hobart auftreten. Lien wird es sehr schwerfallen, sich den Auftritt anzuschauen, weil sie nicht gut sitzen kann. Aber wenn wir Eintrittskarten bekommen könnten, würden wir uns einen speziellen Rollstuhl leihen, ihr Wärme- und Stützkissen besorgen und uns um einen barrierefreien Zugang kümmern. Ich weiß, das ist viel verlangt, und wir bräuchten auch noch eine Übernachtungsmöglichkeit, weil die lange Autofahrt sehr anstrengend für sie sein wird …« Bei der Aufzählung all dieser Schwierigkeiten verdüsterte sich Tus Miene.
»Überlassen Sie das mir«, sagte Christmas. »Ich habe das Gefühl, dass das zu schaffen ist. Lien wird eine wunderbare Zeit haben. Ich werde versuchen, Eintrittskarten für sie und zwei ihrer Freundinnen und ein Hotelzimmer mit einem besonders weichen Bett zu bekommen.«
»Wirklich?« Vor Dankbarkeit wurden Tus Augen feucht.
»Na klar. Lien hat ein wenig Spaß verdient, und wir werden ihr das ermöglichen. Aber verraten Sie ihr noch nichts, für den Fall, dass es doch nicht klappt. Ich werde Sie anrufen, sobald ich mehr weiß. Und falls ihr die Mousse schmeckt, können Sie in der Zwischenzeit jeden Tag vorbeikommen und sich eine Portion davon abholen.«
Tu faltete die Hände, legte die Fingerspitzen an die Nase und starrte Christmas an, als könne sie ihr Glück kaum fassen. »Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank.«
»Es ist mir ein Vergnügen. Und das meine ich ernst.«
Später an diesem Nachmittag hatte ihr Tu eine SMS geschickt und ihr mitgeteilt, dass Lien die Mousse sehr gut geschmeckt habe; sie sei plötzlich richtig gut aufgelegt gewesen. Seit sie sie gegessen habe, lächle sie und mache Witze. Es muss eine Zauber-Moussesein!, hatte sie hinzugefügt.
Und Christmas, die gerade den Boden gefegt hatte, hatte innegehalten und sich auf ihren Besen gestützt, als ihr ein prickelnder Schauer über den Rücken gelaufen war.
Geraniumöl war dafür bekannt, eine beruhigende Wirkung auf das Nervensystem zu haben, die Stimmung zu heben, Hoffnung zu erwecken und Depressionen zu lindern. Zumindest hatte sie das gelesen. Konnte das Geraniumöl in der Erdbeermousse Liens Stimmung gehoben haben?
Ihr Herz klopfte heftig. Das war durchaus möglich. Und es gab etliche Forschungen über die gesundheitsfördernde Wirkung von dunkler Schokolade. Sollte beides der Wahrheit entsprechen, waren ihre Schokoladenkreationen vielleicht tatsächlich Heilmittel. Bisher hatte sie das für zu weit hergeholt gehalten, und dass ihre Mutter bei dieser Idee nur die Augen verdreht hatte, war nicht sehr hilfreich gewesen, aber vielleicht, nur vielleicht war doch was dran. Tus Rückmeldung hatte es auf jeden Fall bestätigt. Und von diesem Augenblick an hatte sie nur noch nach vorne geschaut.
Die Fahrt zu der Aufführung der irischen Tanztruppe war ein voller Erfolg gewesen. Tu, Lien und ihre Freundinnen hatten ein wunderschönes Wochenende in Hobart verbracht. Christmas hatte ihre Beziehungen aus der Zeit in der Werbebranche spielen lassen und mithilfe ihrer Freundin Mary Hauser, einer Journalistin, von der Tanzgruppe Gratistickets bekommen. Es war ihnen auch gelungen, ein Hotel für alle zu finden, und Lien hatte ein großes Bett gehabt, mit genügend Platz für die vielen, für sie nötigen Stützkissen. Am Tag nach ihrer Rückkehr hatten Tu und Lien Christmas besucht, und das Mädchen hatte vor Begeisterung gestrahlt. Schon bald darauf wurde Lien Christmas’ Testesserin.
»Grässlich!«, erklärte sie, nachdem sie Christmas’ deutsche Schokoladenmuscheln mit Kamille und Limette probiert hatte.
»Lien!«, rief Tu peinlich berührt. »Tut mir leid, Christmas.«
»Kein Problem. Es ist besser, wenn ich das von Lien zu hören bekomme als von einem zahlenden Kunden.« Christmas zwinkerte dem Mädchen zu.
Ungerührt griff Lien nach ihrem Stock, um sich aus dem Kühlschrank ein Glas Milch zu holen. »Vielleicht schmeckt es Schafen?«, frotzelte sie.
»Gute Idee. Ich werde den Rest zum Tierheim in Longford bringen.«
Tu reichte Christmas eine Schüssel mit Nudeln. »Bleibst du zum Abendessen?«
»Sehr gern.«
Lien zu helfen, war sehr rasch Christmas’ Hauptmotivation geworden.
Regel Nummer eins: Tue, was du liebst, und liebe, was du tust.
Und Christmas liebte ihren Laden. Das bröckelige Mauerwerk und den alten Kamin, in dem sie kein Feuer machen konnte, weil das die Schokolade verderben würde. Sie war immer wieder begeistert von Cheyennes herrlichen Blumen, die neben dem Schokoladenschaukasten wie eine Pyramide aufgebaut waren und an einen farbenprächtigen, duftenden Wasserfall erinnerten. Und von dem Massageraum in der hinteren Ecke, einem heiteren kleinen Rückzugsort zur Heilung und Entspannung, wo Abigail jeden Tag Muskeln lockerte und Stress abbaute. (Regel Nummer sechs: Eine Massage ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit.) Und sie liebte die Ecken und Winkel mit den Gartenkörben aus Holz, den Weinfässern und den Brotkästen aus Metall, die handgemachten Seifen, die Flaschen mit Blütenwasser, die Keramikvögel, die Teekannen, den getrockneten Lavendel, die Blechdosen, die bezogenen Stühle, die Uhren, die Einmachgläser, die spitzenbesetzten Tischtücher.
Und genau deshalb sollte sie nach Frankreich fahren. Sie hatte einen ungewöhnlichen Berufsweg eingeschlagen. Er war ihr Leben, und sie wäre verrückt, wenn sie nicht fahren würde. Allerdings musste sie jegliche Gedanken oder Emotionen, die ihren Vater betrafen, aus ihrem Kopf verbannen und sich einfach nur auf die nackten Tatsachen konzentrieren: Dass sie nichts lieber tat, als Schokolade zu verarbeiten, und dass Maître Le Coutre ein virtuoser Chocolatier war.
Fahr nach Frankreich, befahl sie sich. Fahr nach Frankreich und vergiss deinen Vater.
3
Im Altenheim Green Hills in Oatlands wartete Elsa van Luc ungeduldig auf die Rückkehr ihres Enkels. Er war am Tag zuvor direkt vom Flughafen zu ihr gekommen, hatte aber sein Taxi auf dem Parkplatz warten lassen und war nur kurz bei ihr gewesen. Obwohl sie sich nichts lieber gewünscht hätte, als dass er länger blieb, hatte sie ihn nach Hause geschickt, damit er sich ausruhen konnte. Es gab nichts Schlimmeres als eine Großmutter, die zu sehr klammerte.
Sie hatte Lincoln bereits kommen gehört, bevor sie ihn sah, und ihr Herz hatte vor Freude schneller geschlagen. Vor der Tür ihres freistehenden Bungalows hatte er sie gerufen, aber ihre Antwort nicht abgewartet. Er war einfach hereingeplatzt, wie Hunderte Male zuvor, als er mit seinem Fahrrad zu ihrer Farm kam, um sie zu besuchen und mit ihr mit Rohzucker bestreuten Apfelkuchen zu essen. Gestern hatte er eine weiße Schachtel dabeigehabt.
Elsa hatte ihn nur an seiner Stimme und an seinem Lächeln erkannt – alles an ihm schien mit Haaren überwuchert zu sein.
»Hi, Nan.« Er beugte sich über ihren Rollstuhl, küsste sie auf die Wange und umarmte sie. Sein Bart kitzelte sie an der Nase.
»Meine Güte, wer besucht mich denn da? Ein Yeti?«
Er drückte ihr die Schachtel in die Hand, und sie umklammerte sie mit ihren gekrümmten Fingern, an denen die geschwollenen Knöchel stark hervortraten. Als sie den Duft nach Schokolade wahrnahm, hielt sie sich das Päckchen an die Nase, atmete tief ein und schloss genüsslich für einen Moment die Augen. Mit zweiundneunzig Jahren musste man jeden Augenblick auskosten, so gut es ging. Der Duft rief ihr die Erinnerung an die Zeit zurück, in der sie als junges Mädchen in einer vornehmen Konditorei gearbeitet hatte. Sie hatte ein weißes Spitzenhäubchen getragen und Silber polieren müssen und war den ganzen Tag ohne Pause auf den Beinen gewesen.
»Ich bin direkt hierhergekommen, mit einem kleinen Umweg über den Schokoladenladen.« Lincoln zog sich einen wuchtigen Stuhl an das Erkerfenster, wo sie in der vergangenen Stunde in dem Buch Bis(s) zum Morgengrauen gelesen hatte, dem aktuellen Werk von der Liste des Buchclubs. Lulu Divine, die im Bungalow neben ihr wohnte, war so empört über Elsas Wahl gewesen, dass Elsa ihre Stellung als Vorsitzende des Buchclubs in Gefahr sah. Lulu könnte bei der nächsten Wahl versuchen, sie zu stürzen. Sie konnte sich jetzt bereits gut vorstellen, wie Lulu eine gehässige Schmährede halten würde. Oh, diese Frau war wirklich eine Plage. Sie war früher Rodeoreiterin gewesen und auch jetzt immer noch ein sehr selbstbewusstes Mädchen (mit zweiundsiebzig war sie im Vergleich zu den anderen Bewohnern des Altenheims tatsächlich noch ein Mädchen), das mit achtzehn Jahren Australien verlassen und sich in Amerika dem harten Konkurrenzkampf im Rodeoreiten gestellt hatte. Für Bellas albernes, zimperliches Verhalten und ihre Opferrolle hatte sie sicher kein Verständnis. Nein, Lulu Divine würde dem Vampir Edward in null Komma nichts zeigen, wo er hingehörte.
Elsa hingegen hatte eine Schwäche für diesen Cullen-Jungen entwickelt. Typisch für sie. Nichts hatte sich geändert. Manchmal wünschte sie sich, sie wäre in ihrer Jugend mehr wie Lulu gewesen. Ihr Ehemann Ebe war zwar kein Vampir gewesen, aber ein großes Kind, das niemals erwachsen wurde und keine Verantwortung übernehmen wollte. Ihm musste immer alles zufliegen. Harte Arbeit wurde in Ebes Augen gründlich überschätzt.
»Du sollst mir doch nichts mitbringen«, schalt sie ihren Enkel, aber sie wusste, dass Lincoln sie durchschaute und ihr den gespielten Vorwurf nicht abnahm. Sie hatte ihn schrecklich vermisst. »Und du hättest dich erst einmal zu Hause ausruhen sollen.«
Bei diesen Worten befiel sie plötzlich Heimweh, und sie dachte an das Haus, das sie in der Stadt gekauft hatte, als ihr die Farmarbeit nach Ebes Tod zu viel geworden war. Jetzt wohnte Lincoln während seiner kurzen Aufenthalte zwischen seinen Reisen dort. Es gefiel ihr, dass er einen Ort hatte, an den er zurückkehren konnte. Einen Ort, der nicht weit von ihr entfernt lag.
»Ich leide noch ein wenig unter Jetlag«, gab er zu. »Deshalb habe ich es nicht gewagt, selbst zu fahren. Im Geiste bin ich noch auf der anderen Seite der Erde.«
»Ich habe deine E-Mail bekommen«, sagte Elsa. »Was für ein Glück für mich, dass du dein Projekt ein wenig früher als erwartet abschließen konntest.« Sie kniff die Augen zusammen.
Er setzte sich und stützte die Arme auf die Oberschenkel. Dann richtete er seine blauen Augen auf sie, deren irisierende Farbe an die Federn eines Blauhähers erinnerten. Sie glichen Toms Augen, aber anders als bei seinem Vater wirkten sie nicht matt, sondern lebendig und interessiert. »Ja«, sagte er und beobachtete sie aufmerksam.
Eine Weile schauten sie sich an. Ohne Zweifel steckte Jenny dahinter.
»Ich nehme an, du bist eher zurückgekommen, weil deine Schwester dich darum gebeten hat«, sagte Elsa.
Er zögerte, als wolle er abwägen, wie viel er ihr verraten sollte. »Sie hat sich nicht ohne Grund Sorgen gemacht. Diese Schwester, wie heißt sie noch, Susan …?«
»Sarah.«
»Richtig, Sarah. Sie hat Jen in einer E-Mail mitgeteilt, dass sie sich Sorgen um dich mache.«
»Ach ja?« In Elsa flackerte kurz Ärger auf, der jedoch sofort wieder verflog. Ihre Lieblingskrankenschwester Sarah konnte in ihren Augen nichts verkehrt machen.
»Sie hat erwähnt, dass Dad Schwierigkeiten gemacht hat.«
Lincoln versuchte offensichtlich, etwas aus ihr herauszubekommen. Viel schien er nicht zu wissen, aber er hatte wegen ihr seine Forschungsreise abgekürzt. Das war sehr schmeichelhaft. Aber wer sollte denn sonst vorbeikommen, wenn nicht er? Sie machte sich da keine Illusionen. Für Jenny war die Reise von Nord-Queensland mit dem jungen Nathan im Rollstuhl viel zu beschwerlich. Und was den Rest der Familie anbelangte: Elsas ältester Sohn Matthew war in Vietnam gefallen, ihr zweiter Sohn Jake war vor vierzig Jahren von Australien nach London ausgewandert, und ihr jüngster Sohn Tom war derjenige, der verrückt spielte.
»Also, wie geht es dir wirklich?«, fragte Lincoln ernst. Die Betroffenheit in seiner Stimme machte sie traurig. Er sollte sich nicht den Kopf wegen einer alten Frau zerbrechen.
Sie löste die Schleife an der Schachtel und las laut die Aufschrift auf dem sepiafarbenen Aufkleber vor. »Die Schokoladenapotheke. Ich glaube, von diesem Laden habe ich noch nie etwas probiert. Vielen Dank.«
»Gern geschehen. Aber versuch nicht, das Thema zu wechseln.«
Sie schluckte ihren Ärger hinunter. Die jungen Leute verstanden einfach nicht, dass es keinen Sinn hatte, Trübsal zu blasen und sich zu beklagen. Das änderte nichts, also sollte man damit nicht seine Zeit verschwenden. Stattdessen galt es, sich zu beschäftigen und immer wieder ein neues Ziel vor Augen zu haben, mochte es auch noch so unbedeutend sein. Selbst in ihrem Alter sollte man immer noch nach mehr streben. Tatsächlich war das lebenswichtig. Das sagte sie sich auch immer wieder, wenn sie voll Stolz ihren Namen am schwarzen Brett im Speisesaal las: Vorsitzende des Buchclubs: Elsa van Luc, Wombat Bungalow.
»Der Physio-Terrorist war diese Woche ganz begeistert von der Arbeit mit mir im Pool«, sagte sie fröhlich und versuchte, seine Bedenken zu zerstreuen. »Er sagte, es sei fantastisch, wie gut ich meine Hüften wieder bewegen kann. An Silvester werde ich einen Tanz an der Stange vorführen.«
»Diesen Partytrick würde ich zu gern sehen«, erwiderte Lincoln. Es war so leicht, ihn zufriedenzustellen.
»Hast du deinen Vater schon besucht?«, lenkte sie rasch ab.
»Ich komme direkt vom Flughafen.« Er warf ihr einen Blick zu. »Sobald ich den Jetlag überwunden habe, melde ich mich bei ihm. Ich wollte zuerst zu dir und mich vergewissern, dass es dir gut geht.«
Elsa öffnete die Schachtel und stieß einen Laut der Begeisterung aus. Einige der Pralinen waren oben mit einem filigranen Blumenmuster versehen. Ein paar waren geformt wie eine Kaffeetasse, mit weißer Schokolade als Milch. Andere waren nicht nur in farbenfrohe Folie verpackt, sondern auch mit winzigen Schleifen geschmückt. Und es gab sogar kleine, handbemalte Feen mit glitzernden Flügeln. »Sie sind beinahe zu schön, um sie zu essen«, schwärmte sie. »Jede dieser Pralinen ist ein Kunstwerk.«
»Der kleine Laden ist wunderschön«, sagte er. »Die Frau, die ihn führt, ist auch eine gute Fee.«
»Eine gute Fee?«
»Anscheinend. Ich habe am Flughafen einen Werbeprospekt gefunden.« Er klopfte seine Taschen ab, gab jedoch auf. »Wie auch immer, sie ist wohl eine professionelle Wünscheerfüllerin oder so etwas in der Art. Man kann sich an sie wenden, wenn man einem Familienangehörigen oder einem Freund einen Wunsch erfüllen möchte. Ist das nicht eine tolle Idee?«
Elsa schob sich eine Haselnusspraline in den Mund und stöhnte, als die zarte Schokolade schmolz und ihre Geschmacksknospen kitzelte, während ihr der Duft in die Nase stieg.
Lincoln grinste. Sie hielt ihm die Schachtel hin, aber er lehnte mit einer Handbewegung ab. Dann gähnte er.
»Es gibt noch einiges zu besprechen.« Elsa fuhr sich mit der Zunge über ihr Gebiss, um sich keinen Krümel der Schokolade entgehen zu lassen. »Aber jetzt musst du dich erst einmal ausschlafen.« Sie zog eine ihrer dünnen Augenbrauen nach oben und deutete auf sein Gesicht. »Und duschen und dich rasieren.«
Er fuhr sich mit der Hand über sein langes, zerzaustes Haar und gähnte wieder. Seine Augen tränten vor Müdigkeit.
»Ich will alles über den Dschungel hören, aber nicht jetzt«, erklärte sie. »Ein Grund, um mich bald wieder zu besuchen. Aber jetzt fahr heim. Die Taxiuhr läuft, und es wird schon dunkel.«
Lincoln legte seine große, schwielige Hand auf ihre knotige, geäderte Hand. »Ich brauche keinen Vorwand, um meine Lieblingsgroßmutter zu besuchen.«
»Pah, außer mir hast du keine Großeltern mehr. Und das nutze ich natürlich aus, so gut ich kann. Komm wieder, wenn du dein Gesicht unter all den Haaren wiedergefunden hast.«
Er stand auf und küsste sie auf die Wange. Sie tätschelte seine Schulter. »Du bist ein guter Junge.«
Er grinste, und sie erinnerte sich plötzlich daran, als er ihr mit sechs Jahren bei der Gartenarbeit geholfen und mit beiden Händen voll Laub lächelnd vor ihr gestanden hatte.
»Danke, Nan. Bis bald.«
Als er mit großen Schritten das Zimmer verließ, hatte sie unversehens eine große Sehnsucht verspürt.
Und nun wartete sie wieder auf ihn. Wieder lag das Buch Bis(s) zum Morgengrauen aufgeschlagen auf ihrem Schoß, aber sie konnte sich nicht darauf konzentrieren. Stattdessen hielt sie am Fenster Ausschau nach seinem Wagen – eigentlich war es ihr Wagen –, und wartete darauf, ihn die Auffahrt herauftuckern zu hören. Sie wartete wie ein treuer Hund. Und überlegte sich, wie sie ihn dieses Mal dazu bringen konnte, länger bei ihr zu bleiben.
Es war ihr unangenehm, dass sie wegen seines Besuchs so aufgeregt war. Und sie fühlte sich unendlich schuldig, weil sie ihren Enkel mehr liebte als ihren Sohn.
Sie schämte sich dafür, dass sie sich, wenn sie ehrlich mit sich selbst war, wünschte, er würde für sie sein Leben ändern. Keine Reisen mehr um die ganze Welt. Sie wollte, dass er sesshaft wurde. Eine Frau fand, heiratete und Kinder in die Welt setzte. Sosehr sie ihren Enkel auch liebte – manchmal erinnerte sie seine lässige Einstellung zum Leben an ihren Mann. Obwohl Lincoln viel selbstloser und zuverlässiger war als Ebe.
Natürlich wollte sie nicht, dass er ihr Leben nach ihr ausrichtete. So egoistisch war sie nicht. Sie war eine alte Frau, und er war ein junger Mann. Da regierte das Gesetz der Natur.
Aber trotzdem wäre es schön, wenn sich alles irgendwie so fügen würde …
Vor allem, so wie die Dinge mit Tom jetzt standen. Wenn sie an ihren jüngsten Sohn dachte, hatte sie das Gefühl, als gieße ihr jemand einen Eimer kaltes Wasser über den Kopf. Nicht zum ersten Mal fragte sie sich, warum sich Lincoln und sein Vater so sehr voneinander unterschieden.
Natürlich gab es darauf eine Antwort. Lincoln hatte sich zum Teil für ein Weltenbummlerdasein entschieden, weil er nicht lange mit seinem Vater zusammen sein wollte. Die beiden Männer rieben sich aneinander wie zwei Feuersteine. Tom war mit Lincoln immer zu hart umgesprungen, das war allen aufgefallen. Und deshalb hatte Lincoln auch in seiner Kindheit mehr Zeit bei ihr als zu Hause verbracht. Tom war ein Narr und zu dickköpfig, um zuzugeben, dass er ein schlechter Vater gewesen war.
Aber sie hatte noch eine Chance. Sie musste nur etwas finden, was Lincoln stark genug motivieren würde, um hierzubleiben. Es war eine Herausforderung, wie eine Partie Schach, und sie mochte Herausforderungen. Damit konnte sie sich in den schlaflosen Nächten beschäftigen, fleißig wie ein Bienchen, wenn sie in ihrem Bett lag und nur die roten Lampen der Notrufschalter in ihrem Bungalow sie daran erinnerten, dass sie nicht allein und das Hilfspersonal in dieser gut betreuten Anlage in unmittelbarer Nähe war.
Sie hörte den Honda knirschend die Auffahrt heraufkommen und schlug ihr Buch zu.
Herausforderung angenommen.
An: Joseph Kennedy; Christmas Livingstone; Darla Livingstone
Von: Valerie Kennedy
Betreff: Terminankündigung!
Liebe Familie,
es ist so weit – Archie hat mir die entscheidende Frage gestellt! Na ja, das klingt ein wenig zu dramatisch. Genau genommen haben wir bei Fish und Chips beschlossen, dass es nach zehn Jahren und drei gemeinsamen Kindern allmählich Zeit wird zu heiraten. Wir haben uns dafür den 29. Juli ausgesucht. Eine einfache Trauung in der Kirche, mit anschließendem Empfang bei uns im Garten. Nichts Besonderes, keine großen Traditionen. Obwohl ich dich, Dad, fragen möchte, ob du mich zum Altar führen willst. Und Christmas, willst du meine Brautjungfer sein? Mum, glaubst du, dass du kommen kannst?
Val xx
❉
An: Valerie Kennedy; Christmas Livingstone; Darla Livingstone
Von: Joseph Kennedy
Betreff: Re: Terminankündigung!
Mein kleiner Schatz, ich gratuliere euch beiden. Und natürlich werde ich dich gern zum Altar führen. Es wird mir eine Ehre sein. Ruf mich heute Nachmittag an.
Dad xx
Christmas hatte das Gefühl, einen Schwamm verschluckt zu haben. Einen großen, dicken Schwamm, der ihren Speichel aufsaugte. Die Zunge klebte ihr am Gaumen. Nur gut, dass Val ihr diese Neuigkeit per E-Mail und nicht persönlich mitgeteilt hatte.
Sie ließ die Schokoladentafel auf die Marmorplatte fallen, atmete tief ein und strich mit den Händen über ihre Schürze. Die Spitze an dem herzförmigen Ausschnitt ihres Kleids fühlte sich plötzlich kratzig an, und sie zupfte hastig daran.
Sie freute sich für Val. Ganz klar. Sie und Archie waren schon so lange zusammen, und ihre Beziehung schien sehr stabil zu sein. Und glücklich. Warum sollten sie nicht heiraten? Und es war eine Ehre, ihre Brautjungfer sein zu dürfen. Warum also fühlte sie sich so merkwürdig?
Schließlich verlor sie ihre Schwester nicht. Eigentlich würde sich nichts ändern. Val und Archie wohnten schon lange zusammen und hatten drei Jungen, also würde es keine größere Veränderung geben, die das Verhältnis zwischen den Schwestern belasten könnte.
Sie begann, die Schokolade in eine kleine Schüssel zu reiben. Ein ungutes Gefühl breitete sich langsam, aber unaufhaltsam von ihrer Körpermitte aus, durchdrang ihre Brust und wanderte ihre Beine hinunter.
Dieses quälende, überwältigende Gefühl war Eifersucht, wie sie entsetzt feststellte. Sie war tatsächlich eifersüchtig.
Aber es ging nicht um die Hochzeit – sondern um Joseph.
An: Joseph Kennedy; Valerie Kennedy; Darla Livingstone
Von: Christmas Livingstone
Betreff: Re: Terminankündigung!
Meine kleine Val heiratet!!! Wie aufregend! Glückwunsch! Ja, natürlich werde ich deine Brautjungfer sein. Wir sprechen uns bald! 🙂 Liebe Grüße xxx
❉
An: Valerie Kennedy; Christmas Livingstone; Joseph Kennedy
Von: Darla Livingstone
Betreff: Re: Terminankündigung!
Warum willst du etwas ändern, was bisher gut geklappt hat? Valerie, ich weiß, dass du glaubst, das Richtige zu tun, aber, ganz ehrlich, eine Ehe ist nicht immer so, wie man sich das vorstellt. (Sag ihr das, Joseph – du hast schließlich schon zwei gescheiterte Ehen hinter dir.) Bei dir und Archie läuft es doch gut, also macht euch das nicht kaputt.
Ich habe sehr viel Arbeit und sollte um diese Zeit eigentlich in West-Queensland sein. Aber wenn ihr bei eurem Plan bleibt, werde ich auf jeden Fall versuchen zu kommen.
Mum
❉
An: Christmas Livingstone
Von: Valerie Kennedy
Betreff: Was zum Teufel ist mit unserer Mutter los?!
Als Christmas neun Jahre alt war, hatte sie sich ihren leiblichen Vater so vorgestellt wie die französische Cartoonfigur Pepe, das Stinktier aus der Trickfilmserie Looney Tunes. Christmas’ Mutter hatte ihr nur erzählt, dass ihr Vater ein zwanzigjähriger umherziehender Jongleur aus Frankreich war, den sie nur »flüchtig« gekannt hatte (was immer das auch heißen mochte). Er war nicht auf ihrer Geburtsurkunde eingetragen. Und auch sonst niemand. Als Erwachsene hatte Christmas Zweifel gehegt, ob es ihn überhaupt gegeben hatte. Sie vermutete, dass Darla ihn erfunden hatte, um zu vertuschen, dass sie sich nicht mehr an Christmas’ Vater erinnern konnte.
Aber als Kind hatte sie sich vorgestellt, dass ihr Vater schwarzes Haar mit einem breiten weißen Streifen darin hatte, das er zu einer Tolle frisierte. Er besaß stark ausgeprägte Backen, die er hingebungsvoll an das Objekt seiner zügellosen Begierde presste – ihre Mutter. Wenn er Darla an sich zog, flogen aus seiner Brust Cartoon-Herzchen, und aus seinen Augen schossen Sternchen, weil sie so unfassbar schön war. Er war stürmisch und unglaublich romantisch. Eine Rose zwischen den Zähnen brachte er ihrer Mutter ein Ständchen und flüsterte ihr atemlos französische Gedichte ins Ohr. Abgesehen davon, dass Pepe der schwarz-weißen Katze, in die er sich verknallt hatte, ungeniert nachstellte und sie sexuell belästigte und roch wie, nun ja, wie ein Stinktier, war er der Traum eines jeden Mädchens.
Später, als Christmas ein Teenager war und Darla ihr die schockierende Auskunft gegeben hatte, dass ihr Vater Gregoire Lachapelle hieß, hatte sich ihre Vorstellung von ihm rasch geändert. Für sie sah er nun aus wie einer der französischen Filmstars aus den Achtzigern. Sie lieh sich im örtlichen Videoladen entsprechende Filme aus und schaute sie sich immer wieder an. Er hatte sehr weiche tiefschwarze Locken, die ihm ins Gesicht fielen und die man sich am liebsten um die Finger gewickelt hätte. Olivfarbener Teint. Kantiges, glattrasiertes Kinn. Eine heisere, rauchige Stimme. Und Augen, in denen Leidenschaft schwelte. Sie kochte vor Wut, dass ihre Mutter diesen Mann hatte entwischen lassen.
Selbst als erwachsene Frau änderte sich Christmas’ Vorstellung von ihrem Vater ständig. In letzter Zeit sah sie ihn gealtert und mit Falten im Gesicht vor sich. Wahrscheinlich war er mittlerweile in Rente, hatte graues Haar und einen silbergrauen Dreitagebart, den er sorgfältig pflegte und nicht allzu lang wachsen ließ. Manchmal stellte sie sich vor, dass er Bauer war, der sich auf den Feldern um seine Schafe kümmerte oder Wein anbaute. Oder er war Künstler in Paris, der, so wie sie, in einem Ein-Zimmer-Loft wohnte. Allerdings lebte er mitten im Herzen der Stadt, vielleicht im Quartier Latin, wo es viele Cafés gab. Hin und wieder bildete sie sich ein, er sei verheiratet und habe Kinder und Enkelkinder, mit denen er an den Wochenenden im Park spielte. Und manchmal war Gregoire in ihrer Vorstellung schwul – ein ehemaliger Jongleur, der als junger Mann die Reise über das Meer gewagt hatte, um sich und die Welt zu erkunden, wobei das Verhältnis zu ihrer Mutter ein Experiment dargestellt hatte.
Sehr zu Christmas’ Verdruss geizte Darla mit Einzelheiten. Als Teenager hatte Christmas sie einmal gefragt, ob Gregoire tatsächlich Jongleur gewesen sei, und Darla hatte die Frage mit Ja beantwortet. Dann hatte sie den Blick in die Ferne gerichtet, die Schere auf die Zeitschrift gelegt, aus der sie gerade Gutscheine ausschnitt, und hinzugefügt: »Oder vielleicht war er auch Obstpflücker, der sich nur darauf verstand, mit Äpfeln zu jonglieren.«
Christmas war wütend und erfüllt von der für Teenager typischen Existenzangst. »Gab es andere?«, fragte sie. »Könnte es auch ein anderer gewesen sein?« Schließlich war sie in den psychedelischen Siebzigern gezeugt worden (selbst an Tasmanien war diese Bewegung nicht ganz vorübergegangen), und ihre Mutter konnte sich offensichtlich nicht mehr an alles genau erinnern.
Christmas hatte gehofft, dass Darla ihr das übelnehmen und sie wütend erwidern würde: »Natürlich nicht, red keinen Unsinn!« Aber stattdessen hatte sie gründlich darüber nachgedacht, während Christmas mit heftigem Herzklopfen auf ihre Antwort wartete.
»Nein«, sagte Darla schließlich, langsam und bestimmt. »Nein.«
Christmas war trotzdem wütend in ihr Zimmer gestürmt und hatte die Tür hinter sich zugeknallt.
Sie hatte niemals einen Vater gehabt, nicht einmal ein Foto von ihm. Es war beinahe so, als wäre sie aus dem Nichts aufgetaucht. Sie konnte nicht um ihren Vater trauern, weil sie nie einen gehabt hatte. Dennoch litt sie unter seiner Abwesenheit. Das war die grausame Ironie, etwas verloren zu haben, was man nie besessen hatte.
Joseph hatte ihre Mutter geheiratet, als Christmas sechs Jahre alt war. Er hatte einen stabilisierenden Einfluss auf Darla gehabt, den leeren Kühlschrank mit Fertiggerichten und frischem Gemüse gefüllt und Darla dazu gebracht, dass sie sich nicht mehr bis spät nachts in der Gegend herumtrieb, sondern Christmas vor dem Zubettgehen etwas vorlas und ihr ein Glas warme Milch brachte. Als Christmas sieben war, kam Val auf die Welt, und eine Zeit lang sah es so aus, als wären sie für immer eine glückliche Familie.
Aber ein Jahr später verließ Joseph sie. Die zwölfjährige Christmas stand in der Auffahrt und starrte dem vollgepackten Wagen nach, in dem ihr Vater mit ihrer kleinen Val saß. In einer Hand hielt sie ein Stück Papier mit einer Telefonnummer, die er ihr aufgeschrieben hatte. Sie könne ihn jederzeit anrufen, hatte er gesagt. Sie hatte sich geweigert zu weinen, obwohl der Schmerz sie beinahe umgebracht hatte.