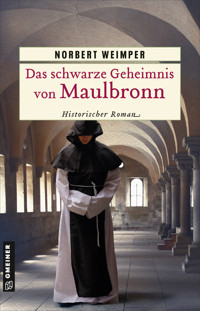
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Bruder Anselm
- Sprache: Deutsch
Kloster Maulbronn im Jahre des Herrn 1516. Der junge Anselm sucht das weltabgewandte mönchische Leben. Als die mächtige schwäbische Zisterzienserabtei bedroht wird, schickt ihn der Abt auf eine gefährliche Mission. Hohe weltliche Herren und der berüchtigte Magier Dr. Johann Faust kreuzen seinen Weg. Man trachtet ihm außerhalb und innerhalb der Mauern nach dem Leben. Doch Bruder Anselm muss sein geliebtes Kloster retten. Der versteckte Brief einer Seherin weist ihm den Weg zum Schwarzen Geheimnis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Norbert Weimper
Das schwarze Geheimnis von Maulbronn
Historischer Roman
Impressum
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Karte: Susanne Lutz
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Bilder von: © Bruno Ismael Silva Alves / Shutterstock.com und José Luiz Bernardes Ribeiro / CC BY-SA 4.0
ISBN 978-3-7349-3434-6
Dramatis Personae
Anselm von Dürrmenz-Lomersheim, Novize/Mönch
Ingbert von Speyer, Cellerar
Johannes Burrus von Bretten, Abt (?–1521)
Johann Entenfuß von Unteröwisheim, Abt (?–1525)
Johann Georg Faust, genannt Dr. Faustus, Magier und Alchemist (ca. 1480–ca. 1541)
Margarethe von Dürrmenz, Magd
Raimund von Hagenau, Bursarius
Ulrich, Herzog von Württemberg (1487–1550)
Ulrich von Dürrmenz, Bischof von Speyer und kaiserlicher Reichskanzler (?–1163)
Walther von Lomersheim, Klosterstifter (12. Jahrhundert n. Chr.)
Historische Personen mit Angabe der Lebensdaten
Wichtige Ämter im Kloster
Abt – Klostervorsteher
Bibliothecarius – Vorsteher der Bibliothek und des Scriptoriums (Schreibstube)
Bursarius – Verwalter des Klostervermögens
Cellerar (Kellermeister) – Verwalter der Klosterwirtschaft
Infirmarius – Vorsteher des Siechenhauses (Krankenhaus) und der Klosterapotheke
Konventuale – Meinungsberechtigte Herrenmönche des klösterlichen Konvents
Magister novitius (Novizenmeister) – Aufseher und Lehrer der Novizen
Portarius (Pförtner) – Wärter am äußeren Klostertor
Prior – Stellvertreter des Abtes
Vestiarius – Vorsteher der Kleiderkammer
Prolog
Kloster Maulbronn, anno domini 1492
Weg! Weg von hier! Nur dieser eine Gedanke raste der jungen Frau durch den Kopf. Vom Haus des Abtes stolperte sie auf die Tür am Ende des Laubenganges zu und verschwand. Wie Feuer brannte ihr Unterleib. Der Schädel dröhnte, sie war noch immer benommen. Das Schlimmste aber waren die schrecklichen Bilder, die sie nicht loswurde. Der Ordensmann war ein Satan. Vor Ekel schüttelte sich die Gepeinigte. Wie in Trance schleppte sie sich über den kalten Steinboden des Kreuzganges und gelangte in die Kirche.
Eine Frau im Herrenchor, dem heiligsten Ort eines Zisterzienserklosters!
Erschöpft sank Margarethe vor der mächtigen Madonnenfigur zu Boden. Sie faltete die Hände, aber nur ein ersticktes Schluchzen entrang ihrer Kehle. Zu groß war der Schmerz, der sich in ihre Seele fraß. Fahles Mondlicht lag auf ihrem verweinten Gesicht, als plötzlich der Schein einer Kerze auftauchte. In panischer Angst verbarg sich die zierliche Frau in der hohlen Rückseite der Marienfigur im Altarraum. Sie presste sich selbst die Hand vor den Mund, und endlich verließ der Schatten des Mönchs schlurfend den Kirchenraum.
Es war totenstill. Die Kälte kroch Margarethe in die Glieder. Mit letzter Kraft richtete sie sich auf und schlüpfte durch die Grabkapelle Ulrichs von Dürrmenz lautlos nach draußen. Sie fand die kleine Holztür in der südlichen Wehrmauer und ging in ihrem Schutz nach Westen. Der Salzach entlang stolperte sie durch die Bachauen Richtung Elfinger Hof. Auch dessen Ummauerung überwand sie irgendwie und erreichte das Haus der Bauernfamilie, bei der sie als Magd arbeitete.
Drei, vier unsichere Schritte noch, dann brach sie im Hausflur zusammen.
Die Bauersfrau kam die Holztreppe herunter und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Sie war in Sorge gewesen, weil Margarethe nach der Feldarbeit nicht heimgekommen war. Die resolute Frau wollte ihrer Magd aufhelfen – und bekreuzigte sich entsetzt. Das zitternde Bündel vor ihr sah furchtbar aus. Vorn auf ihrem Kleid, in Höhe der Oberschenkel, entdeckte ihre Herrin kleine Blutflecke. Erneut schlug sie das Kreuz.
Tagelang kam die Magd nicht aus dem Bett. »Bete zu Gott, Mädchen, dass du nicht geschwängert wurdest«, sagte die Bauersfrau. »Geh zu einem Priestermönch und lass dir die Beichte abnehmen.« Entsetzt riss Margarethe die Augen auf und schüttelte den Kopf.
Es dauerte Wochen, bis sie sich etwas erholt hatte. Und die Arbeit fiel ihr schwer. Barsch hatte der Bauer, der wenig Verständnis für die Magd zeigte, sie dazu angetrieben. Als Leibeigene des Klosters hatten die Bauern vom Elfinger Hof Frondienste zu leisten und dafür zu sorgen, dass die jährliche Zehntabgabe für die Mönche möglichst üppig ausfiel.
Margarethe selbst fragte sich, wofür Gott ihr diese schlimme Strafe geschickt hatte. Und warum gerade der strenge, unduldsame Abt des mächtigen Klosters Maulbronn? Sie fand keine Antwort.
Die Zeit verging, und die Leute sahen das, was sie schon wusste. Mit bestürzter Miene hatte ihr die Bauersfrau erklärt, was es bedeutete, dass nach der Nacht im Kloster ihr monatliches Blut ausgeblieben war. Immer schlechter konnte die junge Magd ihren runden Bauch unter der Kleidung verstecken, und etwa neun Monate nach ihrem bösen Erlebnis gebar sie einen Sohn.
Es war warm gewesen, an jenem 21. März im Jahre des Herrn 1493. Das Lachen war nicht mehr in Margarethes Gesicht zurückgekehrt, sie aß schlecht, und die Bauersfrauen auf dem Wirtschaftshof hätten sich nicht gewundert, wenn die Magd im Wochenbett gestorben wäre.
Margarethe überlebte die Geburt. Sie hatte Glück, dass man sie nicht samt ihrem Bastard vom Hof jagte. Vielleicht hing das damit zusammen, dass die Leute eine bestimmte Art von Respekt vor dem ehemals hübschen Mädchen hatten. Gleich nachdem es damals aus Dürrmenz, einem nahen Dorf in klösterlichem Besitz, gekommen war, erkannte man seine besondere Gabe. Margarethe umwehte das Mysterium der Prophetie. Zwei Voraussagen, die sie in Tagvisionen sah, hatten sich erfüllt.
»Wie soll das Kind heißen?«, fragte die Bauersfrau. »Anselm, Anselm von Dürrmenz«, bestimmte seine Mutter. Bisweilen jedoch nannte Margarethe den Säugling auch Anselm von Lomersheim. Die Leute hielten sie für verwirrt. Doch sie war inzwischen so wortkarg, so in sich gekehrt und irgendwie geheimnisumwittert, dass niemand sie darauf ansprach.
Kurze Zeit später war Margarethe verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Und keiner hatte die Achtzehnjährige je wieder gesehen. Die Bauern bekreuzigten sich. Dann nahm ihr Leben wieder den gewohnten Gang.
Anselm, das elternlose Kind, blieb auf dem Hof.
Kapitel 1
Kloster Maulbronn, anno domini 1502
Anselm legte den Kopf in den Nacken. Vor ihm ragte der gemauerte Torturm in den Himmel. Der ältere Bauer schubste ihn über die Zugbrücke und pochte gegen das schwere, hölzerne Tor.
»Wer bist Du, was ist Dein Begehr?« In der vergitterten Türluke erschien das verschlafene Gesicht des Bruders Pförtner.
»Ich bin Bauer auf dem Elfinger Hof und bringe Euch diesen Balg hier.«
Der Mönch musterte den schmächtigen Knaben. Er schien recht aufgeweckt, und seine strahlend blauen Augen unter dem schwarzen, glatten Haar wollten nicht so recht zu seiner dreckigen, ärmlichen Kleidung passen.
»Du willst den Buben in die Obhut des Klosters geben?«, fragte der Pförtner nach.
»Ja.«
»Warum?«
»Seht uns doch an! Zwei grausige Winter mussten wir überstehen, dazwischen einen kalten, regnerischen Sommer, in dem das Korn auf den Feldern verfaulte. Dünne Wassersuppe löffeln wir und fressen Sauerampfer von der Wiese!«
»Und der hier«, der Bauer deutete auf den Jungen, »ist ohne Eltern. Zwei linke Hände hat er, und mit seinem vorlauten Geplapper passt er wohl besser zu euch Pfaffen.«
»Kommt herein.« Der Mönch öffnete die in das eisenbeschlagene Tor eingelassene, kleinere Mannpforte.
»Anselm heißt er«, erklärte der Bauer, »er ist neun Jahre alt.«
Interessiert blickte sich der Junge um. Gepflegte Fachwerkhäuser schmiegten sich beidseits des Turms an die hohe Wehrmauer. Er achtete nicht darauf, was die beiden Männer sprachen, und als sich der Bauer mit der Bemerkung, »… ein Maul weniger zu stopfen«, zum Gehen wandte, stand Anselm teilnahmslos da.
»Hm«, brummte der Mönch nur, ging kurz in seine Torstube und bedeutete dem Jungen, ihm zu folgen. Nach wenigen Schritten passierten sie eine zweite Toranlage, und Anselm bestaunte den weitläufigen Wirtschaftshof des Klosters Maulbronn. Mächtige Gebäude standen hier, und obwohl es früh am Morgen war, herrschte geschäftiges Treiben. Bärtige Männer in braunen Kutten rollten Weinfässer in die Keller, Anselm roch die Tiere in den Ställen und hörte die dröhnenden Hammerschläge des Laienbruders vor der Schmiede.
Eine weitere Befestigungsmauer. Der Mönch zog Anselm durch den runden Torbogen für Fuhrwerke in den inneren Klosterhof. Vor ihnen stand die Kirche samt riesiger Bauwerke, die sich ihr anschlossen. Die Klausur. Sie war allein der Gemeinschaft der Herrenmönche vorbehalten.
»Wohin gehen wir?«, fragte Anselm.
»Ein wirklich vorlautes Kerlchen«, murmelte der Bruder Pförtner und befahl: »Warte hier.« Anselm sah den Mönch in einem schmalen Gang verschwinden.
»Lass den Novizenmeister rufen«, sagte der Pförtner zum Hüter der inneren Pforte, die in den Kreuzgang des Klosters führte.
Einige Zeit später trat ein alter Mönch zu dem wartenden Pförtner und Anselm. »Deus tecum, frater portarius, Gott sei mit Dir, Bruder Pförtner«, grüßte er förmlich.
»Et cum spiritu tuo, frater, und mit Deinem Geist, Bruder«, gab der Angesprochene zurück.
»Wen hast du da bei dir?«, fragte der Mann mit dem ergrauten Haarkranz um die Tonsur. Wie der andere trug er eine weiße Mönchskutte mit schwarzem Skapulier darüber. Seine asketische Gestalt und die tief liegenden Äuglein über der Hakennase flößten Anselm Respekt ein.
»Der Junge heißt Anselm, ich gebe ihn in Deine züchtigen Hände.«
Der für den Nachwuchs im Kloster zuständige Novizenmeister blickte finster drein: »Bist du verrückt«, fragte er, »was soll ich mit einem Kind?« Er schalt sein Gegenüber: »Du weiß doch ganz genau, dass unser Kloster keinen solchen Dreikäsehoch aufnimmt!«
»Aber …«, setzte der Pförtner an, doch der Novizenmeister fuhr ihm scharf über den Mund: »Als hätte ich nicht schon genug von diesen älteren Nichtsnutzen, die von ihren Vätern nur hergebracht werden, damit sie später für das Lotterleben ihrer adeligen Familien beten können. Wenngleich …«, bemerkte er nach einer kleinen Pause, »der hier sieht nicht so aus.«
»Er kommt von unserem klösterlichen Wirtschaftshof im Tal unten, einer der armen Schlucker gab ihn hier ab«, erklärte der Pförtner.
»Wie dem auch sei«, erwiderte der Herr der Novizen, »ich kann ihn nicht gebrauchen, mach du also mit dem Knäblein, was du willst.« Er ließ die beiden stehen und verschwand in der Pforte zur Klausur.
Kurz stand der Portarius ratlos da. »Komm mit«, sagte er dann und stapfte los. Mit bangem Herzen folgte Anselm dem brummigen Mönch über den Hof. Man hatte ihn abgelehnt, was sollte nun aus ihm werden?
Wortlos öffnete der Alte die Tür zu seiner Pförtnerstube und winkte den Jungen herein. Anselm trat in den karg eingerichteten Raum mit Tisch, drei Stühlen und einem Schränkchen, auf dem nichts stand. Das Fenster ließ nur wenig Licht herein und außer einer Tür an der Rückwand gab es nichts zu entdecken.
»Setz dich hier hin«, wies der Mönch ihn an, »und warte, bis ich zurück bin.«
»Wohin geht Ihr, Pater«, fragte Anselm und bekam keine Antwort. Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit, bis er den Mönch endlich kommen hörte. Der schien recht missmutig, nahm Platz und grübelte offensichtlich darüber nach, was er mit dem dreckigen kleinen Bauernjungen anfangen sollte. Anselm schaute zu Boden und sagte nichts. Bleiern verrann die Zeit. Immer wieder verließ der Portarius kurz das Haus, um jemanden aus dem Kloster hinaus- oder hereinzulassen. Die Zugbrücke vor dem Tor, soviel konnte der Junge erahnen, blieb tagsüber heruntergelassen. Als es draußen zu dämmern begann, ging der Alte ein letztes Mal hinaus. Kurz darauf trat er wieder ein und sprach Anselm das erste Mal seit Stunden an: »Da habe ich mir ja was Schönes eingebrockt mit dir, Bengel«, sagte er vorwurfsvoll, »aber es hilft nichts.« Der Junge verstand nicht. Der Mönch forderte ihn auf, ihm in die kleine Kammer zu folgen, in der es außer einer Schlafstatt und einem schlichten Holzkreuz an der Wand nichts gab. Immerhin waren die Dielen gefegt. »Du wirst dich mit dem Boden zufriedengeben müssen«, grunzte der Alte und ließ sich auf seinem Lager nieder. Anselm war erleichtert. Er hatte zumindest vorerst eine Bleibe gefunden. Der Raum war trocken und, abgesehen von dem Fußschweiß seines Gastgebers, stank kaum. Da hatte er auf dem Hof schon anderes erlebt. Also wollte sich Anselm nicht beklagen. Er legte sich wie gewohnt auf den Rücken, schaute an die inzwischen dunkle Decke und war nach dem langen Tag, begleitet vom Schnarchen des Mönchs, bald eingeschlafen.
Am nächsten Morgen waren Anselm und der Pförtner schon früh auf den Beinen. Sie gingen über den Wirtschaftshof des Klosters, und der Mönch fragte: »Du hast nichts bei dir, nicht einmal einen Gürtel- oder Umhängebeutel?«
»Nein, nichts«, antwortete Anselm, »nur die Kleider, die ich am Leib trage.«
Als sie an einem ansehnlichen Gebäude, das rechterhand stand, vorbeikamen, sah Anselm einen jungen Herrenmönch. Er war schlank, stand kerzengerade da, und sein hellblondes Haar leuchtete geradezu über dem weiß-schwarzen Habit. Aus der Entfernung nickten sich die beiden Brüder zu und nahmen ansonsten kaum Notiz voneinander. Allerdings: Als Anselm kurz den Kopf drehte, traf ihn der Blick des Mönchs. Offensichtlich war er überrascht, ein Kind innerhalb der Klostermauern zu sehen.
Das ungleiche Paar näherte sich einem besonders großen Gebäude, das an die nördliche Klostermauer angebaut war. An seiner Außenmauer drehten sich mit einigem Getöse zwei gigantische Mühlräder. Angetrieben wurden sie vom Wasser, das in einer Rinne von der hohen Mauer herunterschoss.
In der Klostermühle war die Pfisterei, die Bäckerei des Klosters, untergebracht. Der Pförtner hielt direkt auf zwei Herren zu, die sich lautstark unterhielten. »Deus vobiscum, Gott mit Euch«, rief er, »da treffe ich ja genau die Richtigen.«
»Was führt Euch zu uns, Bruder Portarius?«, fragte der deutlich Kräftigere.
»Ich möchte fragen, Bruder Müllermeister und Bruder Pfistermeister, ob einer von euch einen Gehilfen brauchen kann«, antwortete der Pförtner und deutete auf Anselm. Der Junge betrachtete die groben braunen Kutten, die die Männer trugen. Er hatte bereits mitbekommen, dass die Laienmönche im Kloster so gekleidet waren – und die, wie er fand, richtigen Mönche der Ordensgemeinschaft einen edlen Habit trugen.
»Ich suche immer Gehilfen«, lautete die Antwort des Müllers, »aber kein solches Kerlchen. Das Mühlenhandwerk ist ein schweres Geschäft, für das man Kraft braucht.« Der Laienbruder, der im Kloster für das Mahlen des Korns zuständig war, zeigte seine Oberarmmuskeln und erklärte: »Den müsst Ihr schon woanders unterbringen.«
»Auch ich könnte in den Backstuben einen weiteren Gehilfen gebrauchen. Aber er muss sich gut anstellen.« Der Pförtner runzelte die Stirn, sagte aber nichts.
Aus einiger Entfernung beobachtete der Mönch vor dem großen Haus das Gespräch. Er sah, wie der Bäckermeister nickte, und Anselm einen Schritt auf ihn zuging.
»So, du willst also ein Bäckergeselle werden?«, wurde der Junge gefragt und antwortete wahrheitsgemäß: »Nein, ich möchte lieber ein richtiger Mönch werden und so eine schöne Kleidung tragen wie der Vater Pförtner und der dort drüben.« Er deutete zu dem Gebäude auf der anderen Seite des Hofes und erklärte: »Außerdem haben sie in Elfingen gesagt, dass ich nicht zum Arbeiter taugen würde, ich solle besser ein Pfaffe oder Mönch werden.«
»Lass dir gesagt sein«, erwiderte der Meister, »zwischen einem einfachen Bauerntölpel und einem Mönch mit Weihe liegen Welten! Aber vielleicht könnte aus dir ja zumindest mal ein anständiger Laienbruder werden, wer weiß.«
Anselm biss sich auf die Lippen und folgte dem Bäcker, der ihm zunächst die Mühle und danach die Pfisterei zeigen wollte.
Es war schrecklich staubig. In den hellen Sonnenstrahlen, die durch die Fenster einfielen, flirrte es nur so. Anselm kniff die Augen zusammen und sah, wie mehrere Braungekleidete und wie Bauern angezogene Gehilfen Säcke hin- und herschleppten, um sie irgendwo hineinzuschütten. Unaufhörlich stiegen sie die vielen Holztreppen auf und ab.
»Vom Korn zum Mehl zum Brot«, erklärte der Pfistermeister, »das ist der Weg.«
»Und von dort in die Küche und in die Mägen der Mönche«, ergänzte Anselm mit schelmischem Blick.
Der Bäckermeister senkte drohend die Augenbrauen.
Dumpf und monoton dröhnten die Mahlwerke, und Anselm konnte sich in der Tat nicht vorstellen, irgendeine der Arbeiten auszuführen, mit denen die kräftigen Burschen beschäftigt waren.
»Warum gibt es hier so viele Katzen?«, fragte er den Pfistermeister. Ihm war nicht entgangen, dass die Samtpfoten überall herumstrichen oder ruhig auf Fensterbänden saßen und auf den Boden starrten. »Du willst wohl alles ganz genau wissen?«, meinte der Bäcker, »und ein guter Beobachter scheinst du auch zu sein.« Er erklärte dem Jungen, dass der Kollege Müller die Pflicht hatte, eine gute Anzahl Katzen zu halten, damit sie das Korn vor Mäusen schützten. Um die Mühlenkatzen in den Gebäuden und bei Laune zu halten, müsse er sie mit ungesalzener Fleischbrühe füttern. Sogar zwei Hunde besäße er, die gerade draußen Ratten jagten, die ebenfalls eine Gefahr für das wertvolle Getreide darstellten.
In den Backstuben war es unglaublich heiß. Anselm kannte nur das kleine Backhaus auf dem Hof, von dem er kam. Es war kein Vergleich hierzu! In der Klosterbäckerei wurde jeden Tag gebacken, was das Zeug hielt. Es galt, mehrere hundert Leute zu versorgen.
»So, nun ist’s genug geredet und geschaut«, stellte der Meister klar. »Einer meiner Gehilfen wird dir deinen Schlafplatz zeigen und dir eine Arbeit in der Pfisterei zuweisen. Denn du magst für dein Alter aufmerksam und begabt sein – doch hier wird gearbeitet! Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, wenn es sein muss. Und zwar ohne Murren und Klagen. Hier verdient man sich sein tägliches Mahl mit eigener Hände Arbeit.«
Außer den Herrenmönchen, dachte Anselm. Er verbeugte sich artig, dankte für die Aufnahme und versprach: »Ihr werdet mit mir zufrieden sein, Meister, ich strenge mich schon an.«
»Das rate ich dir, Junge«, entgegnete der Pfister und fügte an: »Schauen wir auf deine zwei linken Hände!«
Anselm schöpfte Hoffnung. Er war unter die Obhut eines Mannes gekommen, der wohl streng, aber anständig und gerecht war. Wenn er sich nur richtig anstellte und sonst keinen Ärger machte, würde es sich hier zumindest für den Moment aushalten lassen. Den kleinen Dämpfer, was die Mönchsausbildung betraf, schob er erst einmal beiseite.
In den Backstuben des Klosters konnte Anselm jede Menge lernen. Abgesehen von der Hitze, war die Arbeit weniger anstrengend als die schweren Feld- und Stallarbeiten, bei denen er auf dem Hof von klein auf hatte mithelfen müssen.
Mehl, Wasser, Salz, Öl, Hefe und Sauerteig, das waren die Zutaten, aus denen die Gesellen die unterschiedlichen Brote buken. Anselm schaffte sie her und sah zu, wie die verschiedenen Teige gemischt und in Trögen geknetet wurden. Er holte die Reisigbüschel zum Anfeuern der aus Lehmziegeln gemauerten Öfen und stapelte Brennholz. Und er hatte von Anfang an eine Aufgabe, die er besser erledigte als manch anderer: Weil er klein und schmächtig war, konnte er beim Ausputzen der Öfen überallhin kriechen und sie so am besten reinigen.
Die Wochen und Monate vergingen. Jedoch blieb ihm das Anmischen und Kneten des Teiges, das Einschießen der Teiglinge, wie sie das nannten, und das Herausholen der gebackenen Laibe untersagt. Langsam verlor Anselm die Lust. Anfangs war alles neu und interessant gewesen, inzwischen langweilte ihn das tägliche Einerlei zwischen Schlafen und Mehltruhen.
Wenigstens machte er, als sich der Winter ankündigte, eine neue Erfahrung. Anders als auf dem Bauernhof hatte man hier keine Tierställe im Haus. »Ich halte das nicht mehr aus«, jammerte Anselm eines Morgens, als er wie die anderen zitternd vor Kälte unter seiner Decke hervorkroch. »Warte nur ab«, tröstete ihn einer, »es wird besser werden.« Anselm verstand nicht. Dann, ein paar Tage später, zeigte der Pfistermeister ein Einsehen: Die Gesellen und Gehilfen durften in der Backstube schlafen! Hier, wo sie tagsüber arbeiteten, war es in den frostigen Nächten am wärmsten.
Für Anselm zogen sich die Arbeitstage endlos zäh dahin. Bis er etwas für sich entdeckte. Er sah genau hin, wie die Gesellen die Mengen der einzelnen Zutaten bestimmten. Dann lehnte er still an der Wand und beobachtete, wie sie das mit Hilfe der Waage taten. Er verfolgte ihr Hantieren mit den Gefäßen, die offensichtlich stets das richtige Maß hatten. »He, du Faulpelz, schaff das Reisig herbei!«, wurde er manchmal angeschnauzt. Und mitunter bekam er einen Tritt versetzt, mit der Bemerkung, er solle keine Maulaffen feilhalten. Die anderen mochten ihn zwar irgendwie, doch eigenständig mitanpacken, das lernte der Kleine nicht.
Beharrlich versuchte Anselm zu ergründen, nach welchem System aus bestimmten Mengen, Teilmengen und Zahlen die Bäcker ihre Zutaten bemaßen. Und Anselm lernte zählen. Auf einem langen Holztisch lag eine ganze Reihe fertiger Brote, und die Gesellen ermittelten mit Hilfe ihrer Finger deren Zahl. »Eins, zwei, drei, vier, fünf …« Im Geiste zählte Anselm mit und kannte bald schon alle Zahlen von eins bis zwanzig. Dann kam das Zusammenzählen. Eins und eins macht zwei, dachte er sich, und wenn noch zwei dazukommen, sind es vier.
»Er schläft schon wieder, mit offenen Augen!«, schrie ihn einer an. Anselm zuckte zusammen und duckte sich gerade noch rechtzeitig, sonst hätte ihn eine saftige Backpfeife erwischt. »Was soll ich mit dir Nichtsnutz anfangen«, schalt ihn der Ältere, »ein Träumer bist du, zu nichts zu gebrauchen!«
In diesem Moment betrat der Pfistermeister die Backstube. Augenblicklich herrschte Stille. Alle schauten zu ihm auf. Obwohl ihrem Herrn klar war, was sich gerade abspielte, fragte er seinen Gesellen: »Was ist vorgefallen? Warum schreist du so?«
Der Angesprochene wischte seine mehligen Hände am Schurz ab und schob sich die verschwitzten Haare aus dem Gesicht: »Meister, es kann so nicht weitergehen mit dem Jungen.«
»Was hat er getan?«
»Was er getan hat, fragt Ihr? Nichts hat er getan. Eben nichts!« Der Geselle ereiferte sich. »Wir schuften hier bis zum Umfallen, und was macht dieser kleine Rotzlöffel? Er steht da und starrt Löcher in die Luft.«
Der Meister sah sich um. Die anderen nickten betreten, und er musterte Anselm mit zugekniffenen Augen. »Folge mir«, befahl er hart, und mit eingezogenem Kopf trottete ihm der Junge hinterher.
»Was sollen wir nur mit dir anfangen?«, stellte der Pfister nochmals dieselbe Frage. In seiner Dienststube hatte er Platz genommen, und Anselm stand, den Blick gesenkt, vor ihm. »Du bist nicht aufsässig, du prügelst dich nicht mit anderen, und dennoch …«, sprach der Meister. »Und dennoch kannst du hier nicht bleiben.«
Anselm schluckte.
»Du gehst in eure Schlafkammer, packst dein Bündel und dann bringe ich dich weg.«
Anselm war vor den Kopf gestoßen. Was würde mit ihm geschehen? Er nahm den Umhängebeutel, den man ihm gegeben hatte, packte sein Messer, die Holzschüssel samt Löffel und den Trinkbecher ein. Ihm war mulmig im Magen.
Völlig verzagt stand er vor dem Meister. Seine Hände zitterten, als ihm der Pfister einen Kanten Brot reichte. Würde er ihn aus dem Kloster jagen? Müsste er fortan alleine im Wald hausen? »Lieber Gott im Himmel, hilf!«
»Folge mir«, forderte ihn der Meister erneut auf. Er ging voran über den Wirtschaftshof auf das stattliche Gebäude zu, das Anselm vor Monaten aufgefallen war. Mit dem Klopfring schlug er gegen die Tür, und ein junger Mann öffnete. Anselm fiel auf, dass er weder die Kutte eines Laienbruders noch den Habit eines Herrenmönchs trug.
»Deus benedicat tibi«, grüßte der Meister, »Gott zum Gruße.«
»Was ist Dein Begehr?«, fragte der Jüngere, der den Pfistermeister offenbar kannte.
»Ich möchte den Bursarius sprechen«, erwiderte der Bäcker, und als sie über die Schwelle traten, sprach er das übliche »Friede diesem Haus.« Anselm wiederholte den wohlwollenden Wunsch: »Friede diesem Haus.«
Sie wurden ins Amtszimmer des Bursarius, der das Klostervermögen verwaltete, geführt. Er stand am Fenster und hatte die Hände auf dem Rücken verschränkt, den er ihnen zustreckte.
»Deus salvete, Frater Bursarius«, grüßte der Bäcker, und der Fremde wandte sich ihnen zu: »Deus salvete, Pistor.«
Anselm betrachtete den schlanken Mann. Es war der Herrenmönch mit dem leuchtend blonden Haar um die Tonsur, den er vor Monaten gesehen hatte, als der Pförtner ihn zur Pfisterei gebracht hatte. Er war von mittlerer Größe, stand wieder auffällig aufrecht und hatte helle Haut. Anselm beeindruckten seine grünen Augen in dem schmalen Gesicht. Wenig überraschend, dass dieser Mann einem elsässischen Adelsgeschlecht entstammte.
»Was kann ich für Dich tun?«, fragte Raimund von Hagenau. Als Vermögensverwalter des Klosters hatte er eine hohe Stellung inne. Anselm mochte die ruhige, klare Stimme dieses Mannes, der ihm recht jung für das Amt erschien.
»Für mich nichts, aber vielleicht für den Bengel da. Anselm heißt er.«
»Was ist mit dem Knaben?«, fragte der Bursarius.
»Was soll ich sagen? Eigentlich ist er ja ein anständiger Kerl, aber für die Arbeit in Mühle und Bäckerei ist er nicht zu gebrauchen.«
»Soso«, antwortete Raimund von Hagenau und wandte sich an den Jungen: »Ist das richtig?«
Völlig überrascht, nach seiner Meinung gefragt zu werden, antwortete Anselm: »Ja, Vater, so ist es wohl. Alle sagen, dass ich zum Arbeiten nicht tauge.«
Der Bursarius verzog keine Miene und befahl dem Bäckermeister, draußen vor der Tür zu warten.
»Anselm«, sprach er dann, »ich stelle dir jetzt ein paar Fragen. Höre gut zu und überlege dir deine Antworten gründlich.«
Anselm nickte.
»Also, sage mir, wer bist du?«
Ohne nachzudenken, erklärte der Junge: »Man nennt mich Anselm, Vater, ich komme vom Elfinger Hof. Die Bauersleute, die mich nach dem Tod meiner Mutter aufnahmen, nannten mich manchmal auch Anselm von Dürrmenz-Lomersheim.«
»Hm«, Raimund von Hagenau rieb sich das Kinn.
»Sage mir, was willst du einmal werden?«
»Ein richtiger Mönch, Vater.«
»Warum willst du ein Leben im Kloster führen?«
Schneller als ein Stein zu Boden fällt, antwortete der Zehnjährige: »Die meisten Menschen sind nicht gut. Ich möchte in die Gemeinschaft der Ordensbrüder aufgenommen werden, zu Gott beten und in den Himmel kommen.«
Der Vermögensverwalter merkte auf. Er musterte den Knaben, der mit erhobenem Kopf und wachen Augen vor ihm stand. Dann hakte er nach: »Anselm, zwar gibt es im nahen Enztal zwei Ortschaften namens Lomersheim und Dürrmenz, aber wir kennen kein Dorf, das den Doppelnamen Dürrmenz-Lomersheim trägt. Warum also nannten dich die Leute so?«
»Das mit Dürrmenz und Lomersheim weiß ich nicht, Vater.«
»Sodann sage mir, was ist für dich ein richtiger Mönch?«
»Ein richtiger Mönch ist einer so wie Ihr, ehrwürdiger Vater …«
Anselm stockte.
Sein Blick fiel auf ein seltsames Gerät, das auf dem Pult neben dem Tisch stand, hinter dem der Bursarius saß. Was mochte das sein? Ein Holzrahmen mit eingespannten Drähten, auf denen verschiedenfarbige Glasperlen aufgereiht waren.
»Anselm!«, ermahnte ihn der Mönch streng. »Du bist neugierig – und abgelenkt.«
»Entschuldigung, Vater. Aber der Holzrahmen dort drüben …«
»Still. Übe dich in Demut und antworte auf meine Frage.«
»Ein, äh, ein richtiger Mönch, äh, trägt eine weiße und schwarze Kleidung und so einen Haarkranz.« Anselm deutete auf die Frisur des Mönchs. »Und ein richtiger Mönch ist von edler Gesinnung und fest im Glauben«, schob er hinterher.
»Soso.« Bruder Raimund sinnierte kurz. Sein Blick blieb ebenfalls an dem Abakus hängen, mit dem er schwierige Rechnungen ausführte. Er fragte: »Anselm, was ist dir wichtiger: glauben oder wissen?«
Wortlos sah Anselm zu Boden.
»Gott wird dir die richtige Antwort geben«, meinte Raimund, der Bursarius, »und du wirst erkennen, welchen Weg er für dich und dein Leben vorgesehen hat.«
Der Bursarius hatte seine Entscheidung getroffen. Er rief den Bäcker herein und verkündete: »Pfistermeister, ich werde den Jungen behalten. Der Abt und sein Konvent der Ordensmönche brauchen weiterhin nicht von seiner Anwesenheit zu erfahren.«
Der andere senkte ehrerbietig den Kopf, deutete eine Verneigung an und verließ den Raum.
Anselm lächelte.
Kurz darauf verschlug es dem Jungen vom Bauernhof fast die Sprache. Er erwartete, irgendwo einen einfachen Schlafplatz zugewiesen zu bekommen und wurde stattdessen in eine eigene Kammer geführt! »Ich soll in einem ganzen Raum allein schlafen?«, rief er. Der andere nickte und wandte sich wortlos zum Gehen. Anselm betrachtete das Bett und den Stuhl, sogar eine kleine Holztruhe stand da. Er legte seinen Beutel hinein und trat ans Fenster. Alles schien sich zum Besseren zu wenden, und er war begierig darauf zu erfahren, was so ein Bursarius tat und welche Aufgaben er für ihn vorsah. Er musste nicht lange warten, und der Herr des Hauses führte ihn durch sein Reich, das Bursariat. Aus dem zweiten Stock, wo es eine Reihe von Schlafkammern gab, führten steile Stiegen hinunter in das Erdgeschoss. Anselm staunte, als der Vermögensverwalter die Tür zu einem wahren Saal öffnete, in dem sich entlang der Fensterfront Stehpult an Stehpult reihte. An jedem stand ein Mann mit Schreibzeug.
Sie begrüßten ihren Vorgesetzten mit dem gebotenen Respekt. Dem scheuen Jungen schenkten die Bursariatsgehilfen keine Beachtung. Anselm beobachtete, wie sie sich sofort wieder in ihre Arbeit vertieften. Bruder Raimund erklärte ihm, dass man hier die Lagerbücher führte und andere Aufzeichnungen zum Beispiel über die Einnahmen und Ausgaben des Klosters tätigte. Erfasst wurden auch die wirtschaftlichen Aktivitäten der klösterlichen Wirtschaftshöfe und Bauerndörfer in der Umgebung sowie der Pfleghöfe, die das Kloster in den Städten unterhielt. »In Speyer zum Beispiel, einer Stadt unten am Rhein, verkaufen wir unterschiedliche Waren, und kaufen das, was wir selbst nicht herstellen«, führte der Bursarius aus. Anselm hörte aufmerksam zu. Mit Blick auf die vielen Männer an ihren Stehpulten stellte ihr Vorgesetzter fest: »Hier Anselm, läuft alles zusammen!« Bruder Raimund übte die Oberaufsicht aus, und sogar der Cellerar, der Kellermeister der Abtei, musste ihm Rechenschaft ablegen.
»Erlaubt mir eine Frage, Vater Raimund«, traute sich Anselm ihn anzusprechen. »Draußen«, antwortete der Mönch und schob den Jungen hinaus auf den Flur.
»Die Schreiber tragen weder die Kleidung der Mönche noch der Laienbrüder oder Novizen. Wer sind sie?«
»Gut aufgepasst, Anselm«, stellte der Bursarius fest und erklärte ihm, dass er auf kluge Köpfe aus ehrbaren Händlerfamilien von außerhalb setzte. Er bot seinen Gehilfen eine entsprechende Unterkunft im Haus und bezahlte sie gut. »Damit sie bei unserer Geldwirtschaft nicht auf dumme Gedanken kommen«, wie er zu sagen pflegte.
Auf der anderen Seite des breiten Flures führte er Anselm in ein weiteres Zimmer. Es war dunkel und rundum standen raumhohe Regale, die bis unter die Decke mit Büchern gefüllt waren.
»Alle diese Bücher haben deine Leute mit Zahlen gefüllt?«
Raimund lachte. »Nein, wir arbeiten zwar hart, doch all die dicken Bände entstanden im Laufe vieler Generationen.« Der Bursarius straffte seinen Körper und erklärte: »Ich führe das Werk meiner Vorgänger gewissenhaft fort.«
Anselms Achtung vor dem rechtschaffenen Mann wuchs.
Sie gingen hinaus auf den Wirtschaftshof. »An einem anderen Tag werde ich dir Weiteres zeigen«, versprach Bruder Raimund. Anselm war schon gespannt, denn außer der Mühle und der Bäckerei hatte er nicht viel gesehen. Mehr noch interessierten ihn allerdings die ihm zugedachten Aufgaben. Doch darüber schwieg sich der Bursarius aus. Vielleicht, dachte Anselm, wusste er das im Moment selbst nicht so genau.
Einige Zeit später registrierte Anselm wieder einmal einen Herrenmönch, der ungefähr so alt sein mochte wie der Bursarius. Er schien der häufigste Besucher hier im Haus zu sein, und es war nicht zu übersehen, dass sich die beiden Männer gut verstanden.
»Warte hier vor der Tür«, befahl ihm Bruder Raimund, und Anselm war höchst gespannt, was da auf ihn zukam.
Die beiden Mönche verschwanden im Besucherzimmer, und der Gastgeber persönlich schenkte zwei Gläser Rotwein ein. Sie ließen sich auf zwei einfachen Stühlen nieder. »Ich möchte mich über eine Sache mit dir austauschen, Bruder Ingbert«, eröffnete der Hausherr das Gespräch.
Als Cellerar zählte Ingbert von Speyer zusammen mit dem Bursarius zu den wichtigsten Amtsträgern im Kloster. Nur der Abt des Klosters und ausnahmsweise dessen Stellvertreter konnten ihnen befehlen. Der Kellermeister war deutlich fülliger als sein Freund, was vielleicht ein Stück weit seinem Amt geschuldet war. Braune Locken umrahmten seine Tonsur, er zeigte ein faltenfreies, freundliches Gesicht mit warmen braunen Augen. Ein Aussehen, das nach Meinung vieler nicht so recht zu der Aufgabe dieses Mannes passte, der sein Amt sehr ernsthaft und mitunter in entsprechender Strenge auszuüben hatte.
Ingbert von Speyer, der aus einer angesehenen städtischen Kaufmannsfamilie stammte, schaute den Bursarius erwartungsvoll an.
»Wie du weißt, ist unser Abt Burrus nicht geneigt, Kinder in die Gemeinschaft aufzunehmen.« Der Angesprochene nickte.
»Und dies, obwohl die regula benedicti, die Regel des heiligen Benedikt, der wir Zisterzienser folgen, doch Aussagen über Kinder in Klöstern trifft.« Der Bursarius zitierte Kapitel 37 aus dem Kopf: »Zwar neigt der Mensch schon von Natur aus zu barmherziger Rücksicht auf die Lage der Alten und der Kinder; doch soll auch durch die Autorität der Regel für sie gesorgt sein. Immer achte man auf ihre Schwäche. Für ihre Nahrung darf die Strenge der Regel keinesfalls gelten. Vielmehr schenke man ihnen Güte und Verständnis …«
»Ich verstehe nicht, worauf du hinauswillst, Bruder Raimund«, warf der Cellerar ein.
»Du hast den Knaben auf dem Flur gesehen. Er wurde von einem armen Bauern im Kloster abgegeben, doch verwehrt man ihm die Aufnahme als Novize des Ordens.«
»Und was habe ich damit zu tun?«
»Du kennst bestimmt das Kapitel 31 der Regel. Sie besagt: ›Als Cellerar des Klosters werde aus der Gemeinschaft ein Bruder ausgewählt, der weise ist, reifen Charakters und nüchtern. […] Er sei gottesfürchtig und der ganzen Gemeinschaft wie ein Vater. Um Kranke, Kinder, Gäste und Arme soll er sich mit großer Sorgfalt kümmern; er sei fest davon überzeugt: Für sie alle muss er am Tag des Gerichtes Rechenschaft ablegen.‹«
»Aha! Ich verstehe: Wahrscheinlich willst du, dass ich mich um den Bauernlümmel kümmere.«
»Na ja. Ich würde mir wünschen, dass du ebenso wie ich ein Auge auf den Knaben hast. Er kann bei dir ebenso viel lernen wie hier im Bursariat. Er ist klug, der Junge, klug, aber gänzlich ungebildet.«
Bevor der Cellerar antworten konnte, rief Bruder Raimund Anselm herein.
Im Laufe der Zeit setzten der Bursarius und auch der Cellerar den kleinen Anselm immer öfter als Boten innerhalb der Klostermauern ein. Der Junge hatte in der Tat eine rasche Auffassungsgabe und interessierte sich für alles, was es für ihn zu wissen gab. Wie den Vater Bursarius mochte er auch den Vater Cellerar von der ersten Minute an. Anselm war gut beschäftigt und hatte darüber hinaus die Freiheit, den Männern im Wirtschaftshof stundenlang bei ihren unterschiedlichsten Tätigkeiten zuzusehen. »Nur stören darfst du niemanden, keinesfalls, hast du mich verstanden?«, hatte der Bursarius ihm eingeschärft. Und es war ihm bei Strafe verboten, den inneren Klosterhof mit der Kirche und der Klausur der Herrenmönche zu betreten.
Wenn er einmal einen dieser Ordensmänner zu Gesicht bekam, wurde Anselm an die Frage erinnert, die ihm Vater Raimund anfangs gestellt hatte: Was war wichtiger, Glaube oder Wissen? Die hohen Herren des Konvents, die in ihren reinen Gewändern, selbst wenn sie über den Wirtschaftshof schritten, in Gedanken und Gebete vertieft und leicht entrückt schienen, beeindruckten den Jungen ungemein. Inzwischen war er sicher, dass es für ihn allein den Weg des Glaubens geben konnte. Nur mit Beten und dem sittlichen Leben eines Mönches konnte man zu Gott und zum ewigen Leben im Paradies finden. »Alles Wissen der Menschen ist dagegen unnütz«, sagte er sich.
Zwar befand sich Anselm innerhalb der Klostermauern, aber die Welt der Herrenmönche schien für ihn, den kleinen Bauernjungen, unerreichbar. Das machte ihn traurig. Sie beteten hinter der großen Mauer, die das weitläufige Klosterareal in zwei Hälften teilte, er lebte davor in der Welt der Laienbrüder, leibeigenen Bauern und Tagelöhnern des Klosters.
Wären da nicht Bruder Raimund und Bruder Ingbert gewesen, Anselm wäre verzweifelt.
Kapitel 2
Kloster Maulbronn, anno domini 1503
In aller Herrgottsfrühe hatte sich Anselm von seinem Nachtlager erhoben und verließ das Bursariat hinaus in die Finsternis. Sein Ziel war der Morgengottesdienst in der Klosterkirche. Vorher allerdings wollte er an diesem kalten Morgen den östlichen Klosterhof erkunden, was ihm untersagt, also bei Tage nicht möglich war. Am Laienrefektorium vorbei, erreichte er die Engstelle zwischen Mönchsrefektorium und nördlicher Wehrmauer. Der schaurige Ruf eines Kauzes ertönte. »Wenn der Kauz schreit, ist’s zum Sterben nicht weit«, wusste Anselm. Fröstelnd blieb er stehen. Wer konnte schon sagen, ob das wirklich ein Vogel oder nicht doch ein Waldgeist war. Wie andere unheimliche Dämonen, trieben auch die bösen Geister ihr Spiel mit den Menschen. Und in den dunklen, undurchdringlichen Wäldern auf den Höhen rund um das Kloster lauerte der Wolfsmensch! Manche nannten ihn auch den Werwolf. Anselm machte kehrt und schlich sich im Schutz der Mauer zurück auf den inneren Hof. Erleichtert erreichte er den weiten Platz vor der Klausur.
Als das erste Himmelsgrau den Tag ankündigte, betrat er gemeinsam mit den Laienbrüdern durch das westliche Hauptportal die Kirche. Der Cellerar persönlich hatte sein stillschweigendes Einverständnis dazu gegeben, dass Anselm der Laienkirche beiwohnte. Wie immer nahm er in der hintersten Bankreihe Platz. In dem nur spärlich beleuchteten, riesigen Kirchenschiff stimmten die Mönche den ersten Hymnus der Laudes an. Ihr Gesang füllte den Raum, und als ihre Psalmen und Gesänge zur Lobpreisung Gottes erklangen, wünschte sich Anselm nur noch eines: endlich als Novize seinen Platz vorne bei den Chormönchen zu finden. Eine wuchtige, meterhohe Chorschranke trennte die beiden klösterlichen Brudergemeinschaften. Der vordere Teil der Kirche war den Herrenmönchen in ihrem Chorgestühl beim Altar vorbehalten, im hinteren befand sich die Laienkirche für die Brüder in den braunen Kutten.
Nach dem Stundengebet suchte sich Anselm eine ruhige Ecke im überdachten Vorbau der Kirche, den man das Paradies nannte. Er versuchte, den Schlaf zu vertreiben, und lauschte in die Stille. Er vernahm ein leises Flüstern.
»Wieder hat ihn die Fleischeslust gepackt«, hörte er sagen, »der scheinbar keusche Oberhirte ist ein geiler Bock!«
»Was genau weißt du?«
»Zwei unserer Laienbrüder mussten ihm zur Nacht wieder einmal ein Bauernmädchen bringen.«
»Psst, da ist jemand!«
Dann war es ruhig. Anselm konnte sich keinen Reim auf das machen, was er da gehörte hatte.
Als sich die Morgenröte über den weiten Klosterhof ergoss, rief die Glocke zum zweiten Morgengebet. Es war die erste Stunde des Tages, die Zeit der Prim.
Andächtig konzentrierte sich Anselm auf die gesungenen Psalmen, die kurze Schriftlesung sowie das abschließende Gebet. Doch verstand er von dem auf Latein Gesungenen und Gesprochenen nichts.
Er machte sich auf den Weg zurück zum Bursariat. Bald darauf befand er sich auf einem seiner üblichen Botengänge. Anselm kannte sich inzwischen gut aus im Wirtschaftshof mit seinen Lagerhäusern, Stallungen und unterschiedlichen Werkstätten. Viel unterwegs war er in Schmiede, Zimmerei, Wagnerei und Küferei, die ständig etwas mit dem Geldverwalter des Klosters abzurechnen hatten.
»Ich bringe dir, Bruder Schmiedemeister, einen Brief des Bursarius«, sagte Anselm und überreichte dem Laienmönch das Schreiben. Er wunderte sich, dass der grobe Mann Latein konnte, und ärgerte sich, dass er der Sprache der Kirchenmänner und Gelehrten nicht mächtig war. Sogar Händler und andere Städter sprachen auf den Fernstraßen Lateinisch, hatte Anselm gehört. Er kannte nur einzelne Wörter wie littera für Brief oder scribe für schreiben und ein paar kurze Sätze, die ihm Bruder Raimund beigebracht hatte. Wo immer möglich, versuchte er weitere lateinische Brocken aufzuschnappen.
In der Klosterpfisterei hatte Anselm es schwer. »Man muss sich nur besonders dumm anstellen, und schon landet man im weichen Bett bei einem Herrenmönch«, meinte einer der Gesellen und erntete schallendes Gelächter. Der Junge konnte nicht heraushören, ob in der Beleidigung mehr Ironie oder Ärger steckte. Jedenfalls fühlte er sich von solchen Sprüchen getroffen.
In der Mühle nebenan kam der Mühlenmeister auf Anselm zu. Er war sichtlich verärgert und grummelte vor sich hin. »Wir brauchen mehr Wasserkraft für unsere Mühlräder«, raunzte er seinen Stellvertreter an, »die Oberen haben es uns schon vor Zeiten versprochen!« Da kam ihm der junge Bote des Cellerars gerade recht. »Da mihi epistulam!«, herrschte er ihn an. Anselm reimte sich zusammen, dass er dem Meister den Brief aushändigen sollte. Littera heißt doch Brief, dachte Anselm, warum plötzlich epistulam? Der Müller schrie los: »Schau sich einer das an. Jetzt trägt die unfähige Rotznase auch schon die Briefe des Cellerars aus!« Er schnaubte verächtlich – und Anselm sah zu, dass er wegkam.
Nicht allzu lange Zeit später wurde der Klostermüller erhört. Tatsächlich hatte der Abt im Tal direkt oberhalb des Klosters einen neuen See aufstauen lassen. Sein Wasser sollte mit höherem Druck unten bei der Mühle ankommen. Anselm hatte das so verstanden, dass die Mühlräder schneller angetrieben wurden, wenn das Wasser aus größerer Höhe kam.
»Beeil dich, Anselm«, sagte Bruder Raimund, »heute wird der Tiefe See geweiht.« Sie verließen das Kloster durch den südlichen Torturm und gingen unterhalb des Schafhofes Richtung Staudamm. Abt Burrus hatte alle zu sich gerufen: Die Herren- und die Laienmönche, die Novizen und selbst die Leibeigenen und Tagelöhner.
»Jetzt kannst du einmal sehen, wie viele Menschen im Kloster leben«, sagte der Bursarius. Anselm war überrascht. Vor allem die große Anzahl der Herrenmönche beeindruckte ihn. »Weit über hundert«, erklärte Bruder Raimund, und der Junge bekam einen Eindruck davon, wie viel die Zahl »Hundert« ungefähr bedeutete.
Kübel für Kübel hatten die Arbeiter Erde aufgeschüttet, um einen breiten Damm zu errichten, der das Wasser der Salzach weiter aufstaute. Man brauchte es nicht nur zum Antreiben der Mühlräder, sondern auch zum Ableiten von Abfällen, die im Kloster so anfielen. Anselm konnte sich nicht so recht vorstellen, wie das Wasser zu diesem Zweck in mannshohen, unterirdischen Kanälen durch die Anlage floss.
Sie kamen näher, und der Knabe bemerkte einen Mönch, der unter den anderen ganz und gar auffiel. Das musste er sein. Der ehrwürdige Vater Abt des Klosters. Er war von schlanker Gestalt und überragte die meisten um mindestens einen Kopf. Zum Studium der Theologie sei er in Heidelberg gewesen, hatte man Anselm erzählt, und seit vielen Jahren der allmächtige Vorsteher des Klosters.
Mit knappen Gesten drückte der Herr seinen Willen aus. Die anderen nickten und gaben seine Anweisungen weiter.
Anselm stand weitgehend verdeckt hinter dem Bursarius. Der Cellerar trat neben die beiden. »Der oberste Hirte hat alle seine Schäfchen versammelt«, bemerkte er mit Blick auf die Menge.
Der oberste Hirte? Den Ausdruck hatte Anselm doch vor Kurzem schon einmal gehört.
Dann war es so weit: Der Klostervorsteher nahm im Schatten eines eigens dafür gezimmerten Pavillons Platz, um sein Werk feierlich in Betrieb zu nehmen. »Meine Brüder«, erhob Abt Burrus von Bretten die Stimme, »es ist vollbracht! Zum Wohle meines Klosters krönen wir unsere zisterziensische Wasserbaukunst, um die uns die Welt beneidet, mit dem zwanzigsten dieser Reihe von Seen und Fischteichen oberhalb und unterhalb der Abtei. Gott schenke dem Bauwerk seinen Segen!«
»Amen«, murmelten die Mönche, und die Weihrauchträger schwenkten ihre goldenen Fässchen.
Der Abt warf sich in die Brust und rief: »Wie mir der fahrende Astrologe, den ich vor dem Bau befragte, versicherte, wird uns das zusätzliche Wasser aus dem Tiefen See alle Zeiten gute Dienste erweisen.«





























