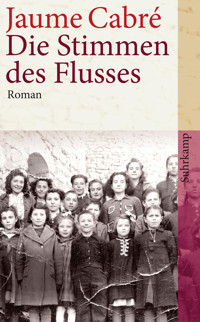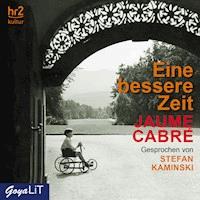13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Antiquitätenladen des Vaters in Barcelona ist eine wahre Schatzkammer, doch die Faszination des jungen Adrià gehört allein einer wertvollen Storioni-Geige aus dem 18. Jahrhundert mit einem bezaubernden Klang. Heimlich tauscht Adrià sie eines Tages mit seiner eigenen Geige aus, um sie stolz seinem besten Freund zu zeigen. Als er die Storioni zurücklegen möchte, sind seine Geige und sein Vater verschwunden, der Antiquitätenhändler wurde kaltblütig ermordet. Viele Jahre danach – Adrià ist inzwischen Gelehrter und Sammler – sucht er das Rätsel um die Storioni zu lösen und so den wahren Grund für den Mord herauszufinden. Er ahnt nicht, dass die Vergangenheit des Musikinstruments Familiengeheimnisse, Mordfälle, Hass und Intrigen, Liebe und Verrat verbirgt. Für Adrià steht einiges auf dem Spiel – auch seine große Liebe Sara …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1150
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
»Die Virtuosität des Autors erzeugt ein in der Gegenwartsliteratur selten anzutreffendes Glücksgefühl.« Frankfurter Allgemeine Zeitung
Der Antiquitätenladen des Vaters in Barcelona ist eine wahre Schatzkammer, doch die Faszination des jungen Adrià gehört allein einer wertvollen Storioni-Geige aus dem 18. Jahrhundert mit einem bezaubernden Klang.
Heimlich tauscht Adrià sie eines Tages mit seiner eigenen Geige aus, um sie stolz seinem besten Freund zu zeigen. Als er die Storioni zurücklegen möchte, sind seine Geige und sein Vater verschwunden, der Antiquitätenhändler wurde kaltblütig ermordet. Viele Jahre danach – Adrià ist inzwischen Gelehrter und Sammler – sucht er das Rätsel um die Storioni zu lösen und so den wahren Grund für den Mord herauszufinden. Er ahnt nicht, dass die Vergangenheit des Musikinstruments Familiengeheimnisse, dunkle Mordfälle, Hass und Intrigen, Liebe und Verrat verbirgt. Für Adrià steht einiges auf dem Spiel – auch seine große Liebe Sara …
Jaume Cabré, 1947 in Barcelona geboren, ist einer der angesehensten katalanischen Autoren. Neben Romanen, Erzählungen und Essays hat er auch fürs Theater geschrieben und Drehbücher verfasst. Seine Romane wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem spanischen Kritikerpreis und dem französischen Prix Méditerranée, und in zahlreiche Sprachen übersetzt. Bereits auf Deutsch erschienen sind der Weltbestseller Die Stimmen des Flusses (2007) und Senyoria (2009).
Jaume Cabré
Das Schweigen des Sammlers
Roman
Aus dem Katalanischen von Kirsten Brandt und Petra Zickmann
Insel Verlag
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel Jo confesso bei Edicions Proa, Barcelona.
Umschlagfoto: Xabier Mendiola
eBook Insel Verlag Berlin 2014
Der vorliegende Text folgt der 3. revidierten Auflage der Ausgabe des insel taschenbuchs 4226.
© Insel Verlag Berlin 2011
© Jaume Cabré, 2011
© first published in Catalan by Raval Edicions, SLU, Proa, 2011
Published by arrangement with Christina Mora Literary & Film Agency (Barcelona, Spain)
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Umschlaggestaltung: Carola Niere, München
eISBN 978-3-458-76000-9
www.insel-verlag.de
Inhalt
I A capite …
II De pueritia
III Et in Arcadia ego
IV Palimpsestus
V Vita condita
VI Stabat mater
VII … usque ad calcem
Die Figuren des Romans
Für Margarida
I A capite …
Ich wird nichts sein.
CARLES CAMPS MUNDÓ
1
Erst gestern Abend, als ich durch die regennassen Straßen von Vallcarca spazierte, wurde mir bewusst, dass es ein unverzeihlicher Fehler war, in diese Familie hineingeboren zu werden. Plötzlich erkannte ich: Ich war stets allein gewesen, hatte mich nie auf meine Eltern oder einen Gott verlassen können, die mir die Suche nach Lösungen abgenommen hätten, wenngleich ich mir als Jugendlicher angewöhnt hatte, die Last des Denkens und die Verantwortung für meine Taten auf einen vagen Glauben und die verschiedensten Lektüren abzuwälzen. Gestern Abend, als ich nach meinem Gespräch mit Doktor Dalmau im Regen nach Hause ging, kam ich zu dem Schluss, dass ich diese Last ganz allein tragen muss. Niemand außer mir ist für die Erfolge und Misserfolge in meinem Leben verantwortlich. Sechzig Jahre habe ich für diese Erkenntnis gebraucht. Ich hoffe, du verstehst mich und merkst, wie schutzlos und einsam ich mich fühle und wie schrecklich ich dich vermisse. Trotz allem, was uns trennt, dienst du mir als Beispiel. Trotz meiner Panik will ich von nun an ohne Rettungsplanke durch die Fluten treiben. Trotz einiger Fingerzeige habe ich noch immer keinen Glauben, keinen Priester, keine allgemeingültigen Codes, die mir meinen Weg ins Ungewisse ebnen könnten. Ich fühle mich alt, und der Sensenmann winkt mir, ihm zu folgen, er hat den schwarzen Läufer gerückt und bedeutet mir nun mit einer höflichen Geste, dass ich am Zug bin. Er weiß, dass mir kaum noch Bauern bleiben. Immerhin: Noch ist nicht morgen, und ich überlege, mit welcher Figur ich ziehen kann. Ich sitze allein vor dem Blatt Papier, meiner letzten Chance.
Vertrau mir nicht zu sehr. Aufzeichnungen wie diese – für einen einzigen Leser verfasste Memoiren – sind anfällig für Lügen, und ich weiß, ich werde versuchen, immer auf allen vieren zu landen wie die Katzen; trotzdem will ich mich bemühen, nicht allzu viel zu erfinden. Alles war genau so oder noch schlimmer. Ich weiß, dass ich es dir schon viel früher hätte erzählen sollen; aber es ist schwierig, und selbst jetzt weiß ich nicht, wie ich anfangen soll.
Im Grunde genommen begann alles vor mehr als fünfhundert Jahren damit, dass ein verzweifelter Mann um Aufnahme ins Kloster Sant Pere de Burgal bat. Hätte er das nicht getan, oder hätte ihm der Prior Dom Josep de Sant Bartomeu die Aufnahme verweigert, dann würde ich dir jetzt nicht all das berichten, was ich berichten will. Aber so weit kann ich nicht zurückgehen. Ich fange später an. Viel später.
»Dein Vater …, hör zu, mein Sohn …, dein Vater …«
Nein, nein: Auch hier will ich nicht anfangen. Besser, ich beginne mit dem Arbeitszimmer, in dem ich vor deinem eindrucksvollen Selbstbildnis sitze und schreibe. Dieses Arbeitszimmer ist meine Welt, mein Leben, mein Universum, in dem fast alles Platz hat außer der Liebe. Als ich noch mit kurzen Hosen herumlief und im Herbst und Winter Frostbeulen an den Händen hatte, durfte ich es nur zu ganz bestimmten Zeiten betreten. Oder aber ich schlich mich heimlich hinein. Ich kannte jede Ecke und jeden Winkel, und einige Jahre lang unterhielt ich hinter dem Sofa ein sicheres Geheimversteck, das ich allerdings nachher jedes Mal aufräumen musste, damit Lola Xica es nicht beim Staubwischen entdeckte. Wenn ich das Zimmer offiziell betrat, musste ich mich benehmen, als wäre ich zu Besuch, und die Hände auf dem Rücken halten, während mein Vater mir das neueste Manuskript zeigte, sieh nur, das habe ich in einem Trödelladen in Berlin gefunden, und lass bloß deine Finger bei dir, dass ich nicht wieder mit dir schimpfen muss. Neugierig beugte sich Adrià über das Manuskript.
»Das ist Deutsch, oder?« Unwillkürlich streckte er die Hand aus.
»Na, na, na, da schaut wieder einer mit den Fingern.« Der Vater schlug ihm auf die Hand. »Was hast du gesagt?«
»Ob das Deutsch ist.« Adrià rieb sich die schmerzende Hand.
»Ja.«
»Ich möchte Deutsch lernen.«
Fèlix Ardèvol betrachtete seinen Sohn voller Stolz und sagte, bald kannst du damit anfangen, mein Sohn.
Eigentlich war es gar kein Manuskript, sondern ein Stapel vergilbter Blätter, auf deren Titelseite in altertümlicher Schrift stand: Der begrabene Leuchter. Eine Legende.
»Und wer ist Stefan Zweig?«
Vater, der gerade eine Randkorrektur neben dem ersten Absatz unter die Lupe nahm, antwortete mir nicht etwa, ein Schriftsteller, mein Sohn, sondern erwiderte nur zerstreut, ach, das ist irgend so ein Kerl, der sich vor zehn oder zwölf Jahren in Brasilien umgebracht hat. Jahrelang wusste ich nicht mehr über Stefan Zweig, als dass er irgend so ein Kerl war, der sich vor zehn, zwölf, dreizehn, vierzehn oder fünfzehn Jahren in Brasilien umgebracht hatte; bis ich dann das Manuskript lesen konnte und ein wenig mehr über ihn erfuhr.
Und dann war die Besuchszeit zu Ende, und Adrià verließ das Arbeitszimmer mit der Ermahnung, bloß keinen Lärm zu machen: Zu Hause durfte man nicht rennen und nicht schreien, nicht einmal mit der Zunge schnalzen, denn wenn Vater nicht gerade ein Manuskript unter die Lupe nahm, kontrollierte er seinen Bestand mittelalterlicher Landkarten oder überlegte sich, wie er an die Neuerwerbungen gelangen könnte, nach denen es ihn in den Fingern juckte. Der einzig zulässige Lärm war, in meinem Zimmer Geige zu üben. Aber ich konnte ja schlecht den ganzen Tag das Arpeggio Nr. XXIII aus dem Livro dos exercícios davelocidade rauf und runter spielen, das mich dazu brachte, die Trullols zu hassen, mir aber die Freude am Geigespielen nicht verdarb. Nein, ich hasste die Trullols nicht. Aber sie ging mir auf die Nerven, vor allem, weil sie so sehr auf der Übung XXIII bestand.
»Ich meine ja nur, ein bisschen Abwechslung wäre nicht schlecht.«
»Hier« – und sie klopfte mit der Spitze des Geigenbogens auf die Partitur – »findest du alle Schwierigkeiten auf einer einzigen Seite. Diese Übung ist einfach ingeniös.«
»Aber ich …«
»Bis Freitag will ich die XXIII fehlerfrei. Einschließlich Takt 27.«
Manchmal war die Trullols einfach blöd. Aber meistens fand ich sie eigentlich ganz passabel. Und manchmal mehr als das.
Bernat war der gleichen Ansicht. Als ich O livro dos exercícios da velocidade durchnahm, kannte ich Bernat noch nicht. Aber über die Trullols waren wir uns einig. Sie muss wohl eine gute Lehrerin gewesen sein, auch wenn sie, soviel ich weiß, nicht in die Geschichte eingegangen ist. Ich glaube, ich muss meine Gedanken erst einmal ordnen, ich bringe alles durcheinander. Ja, gewisse Dinge weißt du schon, vor allem die, die dich betreffen. Aber es gibt Teile meiner Seele, von denen du vermutlich nichts weißt, weil es schlicht unmöglich ist, einen anderen Menschen ganz und gar zu kennen, selbst wenn …
Obwohl der Laden eindrucksvoller war als das häusliche Arbeitszimmer, mochte ich ihn weniger, vielleicht weil ich mich bei meinen Besuchen – die kaum häufiger waren als die im Arbeitszimmer – unwillkürlich überwacht fühlte. Allerdings bot der Laden den Vorteil, dass ich dort die wunderschöne Cecília betrachten konnte, in die ich bis über beide Ohren verliebt war. Ihr stets sorgfältig frisiertes Haar war galaktisch blond, und sie hatte leuchtend rote volle Lippen. Und immer war sie mit ihren Katalogen und Preislisten zugange, schrieb Etiketten oder begrüßte die wenigen Kunden mit einem Lächeln, das ihre vollkommenen Zähne aufblitzen ließ.
»Haben Sie Musikinstrumente?«
Der Mann, der vor Cecília stand, hatte nicht einmal den Hut abgenommen. Er sah sich um: Lampen, Leuchter, Kirschbaumstühle mit feinen Intarsien, Sofas aus dem frühen neunzehnten Jahrhundert, Vasen aller Größen und aller Epochen … Mich nahm er gar nicht wahr.
»Nur ein paar wenige, aber wenn Sie mir folgen wollen …«
Diese paar wenigen waren zwei Geigen und eine Bratsche mit mäßigem Klang, aber wie durch ein Wunder unversehrten Darmsaiten; des Weiteren eine zerbeulte Tuba, zwei prächtige Waldhörner und eine Trompete, die der Gemeindediener des Tals verzweifelt geblasen hatte, um die Menschen der umliegenden Täler zu warnen, dass der Wald von Paneveggio brannte und die Einwohner von Pardàc die Nachbardörfer um Hilfe baten, selbst die von Welschnofen, bei denen es kürzlich ebenfalls gebrannt hatte, und auch die von Moena und Soraga, denen vielleicht der alarmierende Brandgeruch schon um die Nase wehte. Man schrieb das Jahr 1690, und die Erde war rund für beinahe jedermann: Wenn ein Schiff in Richtung Westen aufbrach und unbekannten Krankheiten, gottlosen Wilden, Land- und Meerungeheuern, Eis, Sturm und Regenfluten entging, kehrte es von Osten her zurück, die Seeleute hagerer und ausgezehrter, mit verlorenem Blick, ihre Nächte von Albträumen erfüllt. Und im Sommer dieses Jahres 1690 lief in Pardàc, Moena und den benachbarten Ortschaften alles zusammen, was Beine hatte, und starrte auf das Unglück, das ihnen, dem einen mehr, dem anderen weniger, die Lebensgrundlage zerstörte. Ohnmächtig mussten sie zusehen, wie das Höllenfeuer ganze Fuder kostbaren Holzes verschlang. Als ein gottgesandter Regen es endlich löschte, durchkämmte Jachiam, der vierte und pfiffigste Sohn des alten Mureda aus Pardàc, den ganzen Wald nach brauchbarem Holz, das vom Feuer verschont geblieben war. Auf halbem Weg hinunter zur Klamm kauerte er neben einer jungen, verkohlten Tanne nieder, um seine Notdurft zu verrichten. Aber was er da sah, verdarb ihm die Lust, sich zu erleichtern: ein paar harzgetränkte Kienspäne, umhüllt von einem Lappen, der nach Kampfer oder irgendeiner anderen merkwürdigen Substanz roch. Ganz vorsichtig wickelte er das von den Flammen unberührte Stück Stoff aus, und als er es erkannte, schwindelte ihn: Der schmutzig grüne Lappen mit Saumstichen aus noch schmutzigerem gelbem Garn war aus dem Wams des dicken Bulchanij Brocia de Moena geschnitten. Und als er zwei weitere, allerdings völlig verbrannte Stoffhaufen fand, verstand er, dass Bulchanij, das Ungeheuer, seine Drohung wahr gemacht hatte, die Familie Mureda und mit ihr das ganze Dorf Pardàc zu vernichten.
»Bulchanij.«
»Ich rede nicht mit Hunden.«
»Bulchanij.«
Bei dem düsteren Klang seiner Stimme wandte der andere sich unwillig um. Bulchanij de Moena hatte einen Schmerbauch, auf dem er – hätte er noch länger gelebt und ihn gut genährt – irgendwann wunderbar seine Arme hätte aufstützen können.
»Was zum Teufel willst du?«
»Wo ist dein Wams?«
»Was geht’s dich an?«
»Du trägst es nicht. Zeig’s mir.«
»Verpiss dich. Bildest du dir vielleicht ein, nur weil ihr in der Scheiße sitzt, müssten wir aus Moena alles tun, was ihr sagt?« Bulchanij starrte ihn hasserfüllt an. »Ich denke gar nicht daran, es dir zu zeigen. Und jetzt hau ab, Hundsfott, du stehst mir in der Sonne.«
Da zückte Jachiam, der vierte Sohn des alten Mureda, in kalter Wut das Entrindungsmesser, das er stets am Gürtel trug, und jagte es dem dicken Bulchanij Brocia in den Bauch wie in den Stamm eines Ahorns, den es zu schälen galt. Bulchanij riss Mund und Augen sperrangelweit auf, weniger vor Schmerz als vor Staunen darüber, dass ein Hundsfott aus Pardàc es wagte, ihn anzurühren. Als Jachiam Mureda das Messer wieder herauszog, gab es ein hässliches blubberndes Geräusch von sich und war rot von Blut, und Bulchanij sackte auf seinem Stuhl zusammen, als entwiche ihm durch die Wunde die Luft.
Jachiam sah den menschenleeren Weg hinauf und hinunter, dann lief er unbedacht los in Richtung Pardàc. Hinter dem letzten Haus von Moena bemerkte er, wie die Bucklige von der Mühle, die gerade mit einem Bündel nasser Wäsche daherkam, ihn mit offenem Mund anstarrte, als habe sie alles gesehen. Statt ihrem Blick mit dem Messer zu Leibe zu rücken, schritt er nur rascher aus. Er war noch keine zwanzig Jahre alt und ein Meister darin, den Klang des Holzes zu wecken – und doch war sein Leben soeben in Scherben gegangen.
Seine Familie reagierte besonnen: Sie schickten gleich jemanden mit den Beweisstücken in die Nachbargemeinden, um zu belegen, dass Bulchanij ein Brandstifter war, der ihnen aus Rachsucht den Wald angezündet hatte, aber die aus Moena beschlossen, das Recht in die eigene Hand zu nehmen, und bliesen zur Jagd auf den vermaledeiten Jachiam Mureda.
»Sohn«, sagte der alte Mureda, und sein Blick war noch trauriger als sonst, »du musst fliehen.« Er gab ihm einen Beutel mit der Hälfte des Goldes, das er in dreißig Jahren als Waldbauer im Paneveggio zusammengespart hatte, und keines seiner Kinder muckte gegen diese Entscheidung auf. In feierlichem Tonfall fuhr er fort: »Auch wenn keiner die richtigen Bäume zu finden und den Klang des Holzes zu wecken vermag wie du, mein lieber Sohn, viertes Kind dieses unglücklichen Hauses, ist dein Leben mehr wert als der beste der Ahornstämme, die wir von nun an nie wieder werden verkaufen können. Und so entgehst du dem Verderben, dem wir nun anheimfallen, weil Bulchanij aus Moena uns unser Holz genommen hat.«
»Vater, ich …«
»Verschwinde, flieh, aber stell es klug an. Geh nach Welschnofen, denn sie werden dich in Siròr gewiss suchen. Wir werden das Gerücht ausstreuen, du wärst in Siròr untergekrochen. Hier in den Tälern bist du nicht sicher. Du hast eine lange, lange Reise vor dir, die dich weit weg von Pardàc führen wird. Flieh, mein Sohn, und Gott schütze dich.«
»Aber Vater, ich will nicht weg von hier! Ich will im Wald arbeiten.«
»Den haben sie uns niedergebrannt. Als was willst du denn arbeiten, du Kindskopf?«
»Ich weiß es nicht, aber wenn ich aus den Tälern weggehe, sterbe ich!«
»Wenn du heute Nacht nicht verschwindest, werde ich dich höchstpersönlich umbringen. Hast du jetzt verstanden?«
»Vater …«
»Niemand aus Moena wird Hand an eines meiner Kinder legen.«
Und so nahm Jachiam Mureda Abschied von seinem Vater und küsste nacheinander alle seine Geschwister: Agno, Jenn, Max und ihre Frauen; Hermes, Josef, Theodor und Micurà; Ilse und Erika und ihre Männer; und zuletzt Katharina, Matilde, Gretchen und Bettina. Alle waren sie gekommen, um ihm stumm Lebewohl zu sagen, und als er schon an der Tür war, rief die kleine Bettina »Jachiam«, und er drehte sich um und sah, wie das Mädchen die Hand nach ihm ausstreckte. Sie hielt ihm das Medaillon der Muttergottes dai Ciüf von Pardàc hin, das die Mutter ihr auf dem Totenbett anvertraut hatte. Schweigend musterte Jachiam die Geschwister, dann sah er den Vater an, und dieser nickte wortlos. Da ging er zu dem Mädchen, nahm das Medaillon und sagte: »Meine kleine Bettina, ich werde es tragen, bis ich sterbe«, und er wusste nicht, wie recht er damit hatte. Und Bettina strich ihm mit ihren beiden kleinen Händen über die Wangen, ohne zu weinen. Jachiam ging mit tränennassen Augen hinaus, murmelte am Grab der Mutter ein kurzes Gebet und verschwand in derselben Nacht, zog hinauf ins Gebirge, in den ewigen Schnee, hinter dem ein neues Leben, eine neue Geschichte und neue Erinnerungen auf ihn warteten.
»Weiter haben Sie nichts?«
»Wir sind ein Antiquitätengeschäft«, sagte Cecília in dem eisigen Tonfall, mit dem sie Männer gern in Verlegenheit brachte, und fuhr ein wenig spöttisch fort: »Versuchen Sie es doch mal in einem Musikgeschäft.«
Mir gefiel Cecília, wenn sie grimmig tat. Dann war sie noch hübscher als sonst. Sogar hübscher als Mutter. Als Mutter zu jener Zeit.
Von dort, wo ich stand, konnte ich Senyor Berenguers Büro sehen. Ich hörte, wie Cecília den enttäuschten Kunden, der immer noch seinen Hut auf dem Kopf trug, hinausbegleitete, und während das Läuten der Türglocke und Cecílias »Auf Wiedersehen, der Herr« erklangen, hob Senyor Berenguer den Kopf und zwinkerte mir zu.
»Adrià.«
»Ja.«
Er hob die Stimme: »Wann wirst du abgeholt?«
Ich zuckte mit den Achseln. Ich wusste nie genau, wann ich wo sein sollte. Meine Eltern wollten mich nicht allein zu Hause lassen und brachten mich, wenn beide ausgingen, in den Laden. Ich hatte nichts dagegen, denn so konnte ich mir in Ruhe die unglaublichsten Gegenstände ansehen, die schon ein ganzes Leben hinter sich hatten und nun geduldig auf ihre zweite, dritte oder vierte Chance warteten. Zum Zeitvertreib malte ich mir dann gerne ihr Leben in den verschiedensten Häusern aus.
Irgendwann kam dann Lola Xica, um mich abzuholen, stets in Eile, weil sie das Abendessen machen musste und noch nichts vorbereitet hatte. Darum zuckte ich mit den Schultern, als Senyor Berenguer mich fragte, wann ich abgeholt würde.
»Komm her«, sagte er und winkte mit einem leeren Blatt Papier. »Setz dich an den Tudor-Tisch und mal ein bisschen.«
Ich habe nie gern gemalt, weil mir das nicht liegt, und zwar kein bisschen. Darum habe ich immer dein zeichnerisches Talent bestaunt, das mir wie ein Wunder erschien. Senyor Berenguer schlug mir vor, ein bisschen zu malen, weil es ihn nervös machte, wenn ich nichts tat, was ja gar nicht stimmte, weil ich die Zeit mit Nachdenken verbrachte. Aber Senyor Berenguer durfte man nicht widersprechen. Also setzte ich mich an den Tudor-Tisch und tat beschäftigt, damit er Ruhe gab. Ich holte Schwarzer Adler aus der Tasche und versuchte, ihn zu zeichnen. Armer Schwarzer Adler, sollte er sich je auf diesem Blatt Papier sehen … Übrigens hatte Schwarzer Adler noch keine Zeit gehabt, Sheriff Carson kennenzulernen, denn ich hatte ihn gerade erst am Morgen von Ramon Coll gegen meine Weiss-Mundharmonika eingetauscht. Wenn Vater das erfährt, bringt er mich um.
Senyor Berenguer war ein seltsamer Mensch; wenn er lächelte, fürchtete ich mich ein wenig vor ihm, und ich konnte ihm nicht verzeihen, dass er Cecília wie eine Dienstmagd behandelte. Aber er wusste mehr als jeder andere über meinen Vater, den großen Unbekannten.
2
An einem nebligen Morgen am zweiten Donnerstag im September legte die Santa Maria in Ostia an. Die Überfahrt von Barcelona war schlimmer gewesen als die Reise des Äneas auf der Suche nach seiner Bestimmung und unsterblichem Ruhm. Neptun war ihm ganz und gar nicht gewogen gewesen, und so hatte er an Bord der Santa Maria die Fische gefüttert, und sein Gesicht, das eigentlich die gesunde Bräune eines Bauernburschen aus der Hochebene von Vic besaß, hatte eine geisterhaft bleiche Färbung angenommen.
Hochwürden Josep Torras i Bages höchstpersönlich hatte entschieden, dass dieser kluge, dem Studium zugeneigte, fromme, wohlerzogene und für sein jugendliches Alter erstaunlich gebildete Seminarschüler eine kostbare Blume war, die fruchtbaren Boden brauchte. Im bescheidenen Gärtlein des Priesterseminars von Vic würde sie verkümmern, und damit wäre die Gottesgabe einer ungewöhnlich hohen natürlichen Intelligenz verschwendet.
»Ich will nicht nach Rom, Monsenyor. Ich möchte mich ganz dem Studium widmen, w…«
»Genau darum schicke ich dich nach Rom, mein Sohn. Ich kenne unser Seminar gut genug, um zu wissen, dass jemand von deiner Intelligenz hier seine Zeit verschwendet.«
»Aber Monsenyor …«
»Gott hat dich zu Höherem berufen. Deine Lehrer haben mich inständig darum gebeten.« Hochwürden wedelte leicht theatralisch mit dem Papier in seinen Händen.
»Geboren auf dem Landgut Can Ges in der Ortschaft Tona als Sohn von Andreu und Rosalia im Schoße einer mustergültigen Familie, zeigte er schon im zarten Alter von sechs Jahren die schulische Leistung und Entschlossenheit, die ihn für eine kirchliche Laufbahn geradezu prädestinierten, und wurde demzufolge in die erste Lateinklasse von Monsenyor Jacint Garrigós aufgenommen. Dort machte er so rasche und bemerkenswerte Fortschritte, dass er im Rhetorikkurs die berühmte ›Oratio Latina‹ halten durfte (eine bedeutende Auszeichnung, die nur den besten und sprachbegabtesten Schülern zuteil wird, wie Monsenyor aus eigener Erfahrung wissen, da wir das Vergnügen hatten, Euch ehedem zu unseren Schülern zu zählen), obgleich er mit elf Jahren eigentlich zu jung, vor allem aber zu schmächtig für diese Aufgabe war. So konnten die Zuhörer zwar Fèlix Ardèvols geschliffene Ausdrucksweise in der Sprache Vergils bewundern, doch musste der große Rhetoriker dazu auf einem recht hohen Schemel stehen, um vom Publikum, unter dem sich auch sein Bruder und die stolzen Eltern befanden, überhaupt gesehen zu werden. Desgleichen brillierte Fèlix Ardèvol i Guiteres in den Fächern Mathematik, Philosophie und Theologie und war bald anderen berühmten Schülern dieses Seminars vergleichbar, als da wären die hochgeschätzten Padres Jaume Balmes i Urpía, Antoni Maria Claret i Clarà, Jacint Verdaguer i Santalò, Jaume Collell i Bancells, Professor Andreu Duran und natürlich Ew. Bischöfliche Gnaden, Oberhaupt unserer geliebten Diözese.
Unsere Dankbarkeit gilt auch unseren Vorfahren, wie der Herr uns in Ecclesiastes 44, 1 ermahnt: Laudemos viros gloriosos et parentes nostros in generatione sua. Und so glauben wir, Euch mit Fug und Recht die inständige Bitte antragen zu dürfen, unserem Seminarschüler Fèlix Ardèvol i Guiteres das Studium der Theologie an der Pontifica Universitas Gregoriana zu gestatten.«
»Du hast keine Wahl, mein Sohn.«
Fèlix Ardèvol wagte nicht zu sagen, dass er, ein Bewohner des Festlands, geboren und aufgewachsen fern des Meeres, Schiffe hasste. Und weil ihm der Mut fehlte, gegen den Bischof aufzubegehren, hatte er diese grauenvolle Reise schließlich angetreten. In einem Winkel im Hafen von Ostia erbrach er zwischen halb vermoderten Holzkisten, in denen es von Ratten wimmelte, seine Ohnmacht und fast alle seine Erinnerungen an die Vergangenheit. Einen Augenblick lang stand er noch keuchend da, dann richtete er sich auf, wischte sich mit dem Taschentuch den Mund ab, strich sich energisch die Reisesoutane glatt und richtete den Blick auf seine glänzende Zukunft. Immerhin war er, wie einst Äneas, nach Rom gelangt.
»Dieses Zimmer ist das beste im ganzen Wohnheim.«
Verwundert drehte Fèlix Ardèvol sich um. Auf der Schwelle stand ein gedrungener, heftig schwitzender Student in Dominikanerkutte und lächelte ihn freundlich an.
»Félix Morlin aus Liège«, sagte der Unbekannte und tat einen Schritt in die Zelle.
»Fèlix Ardèvol aus Vic.«
»Oh! Ein Namensvetter!«, rief der andere lachend und streckte ihm die Hand hin.
Sie mochten sich vom ersten Augenblick an. Morlin sagte Fèlix noch einmal, dass er das begehrteste Zimmer im ganzen Wohnheim abbekommen habe, und erkundigte sich, wer sein Gönner sei. Er habe keinen, erwiderte Fèlix; am Empfang habe der dicke, kahle Hausmeister einen Blick in die Papiere geworfen, Ardevole? Cinquantaquattro gesagt und ihm die Schlüssel ausgehändigt, ohne ihn eines Blickes zu würdigen. Morlin nahm ihm das nicht ab, lachte aber herzlich.
In der knappen Woche vor Kursbeginn machte Morlin ihn mit den acht oder neun Studenten aus dem zweiten Jahr bekannt, mit denen er verkehrte, riet ihm, sich mit niemandem abzugeben, der nicht an der Gregoriana oder dem Istituto Biblico studierte, weil das nur Zeitverschwendung sei, zeigte ihm, wie man sich hinter dem Rücken des Zerberus, der den Eingang bewachte, aus dem Wohnheim stahl, legte ihm nahe, weltliche Kleidung für ihre heimlichen Ausflüge bereitzuhalten, und erklärte den Neulingen die spektakulärsten Bauwerke auf dem Weg vom Wohnheim zur Universität. Er sprach ein gut verständliches, wenn auch von französischem Akzent geprägtes Italienisch. Und er schärfte ihnen ein, sich von den Jesuiten der Gregoriana fernzuhalten, die einem ruckzuck eine Gehirnwäsche verpassten.
Am letzten Tag vor Kursbeginn versammelten sich die alten und die neuen Studenten aus aller Welt im gewaltigen Festsaal des Palazzo Gabrielli-Borromeo im Hauptgebäude der Universität, und der Padre Decanus der Pontifica Università Gregoriana del Collegio Romano, Pater Daniele D’Angelo SJ, rief ihnen in untadeligem Latein ins Bewusstsein, wie glücklich und privilegiert sie sich fühlen dürften, »an allen Fakultäten der Pontifica Università Gregoriana et cetera et cetera et cetera studieren zu können. Wir dürfen uns rühmen, namhafte Männer unter unsere Absolventen zu zählen, darunter einige Päpste wie den seligen Leo XIII. Alles, was wir von euch verlangen, ist Eifer, Eifer und nochmals Eifer. Ihr sollt hier lernen, lernen und nochmals lernen, und zwar bei den besten Lehrmeistern in Theologie, Kirchenrecht, Spiritualität, Kirchengeschichte et cetera et cetera et cetera.«
»Pater D’Angelo heißt bei uns D’Angelodangelodangelo«, flüsterte Morlin ihm ins Ohr.
»Und nach Beendigung eures Studiums zieht ihr hinaus in die Welt, kehrt zurück in eure Länder, in eure Seminare, in die Schulen eures Ordens; wer bis dahin noch kein Priester ist, wird die Weihe empfangen, und ihr werdet dafür Sorge tragen, dass alles, was man euch in diesem Hause gelehrt hat, Früchte trägt.« Und so weiter und so weiter und so weiter, geschlagene fünfzehn Minuten lang, und dazu praktische Ratschläge, vielleicht nicht ganz so praktisch wie die von Morlin, aber äußerst hilfreich für den Alltag. Fèlix Ardèvol dachte, dass es viel schlimmer hätte kommen können; dass die Orationes Latinae in Vic manchmal wesentlich langweiliger gewesen waren als die handfesten Anweisungen, die man ihnen hier erteilte.
Die ersten Monate bis nach Weihnachten lief alles wie am Schnürchen. Fèlix Ardèvol bewunderte vor allem den Scharfsinn Pater Falubas, eines slowakisch-ungarischen Jesuiten mit schier unbegrenztem Bibelwissen, und die geistige Strenge des hochfahrenden Paters Pierre Blanc, der über die Offenbarung und ihre kirchliche Vermittlung lehrte und – obwohl er ebenfalls aus Liège stammte – Morlin mit seinem Vortrag über die Annäherung an die Marientheologie in der Abschlussprüfung durchrasseln ließ. Auch freundete Fèlix sich mit Drago Gradnik an, der in drei Fächern neben ihm saß, ein rotgesichtiger slowenischer Riese aus dem Priesterseminar in Ljubljana, dessen Stiernacken das Kollar zu sprengen drohte. Sie redeten wenig miteinander, obwohl Gradnik fließend Latein sprach, aber beide waren schüchtern und verwendeten all ihre Energie darauf, die zahllosen Türen zur Weisheit zu durchschreiten, die ihnen das Studium auftat. Während Morlin jammerte und seinen Freundes- und Bekanntenkreis stetig erweiterte, schloss sich Ardèvol in seinem Zimmer ein und entdeckte neue Welten im paläographischen Studium von Papyrusrollen und anderen biblischen Dokumenten in demotischem Ägyptisch, Koptisch, Griechisch oder Aramäisch, die ihnen Pater Faluba anschleppte. Der Pater war es auch, der sie die Liebe zu diesen Dingen lehrte. Ein zerstörtes Manuskript, so wurde er nicht müde zu betonen, ist für die Forschung nutzlos. Man muss es restaurieren, und zwar um jeden Preis. Und die Rolle des Restaurators ist ebenso wichtig wie die des Forschers, der es entziffert. Und er sagte nicht et cetera et cetera et cetera, weil er immer genau wusste, wovon er redete.
»Schwachsinn«, erklärte Morlin kategorisch, als Ardèvol ihm davon erzählte. »Diese Leute sind nur glücklich, wenn sie mit einer Lupe in der Hand vor angefressenen, modrigen Papieren sitzen.«
»Ich auch.«
»Wozu nutzen einem tote Sprachen?«, fragte Morlin in seinem umständlichen Latein.
»Pater Faluba hat gesagt, dass wir Menschen nicht ein Land bewohnen, sondern eine Sprache. Und indem wir alte Sprachen wieder zum Leben erwecken …«
»Sciocchezze. Stupiditates. Die einzige tote Sprache, die noch einigermaßen lebendig ist, ist Latein.«
Sie waren auf der Via di Sant’Ignazio unterwegs, Ardèvol in seiner Soutane, Morlin in seiner Kutte. Zum ersten Mal war Ardèvol sein Freund fremd. Er blieb stehen und fragte ihn verwundert, woran er eigentlich glaube. Auch Morlin hielt an und sagte ihm, er sei Dominikaner geworden, weil er das tiefe innere Bedürfnis habe, anderen zu helfen und der Kirche zu dienen, und nichts werde ihn von diesem Weg abbringen, weil man der Kirche durch Werke dienen müsse; nicht durch das Studium halb zerfallener Papiere, sondern indem man Einfluss auf Menschen ausübte, die Einfluss auf das Leben von … Er unterbrach sich, dann fuhr er fort et cetera et cetera et cetera, und beide Freunde lachten schallend. In diesem Augenblick ging Carolina das erste Mal an ihnen vorbei, aber keiner von beiden bemerkte sie. Und wenn ich mit Lola Xica zu Hause ankam, musste ich Geige üben, während sie das Abendessen machte und der Rest der Wohnung im Dunkeln lag. Das gefiel mir gar nicht, weil hinter jeder Tür ein Bösewicht lauern konnte, und so trug ich Schwarzer Adler in der Tasche mit mir herum, da mein Vater schon vor Jahren beschlossen hatte, sämtliche Medaillons, Schutzarmbänder, Heiligenbilder und Messbücher aus dem Haus zu verbannen, und der arme kleine Adrià Ardèvol ein Bedürfnis nach unsichtbarem Schutz verspürte. Eines Tages blieb ich, anstatt Geige zu üben, im Esszimmer vor dem Bild über der Anrichte stehen und betrachtete gebannt, wie die hinter Trespui untergehende Sonne die Abtei von Santa Maria de Gerri in magisches Licht tauchte. Es war das immer gleiche Licht, das mich faszinierte und in meiner Phantasie unzählige wilde Geschichten weckte, und so hörte ich nicht die Wohnungstür und auch sonst nichts, bis die raue Stimme meines Vaters mich zusammenzucken ließ.
»Was stehst du hier so nutzlos herum? Hast du keine Hausaufgaben? Musst du nicht Geige üben? Hast du sonst nichts zu tun?«
Und Adrià verschwand mit immer noch heftig klopfendem Herzen in seinem Zimmer, ohne die Kinder zu beneiden, die von ihren Eltern mit einem Kuss begrüßt wurden, weil er nicht glaubte, dass es so etwas gab.
»Carson: Das ist Schwarzer Adler vom tapferen Stamm der Arapaho.«
»Hi.«
»Howgh.«
Schwarzer Adler küsste Sheriff Carson, wie der Vater ihn nicht geküsst hatte, und Adrià steckte beide zusammen mit ihren Pferden in die Nachttischschublade, damit sie sich miteinander vertraut machen konnten.
»Du wirkst bedrückt.«
»Drei Jahre Theologiestudium«, sagte Ardèvol nachdenklich, »und ich weiß immer noch nicht, was dich wirklich interessiert. Die Gnadendoktrin?«
»Das ist keine Antwort auf meine Frage«, beharrte Morlin.
»Das war keine Frage. Die Glaubwürdigkeit der christlichen Offenbarung?«
Morlin sagte nichts, und Ardèvol fragte: »Warum studierst du überhaupt an der Gregoriana, wenn die Theologie …«
Die beiden hatten sich von der Studentenschar abgesetzt, die von der Universität in Richtung Wohnheim trottete. In zwei Jahren Christologie und Soteriologie, Metaphysik I, Metaphysik II, Deus Revelatus und den Standpauken der strengsten Professoren – allen voran Levinski von Deus Revelatus, der fand, dass Fèlix Ardèvols Fortschritte in seinem Fach keineswegs den allseits in ihn gesetzten Erwartungen entsprachen – hatte sich Rom kaum verändert. Ungeachtet des Krieges, der in Europa wütete, glich die Stadt nicht etwa einer offenen Wunde, sie war allenfalls ein wenig ärmer geworden. Die Studenten an der Päpstlichen Universität studierten weiter und scherten sich nicht um den Krieg und die von ihm verursachten Dramen. Jedenfalls die meisten. Und sie wurden immer klüger und tugendhafter dabei. Jedenfalls die meisten.
»Und du?«
»Die Theodizee und die Erbsünde interessieren mich nicht länger. Ich will keine weiteren Rechtfertigungen mehr hören. Es fällt mir schwer, zu glauben, dass Gott das Böse zulässt.«
»Das habe ich schon seit Monaten vermutet.«
»Du auch?«
»Nein: Ich habe vermutet, dass du dich zu sehr in die Sache versteigst. Mach’s wie ich: Beschränk dich darauf, die Welt zu betrachten. An der Fakultät für Kirchenrecht amüsiere ich mich prächtig. Rechtliche Beziehungen zwischen Kirche und Zivilgesellschaft; kirchliche Sanktionen; zeitliche Güter der Kirche; der Reiz der Ordensgemeinschaften; die Consuetudine canonica …«
»Was redest du denn da!«
»Spekulative Studien sind reine Zeitverschwendung, das Studium der kanonischen Regeln ist erholsam dagegen.«
»Nein, nein«, rief Ardèvol aus. »Ich liebe Aramäisch; ich bin versessen darauf, in Handschriften die morphologischen Unterschiede zwischen dem Bohtan-Neuaramäisch und dem Barzani-Jüdisch-Neuaramäisch zu erkennen. Oder zu begreifen, wie Koy Sanjaq Surat oder Mlahsö funktionieren.«
»Soll ich dir was sagen? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Studieren wir an der gleichen Uni? An der gleichen Fakultät? Sind wir beide in Rom?«
»Schon gut. Ich würde einfach gern alles erfahren, was über das Chaldäische, Babylonische, Samaritanische bekannt ist, es sei denn, ich müsste es bei Pater Levinski lernen …«
»Und was nützt dir das?«
»Und was nützt es dir, den Unterschied zwischen geschlossener, vollzogener, rechtmäßiger, vermeintlicher, gültiger und ungültiger Ehe zu kennen?«
Beide prusteten mitten auf der Via del Seminario los. Eine dunkel gekleidete Dame warf einen leicht pikierten Blick auf die beiden jungen Priester, die gegen jeden Anstand auf offener Straße herumalberten.
»Was bedrückt dich, Ardevole? Siehst du, jetzt habe ich dich gefragt.«
»Was bedeutet dir wirklich etwas?«
»Alles.«
»Und die Theologie?«
»Ist ein Teil von allem«, entgegnete Morlin und hob die Arme, als wollte er die Fassade der Biblioteca Casanatense und die zwei Dutzend Menschen segnen, die gerade ahnungslos an ihnen vorüberliefen. Dann ging er weiter, und Fèlix Ardèvol musste sich anstrengen, um mit ihm Schritt zu halten.
»Sieh dir nur den Krieg in Europa an«, fuhr Morlin fort und wies energisch Richtung Afrika. Und dann sagte er leise, wie aus Furcht vor Spionen: »Italien hat gesagt: ›Italien muss seine Neutralität wahren, schließlich ist der Dreibund ein reines Defensivbündnis.‹ Und die Entente Cordiale erwiderte: ›Wir Alliierten werden den Krieg gewinnen‹, worauf Italien würdevoll verkündete: ›Mich bindet mein Wort, und das allein zählt.‹ ›Wir versprechen dir die irredentistischen Regionen Trentino, Istrien und Dalmatien.‹ ›Und ich wiederhole‹, beharrte Italien noch würdevoller und hob die Augen zum Himmel, ›dass Italien die Neutralität wahrt, wie es sich gehört.‹ ›Nun gut: Wenn du dich uns heute anschließt – und das heißt nicht morgen, hörst du? – also, wenn du dich uns heute noch anschließt, bekommst du das ganze irredentistische Paket: Südtirol, Trentino, Venezia Giulia, Istrien, Fiume, Nizza, Korsika, Malta und Dalmatien.‹ ›Wo muss ich unterschreiben?‹, fragte Italien und rief dann mit leuchtenden Augen: ›Es lebe die Entente! Tod den Mittelmächten!‹ Und das war’s, so läuft das nun mal in der Politik, Fèlix. Auf der einen wie der anderen Seite.«
»Und die großen Ideale?«
Nun blieb Félix Morlin stehen und blickte, um eine möglichst lapidare Bemerkung bemüht, zum Himmel auf: »Die internationale Politik wird nicht von den großen internationalen Idealen bestimmt, sondern von den großen internationalen Interessen. Und Italien hat das bestens verstanden: Steht es erst einmal auf Seiten der Guten – sprich, auf unserer Seite –, kommt es zu einer Offensive im Trentino, bei der all die wunderbaren Wälder dran glauben müssen. Dann erfolgt der Gegenangriff, die Schlacht von Karfreit, dreihunderttausend Tote, die Piaveschlacht, Durchbruch durch die Front bei Vittorio Veneti, der Waffenstillstand von Padua, die Gründung des Reichs der Serben, Kroaten und Slowenen, ein künstliches Gebilde, das zwar Jugoslawien heißen, aber kaum länger als ein paar Monate halten wird, und ich wage zu behaupten, dass die irredentistischen Regionen die Mohrrübe sind, die die Alliierten wieder zurückziehen werden. Italien wird dumm aus der Wäsche schauen. Und da alle anderen sich weiter herumzanken werden, wird der Krieg nie ganz zu Ende sein. Und auf den wahren Feind warten wir noch, der ist noch gar nicht erwacht.«
»Und wer ist das?«
»Der bolschewistische Kommunismus. Sollte ich mich irren, kannst du mir das in ein paar Jahren unter die Nase reiben.«
»Woher weißt du denn das alles?«
»Indem ich Zeitung lese und den richtigen Leuten zuhöre. Das ist die Kunst effektiver Kontaktpflege. Und wenn du wüsstest, welche traurige Rolle der Vatikan in diesen Angelegenheiten spielt …«
»Und wann studierst du die geistliche Auswirkung der Sakramente auf die Seele oder die Gnadendoktrin?«
»Das, was ich treibe, sind ebenfalls Studien, mein lieber Fèlix. Ich bereite mich darauf vor, ein guter Diener der Kirche zu sein. Die Kirche braucht Theologen, Politiker und sogar den einen oder anderen Schwärmer wie dich, der die Welt durch eine Lupe betrachtet. Und was bedrückt dich so?«
Schweigend und mit gesenkten Köpfen legten sie ein Stück Weg zurück, jeder in seine eigenen Gedanken versunken. Plötzlich blieb Morlin wie angewurzelt stehen und rief: »O nein!!«
»Was?«
»Jetzt weiß ich, was mit dir los ist! Ich weiß, was dich so bedrückt!«
»Ach ja?«
»Du bist verliebt.«
Fèlix Ardèvol i Guiteres, Student an der Pontifica Università Gregoriana im vierten Jahr, der die ersten beiden Kurse seines höchst erfolgreichen Studienaufenthalts in Rom mit besonderer Auszeichnung bestanden hatte, klappte den Mund auf, um zu protestieren, und klappte ihn wieder zu. Er sah sich selbst am Ostermontag, am Ende der Ferien, müßig durch die Stadt schlendern, nachdem er fertig war mit seiner Arbeit über Giambattista Vicos Verum et factum reciprocantur seu convertuntur und die Unmöglichkeit, die Totalität zu begreifen – wohingegen Félix Morlin, der Anti-Vico, alles zu begreifen schien –, als er sie auf der Piazza di Pietra zum dritten Mal sah. Hinreißend. Zwischen ihnen an die dreißig Tauben. Er ging auf sie zu, und sie, mit einem Päckchen in der Hand, lächelte ihn genau in dem Augenblick an, in dem die Welt strahlender, reiner, weiter wurde. Und er kam zu dem logischen Schluss: Die Schönheit, so viel Schönheit, kann kein Teufelswerk sein. Die Schönheit ist göttlich, und dieses engelsgleiche Lächeln ist … nun ja: eben engelsgleich. Und dann fiel ihm ihre zweite Begegnung ein, als Carolina ihrem Vater geholfen hatte, den Karren vor dem Geschäft zu entladen. Sollte dieser zarte Rücken etwa die groben, randvoll mit Äpfeln bepackten Holzkisten schleppen müssen? Das konnte er nicht zulassen. Er packte mit an, und so luden die beiden schweigend drei Kisten ab, spöttisch beäugt vom Maultier, das Stroh aus einem Futtersack fraß. Fèlix verlor sich in der Betrachtung der endlosen Landschaft ihrer Augen, damit sein Blick nicht zu ihrem Busenansatz herunterglitt, und in Saverio Amatos Laden herrschte Stille, weil niemand wusste, was zu tun sei, wenn ein prete, ein cappellano, ein Seminarschüler sich die Ärmel der heiligen Soutane aufkrempelte, Lastenträger spielte und die Tochter mit diesem dunklen Blick ansah. Drei Kisten Äpfel, eine wahre Gottesgabe in diesen Kriegszeiten, drei köstliche Augenblicke an der Seite dieser Schönheit; dann sah er sich um, stellte fest, dass er in Signor Amatos Laden stand, sagte Buona Sera und ging davon, wobei er es nicht wagte, noch einen Blick auf sie zu werfen, und ihre Mutter kam ihm hinterher und drückte ihm, ob er wollte oder nicht, zwei rote Äpfel in die Hand, und er errötete, weil er sich vorstellte, es wären Carolinas bezaubernde Brüste. Oder er dachte an ihre erste Begegnung, Carolina, Carolina, Carolina, der schönste Name der Welt, ein noch namenloses Mädchen, das vor ihm herging, im selben Augenblick umknickte und einen Schmerzensschrei ausstieß, das arme Kind, und zusammensackte. Bei ihm war Drago Gradnik, der in den zwei Jahren seit seinem Eintritt in die Theologische Fakultät noch eine halbe Handbreit an Höhe und sechs oder sieben Pfund Fleisch zugelegt hatte und in den letzten drei Tagen an nichts anderes denken konnte als an die ontologische Argumentation des heiligen Anselm, als gäbe es keinen anderen Gottesbeweis auf der Welt, wie zum Beispiel die Schönheit dieses wunderbaren Geschöpfs. Drago Gradnik hatte keinen Blick für den verstauchten Knöchel, der sicher fürchterlich schmerzte, und Fèlix Ardèvol fasste sachte das Bein der schönen Adalaisa, Beatrice, Laura und half ihr, es vorsichtig auf dem Boden abzulegen, und die Berührung war wie ein elektrischer Schlag, stärker als die Lichtbögen auf der Weltausstellung, und während er fragte, tut es weh, Signorina?, wäre er am liebsten über sie hergefallen, um sie hier und jetzt zu nehmen, und es war das erste Mal in seinem Leben, dass er ein so drängendes, schmerzhaftes, unerbittliches und erschreckendes sexuelles Verlangen verspürte. Währenddessen sah Drago Gradnik ins Weite und dachte an den heiligen Anselm und andere, rationalere Wege zum Beweis der Existenz Gottes.
»Ti fa male?«
»Grazie, grazie mille, Padre«, sagte die süße Stimme mit den uferlosen Augen.
»Da Gott uns nun einmal die Intelligenz gegeben hat, gehe ich davon aus, dass Glaube und Vernunft nicht unvereinbar sind, was meinst du, Ardevole?«
»Come ti chiami (meine bezaubernde Nymphe)?«
»Carolina, Padre. Grazie.«
Carolina, was für ein wunderschöner Name. Wie könntest du anders heißen, Liebste.
»Ti fa ancora male, Carolina (du unfassbar Schöne)?«, wiederholte er besorgt.
»Vernunft. Durch Vernunft zum Glauben. Ist das Ketzerei? Sag schon, Ardevole.«
Er musste sie auf der Bank zurücklassen, weil die heftig errötende Nymphe ihm erklärte, ihre Mutter werde bald vorbeikommen, und während die beiden Studenten ihren Bummel fortsetzten und Drago Gradnik in seinem nasalen Latein die Behauptung wagte, der heilige Bernat sei vielleicht doch nicht alles im Leben, und ich glaube, in seinem Vortrag fordert Teilhard de Chardin uns zum Denken auf, ertappte er sich dabei, wie er seine Hand ans Gesicht hob und versuchte, einen Dufthauch von der Haut der göttlichen Carolina zu erhaschen.
»Verliebt? Ich?« Er sah Morlin an, der ihn spöttisch musterte.
»Du weist alle Anzeichen dafür auf.«
»Was verstehst du denn davon?«
»Ich hab das schon hinter mir.«
»Und wie bist du’s wieder losgeworden?«, fragte Ardèvol begierig.
»Ich bin es gar nicht wieder losgeworden. Ich habe sie flachgelegt, bis die Liebe vorbei war, und das war’s.«
»Du schockierst mich.«
»So ist das Leben. Ich bin ein reuiger Sünder.«
»Diese Liebe ist unendlich, sie vergeht nicht einfach. Ich könnte niemals …«
»Meine Güte, dich hat’s aber erwischt, Felix Ardevole!«
Fèlix antwortete nicht. Vor sich sah er dreißig Tauben, am Ostermontag auf der Piazza di Pietra. Die Heftigkeit seines Begehrens hatte ihn mitten durch den Taubendschungel getrieben, bis er vor Carolina stand, die ihm das Päckchen überreichte.
»Il gioiello dell’Africa«, sagte die Nymphe.
»Aber woher wussten Sie, dass ich …«
»Jeden Tag kommen Sie hier vorbei. Jeden Tag.«
In diesem Augenblick – Matthäus siebenundzwanzig, Vers einundfünfzig – zerriss der Vorhang des Tempels von obenan bis untenaus, und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, die Gräber taten sich auf, und standen auf viele Leiber der Heiligen, die da schliefen.
Das Geheimnis Gottes und des fleischgewordenen Wortes.
Das Geheimnis der Jungfrau Maria, der Mutter Gottes.
Das Geheimnis des christlichen Glaubens.
Das Geheimnis der menschlichen unvollkommenen und der göttlichen ewigen Kirche.
Das Geheimnis der Liebe einer jungen Frau und ihres Päckchens, das nun schon seit zwei Tagen auf dem Tisch in seinem Zimmer liegt und von dem ich am dritten Tag erst gewagt habe, das Einpackpapier zu öffnen. Es ist eine verschlossene Schachtel. Mein Gott. Ich stehe am Rand des Abgrunds.
Er wartete bis Samstag. Die meisten Studenten waren auf ihren Zimmern. Ein paar waren ausgegangen oder saßen in den verschiedenen Bibliotheken Roms, wo sie empört nach Antworten auf die Frage nach dem Wesen des Bösen suchten und warum Gott es zuließ, nach der empörenden Existenz des Teufels, der korrekten Lesart der Heiligen Schrift oder dem Zugegensein des Pneumas im Gregorianischen und Ambrosianischen Gesang. Fèlix Ardèvol war allein in seinem Zimmer, kein Buch lag auf dem Tisch, alles war an seinem Platz, weil ihn nichts so sehr empörte wie das heillose Durcheinander von Dingen, die nicht mehr zu gebrauchen waren, die nicht dort lagen, wo sie hingehörten, oder an denen der Blick hängen blieb, weil sie nicht richtig ausgestellt waren, oder … Er dachte bei sich, dass er wohl auf dem besten Wege war, Macken zu entwickeln. Ich vermute, das stimmt, es fing in jenen Jahren an; mein Vater war ein Ordnungsfanatiker, zumindest in materieller Hinsicht. Geistige Inkohärenz störte ihn, glaube ich, nicht besonders. Aber ein Buch, das auf dem Tisch herumlag, statt an seinem Platz im Regal zu stehen, oder ein vergessener Zettel auf der Heizung waren schlicht unentschuldbar und unverzeihlich. Nichts durfte störend ins Auge fallen, darauf waren wir alle geeicht, vor allem ich, der ich täglich aufräumen musste, jeden Tag alle Spielsachen, die ich benutzt hatte. Nur Sheriff Carson und Schwarzer Adler kamen davon, weil sie heimlich bei mir schliefen, was Vater nie erfuhr.
Im Zimmer 54 war alles in peinlicher Ordnung. Und Fèlix Ardèvol stand am Fenster, beobachtete die geschäftigen Soutanen, die im Wohnheim ein und aus gingen. Und eine Pferdekutsche, die die Via del Corso entlangfuhr und in ihrem Innern empörende, unaussprechliche Geheimnisse barg. Und den Jungen, der einen Metalleimer hinter sich her schleifte und absichtlich einen empörenden Krach verursachte. Fèlix zitterte vor Angst, darum empörte ihn alles. Auf dem Tisch lag ein unerwarteter Gegenstand, ein Gegenstand, für den noch kein Platz vorgesehen war. Eine grüne Schachtel, die ihm Carolina geschenkt hatte, und darin ein gioiello dell’Africa. Sein Schicksal. Er hatte sich geschworen, noch vor dem Zwölf-Uhr-Läuten von Santa Maria habe er die Schachtel entweder geöffnet oder fortgeworfen. Oder sich umgebracht. Eines von den dreien.
Denn einerseits konnte man sein Leben ganz dem Studium weihen, sich in der faszinierenden Welt der Paläographie, im Universum antiker Manuskripte seinen Weg suchen, Sprachen lernen, die kein Mensch mehr sprach, weil sie seit Jahrhunderten auf muffigen Papyri erstarrt waren, dem einzigen Fenster in das Gedächtnis der Menschheit, man konnte die mittelalterliche Paläographie von der antiken unterscheiden, sich freuen, weil die Welt so groß war, dass man sich, sobald Langeweile aufkam, in Sanskrit oder asiatische Sprachen vertiefen konnte, und sollte ich eines Tages einen Sohn haben, dann wünsche ich mir …
Und wie komme ich jetzt darauf, dass ich eines Tages einen Sohn haben will?, fragte er sich wütend – nein, empört. Und dann sah er wieder zu der einsamen Schachtel hinüber, die auf dem aufgeräumten Tisch im Zimmer 54 lag. Fèlix Ardèvol fegte sich einen eingebildeten Fussel von der Soutane, fuhr sich mit dem Finger über den vom Kollar wundgescheuerten Hals und setzte sich an den Tisch. Noch drei Minuten bis zum Zwölf-Uhr-Läuten von Santa Maria. Er holte tief Luft und beschloss: Vorläufig würde er sich nicht das Leben nehmen. Er nahm die Schachtel in die Hände, ganz behutsam, wie ein Junge das gerade aus dem Baum geraubte Nest hält, um seiner Mutter die hellgrünen Eier oder die hilflosen Vogeljungen zu zeigen, ich ziehe sie groß, Mutter, mach dir keine Sorgen, ich füttere sie fleißig mit Ameisen. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, o Herr. Irgendwie wusste er, dass seine nächsten Schritte einen unauslöschlichen Glanz in seiner Seele hinterlassen würden. Noch zwei Minuten. Mit zitternden Händen versuchte er, die rote Schleife zu lösen, doch der Knoten zog sich immer enger, und das nicht etwa, weil die arme Carolina ihn ungeschickt geknüpft hätte. Unwillig stand er auf. Noch anderthalb Minuten. Er ging zur Waschschüssel, holte sein Rasiermesser und klappte es hastig auf. Eine Minute und fünfzehn Sekunden. Und dann schnitt er kurz entschlossen das schönste rote Band durch, das er in seinem langen Leben je gesehen hatte, denn mit seinen fünfundzwanzig Jahren fühlte er sich alt und verbraucht und wünschte sich, dies alles würde nicht ihm widerfahren, sondern dem anderen Fèlix, der alles auf die leichte Schulter zu nehmen verstand … Eine Minute! Sein Mund war trocken, seine Hände waren feucht, und ein Schweißtropfen rann ihm über die Wange, und dabei war es doch heute gar nicht besonders … Noch zehn Sekunden, dann würden die Glocken von Santa Maria in der Via Lata zwölf Uhr Mittag läuten. Und während in Versailles ein paar Dilettanten verkündeten, der Krieg sei zu Ende, und bei der Unterzeichnung des Waffenstillstands vor Anstrengung die Zungenspitze herausstreckten, um nur ja alle Mechanismen in Gang zu setzen, die wenige Jahre später einen wunderbaren neuen Krieg ermöglichen sollten, noch blutiger und noch näher am Bösen, das Gott nie hätte zulassen dürfen, öffnete Fèlix Ardèvol i Guiteres die grüne Schachtel und schob zögernd die rosafarbene Watte auseinander. Und als der erste Glockenschlag erklang, Angelus Domini nuntiavit Mariae, brach er in Tränen aus.
Es war nicht weiter schwierig, sich aus dem Wohnheim zu stehlen. Mit Morlin, Gradnik und zwei oder drei anderen hatte er das schon unzählige Male ungestraft getan. In weltlicher Kleidung standen ihnen in Rom viele Türen offen – oder jedenfalls andere als die, die sich ihnen öffneten, wenn sie Soutane trugen. In Straßenkleidung konnten sie in alle Museen gehen, deren Besuch ihnen ihre priesterliche Würde verbot. Sie konnten auf der Piazza Colonna Kaffee trinken und, mehr noch, die Passanten beobachten, und zwei-, dreimal hatte Morlin ihn mit zu Leuten genommen, die er seiner Meinung nach kennenlernen sollte. Dort stellte er ihn als Felix Ardevole vor, einen klugen Kopf, der acht Sprachen beherrsche und jedes Manuskript enträtseln könne, und die Gelehrten öffneten ihm ihre Tresore, sodass er das Originalmanuskript der Mandragola in Augenschein nehmen konnte – eine Kostbarkeit – oder ein paar raschelnde Papyri, die von den Makabäern handelten. Aber heute, an dem Tag, an dem Europa Frieden schloss, schlich sich der gelehrte Fèlix Ardèvol davon, unbemerkt von den Aufpassern des Wohnheims und zum ersten Mal auch unbemerkt von seinen Freunden. In Pullover und Kappe, die seinen kirchlichen Stand verbargen, lief er schnurstracks zum Obstladen von Signor Amato und legte sich, die Schachtel in der Tasche, auf die Lauer, und die Stunden vergingen, und er sah die Leute unbesorgt und glücklich vorüberschlendern, weil sie nicht wie er am Fieber litten. Carolinas Mutter ging vorbei. Die kleine Schwester. Alle außer seiner Liebsten. Der gioiello, ein grob gearbeitetes Medaillon mit dem plumpen Bildnis einer romanischen Muttergottes neben einem gewaltigen Baum, vielleicht einer Tanne. Auf der Rückseite das Wort »Pardàc«. Aus Afrika? Ob das ein koptisches Medaillon war? Wieso habe ich sie Liebste genannt, wo ich doch gar kein Recht habe … und die frische Luft erschien ihm unerträglich schwül. Glocken begannen zu läuten, und Fèlix, der noch nicht Bescheid wusste, glaubte, sämtliche Kirchen Roms läuteten seiner heimlichen, sündigen Liebe zu Ehren.
Und dann erschien Carolina Amato. Sie war aus dem Haus getreten, hatte mit wehendem Haar die Straße überquert und war direkt auf den wartenden Fèlix zugegangen, der doch geglaubt hatte, perfekt getarnt zu sein. Als sie vor ihm stand, sah sie ihn mit einem strahlenden Lächeln an, schwieg aber. Er schluckte, umklammerte die Schachtel in seiner Tasche, machte den Mund auf und sagte nichts.
»Ich auch«, sagte sie. Und viele Glockenschläge später: »Gefällt es dir?«
»Ich weiß nicht, ob ich es annehmen kann.«
»Der gioiello gehört mir. Onkel Sandro hat ihn mir bei meiner Geburt geschenkt, er hat ihn selbst aus Ägypten mitgebracht. Jetzt gehört er dir.«
»Was wird deine Familie dazu sagen?«
»Er gehört mir, und jetzt gehört er dir. Sie werden nichts sagen. Er ist mein Liebespfand.«
Sie nahm seine Hand und zog ihn fort bis zu einem verborgenen Winkel, der völlig verdreckt war, aber nach den Rosen der Liebe duftete, und führte ihn in ein verlassenes Haus, dessen Türen offen standen, während die Glocken läuteten und eine Nachbarin aus dem Fenster rief, Elisabetta, der Krieg ist aus! Aber die beiden Liebenden standen kurz vor ihrer entscheidenden Schlacht und hörten den Ausruf nicht.
II De pueritia
Ein guter Krieger kann sich nicht in alle
Squaws verlieben, denen er begegnet,
selbst wenn sie sich mit Kriegsbemalung
schmücken.
SCHWARZER ADLER
3
Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass ich mir viel ausdenke, aber ich sage trotzdem die Wahrheit. Eine meiner wohl frühesten Erinnerungen ist beispielsweise die an mein Kinderzimmer, wo ich versuchte, mich unter dem Bett häuslich einzurichten. Es war nicht ungemütlich, und es machte Spaß, nur Füße zu sehen, wenn jemand hereinkam und sagte, Adrià, Kind, wo bist du, oder Adrià, komm essen. Wo steckt er nur? Ja, es war ein Spaß für mich, denn Abwechslung gab es für mich wenig; mein Elternhaus war kein Haus für Kinder, und meine Familie war keine Familie für Kinder. Meine Mutter zählte nicht, und mein Vater lebte nur fürs Kaufen und Verkaufen, und ich verging vor Eifersucht, wenn ich ihn einen Stich oder eine feine Porzellanvase streicheln sah. Und Mutter … also, Mutter schien ständig auf der Hut zu sein, wie auf dem Sprung, die Augen überall. Und das, obwohl sie in Lola Xica eine Verbündete hatte. Inzwischen verstehe ich, dass mein Vater ihr das Gefühl gegeben haben muss, im eigenen Haus eine Fremde zu sein. Die Wohnung gehörte ihm, und er ließ sie gnädigerweise dort wohnen. Als mein Vater starb, konnte sie aufatmen, und ihre Augen waren nicht mehr so unruhig, auch wenn sie es weiterhin vermied, mich anzusehen. Und sie verwandelte sich. Ich frage mich, wieso. Und ich frage mich auch, warum meine Eltern geheiratet haben. Ich glaube, geliebt haben sie einander nie. Bei uns zu Hause gab es keine Liebe. Und ich war nichts weiter als ein zufälliges Ergebnis ihrer Lebensumstände.
Eigenartig: Ich will dir so viel erzählen und starre nur vor mich hin und verzettele mich in Gedankengängen, bei denen Freud das Wasser im Mund zusammengelaufen wäre. Vielleicht weil die Beziehung zwischen meinem Vater und mir an allem schuld ist. Vielleicht, weil ich an seinem Tod schuld bin.
Einmal, da war ich schon etwas größer und hatte im Arbeitszimmer meines Vaters unbemerkt den Platz zwischen Sofa und Wand erobert und zur Behausung meiner Cowboys und Indianer gemacht, kam mein Vater herein, gefolgt von einer vertrauten Stimme, die mir aber in diesem Augenblick vertraut und furchterregend zugleich klang. Zum ersten Mal hörte ich Senyor Berenguer außerhalb des Ladens, und er klang anders; und seither habe ich seine Stimme weder im Laden noch außerhalb des Ladens gemocht. Ich verhielt mich still, legte Sheriff Carson auf den Boden, und das braune Pferd von Schwarzer Adler, sonst so lautlos, fiel mit einem leisen Geräusch um, was mich zusammenzucken ließ, vom Feind jedoch gar nicht wahrgenommen wurde, und mein Vater sagte, ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig.
»Ich glaube schon.«
Senyor Berenguer setzte sich aufs Sofa, das sich dabei ein Stückchen näher zur Wand schob, und ich sah mich heldenmütig eher zerquetscht als entdeckt. Ich hörte, wie Senyor Berenguer mehrmals auf etwas klopfte, und die frostige Stimme meines Vaters, die sagte, in diesem Haus ist das Rauchen verboten. Dann sagte Senyor Berenguer, er verlange eine Erklärung.
»Sie arbeiten doch für mich«, entgegnete mein Vater spöttisch. »Oder etwa nicht?«
»Ich habe zehn Stiche aufgetrieben und dafür gesorgt, dass die Geprellten nicht allzu laut aufjaulen. Ich habe diese zehn Stiche über drei Grenzen geschafft, ich habe auf meine Kosten Gutachten erstellen lassen, und jetzt erzählen Sie mir, Sie hätten sie verkauft, ohne mich zu fragen. Einer war ein Rembrandt, wissen Sie das?«
»Kaufen und verkaufen. Damit finanzieren wir unsere beschissene Existenz.«
Beschissene Existenz hatte ich noch nie gehört, und es gefiel mir; mein Vater sprach es mit zwei B: bbeschissene Existenz, vermutlich weil er so aufgebracht war. Ich wusste, dass Senyor Berenguer schmunzelte; damals verstand ich mich bereits darauf, Gesprächspausen zu deuten, und ich war sicher, dass Senyor Berenguer schmunzelte.
»Ach, hallo, Senyor Berenguer.« Das war die Stimme meiner Mutter. »Hast du den Jungen gesehen, Fèlix?«
»Nein.«
Alarmstufe eins. Wie konnte ich mich hinter dem Sofa hervorstehlen, in einem anderen Teil der Wohnung verschwinden und so tun, als hätte ich nichts mitbekommen? Ich beriet mich mit Sheriff Carson und Schwarzer Adler, aber die konnten mir auch nicht weiterhelfen. Unterdessen schwiegen die beiden Männer, wahrscheinlich weil sie darauf warteten, dass meine Mutter das Zimmer verließ und die Tür zumachte.
»Auf Wiedersehen.«
»Auf Wiedersehen, Senyora.« Und wieder im bitteren Ton der vorigen Diskussion: »Ich fühle mich betrogen. Ich verlange eine Sonderprovision.« Schweigen. »Darauf bestehe ich.«
Um mich zu beruhigen, übersetzte ich das Gespräch im Geist ins Französische, in ein ziemlich frei erfundenes Französisch, demnach müsste ich damals ungefähr sieben gewesen sein. Ich tat das manchmal, wenn ich mich zusammenreißen musste, denn wenn ich nervös wurde, bekam ich unkontrollierbare Zuckungen, und in der Stille des Arbeitszimmers hätte man die kleinste Bewegung wahrgenommen. Moi, j’exige ma comission. C’est mon droit. Vous travaillez pour moi, monsieur Berenguer. Oui, bien sûr, mais j’ai de la dignité, moi!
Vom anderen Ende der Wohnung rief meine Mutter, Adrià! Lola Xica, hast du ihn gesehen? Dieu sait où est mon petit Hadrien!
Ich erinnere mich nicht mehr genau, aber ich glaube, Senyor Berenguer war ziemlich verärgert, als mein Vater ihn mit den Worten fortschickte, das ist doch ein Streit um des Kaisers Bart, was ich nicht übersetzen konnte. Nichts wünschte ich mir mehr, als dass mich meine Mutter ein einziges Mal mon petit Hadrien genannt hätte.
Jedenfalls konnte ich jetzt mein Versteck verlassen. Während mein Vater seinen Besucher zur Tür brachte, hatte ich Zeit genug, alle Spuren zu beseitigen; dank des Partisanenlebens, das ich zu Hause führte, waren meine Fähigkeiten, mich zu tarnen und praktisch allgegenwärtig zu sein, bestens entwickelt.
»Hier bist du!« Mutter kam auf den Balkon, von wo ich den Autos zusah, die schon nach und nach das Licht einschalteten, denn in meiner Erinnerung war das Leben zu jener Zeit eine ewige Abenddämmerung. »Hast du mich nicht gehört?«
»Was?« In einer Hand hielt ich den Sheriff und das braune Pferd und tat, als fiele ich aus allen Wolken.
»Du musst deinen Schulkittel anprobieren. Wieso hast du mich denn nicht gehört?«
»Den Kittel?«
»Senyora Angeleta hat die Ärmel erneuert.« Mit herrischer Geste: »Mach schon!«
In der Nähstube prüfte Senyora Angeleta, eine Nadel zwischen den Lippen, mit fachmännischem Blick den Sitz der neuen Ärmel.
»Du wächst zu schnell, Kleiner.«
Mutter war in der Diele, um Senyor Berenguer zu verabschieden, und Lola Xica kam herein, um die frisch gebügelten Hemden zu holen, während ich, wie so oft im Lauf meiner Kindheit, in den ärmellosen Kittel schlüpfte.
»Und du wetzt die Ellbogen zu schnell ab«, sagte Senyora Angeleta, die damals schon an die tausend Jahre alt gewesen sein muss.
Die Wohnungstür fiel ins Schloss. Vaters Schritte entfernten sich in Richtung Arbeitszimmer, und Senyora Angeleta schüttelte das schneeweiße Haupt.
»Er bekommt viel Besuch in letzter Zeit.«
Lola Xica schwieg und tat, als hätte sie sie nicht gehört. Senyora Angeleta befestigte mit ihren Stecknadeln den Ärmel am Kittel, während sie noch hinzusetzte: »Und manchmal brüllen sie sich an.«
Lola Xica nahm die Hemden, ohne auf Senyora Angeleta einzugehen. Die ließ nicht locker: »Wer weiß, worum es da geht …«
»Um die bbeschissene Existenz«, sagte ich, ohne nachzudenken.
Lola Xica ließ die Hemden fallen, Senyora Angeleta piekte mir die Nadel in den Arm, und Schwarzer Adler legte sich flach auf den Boden und spähte mit fast geschlossenen Augen über den verdorrten Horizont. Er sah die Staubwolke als Erster. Sogar noch vor Flinkes Kaninchen.
»Es nähern sich drei Reiter«, sagte er. Niemand antwortete. In ihrem Unterschlupf waren sie vor der gnadenlosen Hitze jenes Sommers halbwegs geschützt; doch niemand, keine Squaw, kein Kind, zeigte das geringste Interesse an den Ankömmlingen oder ihren Absichten. Schwarzer Adler gab den anderen einen unmerklichen Wink. Drei Krieger machten sich auf den Weg zu ihren Pferden. Er folgte ihnen, ohne die Staubwolke aus den Augen zu lassen. Sie kam schnurstracks auf das Lager zu. Wie ein Vogel, der ein Raubtier ablenkt und es mit List und Tücke von seinem Nest weglockt, wandten er und seine drei Männer sich nach Westen, um die Reiter abzulenken. Die beiden Gruppen trafen sich bei den fünf Steineichen. Die Besucher waren drei weiße Männer, ein hellblonder und zwei ziemlich dunkelhäutige. Einer davon, der mit dem riesigen Schnauzbart, sprang mit steif abgespreizten Armen geschickt vom Pferd und lächelte.
»Du bist Schwarzer Adler«, sagte er, ohne zum Zeichen der Unterwerfung die Hände an den Körper zu legen.
Der große Häuptling der Arapaho der Südlichen Gefilde am Ufer des Washita-Flusses vom Gelben Fisch saß reglos auf seinem Pferd und nickte kaum merklich, dann fragte er, mit wem er die Ehre habe, und der mit dem schwarzen Schnurrbart lächelte wieder und sagte mit einer witzigen halben Verbeugung, ich bin Sheriff Carson aus Rockland, zwei Tagesritte von eurem Gebiet.
»Ich weiß, wo ihr euer Dorf Rockland gebaut habt«, erwiderte der legendäre Häuptling kurz angebunden. »Auf dem Land der Pawnees.« Und er spuckte als Ausdruck seiner Verachtung auf den Boden.
»Das sind meine Gehilfen«, sagte Carson, der nicht wusste, wem das Ausspucken eigentlich gelten sollte. »Wir sind auf der Suche nach einem entflohenen Verbrecher.« Nun spuckte er seinerseits auf den Boden und fand es ganz interessant.
»Was hat er getan, dass man ihn einen Verbrecher nennt?«, fragte der Arapaho-Häuptling.
»Kennst du ihn? Hast du ihn gesehen?«
»Ich habe gefragt, was er getan hat, dass man ihn einen Verbrecher nennt.«
»Er hat eine Stute getötet.«
»Und zwei Frauen geschändet«, ergänzte der Blonde.
»Ja, das auch«, nickte Sheriff Carson.