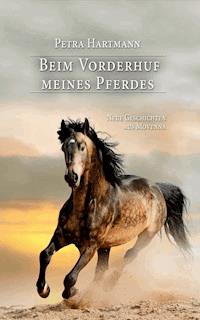Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wurdack Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Doctor Nikola
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Berlin, 1927. Arbeitslos, pleite und mit der Miete im Rückstand: Bankierssohn Felix Pechstein ist nach dem "Schwarzen Freitag" der Berliner Börse ganz unten angekommen. Da erscheint das Angebot, in die Dienste eines fremden Geschäftsmannes zu treten, eigentlich als Geschenk des Himmels. Doch dieser Doctor Nikola ist ihm mehr als unheimlich. Vor allem, als Felix den Auftrag erhält, Nikola zu bestehlen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Petra Hartmann
Das Serum des Doctor Nikola
Nikola Band 6
(c) 2014 Wurdack Verlag, Nittendorf
www.wurdackverlag.de
Cover: Ernst Wurdack
Katzenaugen
»Herr Pechstein! Herr Pechstein!«
Das Bollern an meiner Tür war so heftig, dass sogar das kleine Fenster zum Hinterhof davon klirrte. Meine Hand krampfte sich um das Messer, und ich hielt den Atem am. Jetzt bloß kein Geräusch machen.
»Machense uff, ick weeß, dat se da drinne sind!«
Ich dachte gar nicht daran. Wenn man erstmal so weit heruntergekommen war, dass man im Dachgeschoss von Witwe Bollmanns Mietskaserne lebte, dann hatte man gelernt, sich beizeiten totzustellen.
»Machense uff, fadammte Inzucht, ick krich se ja doch!«
Womit die resolute Dame zweifellos Recht hatte. Das winzige Zimmer, kaum mehr als vier mal vier Schritte messend, bot gerade mal Platz für ein eisernes Bett, den wackeligen Tisch ohne Stuhl und die kleine Kiste mit meinen letzten Habseligkeiten. Ein Versteck oder gar einen Fluchtweg hatte es nicht zu bieten. Also besser sich totstellen.
Durch das undichte Fenster pfiff der Wind. Oft, meist nachts, klapperten die Dachpfannen, und es hatte einige Zeit gedauert, bis ich für das Bett den einzigen Ort gefunden hatte, an dem es nicht durchregnete. Oder zumindest mit 95,5-prozentiger Wahrscheinlichkeit nicht durchregnete. Wo gab es heutzutage schon noch etwas, das zu hundert Prozent sicher war? Das Zimmer war kein Palast, ganz gewiss nicht. Aber zur Zeit leider das einzige, das ich mir leisten konnte. Oder, besser gesagt: mir bis vor zwei Monaten noch hatte leisten können.
»Wennse bis Montag nich bezahln tun, denn könnse sick uff watt jefasst machen, dat saach ick se.«
Geräuschlos atmete ich auf. Witwe Bollmann schien ihr Pulver verschossen zu haben.
Wie hatte es einer meiner Vormieter so despektierlich an die Wand gekritzelt:
»Das Leben ist am schwersten
drei Tage vor dem Ersten.«
Nur dass es für mich keinen Ersten gab. Wie für so viele seit dem schlimmen Freitag nicht mehr. Mein Magen begann laut und vernehmlich zu knurren. Erschrocken hielt ich die Luft an und lauschte. Doch zu meinem Glück hatte sich die zornige Vermieterin offenbar zurückgezogen. Oder stand sie nur still auf dem Flur und horchte, um zupacken zu können, sowie ich die Tür öffnete? Ich würde es wohl riskieren müssen.
Entschlossen hob ich das Messer erneut. Der weiße Schaum vor meinem Mund und die tiefliegenden Augen, die mir aus dem Rasierspiegel entgegenblickten, ließen mein Gesicht fremd und unheimlich aussehen. Und die eingefallenen Wangen wirkten leider alles andere als kreditwürdig. Da half auch die beste Rasur nichts mehr.
Immerhin, wenigstens sahen am Ende mein glattes Kinn und das schmale Oberlippenbärtchen gepflegt und ordentlich aus. Der Stresemann-Anzug freilich war schon seit einiger Zeit aus der Mode, und er schlackerte ungehörig um mich herum, als ich mich wenig später ein letztes Mal im Spiegel musterte. Ich war schmaler geworden in diesen Tagen. Und dem Gustav Stresemann wollte inzwischen auch niemand mehr ähneln.
Über dem Hausdach gegenüber kam gerade die Sonne herauf. Das einzige Privileg, das man als Mieter im Dachgeschoss hatte. Unten in den grauen Hof drangen die Sonnenstrahlen nie.
Ich stellte den Rasierspiegel in die schmale Fensterbank und kippte ihn leicht vornüber. Es war ein kleines Geduldsspiel, aber wenn man den richtigen Winkel erst einmal heraushatte, dann konnte man ... nein, doch noch etwas tiefer, noch etwas weiter nach links ... so war es recht. Der schmale Lichtstrahl fiel jetzt genau ins offene Fenster von Friedrich dem Hinker hinein, und jetzt, jetzt hörte ich auch schon, wie unten in der Wohnung der alte Kanarienvogel loslegte. Schlimm, so ein kleines Tier in einem Zimmer ganz ohne Sonnenlicht zu halten.
Eine Weile hörte ich dem Zwitschern zu. Das tat gut. Dann nahm ich den Hut und den viel zu dünnen Mantel und wagte mich auf den Flur.
Das Glück war mir hold. Ich kam unbehelligt durch den zweiten und ersten Stock. Erst als ich zur Haustür hinausschlüpfte, hörte ich hinter mir die Witwe Bollmann rufen: »Herr Pechstein! Herr Pechstein!« Aber da war ich schon um die Ecke herum und zwischen den grauen Kasernen untergetaucht.
Ja, Berlin war grau geworden in jenen Tagen. Oder bildete ich mir das nur ein, weil ich bis dahin auf der Sonnenseite der Stadt gelebt hatte? Bis ich zur breiten Amadeus-Mundt-Allee kam, war ich schon dreimal angesprochen worden – dunkle, zerlumpte Gestalten, aus deren Augen das letzte bisschen Hoffnung verschwunden war und die jeden, der noch halbwegs anständig gekleidet ging, um Geld oder Arbeit anbettelten. Ich hatte beides nicht.
Den jungen Mann mit seinem großen Schild – »Suche Arbeit, mache alles« – habe ich noch im Gedächtnis. Auch den Kameraden mit der Pappe vor der Brust, darauf stand: »Wir fordern: Aufhebung des Redeverbots für Hitler«. Und dann noch den Taschendieb, der, nachdem er seine Hand aus meiner Rocktasche zurückgezogen hatte, halb ironisch, halb bedauernd mit dem Finger an seine Schiebermütze tippte: »Icke seh schon – nüscht zu holen, Kumpel.«
Den Weg zum Arbeitsamt schenkte ich mir heute. Das Achselzucken des Herrn Oberamtmannes kannte ich schon zur Genüge. Da klang die neue Adresse, die mir einer meiner letzten Freunde gestern Abend zugesteckt hatte, doch vielversprechender: »Friedrich Wilhelm Lehmann & Co. KG – private Arbeitsvermittlung, Winterfeldstraße 9.«
Die Schlange war lang. Viel zu lang, um mir viel Hoffnung zu machen. Sie erstreckte sich vom Eingang der Paulsenstraße zur Ecke Winterfeldstraße bis hin zum Haus mit der Nummer 9. Es war ernüchternd. Drei Stunden anstehen, umgeben von einer Wolke aus Fusel- und Schweißgeruch, dazu die Pöbeleien und dummen Bemerkungen über meine Melone und den inzwischen arg ramponierten Anzug, das hatte mir vor zwanzig Jahren wahrlich niemand in die Wiege gesungen.
Sagte ich drei Stunden? Es müssen gut viereinhalb gewesen sein – genaueres wusste ich nicht, hatte doch meine goldene Taschenuhr, ein Geschenk meiner lieben Mutter Selde, längst den Weg ins Pfandhaus gefunden – es waren also wohl viereinhalb Stunden, bis ich in der Schlange so weit vorgerückt war, dass ich, den Hut in der Hand, vor den Tresen treten durfte, hinter dem Herr Friedrich Wilhelm Lehmann (& Co. KG) residierte.
»Guten Tag, mein Name ist Pechstein. Felix Secundus Pechst...«
»Interessiert ma nicht. Wat hamsen jelernt?«
»Ich ... ähm ...« Ich spürte, wie ich rot wurde. »Ich kann mit Geld umgehen.«
Friedrich Wilhelm Lehmann (und Co. KG) brach in wieherndes Gelächter aus. »Jungchen, Sie machen mir Spaß! Kann mit Jeld umgehen, wa? Und hat keen Jroschen inne Tasche, na dat seh ick doch. Hörensema, Mann, janz Ballin hat keen Jeld mehr zum Mit-Ummegehn. Könnse auch wat Richtiges?«
»Klavierspielen könnte ich, wenn’s recht ist. Und ein wenig singen.«
»Danke, kein Interesse. Der Nächste!«
»Und mit Tieren kann ich gut.«
»Tiere? Tiere, hm? Ick hätte da wat beim Abdecker. Aber nee, ach nee. So’n halbet Pferd kriegense ja doch nich uffn Haken mit Ihre dünne Ärmchen, nee!«
»Hier, ich!«
Ein kräftiger Stoß von hinten ließ mich zur Seite fliegen. Da hatte sich schon ein breitschultriger Kerl vor dem Tresen aufgebaut und grinste den Vermittler an.
»So’n halbet Pferd schleppe ick mit links, wo soll ick denn hin, Mann?«
»Heh!«, protestierte ich. Ich rappelte mich auf. »Gedulden Sie sich gefälligst, bis Sie dran sind.«
Doch Herr Lehmann schüttelte den Kopf. »Sie sehen doch, dass ich Sie hier nicht brauchen kann. Nun gehen Sie schon.«
Fassungslos sah ich zu, wie der grobschlächtige Kerl seinen – meinen! – Kontrakt signierte. Dann zog ich den Kopf ein und wandte mich zum Gehen.
»Heh, Sie!«, rief mir Herr Lehmann plötzlich nach.
Ich blieb stehen.
»Sagten Sie eben: Pechstein? Hamse etwa wat zu tun mit dem Bankhaus Pechstein, wat letztens falliert hat?«
»Ja«, sagte ich tonlos. »Tycho Pechstein war mein Vater.«
»Hab’s inne Zeitung jelesen. Schlimme Sache das. Na, nüscht für unjut, Herr Pechstein. Versuchenses halt morgen wieda, wa?«
Ich lüftete ansatzweise den Hut und ging.
Schlimme Sache das. So konnte man es auch ausdrücken.
Die Scharen von Gläubigern.
Der Sturm auf die Bank.
Der gottwohlgefällige Herr Pastor, der uns nur gerade so eben und mit Gottes Gnade zugestand, es müsse dann wohl doch ein Unfall gewesen sein, als sich der Schuss gelöst hatte. Beim Reinigen seiner Jagdflinte. Kannte man ja. Sonst hätten wir Vater nicht einmal in geweihter Erde begraben dürfen.
Schlimme Sache das.
Wie lange war ich hängenden Kopfes durch die Gassen getrottet? Ich vermochte es später nicht mehr zu sagen, ich hing düsteren Gedanken nach, nur unterbrochen von meinem immer herrischer nach seinem Recht verlangenden Magen, bis ich merkte, dass mich meine Füße unversehens und wohl einer alten Gewohnheit folgend in die besseren Straßen Berlins zurückgetragen hatten und da vor die Tore des ehrwürdigen Hotels Ambassadeur, in dem mein Vater und ich so oft mit unseren besten Geschäftskunden zu Gast gewesen waren.
Nun langte es freilich nur noch für einen sehnsüchtigen Blick hinüber zu der klassisch-gediegenen Fassade des besten Hauses am Platze und auf die vornehmen Equipagen und Automobile, die vor dem palastartigen Eingangstor vorfuhren. Livrierte Diener begrüßten die Gäste mit tiefen Verbeugungen und tausendfachen »Zu Diensten, der Herr«, und drüben, der Empfangschef, der warf schon ein paar misstrauische Blicke in meine Richtung.
Erkannte er mich? Wollte er mich überhaupt noch kennen? Das blaue Blechschild mit der weißen, verschnörkelten Aufschrift »Betteln und Hausieren verboten« hing deutlich sichtbar da und verwies Leute wie mich aus der Bannmeile des Nobelhotels.
Ich sah, wie er zwei breitschultrigen Hausangestellten in der roten Uniform des Ambassadeur zuwinkte und dann mit einem unmissverständlichen Kopfnicken in meine Richtung deutete. Die beiden Kleiderschränke kamen gemessenen, unauffälligen Schrittes auf mich zu. Es war also allerhöchste Zeit, mich zurückzuziehen, denn eine milde Gabe brachten die beiden mir bestimmt nicht heraus.
Ich trat einen Schritt zurück und – plötzlich ertönte eine laute Hupe hinter mir.
Bremsen quietschten.
Ein Schatten.
Ein Kotflügel streifte mich, ich erhielt einen heftigen Stoß, stürzte aufs Trottoir und schlug mir am Bordstein das Knie auf. Ein stechender Schmerz durchfuhr mich. Gleichzeitig wurde mir bewusst, dass jetzt auch noch meine letzte anständige Hose ruiniert war.
Tuckernd war das Automobil neben mir zum Stehen gekommen. Vor dem Portal wieherte ein Kutschpferd und stieg. Ich sah aus dem Augenwinkel, wie mehrere Männer das erschrockene Tier niederholten und beruhigten.
Eine Tür klappte auf. Ein wahrer Riese in Chauffeursuniform glitt mit einer Gewandtheit heraus, die man seinen herkulischen Körpermaßen gar nicht zugetraut hätte. Der Mann kam auf mich zu und – ich schwöre es – in diesem Augenblick verdunkelte sich die Sonne. Der Schatten, den seine breiten Schultern auf mich warfen, ließ mich zittern. Und der Blick, mit dem er mich musterte, ließ einem das Blut in den Adern gefrieren. Wahrscheinlich hätte der Mann mich mit einem einzigen Griff zerquetschen können. Er öffnete den Mund, und seine tiefe Stimme klang wie eine furchtbare Drohung. Ich wich zurück.
»Ist Ihnen etwas passiert?«, wiederholte er seine Frage. Diesmal etwas lauter.
»Neinnein, absolut nichts«, beeilte ich mich zu versichern. Ich sprang auf und sackte mit einem Stöhnen zusammen, als ich mein Knie belastete.
»Ganz sicher nicht?«, fragte er misstrauisch.
Ich schüttelte heftig den Kopf. Um ihm zu beweisen, wie gut es mir ging, reckte ich mich in die Höhe und trat mit beiden Beinen fest auf. »Alles in Ordnung«, versicherte ich.
Um nichts in der Welt wollte ich in irgendwelche Scherereien mit Gästen des Ambassadeur verwickelt werden. Und mit diesem brutalen Leuteschlächter schon gar nicht. Das hatte ich in den letzten Monaten schon gelernt.
Der Fahrer zuckte gleichmütig die Achseln. »Wenn Sie es sagen«, grollte er.
Er stieg wieder ein und ließ den Wagen die letzten paar Meter bis zum Haupteingang des Ambassadeur rollen. Ich sah aus respektvoller Ferne zu, wie sofort eine Schar livrierter Diener auf das Automobil zugestürzt kamen.
Der Riese stieg wieder aus. Zugleich öffnete sich die andere Vordertür, und ein schlanker, asiatisch wirkender Mann glitt hervor. Beide traten an den hinteren Wagenschlag. Der Riese öffnete mit einer kraftvollen Bewegung die Tür, während der Asiate und die Diener des Ambassadeur sich vor dem Aussteigenden verneigten.
Ich konnte den Mann, der dem Ambassadeur hier die Ehre seines Besuches erwies, zunächst nur von hinten sehen. Es war eine elegante, vielleicht ein wenig dandyhafte Erscheinung, hochgewachsen, den beigefarbenen Mantel um die Schultern gelegt, nicht übermäßig breite Schultern, wie es schien. Den hellen, recht hohen Zylinder trug er ein wenig zur Seite geneigt, was aber weniger lustig wirkte als vielmehr äußerst verunsichernd. Das dunkle Haar war akkurat geschnitten. Und obwohl er nichts weiter tat, als aus einem Automobil zu steigen und nun stumm das Hotel musterte, war es mir doch, als ginge von dem Mann etwas Unheimliches, Gefährliches aus. Etwas, mit dem man sich besser nicht anlegte.
Die Hotelangestellten mussten es auch spüren. Es war etwas in der Art, wie sie Haltung annahmen, das mir zeigte, dass offenbar auch ihnen ein Schauer über den Rücken gefahren war.
Der Neuankömmling hatte seine Musterung des Hauses inzwischen beendet. Das Hotel Ambassadeur hatte anscheinend Gnade vor seinen Augen gefunden, und er schickte sich an, das Gebäude zu betreten.
Noch immer hielt der Kleiderschrank in Chauffeursuniform die Wagentür auf und stand in Habt-Acht-Stellung neben dem Gefährt. Wollte noch jemand aussteigen?
Ich erschrak. Ein schwarzer Schatten sprang mit einem wahren Panthersatz hervor. Wahrhaftig, ein schwarzer Panther. Nein, wohl doch nur eine Hauskatze. Allerdings die größte und schwärzeste Hauskatze, die ich jemals gesehen hatte. Das schwarze Fell glänzte in der Sonne, als das Raubtier sich streckte und mit wohligem Schnurren, das bis zu meinem Standort an der Straße noch hörbar war, um die Beine seines Meisters strich.
Ich hielt den Atem an. Was für ein Tier!
Und ich sah, wie auch der Portier nach Luft schnappte. Der war nämlich, wie ich aus meinen langen Nachmittagen und Abenden im Ambassadeur wusste, der eingeschworene Feind aller Vierbeiner und hatte es durchgesetzt, dass im ersten Haus am Platze ein striktes Hunde- und Katzenverbot herrschte. Der Mann lief dunkelrot an, wurde dann kreidebleich. Dieser Gast war niemand, dem man das Mitführen von Katzen zu untersagen wagte.
Amüsiert beobachtete ich die Szene, da plötzlich passierte etwas, mit dem keiner der Beteiligten, am wenigsten ich, gerechnet hätte: Die ungeheure Katze wandte den Kopf in meine Richtung. Ihre grünen Augen schienen Blitze zu versprühen. Der muskulöse Körper spannte sich, ein Panthersatz, noch einer, schon war sie an der Straße.
Den buschigen Schwanz hoch aufgerichtet, so stand sie plötzlich vor mir und starrte mich aus undurchdringlichen tiefgrünen Augen an. Mir blieb fast das Herz stehen.
»Apollyon!«, hörte ich jemand rufen. Hieß sie so?
Auf lautlosen Samtpfoten – Samtpranken sollte ich besser sagen – kam sie näher geschlichen. Ich stand da, bemüht, mir meine Unsicherheit nicht anmerken zu lassen. Keine Angst zeigen, das war das Wichtigste.
»Na, du?«, flüsterte ich.
Kein Ohrenzucken verriet, dass sie mich gehört hatte. Aber die unergründlich grünen Augen registrierten jede meiner Bewegungen. Ich bewegte mich allerdings nicht. Jetzt war sie nur noch einen Meter von mir entfernt.
»Apollyon!«, rief es wieder.
Die Katze blickte zu mir empor und entblößte ihre dolchspitzen Fangzähne. Sie gähnte lange und ausgiebig. Aber bestimmt nicht vor Müdigkeit, sondern um ihre eindrucksvollen Waffen zu zeigen, da war ich ganz sicher. Dann war sie heran. Sie rieb ihren Kopf an meiner Hose, presste sich dann mit einer solchen Kraft gegen meine Beine, dass ich beinahe das Gleichgewicht verloren hätte, und strich um mich herum, wobei sie ein tiefes Raubtiergrollen ausstieß. Kein Zweifel, sie schnurrte.
Langsam, um sie nicht zu erschrecken, beugte ich mich vor und streichelte ihr über den Kopf. Ich musste mich nicht besonders tief bücken.
»Erstaunlich«, sagte plötzlich eine Stimme neben mir. »Das macht er mit Fremden normalerweise nicht.«
Erschrocken fuhr ich auf. Vor mir stand der fremde Hotelgast.
»Ich ... ähm ...«
Ungeschickt zog ich den Hut, während das schwarze Untier, das offensichtlich einen Narren an mir gefressen hatte, sich mit Nachdruck zwischen meinen Schienbeinen hindurchdrängte und mit immer lauter werdendem Schnurren weitere Streicheleinheiten forderte.
Der Anblick des Fremden trug nicht gerade zu meiner Standfestigkeit bei, und hätte ich in diesem Augenblick auch nur noch einen Funken Geistesgegenwart besessen, so wäre ich sofort auf und davon gesprungen. So aber blieb ich stehen wie vom Donner gerührt und starrte ihn an. Ich muss geglotzt haben wie ein Berliner Straßenjunge, der einen dreiköpfigen Elefanten sieht. Nur dass mir beim Anblick eines dreiköpfigen Elefanten wesentlich wohler gewesen wäre.
Der Fremde war recht groß, und sein Körper zeigte jene Spannkraft, die man von trainierten Sportlern oder energischen jungen Unternehmern kannte. Der Mann war tadellos gekleidet, eine Erscheinung von Eleganz und – nach der Qualität des Stoffes und der Verarbeitung zu urteilen – absoluter Kreditwürdigkeit. Und doch war etwas an ihm, das dafür sorgte, dass sich meine Nackenhaare aufstellten wie die einer Katze, die eine Bedrohung witterte. Das geradezu unnatürlich bleiche Gesicht verriet keine Regung. Schwarze Augen – Katzenaugen, Teufelsaugen, dachte ich mit leisem Grauen – fixierten mich und machten es mir unmöglich, den Blick abzuwenden.
Was war mit diesen Augen? Einen schmerzlichen Augenblick lang hatte ich das Gefühl, als würde sich ihr Blick tief in meine Seele hineinbohren und dort Dinge betrachten, die ich mir nicht einmal selbst anzusehen erlaubte.
Ich bemerkte erst, dass die Musterung abgeschlossen war, als der Fremde sich räusperte. Wie aus einem schweren Traum erwachend, fand ich mich plötzlich auf der Straße vor dem Ambassadeur wieder und wusste für einen Moment nicht, wie ich dort eigentlich hingekommen war. Ich stand jedoch noch immer ganz genau an der Stelle, an der mich fatale das Automobil eben beinahe überfahren hätte.
»Faszinierend«, bemerkte der Fremde, mehr zu sich selbst als an mich gewandt. Dann nickte er mir zu, offenbar mit dem, was er gesehen hatte, zufrieden. »Apollyon ist normalerweise recht eigen und schließt selten Freundschaften. Aber wo sind denn meine Manieren? Ich habe mich Ihnen ja noch nicht einmal vorgestellt. Mein Name ist Nikola. Dr. Nikola. Und mit wem habe ich die Ehre?«
»Pechstein«, sagte ich, während ich mechanisch das Fell des noch immer schnurrenden schwarzen Panthers kraulte. »Felix Secundus Pechstein.«
»Sehr angenehm.«
In Nikolas stechenden Blick stahl sich ein fast freundliches Glitzern. Er streckte die Hand aus. Ich schlug ein und hatte für einen Sekundenbruchteil das Gefühl, einen Pakt mit Mächten abzuschließen, denen ich nicht gewachsen war.
Doch mein neuer Bekannter fegte mit einem ausgesprochen charmanten Lächeln meine Besorgnis hinweg. »Nun, lieber Pechstein, ich muss Sie wohl für das etwas ungehobelte Benehmen meines Fahrers um Verzeihung bitten. Obgleich es natürlich ein unverzeihlicher Fehler war, einen Mann von Ihren Qualitäten so einfach über den Haufen zu fahren.«
»Ach nein, das ist doch nicht der Rede wert.« Was redete ich da? Natürlich ist es ein unverzeihlicher Fehler, mich über den Haufen zu fahren. Ich hätte tot sein können.
»Nicht?« Nikola lächelte schmallippig. »Nun, dann möchte ich Sie zumindest bitten, zum Abendessen mein Gast zu sein. Keine Widerrede, mein Guter, ich bestehe darauf.«
Alles in mir schrie danach, mich einfach nur umzudrehen und fortzulaufen. Aber die unheimlichen Augen bannten mich an meinen Platz, und das schwarze Katzenuntier strich noch immer um meine Beine.
»Neinnein, ich möchte wirklich nicht ...«, stammelte ich. Doch in diesem Augenblick begann mein Magen mit einer Lautstärke zu Knurren, die selbst das Schnurren des unheimlichen Apollyon in den Schatten stellte.
»Na, wenn das nicht ein eindeutiges Ja ist«, sagte Nikola zufrieden. »Kommen Sie nur, Pechstein, kommen Sie nur, die Küche des Ambassadeur soll ganz akzeptabel sein.«
Er hakte mich unter, und ich hatte gar keine Zeit mehr, mich wegen meines derangierten Äußeren zu genieren. Arm in Arm, als seien wir die besten Freunde, zogen wir ins Allerheiligste des Ambassadeur ein.
Der Portier und die Pagen machten einen tiefen Diener, als ich an ihnen vorbeimarschierte, und ich konnte mir nicht verkneifen, dem alten Empfangschef, der mich nicht mehr hatte kennen wollen, einen triumphierenden Blick zuzuwerfen.
Tief im Inneren aber graute mir, und ich hatte das Gefühl, als würde ich als Gefangener abgeführt.
Ich begehe eine Riesendummheit
Das Ambassadeur hatte den verstaubten Charme der Jahrhundertwende meisterhaft konserviert. Die Kronleuchter, eine Kreation in Gold und Kristall eines damals sehr gefragten dänischen Handwerkskünstlers hatten schon zu meiner Zeit über den gediegen-gutbürgerlichen Mahagoni-Tischen geschwebt. Lautlose Diener glitten durch den von einem riesigen goldgefassten Spiegel beherrschten Saal, bemüht, den Gästen jeden Wunsch noch vor dem Aussprechen von den Lippen abzulesen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!