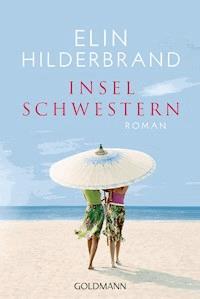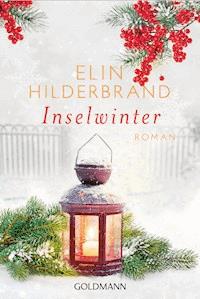8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Seit mehr als einem Vierteljahrhundert leitet die 48-jährige Dabney die Handelskammer von Nantucket, und jeder kennt und liebt sie. Nicht nur wegen ihres Postens, sondern vor allem, weil sie die inoffizielle Heiratsvermittlerin der Insel ist: Dabney hat schon über vierzig Paare zusammengeführt. Seit ihrer Jugend erkennt sie, ob zwei Menschen zueinander passen. Doch als Dabney erfährt, dass sie Krebs und nur noch wenige Monate zu leben hat, beschließt sie, diese Zeit darauf zu verwenden, die richtigen Partner für die Menschen zu finden, die sie am meisten liebt: für ihren Ehemann, ihren Liebhaber und für ihre Tochter. Die Frage ist nur, was die drei selbst davon halten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 545
Ähnliche
Buch
Seit knapp einem Vierteljahrhundert leitet die 48-jährige Dabney die Handelskammer von Nantucket, und jeder dort kennt und liebt sie. Nicht nur wegen ihres Postens, sondern vor allem, weil sie die inoffizielle Heiratsvermittlerin der Insel ist: Dabney hat schon über vierzig Paare zusammengeführt. Seit ihrer Jugend erkennt sie an einer rosa Wolke, ob zwei Menschen verliebt ineinander sind und gut zueinander passen, und an einer grünen Wolke, wenn zwei Menschen zwar vielleicht verliebt, aber nicht gut füreinander sind. Sie hat sich darin noch nie geirrt – nur bei sich selbst, glaubt sie, hat es einmal nicht hingehauen …
Als Dabney erfährt, dass sie Krebs im fortgeschrittenen Stadium und nur noch wenige Monate zu leben hat, beschließt sie, die Zeit, die ihr bleibt, darauf zu verwenden, die richtigen Partner für die Menschen zu finden, die sie am meisten liebt: für ihren Ehemann, ihren Liebhaber und für ihre erwachsene Tochter, die mit dem Falschen verlobt ist. Die Frage ist allerdings, was die drei selbst davon halten …
Mehr Informationen zur Autorin und ihren Werken
finden Sie am Ende des Buches.
Elin Hilderbrand
Das Sommer-
versprechen
Roman
Übersetzt
von Almuth Carstens
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel
»The Matchmaker« bei Reagan Arthur Books/Little,
Brown and Company
in der Hachette Book Group, New York.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung Mai 2015
Copyright © der Originalausgabe
2014 by Elin Hilderbrand
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Flora Press/EWA Stock Photo Library;
FinePic®, München
LT · Herstellung: Str.
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN 978-3-641-15685-5
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz:
Für meinen Norden, meinen Süden, meinen Osten
und meinen Westen:
Rebecca Bartlett
Deborah Briggs
Wendy Hudson
Wendy Rouillard
Und die ewige Nadel auf dem Kompass:
Elizabeth Almodobar
TEIL 1
DABNEY
Dabney konnte es nicht fassen. Sie blinzelte zweimal, dachte daran, dass sie nicht mehr die Augen eines Mädchens oder auch nur die einer jungen Frau hatte, dass es ihr neuerdings nicht so gut ging. Oder spielte ihr Verstand ihr einen Streich? Nach siebenundzwanzig Jahren? Betreff: Hallo.
Dabney Kimball Beech, seit zweiundzwanzig Jahren Geschäftsführerin der Handelskammer von Nantucket, saß in ihrem Büro im ersten Stock mit Blick auf die Main Street. Es war Ende April, der Freitagmorgen des Narzissenfestes, Dabneys zweitwichtigstes Wochenende im Jahr, und die Wettervorhersage der reinste Frühlingstraum. Heute schien die Sonne bei 15 Grad, und am Samstag und Sonntag würde sie bei knapp 18 Grad scheinen.
Dabney hatte sich den Wetterbericht an diesem Tag gerade zum fünften Mal und in dieser Woche zum fünftausendsten Mal angesehen (im letzten Jahr war das Narzissenfest von einem späten Schneesturm ruiniert worden), als die E-Mail von Clendenin Hughes in ihrem Posteingang auftauchte.
Betreff: Hallo.
»Oh mein Gott«, sagte Dabney.
Dabney fluchte nie und missbrauchte den Namen des Herrn selten (dank ihrer frommen katholischen Großmutter, die ihrer zehnjährigen Zunge eine Prise Cayennepfeffer verpasst hatte, weil sie den Ausdruck Jesses benutzt hatte). Dass sie es jetzt tat, reichte aus, um die Aufmerksamkeit von Nina Mobley zu wecken, Dabneys Assistentin seit achtzehn Jahren.
»Was ist?«, fragte Nina. »Was ist los?«
»Nichts«, entgegnete Dabney schnell. Nina Mobley war ihre beste Freundin, aber sie konnte ihr auf keinen Fall erzählen, dass ihr gerade eine Mail von Clendenin Hughes auf den Bildschirm geflattert war.
Dabney kaute auf einer ihrer Perlen, wie es ihre Gewohnheit war, wenn sie sich intensiv konzentrierte, und jetzt hätte sie sie fast durchgebissen. Ihr war klar, dass in diesem Moment Millionen Menschen auf der Welt E-Mails erhielten, ein hoher Prozentsatz davon wahrscheinlich überraschender und ein kleinerer, aber immer noch erheblicher Teil wahrscheinlich schockierender Natur. Aber sie fragte sich, ob irgendjemand irgendwo auf diesem Planeten gerade eine so überraschende und schockierende E-Mail wie diese bekam.
Sie starrte auf den Monitor und presste ihre Zähne auf die Perle. Sie war körnig, woran man ihre Echtheit erkannte. Hallo. Hallo? Kein Wort seit siebenundzwanzig Jahren – und dann das. Eine E-Mail ins Büro. Hallo. Als Clen nach Thailand abgereist war, hatte es noch keine E-Mails gegeben. Woher hatte er ihre Adresse? Dabney lachte. Er war ein mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneter Journalist, da konnte es keine große Herausforderung gewesen sein, ihre E-Mail-Adresse herauszufinden.
Hallo.
Dabney tippte leicht und spielerisch auf die Maus. Sollte sie die Mail öffnen? Was würde darin stehen? Was konnte nach siebenundzwanzigjähriger Funkstille darin stehen?
Hallo.
Dabney konnte die E-Mail nicht öffnen. Sie, die nie rauchte und kaum Hochprozentiges trank, wünschte sich jetzt eine Zigarette und einen Bourbon. Das Einzige, was sie mehr überwältigt hätte als das hier, wäre eine Mail von ihrer Mutter gewesen.
Ihre Mutter war tot.
Hallo.
Dabney fühlte sich, als würde sie bis aufs Knochenmark unter elektrischen Strom gesetzt.
Nina saß an ihrem eigenen Computer und lutschte an ihrem Goldkreuz – eine schlechte Angewohnheit, die sich per Osmose über die anderthalb Meter zwischen ihren beiden Schreibtischen fortgepflanzt hatte.
»Dabney, echt, was ist los?«, fragte sie.
Dabney ließ die Perlenkette aus ihrem Mund fallen; sie schlug auf ihre Brust, als wäre sie aus Blei. Es ging ihr seit Wochen, seit einem Monat vielleicht, nicht richtig gut, und jetzt spielte ihr Körper wirklich verrückt. Die E-Mail von Clendenin Hughes.
Dabney zwang sich, Nina anzulächeln. »Das Wetter wird dieses Wochenende perfekt!«, sagte sie. »Wir bekommen garantiert Sonnenschein.«
»Nach vorigem Jahr«, sagte Nina, »verdienen wir den auch.«
»Ich hole mir aus der Pharmacy schnell einen Frappé«, sagte Dabney. »Willst du auch was?«
Nina runzelte die Stirn. »Einen Frappé?« Sie schaute auf den Wandkalender, dieses Jahr ein Geschenk von Nantucket Auto Body. »Ist es denn schon wieder so weit?«
Dabney wünschte sich, nicht so vorhersehbar zu sein, aber natürlich war Vorhersehbarkeit ihr Markenzeichen. Sie kaufte sich nur einmal im Monat einen Frappé, nämlich am Vortag ihrer Periode, die erst in zehn Tagen fällig war.
»Aus irgendeinem Grund ist mir heute einfach danach zumute«, sagte Dabney. »Willst du auch was?«
»Nein, danke«, sagte Nina und sah Dabney noch einmal an. »Alles in Ordnung?«
Dabney schluckte. »Mir geht’s gut«, sagte sie.
Draußen herrschte eine festliche Atmosphäre. Nach vier zermürbend kalten Monaten hatte auf Nantucket der Frühling Einzug gehalten. Auf der Main Street wimmelte es von Menschen in Gelb. Dabney erspähte die Levinsons (Paar Nr. 28), die sie vor zehn Jahren miteinander bekannt gemacht hatte. Larry war Witwer mit Zwillingen in Yale und Stanford gewesen, Marguerite die bis dato nie verheiratete Direktorin eines renommierten Mädcheninternats. Larry trug einen gelben Kaschmirpullover und leuchtend gelbgrüne Kordhosen und Marguerite einen gelben Popelineblazer; in der Hand hielt sie die Leine ihres Golden Retrievers Uncle Frank. Dabney vergötterte alle Hunde und besonders Uncle Frank, und Larry und Marguerite waren eins von »ihren« Paaren, verheiratet nur, weil Dabney sie einander vorgestellt hatte. Dabney wusste, dass sie stehen bleiben und mit ihnen reden sollte; sie sollte Uncle Franks Kinn tätscheln, bis er für sie jaulte. Aber dazu war sie momentan nicht imstande. Sie überquerte die Straße zur Nantucket Pharmacy, ging jedoch nicht hinein, sondern weiter die Main Street entlang, über den Parkplatz bis zum Straight Wharf. Am Ende des Kais angelangt, blickte sie auf den Hafen. Da war Jack Copper, der auf seinem Charterboot arbeitete; in wenigen Wochen würde sich der Sommer in seiner ganzen wahnsinnigen Pracht zeigen. Jack winkte, und Dabney erwiderte sein Winken natürlich. Sie kannte jeden auf dieser Insel, und doch gab es niemanden, dem sie von dieser E-Mail erzählen konnte. Damit musste sie allein fertigwerden.
Hallo.
Dabney konnte die Fähre sehen, die gerade Brant Point umrundete. In einer Stunde würde die Handelskammer von Besuchern überschwemmt sein, und Dabney hatte Nina ganz allein zurückgelassen. Obendrein auch noch, ohne sich im »Logbuch abzumelden«, was Vaughan Oglethorpe, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Kammer, für unbedingt erforderlich hielt. Dabney musste noch in dieser Sekunde umdrehen und sich wieder den Aufgaben widmen, die sie in den letzten zwei Jahrzehnten immer perfekt erledigt hatte.
Betreff: Hallo.
Drei Stunden später öffnete sie die Mail. Sie hatte nicht vorgehabt, es überhaupt zu tun, doch der Drang wurde so stark, dass er sie körperlich schmerzte. Dabney taten der Rücken und ihr Unterleib weh; das Wissen um diese E-Mail zerriss sie innerlich.
Liebe Dabney,
ich möchte dir mitteilen, dass ich für einen Zeitraum unbestimmter Dauer nach Nantucket zurückkehre. Ich habe vor etwa sechs Monaten einen ziemlich schweren Verlust erlitten und erhole mich nur langsam davon. Überdies ist jetzt Monsunzeit, und meine Begeisterung, über diesen Teil der Welt zu berichten, ist geschwunden. Ich habe bei der Times gekündigt. Korrespondent in Singapur bin ich nie geworden. Vor einigen Jahren war ich nah dran, habe aber – wie immer – die falsche Person verärgert, indem ich einfach nur meine Meinung gesagt habe. Singapur wird ein Traum bleiben. (Schwerer Seufzer.) Ich habe befunden, dass es das Beste für mich ist, wenn ich nach Hause komme.
Ich habe deinen vor langer Zeit ausgesprochenen Wunsch respektiert, dich »nie wieder zu kontaktieren«. Seitdem ist über ein Vierteljahrhundert vergangen, Cupe. Ich hoffe, dass »nie wieder« ein Verfallsdatum hat und du mir diese E-Mail verzeihst. Ich wollte nicht auf der Insel aufkreuzen, ohne dich vorzuwarnen, und ich wollte nicht, dass du die Neuigkeit von jemand anderem erfährst. Ich werde das Haus von Trevor und Anna Jones hüten, 436 Polpis Road, und in ihrem Gäste-Cottage wohnen.
Ich habe sowohl Angst zu viel als auch zu wenig zu sagen. Vor allem möchte ich, dass du weißt, wie leid es mir tut, wie das zwi-schen uns geendet hat. Es hätte nicht so sein müssen, aber ich habe es schon vor langer Zeit alsAUSWEGLOSESITUATIONabgehakt: Ich konnte nicht bleiben, und du konntest nicht weg. Es ist kein Tag vergangen – ehrlich, Cupe, keine Stunde –, an dem ich nicht an dich gedacht habe. Als ich ging, habe ich einen Teil von dir mitgenommen, und diesen Teil habe ich all die vielen Jahre hindurch in Ehren gehalten.
Ich bin nicht mehr der Mensch, den du kanntest – weder in körperlicher noch in geistiger oder emotionaler Hinsicht. Aber natürlich bin ich trotzdem derselbe.
Ich würde dich sehr gern sehen, obwohl mir klar ist, dass ich mir damit fast zu viel erhoffe.
Ich schreibe dies während meines Zwischenstopps inLA. Wenn alles gut geht, müsste ich morgen früh auf Nantucket sein.
436 Polpis Road, Cottage hinter dem Haus.
Immer der Deine, Clen
Dabney las die E-Mail noch einmal, um sich zu vergewissern, dass ihr konfuses Hirn sie richtig verstanden hatte.
Morgen früh.
Paar Nr. 1: Phil und Ginger (geb. O’Brien) Bruschelli, verheiratet seit neunundzwanzig Jahren
Ginger: Es wäre anmaßend gewesen, mich als Dabneys beste Freundin zu bezeichnen, denn schon 1981, in der neunten Klasse, war Dabney das beliebteste Mädchen auf unserer Schule. Wenn ich »beliebt« sage, könnte man meinen, sie wäre blond gewesen oder Cheerleader oder hätte in einem großen Haus in der Centre Street gewohnt. Nein, nein, nein – ihre dichten Haare waren braun und glatt und zum Bubikopf geschnitten, und sie trug immer, immer ein Band darin. Sie hatte große braune Augen und ein paar Sommersprossen, und wenn sie lächelte, glaubte man, die Sonne ginge auf. Sie maß ungefähr einen Meter sechzig und hatte eine niedliche Figur, mit der sie sich aber nie hervortat. Sie trug entweder Pullover mit Zopfmuster und Schottenröcke oder ausgeleierte Levi’s und ein Männeroberhemd – das Hemd hatte sie in vier Farben: weiß, blau, rosa und pfirsich – und stets Penny Loafers und eine Perlenkette und Perlenohrringe. Das war Dabney.
Dabney war das beliebteste Mädchen auf unserer Schule, weil sie zu jedem aufrichtig nett war. Sie war nett zu Jeffrey Jackson, der ein Feuermal im Gesicht hatte; sie war nett zu Henry Granger, der schon in der zweiten Klasse eine Aktentasche besaß und anfing, Budapester zu tragen. Sie bezog jeden in die Planung von Homecoming-Umzügen und Adventsfeiern ein. Sie war als Einzelkind bei ihrem Vater Lieutenant Kimball, einem Polizeibeamten, aufgewachsen. Ihre Mutter war … na ja, keiner wusste genau, was es mit ihr auf sich hatte. Es kursierten ein paar Gerüchte, Tratschgeschichten, aber auf jeden Fall wussten wir alle, dass Dabney keine Mutter mehr hatte, was uns dazu bewog, sie noch lieber zu mögen.
Dabney war außerdem intelligenter als alle anderen auf der Nantucket High School, ausgenommen Clendenin Hughes, der, wie unser Englischlehrer Mr Kane es nannte, ein »Jahrhundertgenie« war. Dabney konnte dann wohl als Neunundneunzig-Jahre-Genie gelten.
In der neunten Klasse waren Dabney und ich die Küken im Jahrbuchkomitee. Das Komitee bestand ausschließlich aus Schülern der oberen Klassen – bis auf uns beide. Dabney fand, wir Neuntklässler sollten trotz unseres niederen Status ebenso vertreten sein wie die oberen Klassen, und meinte, niemand würde sich um uns kümmern, wenn wir das nicht selbst täten. Also verbrachten Dabney und ich in diesem Winter viel Zeit miteinander. Wir nahmen jeden Dienstag und Donnerstag nach dem Unterricht an den Jahrbuchtreffen teil und sahen uns danach das Basketballspiel der Jungsmannschaft an.
Ich war total verknallt in Phil Bruschelli, der in die zehnte Klasse ging und bei den Schulmannschaftsspielen meistens auf der Bank saß. Wenn das Team mehr als zwanzig Punkte Vorsprung hatte, durfte er ein paar Minuten lang mitmachen. Als das wieder einmal passierte, packte ich vor Freude Dabneys Arm.
Ihren Gesichtsausdruck werde ich nie vergessen. Er zeigte, so würde ich es heute nennen, belustigte Erkenntnis. »Du hast ihn gern«, sagte sie. »Du magst Phil.«
»Nein, tue ich nicht«, sagte ich. Obwohl Dabney und ich praktisch beste Freundinnen waren, wollte ich ihr nicht verraten, dass ich für Phil schwärmte.
»Doch«, sagte sie. »Tust du wohl. Ich kann es sehen. Du bist ganz … rosig.«
»Natürlich bin ich das«, sagte ich. »Hier drinnen sind vierzig Grad, und ich bin Irin.«
»Nicht dein Gesicht, Dummerchen«, sagte Dabney. »Deine, ich weiß nicht, Aura ist rosig.«
»Meine Aura? Rosig?«
Nach dem Spiel bestand Dabney darauf, dass ich mit ihr im Flur vor dem Umkleideraum der Jungen wartete. Ihr Vater komme sie abholen, meinte sie.
»Warum gehst du nicht zu Fuß?«, fragte ich. Dabney wohnte genau gegenüber von der Schule.
»Leiste mir einfach Gesellschaft«, sagte Dabney. Und dann strich sie mir die Haare von den Schultern und stellte den Kragen meines Polohemds auf. Sie war mir so nahe, dass ich ihre Sommersprossen hätte zählen können.
»Wie kommt es, dass du keinen Freund hast?«, wollte ich wissen. »Du bist so hübsch, und alle mögen dich.«
»Ich habe einen Freund«, sagte sie. »Er weiß es nur noch nicht.«
Ich hätte sie gern gefragt, wen sie meinte, aber in dem Moment kam Phil Bruschelli aus der Umkleide. Seine dunklen Haare waren noch feucht von der Dusche, und er trug eine dunkelbraune Wolljacke. Ich fiel fast in Ohnmacht, so süß fand ich ihn.
Dabney trat ihm in den Weg. »Hey, Phil.«
Phil blieb stehen. »Hey, Dabney.«
»Schön, dass du heute mitspielen konntest«, sagte Dabney. »In der Schulmannschaft, das muss dich doch gefreut haben.«
Er zuckte die Achseln. »Ja, klar. Der Trainer meint, ich muss meinen Anteil beitragen. Mal sehen, wie’s nächstes Jahr aussieht.«
Dabney zog mich neben sich. »Du kennst Ginger, oder, Phil? Ginger O’Brien? Wir arbeiten beide am Jahrbuch mit.«
Phil lächelte mich an. Mir verschwamm alles vor den Augen, und ich geriet ins Schwanken. Lächeln!, dachte ich. Lächle ihn an! Aber ich hatte das Gefühl, ich würde stattdessen gleich losheulen.
»Du bist Messdienerin in der Kirche, stimmt’s?«, fragte Phil.
Ich spürte, wie Flammen der Verlegenheit auf meinen Wangen aufloderten. Rosig, und ob. Ich nickte und gab ein Piepsen von mir wie ein Spatz. Wer wollte schon gern als Messdienerin erkannt werden? Und doch, ich war eine, und das schon, seit ich zehn Jahre alt war. Es war nicht gerade ein Geheimnis.
»Meine Mutter besteht darauf, dass ich einmal im Monat zur Messe mitkomme, und dann sehe ich dich jedes Mal«, sagte Phil.
»Kein Wunder, dass Ginger dir aufgefallen ist«, sagte Dabney. »Sie ist eine Wucht.« Und damit schlang sie mir einen Arm um den Hals und küsste mich auf meine sengend heiße Wange. »Bis dann, ich muss los! Mein Dad ist da!«
Sie sprang zur Tür hinaus auf den Parkplatz, aber da wartete ihr Vater nicht. Lieutenant Kimball fuhr einen Streifenwagen, und den hätte ich bemerkt. Es warteten überhaupt keine Autos. Dabney ging zu Fuß nach Hause, ließ mich zu einem Zeitpunkt im Stich, an dem ich ihre Unterstützung gebraucht hätte. Ich beschloss, ihr nie zu verzeihen.
Aber dann fragte Phil, ob ich Basketball möge, und ich sagte ja, und er fragte, ob ich Lust hätte, ihn am nächsten Nachmittag für die Mannschaft der Juniors spielen zu sehen, und ich sagte: Okay, gerne. Und er sagte: Na gut, dann bis morgen, vergiss mich nicht! Und ich hatte das Gefühl, in meiner Brust wäre ein Vogelschwarm aufgeflogen.
Phil und ich sind seit neunundzwanzig Jahren verheiratet, und wir haben vier wunderbare Söhne, von denen der jüngste als Power Forward für die Villanova University spielt.
Rosig, und ob.
Dabney verließ das Büro um halb fünf, wie üblich. Alle Vorbereitungen für das Narzissenfest waren getroffen; Dabney hätte es im Schlaf organisieren können – Gott sei Dank, denn den Nachmittag hatte sie damit verbracht, immer wieder Clens E-Mail zu lesen und sich darüber den Kopf zu zermartern.
Ich habe vor etwa sechs Monaten einen ziemlich schweren Verlust erlitten und erhole mich nur langsam davon.
Was für einen Verlust?, fragte sich Dabney. Hatte er einen guten Freund verloren, eine Geliebte? Sie selbst hatte vor zehn Jahren durch einen Herzinfarkt ihren Vater verloren, und ihr geliebter schokoladenbrauner Labrador Henry war kurz vor Weihnachten im Alter von siebzehn gestorben. Doch keiner dieser Verluste ließ sich mit dem Verlust Clendenins vergleichen.
Es ist kein Tag vergangen – ehrlich, Cupe, keine Stunde –, an dem ich nicht an dich gedacht habe.
Sie würde lügen, wenn sie behauptete, sie habe nicht auch an ihn gedacht. Die Liebe ihres Lebens, ihr perfektes Gegenstück, der für sie Bestimmte. Der Vater ihres Kindes. Wie weh es ihr getan hatte, den Kontakt abzubrechen! Aber viele Jahre später war Dabney verblüfft über die Weisheit und Reife ihrer Entscheidung.
Überleben kann ich nur, wenn wir einen sauberen Schnitt machen. Bitte respektiere meine Wünsche und lass mich und dieses Kind in Ruhe. Bitte, Clendenin Tabor Hughes, tu mir den Gefallen, nie wieder Verbindung mit mir aufzunehmen.
Er war sehr, sehr wütend gewesen. Er hatte mitten in der Nacht angerufen, und über das Rauschen in der Leitung hinweg hatten sie sich zum ersten Mal in ihrer Beziehung angeschrien und waren sich ständig ins Wort gefallen, bis Clen das Telefonat mit Es ist deine Entscheidung beendet und den Hörer aufgeknallt hatte. Aber er hatte sich ihrem Willen gefügt und sich nie wieder bei ihr gemeldet.
AUSWEGLOSESITUATION: Ich konnte nicht bleiben, und du konntest nicht weg.
Genau so war es gewesen.
Trotzdem hatte Dabney gedacht, Clendenin würde bei ihrer Entbindung vielleicht im Krankenhaus auftauchen. Sie hatte gedacht, er würde vielleicht am Nachmittag ihrer Hochzeit mit Box in der Kirche erscheinen und wie im Film den Pfarrer im entscheidenden Moment unterbrechen. Sie hatte gedacht, er würde vielleicht Agnes’ erstes Klavierkonzert besuchen oder bei der Party zu ihrem eigenen vierzigsten Geburtstag im Walfangmuseum aufkreuzen. Sie hatte gedacht, er würde vielleicht auf die Insel zurückkehren, als seine Mutter starb – aber Helen Hughes war eingeäschert worden, und einen Gedenkgottesdienst hatte es nicht gegeben.
Dabney hatte immer gedacht, er würde vielleicht doch zurückkehren.
Wenn alles gut geht, müsste ich morgen früh auf Nantucket sein.
Dabney ging zu Fuß nach Hause und wünschte sich, es wäre mitten in der Woche, sodass sie das Haus für sich allein und Zeit und Raum zum Nachdenken hätte. Ihr Ehemann John Boxmiller Beech – Box für alle, die ihn besser kannten – unterrichtete in Harvard, wo er einen Stiftungslehrstuhl in Volkswirtschaft innehatte, weswegen er vier Tage pro Woche in Cambridge übernachtete. Box war vierzehn Jahre älter als Dabney, zweiundsechzig inzwischen, sein Haar vollkommen weiß. Er war ein brillanter Wissenschaftler, witzig auf Dinnerpartys, und er hatte Dabney intellektuell bereichert und sie millionenfach gerettet, nicht zuletzt, vor Jahrzehnten, vor ihren Erinnerungen an Clendenin Hughes. Box hatte Agnes adoptiert, als sie drei Jahre alt gewesen war. Zuerst war er unbeholfen mit ihr umgegangen, doch als sie älter wurde, genoss er es, ihr das Schachspielen beizubringen und sie die Hauptstädte Europas abzufragen. Er bereitete sie darauf vor, in Harvard zu studieren, und war enttäuscht, als sie sich für Dartmouth entschied, aber trotzdem fuhr er dann immer zwischen Nantucket und Hanover hin und her – manchmal durch heftigste Schneestürme –, weil Dabney sich weigerte, die Insel zu verlassen, wenn es nicht lebenswichtig war.
Morgen früh. Heute war Freitag, was bedeutete, dass Box in ihrem Haus in der Charter Street war. Er würde Dabneys Begleiter bei allen Festlichkeiten des Narzissenwochenendes sein, obwohl er nach seiner Knieoperation langsamer war und Schwierigkeiten mit den Namen all derer hatte, die er nicht schon zwanzig Jahre kannte. Jetzt würde er arbeiten und daher abgelenkt sein, aber wenn Dabney an die Tür seines Arbeitszimmers klopfte, würde er seinen Stift hinlegen und den Mozart leiser drehen und zuhören, wenn sie die Worte aussprach, vor denen er sich mit Sicherheit seit zwanzig Jahren fürchtete.
Ich habe eine E-Mail von Clendenin Hughes gekriegt. Er kommt morgen früh für unbestimmte Zeit nach Nantucket zurück.
Was würde Box sagen? Dabney konnte es sich nicht vorstellen. Sie war ihm gegenüber immer ehrlich gewesen, doch sie beschloss, ihm nichts von Clen zu erzählen. Sie revidierte die Ereignisse dahingehend, dass sie die Mail, ohne sie zu lesen, gelöscht und dann ihren Papierkorb geleert hatte, was bedeutete, dass sie verschwunden war, als ob sie überhaupt nie existiert hätte.
Paar Nr. 8: Albert Maku und Corinne Dubois, verheiratet seit zweiundzwanzig Jahren
Albert: Dabney Kimball war die erste Person, die ich in Harvard kennen lernte. Sie saß auf der Seitentreppe zur Grays Hall und heulte sich die Augen aus. Alle anderen Erstsemester schleppten ihre Koffer und Kisten über den Harvard Yard, ihre gut aussehenden und gut gekleideten Eltern und lärmenden Geschwister im Schlepptau. Ich sah Menschen, die sich kreischend umarmten – was für ein glückliches Wiedersehen! Sie waren zusammen im Camp Wyonegonic oder erbitterte Lacrosse-Rivalen gewesen, der eine in Gilman, der andere in Calvert Hall, sie waren gemeinsam von Newport nach Bermuda gesegelt, in Gstaad Ski gelaufen – es wurde einfach immer absurder, und ich konnte keine Sekunde länger zuhören, ohne mich erbärmlich fehl am Platze zu fühlen. Ich kam aus Plettenberg Bay in Südafrika – mein Vater war Lkw-Fahrer, meine Mutter Leiterin des Housekeeping in einem Touristenhotel, und meine Studiengebühren finanzierte ich mit einem Stipendium der United Church of Christ. Ich gehörte nicht in die Grays Hall, nicht nach Harvard, nicht nach Cambridge, nicht in die USA. Ich schlüpfte zur Seitentür hinaus, um abzuhauen – zurück zur U-Bahn-Station, zurück zum Flughafen Logan, zurück nach Kapstadt.
Aber dann sah ich die weinende Dabney und dachte: Guck mal an, Albert, da ist jemand anscheinend ebenso unglücklich wie du selbst. Ich setzte mich neben sie auf die heiße Stufe und bot ihr ein Taschentuch an. Meine Mutter hatte mich um die halbe Welt geschickt, auf die renommierteste Universität des Planeten, bewaffnet mit wenig mehr als einem Dutzend gebügelter weißer Taschentücher.
Das erste weiße Taschentuch brachte mir meine erste Freundschaft ein. Dabney nahm es entgegen und putzte sich ungezwungen die Nase. Sie wirkte nicht überrascht von meiner Anwesenheit – obwohl ich einen Meter siebenundneunzig groß war und nicht viel mehr als fünfundsiebzig Kilo wog und meine Haut dasselbe Lila-Schwarz aufwies wie die Pflaumen, die der Obsthändler auf dem Harvard Square verkaufte.
Als sie sich ausgeschnäuzt hatte, faltete sie das Taschentuch zu einem ordentlichen, feuchten Quadrat zusammen und legte es auf ihr jeansbedecktes Knie.
»Ich wasche es, bevor ich es dir zurückgebe«, sagte sie. »Ich bin Dabney Kimball.«
»Albert«, sagte ich. »Albert Maku, aus Plettenberg Bay, Südafrika.« Und dann fügte ich »Ngiyajabula ukukwazi« hinzu, was auf Zulu »Ich freue mich, dich kennen zu lernen« heißt.
Sie brach wieder in Tränen aus. Ich dachte, das Zulu hätte sie vielleicht erschreckt, und merkte mir im Geiste vor, diese Taktik nie wieder zu benutzen, wenn ich mich einem Amerikaner vorstellte.
»Was ist?«, fragte ich. »Fühlst du dich allein? Hast du Angst?«
Sie schaute mich an und nickte.
»Ja, ich auch«, sagte ich.
Später gingen wir in Mr Bartley’s Burger Cottage. Das war ein berühmtes Hamburger-Lokal, das auch im Handbuch für Erstsemester erwähnt wurde. Wir bestellten Burger mit Zwiebeln und Chilisauce und Käse und Pickles und Spiegeleiern, und wir bestellten Pommes mit Bratensauce, und während ich aß, machte ich mir fröhlich klar, dass dies amerikanisches Essen war und dass es mir sehr gut schmeckte.
Dabney Kimball war auf Nantucket geboren und aufgewachsen, einer Insel, zu der man über Land sechzig und übers Meer noch einmal dreißig Meilen zurücklegen musste. Sie erzählte mir, sie sei in der fünften Generation dort geboren, und ich begriff, dass das für eine Amerikanerin eine Leistung war. Ihr Urururgroßvater war nach Nantucket gekommen, als er selbst gerade sein Studium in Harvard abgeschlossen hatte.
Dabney verließ die Insel nicht gern, wegen eines Ereignisses in ihrer Kindheit, sagte sie.
»Ach, wirklich?«, erkundigte ich mich. »Was war das?«
Ich dachte, sie sei auf dem Festland vielleicht einmal überfallen worden oder in einen Unfall auf dem Highway verwickelt gewesen, aber sie kniff die Lippen zusammen, und mir wurde klar, dass ich mit meiner Frage wahrscheinlich die Grenzen unserer nagelneuen Freundschaft überschritten hatte.
»Es gibt keine Universität auf Nantucket«, sagte sie. »Sonst hätte ich mich da immatrikuliert.« Sie stocherte in den letzten in Sauce schwimmenden Pommes. »Es ist eine Phobie. Wenn ich die Insel verlasse, gerate ich in Panik. Ich fühle mich nur sicher, wenn ich auf dieser Insel bin. Sie ist mein Zuhause.«
Ich erklärte ihr, dass mein Zuhause Plettenberg Bay und ich bis vor zwei Tagen nie außerhalb Südafrikas gewesen sei. Allerdings war Plettenberg Bay keine Insel, und ich war mit dem Chor meiner kirchlichen Jugendgruppe schon ganz schön weit im Lande herumgekommen – bis nach Kapstadt, Knysna, Stellenbosch und Franschhoek, bis nach Jo-Burg und Pretoria, unsere Hauptstadt, und an die schönen Strände von Durban. Verglichen mit Dabney fühlte ich mich welterfahren.
»Außerdem«, sagte sie, »bin ich in einen Jungen namens Clendenin Hughes verliebt. Er geht nach Yale, und ich habe Angst, ihn zu verlieren.«
Na ja, damit hatte sie mich. Über die Liebe wusste ich zu dem Zeitpunkt rein gar nichts.
Dabney und ich blieben die ganzen vier Harvard-Jahre über befreundet. Sie fuhr jedes Wochenende und in den Semesterferien und an Feiertagen nach Hause nach Nantucket und lud mich vor ihrer Abreise jedes Mal ein mitzukommen. Ich stellte mir Nantucket als einen Ort für Weiße vor, teuer und elitär, und obwohl jemand so Nettes wie Dabney dort lebte, glaubte ich, ein klapperdürrer, bettelarmer afrikanischer Junge mit lila-schwarzer Haut und einem Kirchenstipendium würde dort nicht willkommen sein, und lehnte immer ab.
Aber dann, in den Frühlingsferien unseres letzten Jahres, als ich zum Medizinstudium an der Columbia zugelasssen worden war und von meiner Arbeit im Charles Hotel die Taschen voller Geld hatte und sich mein Selbstbewusstsein nicht nur dank meiner Zukunft als Arzt und meiner finanziellen Situation gesteigert hatte, sondern auch dank der Erkenntnis, dass ich irgendwie Amerikaner geworden war (mir gefielen Filme mit Mickey Rourke, und ich trank gelegentlich ein Bier im Rathskeller), sagte ich zu.
Dabney fuhr damals einen 1972er Chevy Nova, in den ich mich für die Fahrt nach Hyannis klemmte, wo wir die Fähre nach Nantucket besteigen würden.
»Ach, weißt du was?«, sagte Dabney. »Meine Freundin Corinne Dubois kommt auch mit.«
Ich wollte Dabney meine Enttäuschung nicht spüren lassen. Ich sehnte mich nach ihrer Aufmerksamkeit und hasste die Vorstellung, stumm dazusitzen, während Dabney mit ihrer Freundin quasselte, dieser Corinne Dubois.
»Sie ist ein tolles Mädchen, einfach prima – wunderschön, intelligent, du wirst sie mögen«, sagte Dabney. »Sie macht demnächst am MIT ihren Abschluss in Astrophysik.«
Wir lasen Corinne Dubois auf dem Edward Land Boulevard vor dem Museum of Science auf. Sie hatte lockige kupferrote Haare und trug lange silberne Ohrringe und einen langen Bauernrock und eine dunkle runde Sonnenbrille. All das nahm ich in einer Minute zur Kenntnis und war nicht sehr beeindruckt, sondern fand nur, dass Corinne Dubois nicht aussah wie eine Person, die demnächst am MIT ihren Abschluss in Astrophysik machen würde. Aber als sie dann ins Auto stieg, roch ich ihr Parfüm, und etwas regte sich in mir. Sie knallte die Tür zu und schob sich ihre Sonnenbrille auf den Kopf, und ich stellte mich vor.
»Albert Maku«, sagte ich und bot ihr meine Hand.
Sie schüttelte sie ausgiebig. »Corinne Dubois«, sagte sie. »Freu mich sehr, dich kennen zu lernen, Albert.«
Ihre Augen waren grün und lächelten mich an. Und obwohl ich nicht wusste, was Liebe war, verspürte ich sie in diesem Moment.
Dabney merkte es. Sie sah mich an und sagte: »Albert, du bist rosig.«
Und ich dachte: Wie kann ein Mann mit der lila-schwarzen Haut einer Pflaume rosig aussehen?
Aber ich wusste, dass sie Recht hatte.
Dabney Kimball Beech stammte von einer langen Reihe starker Frauen ab. Mit einer Ausnahme.
Dabney war nach ihrer Urururgroßmutter benannt worden, Dabney Margaret Wright, verheiratet mit Warren Wright, der Kapitän des Walfängers Lexington gewesen und bei seiner zweiten Fahrt zur See umgekommen war. Dabney hatte drei Söhne, von denen David Warren Wright, der Jüngste, Alice Booker heiratete. Alice war Quäkerin; ihre Eltern waren Abolitionisten in Pennsylvania gewesen und hatten entflohenen Sklaven geholfen. Alice brachte zwei Mädchen zur Welt, und ihre ältere Tochter, Winford Dabney Wright, heiratete Richard Kimball, Nantuckets einzigen Rechtsanwalt. Winford war Suffragette und bekam einen Sohn, Richard Kimball jun., genannt Skip, der sein Harvard-Studium abbrach und unerhörterweise ein irisches Zimmermädchen namens Agnes Bernadette Shea heiratete, Dabneys geliebte Großmutter und die Mutter ihres Vaters David Wright Kimball, der bei den ersten Einsätzen der Amerikaner in Vietnam mitkämpfte und nach seiner Heimkehr seinen Dienst als einer von vier Polizisten auf der Insel antrat und eine Touristin namens Patricia Beale Benson heiratete.
Patty Benson, Dabneys Mutter, war das schwache Glied in der Ahnenreihe. Sie verließ Nantucket, als Dabney acht Jahre alt war, und kam nie zurück.
Als Dabney feststellte, dass sie ein Kind erwartete (und was Skandale betraf, gab es im Jahr 1988 keinen größeren als den, dass Dabney Kimball unehelich schwanger wurde), wünschte sie sich einen Sohn. Eine Tochter zu bekommen, nachdem sie ohne Mutter aufgewachsen war, erschien ihr als eine Herausforderung, die ihre Fähigkeiten überstieg. Aber als Dabney dann ein kleines Mädchen in die Arme gelegt wurde, übermannte sie die Liebe, die allen frischgebackenen Müttern eigen ist. Sie nannte das Baby nach ihrer Oma Agnes Bernadette und befand, die einzige Möglichkeit, den Schmerz darüber zu lindern, dass sie von ihrer Mutter verlassen worden war, sei die, es selbst richtig zu machen. Sie würde an erster Stelle Mutter sein, eine Mutter für immer.
Als Dabney sich ihrem Haus in der Charter Street näherte, sah sie Agnes’ Prius in der Einfahrt.
Agnes! Dabney empfand Hochstimmung. Agnes war zum Narzissenfest heimgekommen! Agnes hatte sie überraschen wollen, was, so nahm Dabney an, bedeutete, dass alles verziehen war.
Dabney wollte gar nicht an das Missverständnis zu Weihnachten denken. Es war das schlimmste Missverständnis gewesen seit, na ja … seit dem einzigen anderen echten Konflikt, den Dabney und ihre Tochter gehabt hatten, als Agnes sechzehn gewesen war und Dabney ihr erklärt hatte, wer ihr richtiger Vater war. Im Vergleich zu dem damaligen Orkan war der Krach zu Weihnachten unbedeutend gewesen.
Dabney trat durch den Vorraum ins Haus.
»Agnes?«, rief sie.
Agnes stand an der Küchentheke und aß ein Sandwich. Sie kam Dabney sehr mager vor. Ihre Jeans schlackerten ihr um die Hüften. Und – noch schockierender! – sie hatte sich die Haare abgeschnitten!
»Oh nein!«, sagte Dabney. Sie streckte die Hand aus und berührte Agnes’ geschorenen Kopf. All das wunderschöne glatte dunkle Haar, das Agnes bis zu ihrem nahezu fehlenden Hintern gereicht hatte, war abgesäbelt worden. Sie sah aus wie ein Junge.
»Ich weiß«, sagte Agnes. »Es verändert mich total. Ich fühle mich wie ein anderer Mensch. Gestern früh hab ich mich zuerst gar nicht im Spiegel erkannt.«
Dabney presste die Lippen zusammen, um die fünfzig lästigen Mom-Fragen zu unterdrücken, die ihr zu entweichen drohten: Wann hast du es abgeschnitten? Warum hast du es abgeschnitten? Oh, Schätzchen, warum?
Agnes biss von ihrem Hühnersalatsandwich ab, und Dabney dachte: Ja, iss, iss! Dies war also die Strafe dafür, dass sie ihre Tochter trotz mindestens zweihundert Einladungen nie in New York besucht hatte. Ihre Tochter war nach Hause gekommen als eine Kreuzung aus Twiggy im Rolling Stone von 1966 und einem männlichen Teenager, der eben aus der Jugendhaft entlassen worden war.
Agnes schluckte und sagte: »CJ hat mich dazu überredet.«
CJ, natürlich.
Dabney umarmte ihre Tochter. »Wie geht’s CJ?«, fragte sie.
»Bestens!«, sagte Agnes. »Er ist hier. Er ist mitgekommen.«
»Wirklich?« Dabney klang erfreut und glücklich, selbst in ihren eigenen Ohren. »Wo ist er?«
»Er ist joggen gegangen«, sagte Agnes.
»Oh, gut!«, sagte Dabney. Für sie klang »oh, gut« okay. Es klang wie: Oh, gut fürCJ, dass er draußen dieses herrliche Frühlingswetter genießt! Was sie meinte, war: Oh, gut, dass ich mich nicht gleich mitCJbefassen muss.
Dabney holte tief Luft und erneuerte insgeheim ihr Gelübde, CJ nicht zu kritisieren. Charles Jacob Pippin war vierundvierzig Jahre alt, nur vier Jahre jünger als Dabney, Agnes sechsundzwanzig. Aber Box wies sie darauf hin, dass sie kein Recht habe, sich über den Altersunterschied aufzuregen, denn Box war vierzehn Jahre älter als Dabney, und das hatte nur selten, wenn überhaupt, ein Problem dargestellt. CJ war von einer Frau namens Annabelle geschieden, die – wie er gern und oft erwähnte – jetzt in Boca Raton lebte, wo sie die eine Million Dollar verschleuderte, die CJ ihr jährlich an Unterhalt zahlte. CJ war Sportleragent in New York; er betreute unter anderem neun New York Giants und vier prominente Yankees sowie einige Tennis- und Golfspieler der Spitzenklasse. CJ und Agnes hatten sich im letzten September bei der alljährlichen Benefizveranstaltung für den Morningside Heights Boys & Girls Club kennen gelernt, bei dem Agnes Geschäftsführerin war. CJ hatte dem Club einen dicken Scheck ausgestellt und dann den ganzen Abend über mit Agnes im Ballsaal des Waldorf getanzt. Am Montag darauf war ein Karton mit zwei Dutzend nagelneuen Basketbällen im Club eingetroffen, dem am Dienstag eine große Menge Bastelartikel folgte. Am Mittwoch rief Victor Cruz, Runningback bei den Giants, im Club an, um zu fragen, ob er vorbeikommen könne, um den Kindern Autogramme zu geben; Agnes hatte es zunächst für einen Telefonstreich gehalten. Am Donnerstag traf ein riesiger Blumenstrauß für Agnes ein, zusammen mit der Einladung, am Freitag mit CJ im Nougatine essen zu gehen.
Es war ein Liebeswerben wie im Film, und Dabney konnte es Agnes nicht verübeln, dass sie ihm nachgab. Welche Sechsundzwanzigjährige hätte da widerstehen können? CJ war intelligent, erfolgreich und kultiviert – er konnte über alles reden, von Frank Lloyd Wright bis zum Weltringerverband. Seit sie sich kannten, hatte CJ Agnes auf Reisen nach Nashville, Las Vegas und nach Italien mitgenommen, wo sie in einem gemieteten Ferrari die Amalfi-Küste entlanggefahren waren.
Box, den niemand so leicht beeindruckte, hielt CJ für das Größte seit der Erfindung von Schnittbrot. CJ spielte Golf, er verstand etwas von Wirtschaftstheorie und war Republikaner. Box’ Meinung nach war es ein Einer-für-zwei-Deal: ein Kavalier für Agnes, ein Freund für ihn.
Der Streit an Weihnachten hatte damit angefangen, dass Agnes ihre Mutter fragte, ob sie und CJ perfekt zueinander passten.
Dabney war das Herz schwer geworden. Sie war »Cupe«, Kurzform für Cupido; sie war Nantuckets Kupplerin schlechthin, mit zweiundvierzig Paaren auf der Habenseite, die alle noch zusammen waren. Dabney erkannte, ob zwei Menschen perfekt zueinander passten, indem sie sie einfach nur anschaute. Dann sah sie entweder ein rosiges Leuchten oder einen olivgrünen Dunst. Trotzdem äußerte Dabney nicht gern ihre Meinung über Paare, die sie nicht selbst zusammenbrachte. Es war sinnlos. Die Leute würden ihre eigenen Entscheidungen treffen, unabhängig von Dabneys Voraussagen. Stürmische, leidenschaftliche Liebe und – schlimmer noch – Lust waren die Feinde von Vernunft und gesundem Menschenverstand.
»Oh, Schatz, ich habe keine Ahnung«, sagte sie.
Agnes drängte: »Mom, bitte. Sag’s mir.«
Dabney dachte an Agnes und CJ. Zu Weihnachten hatte CJ Agnes ein Paar High Heels von Christian Louboutin geschenkt, das neueste iPad und ein goldenes Liebesarmband von Cartier, das er ihr mit dramatischer Geste ums Handgelenk legte. Besonders dieses letzte Geschenk unterstrich seinen Hang zur Kontrolle. Er wollte, dass Agnes darauf achtete, was sie aß, er hatte es gern, wenn sie regelmäßig Sport trieb, am liebsten zweimal täglich. Er missbilligte Agnes’ Freundinnen und hielt sie für »eine Gefahr für die Beziehung«, weil sie sich mit ihnen zu Cocktails traf und am Wochenende in Clubs im Meatpacking District ging. Inzwischen, vermutete Dabney, waren die meisten Freundinnen Geschichte. Wenn CJ und Agnes nebeneinander herliefen, zog CJ sie mit sich, als wäre sie ein aufsässiges Kind.
Zu Dabney war CJ immer charmant, aber charmant auf eine Weise, die ans Schmeichlerische grenzte. Er nahm gern Bezug darauf, dass er und Dabney praktisch gleichaltrig waren. Sie waren beide in den Achtzigern aufgewachsen, der Ära der J. Geils Band und von Ghostbusters; sie waren beide zur Highschool gegangen, als die Union-Carbide-Katastrophe in Indien geschätzte zwanzigtausend Todesopfer gefordert hatte. Es gefiel Dabney nicht, dass CJ nach seiner Scheidung seinen Namen geändert hatte; seine erste Frau Annabelle und alle anderen in seinem vorherigen Leben hatten ihn Charlie genannt. Dabney war alarmiert, als CJ sagte, er möge keine Hunde (»zu schmutzig«) und wolle keine Kinder. Agnes liebte Kinder; deshalb arbeitete sie auch im Boys & Girls Club. Mittlerweile meinte sie, es sei ihr egal, ob sie Kinder bekomme oder nicht. Dabney wusste nicht genau, wie sie es erklären sollte, aber sie witterte etwas Niederträchtiges, vielleicht sogar Bösartiges hinter CJs charismatischer Fassade.
Wenn Dabney Agnes und CJ anschaute, nahm sie einen Dunst wahr, der so graugrün war wie Wolken vor einem Gewitter. Normalerweise stand ein Paar, wenn Dabney ein solches Miasma erblickte, kurz vor der Trennung.
Dabney sah keine andere Möglichkeit, als Agnes die Wahrheit zu sagen. An erster Stelle Mutter sein, eine Mutter für immer.
»Nein«, sagte sie. »Ihr passt nicht perfekt zueinander.«
Agnes hatte noch am selben Nachmittag ihren Koffer gepackt und das Haus verlassen, anderthalb Tage früher als geplant, und damit die nachweihnachtliche Familientradition der Steaksandwiches und Brettspiele ignoriert. Sie war abgefahren, ohne auch nur eins ihrer Geschenke mitzunehmen, sodass Dabney sie hatte einpacken und per Post nach New York schicken müssen.
Box war verwirrt gewesen, als er aus seinem Arbeitszimmer auftauchte. »Warte mal«, sagte er. »Was ist passiert? Warum sind sie abgereist?« Agnes hatte sich nicht von Box verabschiedet, und das, wusste Dabney, weil sie nicht wollte, dass er versuchte, sie zum Bleiben zu überreden.
Dabney seufzte. »Ich habe Agnes etwas gesagt, was sie nicht hören wollte.«
Box schob seine rechteckige, schwarz gerahmte Brille hoch, sodass sie sich in sein schneeweißes Haar schmiegte. Er war ein begabter und geachteter Mann, aber manchmal wünschte sich Dabney, ihr bliebe die Predigt erspart. An guten Tagen hielt Box ihre Kuppeleien für frivol und albern, an allen anderen für eine abscheuliche Einmischung in die Privatangelegenheiten anderer. »Was?«, fragte er. »Was hast du ihr gesagt?«
»Das ist eine Sache zwischen ihr und mir.«
»Dabney.« Seine Augen waren durchdringend blau, klar und kalt, streng.
»Sie hat mich gefragt, ob ich finde, dass sie und CJ perfekt zueinander passen.«
Box hob sein Kinn um ein winziges Stück. »Du hast ihr doch bestimmt nicht deine Meinung dazu gesagt?«
Dabney antwortete nicht. Sie stand aufrecht und mit gefalteten Händen da. Sie war das aufsässige Schulmädchen, das der Direktor zu sich bestellt hatte. Box war ihr Ehemann, rief sie sich ins Gedächtnis. Sie waren gleichberechtigt.
Box’ Gesicht rötete sich. »Du hast ihr deine Meinung gesagt. Sonst wäre sie nicht durchgebrannt.«
»Durchgebrannt«, sagte Dabney. Sie hatte die schlechte Angewohnheit, Wendungen von Box zu wiederholen, die sie idiotisch fand. Etwa »durchgebrannt«. Das war Professor Beech, der versuchte, nicht nur nach Harvard zu klingen, sondern auch noch britisch. Heldinnen edwardianischer Romane »brannten durch«. Agnes war in ihren Prius gestiegen und ohne Lärm oder toxische Emissionen davongefahren.
»Unhöflich von ihnen, sich nicht zu verabschieden«, sagte Box. »Von CJ hätte ich mehr erwartet. Man übernachtet nicht bei jemandem und verdrückt sich dann ohne ein Wort.«
»Du hast gearbeitet, Liebling«, sagte Dabney. »Deine geschlossene Tür wirkt sehr einschüchternd, das habe ich dir schon hundertmal erklärt. Sicher wollten sie dich einfach nicht stören.«
»Sie hätten mich nicht gestört«, sagte Box. »Ich habe bloß gele-sen. Und an einer geschlossenen Tür ist nichts Einschüchterndes. Sie hätten nur anklopfen müssen.«
»Es ist meine Schuld«, sagte Dabney. Der Tag nach Weihnachten und auch der Tag danach waren jetzt ruiniert.
Box atmete hörbar aus. Vielleicht hätte er gern etwas Strafendes gesagt, doch als perfekter Gentleman, der er war, hielt er sich zurück. Er wusste, dass Agnes’ Abreise Strafe genug war.
Das Wetter zum Narzissenfest würde ideal sein, doch das war’s dann auch schon; alles andere in Dabneys Leben stellte sich als heilloses Durcheinander dar. Ihre Tochter war nach Hause gekommen – das war schön –, aber sie hatte CJ mitgebracht, und das war nicht schön. Und am nächsten Morgen würde Clendenin Hughes auf Nantucket eintreffen. Dabney ging es gar nicht gut – sie hatte Schmerzen im Unterleib und im Rücken, und sie war erschöpft. Also hatte sie obendrein wahrscheinlich eine Borreliose!
Dabney packte diese Mischung aus Gegebenheiten an, wie sie in den vergangenen achtundvierzig Jahren alles angepackt hatte, nämlich nach dem Motto: Ruhe bewahren. Als Erstes rief sie in Ted Fields Praxis an, um für Montagvormittag einen Termin zu vereinbaren. Ted Field, der Arzt auf der Insel, war ungeheuer beliebt und immer überbucht. Doch Dabney wusste, dass sie einen Termin bekommen würde, weil sie Ted Fields Sprechstundenhilfe Genevieve Lefebvre vor Jahrzehnten bei ihrer eigenen Hochzeit mit ihrem späteren Ehemann Brian bekannt gemacht hatte (Paar Nr. 17). Sie waren seit zweiundzwanzig Jahren verheiratet und hatten fünf Töchter.
»Was ist los?«, fragte Genevieve. »Bist du krank?«
»Nicht so richtig«, sagte Dabney. »Vielleicht Borreliose. Vielleicht das Alter.«
»Ach, sei still. Du siehst noch genauso aus wie mit siebzehn. Um neun Uhr würde es passen.«
Nachdem das erledigt war, ging es Dabney geringfügig besser. Vielleicht Borreliose. Vielleicht einfach Stress.
Sie schaffte es, die Zähne zusammenzubeißen und den Rest des Tages zu bewältigen. Sie begrüßte CJ herzlich und schickte ihn und Agnes dann los, um den Narzissenteppich und den Narzissenkranz abzuholen, die den Impala bei der Oldtimerparade am nächsten Tag schmücken sollten. Sie rief Nina an und entschuldigte sich dafür, dass sie im Büro so unbeherrscht gewesen war und sie unnötig angeblafft hatte.
(Als Dabney ohne einen Erdbeer-Frappé aus der Pharmacy in die Handelskammer zurückgekehrt war, hatte Nina sie verwirrt angeblinzelt. »Wo bist du denn gewesen?«
Und Dabney hatte gesagt: »Du brauchst eine Brille, Nina.«
Nina war zurückgeschreckt, als hätte Dabney ihr mit der Zeitung einen Klaps auf die Nase versetzt, und Dabney hatte sich gefühlt wie eine schreckliche Zicke.)
Jetzt sagte Dabney: »Mir geht es wirklich nicht gut. Ich glaube, ich brüte was aus.«
»Ruh dich aus heute Abend, meine Liebe«, sagte Nina. »Morgen ist Showtime.«
Dabney traf die letzten Vorbereitungen für das Büfett am nächsten Tag, obwohl das meiste dafür schon fertig war. Sie machte jedes Jahr dasselbe, weil es am Narzissenwochenende genau wie zu Thanksgiving und zu Weihnachten besonders um Tradition ging. Die Schichtsandwiches waren Glanzpunkt ihres Angebots – Weißbrot ohne Kruste mit einer Schicht Eiersalat (gelb), einer Schicht Lauchfrischkäse (grün) und einer Schicht Maraschinokirschfrischkäse (rosa). Agnes und Box zogen sie sowohl damit auf, dass sie Schichtsandwiches machte, als auch damit, dass sie ihr gut schmeckten. Das sei doch Küche für weiße angelsächsische Protestanten in Reinkultur, sagten sie. Warum servierte sie keine Vollkorncracker mit Velveta, wenn sie schon dabei war? Oder eingelegten Blumenkohl? Dabney ignorierte ihren Spott; dank der Aversion der beiden blieben einfach mehr Schichtsandwiches für sie selbst übrig und für Peter Genevra, Chef des Wasserwerks, der jedes Jahr zu ihrem Stand kam, um ein halbes Dutzend davon zu verschlingen.
Dabney machte außerdem einen mit Bourbon glasierten, fächerförmig aufgeschnittenen Schinken, einen Honig-Curry-Brotzopf, pochierten Spargel mit Sauce hollandaise und einen Tortellinisalat mit Kräutermayonnaise. Zitronentörtchen würde sie aus dem Nantucket Bake Shop mitbringen. Für sich und Agnes kaufte sie eine Flasche Champagner, für Box einen guten weißen Bordeaux und einen Zwölferpack Bier für alle, die ihren Stand aufsuchten.
Während Dabney die Kruste vom Weißbrot abschnitt, trat Box in die Küche. Er war am Morgen nach Hause gekommen, während sie bei der Arbeit war; sie hatte ihn seit Montag früh um 7 Uhr, als sie ihn am Flughafen abgesetzt hatte, wie sie es jeden Montag tat, nicht gesehen.
»Hallo, Liebes«, sagte er und küsste sie keusch auf die Wange. Allein seine Begrüßung zeigte, wie es zwischen ihnen zuging – angenehm, zivilisiert, sexlos. Er nannte sie »Liebling«, gelegentlich »Liebes«. Zu Beginn ihrer Beziehung und ihrer Ehe hatte Dabney den Donnerstagnachmittag gar nicht abwarten können, denn damals verließ Box Harvard um drei, wenn der letzte Unterricht vorbei war, und oft schaffte er es bis um fünf auf die Insel. Dann holte Dabney ihn vom Flughafen oder von der Fähre ab, und sie beeilten sich, damit sie schnell zu Hause waren und sich lieben konnten. Jetzt übernachtete Box donnerstags in seiner Professorenwohnung. Er arbeitete bis um sieben oder acht und ging dann mit Kollegen essen. Immer wieder versuchte er, Dabney zu überreden, donnerstagabends nach Cambridge zu kommen. Es gebe so viele neue Restaurants, und sie könnten eine Lesung oder ein Konzert besuchen. Aber Dabney lehnte jedes Mal ab. Box wusste, Dabney zu bitten, dass sie nach Cambridge kam, war dasselbe wie sie aufzufordern, ohne Sauerstoffflasche mit ihm im Marianengraben zu tauchen. Sie war fest davon überzeugt, dass sie es schlichtweg nicht überleben würde.
Mit der Zeit bekam Box ihre Weigerung zu reisen satt, und Dabney nervten seine ständigen Überredungsversuche. Ich habe nie vorgegeben, jemand anders zu sein!, hatte sie ihn vor ein paar Jahren angeschrien, und das hatte sie beide erschreckt. Ihre Ehe war keine, in der Emotionen hochkochten – und so wurde von da an nicht mehr darüber diskutiert. Box blieb am Donnerstagabend in Cambridge und Dabney auf Nantucket.
Jetzt fragte Dabney wie üblich: »Wie war deine Woche?«
»Gut«, sagte Box. »Mein türkischer Lektor hat angerufen. Sie bringen die neue Ausgabe raus.«
»Wunderbar«, sagte Dabney. Box war nicht nur Inhaber eines Stiftungslehrstuhls, sondern auch Verfasser eines Lehrbuchs über Makroökonomie, das von über vierhundert Universitäten im ganzen Land benutzt wurde. Außerdem war es in vierundzwanzig Sprachen übersetzt worden. Box aktualisierte es alle drei Jahre; die Höhe seines dadurch generierten Einkommens war schwindelerregend. Box verdiente zwischen drei und vier Millionen Dollar pro Jahr an dem Lehrbuch; das Gehalt, das er in Harvard bezog, betrug dagegen nur dreihunderttausend. Aber Geld bedeutete Box wenig und Dabney noch weniger, abgesehen davon, dass sie sich deshalb nie Sorgen machen mussten. Das Haus in der Charter Street war in allen Teilen historisch erhalten, und sie hatten es langsam und umsichtig mit Antiquitäten und Kunst gefüllt. Agnes würde es erben. Dabney war stolze Besitzerin eines tomatenroten Chevy Impala von 1966 mit weißem Vinyl-Verdeck, der mehr oder weniger ein Groschengrab war, aber sie hielt ihn in Ehren. Box fuhr auf Nantucket einen zerbeulten Jeep Wrangler und auf dem Festland einen Audi RS 4. Urlaub machten sie wegen Dabney nie; allerdings verbrachte Box jedes Jahr zwei Wochen in London, um dort an der School of Economics zu unterrichten, und im November nahm er an einer Konferenz mit wechselnden Standorten teil – San Diego, Amsterdam, Honolulu. Hunderttausend Dollar pro Jahr spendeten sie anonym dem Morningside Heights Boys & Girls Club, wo Agnes arbeitete, und hunderttausend dem Nantucket Cottage Hospital. Weitere größere Ausgaben hatten sie nicht.
Dabney fragte sich, ob Clendenin Hughes wusste, dass sie einen gefeierten und geachteten Wirtschaftswissenschaftler geheiratet hatte. Sie vermutete es. Heutzutage konnte man über das Internet alles herausfinden. War Clen eifersüchtig? Natürlich hatte Clen einen Pulitzerpreis gewonnen; das hatte Dabney in den Ehemaligen-Meldungen ihres Highschool-Newsletters gelesen. Stolz war in ihr aufgewallt, gefolgt von Verärgerung. Bei dem, was er aufgegeben hat, musste es auch der Pulitzer sein!, hatte sie gedacht.
Sie wollte nicht mehr an Clendenin Hughes denken.
»Und wie war deine Woche?«, fragte Box. »Ich nehme an, du bist schon ganz aufgeregt wegen des Festes. Also, was genau steht auf dem Programm?«
»Heute Abend Essen im Club Car«, sagte Dabney. »Ich habe für zwei reserviert, aber das werden wir auf vier erweitern müssen, weil Agnes und CJ hier sind.« Sie hielt inne und dachte daran, wie Box und CJ sich um die Rechnung streiten würden. Das war auch so eine Sache bei CJ: Er musste immer für alles bezahlen, sonst wurde er ausgesprochen unwirsch. »Morgen Oldtimerparade um zwölf, Picknick um eins.«
»Erschöpft zusammenbrechen um fünf«, sagte Box.
»Ich habe am Montagmorgen um neun einen Termin bei Ted Field«, sagte Dabney.
»Ach ja?«, fragte Box. »Geht es dir denn nicht gut?«
Dabney starrte auf die perfekten Weißbrotvierecke auf dem Schnittbrett. Diese Vierecke repräsentierten ihr Leben – beziehungsweise das, was ihr Leben vor der Ankunft der E-Mail heute Morgen gewesen war. »Nein, nicht gut«, bestätigte sie. »Borreliose vielleicht.«
»Hat dich eine Zecke erwischt?«
»Nicht dass ich wüsste«, sagte Dabney. Zum letzten Mal in den Mooren herumgelaufen war sie vergangenen Herbst mit ihrem Hund Henry. Schon beim Gedanken an ihn kamen Dabney die Tränen.
»Es sieht dir gar nicht ähnlich, krank zu werden«, sagte Box. »Ich weiß nicht mal, wann du zuletzt erkältet warst.«
»Ich auch nicht«, sagte Dabney. Ihre Stimme klang weinerlich. Es sah ihr auch nicht ähnlich, sich dramatisch oder gefühlsselig zu gebärden. Sie wusste, dass Box das Unbehagen verursachte.
»Ich würde ja anbieten, am Montag hierzubleiben«, sagte Box. »Aber …«
»Du kannst nicht«, ergänzte Dabney. Montags um eins hielt Box für sechs handverlesene Studenten ein Seminar über Tobin ab; es war seine Lieblingsveranstaltung.
»Vielleicht könnte ich Miranda bitten einzuspringen«, sagte Box.
Ach ja, Miranda. Das fünfunddreißigjährige australische Ökonomie-Wunderkind Miranda Gilbert mit der Bibliothekarinnenbrille und dem bezaubernden Akzent. Sie war seit vier Jahren Box’ Assistentin. Dabney war immer ein bisschen eifersüchtig auf Miranda gewesen. Doch Box würde vor Dabney nie Geheimnisse haben wie sie jetzt vor ihm. Sie sollte ihm einfach sagen: Clendenin Hughes trifft morgen auf Nantucket ein. Na und? Es ihm nicht zu erzählen machte es wichtiger, als es eigentlich war, ließ es aussehen, als ob es Dabney etwas bedeutete.
Es bedeutete ihr etwas.
»Wie geht’s Miranda?«, fragte sie.
»Miranda?« Box angelte sich eine Maraschinokirsche aus dem Glas, aß sie und zog eine Grimasse. »Gut. Dr. Bartelby plant wohl, ihr demnächst einen Antrag zu machen.«
Dr. Bartelby, Mirandas Freund (mit Vornamen hieß er Christian), war Internist am Mass General. Er und Miranda hatten die Beeches in den letzten drei Sommern auf Nantucket besucht. »Er hat ihr gesagt, dass er einen Antrag plant? Das verdirbt ja den ganzen Spaß.«
»Ich weiß nicht genau, wie das heutzutage vor sich geht«, sagte Box. »Jedenfalls glaube ich, dass Miranda in Kürze zu den Verheirateten gehört.«
Ein Schwindelanfall überkam Dabney, und sie stützte sich auf die Theke.
»Alles in Ordnung?«, fragte Box. Er legte ihr eine Hand aufs Kreuz, doch sogar diese leichte Berührung tat weh.
Dabney musste mit den Schichtsandwiches fertig werden, bevor das Brot austrocknete. Und sie musste den Spargel putzen und pochieren. Agnes und CJ würden bald mit den Narzissen für den Wagen hier sein. Am Freitagabend den Impala zu schmücken war immer eine von Dabneys Lieblingstätigkeiten am Narzissen-Wochenende gewesen. Aber jetzt schaffte sie es nur noch, durch die Küche in die Bibliothek zu taumeln, wo sie sich aufs Sofa fallen ließ. Box deckte sie mit einer Wolldecke zu, gehäkelt von ihrer geliebten Oma, der ersten Agnes Bernadette. Dabney hatte das Gefühl, gleich sterben zu müssen.
Ruhe bewahren: Ihre Vorfahren hatten viel Schlimmeres ertragen, das wusste Dabney. Ihre Urururgroßmutter Dabney Margaret Wright war aus Beacon Hill, wo sie ihr Heim, ihre Möbel, die gehobene Gesellschaft zurückgelassen hatte, nach Nantucket gekommen. Sie und ihre drei Söhne waren in ein Haus in der Lily Street gezogen, während Warren lossegelte, um Wale zu jagen. Beim ersten Mal war er achtzehn Monate unterwegs, dann sechs Monate zu Hause – und von seiner zweiten Fahrt kehrte er nie zurück. Dabney Wright hatte das Beste aus der tragischen Situation gemacht: Sie war der Gemeinde der Summer Street Church beigetreten und hatte sich mit anderen Frauen angefreundet, die durch das Meer Witwen geworden waren. Sie hatte sich nicht beklagt, zumindest nicht in Dabneys Fantasie. Sie hatte es gefasst hingenommen.
Und auch Dabney würde stark bleiben. Als sie sich von ihrem Anfall erholt hatte, stapelte sie die Schichtsandwiches und wickelte sie in Wachspapier. Sie pochierte den Spargel. Agnes und CJ übernahmen das Dekorieren des Impala mit den Narzissen. Dabney duschte und zog ihr marineblau-gelbes Wickelkleid von Diane von Furstenberg an. Es war eins von den Kleidern, die Patty Benson in ihrem Schrank hatte hängen lassen, als sie Ehemann und Tochter verließ. Dabney hegte keine sentimentalen Gefühle für Gegenstände, zumindest nicht in diesem Fall. Sie trug die Kleider ihrer Mutter oft, weil sie ihr gefielen und ihr passten.
Dabney gab sich alle Mühe beim Abendessen im Club Car, obwohl sie lieber mit einem Teller Suppe und einem Jane-Austen-Roman im Bett gesessen hätte. So bestellte sie Lammkoteletts, was sie hier immer tat, und Box wählte dazu einen hervorragenden australischen Shiraz. Nach einem Schluck Wein drehte sich in Dabneys Kopf alles.
»Wisst ihr, Box hat in Harvard unterrichtet, als ich dort Studentin war, aber ich habe nie eine seiner Veranstaltungen besucht.«
Agnes starrte ihre Mutter an. Sie hatte den Krabbenpuffer bestellt, aber noch keinen Bissen davon genommen. »Ja, Mommy, das wissen wir.«
CJ lächelte Dabney an. Er trug einen marineblauen Blazer und ein üppig gemustertes Hemd. Bevor sie von zu Hause aufgebrochen waren, hatte Box CJs schokoladenbraune Gucci-Slipper bewundert und zu Dabney gesagt: »So ein Paar solltest du mir auch besorgen!« Dabney musste einräumen, dass CJ eine gute Figur abgab, dass er angenehm roch und einen schönen Schopf welliger grau-schwarz gesprenkelter Haare hatte und gerade weiße Zähne. Zu weiß, als ob sie womöglich gebleicht waren. Aber das war kein Grund, den Mann nicht zu mögen. CJ hatte auch die Lammkoteletts bestellt, medium rare, genau wie Dabney, und das erinnerte sie an einen Abend im September, als er ebenfalls dasselbe genommen hatte wie sie. Es war, als versuchte er, sie zu imitieren, damit er ihre Zustimmung fand.
»Wenn ich mich recht erinnere, war Ihr Hauptfach Kunstgeschichte?«, sagte CJ. »Sie haben Ihre Abschlussarbeit über Matisse geschrieben?«
»Wir haben unseren Hund Henry nach ihm benannt«, sagte Agnes leise.
CJ, der sich nichts aus Hunden machte (»zu schmutzig«), reagierte nicht darauf. Zu Dabney sagte er: »Sie sollten sich die Matisse-Kapelle in Vence anschauen.«
Es war unwahrscheinlich, dass Dabney es je bis nach Frankreich schaffen würde, doch sie musste ihm Anerkennung für seine Mühe zollen.
»Mein Lieblingsgemälde von ihm ist La Danse«, sagte sie. »Es hängt im MOMA, aber ich habe es noch nie gesehen.«
»Der Direktor des MOMA ist ein Freund von mir«, entgegnete CJ. »Sollten Sie also jemals beschließen, nach New York zu kommen, kann ich etwas arrangieren.«
Dabney trank ihren Wein. Die Lammkoteletts rührte sie nicht an. Sie hatte absolut keinen Appetit.
Sie stellte sich vor, dass Clendenin Hughes ins Club Car kam, sich Dabney über die Schulter warf und sie hinaustrug. Dann schwelgte sie in einem Moment tiefsten Selbstmitleids. Sie hatte ein ruhiges und friedliches, ein glückliches und produktives Leben geführt – bis heute Morgen.
Sie trank ihren Wein.
Zwischen Hauptgang und Dessert wurde Champagner an den Tisch gebracht, und nicht einfach Champagner, sondern eine Flasche Roederer Cristal. Dabney blinzelte. Agnes und sie selbst liebten Champagner, aber Box bekam Kopfschmerzen davon und hätte, reich, wie er war, nie dreihundert Dollar für eine Flasche Roederer Cristal ausgegeben.
Sie alle saßen schweigend da, während die Bedienung die Flasche entkorkte und vier Gläser füllte. Dabney war verwirrt. Sie warf ihrer Kellnerin – einer streng aussehenden Frau in weißer Smokingjacke – einen flehenden Blick zu, doch deren Gesichtsausdruck war unergründlich wie der der Wachen am Buckingham Palace.
Plötzlich räusperte sich CJ, stand auf und erhob sein Glas. »Agnes und ich haben etwas zu verkünden.«
Oh nein, dachte Dabney. Neinneinneinneinneinneinnein.
Agnes lächelte schüchtern und hob die linke Hand, sodass Dabney den Diamantring – von Tiffany natürlich – in all seiner funkelnden Pracht sehen konnte. Sie rang sich eine glückliche, erfreute Miene ab.
»Agnes hat eingewilligt, meine Frau zu werden«, sagte CJ.
Dabney entwich ein Schrei des Entsetzens, den die anderen als Entzücken missdeuteten. Sie allein nahm den grünen Nebel wahr, der Agnes und CJ umwaberte wie Giftgas.
»Das ist ja wundervoll!«, sagte Dabney.
Box stand auf, um erst Agnes und dann CJ zu umarmen, und Dabney, die wusste, dass dies die angemessene Reaktion war, folgte seinem Beispiel. Sie ergriff Agnes’ Hand – dieselbe Hand, mit der Agnes im Kindergarten Ton geknetet, die sie abgeklatscht hatte, als Agnes beim College-Eignungstest 1400 Punkte erzielt hatte – und bewunderte den Ring.
»Was für ein wunderschöner Ring!«, sagte sie. Das zumindest war ehrlich gemeint. Hier hatte CJ den Nagel auf den Kopf getroffen – der Ring war schlicht, klassisch, zeitlos, der Stein riesig. Dabney schätzte ihn auf zwei Karat, jedenfalls annähernd.
Aber der gespenstisch-grüne Nebel, der Agnes einhüllte, konnte nur auf eine künftige Katastrophe hinweisen – CJ würde Agnes mit einer der Giants-Cheerleaderinnen oder einer Praktikantin in seinem Büro betrügen. Oder Schlimmeres. Dabney würde nicht tatenlos abwarten. Sie würde irgendwie eine Möglichkeit finden, ihre Tochter zu retten.
Am Samstagmorgen fühlte sich Dabney dank zu viel Shiraz, der grauenhaften Nachricht von »der Verlobung« und Clens bevorstehender Ankunft noch schlechter als sonst. Trotzdem warf sie sich in ihr übliches Outfit für die Narzissenparade – gelbe Hemdbluse, Jeans, marineblauer Blazer, Penny Loafers und Strohhut mit marineblauem geripptem Seidenband. Sie griff sich ihr Klemmbrett mit der Liste der hundertzwanzig Teilnehmer des Oldtimerkorsos. Die Sonne schien, die Luft war tatsächlich mild; Dabney war zu warm in ihrem Blazer, und sie erwog, ihn auszuziehen, aber sie wusste, dass es kühl werden würde, wenn sie auf der Fahrt nach Sconset bei offenem Verdeck in ihrem Impala saß.
Auf der Main Street wimmelte es von festlich gestimmten Menschen. Alle trugen Gelb und Grün, um die drei Millionen Narzissen zu feiern, die auf Nantucket wuchsen. Kinder hatten sich Narzissen aufs Gesicht gemalt und Narzissengirlanden um die Lenkstangen ihrer Räder geschlungen. Hunde trugen Halsbänder aus Narzissen. Jede einzelne Person schien sich Dabneys Aufmerksamkeit zu wünschen. In den vergangenen Jahren hatte sie die Situation mit Würde und Selbstbewusstsein gemeistert. Es hatte ihr gefallen, alle zu kennen und allen bekannt zu sein. Sie hatte Scherzworte mit dem Gemeindedirektor gewechselt, dem Müllentsorger, der Inhaberin des Buchladens, der Besitzerin des Dessousgeschäftes, mit Andrea Kapenash, die mit dem Polizeichef verheiratet war, mit Mr Berber, der in der fünften Klasse Agnes’ Lieblingslehrer gewesen war, mit einem Sommergast, der im Verwaltungsrat der New Yorker Börse saß, und einem weiteren Sommergast, Chefsprecher der Sechs-Uhr-Nachrichten in Boston. Ein Querschnitt der Menschheit, der eines gemeinsam hatte … sie alle liebten die Insel Nantucket. Doch dabei stand Dabney unstrittig an vorderster Stelle. Sie liebte Nantucket mehr, als irgendjemand es je geliebt hatte. Sie wusste, dass ihre Ergebenheit ungewöhnlich war, vielleicht sogar ungesund, doch an einem Tag wie heute machte das nichts. Heute war sie unter Gleichgesinnten.
Dabney plauderte mit jedem, der ihren Weg kreuzte, hatte aber das Gefühl, mit einer automatisierten Stimme zu sprechen wie der, die sich nach Büroschluss auf der Mailbox der Handelskammer meldete. Ja, das Wetter war herrlich, nein, sie konnte sich an keinen schöneren Tag erinnern, nein, sie fasste es auch nicht, dass schon wieder ein Jahr vergangen war, ja, sie war bereit für den Sommer, sie war immer bereit für den Sommer. Wie nett, Sie zu sehen, sagte sie, aber ihre Stimme klirrte wie Falschgeld. War das für alle hörbar? Dabney hätte am liebsten jemanden am Arm gepackt – und wenn es der Nachrichtensprecher gewesen wäre – und ihm ihr Herz ausgeschüttet. Es geht mir gar nicht gut, irgendwas stimmt nicht mit mir, Clendenin Hughes kommt heute zurück nach Nantucket, vielleicht ist er sogar schon hier bei uns, und mein Mann weiß es nicht. Meine Tochter hat gestern Abend verkündet, dass sie mit einem Mann verlobt ist, der die Wiederkunft des Herrn zu verkörpern scheint, und ich allein weiß, dass er nicht zu ihr passt. Und es gibt nichts, was ich tun oder sagen kann. Hier bin ich, die Inselkupplerin, vorgeblich Expertin in Sachen Liebe, und doch dröselt sich mein Leben auf. Nichts ist so, wie es sein sollte.
Können Sie helfen? Können Sie mir helfen?
Dabney stieß mit Vaughan Oglethorpe zusammen, dem Verwaltungsratsvorsitzenden der Kammer, ihrem Boss,