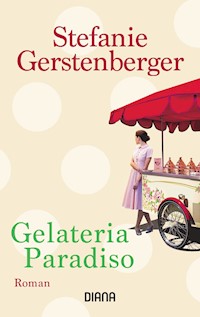9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Eine unmögliche Liebe, so besonders wie das Leben
Nicola kommt mit einem Lächeln zur Welt. Als Wunschkind seiner Eltern wächst er in einem kleinen Fischerdorf bei Palermo ärmlich, aber behütet auf. Stella hingegen, am selben Tag im selben Ort geboren, wird von ihrer Mutter keines Blickes gewürdigt. Die schöne Adlige hat wenig Verwendung für ein drittes Mädchen. So könnten Stella und Nicola nicht unterschiedlicher sein, und es vergehen Jahre, bis sich ihre Wege kreuzen. Doch diese Begegnung wird ihr Leben für immer verändern …
Die Bestsellerautorin Stefanie Gerstenberger erzählt in ihrem neuen Roman eine sizilianische Familiengeschichte über drei Generationen hinweg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 749
Ähnliche
Zum Buch
Nicola kommt mit einem Lächeln zur Welt. Als Wunschkind seiner Eltern wächst er in einem kleinen Fischerdorf bei Palermo ärmlich, aber behütet auf. Stella hingegen, am selben Tag im selben Ort geboren, wird von ihrer Mutter keines Blickes gewürdigt. Die schöne Adlige hat wenig Verwendung für ein drittes Mädchen. So könnten Stella und Nicola nicht unterschiedlicher sein, und es vergehen Jahre, bis sich ihre Wege kreuzen. Doch diese Begegnung wird ihr Leben für immer verändern …
Der neue Roman von Bestsellerautorin Stefanie Gerstenberger erzählt eine sizilianische Familiengeschichte über drei Generationen hinweg.
Zur Autorin
Stefanie Gerstenberger, 1965 in Osnabrück geboren, studierte Deutsch und Sport. Sie wechselte ins Hotelfach, lebte und arbeitete u. a. auf Elba und Sizilien. Nach einigen Jahren als Requisiteurin für Film und Fernsehen begann sie zu schreiben. Ihr erster Roman Das Limonenhaus wurde von der Presse hoch gelobt und auf Anhieb ein Bestseller, gefolgt von Magdalenas Garten, Oleanderregen und Orangenmond. Ihre Romane wurden für den DeLiA-Literaturpreis nominiert, die Autorin lebt mit ihrer Familie in Köln.
STEFANIE
GERSTENBERGER
Das Sternenboot
Roman
Für Enzo.
Alle, die mir von dir erzählten,
haben dich unglaublich geliebt.
Und nun liebe auch ich dich …
Ad Enzo.
Ogni persona che ho incontrato
e mi ha parlato di te,
ti aveva infinitamente amato.
Oggi, ti amo anch’io …
1
Dies wäre ein guter Moment, um zu sterben, dachte Flora, während ihr die Tränen über die Wangen liefen. Die Zeit stand einen Moment lang still, wie um den Augenblick zu würdigen, dann zog die Hebamme Concettina mit einem Ruck den blauen Vorhang auf. Das sanfte Rosa der Morgendämmerung drang in den Raum. Flora weinte immer noch. Sie lag in einer warmen, klebrigen Lache, wahrscheinlich Blut, sie hatte nicht nachgeschaut. Ihre Oberschenkel zitterten von der Anstrengung der vorangegangenen Stunde. Es war vorbei. Ab und an fuhr noch ein Echo des Schmerzes durch sie hindurch und sammelte sich krampfend in ihrem Unterleib. Sie sah, wie die Wände immer heller wurden und die Farben mit dem Tageslicht zurückkehrten. Sie hatte diese Zeit am frühen Morgen schon immer geliebt. Aus dem Radio von Signora Mantelli war Klaviermusik zu hören. Die dunklen Töne drangen aus dem Erdgeschoss durch das offene Fenster und verklangen allmählich im langsamen Rhythmus des Stücks. Die Tränen liefen weiter an Floras Schläfen entlang, hinunter in ihr verschwitztes dunkles Haar. Wenn man so glücklich ist, muss sterben ganz leicht sein, ging ihr durch den Kopf.
»Ah, das Bett, das gute Bett, die guten Matratzen …«, murrte die Hebamme und strich sich die wenigen grauen Haare auf dem Kopf glatt. »Warum hast du mich nicht früher gerufen? Da wäre noch Zeit gewesen, dich auf den Tisch in der Küche zu packen …«
Doch Flora nahm nur die Nachbarinnen Pia und Ada wahr, die sich mit leisen Schritten um sie herum bewegten. Mitten in der Nacht hatten die Frauen Tommaso in der Küche umhergehen hören, vor Aufregung war ihm irgendetwas aus der Hand gefallen und zerbrochen. Sie hatten sofort gewusst, dass es so weit war, hatten Mann und Kinder schlafend in den Betten zurückgelassen und waren zu Flora hinübergeeilt. Während Tommaso loslief, um die Hebamme zu holen, waren sie bei ihr geblieben, um ihr den Schweiß abzutupfen, die trockenen Lippen mit Zitronenwasser zu befeuchten und die Hand zu halten. Flora mochte die beiden, sie waren jung und neugierig wie sie selbst, unter ihnen gab es keine Missgunst, dafür häufig etwas zu lachen. Pia kam nun mit einer Schüssel und wusch Floras Unterleib sanft mit warmem Wasser. Ada breitete ein Tuch unter ihr aus und wechselte das Laken so geschickt, dass Flora kaum ihren Körper anheben musste. Flora lächelte. An diesen Augenblick, in dem ihr Sohn mit einem letzten warmen Schwall aus ihr herausgeglitten war, würde sie sich bis an ihr Lebensende erinnern. Sie hatte es nicht nur überlebt, sie hatte es auch noch besonders gut und richtig zu Ende gebracht!
Die Tränen liefen immer noch, doch Flora schämte sich nicht mehr für den salzigen Strom, der von einem Schluchzen, das beinahe nach Lachen klang, begleitet wurde. Concettina tätschelte Floras Schulter, sie hatte schon viele Frauen weinen sehen, die gerade geboren hatten.
»Es ist das Glück, das ihr aus den Augen strömt«, sagte sie zu den Frauen, während sie die Plazenta vor das Fenster hielt, um zufrieden festzustellen, dass nicht das winzigste Stück in Floras Bauch zurückgeblieben war.
»Was hast du gesagt, wo ist ihre Mutter?«, raunte sie Ada zu. »Und was ist mit der Schwiegermutter? Die sind doch immer die Ersten, die sich Wochen vorher einquartieren …«
»Soviel ich weiß, sind beide noch in Mistretta, wahrscheinlich sehnsüchtig wartend, mit gepackten Koffern«, tuschelte Ada zurück. »Flora hat ihnen nicht den richtigen Termin verraten wollen, hat um einen Monat getrickst …«
»Aber was für ein Drama ist denn da passiert?« Die Hebamme schüttelte den Kopf. Bei den Schwiegermüttern verstand man das ja noch, aber die eigene Mutter nicht dabeihaben zu wollen? »Haben sie Streit? Es war doch nicht etwa eine fuitina!«
»Nein! Sie sind nicht heimlich durchgebrannt. Schaut doch!« Mit einem Stolz, als ob sie ihr selbst gehörten, wies Ada auf die dunkelbraunen schweren Möbel, die das Schlafzimmer beherrschten. Eine wuchtige Kommode, ein metallenes Kopfteil am Bett, ein Schrank, der die ganze Wand einnahm und das wenige Licht schluckte. »Sie ist die einzige Tochter, sie hätte sich doch um ihre Aussteuer gebracht. Nein, nein, sie hat bekommen, was sie wollte. Die Hochzeit, die Möbel, den Mann!« Ada seufzte, wie immer, wenn sie an ihren Nachbarn Tommaso Messina dachte. Diese Augen! Die Vorhänge, die Flora für das Schlafzimmer genäht hatte, hatten genau dieselbe Farbe. Wie das Meer an einem dieser typischen Tage im Mai, wenn das Wetter umschlägt und der Sommer endlich kommt.
»Sie hat Glück, dieses kleine Frauchen aus den Bergen«, murmelte die Hebamme Concettina jetzt. Die Nachbarinnen nickten eifrig. Wirft beim ersten Kind so leicht wie eine Kuh ihr zehntes Kalb, fuhr Concettina in Gedanken fort. Ein paar Presswehen, und schon war er da. Und dann noch ein so bildschöner Junge! Die meisten Neugeborenen sind verknautscht wie ein Laken, das man nicht rechtzeitig zum Trocknen aufgehängt hat. Sie sind rot und fleckig, haben hängende, griesgrämige Bäckchen und geschwollene Augenschlitze, die sie nicht öffnen wollen. Aber dieses hier … Weißt du überhaupt, wie gesegnet du bist, Frau aus Mistretta?
Die Hebamme legte den Mutterkuchen in eine Schüssel aus Emaille und deckte ihn mit einem Tuch zu. Die alte Anna würde ihr ein hübsches Sümmchen dafür geben, ihn dann auswaschen und aus dem Blut verschiedene Heiltränke, Tropfen und Tinkturen herstellen.
Es war tatsächlich keine schwere Geburt gewesen, kaum zwei Stunden hatte Flora gebraucht, um ihr erstes Kind ans Licht der Welt zu pressen. Die Vorwehen hatte sie im Schlaf hinter sich gebracht. Sie hatte geträumt, in einer Backstube zu stehen. Es war wohlig warm, und sie war der Ofen, in dem die Leute ihre Brote backen ließen. Ihr Bauch zog und schmerzte, nicht übermäßig, aber doch spürbar, und immer wieder kam jemand an, öffnete ihren Bauch mit einer kleinen Tür, die seltsamerweise darin eingelassen war, und legte einen Laib Brot hinein. Sie erwachte in dem Augenblick, als die Fruchtblase platzte und das Bett durchnässte. Sie hatte sich so geschämt! Mein Gott, sie hatte ins Bett gemacht. Warum war das passiert? Warum hatte sie das Wasser nicht halten können? Mit einem Handtuch zwischen den Beinen versuchte sie, wieder einzuschlafen, und hoffte, dass Tommaso nichts merkte. Gleich am Morgen würde sie das Bett frisch beziehen. Doch dann wurden die Schmerzen immer stärker, bohrten in ihrem Rücken, bis sie unerträglich wurden und sie laut aufschrie. Tommaso fuhr hoch, als ob ihn jemand mit der Pistole bedrohte. Plötzlich war der Schmerz wieder weg. Flora lächelte, während sie stöhnend aufatmete. »Ich weiß nicht, aber ich glaube, du musst die Hebamme holen.«
Kleines, starrköpfiges Ding, hast so lange gewartet, mich zu rufen, dass es dann zu spät war, dich auf den großen Tisch in der Küche zu legen, dachte Concettina weiter, jetzt sind die obersten zwei der vier Matratzen dahin, und dein Mann wird euch neue kaufen müssen. Die billigen, gefüllt mit Maisblättern, werden es sein. Sie ließ den Blick durch das Zimmer schweifen. Außer den massiven teuren Möbeln gab es vermutlich nichts Wertvolles in diesem Haus, doch etwas Heiteres lag zwischen den kargen Mauern und durchdrang alles darin, man meinte es beinahe greifen zu können.
Es kam sehr selten vor, dass Concettina in den Wohnungen, in die sie gerufen wurde, ein solches Ausmaß von Glück und Zufriedenheit wahrnahm. Egal, ob bei den Armen oder den Reichen. Wenn, dann konnte sie manchmal den Respekt der Ehepartner füreinander spüren, die meistens von den Eltern oder Verwandten ausgewählt worden waren.
Nachdem die Nachbarin Flora behutsam ein frisches Nachthemd übergestreift hatte, deckte Concettina sie mit einem sauberen Laken zu, legte den gewaschenen und stramm in ein Tuch gewickelten Jungen neben die Wöchnerin auf das Kissen und holte dann den Vater herein. Tommaso betrat zögernd und voller Ehrfurcht das kleine Zimmer. Die drei Frauen hielten in ihrer jeweiligen Tätigkeit inne. Sie wollten sehen, wie er seinem Erstgeborenen begegnete. Die Uniform der Carabinieri, die er für den Frühdienst in der Kaserne an der Via Fontana trug, glänzte in sattem Dunkelblau. Auch Floras Blick hing zwei Jahre nach der Hochzeit immer noch hingerissen an ihrem Mann. Er war zehn Jahre älter als sie, hochgewachsen, mit ernstem Gesicht zwar, aber leuchtend blauen Augen und einem leicht belustigten Zug um den Mund. Tommaso beugte sich über das hohe Bett, er küsste Flora nicht, das würde sich unter den Augen von Hebamme und Nachbarinnen selbst nach einer Geburt nicht schicken.
Er war noch immer verliebt in sie, wie in dem Moment, als sie ihm vor fünf Jahren in Mistretta, hoch in den Bergen der Madonie, aus Versehen in die Arme gelaufen war. Er war auf Urlaub von der Armee gekommen, und das kleine Mädchen, die freche Tochter des Kioskbesitzers, war plötzlich eine junge Frau. Zwar nicht sehr groß, doch mit was für einem tiefgründigen, lebenshungrigen Blick und was für einem Mund! Ach, er war immer noch ganz verrückt nach ihren weichen Lippen und ihrem sinnlich runden Körper.
Die Hebamme schnaufte. Tommaso wusste, dass diese in die Breite gegangene Alte genau mitbekam, was sich in den Häusern, in die sie gerufen wurde, abspielte, und alles, was sie hier sah, weitertratschen würde. Sollte sie doch! Er flüsterte seiner Frau ein zärtliches »Amore mio!« zu. Erst dann besah er sich seinen neugeborenen Sohn.
Dieses Wunder, hervorgegangen aus ihnen beiden, aus einer ihrer herrlichen Liebesnächte – oder war es an einem dieser Vormittage gewesen, als er sich einfach nicht hatte beherrschen können? Es kam ihm vor, als hätten sie in den vergangenen zwei Jahren, seitdem sie von Mistretta weggegangen waren, um hier in Bellaforte in dieser kleinen Wohnung zu leben, jeden Tag miteinander geschlafen. Flora hatte immer Appetit auf ihn, selbst in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft noch. Er schob die Erinnerung beiseite, er wollte vor seinem Sohn nicht schon wieder an Floras ehemals unschuldige, weiße Brüste denken, noch ohne dieses blaue Netz von Adern, das sie jetzt durchzog. Und ihren auffordernden Blick, der ihm auch in diesem Moment noch die Knie weich machte und etwas in der Hose seiner Uniform zum Leben erweckte. Um seine Verwirrung zu unterdrücken, räusperte er sich, bevor er sagte: »Er hat ja noch die Augen zu!«
Flora lächelte und drehte sich, um ihren Sohn besser betrachten zu können. Mit der Kuppe ihres Zeigefingers strich sie über die feinen Linien der Augenbrauen, zog dem Säugling dann das Tuch aus der Stirn und sog den zarten Geruch ein, den sein Köpfchen verströmte. Er roch süß und sauber, nach frisch geöffneten Erbsenschoten und Karamell. In diesem Moment hob er sein Kinn, als ob er auch ihren Duft aufnehmen wollte, das kleine Näschen streifte Floras Wange. Er hatte sie das erste Mal berührt! Jetzt wusste sie, warum ihre Tränen flossen, dieses Wesen aus ihrem Innersten war ein Teil von ihr, es würde immer an sie geschmiedet sein, würde sie nie mehr verlassen. Sie liebte es jetzt schon mehr als alles, was sie auf dieser Welt besaß. Sogar mehr als ihren Mann. Und das erfüllte sie einen Moment lang mit Sorge und Angst.
»Wie soll er heißen?«, fragte die Hebamme Concettina, ihre Nasenlöcher weiteten sich, und ihr Magen knurrte vernehmlich, denn aus der Küche zog der Geruch von frischem Brot in das Zimmer, das eine weitere Nachbarin gebracht hatte.
»Nicola!«, antwortete Tommaso. »Nach meinem Vater!« Die Nachbarinnen murmelten zustimmend.
»Ja, Nicola Messina!«, wiederholte Flora leise und drückte das Bündel an sich.
Einen Namen für seinen Sohn zu finden war nicht schwer gewesen. Der erstgeborene Sohn wurde nach dem Vater des Mannes genannt, der zweite nach dem Vater der Frau, doch allein den Namen auszusprechen, der seinen Sohn zeit seines Lebens begleiten sollte, hatte Tommasos Erregung wieder beruhigt.
Er öffnete die oberste Kommodenschublade und holte eine Kamera heraus, die unter seltsamen Umständen in seinen Besitz gelangt war. Er hatte sie nicht gestohlen, niemandem abgenommen, nicht unrechtmäßig getauscht oder auf sonstigem Weg illegal erworben. Dennoch widerstrebte es ihm, etwas, das er nicht gekauft hatte, als sein Eigentum zu betrachten. Manchmal dachte er darüber nach, welchem deutschen Soldaten sie wohl einmal gehört hatte, ob er noch lebte, und was passiert war, bevor er sie in dem Zugabteil gefunden hatte, in dem er zusammen mit seinen Kameraden nach Ende der deutschen Besatzung aus der Toskana zurück in die sizilianische Heimat fuhr. Die Kamera lag schwer in seinen Händen, »Leica« stand unten am Boden in das Metallgehäuse eingraviert, darunter noch einige deutsche Worte, die ihm nichts sagten: »Ernst Leitz Wetzlar«. Er würde den Film zu den Gebrüdern Lorenzini in das einzige Fotostudio von Bellaforte bringen, dort, wo alle hingingen, um sich an den besonderen Festtagen fotografieren zu lassen. Schon einmal hatte er einen Film dort hingebracht, den er in Bellafortes Straßen verknipst hatte. Nicht die Leute in ihren besten Kleidern an den Festtagen, dafür aber Plätze und Häuser, ja sogar das Muster der runden Steine auf der Straße, all die Dinge, an denen er täglich vorbeikam. Auch die Menschen auf den Bildern sahen genauso aus, wie er sie kannte. Ein Junge auf einer Bank. Ein Messer- und Scherenschleifer mit seinem Wagen. Eine in Schwarz gehüllte Alte mit einem Regenschirm. Was ein, zwei Jahrhunderte Bestand gehabt hatte, würde sich bald ändern, das ahnte er. Schon der Krieg und die Besatzung der Amerikaner hatten so viel Neues gebracht. Das weiche weiße Brot zum Beispiel, innen wie Watte, das ein unbefriedigendes Gefühl im Mund hinterließ. Oder die ganz anders riechenden, feinen Zigaretten, das dunkelrote, faserige Fleisch in den eckigen Büchsen oder das ciuingam … Chewinggum. Doch ab jetzt würden die flüchtigen Augenblicke, die er festgehalten hatte, nicht mehr vergessen werden. Es ist albern, dachte er, auch die fratelli Lorenzini haben komisch geschaut. Wer bin ich denn schon? Ein Maresciallo in einem kleinen Städtchen am Meer, der viel öfter Akten liest als Verbrechen bekämpft und bestimmt kein großer Künstler ist. Doch ich habe das Alte für die Nachwelt bewahrt.
»Nun sieh sich das einer an, das Bübchen lacht!«, rief die Hebamme aus. Auch Pia und Ada beugten sich vor. Tommaso schaute durch den Sucher und drehte hastig an dem metallenen Objektivring, um scharf zu stellen. Sein Sohn hatte den kleinen Mund verzogen und die Augen geöffnet, es sah wirklich aus, als würde er lachen. »Heilige Mutter Gottes!« Concettina bekreuzigte sich. »Viele, viele habe ich den ersten Blick in die Welt tun sehen, doch gelacht wie dieser hier hat keiner. Möge das Glück und Gottes Segen weiterhin bei euch sein, cara Flora! Und auch bei Ihnen, Maresciallo!«
Es klopfte, die Tür ging auf, und der Arzt betrat das Zimmer. Ein kleiner Mann mit dunklen Haaren und einem glatten Gesicht, dem man seine knapp sechzig Jahre nicht im Mindesten ansah. Zu spät, wie so manches Mal, dachte Concettina, als sie ihn begrüßte. »Alles in Ordnung, Herr Doktor, Erstgebärende, spontane Geburt, Plazenta unauffällig und intakt, keine besonderen Probleme …« Mit diesen Worten nahm sie die abgedeckte Schüssel, ging hinüber in die Küche und packte den Mutterkuchen in eine kleine, mit Stanniol ausgekleidete Kiste. Dann ließ sie sich von Nachbarin Nunziata, deren sieben Kinder sie alle geholt hatte, Kaffee einschenken und ein Stück duftendes Brot auf den Teller legen. Sogar recht hell war es, nicht dieses dunkle Zeug, was sie im Krieg und lange Zeit danach immer bekommen hatten. Was für eine leichte Geburt, dachte Concettina noch einmal und griff nach dem Geld, das Tommaso für sie auf den Küchentisch gelegt hatte. Mit einem Aufseufzen ließ sie die zwei großen fleddrigen Lirescheine in ihrem Geldbeutel verschwinden. Der Doktor würde für seinen Besuch mehr als das Doppelte einstreichen, obwohl er nichts getan hatte und außer den Eltern einen warmen Händedruck zu geben und ein paar Worte über das Wetter zu verlieren auch nichts tun würde. Sie aber würde zwei Wochen lang täglich nach Flora und dem lächelnden Säugling schauen, ihr das Baden des Kindes abnehmen, die Rückbildung der Gebärmutter und den Wochenfluss überwachen, ihr jeden Tag das Bett mit den feinsten Laken der Aussteuer frisch beziehen, damit der zahlreiche Besuch, der ins Haus stand, einen guten Eindruck bekam. Jetzt, nachdem das Kind geboren war, würden Mutter und Schwiegermutter bestimmt anreisen, um zu helfen, was immer da auch vorgefallen sein mochte. Concettina gähnte herzhaft. Manchmal ging ihre Arbeit auch anders aus. Sie presste ihre Hand auf ihren wehen Rücken und sah an Nunziatas ausgemergeltem Körper hinab. Die Schwangerschaften und Geburten hatten die Frau ausgezehrt, ihre Lippen waren schmal wie Rasierklingen, und sie litt unter einer schon krankhaften Neugier; doch gezahlt hatte sie immer. Auch wenn vier ihrer Kinder nicht überlebt hatten und inzwischen auf dem Friedhof ruhten. Friede ihren kleinen Seelen. Draußen auf der Straße rief man ihren Namen, Concettina seufzte, biss noch einmal vom Brot ab, das knusprig war und sättigte, und trank schnell noch einen großen Schluck von dem Kaffee, der angenehm heiß ihre Kehle hinunterlief. Heute war der erste April des Jahres 1947, in den nächsten Tagen würden noch mehrere Frauen ihre Kinder bekommen. Vielleicht weil der Schrecken des Krieges sich jetzt endgültig aus den Köpfen der Menschen verlor? Weil es wieder genug zu essen gab, wenigstens Pasta, Weißbrot und Öl? Die Rufe nach Concettina kamen näher, schon klopfte es hektisch an die Tür, die Nachbarin öffnete.
»Concettina, bist du da? Dio santo, die Marchesa di Camaleo braucht dich!«
Tommaso hatte die deutsche Kamera noch nicht völlig im Griff. Auf dem Foto, das er Wochen später aus dem Laden der Gebrüder Lorenzini abholte, sah man nur die linke Gesichtshälfte von Flora, mit einem verweinten und zugleich strahlenden Auge und der Hälfte ihres lachenden Mundes, daneben das zarte Gesichtchen des Kindes, mit offenen Augen und amüsiert hochgezogenen Mundwinkeln. Die Kunde vom lachenden Neugeborenen machte die Runde in Bellaforte, jeder wollte ihn sehen, und die drei Worte il neonato felice eilten Nicola eine Zeit lang voraus. Um genau zu sein, zwei Jahre und sechs Monate lang, dann sollte sich der Namenszusatz für ihn unter tragischen Umständen ändern, doch davon konnten seine Eltern zu diesem Zeitpunkt noch nichts ahnen.
2
Concettina machte sich auf den Weg. Auf kurzen Beinen und mit wiegendem Gang folgte sie dem Jungen, der sie gerufen hatte, und stieg in die Kutsche, die an der Ecke des Kirchplatzes im Licht der aufgehenden Sonne auf sie wartete. Der Doktor hatte noch Zeit, er würde nachkommen. Es ging in ein wesentlich reicheres Haus. Nun ja, von außen zumindest, dachte die Hebamme. Mit der Kutsche war es nicht weit, nur ein paar Straßen aus dem Zentrum hinaus, Richtung Meer, und auch, wenn man wie sie nicht gut zu Fuß war, lief man nicht länger als eine halbe Stunde. Doch es war eine Weltreise, was die gesellschaftliche Schicht betraf. Die Hebamme war dankbar für die würzige Meeresluft, die ihre Lungen füllte. Ein Haus nach dem anderen ließen sie in den Straßen hinter sich, in fast jedem hatte sie in den letzten zwanzig Jahren Kindern auf ihrem beschwerlichen Weg in die Welt geholfen. Man vertraute ihr in der Stadt, sie hatte die meiste Erfahrung, kannte Kniffe und Tricks, war noch kräftig und wendig, bis auf ihren Rücken, der ihr jetzt, da sie schon über vierzig war, ab und an Schmerzen bereitete. Sie bogen in die von kleinen Lorbeerbäumen gesäumte, breite Via Alloro ein, die hinaus aus der Stadt und runter nach Marinea führte. Bald wurde es ländlich, und weiter unten wechselten sich gewaltige Platanen mit hohen Mauern ab, Jasminzweige hingen darüber, um die Pracht der dahinter liegenden Sommervillen und ihrer imposanten Gärten anzudeuten. Ganz am Ende der Straße, schon am Anfang des Fischerdörfchens Marinea, lag die Villa Camaleo, auf die sie jetzt zusteuerten. Auch dort hatte sie schon zwei Kinder ans Licht der Welt geholt.
Giuseppina lag hoch aufgerichtet in den Kissen, als ob sie unter den Wehen eine Audienz halten wolle, sie atmete schwer, doch der herrische Blick war dennoch nicht aus ihren Augen verschwunden. In ihr außergewöhnlich schönes Gesicht hatten Verbitterung und Enttäuschung senkrechte Linien gegraben, wie Holzwürmer ihre Schächte in eine Anrichte aus weichem Nadelholz. Ihre Frisur war hoch aufgetürmt, ihr Hemd zierte ein Spitzenbesatz.
Was für ein starker Charakter, die kleine Flora di Salvo, ging es Concettina wieder durch den Sinn, während sie sich Giuseppina durch den großen Raum näherte, will ihren Ehemann nicht beunruhigen und beißt die Zähne zusammen … Die guten Matratzen – dahin. Und dann dieses lachende Kind … Doch im nächsten Moment schob sie die Gedanken an die zurückliegenden Stunden energisch beiseite, sie musste sich auf die schwer atmende Frau vor sich konzentrieren. Diese würde sie, ob nun von adliger Herkunft oder nicht, auf den Tisch im salotto bringen, der Doktor würde ihr andernfalls etwas erzählen; wie sollte er sonst an die Gebärende herankommen, ohne sich den Rücken zu verrenken. Und es war ja auch für die werdende Mutter selbst besser. In dem weichen Bett hatte sie keinen Halt, konnte die Füße nicht ordentlich aufsetzen für die Schwerstarbeit, die ihr Körper leisten musste. Concettina wusch sich in einer Schüssel, die auf der goldverzierten Kommode stand, die Hände. Mit ihrem hölzernen Hörrohr, das sie Giuseppina auf den Bauch legte, überprüfte sie die Herztöne des Kindes.
»Ich muss Sie jetzt dort mal untersuchen, Marchesa!«, kündigte sie ihren Griff an. Der Muttermund hatte bereits begonnen, sich zu öffnen, stellte sie fest. Dies war das dritte Kind; man wusste es zwar nie, aber vermutlich würde es nicht mehr lange dauern. Doch das Kleine wollte und wollte nicht kommen. Es lag richtig herum, aber es schien, als wäre es seit der letzten Untersuchung vor ein paar Wochen noch einmal ein gutes Stück gewachsen. Es dehnte den Bauch seiner Mutter auf geradezu erschreckende Weise. Vielleicht hatte Concettina nicht richtig hingehört, den Bauch nicht sorgfältig genug abgetastet, und es waren doch Zwillinge – oder gar Drillinge. Das war ihr erst einmal passiert, ganz am Anfang, als sie noch mit der alten Perpetua mitgegangen war. Alle drei Mädchen waren ihnen gestorben, wohlgestaltete kleine Geschöpfe, bereits Engel, als sie auf die Erde kamen. Zu zart für diese Welt, Gott hatte sie sofort wieder zu sich geholt.
Die Stunden vergingen, wo blieb nur der verdammte Doktor. Concettina fluchte innerlich. Sie schickte den jungen Kutscher los, um nach ihm zu suchen. Giuseppina lag auf dem großen Esstisch, litt unter den starken Wehen, die in unregelmäßigen Abständen kamen und gingen. Sie schwitzte, schrie, betete und schimpfte und war am Ende ihrer Kräfte. In diesem Haus war von Harmonie nichts zu merken, Concettina spürte nur Apathie und Verbitterung. In den weitläufigen, leeren Salons, den Fluren und hohen Decken fühlte man sich verloren. Etwas Unwiederbringliches war aus diesen Räumen entschwunden – nicht nur der Reichtum – und prägte die Atmosphäre der Villa, deren östlicher Flügel schon gar nicht mehr bewohnbar war, so verfallen waren seine Mauern. Giuseppina mit dem auffällig honigblonden Haar, das dick und glatt in einem sich auflösenden Zopf über ihren schmalen Rücken fiel, den hungrigen Augen und dem einst so herrlichen Mund schien eingeschlossen in etwas, was sie einmal so dringend gewollt hatte und nun bereute. Festgehalten in der verarmten adligen Familie, in die sie nur eingeheiratet hatte, um etwas Besseres zu sein. Festgehalten in diesem aufwendig bestickten Gebärhemd, das sie zu allen Geburten trug, ihrem Mann schon längst gleichgültig, obwohl er offensichtlich regelmäßig sein eheliches Recht in Anspruch nahm, um den Stammhalter zu zeugen. Denn obwohl sie schon drei Jahre verheiratet waren, gab es nur zwei Mädchen. Doch bei diesem dritten Versuch war Guiseppinas Bauch wieder voll guter Hoffnung und schien kurz vor dem Platzen.
»Was für ein Geruch ist das hier? Nach Schwefel? Nach Zwiebeln? Es ekelt mich, kommt das von draußen? Macht die Fenster zu, ich ertrage es nicht!« Sie kommandierte gerne herum, die Giuseppina di Camaleo, geboren unter dem bürgerlichen Namen Ducato, deren Mutter eine Contessa war und die einen gemeinen Mann aus dem Volk geheiratet hatte. Was für ein Skandal! Concettina konnte sich noch gut daran erinnern. Dahin die Mitgift und Erbschaften, dahin all der Wohlstand, den ihre Familie für Silvia Paternó di Pozzogrande in mächtigen Aussteuertruhen bereitgehalten hatte. Aus dieser Ehe würden weder kleine conti noch contessine hervorgehen, sondern ganz normale bürgerliche Jungen oder Mädchen. Die ältere Tochter Assunta war auch prompt mit einem zu kurzen Bein zur Welt gekommen. Die leibgewordene Strafe auf diese nicht standesgemäße Heirat, sagten einige Leute. Verkrüppelt wie sie war, rechneten die Eltern nicht damit, dass Assunta jemals heiraten würde, sie würde bei ihnen leben und sie bis zu ihrem Tod pflegen. Ihre gesamte Hoffnung hatte auf der schönen Giuseppina gelegen.
Maria, die junge Magd der Marchesa, schloss das Fenster. Sie bekreuzigte sich und schickte ein kleines Gebet zum Himmel. Die Köchin Pupetta und auch Tina, die langjährige Hausdienerin der verstorbenen Tante, hatten sich geweigert, Giuseppinas Räume und das zum Geburtszimmer hergerichtete Esszimmer während der Geburt zu betreten.
»Nichts da!«, hatten sie der bettelnden Maria an den Kopf geworfen. »Du bist extra angestellt worden, um der Hausherrin zur Hand zu gehen!«
Man fühlt die Zwietracht unter den Bediensteten, dachte Concettina, Nachbarinnen zum Beistehen und Beten lassen sich auch nicht sehen, sind wahrscheinlich nicht erwünscht, aber auch hier fehlt die Mutter der Gebärenden. Eine Mutter hatte ihrer Tochter in diesen schweren Stunden zur Seite zu stehen! Wenn sie sich recht erinnerte, war sie auch bei den anderen beiden Geburten nicht dabei gewesen. Und der Herr des Hauses? Ach, der …
Der Marchese Ciro di Camaleo war der Letzte eines verarmten Astes derer von Camaleo. Ein Eigenbrötler aus Messina, Mitte dreißig, dessen Augen mit unsicherem Blick alles um ihn herum fixierten, nur nicht sein Gegenüber. Der seinen schon immer schwammigen Körper in alte verschossene Brokatmäntel gehüllt hatte. Wenn das mit der Erbschaft nicht passiert wäre, hätte sich kein Mensch um ihn geschert, und der kümmerliche Trieb der Familie, den er vertrat, wäre ohne weitere Beachtung eingegangen. Doch dann vererbte ihm eine alleinstehende Tante ihr gesamtes Vermögen, eine Summe von einer halben Million Lira in Goldmünzen, hatte es geheißen. Nach Kriegsende eine beachtliche Summe. Obendrein gab es noch einige Adelstitel. Dazu kam die baufällige Sommervilla in Bellaforte mit all ihren Gemälden, dem feinen Porzellan mit dem Familienwappen, mit Schränken voller bestickter Wäsche, zwei treuen Dienerinnen sowie im Landesinneren verstreute Ländereien.
Das machte ihn in den adligen Kreisen wieder interessant. Er tauchte in Bellaforte auf, und die Familien rund um das kleine Städtchen und in Palermo überlegten, welche ihrer Töchter sie mit diesem seltsam stillen Menschen vermählen konnten, der sich jetzt Marchese von Camaleo und Markgraf von Mentana, Norma, Civitella, Pratica, Moricone und Percille nennen durfte.
Seine Eltern, Gott habe sie selig, lagen schon lange im nicht sehr würdigen Familiengrab der Camaleos, in Messina, und so mühte er sich alleine und äußerst ungeschickt ab, den von der unbekannten Tante ererbten Reichtum zu mehren. Er warf die verschossenen Brokatmäntel weg und ließ sich neue aus Paris schicken. Auch englische Anzüge ließ er sich maßschneidern, man munkelte, er habe sogar Sprechunterricht und Tanzstunden genommen, bevor er sich auf die Suche nach einer geeigneten Frau begeben hatte! Concettina hatte gehört, dass er manchmal wochenlang unterwegs war, um die Ländereien zu kontrollieren. Diese Ländereien lagen bei Prizzi, waren natürlich verpachtet und sollten doch wohl einiges abwerfen an Wein, Getreide und Geld. Man vermutete aber, dass dies nicht der wahre Grund für die Reisen war. Der Marchese wollte einfach nicht zu Hause bei seiner Frau sein. Dabei hätte er es doch wissen können. Geld vermehrte man nur mit noch mehr Geld. Nicht mit Schönheit. Nur eine geschickt eingefädelte Allianz mit einer wohlhabenden adligen Familie hätte die maroden Mauern der Villa wieder aufgebaut, die Schatullen vollständig gefüllt, die Divane neu gepolstert, das Ansehen gehoben. Aber so? Wählte der Trottel das schönste Mädchen von Bellaforte, das bekanntermaßen aus einer Familie kam, die durch den Fehltritt der Mutter mit einem Bürgerlichen gerade aus der Beletage der nobili herausgerutscht war und natürlich keine Lira besaß. Hätte er lieber eine weniger schöne Frau genommen, ja selbst hässlich hätte sie sein können, dafür aber von gleichem Stand, mit einer stattlichen Mitgift ausgestattet. Das wäre schlau und besonnen gewesen. Concettina zuckte mit den Schultern, sie wusste, dass die Einwohner von Bellaforte sich das Maul über diesen Tölpel zerrissen, dem seine hübsche Frau kein Glück und bis jetzt auch nicht einmal einen Erben gebracht hatte und dem der überraschend erworbene Reichtum zwischen den Fingern zerrann. Tja, auch die Reichen hatten ihre Sorgen.
Der Kutscher kam zurück, der Doktor sei schwer gestürzt, berichtete er umständlich, und mit dem Kopf aufgeschlagen, als er einen Wagen bestiegen habe, der ihn zur Villa habe bringen sollen. Wenn man ihn schon einmal braucht!, dachte Concettina wütend. Hat wahrscheinlich beim Maresciallo einen Rosolio zu viel getrunken, denn wo immer er auftauchte, wurde ihm dieser starke Likör aus Dankbarkeit angeboten, den er nur selten ablehnte.
Als es Giuseppina immer schlechter ging und die Herztöne des Kindes durch das Rohr schwächer und schwächer klangen, warf sich die stämmige Hebamme mit ihrer ganzen Kraft auf den Bauch der Schwangeren und zwang das sechs Kilo schwere Baby auf diese Art Stück für Stück hinaus aus seiner engen Behausung, die es aus eigener Kraft nicht verlassen konnte.
»Bleib wach, bleib wach!«, schrie sie Giuseppina währenddessen zu, eine ohnmächtige Mutter konnte sie nicht gebrauchen. »Und du hörst auf zu heulen!«, herrschte sie Maria an. Die Magd weinte dennoch weiter und flehte alle Heiligen an, die sie kannte, ihr beizustehen. Zu grausam waren die Geräusche und die Bilder, denen sie während der letzten Stunden ausgesetzt gewesen war. Pünktlich zur Abenddämmerung, als die Sonne rötliche Streifen auf den Steinboden des großen Speisesalons warf, erschien zwischen Giuseppinas kraftlosen Beinen endlich der Kopf des Kindes. Concettina war schweißüberströmt, das schüttere Haar klebte ihr klatschnass an der Kopfhaut, sie zog und drehte an dem Kind und versuchte, eine der Schultern zu fassen, während sie zu der Schutzheiligen der Hebammen, der heiligen Anna, betete. Das Gesicht war rund, blau und verquollen, die Augen in ihren kleinen Fettpolstern waren kaum sichtbar.
»Ach je, noch ein Mädelchen!«, sagte Concettina erschöpft, nachdem sie das Kind vollständig herausgezogen hatte. »Atme, Atme! Was machst du mir denn für Schwierigkeiten, du dickes Krötchen?!«, brummelte sie und musste regelrecht auf die gut gepolsterten Hinterbäckchen des Neugeborenen einschlagen, damit es endlich den erlösenden ersten Schrei tat.
Doch sie war glücklich darüber, dass ihr weder Mutter noch Kind unter der Hand weggestorben waren, und schwor, der heiligen Anna eine Kerze anzuzünden, gleich am Sonntag vor der Messe. »Aber nur, wenn die Mutter dann noch lebt, verehrte Sant’Anna«, murmelte sie. »Nur dann!« Sie wickelte das Mädchen in ein Tuch und drückte es der Magd in die Arme.
Nachdem die Nachgeburt gekommen war, versorgte sie die Wöchnerin, holte sie dann vom Tisch und brachte sie hinüber in ihr großes Bett. Dann wusch sie das Kind mit Seifenwasser ab und hüllte es in vorgewärmte Tücher.
»Wie soll es heißen?«, fragte sie Giuseppina und hielt ihr das Bündel vors Gesicht. Die war zu schwach, um zu antworten, schaffte es aber, den Kopf von dem kleinen Mädchen abzuwenden und in das Kissen zu drücken.
»Maristella«, flüsterte Maria scheu, denn diesen Namen hatte ihre Herrin ausgesprochen, als es ihr ein paar Tage zuvor noch gut ging. Als sie noch der Überzeugung war, dass sie einen Sohn zur Welt bringen würde, weil sie sich diesmal so anders fühlte als bei den beiden Mädchen, weil sie schöner geworden war und mehr Appetit hatte.
»Bartolo Domenico wird er heißen, nach dem Vater des Marchese!«, hatte sie gesagt. »Und wenn Gott mich mit einem dritten Mädchen strafen will, wird sie Maristella heißen, wie mein kleines Schwesterchen, das nach mir zur Welt kam und nach nur wenigen Monaten morgens tot in der Wiege lag. Hat einfach nicht mehr geatmet.«
Maria hoffte, dass die Angst einflößende Hebamme sie nicht mehr zurück in dieses Schreckenszimmer schicken würde, in dem sich die blutgetränkten Tücher auf dem Boden häuften und in dem es furchtbar nach einer Mischung aus Blut, Schweiß und frischem Firnis roch. Das dicke Monster hat seine Mutter erbarmungslos auseinandergerissen, dachte Maria, und weil sie auch nur Schlimmes darüber gehört hatte, wie so ein Ungeheuer in den Bauch einer Frau gelangte, schwor sie beim Namen der Heiligen Jungfrau, niemals Kinder zu haben.
»Wo bleibt denn bloß dieser verdammte Doktor?!«, fluchte die Hebamme. »Komm her, wir müssen es ohne ihn schaffen!«
»Soll ich beten?«
»Ach was, beten, so weit ist es noch nicht!«
Maria folgte den Anweisungen der Hebamme, die sich bemühte, die nicht enden wollende Blutung zu stillen. Ein Tuch nach dem anderen reichte Maria ihr an, bis es Concettina schließlich gelang, den Strom zum Versiegen zu bringen. In diesem Moment betrat der Doktor mit seiner ledernen Tasche das Zimmer. Sein Kopf war mit einer weißen Binde umwickelt, doch sein Gang war sicher und fest.
»Endlich!«, brummelte Concettina, während sie versuchte, ihn noch vor dem breiten Bett abzufangen. »Dottore Zingaro! Was ist passiert?« Sie konnte den süßlichen Alkohol in seinem Atem riechen. Ohne eine Antwort abzuwarten, näherte sie sich seinem rechten Ohr, das nicht von dem Verband bedeckt war: »Ein gesundes Mädchen, aber ein wahrer Brocken. Mindestens sechs Kilo. Für die Verwüstung kann ich nicht die Verantwortung übernehmen! Schauen Sie selbst!«
Der so Angesprochene wusch sich schweigend die Hände, klappte seine Tasche auf und machte sich ans Werk. Concettina nickte. Nähen konnte er wirklich, der Doktor, auch wenn er vielleicht immer noch einen kleinen Schwips hatte. Ach, Maristella, du unglückseliges Kind, ging ihr durch den Kopf, deine Mutter würdigt dich keines Blickes! Was für ein Leben hast du dir ausgesucht? So völlig anders als das des kleinen Nicola … Sie wickelte das Kind in eine Decke. Auch wenn dieser kunstvoll bestickte Batist schon Generationen von Grafen gewärmt hat, so reich an Liebe wie das seine wird dein Leben hier zwischen diesen Mauern niemals werden!
Seufzend schickte sie Maria los, um Giuseppinas Mutter zu holen, die mit der Familie in einem Teil Bellafortes lebte, wo die Häuser eng beieinanderstanden und man das Meer nicht sehen und schmecken konnte. Kurze Zeit später, als hätten sie schon ungeduldig an einer nahen Straßenecke gewartet, traf die ganze Familie ein. Die Eltern und Giuseppinas Schwester, die wohl nie einen Verlobten haben würde.
Was sollte nun mit dem Neugeborenen werden, die beiden älteren Mädchen waren ja auch noch da. Giuseppina lehnte alle Vorschläge ihrer Eltern und die des Doktors ab. Sie wollte nicht ins Krankenhaus, sie wollte nicht, dass die Eltern in der Villa blieben, um sie zu versorgen, sie wollte den Marchese nicht benachrichtigen, und sie wollte auf gar keinen Fall wieder nach Hause. Dottore Zingaro gab ihr eine Beruhigungsspritze, dann beschloss er zusammen mit Giuseppinas Mutter, dass sie bis zur Rückkehr des Marchese mit der Familie in der Villa bleiben sollte. Die Eltern würden sich in den folgenden Tagen um ihre Tochter, das Neugeborene, das ja Pflege rund um die Uhr brauchte, und die beiden kleinen Mädchen kümmern.
Concettina musterte die Familie verstohlen. Die Adlige hatte sich gut gehalten, musste sie zugeben. Trotz der recht einfachen Kleider, die sie trug, strahlte sie eine Eleganz aus, die angeboren schien. Ernesto Ducato, für den sie alles aufgegeben hatte, war mit den Jahren männlicher geworden, die Arbeit auf dem Land hatte ihn kräftiger werden lassen, der weiße Bart ließ ihn allerdings älter aussehen, dabei war er vermutlich nicht einmal fünfzig. Assunta, die erstgeborene Tochter, hatte der jungen Magd Maria das kräftige Kind aus den Armen genommen und wiegte es vor ihrem gigantischen Busen. »Ach, wenn ich der Kleinen doch etwas geben könnte!«, rief sie immer wieder.
»Ich kann es nicht, und ich will es auch nicht!«, murmelte Giuseppina von ihren hohen Matratzen herunter, auf die sie wie ein Leichnam gebettet war.
»Warum holt ihr nicht Brigida, die bei euch nebenan wohnt? Die hat Milch für zwei und verdient sich gerne etwas dazu«, schlug Concettina vor.
Als sich der Marchese zehn Tage später ankündigte, packte die Familie in Windeseile ihre Sachen, küsste die kleinen Schwestern und die immer noch schwache Giuseppina und machte vor Concettinas Augen Anstalten, die Villa zu verlassen.
»Der Marchese sieht uns nicht gern in seinem Haus. Besser, ihn nicht zu erzürnen«, sagte Assunta. Ihre Eltern schwiegen.
»Nehmt sie mit!«, sagte Giuseppina, indem sie auf die Wiege zeigte, in die sie noch immer keinen Blick geworfen hatte. »Ich kann mich nicht um sie kümmern, und die Amme wohnt ja gleich neben euch, dann spart sie sich den Weg!« Und ich mir das Geld für den Kutscher, fügte sie für sich hinzu.
Ja, tragt dieses kleine Wesen hier hinaus, hinaus aus den Räumen, in denen es doch keiner haben will!, dachte Concettina und machte sich daran, Giuseppina zu ihrem Befinden zu befragen und ihr Bett mit einem der unzähligen verzierten Wöchnerinnenlaken frisch zu beziehen.
Die Familie nahm also das Bündel und brachte es in die Alberia, überzeugt, dass der Marchese sein Töchterchen schon bald zu sich holen würde. Denn das Viertel war zwar sehr auf seinen guten Ruf bedacht, lag aber viel zu dicht an dem Armenviertel Armuzzi Santi, in dem die Straßen mit Unrat bedeckt waren und die Kühe, Pferde, Schafe und Hühner sich den Wohnraum mit ihren Besitzern teilten. Doch die Tage und Wochen vergingen, ohne dass jemand kam, um Maristella, deren Name schon in den ersten Tagen zärtlich auf Stella oder Stellina verkürzt worden war, zurück in die Villa zu bringen. Ihre Mutter lag im Bett und versuchte, die Erinnerung an sie aus ihrem Gedächtnis zu löschen, und ihre Geschwister waren zu klein und wussten schon nichts mehr von ihr. Ihr Vater hatte sie nicht gesehen, und da er schon zwei Töchter, aber noch immer keinen Sohn hatte, betrachtete er jedes weitere Mädchen als überflüssige Anwärterin auf eine kostspielige Mitgift.
Stella wurde auf Wunsch ihrer Mutter aus ihrem Elternhaus entfernt, mitleidslos, wie ein fauler Zahn aus einem Kiefer, doch sie hatte Glück. Obwohl es bei den Großeltern und der hinkenden Tante Assunta sehr bescheiden zuging, sollte sie die nächsten Jahre in einer Fülle von Liebe und Geborgenheit verbringen.
3
Die Glocken läuteten, heute am Sonntag, dem sechsten Juli, war der große Tag. Flora war mit ihrem Sohn zum ersten Mal hinausgegangen, um ihn unter freiem Himmel zur Kirche zu tragen. Weit hatte sie es nicht, die Chiesa Maria Immacolata lag an der Stirnseite des Platzes, an dem sie wohnten. Tommaso war neben ihr, feierlich in seinen Hochzeitsanzug gekleidet. Hinter ihnen die Paten. Tommasos Bruder Francesco, auch er ein Maresciallo der Carabinieri, der aber in Sant’Agata di Militello seinen Dienst tat, nicht weit von der gemeinsamen Heimatstadt Mistretta. Und Nachbarin Ada, mit rot glänzendem Gesicht und voller Stolz, dass Flora sie gebeten hatte, das hochgeachtete Amt der Patin zu übernehmen. Flora war Einzelkind und hatte auch keine ihr nahestehenden jüngeren Verwandten, die dafür infrage gekommen wären.
Mit diesen Paten ist für unseren Nico gut gesorgt, dachte sie, als sie Ada das Kind am Portal der Kirche in die Arme legte, damit sie es nach der Elf-Uhr-Messe zum Taufbecken tragen konnte. Ada schaute lächelnd auf den Säugling und zupfte sein langes weißes Taufkleid zurecht.
»Vergiss nicht, ihn mit dem rechten Arm zu tragen, immerhin ist er ein Junge!«
»Wie könnte ich das vergessen, dass du einen kleinen Pisellino-Träger geboren hast!«, erwiderte Ada lächelnd. Bei der Taufe ihres ersten Kindes war sie genauso aufgeregt gewesen.
Kaum waren sie wieder aus dem Kirchenportal getreten, gab Ada das Kind zurück in Floras Arme. »Tu me l’hai dato pagano e io te lo porto cristiano« – du hast ihn mir als Heiden gegeben, und ich bringe ihn dir als Christen zurück. Flora nickte und sah, wie Tommaso sich verstohlen über die Augen wischte, als sei ein Staubkorn hineingeflogen. Ihr Mann war so empfindsam, obwohl er auf den ersten Blick gar nicht diesen Eindruck vermittelte. Wie so oft hatte er seine Kamera dabei und ordnete jetzt die glückliche Taufgesellschaft unter der Mittagssonne mit den Händen zum Gruppenfoto an. Ada lachte, ihre Wangen glühten immer noch. Flora drückte ihre Hand, sie war selig. Die Schwiegereltern waren mit Tommasos Bruder aus Mistretta gekommen und hatten ihre Mutter gleich mitgebracht. Und wie sie gestrahlt hatte, als sie vor dem Haus am Fuße der schmalen Treppe stand und zu ihr hinaufschaute. Flora war so stolz wie noch nie, nicht einmal am Tage ihrer Hochzeit. Sie hatte ein eigenes Heim, einen Mann, der sie liebte, und einen Sohn! Ihre Mutter hatte sie umarmt, und Flora hatte es zugelassen. Die Geburt von Nicola hatte sie weich gemacht, sie war bereit, ihrer Mutter zu verzeihen, dass sie damals die Augen verschlossen hatte vor dem, was der Vater ihr angetan hatte. »Ein Söhnchen, ein Söhnchen, wie habe ich mir das gewünscht!« Ich werde besser auf ihn aufpassen als du auf mich, dachte Flora und zwang sich zu einem Lächeln.
Der Vater war nicht dabei. Auch dies ein Geschenk Gottes. Drei Monate hatte man auf seine Genesung gewartet, doch dann hatte es plötzlich geheißen, die Mutter solle alleine fahren, damit der Säugling endlich getauft werden könne. Wie schrecklich, wenn Nicola etwas passieren würde, nicht auszudenken. Doch ohne die heiligen Sakramente der Kirche wäre er auch noch dazu verdammt, hinab in die Hölle zu fahren. Flora vermisste ihren Vater keineswegs; nicht seine jähzornigen Ausbrüche und auch nicht seine behaarten Hände, die sie damals gezwungen hatten, etwas zu tun, was sie nicht tun wollte.
Von seinen Paten würde Nicola ein goldenes Kettchen mit einem Kreuz überreicht bekommen, auf dem sein Name und sein Geburtsdatum eingraviert waren. Ada hatte es ihr schon gezeigt, und Flora hatte es andächtig durch die Hände gleiten lassen.
»Lächeln!« Tommaso ging noch einen Schritt zurück. In diesem Moment hielt eine prachtvolle Karosse auf dem Kirchplatz. Der Kutscher sprang vom Bock und riss die Tür des Landauers auf. Gestützt von einem weiteren Diener, stieg eine wunderschöne Frau aus, mit blondem Haar von der Sorte, das nie fettig zu werden schien, und in einem langen Kleid. Noch weitere Leute quollen hinter ihr aus der altmodischen offenen Kutsche, darunter zwei blond gelockte Mädchen, wie Flora feststellte, auch sie vornehm gekleidet. Das größere, etwa drei Jahre, und sein Schwesterchen, das gerade laufen konnte, aber zur Sicherheit von einer Frau, die wie eine elegante Gouvernante aussah, an die Hand genommen wurde.
So süße kleine Mädchen, dachte Flora, während sie abwechselnd auf das Schauspiel, das die sich leerende Kutsche bot, und in die Linse der Kamera schaute. Hätte ich doch auch eins! Ein Kind wünsche ich mir noch! Heilige Mutter Gottes, schenke mir zu meinem Sohn eine gesunde Tochter, dann werde ich dich nie mehr um etwas bitten. Nun sah sie, wie eine weitere Gouvernante ein Baby in einem meterlangen Taufkleid aus der Kalesche hob. Eines ihrer Beine war anscheinend stark verkürzt, denn sie hinkte auffällig. Ein paar Kinder in kurzen Hosen und trotz des Sonntags mit dreckigen Gesichtern, scharten sich um sie, zeigten mit dem Finger und lachten.
Lass es bloß nicht fallen, dachte Flora, wo du schon so bedenklich schief stehst. Aber die hinkende Gouvernante hielt das Kind sicher und versuchte, es der blonden Frau, offensichtlich die Mutter des Täuflings, in den Arm zu legen. Doch diese drehte sich weg. Die Hinkende machte daraufhin eine kaum wahrnehmbare Bewegung in Richtung des gut gekleideten Mannes, der wohl der Vater des Kindes war, aber auch er ignorierte die Geste und ging zu der zweiten Kutsche, die eingetroffen war.
In dem Augenblick, als Tommaso das Foto schoss, war Floras Gesichtsausdruck stolz, in ihrem Inneren breitete sich jedoch Mitleid aus. Natürlich war sie keine Dame der höheren Gesellschaft, ihr Kleid war weder modisch noch teuer, ihr Haar dunkel statt golden, sie war nicht so groß, ihre Taille dafür nach der Geburt mindestens doppelt so umfangreich. Aber was ist dieser Frau nur passiert, überlegte Flora, dass sie mit dem Liebenswertesten, was es auf der Welt gibt, mit ihrem eigenen Kind, offenbar so gar nichts anzufangen weiß?
Das Foto war gemacht, die Gruppe löste sich auf, während die andere auf das Kirchenportal zusteuerte, um dort ihren eigenen Taufgottesdienst zu feiern. Für einen kurzen Augenblick bewegten sich die Gesellschaften aufeinander zu, die Hinkende allen voran, und die beiden Täuflinge zogen auf gleicher Höhe aneinander vorbei. Flora nickte der Frau zu, die das mit einer rosa Stoffblüte geschmückte Taufkleid während des Gehens zurechtlegte. Ein weiteres Mädchen also. Hinter ihr strömte die Familie herbei, die blonde Dame mit erhobenem Kinn und versteinerter Miene, die in diesem Moment einer mageren Katze einen Fußtritt verpasste, sodass sie aus ihrer schleichenden Spur geschleudert wurde. Flora zuckte zusammen, sie hasste es, wenn Tiere lieblos behandelt wurden.
»Das ist die Marchesa von Camaleo«, sagte Ada leise, doch der Name sagte Flora nichts. Sie hatte die Frau in den vergangenen zwei Jahren, in denen sie jetzt schon in Bellaforte lebte, noch nie gesehen und würde ihr sicher auch nicht vorgestellt werden. Sie wollte die Augen niederschlagen, um sie nicht grüßen zu müssen, doch dann verflocht ihr Blick sich mit dem ihres Mannes, und sie vergaß die blonde Frau, die magere Katze und die Hitze, die ihr den Schweiß die Achseln hinunterrinnen ließ. Sie liebte ihn, er tat alles für sie und ihren Sohn, und sie verspürte das erste Mal seit der Geburt wieder Lust auf ihn. Natürlich würde es wehtun, wenn Tommaso den Gang benutzte, durch den Nicola sich von der anderen Seite ans Licht der Welt geschoben hatte. Die Nachbarinnen hatten mehr als eine Andeutung darüber gemacht. Am Anfang sicher, na, und wenn schon, etwas, das so viel Freude bereitete, durfte man nicht vernachlässigen. Sie würden bald wieder miteinander schlafen, und wenn sie in der nächsten Zeit auf Salz verzichten würde und besonders viel Zitronen äße, bestimmt eine Tochter zeugen. Alleine der Gedanke an eine Zitrone ließ ihr das Wasser im Mund zusammenlaufen. Sie schluckte, fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und lächelte Tommaso an.
4
Ich halte es nicht aus! Halte es nicht mehr aus!« Giuseppina stöhnte und warf den Kopf in den Nacken, sodass ihr wohlgeformtes Kinn in die Luft ragte. Endlich hatte sie aus der wackelnden Kutsche aussteigen können. Wann kaufte ihr Waschlappen von einem Ehemann endlich das Automobil? Alle anderen Familien von Palermo hatten so ein Ding schon vor ihren Palazzi stehen. Worauf wartete er denn noch? Die ganze Fahrt über war sie gezwungen gewesen, ganz vorne auf der ungemütlichen Kante der Bank zu sitzen. Schuld an alldem hatte »es«. Sie wollte seinen richtigen Namen, auf den es heute getauft werden sollte, nicht einmal denken. Es. Das Ungewollte.
Die Wunde, die es ihr gerissen hatte, war zwar genäht worden, doch sie spürte die Nähte noch, wie Drahtseile, denn die Fäden hatten zu eitern begonnen, und nach drei Monaten war immer noch nicht alles völlig verheilt. Beim Sitzen, beim Gehen, selbst beim Schlafen mahnten sie daran, bei jedem Gang auf den Abort jedoch wurde die Erinnerung zur Höllenqual.
Nach sechs Wochen war sie das erste Mal wieder aufgestanden, obwohl die Hebamme sie schon früher dazu hatte zwingen wollen. Wozu? Was sollte sie denn da draußen? Sie hatte kaum mehr auf den Beinen stehen können, so schwach waren ihre Muskeln geworden.
Mal war die Mutter zu Besuch gekommen, mal die Schwester. Giuseppina wusste, warum, doch niemand sprach in ihrer Nähe von dem ungewünschten Mädchen, dafür hatte sie nach dem ersten Versuch mit einem sorgfältig berechneten Nervenzusammenbruch gesorgt.
Giuseppina bewegte sich vorsichtig, der kleine Schritt hinab aus der Kutsche schmerzte, das Laufen fiel ihr noch immer schwer. Heute war nun also die Taufe des Kindes, dessen Namen sie möglichst nicht dachte. Natürlich konnten sie diesem Ereignis als Eltern nicht fernbleiben, Gott würde sie dafür mit Freude in der Hölle schmoren lassen. Die Taufe hätte eigentlich in der kleinen Kapelle der Villa Camaleo stattfinden sollen, man hätte sich gar nicht mit dem Ungewollten in der Öffentlichkeit zeigen müssen. Pater Anselmo war schon für die Hausmesse einbestellt gewesen, doch dann war die Decke vor zwei Tagen heruntergekommen, ein verheerendes Zeichen. Nicht einmal die Kapelle mochte das Ereignis feiern. Immer noch lag alles voller Staub, Mörtel und Steinbrocken, nur gut, dass niemand im Raum gewesen war!
Dieser alte Kasten brachte nur Unglück. Sie hatte sich von seiner imposanten Fassade blenden lassen, wie auch von Ciros Fassade, von dessen herrschaftlichem Auftreten, das er trotz seines eher weichlichen Aussehens vor manchen Leuten beherrschte. Seine Lippen waren fleischig und geschwungen, seine Augen von den Lidern immer halb bedeckt, was seinem Gesicht stets einen schläfrigen Ausdruck verlieh. Doch seine Manieren waren untadelig gewesen, als sie ihn kennenlernte, seine Garderobe beeindruckend. Vielleicht hätte sie lieber seinen Schneider heiraten sollen. Aber sie war ja eine unwissende Gans gewesen. Sie hatte vor lauter Bemühen, den richtigen Schritt zu machen, nicht geschaut, wo sie hintrat.
Weil Ciro nicht einsehen wollte, dass die Villa renoviert werden musste, auch wenn Mauern und Decken um ihn herum einstürzten, standen sie nun vor der Chiesa Maria Immacolata. Aus der Kirchentür strömten wie gewohnt schwarz gekleidete Frauen, die keine Messe ausließen, einige junge Mädchen, bewacht von Brüdern und Vätern, und Ehepaare in ihrem abgewetzten Sonntagsstaat. Giuseppina verachtete sie nicht, sie konnte sich nur zu gut daran erinnern, wie es war, seine Kleidung wieder und wieder zu flicken, zu wenden und zu stopfen. Aber sie wollte nicht daran denken und ging deswegen ungerne hinaus. In der Villa hatte sie das Gefühl, sich nicht mehr um diese andere Welt kümmern zu müssen, die einmal die ihre gewesen war. Was sie nicht sah, ging sie nichts an.
Ihr Blick streifte ihre Eltern, oje, ihre Eltern, die hatten ihr das alles eingebrockt. Was hatte ihre Mutter nur in diesem Mann gesehen, einem einfachen Landvermesser bei der Eisenbahn, als sie ihn kennenlernte? Sie hätte den Waggon der ersten Klasse nicht verlassen sollen, dann wäre ihnen allen dieser gewöhnliche Mensch erspart geblieben. Giuseppina merkte, wie ihre Kiefermuskulatur sich noch mehr verspannte, sie wusste manchmal selbst nicht, ob sie ihre Mutter bewunderte oder verachtete. Trotz ihrer abwertenden Heirat hatte sich die Contessa Silvia Paternó di Pozzogrande ihre Anmut und ihr selbstbewusstes Auftreten bewahrt. Ihre Kleider waren einfach, doch gut geschnitten, und mit dem schwarzen Schleier umgab sie noch immer etwas Aristokratisches.
In diesem Moment erblickte Giuseppina den anderen Täufling und die kleine untersetzte Frau, die ihn trug; dem maßlos stolzen Blick nach zu urteilen, wohl seine Mutter. Sie kannte sie nicht, sie kannte nur die Familien der Adligen und der Reichen, die hatte sie in ihren Jugendjahren bewundert, beobachtet, ja regelrecht studiert. Die von Salandra, die von Verdura, die von Frasca, und wie sie alle hießen. Nein, diese Frau da vor ihr war keinesfalls wohlhabend oder aristokratisch. Sie war zwar festlich herausgeputzt, doch das Kleid, das sie trug, war ihr einziges, wusste Giuseppina mit untrüglicher Gewissheit. Sie hätte also auf ihr Kleid und dann an ihr vorbeigeschaut, wenn sich der Maresciallo Messina nicht in diesem Augenblick neben sie gestellt hätte. Dio! Der Maresciallo war also ihr Ehemann!
Er kam aus einem Bergdorf weiter im Westen Siziliens, hatte kein Geld und war »nicht von Klasse«, wie der Marchese gerne sagte. Deswegen wäre er für sie niemals infrage gekommen, auch wenn sie ihn früher kennengelernt hätte und er ihr nicht erst vor zwei Jahren bei der Herbstprozession aufgefallen wäre, als er sich schützend vor sie und ihren damals schon so unförmigen Körper gestellt hatte, damit sie von den drängenden Massen nicht angerempelt wurde. Es hatte ihr gefallen, wie er da so aufrecht und ernst in seiner Uniform am Rande des Corso Garibaldi vor ihr stand. Mit keinem Blick zu verstehen gebend, dass er ihre Schwangerschaft bemerkt hatte, und doch mit diesem fein lächelnden Zug um den Mund, der irgendetwas in ihr auch jetzt wieder entzückt aufseufzen ließ.
Er sah gut aus und war jung, zu jung eigentlich, um Chef der Carabinieri-Kaserne zu sein. Man sagte, er sei nicht wie die anderen. Er habe ein offenes Ohr für Probleme, war angeblich sogar immun gegen Bestechung. Giuseppina schüttelte unmerklich den Kopf. Ein Carabiniere, den man mit Geld nicht lenken konnte? Wo gab es denn so was?
Ein scharfes Gefühl von Neid durchfuhr sie und verengte ihre großen grünen Augen. Unfassbar, sie beneidete das kleine Frauchen dort vorne um den Blick, den es von ihrem Mann geschenkt bekam.
In den hellblauen Augen des Maresciallo hatte Giuseppina nämlich etwas Unglaubliches entdeckt: Bewunderung und Respekt für eine Frau. Seine Frau! Vielleicht redeten die beiden sogar beim Essen am Tisch oder auch bevor sie schlafen gingen. Vielleicht erzählte er ihr, was er am Tag erlebt hatte, und hörte ihr danach zu, was sie zu berichten hatte. Giuseppina schnalzte mit der Zunge. Aber was hatte eine wie die schon zu berichten?
In der Ehe ging es nicht um Liebe, das hatte sie schon früh begriffen. Wo sollte diese Liebe zwischen Mann und Frau denn herkommen? Sie hatte davon gehört und es auch im Kino auf der Leinwand gesehen, doch im wahren Leben noch nie bemerkt. Nicht mal bei ihren Eltern, obwohl die doch angeblich aus Liebe geheiratet hatten, woraufhin ihre Mutter alles verlor. Titel. Aussteuer. Familie. Als Kind hatte sie ihre Eltern beobachtet, um ein Zeichen der Liebe zu finden, die das alles rechtfertigte, sie aber nirgends entdecken können. Nicht beim Essen, wenn der Vater stumm die selbst gemachten fusilli in sich hineinschaufelte, während die Mutter dauernd aufsprang, um ihn zu bedienen. Nicht beim Spaziergang nach der Messe und schon gar nicht, wenn die beiden alleine waren. Es gab kein Geheimnis, hatte sie bald erkannt, nur den Titel einer Contessa, der nicht mehr weitergegeben werden konnte, eine einzige Halskette, die sie, Giuseppina, irgendwann hoffentlich erben würde, und freiwillige Armut.
Ihr Vater, Ernesto Ducato, der blonde Jüngling aus Bellaforte, hatte eine Fachschule besucht und war Landvermesser geworden, landete dann aber nur bei der Eisenbahngesellschaft. Sie heirateten, der Vater arbeitete weiter bei der Eisenbahn, auch während des Krieges, und danach, als die Amerikaner überall waren. Doch eines Tages kam er nach Hause und war entlassen. Sie hatten nicht nur wenig, sie hatten plötzlich gar kein Geld mehr.
Giuseppina ordnete ihre Frisur, an der der Wind auf dem Kirchplatz zerrte. Ein scirocco kam auf, sie spürte es an den winzigen Sandkörnern in ihrem feuchten Nacken.
Sie hatte schon früh begriffen, dass allein ihr Aussehen sie aus dieser Klasse, in die ihre Mutter sie so unüberlegt hineingeführt hatte, wieder hinausführen konnte. Und zwar nicht, indem sie Lehrerin oder etwas ähnlich Unnützes würde, um ihr eigenes Geld zu verdienen, was manche Frauen neuerdings scheinbar erstrebenswert fanden. Sie war schön, das hatte sie schon als Kind zu hören und zu spüren bekommen. Das symmetrische, aber kantige Gesicht ihrer Mutter, und das weiche, von hellblonden fusseligen Haaren umgebene Antlitz ihres Vaters waren bei ihr zu einer perfekten Komposition verschmolzen. Sie war schlank und überragte die Eltern schon mit vierzehn Jahren um zwei Köpfe, und die schiefe Assunta sowieso. Giuseppina wusste, die Liebe führte einen ins Verderben, an mehr glaubte sie nicht. Aber sie wollte wenigstens ein bequemes Leben, sie wollte ihre Familie mit dem Geld ihres zukünftigen Mannes unterstützen, ja, am Anfang wollte sie das wirklich.
Jetzt kam er auf sie zu und ging neben ihr, dieser Fremde, den sie geheiratet hatte, der seit fast vier Jahren ihr Mann war. Sie kannte ihn nicht, obwohl er manchmal nachts zu ihr kam, ihr so nahe kam wie niemand sonst auf der Welt, schnell und hastig ihre Knie auseinanderdrückte und endlos auf ihr herumwütete. Mit einer Energie, die man seinem dicklichen Körper und seiner Unentschlossenheit gar nicht zutraute.
Ihr Ehemann war wie die Villa. Von außen schienen beide mächtig und imposant, aber innen fiel alles in sich zusammen.
Diese Kälte, die von den Mauern im Winter ausging, und die Düsternis, die einen im Sommer umgab … Dieselbe Kälte ging auch von Ciro aus, der so oft durch sie hindurchsah. Düster war er, wenn er sich in sein Studierzimmer verzog und vorgab, über schwierige Entscheidungen nachdenken zu müssen. Dabei war offensichtlich, dass er die wichtigen Sachen vernachlässigte, während er sich stundenlang mit absolut bedeutungslosen Fragen beschäftigen konnte.
Sie hatte bei der ersten und einzigen Reise zu den Ländereien, zu der er sie mitgenommen hatte, sofort erkannt, dass die Verwalter betrügerische Hunde waren, die ihm etwas vorlogen. Sie kannte diesen Schlag von Menschen aus dem Viertel, in dem sie aufgewachsen war. Sie buckelten vor dem Marchese in gespielter Ehrfurcht, fälschten aber garantiert die Geschäftsbücher und steckten sich das meiste Geld in die eigene Tasche.
Ich sehe viel klarer als er, was man tun müsste, dachte sie, aber wer bin ich schon, dass ich ihm Ratschläge geben könnte? Ich habe zwar zehn Jahre die Schule besucht, bin aber nur eine Frau, und nicht einmal von Klasse. Kann weder Klavier spielen, noch beherrsche ich diesen ganzen Unsinn, den die Adligen lernen. Und er würde ja eh nicht auf mich hören.
Giuseppina nahm von ihrer Mutter ihre älteste Tochter in Empfang. Was brauche ich denn noch, mit diesen beiden Kindern sind bereits alle meine Wünsche in Erfüllung gegangen, dachte sie, während sie die kleine Enza an die Hand nahm und mit ihr das Kirchportal durchschritt. Mit Regina, dem nur ein Jahr jüngeren Schwesterchen, ist mein Glück perfekt. Aber der Marchese will natürlich einen Sohn, alle wollen immer nur Söhne, darum wird er es immer wieder probieren. Das, was Assunta hinter mir im Arm hält, das, was heute getauft werden soll, hat ihm nur ein sarkastisches Lächeln entlockt. Giuseppina presste die Lippen zusammen.
Nach der Andacht wäre ihre Schwester die Patin, sie würde das Kind zurück nach Hause in die kleine Wohnung tragen, aus ihren Augen. Sie wollte schon ein kleines Dankesgebet an Gott schicken, doch im letzten Moment hielt sie inne. Gott nahm so etwas übel, er würde ihr zur Strafe ein Mädchen nach dem anderen schicken, und Ciro hätte noch die nächsten zwanzig Jahre das Recht, in der Nacht zu ihr zu kommen. Nein, nur nicht daran denken, einfach nicht daran denken. Hastig bekreuzigte sie sich.
5
An diesem Morgen war Tommaso rundum zufrieden mit dem Leben. Für Anfang November war es nicht besonders kalt, und auch der Wind, der sonst um diese Jahreszeit oft nass und schwer vom Meer über die Stadt fegte, war kaum spürbar. Auf dem Hinweg zur caserma