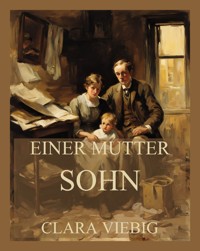Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mine und Bertha sind Dienstmädchen vom Lande, die nach ihrer Übersiedlung nach Berlin schmerzhaft erfahren müssen, wie hart und entbehrungsreich das Leben in der zunächst so verheißungsvollen Großstadt in Wirklichkeit ist. Trotzdem geben sie ihre Träume nicht auf und hoffen auf ein Ende dieses schweren Lebens. "Nein! Sie schrie laut auf! Nicht mehr dienen! Auch einmal herrschen, wie andere herrschen! Sich einmal nicht mehr schinden, sich nicht mehr hin- und herjagen lassen, sich nicht mehr ducken, sich nicht mehr die Nägel abarbeiten: nur um das bißchen tägliche Brot!" Doch Berthas anklagender Stoßseufzer wird sich wohl kaum jemals erfüllen, und auf eine Frau, die nicht mehr dient, wartet die Gosse … "Das tägliche Brot" gehört in die Reihe der frühen Berliner Großstadtromane Viebigs, die sich durch ein waches Auge und ein offenes Ohr für soziale Missstände auszeichnen und ein flammendes Plädoyer für eine menschlichere Welt zum Ausdruck bringen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 621
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Clara Viebig
Das tägliche Brot
Roman
Saga
I.
Hinter dem sandigen Hügel hebt sich eben die Sonne empor. Die Kiefern auf der Höhe werden rot umstrahlt, haarscharf zeichnet sich jede Nadel der struppigen Äste auf dem durchglühten Morgenhimmel ab. Ein scharfer Frühwind weht; das Hungermoos, das, grauweißen Bartzipfeln gleich, an den Stämmen hängt, flattert. Zuckende Lichter überhuschen die spärliche Grasnarbe, die kaum die knorrigen Wurzeln deckt, fingernde goldne Strahlen greifen hierhin und dorthin, strecken sich länger und länger, leuchten wärmer und wärmer.
Unten in der endlosen Weite der Felder noch bleichgrauer kalter Dämmerschein. Dampfende Nebel steigen aus den Senkungen und ziehen ihre weißen Gespinste über den Acker, bis sie fern an der blauen Wand des Waldes in Fetzen zerflattern.
Fahl schimmern in der Dorfgasse die gekalkten Giebel der Hütten, nur die hohen Mauern der Kirche zeigen schon warme Reflexe. Die Kastanienbäume am Portal schütteln sich, daß ein Regen von nachtfeuchten, gelben Blättern niedertrieft; ein herber bitterlicher Herbstduft steigt auf vom fallenden Laub.
Auf dem Pfuhl an der Straße rudert eine Schar Enten; lautlos, langsam, wie verschlafen, folgt eine der andren, einen helleren Streifen im dunklen Wasser nach sich ziehend. Jetzt richtet sich der Enterich kerzengerade auf, schlägt das Wasser mit den Flügeln, daß Tropfenperlen rings versprühn —, die ganze Schar bricht in lautes Geschnatter aus.
Auf Barthel Heinzes Dunghaufen erhebt der Hahn ein durchdringendes Kikeriki; feurig glühn die Firste der niedrigen Strohdächer, die Heinzen stößt die Läden auf — in der Stube wird es hell.
Der Tag ist da.
„Mach der nu uff“, sagte der Bauer zur ältesten Tochter und erhob sich schwerfällig hinterm Tisch, der die Reste des Frühstücks: Brotkrumen, Kartoffelschalen und den geleerten Suppennapf zeigte. „Laß der’sch gutt gehn, un schreib ooch! Halt der brav! Daß de tüchtig was sparst im Dienst! Schick’s Geld nur glei heeme, ich tu’s in Schwerin auf de Sparkass. Laß der nich beifallen, daß de’s verjuxst! Das sag ich der: kommste heeme un hast nischt vor der gebracht, kriegste de Hucke voll!“
„Ich wer’ schon, Vatter, ich wer’ schon“, versicherte die Tochter.
„Ei, die Mine is doch een guttes Kind“, sagte die Mutter weicher und strich mit der knochigen Hand dem Mädchen die Falten am kornblumenblauen Sonntagskleid herunter. „Was der Stoff sich scheene trägt! Verunjenier nicht, Mine! Ei, Heinze, laß nur, se wird sich schon schicken in Berlin. Arbeiten kan se — ju ju, das hammer se gelehrt. Da ist keine Herrschaft nich betrogen. Laß der nischt vormachen, Mine, laß der nich die Butter vom Brot nehmen, ooch von de Herrschaft nich! Kuck, daß de zu was kommst, schick brav heeme und bleib gesund!“
„Ich — wer’ — schon!“ Nun schluchzte das Mädchen.
Obgleich Wilhelmine Heinze schon zweiundzwanzig Jahre zählte und eine große breitschultrige Person war, die ihren Zentnersack Kartoffeln auf dem Rücken schleppte, so weinte sie doch wie ein Kind. Nun es ernstlich an den Abschied ging, wurde ihr der so schwer, wie sie es nie für möglich gehalten. Mit einem langen Blick sah sie sich im Zimmer um, wo die Kuckucksuhr an der Wand tickte und neben dem Ofen das hochgetürmte Bett der Eltern an der Wand stand.
Sie machte ein paar Schritte nach dem schmalen Türchen hin, das in die Kammer führte, darin sie so lange mit den drei jüngeren Schwestern gehaust. Da drinnen hing das Jahrmarktsspiegelchen, vor dem sie sich mit den Schwestern sonntags immer gepufft, denn jede wollte zuerst hineinschauen; da standen auf dem Fensterbrett die Geranien und Pantoffelblumen, die so überreich blühten.
Mit einem Schmerzenslaut sank Mine wieder auf den Sessel zurück und hielt sich die Hände vors Gesicht.
„Nu, nu“, begütigte die Mutter, „barm nich gar so sehre!“ Sie schnüffelte gerührt und wischte sich mit dem Handrücken unter der Nase her.
„Hast ja selber partu nach Berlin machen wollen — Mine, sei doch verständig! Denk an, was de verdienen kannst, bares Geld! Ihr seid der Kinder sechse, ju ju.“
„Was willste denn ooch derheeme?“ sprach der Vater. „Der Maxe und die Cilla sind lang groß genug, de Male wird Ostern eingesägent — wer schaffen unsere Arbeit alleene.“
Mit feuchten Blicken sah Mine die Geschwister der Reihe nach an. Der Vater hatte recht, groß genug! Da war der Max, ein kräftiger Bursche von nahezu achtzehn, gewachsen wie eine Tanne. Da war die Cilla, stämmig und breithüftig, wie eine Frau anzusehn trotz ihrer sechzehn Jahre. Da die Male, die die Zöpfe auch schon aufsteckte; da der Heinrich, der die Gänse, die Schweine und die Kuh hüten konnte, und da die Emma, die schon zur Schule ging. Mine nickte verständnisinnig — so war’s schon recht, eine mußte weg! Es waren der Mäuler gar zu viele für Barthel Heinzes Acker; das Haus war eng, man konnte doch nicht so aufeinander hocken. Wenn nicht der Peter und die Lisa, die nach ihr im Alter kamen, schon als Kinder miteinander im Entenpfuhl ertrunken wären, hätte sie längst fortgemußt. Und hatte sie denn auch nicht selbst den Wunsch, endlich einmal einen Groschen eigen zu haben? Die Mädchen, die nach der Stadt gezogen waren, erzählten Wunderdinge. Zuweilen kam eine zu Besuch nach Haus, dann lief das ganze Dorf zusammen, stellte sich vor der Tür auf oder lugte durch die kleine blasige Scheibe, hinter der die Heimgekehrte, in der Pelerine mit Perlenbesatz, in dem großen weißen Strohhut mit Seidenband und langer weißer Feder, stand und sich von den stolzen Eltern bewundern ließ. Selbst recht wohlhabende Bauerntöchter verschmähten es nicht, für ein oder zwei Jahre nach Berlin zu gehen, in „Pennssjohn“ (Pension), wie sie sagten.
Mit Blitzesschnelle zogen die Gestalten städtisch geputzter Mädchen an Mines innerem Auge vorüber — manch eine kam heim mit ’nem schönen Sparkassenbuch, heiratete gut oder machte auch in Berlin eine Partie, die sich sehen lassen konnte. Da lag ja ohnehin das Glück auf der Straße; leichte Arbeit, hoher Lohn. Nein, es war doch gut, daß sie selber ging und sich nicht von der Cilla zuvorkommen ließ, die immer drum redete. Gut, daß sie zu der gesagt: „Hör uff mit dem Gebelber, ich bin die ält’ste, ich han die Vorhand.“
Mit einem energischen Ruck sprang Mine auf und wischte sich, wie vorhin die Mutter getan, mit dem Handrücken die Nase; dann auch die Augen. Groß und stark stand sie vor den Eltern und reichte ihnen die Hand zum Abschied.
„Adje! Bleib gesund, Vatter! Adje Mutter! Bleib gesund!“
„Adje, Mine“, sprach der Vater, nahm die Pfeife aus dem Mund und betrachtete sie kritisch. „Scheene is se nichtmehr! Kannstmer zu Weihnachten ’ne neue schicken. Geh ooch zur Kirche, Mine!“
„Ju ju“, fiel die Mutter ein.
„Spar fleißig!“
„Un schick’s glei heeme!“
„Schreibt bald!“ Nun kamen der Tochter doch wieder die Tränen.
„Schreib du ooch bald!“
Mine reichte den Geschwistern der Reihe nach die Hand, erst den Großen, dann den Kleinen. Emme hing sich ihr an den Hals; sie hatte das Kind, das sie von seiner ersten Stunde an gewartet, immer sehr lieb gehabt, nun küßte sie es schallend auf Mund und Wangen. Immer tiefer bückte sie sich, um ihren Kummer zu verbergen.
„Bust du wehleidig“, lachte Cilla und gab ihr einen freundschaftlichen Klaps auf den Rücken. „Siehste, hätteste mir ziehen lassen!“
„Ich geh schon“, murmelte Mine und richtete sich auf. „Adje alle zusammen, bleibt gesund! Komm, Maxe, faß an.“
Verdrossen schlorrte der lange hübsche Bursche heran. Sie zogen den Reisekorb aus der Kammer; klein war der nur und nicht schwer, aber funkelnagelneu, für vier Mark fünfzig auf dem Schweriner Jahrmarkt erstanden. Mit Stolz ruhte Mines Blick auf ihm.
Alle gaben sie der Scheidenden das Geleit bis zur Tür.
„O du mein Harre!“ schrie plötzlich die Mutter auf, „de Eier for Tante Male!“ So rasch ihr offner Beinschaden, an dem sie litt wie alle Weiber in ihren Jahren, es erlaubte, humpelte sie ins Zimmer zurück, wo unterm Bett der Henkelkorb stand mit den seit Wochen gesammelten „frischen“ Eiern. Mit einem beruhigten: „Su!“ kam sie wieder zurück und hing der Tochter den ziemlich schweren Korb an den noch freien Arm.
„Die Reschken mecht scheene kucken, wenn ich ihr nischt mitschicken täte vors Geschäft. Gib Obacht, Mine, zertepper nischt. Und sprich zur Muhme: ‚En scheen Gruß von der Mutter, fünf Mandeln, ganz frisch gelegt!‘ Es kommt dir zugutte, Mädel, sie verschafft dir dafor en reichen Dienst. Und sprich ooch, daß sie nicht vergißt, daß sie Malen ihr Pate ist, zu Ostern wird sie eingesägent. Adje!“
Die Eltern blieben auf der Schwelle stehen, die Geschwister liefen noch ein Stück des Wegs mit. Die Kleinen halfen den Korb tragen und zankten sich mit dem Bruder, weil er behauptete, sie machten ihm die Last nur schwerer. Male blieb ein wenig zurück und las die Pflaumen auf, die über die Planken der Gartenzäune gefallen; es kam ihr auch gar nicht darauf an, den überhängenden Ast eines Apfelbaumes derb zu schütteln.
Cilla hatte sich der Schwester an den Arm gehängt und tuschelte ihr noch allerlei in die Ohren. „Schaff der bald ’nen Schatz an — mit Freiers Emil war’s doch nischte — einen vons Militär, hörste, ’nen Schneidigen! Und schreib mer ooch dervon!“
Mine nickte. „Kannst der Freiern nur sagen, ihr Emil kann mir jetzt den Buckel lang rutschen; um den wer ich mer wahrhaftig nich mehr haben.“ „Das glaub ich. Un höre, Mine, schickst mer ooch balde ne scheene Schörz, oder sonst was. Ich tu der dafor ooch mal wieder en Gefallen.“
Mine versprach alles. Wie Schatten glitten an ihrem umflorten Blick die stillen Hütten rechts und links vorüber; noch schliefen die Nachbarn, nur ganz in der Ferne klappten zwei Dreschflegel — klipp klapp — klipp klapp.
Am allerletzten Haus, wo der Meilenstein an der Chaussee steht — Schwerin a. W. 7,6 Kilometer — nahmen die Geschwister Abschied.
Rüstig schritten Mine und Max, den Korb zwischen sich, über die einsame Chaussee.
Noch war die Sonne nicht ganz durchgebrochen, sie kämpfte noch immer. Auch der feurige Schein auf dem Gipfel des Golmützer Sandbergs war wieder erloschen, die Kiefern waren nicht mehr rot angestrahlt. Dichte weiche Schleier hüllten den goldenen Ball wieder ein; über die Äcker, rechts und links vom Weg, flogen weiße Nebelfetzen, vom Morgenwind getrieben. Es graute und braute in den Gründen und wogte und quirlte. Leise tropfte es von den Chausseebäumen, die Gräser am Grabenrand glänzten versilbert, und die niedrigen Wacholderbüsche trugen Schleierhauben.
Die Gestalten der beiden Geschwister gingen wie in lauter Dämpfe gehüllt. Das lange Band an des Mädchens Hut flatterte im feuchtfrischen Herbstwind; jetzt wurden die Weiberröcke fest an den Körper gepeitscht, jetzt blähten sie sich gleich Segeln in der unruhigen Morgenluft.
„Kommen mer ooch nich zu späte, Maxe?“ fragte Mine ängstlich und beschleunigte ihre Schritte. „Die Jesebahn geht gegen sieben — weeßte’s ooch genau?!“
„Zeit de Masse“, sagte der Bursche phlegmatisch. „Renn doch nich su! Kannst’s wohl nicht mehr derwarten. Na, paß uff, wann ich beis Militär komme, mach ich ooch nach Berlin.“
„Da freu ich mer, wenn de kommst.“
„I, da wirschte wenig von mer zu sehn kriegen. Da hab ich mehr zu tun; bei der Garde seh ich alle Tage den Herrn Kaiser. Un ich laß mer den Schnurrbart stehn. Un sonntags geh ich tanzen. Das wird en Leben!“ Er reckte seine schlanke Gestalt noch höher und drückte die Brust heraus. „Da wird mer mal uffatmen, beis Militär!“
Sie lachte ihm ins Gesicht. „Drillen werden se der!“
Er maß sie mit einem verächtlichen Blick. „Was du weeßt, dumme Trine!“
„Dummer Bengel!“
Mit einem plötzlichen Ruck setzte er den Korb nieder.
„Da, kannst der deinen Dreck alleene tragen.“
„Aber Maxe!“
„Nä, nä, ich will nich, du bist mer zu frech!“
„Aber Maxe, du hast doch angefangen! Ich han ju gar nischt gesagt. Maxe, faß doch an, die Jesebahn wart nich! Maxe!“
Dummtrotzig und breitbeinig stand er da, hatte ein Hölzchen aus der Westentasche gezogen und stocherte sich damit in den Zähnen. „Da siehste’sch, immer kujonieren — nä, nä. Der Alte kujoniert, die Alte kujoniert, un nu willst du ooch noch kujonieren?! Ich bin froh, daß de fortmachst, du Drache!“ Er sah sie mißmutig an; dann spuckte er aus. „Verfluchte Schinderei! Nä, nä, nur keen Bauer! Nä, ich will nich. Du hast’s gutt, du machst nach der Stadt.“
„Maxe, so helf mer doch! Maxe!“ Sie legte sich aufs Bitten. „Ich schick der ooch was scheenes.“
„Wahrhaftig?“ fragte er mißtrauisch.
„Wahrhaftig.“
„Na, denn los!“ Schnell versöhnt lachte er sie an, daß man seinen letzten Zahn sah. Rascher eilten sie davon. Mines blühende Wangen wurden röter und röter, sie hastete sich in Angst wegen der Eisenbahn. Max fluchte schon.
Da — Rädergeroll hinter ihnen. Sie sahen sich um. Aus dem Nebelgewoge, in dem das Dorf verschwunden war, löste sich ein dunkler Gegenstand und kam rasch näher. Ein Pferdekopf schnaufte sie an, ein Kalb blökte. Das war wohl der reiche Bauer Obst aus Rokitten, der ein Mastkalb nach Schwerin zu Markte fuhr.
„Morjen!“ Bescheiden traten die zwei an den Grabenrand.
„Morjen!“
Überrascht blickte Mine auf — ei, war das nicht Fidlers Bertha, die Tochter von der „Weisen Frau“?!
Richtig, da tauchte ihr blonder Kopf hinten im Wägelchen neben dem Kalb auf! Sie hatte dem großäugigen, ängstlich dreinblickenden Tier den Arm um den Hals gelegt und lachte nun übermütig. „Wir beide vertragen uns ganz gutt, was meenste, Schatz? Muh!“ Sie küßte das Kalb auf die Schnauze.
Der Wagen hielt; der Bauer mußte sich ausschütten vor Lachen. „Nä, das ist eene! Hahaha!“ Die konnte einem den Weg verkürzen. Gut, daß er der erlaubt hatte, aufzusitzen, als sie ihn in Golmütz anhielt.
„Seid ihr nich ooch aus Golmütz, dem Barthel Heinze seine?“ rief er wohlgelaunt die Geschwister an. „Steigt nur ooch uff!“
Nun hätte Max füglich umkehren können — der Reisekorb stand ganz hinten im Wägelchen, die beiden Mädchen setzten sich darauf —, aber Schwerin ließ er sich nicht so leicht entgehen. Es war ihm ein Hochgenuß, die Hände in den Hosentaschen, die Zigarre im Mund, über das holprige Pflaster des Städtchens zu schlendern. Wie ein Herr! Und so kroch er eilends, der Schwester nach, hinauf und kauerte sich, wie ein Türke mit untergeschlagenen Beinen, zu Füßen der Mädchen nieder. Das ängstliche Kalb guckte ihm über die Schulter.
„Machste nach Berlin?“ fragte Fidlers Bertha Heinzes Mine.
„Ju ju. Und du?“
„Ooch nach Berlin.“
„Ei, das trifft sich scheene! Da können mer uns ja zusammentun!“ Mine vergaß ganz, daß ihr Fidlers Bertha nie recht gefallen hatte, und daß sie bis dahin kaum mit der gesprochen.
Sie waren auch wenig in Berührung gekommen. Mine schaffte hart auf dem Feld; die Witwe Fidler hatte keinen Acker, die war mehr städtisch. So saß die blonde Bertha am Fenster hinter den halb zurückgezogenen Gardinchen und häkelte Kanten; oder wenn’s hoch kam, schlenderte sie in den kleinen Garten am Haus und wirtschaftete ein bißchen an dem schmalen Gemüsebeet herum. Meist aber waren der Salat und die Rüben von Unkraut überwuchert, und die Tochter, in einer zierlichen Schürze, stand an der Haustür und schwatzte mit den Kunden der Mutter. Frau Fidler war viel begehrt und mehr auswärts auf den umliegenden Ortschaften als daheim.
Jetzt wo Mine so allein hinaus in die Fremde sollte, zu lauter Unbekannten, kam ihr die Bertha wie eine Freundin vor. Sie preßte zutraulich deren Hand.
„Nä, wie mer das aber freit! Warum haste mersch denn nich ehnder gesagt, daß de ooch nach Berlin machst?!“
Die andere lachte. „Keenen Schimmer nich han ich vorher davon gehatt! Es gefällt mer aber uff eenmal nich mehr zu Haus. Alles alleene klauen — de Mutter ist immer weg, un wenn se zu Haus is, kippt se eenen; un dann schnarcht se entweder, oder se räsoniert. Das paßt mer noch lange nich. Un als se gestern so geschimpft hat, dacht ich: ‚Na wart! Heut nacht is se beim Bauer Reim zu Liebuch, der hat se gestern abend mit dem Wägelchen geholt; de Frau kriegt’s sechste. Da läßt se sich’s immer wohl sein, da dauert’s lange. Wenn se von da wiederkommt, bin ich bald in Berlin. Hahaha!“ Sie lachte ihr helles Lachen.
„Nä — aber“, stotterte Mine ganz verblüfft.
„Recht hat se“, brummte Max beifällig.
„Was ich brauch, han ich vorerscht!“ sagte Bertha und stieß mit dem Fuß an ein nachlässig zusammengerolltes Bündel und eine Pappschachtel, die sie unter das Kalb geschoben. „Das andere Gelumpe kann se behalten, da is nischt mit los. In Berlin schaff ich mer doch alles neu an. Du sollst mal sehn, was ich forn Hutt krieg! Vom erschten Lohn wird er angeschafft.“ Sie hielt den hübschen Kopf so aufgereckt, als trüge sie schon einen Florentiner mit lauter weißen Federn darauf.
„Du bist eene!“ stieß Max hervor und betrachtete sie mit bewundernden Blicken.
Sie fuhr mit leichter Hand ums Kinn. „Gefall ich der? Das ist recht, Jüngelchen!“
Er brummte Unverständliches. Daß sie ihn „Jüngelchen“ nannte, empörte ihn. Wußte sie nicht, daß er bald achtzehn war, so alt wie sie?! Daß er ein forscher Kerl war, wollte er ihr schon beweisen. Er suchte ihren Fuß unter dem Gewirr von Beinen, das sich auf dem engen Räumchen zusammendrängte, glitt mit der Hand höher hinauf und kniff sie tüchtig in die Wade.
Mit einem hellen Schrei fiel sie rücklings über; Mine hielt sie besorgt fest und faßte zugleich nach ihrem Eierkorb, der ins Wanken geraten war.
Der Bauer drehte sich auf dem Kutschsitz um: „Nanu, was ’s denn los?“ Mine war sehr böse auf den Bruder, aber Bertha lachte aus vollem Halse — war das ein Spaß! Von nun an schaute sie den jungen Menschen immer mit einem schelmischen Blinzeln an.
Sie erzählten sich noch dies und das; der ganze Dorfklatsch wurde abgehandelt. Bertha gab manches Späßchen zum besten — was kriegte die nicht auch alles zu sehen und zu hören! Nur als Bauer Obst auf einen Schatz anspielte, hatte sie keine Ohren.
„Das sollt mer fehlen“, fertigte sie ihn kurz ab. „Ich weiß, wie’s zugeht, uije! Dafor bin ich meiner Mutter Tochter. Nä, nä —“, sie schüttelte sich in einem inneren Grausen —, „ich will vorerscht mein Leben genießen.“
Mine wußte darauf nichts zu sagen, sie verstand die andere nicht einmal. So legten sie schweigsam das letzte Viertel des Weges zurück. Die Sonne hatte den Nebel durchbrochen und stand groß und leuchtend über der Flur. Weit hinten in dem Gewirr von Strahlen lag das Heimatdorf; man konnte es längst nicht mehr sehen, und doch blickte Mine zurück, bis ihr die Augen übergingen.
Unverlaßbar teuer dünkten ihr auf einmal die weiten Felder, über die der Wind strich; von den blauen Kiefernwäldern herüber kam ein harziger Duft. Sie stieß einen Seufzer aus und zog den Duft ein, als sollte ihr die Brust springen. Die Schwalben waren schon weggezogen, leer waren die Drähte zwischen den Telegraphenstangen, auf denen sie sonst gereiht saßen — ein weißer Brustlatz neben dem anderen. Aber auf der Wiese dort, in der Niederung, stand noch ein einsamer Storch, regungslos auf einem Bein. Mine hielt den Atem an — blieb der hier? Aber Bertha schrie laut: „Husch, husch, puff!“ Langte dem Bauer über die Schulter, ergriff die Peitsche und knallte übermütig. Da breitete der Vogel die Schwingen aus und flog hoch in die Luft, bis er nur mehr wie ein dunkler Fleck gegen die helle Sonnenscheibe stand.
Der blieb also auch nicht hier! Mine gähnte; sie fühlte sich durchfröstelt und übernächtigt, ihr war gar nicht gut zu Mut. Hatte sie doch auch fast keinen Schlaf bekommen. Gestern, nach Feierabend, war sie im Sonntagskleid zu den Nachbarn gegangen und hatte sich verabschiedet; heimgekehrt, hatte sie den Staat abgelegt und noch bis spät Mitternacht der Mutter den Brotteig geknetet, die Milchsatten abgerahmt, gebuttert, Brennholz gespalten und den Flur gefegt. Dann erst noch in ihrer Kammer die letzten Sachen in den Reisekorb getan, und als sie sich endlich niederlegte, beengte sie die fest schlafende Emma, mit der sie das Bett teilte. Sie hörte die Turmuhr jede Stunde schlagen; ein seltsames Gemisch von Freude und Schmerz nahm ihr den Schlaf.
Blaß und nachdenklich saß sie auf dem Wagen, älter erscheinend, als sie in Wirklichkeit war.
Fidlers Bertha dagegen traute man nicht einmal ihre achtzehn zu. Die sah blutjung aus, frisch wie eine Heckenrose und ebenso hübsch wie diese. Ihr blondes Haar glänzte seidig; sie trug es glatt aus der reinen Stirn gestrichen, nur im Nacken hatte sie sich mit der Tollschere, die die Mutter zu ihren Hauben brauchte, ein paar Löckchen gebrannt. Aus ihren klaren blauen Augen schaute sie vergnügt in die Welt; sie hatte einen Kinderblick.
Als jetzt der Wagen auf der Höhe der Chaussee angelangt war und unten in der Niederung der Warthe das Städtchen sich präsentierte, mit seinen zwei Türmen, dem Rathaus und dem Brückenbogen über dem Fluß, richtete sich Bertha hoch auf. Sie stieß einen Freudenschrei aus: „Siehste, da — da, das rote Haus?! Das is der Bahnhof — da is de Jesebahn, da fahren mer nach Berlin!“ Sie strahlte vor freudiger Erwartung, die blonden Haare flatterten ihr im lustigen Wind, beide Hände streckte sie aus, als wollte sie so das Glück ergreifen.
Mine nickte, ohne zu sprechen.
Sie fuhren durch die Kirschbaumallee, die die Hopfenpflanzungen bis zur Stadt durchzieht. Wenig verschrumpelte Blätter nur mehr an den Bäumen, und auch diese bereit, im nächsten Windstoß davonzufliegen. Als Mine das letztemal hier gegangen, war’s Sommer gewesen, und der Pächter, der gerade Kirschen pflückte, hatte ihr ein paar Hände voll prächtiger roter Früchte geschenkt. Das Wasser lief ihr noch im Munde zusammen.
Die ländliche Stille der Felder war zurückgeblieben; in den Scheunen der Vorstadt klapperten noch nach altbäuerlicher Weise die Dreschflegel. Aber schon mischte sich das Fauchen einer Maschine ein. Jetzt sprühten Funken aus einer offenen Schmiede. Das Kalb entsetzte sich und hielt sich kaum mehr auf den zitternden Beinen.
Die Wagenräder ratterten über das Pflaster, Fenster klirrten, Ladentüren klingelten, ein Radfahrer kam angeschnauft, eine Glocke gellte. Menschen standen zur Seite. Schulkinder liefen johlend dem Wagen nach. Das Kalb stieß ein angstvolles Blöken aus, einen jämmerlichen tierischen Hilferuf.
„Halt’s Maul!“ Bauer Obst hob ärgerlich die Peitsche.
Jetzt kam das Haus des Schlächters an der Ecke, mit der fettigen, trägfließenden Gosse davor; Kalbsviertel und Speckseiten, Würste und blutiges Geschlinge baumelten im Fenster. Die roten Gardinchen der Ladentür flatterten in einem plötzlichen Windstoß und reckten sich lang in die Gasse wie gierige Zungen.
Die Ohren spitzend, die Augen herausdrückend, stieß das zitternde Kalb einen markerschütternden Schrei aus und machte einen wilden Satz; es wäre vom Wagen gesprungen, hätte Max es nicht noch gerade bei einem Hinterbein erwischt.
„Brr — hott, hü! Verdammtes Beest“, schimpfte der Bauer.
„Es riecht das Blut“, sagte Bertha lachend und hob witternd das Näschen.
II.
Unterwegs hatten sie innige Freundschaft miteinander geschlossen. Mine dachte, allein hätte sie wohl nie die Reise überstanden; so lange war sie noch nie Eisenbahn gefahren. Es war sehr heiß im Coupé vierter Klasse, der Schweiß rann ihr von der Stirn. Ihr blaues Staatskleid, das für Winter und Sommer diente, engte sie ein wie ein Panzer; um all ihre Sachen gut wegzubringen, hatte sie noch einen Alltagsrock darunter gezogen. So kühl es am Morgen gewesen, so sehr stach die Septembersonne am Mittag. Die kleinen Fensterscheiben blendeten vor Glanz, man konnte kaum einen Blick hindurchwerfen. Unzählige Stäubchen tanzten im Sonnenstrahl, fingerdick lag der Kohlengrus auf dem Boden, auf den Bänken, auf den Menschen. Es war Mine, als müsse sie die Luft förmlich durchbeißen; kein Atemzug ging leicht.
In Landsberg hatten sie die Klingelbahn verlassen, um über die Warthebrücke nach der Hauptbahn, deren Schienennetz sich wie ein unlösliches Gewirr nach allen Seiten spannt, zu gehen. Mine rannte hin und her, wie ein aufgescheuchtes Huhn. Bertha half ihr den Reisekorb tragen, aber er wurde ihr bald zu schwer, immer wieder mußte sie verschnaufen; als sie schweißgebadet auf dem Hauptbahnhof ankamen, fuhr der Zug eben ab. Mine war sehr bestürzt, Bertha lachte, eine nette Gelegenheit, Landsberg zu besehen! Aber den Perron zu verlassen, war die andere nicht zu bewegen; stumm und steif saß sie für Stunden auf ihrem Reisekorb, wendete das rotglühende Gesicht nach jener Seite, wo hinter Geleisen und Signalstangen die freie Weite flimmerte, und starrte mit aufgerissenen Augen.
Nun, am Nachmittag näherten sie sich endlich Berlin. Schon schrie Bertha, die sich ungeduldig weit zum Fenster hinauslehnte, daß sie unzählige Häuser, groß wie Schlösser, Türme und Schlöte sehe; da wurde es Mine sehr angst. Die Gefährtin am Kleid zurückzerrend, haschte sie nach deren Hand: „Bleib bei mer!“
Bertha nickte.
„Komm mit bei de Reschken, da kost’s dir ooch nischt. Ich han dersch ju gesagt, die is Vermieterin, die schafft der ooch en gutten Platz. Komm mit!“
Bertha schlug sich auf die Knie vor Vergnügen bei dem Vorschlag; sie wußte sowieso nicht wohin. Und wenn sie sich auch weiter keine Sorge darum gemacht — es sollte ja überall auf den Bahnhöfen stehen: „Heimathaus für stellensuchende junge Mädchen, Stellennachweis“ — besser war’s doch, mit der Bekannten zu gehen. So umarmte sie Mine, und diese drückte ihr fest die Hände.
Am Bahnhof Friedrichstraße waren sie wie betäubt. Gedrängt, geschoben, gepufft, geschimpft, angeschrien, ausgelacht, retteten sie sich endlich aus der hastenden Menge. Hinunter auf die Straße waren sie endlich gekommen, aber da standen sie nun, an einen Pfeiler der Stadtbahnbogen gelehnt, und schauten verwirrt in das brandende Meer der Stadt.
„Göbenstraße achte, Göbenstraße achte“, murmelte Mine unablässig — da wohnte die Tante. Aber wie kamen sie dahin?! Ein trostloses Gefühl bemächtigte sich ihrer. Auch Bertha war etwas kleinlaut, ihr hübsches Gesicht war blaß; sie war müde, hungrig und durstig. Die paar Käseschnitten, die Mine unterwegs treulich mit ihr geteilt, hatten zwei gesunde Mägen nicht befriedigen können. Auch schmerzten sie die Arme vom vielen Schleppen der vielen Sachen; der Bindfaden des Kartons, darin ihre größten Schätze — die rosa Bluse, der blanke Gürtel, die zwei Nachtjacken mit breiter Häkelei, der gestärkte weiße Unterrock, die Pelzboa, das perlbestickte Cape, das der Bauer Freier der Mutter geschenkt, als seine Frau im Kindbett gestorben — schnitt sie tief in die Finger.
Kein Mensch achtete auf die beiden, jeder hatte mit sich zu tun. Da kamen ein paar junge Leute vorbei, feine Herren, Bertha sah, wie der Blick des einen sie streifte; instinktiv fühlte sie das Wohlgefallen in diesem Blick. Kurz entschlossen trat sie heran: „Entschuldigen Se, können Se uns nicht sagen, wie mer nach Göbenstraße achte gehen?“
Er lächelte über ihr tiefes Erröten. „Das ist weit, zu Fuß ’ne Stunde. Fahren Sie doch, da kommt der richtige Omnibus! Halt!“ Er hielt den Arm in die Höhe; der große Kasten, mit zwei mächtigen Pferden bespannt, hielt an.
Es dauerte eine Weile, bis die Mädchen glücklich untergebracht waren; Mine hatte erst noch einen Kampf zu bestehen, der Kondukteur wollte ihren Reisekorb nicht mit aufnehmen. Ein bittender Blick Berthas entwaffnete den Gestrengen; brummend schob er den Korb unter die Treppe, die aufs Verdeck führte. Behend schlüpfte Bertha der Freundin nach, die mit ihrem Eierkorb am Arm vierschrötig in die enge Tür drängte, zwängte sich zwischen zwei junge Arbeiter, schob dem Linken ihr Bündel, dem zur Rechten ihren Pappkarton halb auf den Schoß und drehte den Kopf nach hinten, um durch die große Scheibe unverwandt auf die Straße zu blicken.
Sie hatte nicht einmal Acht, daß der Kondukteur mit den Billetts kam. Mine mußte für sie bezahlen.
Die hatte sich gleich bei der nebenan sitzenden Frau erkundigt, was es kostete; aber die fünf Pfennige Trinkgeld, die diese ihr zu spendieren anriet, gab sie nicht.
Mine sah nicht auf die Straße, unverwandt guckte sie in den Eierkorb auf ihrem Schoß.
„Sie sind wohl fremd zugezogen, Fräulein?“ fing die Frau neben ihr, die ein mageres, blasses Gesicht und hungrige Augen hatte, ein Gespräch an. Sie nickte nur.
„Nu ebent, det sah ick Sie jleich an! Sie suchen wohl Stellung zu’n ersten Oktober? I, det ist noch ’ne jlückliche Zeit, wenn man for nischt nich zu sorjen hat als for den Reisekorb un de Komode. Alle vier Wochen uff ’ne andre Stelle, wenn die Madame zu ville Krach macht. Ach ja“ — sie stieß einen kläglichen Seufzer aus —, „nu ist nischt mehr los mank all die Jören. ‚Mutta‘ hier un ‚Mutta‘ da!“
Die beiden Arbeiter gegenüber, zwischen denen Bertha saß, zeigten Anteil.
„Ick bin ooch verheiratet“, sagte der eine; Mine hätte ihn kaum für zwanzig gehalten. „Schonlange, drei Jahre!“
„Jotte doch, wenn der Mann arbeet, jeht’s ja noch“, rief die Frau.
„Aber meiner hat erst sechs Wochen in’s Scharretee (Charité) jelejen, un nu hockt er mir schonst das janze Monat zu Hause rum. Happen pappen, jawoll! Aber verdienen is nich. Was meine Älteste is, die Klara, die war mit de Ferienkolonie vier Wochen ins Jebirje, nu hab ick ihr aber seit vierzehn Tagen wieder da, un alles is beim alten: Kopfweh, müde, plierige Augen. Lotte und Fritze haben Stickhusten, un was de Kleenste is, de Mieze, ick jloobe nich, det se’t durchmacht. In’s Polleklinik sagen se: ‚skrophelös, Milch trinken, Eier, alle Tage zwei frische Eier! Jotte, wo soll mans hernehmen?‘“
Und mit der Redseligkeit der Armut, die nichts weiter hat als ihre Leiden, fuhr sie fort: „Un die Miete! Un allens so teuer! Denken Se an, de Mandel Eier eine Mark, un denn sind immer noch ’n paar faule mank — die Ausverschämtheit!“ Unverwandt ruhten ihre hungrigen Augen auf dem Korb des Mädchens. „Ick würde die Kleene so jerne en paar frische Eier jeben, man nur en paar!“ Sie beugte sich dicht auf Mines Korb, ihre mageren Finger streckten sich aus und zogen sich wieder zurück — nun konnte sie sich doch nicht bezwingen, sie tippte auf ein Ei und nahm es in die Hand.
„Janz frisch, wat?“
Mine erschrak; wollte die Frau ihr eins wegnehmen? Zugleich wurde sie böse; was gingen fremde Leute sie an? Sie nahm der Frau das Ei aus der Hand, legte es zu den übrigen und zog das deckende Tuch, das verrutscht war, fest darüber. Es war ein trauriger Blick, mit dem die blasse Frau zusah; noch eine kurze Strecke, dann erhob sie sich seufzend und stieg aus.
Bertha schien von alledem nichts gemerkt zu haben, unverwandt guckte sie durch die Scheibe. Als der Kondukteur „Büloffstraße“ rief, war ihr der Hals von der unbequemen Drehung ganz steif geworden.
Was die hier in Berlin „nah“ nannten! Der Weg von der Bülow- bis zur Göbenstraße dünkte den Mädchen zweimal so weit, wie der durchs ganze Dorf. Und immer blieb Bertha an den Schaufenstern stehen, besonders an den Konditorläden konnte sie nicht vorüber; dann funkelten ihre Augen in einem schimmernden Glanz, hurtig leckte ihre Zunge über die roten Lippen, als schmeckte sie schon Süßes.
Endlich kamen sie an die Göbenstraße.
„Eins, zwei ..., sechs, sieben, achte!“ Mine zählte laut, und doch wäre sie noch in ihrer Verwirrung vorbeigelaufen, hätte Bertha nicht „Halt!“ gerufen.
Mehl und Vorkost
Obst und Gemüse
von Jakob Reschke
stand mit großen weißen Buchstaben auf der mit glänzend himmelblauer Ölfarbe gestrichenen unteren Wandhälfte des Parterres.
Die Holzstufen, die hinunter führten in den Keller, waren rechts und links flankiert von hohen Körben. Obenan ein mit schon welkenden Bohnen gefüllter; diesem gegenüber einer rot von der Suppe, die zerplatzte und zerdrückte Preißelbeeren vergossen.
Das Fenster, in gleicher Höhe mit dem Bürgersteig, bot ein buntes Durcheinander: Kohlköpfe, Gurken, Äpfel, Zitronen, Bücklinge, Birnen, Pflaumen, Heringe, Brot und weißer Käse; in der Mitte ein Körbchen „Garantiert frische Trinkeier“.
An Inschriften war überhaupt kein Mangel, überall baumelte ein Pappstückchen:
Täglich frisches Landbrot
Feinstes Petroleum, pro Liter 18 Pfg.
Einmacheessig
Kleine Fuhren werden gefahren
Perleberger Glanzwichse
Rollmops
Alle Sorten Biere, frei ins Haus
Hier kann gerollt werden.
Größer aber als alle, prangte ein Zettel:
Gesindevermietungsbureau
von Frau Amalie Reschke.
Die Stufen waren feucht, glitschig von zertretenen Gemüseresten. Hier lag ein Kerngehäuse, da ein ausgespuckter Pflaumenstein, dort schimmelten Traubenschalen; alle die Mägde, die unten Obst geholt hatten, probierten auf der Treppe davon.
Es war ein sehr frequentiertes Geschäft, den ganzen Tag schlug die Klingel an, die sinnreich unter einer Treppenstufe angebracht war; sie keifte und gellte und zeterte in einem hohen, ohrenzerreißenden Diskant. War Frau Reschke wirklich einmal hinter der Glastür mit den gegelbten Gardinchen, die in die Wohnung der Familie führte, verschwunden, gleich rief das durchdringende Geschrill sie wieder herbei. Da gabs kein Sich-unbemerkt-in-den-Laden-schleichen, wenn auch die blaulackierten Türen weit in den Angeln zurücklagen und sich erst abends, lange nach zehn, schlossen.
Die Mädchen stellten ihr Gepäck oben nieder und tappten die schmierige Treppe hinunter.
Mine schrak zusammen, daß ihr das Herz im Leibe erzitterte, als unter ihrem derben Tritt auf die Stufe die verborgene Klingel ertönte. Das war ein scharfes, nicht endenwollendes Läuten, ein warnendes, bösartiges, bissiges Gebelfer. Sie wagte nicht, sich zu rühren, der Schweiß brach ihr aus. Gott sei Dank, jetzt hörte es auf! Bertha hatte sie die Treppe vollends hinabgezogen.
Nach der Helle der Straße schien es unten völlig dunkel. Erst allmählich gewöhnten sich die Augen daran und lernten unterscheiden.
Da stand eine kleine dicke Frau hinter dem Ladentisch, der mit Schachteln und Körben, Glaskrausen, Broten und Kruken so hoch bepackt war, daß sie kaum darüber wegsehen konnte. Eine helle Kattunschürze saß prall um die mächtigen Hüften; der Busen, über den der Schürzenlatz sich spannte, zeigte den Schmuck einer rosa Aster.
„Was soll’s denn sein?“ fragte sie außerordentlich freundlich und schmunzelte die Mädchen an.
„Das is se“, wisperte Bertha und puffte Mine in den Rücken. „Nu sei nich uffs Maul gefallen!“
Mine machte ein paar zögernde Schritte gegen den Ladentisch; den Eierkorb wie zum Schutze vor sich hinhaltend, stotterte sie:
„Ich — bin et — de Mine!“
„Wer?“
„Nu, die von Heinzes, aus Golmütz!“
„Jotte doch, Heinzes Mine aus Golmütz?!“ die Frau schlug die Hände zusammen. „Warum sagste det denn nich jleich?! Ick kenne so ville Minens. Na, det ’s ja reizend, daß de hier bist!“ Sie reichte der Nichte die Hand. „Ick sagte schon zu Reschken: ‚Wetten?! Die kommt nich, die is bange vor Berlin.‘ “
„O ne.“
„Na, denn setz der!“ Scharf musternd überflog der Blick der Kennerin die zierliche Gestalt Berthas. „Wen haste denn da mitjebracht?“
„’ne gutte Bekannte.“
„So, Fräulein, Sie suchen wohl auch Stellung? Was? Det wird nich schwer halten.“ Wohlgefällig lächelte die Frau und wendete sich dann gegen die Glastür. „Reschke, Reschke!“
„Was ’s denn los? Ich bin bei’s Bücherführen“, grunzte die Stimme des Mannes hinter der Tür.
„Quatsch! Deine Nichte is anjekommen! Man fix!“
„I, da soll doch!“ Die Glastür öffnete sich, und Reschke in Hemdsärmeln und niedergetretenen Schluffen erschien neugierig. Mit einem geübten Griff faßte er Bertha unters Kinn. „Na, Mächen, du hast der ja janz vermost rausjemausert! Als ich vor neun Jahren bei de Schwester zu Besuch war, warste man noch recht unbedeutend. Aber nanu!“
„Ich bin de Mine, Onkel“, sagte Mine.
„So — du — ?!“ er sagte es etwas langgezogen. „Na, freilich, nu kenne ich der ans Jeschlechte! De Knochen von der Anne, un de Nase von ihm, Heinzen. Na, mach der’s bequem, tu, als wärste zu Hause!“
„En scheenen Gruß von Vatter un Mutter“, murmelte Mine und suchte unter all dem Wirrwarr auf dem Ladentisch ein Plätzchen für ihren Eierkorb. „Selbstgelegte. Unse sein alle zusammen gesund derheeme. Un de Male wird Ostern eingesäjent.“
Es hatte sie zwar kein Mensch gefragt, aber es war ihr so selbstverständlich, von den Ihren zu sprechen, hier, bei den nächsten Verwandten. Der starke Mann da, mit der klumpigen Nase und den freundlichen kleinen Äugelchen, war doch der einzige Bruder der Mutter, ihr Stolz, der Krösus, von dessen Glück sie ihren Kindern und auch anderen Leuten gern und viel erzählte. Mine trat dicht an ihn heran und gab ihm die Hand. „Sei bedankt, Onkel, wenn de mer zu ’ner gutten Stelle verhilfst! Ich möcht auch mein Glück hier machen!“
„Hoh, Hohoho“ — Reschke wollte sich ausschütten vor Lachen. „Da denken se alle, das Jeld liegt hier uff de Straße! Ja, Mächen, da mußte dich an meine Frau verhalten, die hält den Teufel an der Strippe. Soll se ’n for Ihnen ooch mal springen lassen, Fräulein?“ Er zwinkerte Bertha zu. „Red nich so ’n Quatsch“, fuhr ihn seine Frau an, „du weeßt recht jut, wie ’s heutzutage mit die Herrschaften is, die sind zu wählerisch, mit die nettsten Mächens machen se Krach. Un mit ’n Lohn knappsen se, det ’s schon mehr himmelschreiend. Nu machen sie alle von außerhalb nach Berlin, janze Rudel Mächens, un denken wunders, was hier los ist — ja Kuchen! Fünwe, zehne, fufzehn — eene Mandel!“ Sie zählte die Eier. „Fünwe, zehne, fufzehn — Na, aber wir werden schon sehen — zwei Mandeln! Fünwe, zehne, fufzehn — drei Mandeln! Du brauchst keine Bange nich zu haben — fünwe, zehn, fufzehn — fünf Mandeln! Det wär ja noch schöner, du keene Stellung kriegen?! So’n hübschet Mächen, so bescheiden, un so tüchtig! Da laß du nur die Reschken for sorjen!“ „Na siehste’t“, sagte der Onkel und klopfte sie auf die Schulter. Mine strahlte übers ganze Gesicht; Bertha lächelte in sich hinein.
III.
Die Reschkesche Wohnung bestand außer dem Laden und dem großen Zimmer hinter der Glastür, wo das Piano stand und das durch einen Kattunvorhang verdeckte Bett des Ehepaares, aus einer Kammer und einer winzigen Küche. Rechts vom guten Zimmer war noch ein fensterloser niedriger Raum, in dem Kartoffeln und Scheuersand aufgeschüttet lagen und ein paar große Hunde herumlungerten. Mit ihnen fuhr Reschke zum Markte.
Schon des Morgens um drei konnte man ihn auf dem Hof herumschlorren und den Hunden pfeifen hören. Von dem Karren, der im feuchten Hofwinkel stand, zerrte er die Plane herunter und jagte Flick und Flock, die ihn mit eingekniffenem Schwanz umschlichen, mit einem Strickende vor die Deichsel. Herr Reschke spannte an. Sein Ideal war, einmal einen ausgedienten Militärgaul zu besitzen und mit diesem, wenn der Sonntag die Reihe der täglichen Marktfuhren unterbrach, am Nachmittag seine Familie in den Grunewald zu kutschieren. Aber bis jetzt hatte es immer noch nicht zur Equipage gelangt. Arthur sollte studieren, und das kostete viel Geld. So setzte er sich auf den Karren und fuhr einstweilen noch mit den Hunden zur Zentral-Markthalle; die hochbeinigen mageren Bestien jagten durch die noch nächtlich stillen Straßen, als hätten sie den Teufel im Leibe. Wenns not tat, war er um vier schon an Ort und Stelle. Dann ging das Feilschen los, das Bieten und Überbieten bei den Auktionen, das Durchdrücken und Durchpuffen zwischen all den kleinen Handelsleuten, welche sich um die noch vom Bahntransport verpackten Körbe drängten. Kam Vater Reschke aber mit der hochbeladenen Karre, die die Hunde jetzt mühsam durch die lebendiger werdenden Straßen zogen, nach Hause, dann legte er sich wieder in das von der stattlichen Korpulenz seiner Ehehälfte noch angenehm durchwärmte Bett und schlief bis Mittag. Mochte die verborgene Klingel noch so oft bösartig gellen, er schnarchte tief.
Die Kammer, deren niedriges Fensterchen unterm Niveau des Hofes lag und vor deren ewig verstaubten Scheiben der Zugwind allen Kehricht zusammenblies, war dem ältesten Sohne eingeräumt. Ängstlich wachten Vater und Mutter darüber, daß Arthur nicht gestört wurde, wenn er dort bei seinen Büchern saß. Sie hatten sich’s nun einmal in den Kopf gesetzt, der Älteste sollte studieren. Man wußte dann doch, wenn man einen „Herrn Doktor“ seinen Sohn nannte, wofür man sich geschunden hatte. „Er ist sehr helle“, sagte Reschke; seine Frau hatte ihm das eingeredet, auch verfehlte dieser nie, hinzuzusetzen: „Außerordentlich bejabt! Der wird was!“ Amalie Reschke betrachtete ihren Arthur als ein teures Vermächtnis jenes „Herrn Doktor“, der, als sie und ihre Mutter möbliert vermieteten, bei ihnen gewohnt hatte. „Beinah wär ich Frau Doktor geworden“, erzählte sie noch mit Stolz, „wenn er nich an die Jalloppierende jestorben wäre!“ Gerührt wischte sie sich eine Träne aus dem Auge. Ja, sie trug ihren „Herrn Doktor“ noch in gutem Andenken, wenngleich sie damals, in seinen letzten Krankheitswochen, schon angefangen hatte, mit Herrn Reschke „zu gehen“. Reschke war zu jener Zeit Hausdiener in einem Materialwarengeschäft; von seinen Ersparnissen und den mehreren hundert Mark, die der Herr Doktor hinterlassen, gründeten sie einen Grünkram.
In der winzigen Küche schlief die älteste Tochter, Trude, die bei Wertheim Verkäuferin war. Siebzehn Jahre war sie, und obgleich sie im Küchentisch schlief, der nachts zu einem Bett auseinandergeklappt wurde, und obgleich sie sich unter der Wasserleitung waschen mußte, sah sie aus wie eine kleine Dame. Zierlich saßen ihr die billigen Lackschuhe und der buntgewebte Strumpf, den sie gern zeigte, wenn sie, ihr Kleid hebend, auf die Pferdebahn sprang. Sie hielt etwas auf sich. Da sie’s weit zum Geschäft hatte, gestatteten ihr die Eltern für den Winter ein Pferdebahnabonnement; aber sie löste es nur für kurze Zeit, dann lief sie lieber heimlich sich außer Atem und schaffte von dem so erübrigten Geld ein Jackett an, ganz nach der neuesten Mode, von geringem Stoff, mörderisch dünn, aber „schick bis aufs Tüffelchen“. Sie war ganz verliebt in ihr Jackett, es machte so voll in der Brust, so schlank in der Taille; an keinem Schaufenster konnte sie vorübergehen, ohne sich darin zu bespiegeln. Die lange Federboa flatterte ihr bis auf die schmalen Hüften, in ihren durchsichtig zarten Ohrläppchen einer Bleichsüchtigen glitzerten ein paar Glasdiamanten, die kleine Stumpfnase mit den beweglichen Flügeln guckte in die Luft, hinter den blassen, etwas zu vollen Lippen blinkten die weißen Zähne mit krankhaft perlartigem Schmelz. Morgens stand sie eine gute halbe Stunde früher als nötig auf, obgleich sie wer weiß was drum gegeben hätte, noch neben der Schwester Grete im Küchentisch weiter zu schlafen. Sie war immer müde; aber es half nichts, das Haarbrennen dauerte lange. Da lag sie, zähneklappernd im kurzen, roten Wollunterröckchen, auf den Knien vor dem kleinen Stehspiegel, den sie auf den Herdrand plaziert. Zwanzig-, dreißigmal mußte sie die Brennschere in den Zylinder der Küchenlampe stecken, bis alle Wellen des reichen Haares kunstgerecht saßen und an den Seiten mächtig aufgebauscht, den kleinen Kopf unnatürlich verdickten.
Die zwölfjährige Grete war ein armes Wurm, dessen Sprache man kaum verstand. Ihrem Wolfsrachen hätte wohl beizeiten durch eine Operation, durch einen „Verschluß der Gaumenspalte“, wie der Arzt gesagt hatte, abgeholfen werden können; aber Reschkes waren nicht für so was, das kostete zu viel Geld, geringsten Falles Zeit. Vielleicht, daß die Geschichte von selber wieder in Ordnung kam. So blieb Grete die lächerliche Figur für die Geschwister; da sie infolge ihres Fehlers auch nur langsam schlucken konnte, aßen sie ihr das Beste vor der Nase weg. Sie hatte sich nach und nach das Sprechen fast abgewöhnt; als sie verständiger geworden, genierte sie sich. Stumm und scheu drückte sich das blasse, kränkelnde Mädchen an den Wänden entlang; im Laden durfte sie sich nicht sehen lassen, da jagte die Mutter sie gleich hinaus.
Mit der kleinen Elli machten Reschkes desto lieber Staat. Das war „ne findige Kröte“, wie Vater Reschke schmunzelnd sagte; mit ihren sieben Jahren klüger als manch andere, die doppelt so alt war. Die ganze Kundschaft amüsierte sich über sie. Mit ihrer spitzigen Kinderstimme sang sie die beliebtesten Couplets; hatte sie nur einmal eins gehört, gleich hatte sie’s weg. Sie schlief als Nesthäkchen bei den Eltern, in der guten Stube auf dem Sofa.
Es hatte einige Schwierigkeiten gemacht, Mine und Bertha für die Nacht unterzubringen; denn auch letztere dazubehalten, war Frau Reschke willens, zwanzig Pfennige Schlafgeld pro Person und dreißig pro Person fürs Essen. Mine war wie vom Donner gerührt — bezahlen?! Da brauchte man doch nicht zu Verwandten zu gehen und obendrein noch Eier mitzubringen! Sie wollte vor lauter Bestürzung grob werden, aber Bertha trat ihr verstohlen auf den Fuß und sah sie aus den blauen Kinderaugen so mahnend an, daß sie nichts sagte. Nachher flüsterte ihr Bertha zu: „Halt’s Maul! Meenste, ich wer’ mer nachher noch lang mit de Reschken aufhalten? Aber jetzt müssen wer still halten, bis se uns en gutten Platz ausgemacht hat.“ Und Mine sah das ein.
Bertha war den Abend von anhaltender Fröhlichkeit, von großer Anstelligkeit gewesen, half hier, half da und hatte die Augen überall. Als sie, nach Schluß der blaulackierten Türen, Mutter Reschke noch den Laden aufräumen half, war diese ganz begeistert. „Nee, so’n Mächen! Ne, so was! Sie machen Ihr Jlück, det ’s jewiß!“
Auch Reschke blickte schmunzelnd auf, als seine Frau mit Bertha in der Wohnstube erschien. Da war es sehr langweilig zugegangen. Arthur, die Ellbogen aufgestemmt, den Kopf zwischen beide Hände gestützt, stierte in ein Buch; Trude war noch nicht aus dem Geschäft zurück; Elli saß am Pianino und klimperte eine Tonleiter, die ihr das Klavierfräulein aufgegeben; Grete hockte stumm im dunkelsten Winkel. Vater Reschke gähnte, die Augen wollten ihm zufallen; die große Weiße, die er „bei’s Bücherführen“ zu leeren pflegte, war längst ausgekippt. Neidisch spitzte er die Ohren, wenn draußen im Laden Berthas helles Gekicher sich mit dem fetten Lachen seiner Frau mischte. Die Mine war doch gar zu traurig; die saß steif auf dem Stuhl, verzog keine Miene, sprach nicht, hatte die Hände in den Schoß gelegt und rührte sich nicht. Es paßte ihr alles nicht. Im stillen hatte sie doch erwartet, die Verwandten würden den Besuch, der von so ewig weit herkam, ein bißchen mehr „aufnehmen“. Da war’s bei ihnen zu Hause doch besser; wenn sie auch nicht soviel Geld hatten, einen Kuchen von Weckteig, mit Belag von Pflaumenmus oder Quarkkäse, gab’s bei jeder besonderen Festlichkeit. Sie würgte an einer großen Enttäuschung.
Und die Enttäuschung hielt an, als sie sich zu Bertha in das Küchentischbett legte, neben welches die stumme Grete sich einen Strohsack schleppte. Trude, die um elf dreimal an die blaulackierte Tür getrommelt hatte — das war ihr Zeichen — schlief mit Elli auf dem Sofa in der guten Stube.
Mine konnte nicht schlafen, eine ungeheure modrige Schwüle nahm ihr den Atem; sie streifte sich das Bett vom Halse und legte die Arme obenauf. Es wurde doch nicht besser. Im Dunkeln lag sie mit brennenden Augen und glaubte Tropfen von den Wänden, die bei Lampenschein so seltsam glitzerten, niederfallen zu hören.
Ein schauerliches Rasseln ließ sie zusammenfahren; sie tastete nach dem warmen Körper Berthas und flüsterte erschrocken: „Hörste?!“ Die schlief ruhig weiter.
Das prasselte und schnaufte und ächzte! Ein abergläubisches Entsetzen packte die Wachende, sie setzte sich aufrecht im Bett und lauschte — nun wußte sie’s, die stumme Grete schnarchte.
„Biste stille“, schrie sie in unterdrücktem Ton und klopfte an die als Seitenwand aufgeklappte Platte des Küchentisches. Das Rasseln verstummte, und ein leises Knistern des Strohsackes verriet, das die Kleine erwacht war.
Eine schwere Mattigkeit überkam Mine, die Glieder waren ihr wie gelähmt; klebriger Schweiß rann ihr in der dicken, von vielen Lungen verbrauchten Luft am Gesicht nieder, ihr ganzer Körper war übergossen davon. Für kurze Augenblicke umnebelten sich ihre Gedanken — sie glaubte, daheim im Golmützer Forst ins Moor geraten zu sein, zäh und schlammig hing sich’s ihr an die Füße und zog sie tiefer und tiefer; ein scheußlich stinkender Moderduft stieg auf. Sie wollte den Arm heben, sich ans rettende Schilf klammern, — der Arm ließ sich nicht heben, starr, wie tot lag er auf der Decke.
Jetzt wachte sie wieder; und jetzt, gerade, als sie aufschreien wollte: „Diebe!“ fiel ein heller Schein über ihr Bett, und unter ihren blinzelnden Lidern vor sah sie den Onkel, notdürftig bekleidet, torkelnd vor Müdigkeit, auf den Herd zutappen. Er nahm das braune Kaffeetöpfchen aus der noch warmen Asche und tappte wieder hinaus.
Also es war Morgen! Das gab ihr eine Art von Beruhigung; endlich fielen ihr die Augen zu. Sie schlief fest, aber sie träumte Entsetzliches, mattete sich ab in einem vergeblichen Kampf, rang nach Luft, in einem erstikkenden Brodem. Ein kalter Finger, der sie unter der Nase kitzelte, erweckte sie. Sie schlug mit den Armen um sich und wußte nicht, wo sie war.
Die winzige Küche war voll von Menschen. Arthur stand an der Wasserleitung und ließ Wasser in seinen Krug plätschern; Elli sprang im Hemdchen um ihn herum und trieb allerlei Faxen. Vor dem Spiegelscherben kniete Trude, im kurzen Röckchen, und brannte sich den ganzen Kopf voll Locken, während Bertha, in einer ihrer Nachtjacken mit Häkelspitze, dabei stand und aufmerksam zuschaute.
„So müssen Sie sich auch die Haare machen“, riet Trude, „das is schick“.
„Wer’ schon“, sagte Bertha, „später! Jetzt kleid mer das“ — sie strich sich mit beiden Händen über ihr glattes Köpfchen — „noch ganz gutt!“ Sie hatte recht, sie sah bildhübsch aus mit dem glattgesträhnten, weichen Blondhaar, das ein dichtes Flechtennest über dem gar nicht verbrannten, milchweißen Nacken bildete.
Arthurs Krug lief über, das Wasser plätscherte auf den Boden, er hatte nicht acht darauf, seine Augen richteten sich starr auf das hübsche Mädchen und verschlangen dessen Gestalt.
„Du Schlemihl“, schrie Trude, „Gib doch Achtung, das Wasser spritzt mer ja auf die Frisur!“
„Na, wenn schon!“ Nun drehte er den Leitungshahn so weit wie möglich auf, daß das Wasser nach allen Seiten sprühte.
Elli kreischte laut vor Vergnügen; wie eine Balletteuse ihr Hemdchen mit spitzen Fingern fassend, schwenkte sie die Beine und piepte in höchster Höhe: „Ach Schaffnehr, lieber Schaffnehr, was haben Sie jetan?!“ Das war ihr Leib- und Magenstück; im Wintergarten, wohin ihre Eltern sie am ersten Osterfeiertag-Abend mitgenommen, hatte sie’s gehört.
Die anderen lachten, nur Mine nicht, sie war ärgerlich, daß sie verschlafen hatte, und wollte gern aufstehen.
„Langschläfern, man fix“, rief Trude und wollte ihr das Deckbett wegziehen. Mit einem Schrei riß Mine es wieder über sich und warf einen ängstlichen Blick nach Arthur hin.
Dieser fing den Blick auf. „Man los! ich wer’ euch nischt abkucken!“ Er stellte sich breitbeinig hin.
„Er soll rausgehen“, jammerte Mine.
Trude schrie vor Lachen.
„Ach Schaffnehr, lieber Schaffnehr“, kreischte Elli.
Die Wasserleitung plätscherte, oben übers Pflaster rasselten Milch- und Gemüsewagen, an der Fensterluke trappten Arbeiterstiefel vorüber; es war ein Höllenlärm.
„Ruhe“, rief Bertha in alles Getöse hinein. Lachend faßte sie Arthur an den Schultern und schob ihn, ehe er sich’s versah, zur Küche hinaus. Als er ihr einen raschen Kuß aufdrücken wollte, wich sie geschickt aus, entschlüpfte ihm, schlug die Tür vor der Nase zu und drehte den Schlüssel um.
Nach ein paar Minuten drückte jemand von außen auf die Klinke.
„Wer ist da?“
„Nanu“, schallt die Stimme der Reschke, „was soll denn det heißen? Injeschlossen?! Det is nich Mode hier, bei uns kann allens jesehen werden; zu verberjen haben wir Jott sei Dank nischt!“ Sie war schlechter Laune, Reschke war eben wiedergekommen und hatte empörend teuer eingekauft. Den Weißkrautkopf zehn Pfennige im Engros, und die Metze Pflaumen drei Mark! Wenn man berechnete, was einem davon alles verdarb, wie sollte man da etwas verdienen?! Sie rüttelte ganz gefährlich an der Tür.
Bertha schloß rasch auf.
Frau Reschke war noch in Morgentoilette, die aus Unterrock und Nachtjacke bestand. Der starke Busen hing ihr bis auf den mächtigen Leib; in niedergetretenen Filzschuhen schlotterte sie zum Herd. „Wenn ick so lange in de Klappe liejen wollte!“ brummte sie mit einem grimmigen Blick auf Mine, die eben im Begriff war, ihre Strümpfe anzuziehen. „Macht man, daß ihr hier raus kommt! Jeh, Elli, mein Herzblatt, jeh, lege dir noch en bißken bei Papan! Ne, wenn ick det jeahnt hätte, so’n Jeruder!“
Stürmisch rasselte sie mit den Herdringen, durchstocherte die Asche nach ein paar Funken und setzte einen großen Blechtopf mit Wasser auf.
„Mine, wenn de deine Tojilette beendet hast, jeh man bei Onkeln durch — aber leise — rechts in den Keller! Hol den Waschzuber her, er steht mank de Kartoffeln. Ik wer dir de weißen Kleidchens von Ellin einweichen, un Trudes Stickerei-Unterrock, un Arthurs Sporthemd, un Strümpfe und Taschentücher, un sonst noch en paar Kleenigkeiten. Zu’n Sonntag muß allens parat sein. Nanu, wat stehste wie eene von de Puppenbrücke? Immer dalli! Du wirst der wundern, wenn de in Stellung kommst.“
Mine stand in der Tat starr wie aus Stein gehauen; war das dieselbe Frau, die gestern so schmunzelnd hinterm Ladentisch gestanden, mit so einschmeichelnder Stimme gefragt hatte: „Was soll’s denn sein?“
„Ich wer’ gehn, Frau Reschke“, sagte Bertha gefällig und schlüpfte aus der Küche.
Im guten Zimmer überraschte sie Elli, die, während ihr Vater hinter der Gardine schnarchte, Rock und Hose, die überm Stuhl hingen, visitierte, ob nicht irgendein Groschen oder Fünfpfennigstück sich in den Taschen verkrümelt hatte. Als sie Bertha gewahrte, lächelte sie pfiffig. „Der wacht nich uff!“ Und dann setzte sie altklug hinzu: „Heute überhaupt! Er hat ja einen jekippt!“ —
Während Mine am Vormittag in der dunklen, stickigen, vom Brodem der kochenden Lauge noch stickiger gewordenen Küche sich die Hände an der vergrauten Wäsche der gesamten Familie durchrieb, bediente Bertha mit im Laden. Frau Reschke hatte wieder ihre Geschäftsmiene aufgesetzt — hell, freundlich, eitel Wohlgefallen.
„Was soll’s denn sein, Fräulein Thereschen“, rief sie und schlug dann entzückt die Hände zusammen. „Was haben Sie for ’ne neue Frisur, bildschön! Ne, jroßartig, einfach jroßartig!“
Eine hagere, ältliche Person mit einer Hakennase hatte den Laden betreten. Sie trug den Haarknoten spitz vom Hinterkopf abgedreht und eine Menge abgeschnittener und gebrannter Haare über der Stirn hochgekämmt.
„Wie Sie det kleid’t! Reizend! Wie eene von sechzehn!“
Die Person lächelte geschmeichelt und forderte ein Pfund Salz und für’n Sechser Petersilie. Die Reschke schwatzte in einem fort, während sie das Salz abwog und ein großes in Wasser stehendes Bukett Petersilie zerteilte.
„Ja, mit de Petersilie is nischt zu verdienen, reene jar nischt; woanders lassen se nich untern Jroschen ab. Un frisch, janz frisch, heute morgen stand sie noch inn Jarten. Ick kann mer nech zufrieden jeben, wie Ihnen die Frisur steht — was soll’s denn noch sein? Pflaumen oder Weißkohl? Der is heute spottbillig, mein Mann hat besonders vorteilhaft injekauft. Fufzehn un zwanzig Pfennig — na, wie is’t damit?“
„Danke“, sagte die Köchin, „heut wollen se von den neuen rheinischen Sauerkohl mit Sozieschen essen.“
„Jotte doch, so’n schweret Essen! Det’s aber nischt vor Ihren schwachen Magen, Fräulein Thereschen!“
„Na, dann geben Se mer man ’nen Kohl!“ Die Magd nahm einen nach langem Wählen und wog ihn in der Hand. „Was kost der?“
„Fünfundzwanzig.“
„Nanu?“
„Ja, der is auch besonders dick. Der reene Klotz.“
„Fufzehn!“
„Fufzehn —?! Ne, mein Dochter, der kost uns selber mehr als fufzehn.“
Das Mädchen verzog die Lippen. „Das reden Se jemand anders vor! Ne, denn gehe ich zum Kaufmann drüben, das Pfund vom neuen Sauerkohl kost nur zehn Pfennige.“
„Se werden doch nich? I, Spaß! Det wäre! Se werden mer doch de Kundschaft nicht vertragen, Fräulein Thereschen? Ick sehe Ihnen sowieso oft bei’n Kaufmann drüben. Bei Jott, so wahr ick lebe, ick verdiene nischt dran, keenen Pfennig; aber, weil Sie’t sind — da!“ Mit einem Seufzer ließ sie den Kohlkopf in den Korb des Mädchens rollen. „Se sollen nich sagen, daß de Reschken unkulant jegen Ihnen is, wenn se ooch nicht so’n Klimbim von sich her macht, wie der Kaufmann drüben.“
Sie drehte das Mädchen hin und her. „Ne, die Frisur kleid’t Sie! Himmlisch! Wie ’ne Dame! Wie ’ne feine Dame, direkt aus ’s Modeschurnal!“
„Wie ’ne olle Nachteule“, brummte sie hinter der Davoneilenden nach. „Fufzehn! Nur fufzehn Pfennige! De Herrschaft rechnet se doch natürlich zwanzig an. Det klapperdürre Jestelle! Die hab ick auf’n Strich.“
Kaum erschien jedoch eine neue Käuferin auf der Kellertreppe, veränderte sich ihre Miene zauberschnell. Das war wieder der süße Ton: „Was soll ’s denn sein?“
Bertha amüsierte sich köstlich.
Die Stunden von acht, halbneun bis gegen zwölf waren die belebtesten, da flog’s im Laden aus und ein, wie in einem Taubenschlag. Die eine holte Kartoffeln, die zweite Gemüse, die dritte Petroleum, die vierte Heringe, die fünfte Obst. Jede fühlte die Birnen an, ob sie weich waren! Alle kosteten von den Pflaumen, die in einem hohen Korb am Kellereingang standen.
Vor der bleichsüchtigen Marie von Rentiers war kein Obst sicher; selbst in die grasgrünen Äpfel biß sie. In die zwei großen Glaskrausen auf dem Ladentisch — die eine enthielt Kaffeebohnen, die andere Erbsen — langte sie auch hinein. Aber man mußte ein Auge zudrücken, Rentiers kauften immer vom Besten; im Frühjahr den ersten Spargel, im Herbst die ersten Weintrauben.
„Nanu, Mariechen“, fragte Frau Reschke leutselig, „haben Se schon von die Pflaumen jekostet? Fein, was? Nehmen Se sich doch! Sagen Se Ihrer Madam: jroßartige Einmachepflaumen. Hier, kosten Se doch mal die Weintrauben! Was Extras for ihren Herrn Rentier! Se husten ja? Ne, da muß ick Ihnen doch jleich en paar von die neuen Hustenbonbons verehren; schmecken delekat, was? Nur dreiste ringefaßt; wenn se nur helfen! Vergessen Se ’t ooch man nich, Ihre Herrschaft zu sagen von de Einmachepflaumen un den Wein!“
Sie legte dem Mädchen noch eine Handvoll Bonbons in den Korb. Berthas Augen funkelten, mit einer sehnsüchtigen Gier sah sie zu, wie Mariechen einen Bonbon nach dem andern hinter die blassen Lippen schob und wohlgefällig daran lutschend, noch ein wenig mit Frau Reschke schwatzte. Berthas Zunge leckte auch — sie konnte das Zusehen kaum mehr aushalten; Süßes aß sie für ihr Leben gern, schon als Kind hatte sie stundenlang beim Krämer des Ortes vor der Tür gelungert, um so, durch die Beharrlichkeit freundlich begehrter Blicke, dem gutmütigen Manne ein Zuckerstückchen abzubetteln.
Andere Erscheinungen kamen. Die schöne Auguste, so stolz, so ehrbar, daß sie förmlich einschüchternd wirkte. Mit einer ruhigen Würde besorgte sie ihre Einkäufe; in ihrem frisch gestärkten rosa Kleid, dem weißen Häubchen und der blendenden Latzschürze sah sie aus wie das Bild der Reinlichkeit und Reinheit. Sie kaufte eine Menge und ließ alles in ein Büchelchen eintragen; Berthas scharfe Blicke entdeckten, daß Frau Reschke alles um fünf oder zehn Pfennige teurer dort anschrieb, als der Preis war. Und Auguste guckte ihr dabei über die Schulter und diktierte auch ab und zu.
Als die Auguste gegangen war, pries Frau Reschke sie aus allen Tonarten. Das war noch ein solides Mädchen! Die hatte sie aber in ihre jetzige Stellung gebracht, zu jung verheirateten Leuten, die in ihrem schönen neuen Haushalt ganz verliebt in ihre hübsche, ehrbare Auguste waren. Dann erschien die Mathilde von Hauptmanns. Ihr rundliches Gesicht, das in der Jugend gewiß sehr hübsch gewesen, trug einen unendlich gutmütigen und einen zugleich zerstreuten Ausdruck. Sie hatte Tränen in den Augen, als sie davon sprach, am ersten Oktober den Dienst verlassen zu müssen, in dem sie nun fast zwei Jahre gewesen. „Ich bin dem jnä’jen Frauchen ja so gut“, schwatzte sie mit ihrer angenehmen, etwas verschleierten Stimme, „ich wär ja auch nich jezogen, wenn ich mer nich verheiraten tät.“
„Ick jratuliere“, rief die Reschke herüber, die gerade ein paar andere Kundinnen bediente, und zwinkerte diesen zu. „Na, is’t denn jetzt so weit?“
„Noch nich“, sagte Mathilde geheimnisvoll.
Die jungen Dinger, die mit ihren Marktkörben herumstanden, stießen einander heimlich an.
„Ich habe de Nacht um zwölwe mein Punktierbuch jefragt, das sagt ja nu: ‚ja, ja, baldije Hochzeit‘. Und wie ich vorige Woch’ Sonntag zum Abendmahl jeh — mit mein Schwarzseidnes, wo denn schon parat war zur Hochzeit, denn treff ich wen, de Schustersche, wo obenan bei mein Schwager wohnt, und die hat mer denn erzählt, daß de Schwaster krank liegt — an Influenzia. Na, und das stimmt ja woll mit mein Buchchen — de Schwaster stirbt, und bald is wieder Hochzeit!“
„Na, is se denn schon tot?“ rief keck eine der Mägde.
Mathilde verzog keine Miene. „Nei, noch nich“, sagte ihre angenehme Stimme. „Ich frag aber immer de Schustersche, bei mein Schwaster komme ich ja nich ins Haus. Und bei’s Abendmahl in de Kirch hab ich unser liebes Harrjottche so recht von Harzen jebeten — wenn zuerst ne Frauensperson vor’s Altar tritt, denn bleibt se leben; kommt zuerst ’ne Mannsperson, denn stirbt se. Na, und denn kam ja woll zuerst ’ne Mannsperson.“
Die Mädchen kicherten; sie kannten die fixe Idee der alten Mathilde, die immer noch auf den Mann, der sie einstmals, um ihrer jüngeren Schwester willen, hatte sitzen lassen, wartete.
Sie lachten ganz ungeniert, als Mathilde in ihrer Herzensfreude sie alle zur Hochzeit einlud.
„Na, was sagt denn nu die Hauptmannsche?“ fragte die Reschke. „Die wird scheene drinne sitzen, die kriegt so leicht keene. Schmalhans Küchenmeister. Un denn die unjezogenen Bälje.“
„Ach Jottchen!“ Mathilde schnäuzte sich krampfhaft. „Mathildche, sagte se zu mich, ich seh Ihnen man unjern scheiden. Jnä Frauchen, sagte ich, ich tret ja in den heiljen Ehestand. Ach so, sagt se, na denn is was anders, denn wünsch ich Ihnen viel Jelück! Aber man sah es ihr an, wie es se leid tat. Na und denn rief se de Kinderches, und dann sagte se: Kinderches, sagt se, de Mathilde will wegjehn. Ach und de Kinderches kamen in de Küch und hingen sich an mein Rock und denn baten se: bleib doch bei uns, Mathildchen! Ach Jottchen, das Herz im Leib tat mer weh. Aber nei, sag ich, das Buchchen hat jesprochen.“
„Da feiern wir also bald fidele Hochzeit“, rief die Reschke ganz ernsthaft. „Ick halte Ihnen beim Wort.“
Die Mädchen prusteten vor Lachen.
Mathilde merkte nichts von der allgemeinen Heiterkeit; ohne den zerstreuten Gesichtsausdruck zu verlieren, erhandelte sie ein billiges Gemüse und stieg dann, verträumten Blicks, die Kellertreppe empor.
Ein übermütiges Gelächter schallte hinter ihr drein.