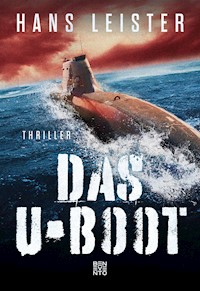
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Benevento
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Düster, hochspannend, apokalyptisch: Überlebenskampf unter Wasser Technische Finesse und ein hervorragendes Gespür für seine Figuren – das zeichnete bereits Hans Leisters ersten Thriller »Der Tunnel« aus. Auch in seinem zweiten Buch verbindet der Autor gekonnt diese beiden Elemente zu einem postapokalyptischen Abenteuerroman, in dem es um nicht weniger als das Überleben der Menschheit geht. Die israelische Marinesoldatin Leah ist mit dem U-Boot auf Patrouille, als plötzlich alle Messinstrumente verrücktspielen. Gewaltiger Unterwasserlärm schreckt die U-Boot-Besatzung auf. Bald steht fest: Auf der Erde hat ein verheerendes Ereignis biblischen Ausmaßes stattgefunden. Über Wasser ist alles zerstört; Häfen können nicht angefahren werden. Niemand an Land scheint überlebt zu haben. Wie sieht die Zukunft der Menschen an Bord aus? - Beklemmend und zugleich faszinierend: Klaustrophobische Odyssee durchs Mittelmeer - Technisch exzellent recherchierter Thriller: Einblick in das Leben an Bord eines U-Boots - Ein packender dystopischer Roman für Fans von Frank Schätzing und Marc Elsberg - Parallelgeschichte zum Thriller-Debüt »Der Tunnel«: Die Geschichten führen am Ende zusammen Wenn die Welt untergeht und das Gefängnis zur Rettung wird In diesem Technothriller entwirft Hans Leister ein eindringliches Szenario, das mit unserer Angst vor dem Kampf ums nackte Überleben spielt. Wie verhalten sich Menschen, abgeschnitten von der Außenwelt, während draußen eine apokalyptische Katastrophe wütet? Für die Recherche zu »Das U-Boot« unternahm der Autor mehrere Reisen nach Israel und war bei der Tauchfahrt eines U-Boots mit an Bord. So wurden die Schilderungen noch anschaulicher und realistischer. Dieser Thriller bietet Spannung und Nervenkitzel: Ein Pageturner, den Sie nicht zur Seite legen werden können!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
HANS LEISTER
DAS U-BOOT
THRILLER
Diese Geschichte ist frei erfunden. Tatsächlich existierende Personen und Firmen wurden verändert und/oder vom Autor ausgedacht, Geschehnisse anderen und/oder fiktiven Personen zugeordnet. Verbleibende Übereinstimmungen mit etwaigen realen Personen wären somit rein zufällig und sind nicht gewollt.
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr.
Eine Haftung der Autoren bzw. Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
1. Auflage 2022
Copyright © 2022 by Hans Leister
Copyright © Deutsche Erstausgabe 2022 Benevento Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – München, eine Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Lektorat: Hanne Reinhardt, Berlin
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Gesetzt aus der Minion Pro, Dharma Gothic, Battery Park
Umschlaggestaltung: : Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagmotiv: U-Boot: picture alliance /dpa/ Markus Scholz;
Himmel/Meer: Aaron Forster/Getty Images
ISBN: 978-3-71090123-2
eISBN: 978-3-71095125-1
Inhalt
PROLOG
TEIL 1 ÜBERLEBEN IM U-BOOT
KAPITEL 1 LEAH: DER TAG, DER MICH AUFS U-BOOT BRACHTE
KAPITEL 2 TARIK: DER VERLORENE DUFT
KAPITEL 3 LEAH: DIE TAUCHFAHRT
KAPITEL 4 TARIK: DER TUNNEL
KAPITEL 5 LEAH: URI, DIE MÖWE UND ICH
KAPITEL 6 TARIK: »PASS MIR AUF DIE KINDER AUF!«
KAPITEL 7 LEAH: DAS MANÖVER
KAPITEL 8 TARIK: CHALED UNTERNIMMT ETWAS GEGEN DIE ZIONISTEN
KAPITEL 9 LEAH: SECHS WOCHEN SCHLAFMANGEL
KAPITEL 10 TARIK: DAS KRANKENHAUS
KAPITEL 11 LEAH: DIE BOHRINSEL
KAPITEL 12 TARIK: AMANYS WELT
KAPITEL 13 LEAH: EIN NEGATIVER TEST
KAPITEL 14 TARIK: WASSEREINBRUCH
KAPITEL 15 LEAH: ALLES KOMMT INS TAUMELN
KAPITEL 16 TARIK: DIE LUFTBLASE
KAPITEL 17 LEAH: »AUF GEFECHTSSTATION!«
KAPITEL 18 TARIK: AUTOWRACKS MIT GELBEN NUMMERNSCHILDERN
KAPITEL 19 LEAH: SCHRECKEN VOR DER KÜSTE
KAPITEL 20 TARIK: DIE RETTUNG VON ELIF
KAPITEL 21 LEAH: KEINE BEWEGUNG AN LAND
KAPITEL 22 TARIK: »HÄNDE HOCH!«
KAPITEL 23 LEAH: GAR NICHT ERST DARAN DENKEN
KAPITEL 24 TARIK: AMANYS GEDÄCHTNIS WIRD GEBRAUCHT
KAPITEL 25 LEAH: »ANKER AUF«
KAPITEL 26 TARIK: »VERRATE UNS NICHT!«
KAPITEL 27 LEAH: DER WHIRLPOOL
KAPITEL 28 TARIK: KEIN BERG MEHR
KAPITEL 29 LEAH: DAS SEEMANNSGRAB
KAPITEL 30 ANNABARBARA: IM SCHWEIZER ALPEN-BUNKER VERENA
KAPITEL 31 LEAH: DER WARME RUCKSACK
KAPITEL 32 TARIK: DIE LETZTEN MANGOS WERDEN GESCHÄLT
KAPITEL 33 LEAH: DAS ENDLAGER
KAPITEL 34 TARIK: EIN RICHTIGER EISENBAHNTUNNEL
KAPITEL 35 LEAH: WIE DAMALS BEI DEN SAURIERN
KAPITEL 36 TARIK: »DIE JUDEN HABEN UNS DAS LEBEN GERETTET!«
KAPITEL 37 LEAH: DIE OPERATION
TEIL 2 JAHRE SPÄTER
LEAH
TEIL 3 VIELE ZEHNTAUSEND JAHRE SPÄTER
KAPITEL 1 DER KRANKENBESUCH
KAPITEL 2 ZWEI MONATE ZUVOR: DIENSTANTRITTSREISE
KAPITEL 3 DRINGENDE FERNGESPRÄCHE
KAPITEL 4 EIN MATERIAL, DAS ES EIGENTLICH NICHT GIBT
KAPITEL 5 DIE GESCHICHTE DER WEISSEN UREINWOHNER
KAPITEL 6 DER KABEL-BERICHT
PROLOG
Nie habe ich Shachaf gegenüber ein Geheimnis daraus gemacht, dass ihr Vater nicht mehr lebt, ebenso wenig wie ihre Großeltern und Sarah, die Urgroßmutter, und alle anderen Verwandten. Diese Information steht ihr zu. Auch wenn niemand mehr herausfinden kann, wie genau sie ums Leben gekommen sind.
Mit der Zeit wurden ihre Fragen drängender: »Wie hieß mein Vater, was hat er gemacht? Was ist passiert? Warum haben wir denn überlebt?«
»Das ist eine komplizierte Geschichte …« Lange wollte ich nicht anfangen, sie zu erzählen.
Meine liebe Shachaf: Hier ist die Geschichte. Auch wenn du nicht alles verstehen wirst, vieles nicht kennst, weil es in der veränderten Welt, in der wir jetzt leben müssen, so vieles nicht mehr gibt, ich selbst schon nachdenken muss, wie es damals wirklich war.
Ich werde dir alles erzählen. Von Anfang an.
Du bist in eine dunkle Welt hineingeboren. Ich durfte lange in einer Welt leben, in der häufig die Sonne schien, voller Farben, Wärme und Licht. Das Leben war bunt und fröhlich. Natürlich gab es auch Bedrohungen, doch niemand hat sich davon allzu sehr beeindrucken lassen, die Menschen verbrachten Stunden und Tage am Strand, feierten, tanzten. Die Gärten waren voller Blüten, in den Häusern traf man sich und aß zusammen bunte Speisen aus den verschiedensten Fleisch-, Fisch- und Gemüsesorten.
Weißt du eigentlich, warum du Shachaf heißt? Shachaf ist der Name einer Vogelart. Diese großen weißen Vögel waren damals in meiner alten Heimat an der Küste und auf dem Meer zu finden, hierzulande sieht man sie jetzt manchmal auch an den Seen, sie heißen hier »Möwen«. Vögel, die elegant und fast ohne Kraftaufwand im Wind an der Küste entlangsegeln und große Strecken über das Meer zurücklegen.
Auch wir haben eine große Strecke über das Meer zurückgelegt, bis wir hierherkamen, und am Meer habe ich mich in deinen Vater verliebt. Eine Möwe hat mich dabei angesehen.
Wir hatten Glück, viel Glück – und Menschen, die uns geholfen haben. Wer weiß, ob wir je den rettenden Tunnel erreicht hätten, wenn nicht Tarik gewesen wäre, und seine erstaunliche Tochter Amany, die uns den Weg dorthin zeigen konnte, obwohl sie ihr kleines Stück Land weit von hier vor der großen Reise nicht ein einziges Mal verlassen hatte.
Erzähl die Geschichte weiter, erzähl sie deinen Kindern und Enkeln, damit sie wissen, was geschehen ist, auch wenn sie sich die Zeit, die ich erlebt habe, wohl noch weniger vorstellen können als du. Gib ihnen unsere Sprache weiter – es gibt nur noch wenige, die sie sprechen.
TEIL 1
ÜBERLEBEN IM U-BOOT
KAPITEL 1
LEAH: DER TAG, DER MICH AUFS U-BOOT BRACHTE
Es war stockdunkel, Mitternacht vorbei, wir dümpelten nordwestlich von Haifa in rauer See, um die Hafeneinfahrt vom Meer her zu überwachen. Die Positionslichter hatten wir gelöscht. Plötzlich der Einsatzbefehl von der Radarstation an Land. »Kleines unbekanntes Objekt mit 1,5 Knoten und Kurs achtzig unterwegs auf Position soundso«, ein ganzes Stück weiter draußen vor der Küste. Wir hörten alle über die Kopfhörer in unseren Helmen mit.
David, der Bootsführer, ließ die beiden Außenbordmotoren aufheulen, äußerste Kraft voraus. Wir knallten in die schräg von vorne kommenden Wellen, die Gischt spritzte in Wolken über das ganze Boot von links vorne nach rechts hinten. David wollte schnell zu dem Objekt. Ich hielt mich fest, zog noch einmal die Sicherungsleine straff – bei dem Tempo und der Dunkelheit bloß nicht über Bord gehen, das war mein einziger Gedanke.
Inzwischen kam eine weitere Meldung: »Noch ein zweites, etwas kleineres Objekt eine halbe Meile südlich vom ersten. Gleicher Kurs, etwas schneller.«
Unsere Radar-Beobachter an Land (diesmal war es eine weibliche Stimme, sachlich und unaufgeregt) waren ziemlich gut. Mit Computer-Analysen und Hightech-Programmen konnten sie per Radar unscheinbare regelmäßige Muster im Wellengang entdecken, wie sie von bewegten Fremdkörpern verursacht wurden. Um festzustellen, was wirklich hinter einem dieser Muster steckte, musste aber jemand hinfahren und nachsehen. Jemand, das waren heute wir drei: David, die Maschinengewehrschützin Keren, und ich, die Wehrpflichtige, als Hilfskraft für alles, was es sonst noch zu tun gab.
Ja, ich hatte freiwillig und unbedingt zur Marine gewollt, wenn ich schon Wehrpflicht leisten musste. Marine – da stellt man sich stolze Schiffe vor, die eindrucksvoll in den Hafen einfahren, mit Matrosen in weiß-blauem Zeug an der Reling aufgereiht, zur Nationalhymne salutierend. So sieht es auf den Werbebildern aus.
Unser Boot war kein Kriegsschiff, sondern eigentlich ein Witz: ein dunkelgraues »Festrumpfschlauchboot«, also ein stabiler Plastikboden mit einem Luftschlauch rundherum, ein Steuerstand mit allerhand Elektronik in einem winzigen Aufbau mit Schiebetüren, vorne ein Maschinengewehr, hinten die beiden Außenbordmotoren und einige Behälter mit Utensilien. David, Keren und ich, das war die ganze Besatzung. Klo gab es keins an Bord. Wenn es zu dringend wurde, pickte man die Sicherungsleine ein (David hatte uns eingeschärft: Immer sichern, beim Pinkeln passieren die meisten Person-über-Bord-Unfälle) und versuchte es irgendwie am Heck. Bei sehr schlechtem Wetter war man früher oder später sowieso durch und durch nass, dann war es auch egal.
Wir waren der graublaue Alltag der israelischen Marine: ein kleines Boot, langweilig, aber wichtig, um Hafen und Küste abzuschirmen.
Heute hatte es am späten Abend ruhig angefangen, es schien eine langweilige Nachtwache zu werden. Der Wind war frisch, der Seegang aus Westsüdwest wurde zusehends rauer. Unser Auftrag: kleine Boote oder Kampfschwimmer der Hisbollah oder irgendwelcher anderer Bösewichte abzufangen. Der Libanon war nur zwölf Seemeilen entfernt, von dort aus konnten jederzeit Terroristen kommen. Meistens passierte bei solchen Fahrten gar nichts, außer dass wir angestrengt und ergebnislos Ausschau hielten und uns durch die Dunkelheit schlichen, ab und zu den Motor aufheulen ließen, mit dem Suchscheinwerfer ein bisschen Spektakel machten und damit die Ankerwachen der auf Reede liegenden Frachtschiffe erschreckten.
So war auch die erste Hälfte dieser Nacht verlaufen, Routine bei anstrengendem Wetter: Wir kreuzten durch schwere Wellen und strammen Wind, mal schnelle Fahrt mit aufgestelltem Bug hoch aus dem Wasser, mal langsamer, mal die Wellen von vorne (übel, da knallte der Bug nach jeder Welle ins Wasser), mal von der Seite, mal von hinten – das war noch am angenehmsten.
Jetzt jagten wir im Alarmzustand auf mögliche Terroristen zu. Beim »etwas kleineren Objekt« würden wir zuerst eintreffen. Kurz vor Erreichen der Position drosselte David die Motoren, wir schlichen uns in kleiner Fahrt an und starrten in die Dunkelheit, versuchten zwischen den Wellen irgendetwas zu erkennen. Von Land kam die Korrektur der Soldatin am Radar: »Etwas weiter nach Nordnordwest, ihr fahrt sonst dran vorbei.« Wir suchten noch eine ganze Zeit, dann sahen wir etwas, einen schwarzen Schatten zwischen den Wellen. Er hatte eine Art Stiel, der im Takt der Wellen nickte.
David berichtete der Landstation, was wir mehr ahnten, als es wirklich sehen zu können. Keren saß auf einem Blechteller, hatte sich mit den Beinen in die Fußrasten des MG-Sitzes verkeilt und richtete die schwere Maschinenwaffe mit beiden Händen auf das Objekt. Wenn sich dort etwas tat, was gefährlich aussah, würde sie erst schießen und dann nachsehen, was sie getroffen hatte, so war Davids Befehl. Trotz meines Helmes und der schusssicheren Weste hatte ich zum ersten Mal richtig Angst und machte mich kleiner hinter dem Gummiwulst. Das half, auch wenn ich wusste: Gummi wird mich nicht schützen. David versuchte, das Objekt auf unsere windabgewandte Seite zu bringen, wir schlingerten fast ohne Fahrt in den Wellen, der Sturm übertönte das Blubbern der Motoren bei niedriger Drehzahl.
Nun schaltete David den großen Suchscheinwerfer ein, schlagartig wich die Dunkelheit vor uns, weiße Schaumkronen leuchteten auf. Der schwarze Schatten schimmerte jetzt bunt, gelb und grün, der merkwürdige Stiel war dunkler, vielleicht braun, davor eine grellorange Boje, wie Fischer sie benutzten.
Langsam kapierten wir: Vor uns lag eine Badeinsel im Wasser. Die Insel war nicht mehr straff aufgeblasen, sondern wurde nur noch von einem Rest Luft gerade so über Wasser gehalten. Der Stiel entpuppte sich als Plastikstange, mit grünen Plastikresten oben dran, die wohl früher mal eine Palme dargestellt hatte. Die ehemalige Plastikpalme fungierte als Segel und ließ das Gebilde im Wind Fahrt machen. Ich richtete mich auf, das Ding schien nicht gefährlich zu sein.
Wir stocherten in Teilen von Fischernetzen, ein Schwimmer und andere Fischereiausrüstung hatten sich an der Insel verfangen.
Nach einem Bericht von David kam der Befehl der Landstation: »Radar-Reflektor am Objekt anbringen, haltet euch nicht lange auf, wir lassen das Zeug von der BAT GALIM bergen. Fahrt sofort zum nächsten Objekt.«
Die BAT GALIM war ein richtiges Schiff, eine Unterstützungseinheit mit einem Kran an Bord, aber die mussten die Badeinsel erst einmal finden, was uns schon schwergefallen war. So wurde es mein Job, weit herausgebeugt und gesichert durch eine Leine, vom Bug aus eine passende Stelle zu suchen, um mit einem Karabiner ein dreißig Zentimeter großes Alu-Blechteil an der Badeinsel anzubringen, einen Radar-Reflektor, damit die Landstation das »Objekt« nicht mehr aus den Augen verlieren und das Unterstützungsschiff, die BAT GALIM, es leicht finden und näher untersuchen konnte.
Ich stellte mir vor: Das Plastik-Teil samt der Palme mit fröhlichen Kindern oder betrunkenen Typen irgendwann, irgendwo an einem Badestrand, vielleicht Mallorca oder Tunesien, dann kam ablandiger Wind auf. Wenn der Wind stark genug war, hatten auch zwei, drei kräftige Schwimmer keine Chance, das Ding zurück an den Strand zu bringen. Jetzt trieb es als Plastikmüll nach einer Odyssee über das Mittelmeer ausgerechnet vor unserer Küste in Haifa.
Wir fuhren in Richtung des zweiten Objekts. Die Suche war dort noch schwieriger. Die Landstation meldete: »Ihr seid genau dort.« Wir stierten in die Dunkelheit und sahen – nichts, nur Schatten von Wellen, Schaumkronen, Wasser. Schließlich schrie Keren in ihr Mikro: »Da, auf zwei Uhr, da muss was sein!« Wir schlichen uns näher heran, dann wieder der Suchscheinwerfer. Ein großer hellblauer Fleck, der sich im Takt mit den Wellen bewegte, darauf einzelne kleine Teile, die nicht klar zu erkennen waren: Es handelte sich um die Reste eines großen Schlauchboots, ohne Luft, die schlappe Hülle bewegte sich genauso wie die Wellen, sie fiel deshalb in der Dunkelheit nicht weiter auf, war nur an den Unregelmäßigkeiten der Wellenkämme zu erkennen. Eine Schwimmweste hing noch an den Resten, außerdem andere Fetzen, vielleicht zurückgelassene Kleidungsstücke.
Mir war es unheimlich. Entweder handelte es sich um ein perfektes Versteck für Taucher, die unter der Plane schwammen, oder es war tatsächlich einfach nur ein verlassenes Schlauchboot, das schon durchs halbe Mittelmeer getrieben sein konnte. Vielleicht eines der Migranten-Boote? Was war mit den Menschen passiert? An Land gegangen, auf See gerettet, ertrunken? Das Boot schien jedenfalls schon lange aufgegeben, die Luft war fast komplett entwichen.
David meldete unseren Fund an die Landstation. »Die BAT GALIM ist schon unterwegs, die schauen sich auch das zweite Objekt an. Habt ihr noch einen Reflektor?« Nein, hatten wir nicht, außer unserem eigenen, der uns selbst kenntlich machen musste. »Wir hängen die Person-über-Bord-Boje dran«, meinte David. Er musste nichts sagen, es war wieder mein Job, das Ding zu befestigen. Die Boje begann auch brav selbsttätig zu blinken, als das schwerere Unterteil sie im Wasser aufrichtete, von mir mit einem Bändsel verbunden mit dem schlappen Schlauchboot-Rest.
Über der ganzen Sucherei begann es nun schon zu dämmern, zartes Rosa zeigte sich im Nordosten. David bat über Funk um Erlaubnis, zur Basis zurückkehren zu dürfen. »Ok, kommt zurück.« Endlich ein vernünftiger Befehl. Auf der Rückfahrt durfte ich das Steuer übernehmen, hielt auf die orange-rosa Färbung im Osten zu, bald schon stach ein erster Sonnenstrahl hinter den Bergen hervor. David hatte keine Augen dafür, er machte sich Notizen mit seinem Spezialstift auf einem Block mit wasserfestem Papier. Er würde einen Bericht schreiben müssen über unsere nächtlichen Plastikmüll-Abenteuer.
Die Sonne war jetzt aufgetaucht. Kurz vor der Hafeneinfahrt übernahm David wieder das Steuer, schwenkte in weitem Bogen um das Ende des Wellenbrechers und hielt auf das ruhigere Wasser zu, das auf der wind- und wellengeschützten Seite der Mole lag. David zog den Fahrthebel zurück, das laute Motorengeräusch verstummte schlagartig, und das Boot kippte aus der Schräglage in eine gemütlichere waagrechte Position, was unsere Köpfe kurz nach vorne nicken ließ.
Jetzt, ohne den Motorlärm, konnten wir von Backbord das Tüt-Tüt-Tüt der Hafenkräne und Fahrzeuge hören, wo im ersten Sonnenlicht Container durch die Luft schwebten, um abwechselnd an Land oder auf einem riesigen Schiff krachend abgesetzt zu werden.
Wir hielten auf den Bereich zu, in dem unser Boot zusammen mit einem halben Dutzend anderer Motorboote seine Heimatbasis hatte. Ich stieg auf den Wulst am Bug des Gummi-Bootskörpers, die Vorleine in der Hand. Im richtigen Moment, weniger als einen halben Meter vom Ponton entfernt, sprang ich hinüber, im gleichen Augenblick ließ David die Motoren noch mal aufheulen, um das Boot im Rückwärtsgang zu stoppen.
Ich schlang die Vorleine um den Poller und warf das Ende zurück zu Keren, die es am Boot festmachte: »Vorleine fest!« Wir waren beide keine Anfängerinnen mehr.
Bald stand ich an der Pier auf festem Grund, aber die Umgebung bewegte sich weiter langsam auf und ab. Nach zehn Stunden Seegang kommt der Kopf nicht damit zurecht, dass man wieder auf richtigem Boden steht. Der Kopf versucht weiter, nicht vorhandene Bewegungen auszugleichen. Ich atmete tief durch und spürte erst jetzt die totale Erschöpfung in mir aufsteigen, die Erschöpfung nach einer harten Nacht, und trotz der Sonnenstrahlen begann ich zu zittern. Die Einbildung des schwankenden Stegs ließ langsam nach, der feste Grund wurde wieder zur Realität. Jetzt schwankte das Boot, als zuerst Keren, dann David an Land gingen. Wir zogen die Handschuhe, die Schwimmwesten und unsere schusssicheren Westen aus und nahmen die Helme ab. Danach rief David: »Antreten!« Keren und ich standen sowieso schon nebeneinander, gaben uns keine besondere Mühe, auch noch gerade zu stehen, David straffte sich, hielt die Hand an seine nicht vorhandene Mütze und rief: »Einsatz beendet. Habt ihr gut gemacht.« Er nahm die Hand herunter. »Geht unter die Dusche und schlaft euch aus. Ich sage Bescheid, dass der Hafendienst tanken soll, wir sind genug gefahren. Wegtreten!«
Ich war David dankbar, dass er uns das Tanken ersparte, ich musste dringend aufs Klo, sehnte mich nach einer heißen Dusche und einem Bett.
Warum hatte ich mir das angetan? Bei der Musterung zum Wehrdienst darauf gedrungen, unbedingt zur Marine zu kommen? Ich muss zugeben, ich hatte keine Ahnung gehabt, was mich dort wirklich erwartete. Die Marine hatte für mich ein Gesicht gehabt: die kantigen Wangenknochen und der verschmitzt lächelnde Mund von Sami, mit Sommersprossen und der hochgeschobenen Sport-Sonnenbrille.
Sami war Ausbilder im Segelkurs beim Yachtclub gewesen, früher hatte er Dienst bei der Marine geleistet, und für mich, mit meinen damals sechzehn Jahren, verkörperte er das absolute Idol, ein großer, kräftiger, gut gelaunter Dreiundzwanzigjähriger, der ruhig und besonnen klare Kommandos gab und immer wusste, was zu tun war. Er roch nach Sonne, Meer und nach der Sommerbrise, die unser Segelboot anschob. Wenn er mir die Hand führte beim Knoten-Üben, bekam ich einen heißen Kopf und das große Prickeln. Mit den losen Enden der Leine brachte ich nichts Vernünftiges mehr zustande, meine Finger waren immer im Weg, doch er blieb gelassen und meinte nur: »Musst du noch üben«, bevor er bei einer anderen Kursteilnehmerin mehr Erfolg mit den Knoten hatte. Ich weiß bis heute nicht, ob er überhaupt bemerkt hat, dass ich ihn anhimmelte. Ich sah ihn nach dem Segelkurs nicht wieder. Trotzdem: Meer, gute Laune und Energie, das hatte sich für mich mit dem Gesicht von Sami und dem Wort »Marine« verbunden.
Wenn schon Wehrdienst sein musste, dann kam für mich deshalb nichts anderes infrage. Endloser Gammel-Dienst in irgendeiner Unterstützungseinheit, nein danke; ich hatte von Mädchen gehört, die zwei Jahre nur Kaffee gekocht hatten an irgendeinem Wüsten-Standort, oder in einem Büro Aktenberge vom ersten in den dritten Stock geschleppt hatten, nur um sie am Tag darauf wieder in den ersten Stock zu bringen und Seite für Seite einzeln zu schreddern. Natürlich hätte ich mich auch zu einer Kampfeinheit beim Heer melden können, das hätte dann wahrscheinlich bedeutet, an irgendeiner Kontrollstelle im Palästinensergebiet arabische Frauen und Kinder abzutasten, das sei der Job der Frauen bei den Kampfeinheiten, wusste eine Mitschülerin zu berichten. Ich hatte nichts gegen Araberinnen, aber mich von ihnen anzetern zu lassen, weil ich ihre Handtaschen durchwühlen musste, das war jetzt auch nicht so das, was ich gerne zwei Jahre lang tun wollte.
Marine sollte es sein, und zwar richtig auf dem Wasser, nicht im Büro des Hafenmeisters oder vor einem Bildschirm an Land. Richtige Marine, auf einem Schiff, na ja, einem Boot, das hatte ich jetzt. Im Moment hatte ich aber gerade genug davon.
Nach der Dusche in der Unterkunft war der Hunger größer als die Müdigkeit. Ich ging in die Messe, wo das Frühstück schon fast beendet war. Aus einer weitgehend leer geräumten Warmhalte-Wanne kratzte ich noch etwas Shakshuka, das Standard-Frühstücksgericht aus Tomaten, Eiern und Schafskäse, stellte dazu einen Brotkorb, etwas Hummus, einen Orangensaft und einen Kaffee auf das Tablett. Schlafen nach einem Nachteinsatz sollte auch mit Kaffee kein Problem sein.
Kaum hatte ich mich vor mein Shakshuka gesetzt, glotzte mich ein Marinesoldat an, derselbe Typ, der letzte Woche schon geglotzt hatte. Blöderweise saß er mir genau gegenüber, auf der anderen Seite der Messe. Ich bemühte mich, nicht hinzusehen, damit er nicht auf die Idee kam, ich wäre an ihm interessiert. Er war nicht der Typ Sami, braun gebrannt und mit Sonnenbrille, sondern einer der bleichen Stubenhocker von der Basis, vielleicht ein Marine-Geheimdienst-Mann, der tagein, tagaus langweilige Funksprüche und Telefonate abhörte, oder einer der Radar-Heinis, die vor Bildschirmen in dunklen Räumen saßen.
Da kam es mir gerade recht, dass ich meinen Blick auf den Eingang richten konnte, wo jetzt eine Kapitänin mit jeder Menge Streifen auf dem Arbeitsanzug hereinkam und sich suchend umsah. Offiziere ließen sich normalerweise hier nicht blicken, die hatten eine eigene Messe.
Die Kapitänin schien recht jung für ihren Rang, vielleicht Anfang dreißig, nicht allzu groß, sportlich. Sie kam jetzt mit entschlossenen Schritten genau auf mich zu. »Bist du Leah Friedman?« Ich schlang den Rest von Ei und Tomaten, den ich gerade im Mund hatte, herunter, und statt einer Antwort nickte ich nur, um mich nicht zu verschlucken.
Sie streckte mir die Hand entgegen: »Ich bin Anat. David hat von eurer Nacht-Patrouille erzählt, du musst müde sein.«
»Ziemlicher Wind und Seegang heute, Plastikmüll hat uns beschäftigt, sonst nichts Besonderes.«
Mein Understatement unserer Patrouillenfahrt schien ihr zu gefallen. »Dann sollten wir uns heute Nachmittag, wenn du ein bisschen geschlafen hast, in Ruhe unterhalten. Wir wollen dir eine Spezialausbildung anbieten, da gibt es einen ganz besonderen Kurs, das könnte was für dich sein.«
Ich sah Anat fragend an, aber sie ging nicht darauf ein. »Wir reden später. Wäre vierzehnhundert für dich ok?« Sie meinte vierzehn Uhr, sprach im Marine-Jargon.
»Wo?«
Anat gab mir eine Gebäudenummer und beschrieb die Lage des Hauses im Marinestützpunkt.
Sie verabschiedete sich, war schon im Gehen, als sie sich noch einmal umwandte. »Bet reicht, wir sind unter uns. Also dann, bis heute Nachmittag.«
Ich saß vor dem leeren Shakshuka-Teller, dem halb vollen Orangensaft-Becher, zwei Brotstücken und dem Rest Kaffee. »Bet« war die B-Uniform, die Arbeitskleidung, ich musste also nicht in Ausgehuniform erscheinen, die mit A wie »Alef« bezeichnet wurde.
Der Marinesoldat, der mich angestarrt hatte, machte jetzt ein verdutztes Gesicht. Dass eine Kapitänin mit jeder Menge Streifen an der Bluse mich suchen würde, das hatte er nicht erwartet. Ich stand auf und ging etwas aufrechter aus der Messe, als ich hineingegangen war.
Kurz vor zwei Uhr war ich im Erdgeschoss des Gebäudes, in das Anat mich bestellt hatte. Hinter einem Fenster saß ein missmutiger Wachmann. »Ich bin Leah und habe einen Termin bei Anat.« Der Wachmann nickte und wurde freundlicher, wollte meinen Truppenausweis sehen, schloss sein Fensterchen wieder. Ich sah ihn nach dem Telefonhörer greifen, hörte aber nicht, was er hineinsprach, hinter seinem Fenster aus Panzerglas. Er öffnete wieder seine Luke. »Hast du ein Telefon dabei?«
»Ja, klar …«
»Musst du hierlassen.«
Er holte einen Umschlag, steckte mein Telefon hinein, ließ sich meinen Namen buchstabieren und schob den Umschlag in ein Regal mit vielen Fächern, in ein Fach mit dem Zeichen für »Lamed«, also den Buchstaben »L«. Schien eine geheime Sache zu sein, die diese Anat mit mir besprechen wollte – oder das ganze Gebäude hatte eine besondere Sicherheitsstufe.
Anat holte mich ab, unterwegs ließ sie mir einen Becher Kaffee aus einem Automaten. Im Gang hingen Bilder von U-Booten, die aufgetaucht mit voller Geschwindigkeit fuhren, auch Innenaufnahmen und U-Boot-Fahrer mit verpixelten Gesichtern, die sich zu fünft an einem viel zu kleinen Tisch drängten, fröhlich grinsten und irgendetwas löffelten, es sah aus wie Shakshuka.
Anat führte mich in ihr Büro. Das kleine Fenster, das teilweise noch von einer überdimensionalen Klimaanlage ausgefüllt war, ließ nur wenig Tageslicht herein. Ein primitiver Schreibtisch voller Akten, neben einem Blechregal eine kleine Besprechungsecke mit unbequemen Stahlrohr-Stühlen.
»Bitte hab Verständnis dafür: Als Erstes musst du unterschreiben, dass du dieses Gespräch absolut vertraulich halten wirst.« Sie schob mir einen Vordruck zu. »Du weißt, was das heißt, denke ich.«
Ich war neugierig genug, um zu unterschreiben, schon um mehr zu erfahren. Anat legte das Papier auf ihren Schreibtisch. »Danke. Ich spreche es direkt an: Wir halten dich für geeignet, dich zu einem Lehrgang bei uns hier nachzumelden, in dem ein Platz frei geworden ist.«
Was hieß »bei uns hier«? Bei den U-Booten? Ich nippte an meinem Kaffee und wartete ab.
»Wir beginnen nächste Woche mit einem neuen Lehrgang für die U-Boot-Ausbildung. Das kommt jetzt überraschend für dich, aber wir glauben, dass wir dich gut genug kennen, um zu wissen, dass du dafür geeignet bist.«
»U-Boote? Da sind Frauen doch gar nicht zugelassen.«
»Bisher nicht. Die Amerikaner haben gemischte Crews, aber auf riesigen Booten, mit getrennten Bereichen. Auf unseren kleinen Booten geht das nicht. Wir stellen deshalb eine komplette Crew aus Frauen zusammen. Mit der Ausbildung wollen wir nächste Woche anfangen, U-Boot-Grundkurs.« Sie fügte hinzu: »Noch ist das Projekt streng geheim.«
Mein Interesse wuchs mit jedem Satz. U-Boot, das war bei der Marine die höchste Stufe des Ansehens, viel toller als alles, was mein Segellehrer Sami wahrscheinlich je gemacht hatte. Und ich sollte dafür geeignet sein? Ich atmete tief durch.
»Die Ausbildung heißt noch nicht, dass du dann tatsächlich auf einem U-Boot fahren wirst, die Chance ist 50:50, würde ich sagen. Wir bilden doppelt so viele aus, wie wir definitiv brauchen. Wenn es nicht klappen sollte, heißt das: als Offizierin ausscheiden, Leutnant der Reserve mit Top-Zeugnis, du hattest eine gute Zeit und hast was gelernt.« Anat machte eine Pause, dann sprach sie leise und sehr deutlich weiter: »Wenn es klappt, und du in den U-Boot-Dienst gehst, dann müsstest du aber etliche Jahre dabeibleiben, das ist die Bedingung. Danach gehst du als Ingenieurin und bekommst die beste Job-Vermittlung, die wir bieten können.«
Ich hatte das Gefühl, jetzt langsam mal eine Frage stellen zu müssen, und mir fiel auch eine ein: »Warum ist ein Platz frei geworden?«
Anat richtete sich auf, dachte wohl nach, wie viel sie verraten sollte, und sagte dann: »Tauglichkeit ist immer ein Problem, gerade beim U-Boot-Personal.«
Die andere Frage, die auf der Hand lag, fiel mir nicht gleich ein, sondern erst viel später: Warum ausgerechnet ich? Schließlich gab es unter den Mädchen im Marinestützpunkt Haifa sicher andere mit besseren Leistungen und mehr Erfahrung, von denen viele mit Begeisterung aufs U-Boot gegangen wären.
Der Moment, in dem ich diese Frage endlich stellte, war nach der kleinen Feier zur Aufnahme in die Elite der U-Boot-Fahrer. Anats Antwort überraschte mich: »Du bist oberer Durchschnitt. Genau das suchen wir.«
An meiner weißen Paradeuniform prangte das gerade angebrachte Abzeichen zur Waffengattung, ein stilisiertes U-Boot in Zigarrenform, fast zehn Zentimeter lang. Es sah eher obszön aus an einer Mädchenbrust. Das begehrte Abzeichen hatten bisher ja auch nur Männer an der Uniform getragen. Nur schade, dass wir aus Geheimhaltungsgründen nicht außerhalb des Stützpunktes damit herumlaufen konnten. Draußen durfte keiner wissen, wer zur wichtigsten und geheimsten Waffe der israelischen Marine gehörte.
»Durchschnitt? Ich dachte, ihr nehmt die Besten …«
Anat, die von der Feier ganz aufgekratzt war, sah mich an. Ich erhielt eine Antwort, die mich noch lange beschäftigen würde: »Fürs U-Boot geeignet sind Leute, die ausgeglichen und teamfähig sind. Leute, die nicht zu Extremen neigen, zuverlässige Leute, die möglichst überall oberes Drittel sind, aber nirgends zu den Allerbesten gehören. Wer in irgendetwas besonders gut ist, hat anderswo ausgeprägte Schwächen. Und solche Personen wollen manchmal andere übertrumpfen. Das können wir nicht gebrauchen. Wir brauchen Teamgeist, Ausgewogenheit, rundum.« Anat zuckte mit den Achseln und redete weiter: »Du bist nirgends ein Überflieger, aber du hast dich unter Kontrolle, fügst dich ein, hast trotzdem ein eigenes Urteilsvermögen, du bist nicht zu groß und nicht zu klein, du hast Mut, bist aber nicht übermütig, du bist nicht schüchtern, aber auch nicht vorlaut. Vier bis sechs Wochen am Stück im U-Boot: Dafür brauchen wir besonnene Profis, keine Superstars mit Allüren, die sind im Einsatz unberechenbar.«
So viel auf einmal hatte Anat noch nie mit mir gesprochen. Ich weiß nicht, ob sie ahnte, was sie damit anrichtete. Seitdem muss ich immer daran denken: Ich, Leah, bin Durchschnitt, na ja, oberer Durchschnitt immerhin. Wenn ich im Schlussverkauf etwas in Größe M suche, und es gibt nur noch XS und XL zu günstigen Preisen, dann muss ich daran denken: Ich bin eben Durchschnitt.
Jedenfalls konnte mir nichts Besseres passieren, als ausgerechnet auf einem U-Boot zu landen. Es hat mir das Leben gerettet. Wäre es anders gekommen, wäre ich heute tot. Wie so viele.
KAPITEL 2
TARIK: DER VERLORENE DUFT
Ein gewaltiger Knall ließ Tarik zusammenzucken. Er sah sich um. Nirgends stieg eine Rauchwolke auf, es handelte sich wohl nicht um einen Angriff auf Gaza. Stattdessen sah er einen Kondensstreifen am Himmel. Sicher hatte bloß mal wieder ein israelisches Kampfflugzeug mit einem Überschall-Knall das Kindergeschrei und den Verkehrslärm am frühen Nachmittag brutal übertönt. Die Kinder waren schlagartig verstummt. Tarik sah den Kondensstreifen weiter vorankriechen, in einem Bogen führte der weiße Strich jetzt weg von der Grenze zu Ägypten, zurück nach Nordosten, zurück nach Israel.
Schon lange war er nicht mehr geflogen. Wie mochte Rafah von dort oben aussehen? Seine Heimatstadt – von der doch nur der eine Teil wirklich seine Heimat war. Der größere Teil zwar, doch der andere, kleinere Teil der Stadt lag in Ägypten, auf der anderen Seite der Grenze, und damit in einer anderen Welt. Tarik war zu Fuß unterwegs, er kam aus dem Zentrum und wollte nach Hause. Gemächlich bewegte er sich entlang einer der lärmenden Hauptstraßen, schließlich bog er in eine Seitenstraße ein und nahm, wie so viele Male zuvor, die Abkürzung entlang der Trasse der ehemaligen Bahnstrecke. Jetzt war dort nur noch ein Streifen verwildertes Land. Sein Großvater hatte ihm erzählt, dass hier früher Züge vom Bahnhof Jaffa, dem ältesten Teil von Tel Aviv, bis nach El Qantara am Sueskanal, entlanggefahren waren, sogar mit Schlaf- und Speisewagen. Eine Friedhofsmauer und das Gelände einer Autowerkstatt begrenzten mittlerweile den Streifen. Laute Hammerschläge waren aus der Garage zu hören.
Er erwartete den vertrauten Anblick der mannshohen Sträucher neben dem Trampelpfad, die im Frühjahr unscheinbare gelbe Blüten trugen, einer der wenigen Lichtblicke im fast komplett zugebauten Gazastreifen. Tarik zuckte zusammen, ein Schreck, schlimmer als bei dem Düsenjäger-Knall zuvor: Dort, wo die Sträucher gestanden hatten, war der sandige Boden planiert, der Bewuchs zerstört, keine Sträucher mehr, das letzte Grün beseitigt!
Tarik konnte den Blick nicht von der kahlen Fläche abwenden, und sein Herz schmerzte. Einzelne Stängel mit verwelkten Blätterresten lagen noch zwischen Betonbrocken und Werkzeug, irgendjemand hatte gründlich gewütet, hier würde nichts mehr blühen.
Fassungslos schüttelte Tarik den Kopf: Man hatte ihm die letzte Erinnerung an Yasmina genommen: Den Geruch der kleinen, unscheinbaren Blüten dieser Büsche. Yasmina, seine große Liebe, die nie in Erfüllung hatte gehen dürfen. Er wusste nicht, ob es ein Parfum war, das Yasmina benutzt hatte, oder ob sie selbst diesen Geruch verströmte, an den ihn die Blüten erinnerten. Lange hatte er nicht gewagt, jemanden zu fragen, wie diese Pflanze eigentlich hieß. Letztes Jahr hatte er ein kleines Ast-Ende mit einer Blüte abgebrochen und dem Apotheker mitgebracht, der meinte, es sei »Ginster« – wohlriechend, aber keine Heilpflanze.
Jedes Jahr im Frühling ging er zwei- oder dreimal die Woche wie zufällig die Abkürzung über den kleinen Fußweg entlang der früheren Bahntrasse, um die Ginsterbüsche mit ihren gelben Blüten zu riechen. Bienen, manchmal auch Schmetterlinge schien der Duft ebenso anzulocken. Nirgendwo anders in Gaza waren ihm solche Pflanzen aufgefallen, und auch nirgendwo sonst, aber er hatte den Gazastreifen ohnehin seit Jahren nicht mehr verlassen. Hier in Rafah, ganz im Süden an der ägyptischen Grenze, wo die Folien-Gewächshäuser für Tomaten und Gemüse jeden Quadratmeter unbesiedelten Landes erobert hatten, hatte niemand Platz und schon gar kein Wasser für nutzlose Sträucher.
An Yasminas Gesicht konnte er sich nur noch verschwommen erinnern, jetzt war auch ihr Geruch für ihn verloren. Im Traum spürte er manchmal noch ihre weichen Finger auf seinem Arm, obwohl sie ihn nur wenige Male zart berührt hatte.
Tarik stand noch immer da und starrte auf die Bahntrasse, als er hinter sich eine Stimme hörte. »Salam, Tarik, was gibt es auf der Baustelle so Interessantes zu sehen?« Tarik wandte sich um, er erkannte Abdul, einen Nachbarn, und wollte sich nichts anmerken lassen.
»Was wird da gebaut?«, fragte Tarik daher zurück.
»PalTel baut hier einen Verteilerkasten für Telefon und Internet, nebenan kommt eine Funkantenne hin. Es gibt irgendein neues Europa-Hilfsprogramm für bessere Infrastruktur.«
»So Gott will bleibt die Infrastruktur eine Weile stehen, und die Israelis ruinieren sie nicht gleich wieder mit ihren Raketen.«
»Bis dahin haben wir wenigstens schnelles Internet, und das Telefonieren über WhatsApp wird auch endlich besser funktionieren.«
Tarik nickte, wünschte Abdul ein »Allah sei mir dir« und ging weiter. Er wollte allein sein und an Yasmina denken. Nicht, dass er Salma, seine Frau, nicht verehrte und schätzte. Mit der Zeit spürte er sogar ein tiefes Gefühl der Verbundenheit: Die vielen gemeinsamen Erlebnisse und die beiden Kinder – sie hatten ihr Leben gut gemeistert. Aber echte Liebe, die hatte er nur für einen einzigen Menschen jemals empfunden, und über dieses Gefühl hatte er nie mit irgendjemandem gesprochen.
Die Liebe zu Yasmina war der Grund dafür gewesen, dass er nach dem Studium nicht länger in Ägypten geduldet wurde. Yasmina war Ägypterin, sie hatte wie Tarik an der Sueskanal-Universität in Ismailia studiert.
Als ihre Familie von der unschuldigen Liebe Wind bekam, wurde Yasmina sofort zu Hause eingesperrt. An einen dahergelaufenen Palästinenser, noch dazu aus Gaza, wollte man die einzige Tochter nicht verlieren, das kam überhaupt nicht infrage.
Yasmina musste schon bald darauf einen Cousin aus Kairo heiraten, wie Tarik von einem Studienkollegen erfahren hatte. In den Vorlesungen tauchte sie nie mehr auf.
Tarik hatte seinen Abschluss noch bekommen, aber Yasminas einflussreiche Familie sorgte dafür, dass er danach seine Aufenthaltsgenehmigung sofort verlor und Ismailia und Ägypten wieder verlassen musste.
Zurück in Gaza heuerte er bei einem Vermittlungsunternehmen an, das palästinensische Bauarbeiter nach Kuwait entsandte, denn in Gaza gab es nicht viel zu bauen – und Israel, wo früher viele aus Gaza gearbeitet hatten, ließ Arbeitskräfte von hier nicht mehr ins Land.
So fand sich Tarik in einer stickigen Schlaf-Baracke in Kuwait wieder, in der es auch nachts zum Schlafen viel zu heiß war, tagsüber befehligte er bei sengender Hitze pakistanische Bauarbeiter oder schwitzte in einem verdreckten Bürocontainer ohne Klimaanlage gebeugt über Plänen für pompöse Luxusbauten, schicke Villen mit Swimmingpools oder Bürotürme mit großen, getönten Scheiben und Aircondition. Nach einem Jahr in Kuwait bekam er zwei Wochen Urlaub und eine stattliche Summe Geld.
In diesen zwei Wochen heiratete er Salma, die Familien hatten das so arrangiert. Er kannte sie vor der Hochzeit nicht, konnte sich jedenfalls nicht an sie erinnern, auch wenn die Eltern behaupteten, sie hätten als Kinder schon zusammen gespielt. Salma kam ebenfalls aus Rafah, ihre Familie lebte wie die von Tarik schon immer in Gaza, keine Nachkommen von Flüchtlingen aus dem heutigen Israel, man wollte unter sich bleiben.
An die Hochzeit erinnerte er sich wie an einen Film, in dem er aus Versehen selbst die Hauptrolle spielte. Salma fand er sympathisch, es war keine Liebe, aber er respektierte sie. Sie konnte nichts dafür. Manchmal dachte er darüber nach, ob auch Salma zuvor eine unerfüllte Liebe erlebt hatte. Gefragt hatte er sie nie.
Er hatte sich noch längst nicht an das neue Leben als Ehemann und die Verantwortung für eine Familie gewöhnt, als er sich schon kurz darauf wieder in Kuwait wiederfand. Es verging Jahr um Jahr, meist arbeitete er in einem der Golf-Staaten, baute Luxushäuser, Abwasserkanäle im Untergrund, Hafenanlagen, immer wieder unterbrochen für einige Monate in Rafah bei seiner Familie. Schließlich kam er aber doch noch zu einer Arbeit zu Hause in Rafah, die fortan den Lebensunterhalt der ganzen Familie sicherte.
Es war purer Zufall: Auf dem Flug von Kuwait nach Ägypten, von wo es für einen kurzen Urlaub weiter per Bus zur Grenzstation nach Rafah gehen sollte, saß breitbeinig auf dem Fenstersitz ein verschlossener Typ, der nur kurz mürrisch aufblickte und unwillig sein Bein zurückzog, damit Tarik sich auf den Sitz am Gang zwängen konnte. Als Tarik in den Unterlagen seines Arbeitgebers blätterte, las der dunkle Typ unverhohlen mit und begann sich plötzlich für ihn zu interessieren. Er stellte sich sogar vor und reichte ihm, trotz der Enge im Flugzeug, gebieterisch seine breite, behaarte Hand, mit der er schmerzhaft zudrückte: »Ich bin Hakim.« Er wollte wissen, was Tarik in Kuwait machte und was er gelernt hatte. Daraufhin drängte er Tarik, ihm seine Telefonnummer zu geben. Tarik hatte kein großes Verlangen danach, aber der Mann ließ sich nicht abwimmeln.
Schon am nächsten Tag, er hatte die Begegnung im Flugzeug bereits verdrängt, meldete sich dieser Hakim, man müsse sich dringend sehen, er solle sofort in das Café Abu Ahmed kommen, das sei ja gleich um die Ecke. Er sagte das mit einer Bestimmtheit, wie sie nur die Funktionäre der Hamas an den Tag legten. Sein Ton ließ einen Widerspruch unangebracht, vielleicht sogar gefährlich erscheinen, und auch wenn Tarik sich wunderte, woher Hakim wusste, dass das Café Abu Ahmed nicht weit von seinem Haus lag, machte er sich sofort auf den Weg.
Hakim begrüßte ihn ohne Worte und bedeutete auch ihm zu schweigen. Er öffnete ein kleines Metallbehältnis und legte sein Telefon hinein. Dann wies er ihn mit Gesten an, auch sein Handy in das Kästchen zu legen, gleichzeitig lud er ihn ein, sich auf das bereitliegende Kissen zu setzen. Erst als er den Behälter fest verschlossen hatte, begann Hakim zu sprechen: »Vorsichtige leben länger. Auch du wirst dich von nun an vorsehen müssen.« Dann kam er schnell zur Sache. »Ich habe mich erkundigt. Du baust unterirdische Kanäle in Kuwait und hast einen Plan für einen Tunnel unter dem Sueskanal entworfen, drunter durch, stimmt das?« Er machte eine Handbewegung, die die Linienführung eines Tunnels unter dem Kanal hindurch andeuten sollte.
Tarik erklärte ihm, dass ein Tunnel unter dem Sueskanal eine der Standardaufgaben bei den Bauingenieuren der Universität Ismailia sei, schließlich führte die Uni ja den stolzen Titel »Sueskanal-Universität«. Berge gab es in der Nähe keine, und so lag es nahe, im Fach Tunnelkonstruktion einen Tunnel unter dem Kanal hindurch zu entwerfen. Von Studenten wurden jedes Jahr etliche Tunnels unter dem Sueskanal gezeichnet und in allen Einzelheiten am Computer konstruiert. Tatsächlich gebaut wurde jedoch außer dem einen, der damals schon längst fertig war, nie wieder einer.
Hakim war ganz aufgeregt. »Du fährst nicht zurück nach Kuwait, du bleibst hier. Wir haben Arbeit für dich.«
»Aber ich habe einen Vertrag mit der Vermittlungsfirma, die haben mir auch noch nicht alles ausgezahlt für die letzten Monate, ich kann nicht einfach hierbleiben!«
»Vergiss die Kerle, du bekommst dein Geld, dafür sorgen wir. Du kannst sicher sein: Die zahlen, wenn ihnen ihr Geschäft wichtig ist, und ihr Leben. Und du hast ab sofort Arbeit bei uns, hier, zu Hause, in Rafah. Ein Mann sollte sowieso auf seine Frau aufpassen, ist nicht gut, wenn er zu oft und zu lang weg ist. Morgen regeln wir alles. Du kannst dich darauf verlassen.«
Hakim richtete sich auf, Tarik fiel auch in dem düsteren Café sein ungepflegter Bart auf, die Härchen wuchsen in alle Richtungen und auch aus der Nase. Hakim sprach leiser: »Wir suchen einen Tunnelbauer, einen richtigen Ingenieur, einen, der das wirklich gelernt hat. Ein langer, tiefer, stabiler Tunnel, den niemand so leicht entdeckt.« Hakims Miene verfinsterte sich. »Erwähne gegenüber niemandem unser Gespräch, hörst du! Du hängst jetzt sowieso mit drin. Also halt die Klappe, in deinem Interesse und im Interesse deiner Familie.« Dann wurde seine Stimme wieder weicher. »Ruf morgen um zehn Uhr diese Nummer an, und sorge dafür, dass du dann Zeit hast bis drei Uhr.«
Hakim griff nach seiner fast leeren Zigarettenschachtel, riss den Deckel ab, kritzelte eine Telefonnummer darauf und steckte ihn Tarik zu. Er öffnete den Telefon-Behälter, bedeutete ihm wieder zu schweigen und gab ihm sein Telefon zurück. Dann stand er auf und verschwand grußlos aus dem Café. Tarik bekam keine Gelegenheit, die Verabredung zu bestätigen. Es schien für Hakim selbstverständlich zu sein, dass andere taten, was er befahl.
In was war er da hineingeraten? Andererseits: bezahlte Arbeit in Gaza, nicht zurück nach Kuwait, wo man als Palästinenser den Reichtum der Golfbewohner sah, aber in einem Sklavenlager leben musste. Vielleicht doch gute Aussichten?
Dass er für die Hamas-Regierung arbeiten würde, schien da kein allzu großes Problem. Tunnel unter der Grenze gab es etliche, einer gefährlicher als der andere. Wenn er schon einen Tunnel bauen musste, dann würde seiner der beste werden, und der sicherste!
Dass sein Tunnel auch für ihn Sicherheit bedeuten würde, und zwar in einem Moment, in dem nichts mehr sicher war, das konnte er damals aber noch nicht ahnen.
KAPITEL 3
LEAH: DIE TAUCHFAHRT
Lernstress, wie in der Schule, Physik und Mathe, Chemie und Biologie. Alles kam wieder, nun jedoch im Zusammenhang mit Wassertiefe, Druck, Grundlagen der Elektrotechnik, Dieselmotor-Technik, Grundlagen von Brennstoffzellen, Kohlendioxid-Konzentration in der Atemluft, Brandbekämpfung und Verhalten im Notfall, Gesundheitsvorsorge im U-Boot, Metallhydrid-Wasserstoffspeicher, Batterietechnologie, Stromrichter, Batterieladung und Aufbau von Drehstrommotoren. Dazu auch noch Basiswissen der Seefahrt, zum Beispiel Morsen und akustische Signale. »Wer morst denn heute noch?«, murmelte Roni, die neben mir saß. Da musste ich sie mit meiner Patrouillenboot-Praxis korrigieren: »Mit Lichtsignalen wird schon noch gemorst, ist abhörsicher. Musste ich auch schon machen.«
Eines Vormittags kam der Leiter des Lehrgangs in den Kurs, bat den Dozenten um eine kurze Unterbrechung und fragte: »Wer ist noch nicht auf Tauchfahrt gewesen? Wir haben heute Nachmittag einige Mitfahrplätze für eine kurze Tagesfahrt.«
Ich riss die Hand hoch, sechs andere fuhren gleichzeitig in die Höhe. »Nur vier können mit – Roni, Talia, Rachel und«, jetzt sah er mich an, »und du, Leah.« Ich konnte mein Glück kaum fassen: endlich raus aus dem Lehrsaal und wieder auf ein Schiff, noch dazu ein U-Boot.
Wir liefen dem Lehrgangsleiter hinterher, der es eilig hatte. Als erstes ging es zum Taucherarzt, wo wir vier Frauen nacheinander antreten mussten. Der Taucherarzt hatte meine Gesundheitsakte vor sich, die große Tauglichkeitsuntersuchung lag aber schon Monate zurück. Er legte prüfend die Hand an meine Stirn. »Erkältet?«
»Nein.«
»Mach mal Druckausgleich.«
Ich hielt die Nase zu und drückte die Trommelfelle nach außen, ließ die Luft wieder heraus und machte eine Bewegung wie beim Gähnen mit dem Unterkiefer, bekräftigte: »Alles klar.« Der Doktor nickte.
Danach klopfte er mir mit dem Fingerknöchel auf die Stirn und die Wangenknochen. »Tut irgendetwas weh?«
Es tat nichts weh.
»Schwanger?«
»Nein.«
Schwungvoll unterschrieb der Taucherarzt das Blatt Papier und drückte es mir in die Hand. »Gute Fahrt!«
Als wir alle durchgeschleust waren, ging es zur Pier. Erst jetzt, wo wir ganz nah davorstanden, sahen wir von oben das ganze Boot, vorher hatten nur der Turm, die Periskope und Antennen über die Pier hinausgeragt. »Wartet hier.«
Auf dem Vorschiff standen zwei U-Boot-Männer und hantierten an den Leinen, eine Klappe des Turmes stand steil nach oben; die beiden starrten jetzt aufmerksam uns vier junge Frauen an, die Leinen interessierten sie nicht mehr. Sonst war niemand zu sehen. Der Lehrgangsleiter ging auf den schmalen Steg, der zum Boot führte, und lief zu einem anderen Luk, das offen stand. Er rief nach unten, gab dem Kommandanten Bescheid, dass die Gäste angekommen waren. Ob eine Antwort kam, konnten wir nicht hören. Eine ganze Weile passierte gar nichts.
Dann tauchte eine weiße Mütze auf, schließlich der Kopf und der drahtige Körper des Kommandanten. Er nahm keine Notiz von uns, sondern ging an uns vorbei an Land. Jetzt kamen aus dem Luk die U-Boot-Männer, einer nach dem anderen, und folgten dem Kommandanten. Sie stellten sich im Abstand von zehn Metern zur Pier in einer Reihe auf, dem Boot zugewandt. Den einen oder anderen meinte ich schon mal in der Kantine gesehen zu haben. Sie sahen eigentlich ganz normal aus, jedenfalls nicht so, wie man sich Elitesoldaten vorstellt.
Der Lehrgangsleiter wies uns an, ebenfalls eine Reihe zu bilden, aber senkrecht zur Pier. Uns gegenüber stellten sich die Offiziere auf, das ganze bildete jetzt ein zur Pier offenes Viereck. Der Kommandant stand mittlerweile neben dem Steg.
Der Erste Offizier meldete: »Crew Charly angetreten!« Dann sprach der Kommandant, nicht allzu laut: »Danke. Männer der Crew Charly, wir machen eine Übungsfahrt und prüfen die Grundfunktionen des Bootes, bevor wir morgen die Waffen an Bord nehmen. Geplant sind zehn Stunden auf See. Auslaufen dreizehnhundert, es fährt die Steuerbordwache, um achtzehnhundert übernimmt die Backbordwache, Rückkehr gegen dreiundzwanzighundert. Noch etwas: Wir haben heute Gäste dabei, die Lehrgangsbesten der künftigen Crew Foxtrott.« Oh, er hatte uns zu Lehrgangsbesten befördert. Er wandte sich uns zu: »Willkommen an Bord, zu eurer ersten Tauchfahrt, wie ich gehört habe.« Und dann wieder zur Besatzung: »Männer, dass mir keine Beschwerden kommen.« Bei der Mannschaft kam Gemurmel auf.
So förmlich hatte ich mir das alles nicht vorgestellt. Ich streckte den Rücken durch. Die Männer schielten zu uns herüber.
Der Erste Offizier rief laut: »Crew Charly«, dann mit merkwürdiger Betonung, das erste Wort lang gedehnt: »Aaauuuf … Manöverstation!« Alle bewegten sich über den Steg und verschwanden nacheinander im Luk, drei Mann blieben an Deck und gingen wieder zu ihren Leinen. Von der Seite näherte sich ein Kranfahrzeug, fuhr auf den Steg zu. Es sollte ihn wohl heben und damit die Verbindung zum Land kappen. Der Lehrgangsleiter gab uns die Hand, dann gingen wir als letzte über den Steg, bückten uns, um den Handlauf der Leiter durchs Luk zu erreichen, und dann mussten wir aufpassen, die Sprossen unter uns zu treffen und den Po durch das enge Rohr nach unten zu schieben.
Unten angekommen standen wir im Halbdunkel im Weg herum, bis uns der Zweite nicht diensthabende Offizier einige Schritte weiter in die Zentrale bugsierte. »Ich soll euch einweisen. Also: Ihr aus dem Lehrgang müsstet euch ja eigentlich auskennen. Hier ist der Niedergang nach unten zu den Mannschaftsräumen, hier in den Ecken der Zentrale oder unten in der Messe stört ihr am wenigsten. Geheimes gibt es heute nicht an Bord, wir haben auch fast keine Waffen dabei, in den Rohren sind nur Dummies, wegen des Gewichts. Ihr werdet selbst ein Gefühl dafür haben, wann die Kameraden Zeit haben, euch etwas zu erklären. Wenn sie beschäftigt sind, lasst sie in Ruhe.«
Die Sicherheitseinweisung war kurz, theoretisch wussten wir ja alles, er wies nach oben. »Gelbe Tüten mit Atemmasken hängen überall, im Notfall die erstbeste greifen. Anschlüsse für Atemluft«, er wies auf ein Rohr mit einem Ventil dran, das Rohr ging durch den ganzen Raum, immer wieder Ventile, »auch überall, im Notfall von einem zum anderen hangeln, immer aus- und wieder einstöpseln. Habt ihr schon mal geübt, hoffentlich, jetzt wisst ihr auch, wie es an Bord aussieht. Hier sind wir in der Zentrale. Die Arbeitsbereiche sind eingeteilt«, er wies auf den Bereich uns gegenüber, »in Maschine und Elektrotechnik, da Ruder, dort der Waffeneinsatz.« Die meisten der Bildschirme waren abgedeckt, es saß auch keiner dran. »Da drüben Horchen und Sonar, daneben Lagezentrum, Kommunikation und hier«, wir standen davor, »Navigation, da stören wir jetzt im Moment am wenigsten.« Überall waren Sessel vor den Arbeitsplätzen, überall Tastaturen, Mousepads und jede Menge Bildschirme, meist drei übereinander. Am Rand ein altmodischer Telefonhörer mit einem kleinen Schaltkasten, »Unterwassertelefonie« stand dran. Mittendrin das Sehrohr, ein großer Block, die Okulare, jeweils drehbar mit zwei Griffen, mit extra Bedienungstasten für fast jeden Finger.
»Wollt ihr beim Auslaufen auf den Turm? Zwei können hoch, mehr Platz ist nicht.« Ich stand richtig, und zusammen mit Talia kam ich dran. Also wieder hoch, aber diesmal durch den Turm, eine viel längere Leiter, unterbrochen durch das untere Turmluk, wo sich die Röhre verengte, zum Glück mit glatten Flächen, sodass man sich mit dem Rücken hinten abstemmen konnte beim Nach-oben-Schieben. Oben angekommen suchte man vergeblich eine Stehfläche, es gab nur einen schmalen Rand um das Loch, durch das man bis auf das Deck im Bootskörper tief unten sehen konnte.
Der Erste Offizier stand bereits auf dem Turm, nahm aber keine Notiz von uns und musterte die Vorbereitungen der Männer an Deck. Schließlich rief er in ein Mikrofon: »Klar zum Auslaufen.« Der Lautsprecher tönte blechern: »Leinen los und auslaufen.«
Nach einer Reihe weiterer Kommandos machte sich das Boot auf den Weg Richtung Hafenausfahrt, ein Weg, den ich schon oft mit dem Patrouillenboot selbst gesteuert hatte.
»Diesel starten, auf vierzig Umdrehungen gehen.« Jetzt ertönte ein Grummeln an der Flanke des Bootes, kein richtiges Motorgeräusch, bloß ein starkes Fauchen und manchmal ein Blubbern. Der Offizier hatte mitbekommen, dass ich auf das Geräusch achtete. »Wenn wir getaucht mit Schnorchel fahren, ist fast nichts zu hören, der Auspuff ist so konstruiert, dass er zusätzlich ein Luftbläschen-Polster um das Heck legt. Aufgetaucht und mit solchem Krach fahren wir ja nur in der Hafeneinfahrt.«
Jetzt fuhren wir um die Neunzig-Grad-Kurve in der Hafeneinfahrt. Das Boot begann sich mit der Dünung zu bewegen, es gab nahezu keine Bugwelle, der runde Bug schob sich einfach so unter die Wasseroberfläche, nur seitlich und hinten gab es eine mächtige Schaumspur. Im Takt der Wellen wurde das Fauchen der Abgase mal lauter, mal leiser. Der Kommandant kam von unten und schob sich neben uns auf die winzige Plattform im Turm, nickte uns zu und drehte sich zur Sprechanlage: »Klarmachen zum Tauchen!«
Wir verstanden das als Signal für uns, nach unten zu verschwinden. Talia zuerst, ich kletterte ihr langsam nach und achtete darauf, ihr nicht auf den Kopf oder die Hände zu treten. Von oben drängelte schon der Erste Offizier. Unten angekommen spürten wir die Betriebsamkeit in der Zentrale. Die Bildschirme waren jetzt erleuchtet, ein Teil der Sitze war von den Männern besetzt, die Tastaturen oder Knöpfe bedienten. Als Letzter kam der Kommandant, wir hörten ihn klackend das Luk verriegeln, hoch über uns, dann stieg er herunter, das untere Luk ließ er offen.
»Boot ist klar zum Tauchen«, meldete der Erste Offizier. »Fluten und auf Sehrohrtiefe gehen!«, rief der Kommandant, »Fluuuten« wiederholten alle im Boot im Chor. Der tiefe Männergesang, der nur aus diesem einen Wort bestand, hatte etwas Geheimnisvolles, wie eine Beschwörungsformel der gemeinsamen Tauchfahrt. Ein Ritualgesang, den ich noch oft genug hören sollte, auch wenn er als reiner Frauenchor nicht so eindrucksvoll klang, das muss ich zugeben.
Das leise Gluckern von Wasser in den Tauchtanks war zu hören, danach passierte überhaupt nichts Außergewöhnliches. Den ersten Tauchgang hatte ich mir spannender vorgestellt. Es fiel kein Wort, außer wenigen kurzen Ansagen und Befehlen: »Achtzehn Meter, Sehrohrtiefe.« – »Maschine stopp, Boot auspendeln.« Wir schwebten jetzt lautlos durchs Wasser, ein leichtes Schwanken. Dann: »Fünfzig Umdrehungen.«
Es war genauso ruhig, als läge das Boot noch im Hafen, kein Schiffsgeräusch, kein Maschinengeräusch. Ich ging zum Kontrollstand für die Motoren und die Elektrotechnik, einer der Dieselmotoren schien zu laufen, zu hören war davon aber nichts. Der Maschinen-Maat zeigte mir die Drehzahlanzeige des Elektromotors, der nur fünfzig Umdrehungen machte, geradezu gemächlich, verglichen mit den hochtourigen Motorbooten, die ich von früher kannte. »Der Schnorchel ist draußen, der Diesel lädt die Batterie und liefert gleichzeitig Strom für den Antrieb«, er zeigte auf Pfeile, die die Stromflüsse anzeigten. »Die Schraube ist sehr groß, damit wir nur wenige Umdrehungen machen müssen und so praktisch ohne Schraubengeräusch unterwegs sind.«
In dem Moment ging einer der Männer zur Tür des Maschinenraums und stülpte sich große Ohrenschützer über. Als er die Tür öffnete, dröhnte der Dieselmotor laut, als er sie hinter sich schloss, war es sofort wieder absolut ruhig. »Alles, was Krach macht, ist gummigelagert in einer hermetisch geschlossenen Kapsel. Auf keinem Schiff schläft man so komfortabel wie in unserem Boot, keine Vibration, kein Krach! Und vor allem: Niemand hört uns, wir sind nicht zu orten.« Der Maat schien so stolz auf das Boot zu sein, als hätte er es selbst konstruiert. Ich nickte ihm anerkennend zu.
Der Zweite Offizier kam vorbei. »Schaut euch ruhig allein um.« Das ließen wir uns nicht zweimal sagen. Zuerst gingen wir in den Bugraum mit seinen mächtigen Torpedorohren. Die Durchgänge hatte ich mir enger vorgestellt; aus U-Boot-Filmen kennt man die Schotten mit den kleinen runden Mannlöchern zum Durchschlüpfen, hier gab es keine Schotten, im Bugraum war sogar richtig Platz. Einer der U-Boot-Männer schien meine Gedanken zu ahnen und stellte richtig: »Hier geht es eng zu, wenn wir alle Waffen dabeihaben.« Er zeigte uns auch den Schlafraum für die Unteroffiziere, drei Kojen übereinander, die beiden Wachen schliefen abwechselnd, keiner hier hatte eine eigene Koje. Jetzt am Nachmittag lagen nur zwei Mann darin, einer auf der oberen Koje döste vor sich hin, einer ganz unten hatte einen E-Book-Reader in der Hand und sah jetzt zu mir herauf.
Er fragte grinsend: »Na, ihr Schönen, wollt ihr wirklich eure eigene Foxtrott-Crew aufmachen, oder nicht doch lieber mit unserer netten Crew Charly mitfahren? Wir hätten viel Spaß hier.« Da beugte sich der Mann von der oberen Liege heraus und fuhr ihn an: »Wegen Typen wie dir, die Frauen blöd anquatschen, trauen die sich nicht, sie bei uns mitfahren zu lassen. Halt doch einfach die Klappe, dann wird das eher was mit den gemischten Crews.«
»Na, so empfindlich sind die Frauen aber auch nicht, die sind doch schon auf anderen Schiffen gefahren, stimmt’s?«
Ich nickte und sagte beim Hinausgehen: »Kann mit euren Sprüchen umgehen.«
Aus der oberen Koje hörte ich noch: »Bei denen brauchst du dir keine Hoffnungen zu machen mit deiner blöden Anmache!«
»Aber du vielleicht?«
Dann war hinter dem Filzvorhang nichts mehr zu hören.
Neben dem Schlafraum sollte eine Toilette sein, wie ich vom Bootsgrundriss aus dem Lehrgang wusste. Tatsächlich, es gab eine Tür; ich öffnete sie vorsichtig. Eine Dusche mit Plastikvorhang, ein Waschbecken, unglaublich viele Rohre und Ventile und dazwischen eine Toilette. Ich stand noch unschlüssig in der Tür, als einer der Männer vorbeiging und rief: »Aber nichts reinwerfen! Wenn sie verstopft ist, müssen wir einen Eimer aufstellen.«
»Sollen immer nur Frauen schuld sein, wenn was verstopft ist?«, gab Talia sofort zurück.
»Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Frauen neunundneunzig Prozent aller Rohrverstopfungen verursachen.«
»Erstens sind wir nicht irgendwelche Frauen, wir sind nicht erst seit gestern bei der Marine. Und zweitens stammen neunundneunzig Prozent aller blöden Sprüche von Männern.«
Er hob beschwichtigend die Hände: »Ok, ok, alles gut, zwei zu eins für euch. Ich wollte es ja nur gesagt haben.«
Wir gingen wieder zurück in die Zentrale, dann über die Leiter ins Unterdeck, dort kamen wir neben der Kombüse heraus, der Koch füllte gerade Kaffee in eine Kanne. »Das ist mein Reich. Ich habe es am schönsten an Bord, ich teile mir meine Arbeit selbst ein.« Wir staunten. »Und wie sieht diese Einteilung aus?« »Essen gibt es immer in zwei Schichten: vier Uhr aufstehen, um fünf Uhr dreißig und sechs Uhr Frühstück, ein bisschen Freizeit, um zehn Uhr Mittagessen kochen, elf Uhr dreißig und zwölf Uhr wieder Essen in zwei Schichten, aufräumen und ein wenig Freizeit, siebzehn Uhr dreißig und achtzehn Uhr Abendessen, danach wieder alles aufräumen, den Mitternachtsimbiss vorbereiten und ab in die Koje. Ich möchte aber mit keinem tauschen.«
Wir musterten seine winzige Küche, in der genau ein Mann Platz hatte, mit Herd, Backofen, Spüle und vielen Schränken. »Wollt ihr mal sehen?« Er kam aus der Kombüse, öffnete eine riesige Tür, und man konnte in einen begehbaren Kühlschrank sehen. »Dahinter ist der Gefrierraum. Hier haben wir Futter für sechs Wochen dabei, wenn wir auf großer Fahrt sind. Morgen kommt die Lieferung. Habt ihr überhaupt schon was gegessen?«
»Eigentlich nicht.«
»Na, ich habe hier noch Hühnchen in Orangensauce mit Reis, wie wäre es? Dann gibt es erst wieder nach siebzehnhundertdreißig etwas zu Essen, für die Backbordwache.« Der Koch holte einen Stapel von vier Suppentellern aus einem seiner Schränke, füllte jeweils in den obersten Teller Reis und eine Kelle Orangenhühnchen-Sauce und reichte ihn heraus. »Besteck ist da«, wies er auf ein schmales Regal an der Wand. »Wasser, Cola, was darf es sein? Salat gibt es hier.« Er wies auf eine große Blechschüssel zur Selbstbedienung.
Wir »Gäste« saßen gegenüber auf zwei Bänken vor unseren Tellern, zu viert war es ok, aber wenn hier zehn oder mehr Seeleute auf einmal essen sollten, würde es ziemlich eng sein.
Das Boot machte jetzt nur noch ganze leichte, gleichmäßige Bewegungen in der Dünung, je tiefer, desto ruhiger; wir waren auf Marschfahrt in Sehrohrtiefe. Das Hühnchen in Orangensauce schmeckte sogar ganz gut, fand ich, besser als in der Kantine, und die anderen stimmten zu. »Müssen wir dem Koch sagen, der freut sich.«
In dem Moment schrien oben alle Männer gleichzeitig: »Alaaaarm!« Der Koch in seiner Kombüse und die drei, vier Männer, die im unteren Deck waren, stimmten ein und riefen auch: »Alaaarm!« Wir hielten unsere Teller fest, oben war wieder Betriebsamkeit zu hören. Obwohl er wusste, dass es sich nur um eine Übung handelte, schloss der Koch hektisch seine Schubladen und zurrte die klappernden Schöpflöffel an der Wand fest.
Wir wussten aus dem Lehrgang: Auf Sehrohrtiefe und mit Schnorchel war ein U-Boot noch nicht wirklich ein U-Boot, der Schnorchel war zu sehen und zu orten, die Abgase sogar zu riechen von den Schnüffel-Sensoren der U-Jagd-Hubschrauber. Wenn man einen U-Boot-Jäger in der Nähe vermutete, musste man schleunigst zu einem richtigen U-Boot werden und tief tauchen. Dazu musste der Diesel gestoppt und die Luftzufuhr durch den Schnorchel sicher verschlossen werden, dann musste das Boot nur mit Batteriestrom lautlos in sichere Tiefe gehen, und das alles sollte ganz schnell passieren. Deshalb das Geschrei, damit alle die eingeübten Griffe ohne zu zögern ausführten und jeder sofort mitbekam, was los war.
Wir spürten die Vorlage des Bootes, als wir tiefer gingen, sonst war auch dieses Manöver wenig spektakulär. Ich hielt den Teller fest, löffelte den Rest Soße mit Reis, stellte den leeren Teller in die dafür vorgesehene Plastikwanne und machte mich auf den Weg nach oben in die Zentrale. »Zweiundfünfzig Meter«, wurde dort gerade angesagt. Der Kommandant saß in seiner Ecke und schien unbeteiligt. Ich sah auf den Platz, den ich irgendwann einzunehmen hoffte, den Platz des wachhabenden Ingenieurs, als »schiffstechnische Offizierin«. Dort saß ein konzentriert auf drei große Monitore starrender Ingenieur im Offiziersrang, mit kahlrasiertem Schädel und strengem Blick, und ich traute mich nicht, ihn anzusprechen.
Daher fragte ich leise den Zweiten Offizier, der als Backbordwache gerade dienstfrei hatte: »Hört man es denn draußen nicht, wenn an Bord so laut gesprochen wird?« Er sah mich überrascht an. »Meinst du das ›Alarm‹-Geschrei? Nein, Luftschall hier drin überträgt sich nicht nach draußen. Wenn ich aber mit einem Metallgegenstand gegen die Stange hier klopfe, dann hört man das viele Meilen weit.« Er deutete auf ein Gestänge. »Deshalb bewegen sich alle schön langsam und bedächtig, um keinen Körperschall zu produzieren.«
»Sechzig Meter erreicht«, wurde angesagt, jetzt kam das Boot wieder in eine gerade Lage. Ich ging zu den Sonar- und Horch-Männern, die beiden hatten wir vorher auf Oberdeck mit den Leinen gesehen. Die Sonar- und Horchspezialisten mussten die Seemannsarbeit auf Deck beim Einlaufen und beim Auslaufen machen, weil für sie dann in der Zentrale nichts zu tun war. Im Hafen gab es nichts zu horchen. Jetzt waren sie in Aktion und inzwischen die Einzigen, die direkt mitbekamen, was draußen passierte. Sie mussten sich aus den Geräuschen ein Bild machen über andere Schiffe, die Umgebung, den Untergrund.
Einer der beiden starrte angestrengt auf einen Bildschirm mit Mustern, der andere schob einen der beiden großen Kopfhörer vom Ohr, winkte mich heran und fragte mit ehrfürchtig gedämpfter Stimme: »Willst du mal?« Er reichte mir ein zweites Paar Kopfhörer, drehte an seinen Knöpfen. »Hörst du es? Schön, aber lästig, die lenken uns ab und stören eigentlich nur.«
Psychedelische Unterwasserklänge, dann ein dumpfes Rauschen, wieder eine Art Gesang, ein Zirpen und Fiepen, wie aus einer anderen Welt. Ich schaute ihn fragend an. Er erklärte: »Eine Delfin-Schule, die sind richtig gut aufgelegt, haben Spaß da oben! Mindestens zehn, schätze ich.« Ich lächelte.
Auch die Männer der Backbordwache, die dienstfrei hatten, überboten sich, uns junge Frauen herumzuführen und uns alles zu erklären. Als wir zum Steuerstand der Elektrotechnik kamen, rief der Wachhabende das Kommando: »Brennstoffzellen einschalten!« Das Boot konnte ziemlich lange nur mit den Batterien fahren, aber irgendwann würde man wieder auf Sehrohrtiefe gehen und den Schnorchel ausfahren müssen, um mit dem Diesel nachzuladen. Ein Teil unserer Boote hatte allerdings noch eine weitere Möglichkeit der Stromversorgung, neben den Batterien, die irgendwann leer waren: Brennstoffzellen und einen ziemlich großen Wasserstoff- und Sauerstoffvorrat, was die Unterwasserreichweite enorm vergrößerte. Die Stromerzeugung mit den Brennstoffzellen brauchte keine Luft, sie war außerdem lautlos, und als Nebenprodukt fiel chemisch reines Wasser an, das aber nur für Reinigungszwecke verwendet werden durfte.





























