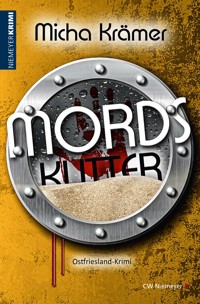7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Nina Morettis 11. Fall Recht und Unrecht sind oft nur eine Frage der Sichtweise. Was dem einen Recht, ist dem anderen Unrecht. Dies scheint auch der Heckenschütze so zu sehen, der einen gerade erst freigesprochenen Schwerkriminellen vor dem Betzdorfer Amtsgericht eiskalt hinrichtet. Bereits am nächsten Tag fallen erneut Schüsse. Ein Rächer geht in der kleinen Siegstadt um, der zurechtrückt, was der Justiz misslingt. Er kennt nur eine Strafe – den Tod!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de© 2020 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerEPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHeISBN 978-3-8271-8387-3
Micha KrämerDas Unrecht des Stärkeren
Über den Autor:„Mit Micha Krämer hat ein neues Talent die Szene betreten. Ich mag seine Schreibe. Er kann etwas, das langsam aus der Mode kommt: eine Geschichte erzählen und uns fesseln“, schrieb Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf einst über Micha Krämer.Dieses Talent demonstriert der Kultautor und Musiker aus dem Westerwald nicht nur in seinen zahlreichen Romanen und Jugendbüchern, sondern auch bei seinen Lesungen, die mittlerweile ganze Hallen füllen. Wer einmal mit dem Mythos Nina Moretti angefixt ist, den lassen die Geschichten rund um die junge Kommissarin nicht mehr los.Hier gelangen Sie zur Internetseite von Micha Krämer: www.micha-kraemer.de
Prolog
Es wird mir nichts ausmachen, ihn zu töten. Ihm eine Kugel in seine hässliche Stirn zu jagen. Im Gegenteil. Ich sehne den Moment schon herbei. Ich werde reglos an dieser oder einer anderen Stelle liegen, ihn ruhig ins Visier nehmen, um dann, wie ich es gelernt habe, zwischen zwei Herzschlägen den Finger zu krümmen. Es wird einen weiteren Schlag meines Herzens dauern, bis die Kugel ihr Ziel erreicht und ich dabei zusehen kann, wie sein Kopf explodiert.
Was ich nicht möchte, ist, dafür, dass ich der Gerechtigkeit auf die Sprünge helfe, auch noch ins Gefängnis zu gehen. Schließlich bin ich keines dieser skrupellosen Subjekte, sondern lediglich die Person, die das Urteil vollstrecken muss.
Gefällt ist es längst. Nicht von der sogenannten ordentlichen Gerichtsbarkeit der weltlichen Gerichte, wo sie seit Tagen verhandeln und doch nicht zu dem richtigen Ergebnis kommen werden. Nein, das Urteil hat der Delinquent längst selbst gesprochen. In dem Moment, als er den Pfad der Kriminalität gewählt hat, hat er sein Schicksal gewählt. Niemand hat ihn gezwungen, so zu werden, wie er ist. Nun ist er schuldig und muss dafür bestraft werden. Ich muss nun das geraderücken, was die Justiz bei ihm seit Jahren nicht fertigbrachte. Aber wie sollten sie auch? Es kann doch in diesem System gar nicht zu einem gerechten Urteil kommen.
Genau wie bei den letzten Prozessen sind auch dieses Mal wieder sämtliche Zeugen gekauft oder so unter Druck gesetzt worden, dass sie einfach vergessen haben, was passiert ist. Niemand will mehr gesehen haben, was dieser Teufel in Menschengestalt angerichtet hat. Alle haben sie Angst. Wie bei Kindern, die eine Bestrafung befürchten, sind ihre Köpfe vor Gericht gesenkt. Dabei haben sie nichts getan … außer weggesehen und vergessen. Man kann den Angstschweiß im Gerichtssaal beinahe riechen, während der Angeklagte feist lächelt. Nicht einer der sogenannten Zeugen hat es sich überhaupt getraut, ihm in die Augen zu sehen. Schlotternd, den Blick zu Boden gerichtet, lügen sie aus Angst um ihr kleines bisschen Leben.
Unter diesen Umständen tendiert die Wahrscheinlichkeit, dass es diesmal endlich zu einer Verurteilung kommt, gegen null. Doch auch wenn der unfassbare Fall eintreten sollte und das Gericht sich doch zu einem Urteil durchringen könnte, wäre die zu erwartende Strafe für das, was er getan hat, zu gering. Was wären schon ein paar Jahre im Gefängnis? Nein, die Strafe für derartige Verbrechen kann nur eine sein. Der Tod!
Ich wundere mich über mich selbst, dass ich keinerlei Furcht mehr verspüre. Weder vor ihm noch davor, dass sie meiner habhaft werden und mich einsperren könnten. Wenn es so ist, dann hat es so sollen sein. Bis dahin werde ich jedoch alles tun, dass dieser Fall nicht eintreten wird. Wichtig ist, dass ich ruhig bleibe und überlegt handele. Sowohl bei der Planung als auch in dem Moment, wenn ich den Abzug des Gewehres betätige. Noch nie in meinem Leben war ich von dem, was ich zu tun hatte, so überzeugt wie in den letzten Tagen und Wochen.
Vorsichtig öffne ich das kleine Fenster und luge hinaus. Die Luft ist kalt und klar so hoch über der Stadt. Ich atme tief ein und aus. Dabei schweift mein Blick über die Dächer der kleinen Siegstadt bis zum Amtsgericht. Ein hässlicher sechsstöckiger Betonklotz aus den Siebzigerjahren. Rechts daneben liegt die ehemalige Bergbauverwaltung, in der sich heute die Polizei- und Teile der Kriminalinspektion befinden. Vor einigen Jahren wurden beide Gebäude mit einem Anbau verbunden. Im unteren Teil befand sich, von hier aus gesehen, links der Eingangsbereich des Gerichts, rechts daneben der der Polizei mit dem Schalter der Wache. Darüber hatte man eine Art verglaste Brücke gebaut, die die jeweils zweite Etage der Gebäude verbindet. Von der viel befahrenen Friedrichstraße vor dem Haus ist sie nicht einsehbar, da es sich bei den Fenstern um Spiegelglas handelt. Sogenannte venezianische oder auch spanische Spiegel. Die im Inneren können nach draußen sehen, ohne von draußen gesehen zu werden. Eine Vorsichtsmaßnahme, die verhindern soll, dass Passanten sehen können, wer da gerade entlanggeht.
Von dieser, der zum Fluss Heller gewandten, Seite hielt man diesen Aufwand wohl für nicht nötig. Im Prinzip ist es auch schlichtweg nicht möglich, von hier in das Bauwerk zu sehen. Außer man steigt, wie ich es getan habe, auf den Turm von St. Ignatius.
Ich nehme die Laseroptik aus der Tasche und sehe hindurch. Die Entfernung bis zur Mitte der Verbindungsbrücke beträgt genau zweihundertachtzig Meter. Freies Schussfeld. Es ist kein großes Ding, von hier aus einen Menschen zu treffen. Ich schwenke nach rechts an den Fenstern entlang, bis ich hinter einer der Scheiben eine Bewegung wahrnehme. Wieder einmal staune ich über die Präzision der Optik. Kriminalhauptkommissarin Nina Moretti sitzt an ihrem Schreibtisch und wischt sich gerade eine Haarsträhne aus der Stirn. Hätte ich jetzt mein Gewehr dabei … es wäre ein Leichtes … Wobei sie ja nicht das Ziel ist. Nein, im Gegenteil. Die Frauen und Männer der Polizei erfüllen auch nur ihre Pflicht. Ein elender Job. Tage, Monate, Jahre jagen sie diesen Verbrechern hinterher, um dann mit anzusehen, wie deren Rechtsverdreher sie mit legalen, aber auch unsauberen Schachzügen wieder herauspauken. Das, was diese Leute als Recht bezeichnen, ist doch in Wahrheit nichts weiter als schreiendes Unrecht. Das Unrecht der Stärkeren und Mächtigen. Doch es wird Zeit, die in Schieflage geratene Waage der Justitia endlich wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Langsam senke ich die Optik und muss enttäuscht feststellen, dass die Sicht auf den Parkplatz hinter dem Gebäude durch Bäume und den neuen Anbau des Rathauses verdeckt wird. Das ist schlecht. Der Hintereingang, durch den auch die Gefangenen den Gebäudekomplex betreten, ist von hier aus nicht einzusehen. Dabei hatte ich gedacht, der Kirchturm wäre der perfekte Ort für mein Vorhaben. Hineinzukommen in das Haus Gottes war ganz leicht, wenn man wusste, wie. Die Sicherheitsvorkehrungen bestanden im Grunde aus Schlössern, die es in jedem Baumarkt zu kaufen gibt und die man zur Not auch mit einer Haarnadel oder einer Büroklammer öffnen könnte. Wer rechnet schon damit, dass jemand auf die Idee kommt, von hier oben einen Menschen zu erschießen? Bis die Polizei dahinterkäme, von wo ich geschossen habe, bin ich längst auf und davon. Doch aus meinen Plänen wird unter diesen Umständen nichts werden. Ich brauche ein sauberes Schussfeld.
Von unter mir aus der Kirche klingt sanft der Gesang des Chores, der heute probt. Ich erkenne das Ave Maria von Franz Schubert sofort. Eine Komposition für die Ewigkeit. Der Moment hat nun beinahe etwas Friedvolles. Trotzdem dreht sich in meinem Kopf alles nur um einen einzigen Gedanken. Ich muss ihn töten!
Ich schließe das Fenster wieder und denke nach. Es muss noch einen anderen Weg geben, ihn ins Visier zu nehmen.
Kapitel 1
Dienstag, 11. Februar 2020, 12:42 UhrAmtsgericht Betzdorf
Nina war so wütend wie lange nicht. Sie biss die Zähne zusammen und ballte die Fäuste in den Taschen ihrer Jacke. Beinahe teuflische Gedanken kamen ihr, während sie mit anhören musste, wie Richterin Frida Christiansen den Freispruch für Öger Mhalladi begründete. Am liebsten würde Nina jetzt aufspringen und diesem feist grinsenden Dreckskerl immer wieder laut schreiend ins Gesicht schlagen. Der Mann war eindeutig schuldig. Es gab handfeste Beweise und auch Zeugenaussagen, dass Mhalladi vor einem halben Jahr so lange auf einen jungen Mann eingeprügelt hatte, bis dieser beinahe verstorben wäre. Der Junge lag immer noch im Koma. Die Chancen, dass er jemals wieder aufwachen würde, tendierten gegen null. Sämtliche Zeugen hatten vor Gericht ihre vorherigen Aussagen revidiert und waren sich plötzlich überhaupt nicht mehr sicher gewesen, was oder ob sie überhaupt etwas gesehen hatten. Die Hauptbelastungszeugin der Anklage, eine junge Frau, war erst gar nicht zum Prozess erschienen. Niemand wusste, wo sie abgeblieben war. Nina befürchtete das Schlimmste. Öger Mhalladi war mit das Übelste an Mensch, was Nina jemals untergekommen war. Die Liste der Straftaten, die dem Oberhaupt des libanesischen Familienclans in den letzten Jahren vorgeworfen worden waren, war ellenlang. Es hatte Dutzende Verfahren gegen den Mann gegeben, die aber alle, genau wie der Prozess heute, mit einem Freispruch geendet hatten oder eingestellt worden waren.
Als die Richterin die Sitzung schloss, war Nina die Erste, die den Gerichtssaal verließ.
„Nina, Schätzelein, beruhig dich“, hörte sie Kriminalhauptkommissar Holger Wolf hinter ihr sagen, der extra wegen des Prozesses aus Köln angereist war.
Nina blieb abrupt stehen und wirbelte herum. Holger wäre fast gegen sie gerannt.
„Ich soll ruhig bleiben? Das blöde Arschloch da drin belacht sich über uns, und ich soll ruhig bleiben?“, zischte sie zurück.
„Genau, Nina. Du kannst et nämlich nit ändern“, meinte der Kölner Kollege.
Sie wusste, dass er recht hatte. Sie, Nina Moretti, konnte nichts ändern. Typen wie Öger Mhalladi bogen sich das Gesetz so, wie sie es brauchten. Der Typ machte keinen Hehl daraus, wie sehr er die Polizei und das deutsche Rechtssystem verachtete. Andererseits spielten er und sein Anwalt das Spiel perfekt. Es war hinlänglich bekannt, dass der Clan des Libanesen Zeugen kaufte oder unter Druck setzte. Holger hatte Nina von einem Fall in Köln erzählt, in dem diese Kriminellen sogar vor Polizisten und dem leitenden Staatsanwalt nicht Halt gemacht hatten. Ein Kollege aus der Domstadt hatte sogar, nachdem er und seine Familie massiv bedroht worden waren, den Dienst quittiert und war weggezogen.
Leute wie Öger Mhalladi glaubten von sich selbst, über dem Gesetz zu stehen und mit allem durchzukommen. Und wie die Urteilsverkündung gerade gezeigt hatte, schien es ja auch zu funktionieren.
„Weißt du was, Holgi? Du hast recht. Ich kann es nicht ändern. Aber zum Glück ist der Dreckskerl ja ab morgen wieder in Köln und somit ganz allein euer Problem“, fuhr sie ihn harscher an, als sie wollte.
„Sorry … Holger – war nicht so gemeint“, entschuldigte sie sich sofort.
Holger lächelte. Seine Ruhe und Ausgeglichenheit hatte sie schon früher immer bewundert, als sie selbst noch beim KK11 in Köln gewesen war. Acht Jahre waren seit ihrer Versetzung ins Land gegangen. Die Domstadt am Rhein war nie ihre Stadt gewesen, weshalb Nina den Wechsel ins eher ländliche Betzdorf noch keinen Tag bereut hatte. Der Einzige aus der alten Kölner Truppe, zu dem sie auch heute noch gelegentlich Kontakt hatte, war Holger Wolf, ihr damaliger Partner. Natürlich waren sie nur dienstlich Partner gewesen. Dies lag zum einen daran, dass Holger nicht wirklich dem Bild von Ninas Traummann entsprochen hatte, und zum anderen an der Tatsache, dass Holger auf Jungs stand. Dennoch war da zwischen ihnen etwas, das sie durchaus als eine echte Freundschaft bezeichnen würde.
„Glaub mir, Schätzelein, mich nervt das auch gewaltig, dass der Mhalladi das Gericht als freier Mann verlässt. Aber irgendwann … irgendwann, dann is er auch reif. Du weißt doch: Die kleinen Sünden bestraft der liebe Gott sofort, und bei den großen – da dauert das eben schon mal etwas länger. Aber am End, da bekommt jeder, wat er verdient.“
„Eine super Weisheit, Holgi. Magst du die mal den Eltern von dem Jungen erzählen, den der Öger Mhalladi ins Koma geprügelt hat? Frag sie mal, für welche Sünde ihr Sohn büßen musste“, schnaufte sie und packte dann Holger, der betroffen den Blick senkte, am Arm und zog ihn mit sich. Hinter ihnen drängten nun immer mehr Menschen aus dem Gerichtssaal. Es wurde Zeit, dass sie hier fortkamen. Auf der Treppe nach unten holte Kriminaloberkommissar Kübler sie beide ein.
„Das ist echt das Letzte“, schimpfte er. Nina antwortete nicht. Sie musste das Ganze hier schnell vergessen. Falls das überhaupt so einfach möglich war. Sie zog ihr Mobiltelefon aus der Tasche und sah auf das Display. Es war kurz vor ein Uhr.
„Was haltet ihr von chinesisch?“, fragte sie.
„Da wär ich dabei“, antwortete der Kölner.
„Ähm … Meine Frau hat mir Brote geschmiert“, entschuldigte Kübler sich.
„Quatsch, Thomas, komm mit. Ich geb einen aus“, erwiderte sie. Kaum jemand kannte Kübler so gut wie sie. Thomas ging gerne essen. Dumm war nur, dass er dafür meist zu geizig war.
„Na gut, wenn du drauf bestehst, komme ich eben mit“, gab er auch prompt klein bei.
Die Luft draußen vor dem Amtsgericht war angenehm kühl und frisch.
„Ich glaub, das gibt Schnee“, nörgelte Kübler und setzte die kunterbunte Bommelmütze auf, die seine Frau Alexandra ihm gestrickt hatte.
Rechts neben dem Eingang lauerte bereits gut ein Dutzend Journalisten. Sogar ein Kamerateam war dabei. Nina entdeckte auch die Reporter der einheimischen Käseblätter. Dumm war, dass die auch sie kannten. Die Ersten, die mit gezückten Stiften, Kameras und Schreibblöcken in den Händen auf sie zukamen, waren Claudia Geimer und Peter Seel von der benachbarten Redaktion der Rhein-Zeitung.
„Claudia – frag mich erst gar nicht“, kam sie der Reporterin zuvor, bevor die überhaupt den Mund öffnen konnte. Nina mochte die Frau mit der Brille und den mittlerweile ergrauten Haaren. Im Prinzip kannte in Betzdorf sowieso jeder fast jeden. Die Endung „Dorf“ nach dem „Betz“ kam nicht von ungefähr. Da konnte das Örtchen dreimal die Stadtrechte bekommen haben. Betzdorf blieb ein Dorf. Und das war im Grunde auch gut so.
„Komm, Nina, kurzes Statement. Wie siehst du als Polizistin den Freispruch?“, fragte Peter Seel.
„Glaub mir, Peter, das willst du gar nicht hören“, antwortete sie. Den Fehler, sich zu irgendeiner Aussage hinreißen zu lassen, die dann morgen in der Zeitung stand, würde sie nicht machen.
Hinter ihnen am Ausgang des Gerichtsgebäudes wurde es nun lauter. In den Pressepulk kam Bewegung. Auch Claudia Geimer und Peter Seel ließen zum Glück nun von Nina ab.
Dann trat der Teufel in Person ins Freie. Siegessicher, wie ein Olympiasieger, riss er die Hände triumphierend in die Höhe. Die Schar der Reporter schnatterte wie Gänse. Kameras klickten, Blitzlichter flammten auf. Plötzlich gab es einen dumpfen Schlag, und Öger Mhalladis Kopf schien förmlich zu explodieren. Blut spritzte. Dann erst, nach einer gefühlten Ewigkeit, hallte der Schuss durch das Tal. Panik erfasste die Menge. Einige der Umstehenden warfen sich zu Boden. Andere drängten zurück ins Gebäude. Nina blieb stehen und zog ihre Waffe, drehte sich dann mit der Pistole im Anschlag im Kreis und suchte die Umgebung ab. Auch Kübler und Holger Wolf hielten nun ihre Pistolen im Anschlag.
„Verdammt, woher kam das?“, schrie sie. Sie sah zu Kübler, dessen Blick auf den gegenüberliegenden, bewaldeten Berghang gerichtet war.
„Das kann nur von oberhalb des Barbaratunnels gekommen sein“, antwortete er. Nina betrachtete noch eine Weile die Bäume, konnte aber nichts sehen. Dann steckte sie die Waffe zurück in das Holster am Gürtel und ging zu der Stelle, an der Öger Mhalladi reglos auf dem Boden lag. Eine Pfütze Blut hatte sich unter dem, was einmal sein Kopf gewesen war, gebildet.
„Die kleinen Sünden bestraft der liebe Gott sofort“, hörte sie sich selbst flüstern. Einen Arzt brauchte Mhalladi nicht mehr. Das Projektil, das ihn getroffen hatte, hatte ganze Arbeit verrichtet. Die Zeit zwischen dem Aufprall des Geschosses und dem Moment, wo sie den Schuss gehört hatten, war verdammt lange gewesen. Wer immer abgedrückt hatte, musste ziemlich weit entfernt und somit ein verdammt guter Schütze gewesen sein. Nina sah zu den Umstehenden, die nun langsam wieder näher kamen oder sich vom Boden aufrappelten. Eine blonde Frau, in etwa in Ninas Alter, stand reglos vor dem Toten. In ihrer zitternden Hand ein Mikrofon mit der Aufschrift eines Kölner Privatsenders. Ihr blasses Gesicht rot gesprenkelt.
„Alles in Ordnung mit Ihnen?“, fragte Nina und fasste die Blonde am Arm. Keine Regung.
„Thomas, rufst du bitte mal den Notarzt“, gab Nina Anweisung, da sie als Nächstes einen totalen Nervenzusammenbruch der Reporterin befürchtete.
Sie sah, wie uniformierte Kollegen aus dem Eingang der Polizeiwache drängten. Eine junge Beamtin fasste die blutverschmierte Reporterin bei den Schultern und sprach beruhigend auf sie ein. Nina ging indes zu der Wand neben der Eingangstür zum Amtsgericht, wo in Kniehöhe der Putz kreisrund um ein Loch abgeplatzt war. Die Kugel hatte den Kopf des Opfers durchschlagen und steckte nun im Mauerwerk.
„Tja, Nina, jetzt ist er wohl wieder dein Betzdorfer Problem – der Öger Mhalladi“, fand Holger Wolf.
Nina sagte nichts mehr. Sie nickte nur stumm. Ihre Gedanken fuhren Karussell. War nicht gerade genau das eingetreten, was sie sich vor einigen Minuten erst gewünscht hatte? Doch … war es. Irgendwer hatte hier für Gerechtigkeit gesorgt. Nur laut sagen durfte sie es nicht. Alles, was ihr gerade in den Sinn kam, musste da bleiben, wo es war. Sie würden in den nächsten Tagen und Wochen einen Täter jagen müssen, dem sie eigentlich dankbar sein sollten. Öger Mhalladi war ein schwerkrimineller Verbrecher gewesen, der weder vor Mord noch Menschenhandel zurückschreckte.
„Das mit dem Chinesen hat sich dann wohl erst mal erledigt?“, brachte Kübler es mit seiner Frage auf den Punkt.
Es hatte etwas über eine Stunde gedauert, um den Ort zu finden, an dem der Schütze auf sein Opfer gelauert hatte. Er lag, wie vermutet, einige Hundert Meter schräg oberhalb der Villa Krupp am Hang gegenüber dem Amtsgericht im Wald.
Die Spurenlage war ziemlich klar und deutete darauf hin, dass der Täter wollte, dass sie wussten, von wo er geschossen hatte. Auf einem vom Sturm vor langer Zeit entwurzelten Baumstamm lag für alle sichtbar eine Patronenhülse. Daneben, auf einem abgebrochenen Zweig, steckte ein Zettel.
„Dies war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich“, las Kübler die Nachricht, die mit einem schwarzen Filzstift von Hand darauf geschrieben stand.
„Das ist von Wilhelm Busch. Aus Max und Moritz“, fiel Nina ein. Holger nickte, und Kübler schien, wie so oft, wenn es um Literatur ging, nichts zu verstehen.
„Was schätzt du, wie weit das ist?“, fragte sie an den Kölner Kollegen gewandt und deutete zwischen den Bäumen hindurch ins Tal, wo sie den Tatort sehen konnte, an dem noch immer hektisches Treiben herrschte.
Holger hob die Schultern.
„Du fragst Dinge, Kindchen. Im Schätzen von Entfernungen bin ich wirklich ganz schlecht“, antwortete er lediglich und winkte ab.
„Das sind locker dreihundert bis vierhundert Meter“, fand Kübler indes.
Nina nickte. Ja, so in etwa würde sie das auch einschätzen.
„Auf alle Fälle wusste unser Täter sehr genau, was er tat. Ich bezweifle nämlich, dass jemand von uns dreien aus dieser Entfernung auch nur ein Scheunentor treffen würde“, spekulierte Kübler weiter. Nina ging zu einer Mulde im Boden. Das Laub war platt gedrückt. Der Körperabdruck des Schützen ließ sich mit bloßem Auge erahnen. Damals während der Ausbildung hatte sie einmal die Gelegenheit gehabt, mit einem Scharfschützengewehr zu schießen. Zum Unterrichtsstoff hatte das aber nicht gehört. Nein, vielmehr hatte sie damals eher zufällig einen Kollegen auf dem Schießstand kennengelernt, der gerade die Ausbildung bei einer Spezialeinheit absolvierte. Dennis, an den Vornamen des Typen konnte sie sich noch gut erinnern, hatte sie zuerst auf die Schießbahn, dann ins Kino und am Ende noch zu ihm nach Hause eingeladen. Beim letzten Programmpunkt hatte sie dann aber zum Glück doch noch die Reißleine gezogen. Aber egal. Von Gewehren hatte der Typ definitiv mehr Ahnung gehabt als von Frauen.
Ein Ziel auf eine solche Distanz zu treffen, war nämlich eine Kunst für sich. Da war es nicht einfach damit getan, sich eine teure Kanone zu besorgen, sich auf den Boden zu legen, zu zielen und abzudrücken. Nein, bei einem Schuss aus vierhundert Metern Entfernung, durch ein dicht bewaldetes Gebiet, gab es so einiges zu beachten. Den Wind, die Temperatur, Atmung und Herzschlag. Nina hatte damals auf einhundert Meter Entfernung gerade einmal den Rand der Scheibe getroffen. Dennis dreimal hintereinander ins Schwarze, mit einer Streuung von nur wenigen Millimetern. Wie gesagt, mit Gewehren hatte er sich ausgekannt.
Im Wald hinter sich hörte sie Hundegebell, das aber nun vom Motorengeräusch eines Helikopters übertönt wurde, der von der Stadt kommend dicht über sie hinwegfegte.
Obwohl ihr Büro Luftlinie nur wenige Hundert Meter entfernt war, war Nina zuvor noch nie hier oben im Wald gewesen.
„Wo komme ich denn raus, wenn ich hier jetzt einfach geradeaus weiterlaufe?“, fragte sie an Kübler gewandt.
„Ich denke mal, in Herkersdorf oder im Imhäusertal“, antwortete er.
Nina zog ihr Mobiltelefon aus der Jacke und startete die Kartenfunktion. Die App zeigte sie selbst als einen blauen Punkt umgeben von Grün. Sie schob das Bild mit zwei Fingern zusammen, bis im Westen die ersten Häuser der Stadt deutlich sichtbar wurden. Im Osten, die Richtung, in die ihr Täter vermutlich geflohen war, erstreckte sich immer noch nur eine grüne Fläche. Verdammt, sie hätte nicht gedacht, dass der Wald gegenüber der Wache so groß war und vor allen Dingen so steil berghoch ging.
Das Funkgerät, das sie bei sich trug, knackte. Der Leiter der Hundestaffel meldete sich und teilte ihr mit, dass die Hunde die Spur verloren hatten. Vermutlich war der Täter in ein Fahrzeug eingestiegen und damit entkommen.
„Okay, wir brechen hier ab und überlassen den Rest den Kollegen von der Spurensicherung“, entschied sie und machte dann noch schnell ein Foto von der verschossenen Patronenhülse und dem Brief des Täters.
„Dies war der erste Streich. Doch der zweite folgt sogleich“, las sie noch einmal und musste schlucken. Eine böse Vorahnung überkam sie. Wer immer das geschrieben hatte, war noch nicht fertig mit dem, was er tat.
Nina umfasste die Tasse fest mit beiden Händen. Der heiße Kaffee tat gut. Ihre Finger und Füße waren nach dem Aufenthalt im winterlichen Wald eiskalt. Ihr Gesicht fühlte sich, nachdem sie nun hier im warmen Besprechungsraum saß, an, als würde es glühen. In Gedanken war sie bei dem Attentäter. Wie lange hatte der Mann … oder die Frau wohl da draußen auf dem gefrorenen Waldboden gelegen? Tief in ihrem Inneren zog sie den Hut vor der Leistung, die er oder sie vollbracht hatte. Die Messung mit einem Laser hatte ergeben, dass der Schuss aus vierhundertzweiundfünfzig Metern Distanz ausgeführt worden war. Interessiert lauschte sie den Ausführungen von Torsten Liebig, dem Leiter der Spurensicherung, zur Tatwaffe. Bei der Munition handelte es sich um eines der gängigsten Militärkaliber 7,62 x 54 mm R. Eine Standardmunition der russischen Streitkräfte und mit die älteste, auch heute immer noch in Verwendung befindliche Militärmunition überhaupt. Die gefundene Hülse stammte aus ostdeutscher Produktion und war als Präzisionsmunition gekennzeichnet, die zumindest bei der NVA fast ausschließlich mit der SWD Dragunow verschossen worden war. Die Abbildung eines solchen Scharfschützengewehrs zierte im Moment die Leinwand des Besprechungszimmers.
„Und wie viele dieser Kanonen sind bei Auflösung der Nationalen Volksarmee in dunklen Kanälen verschwunden?“, wollte Nina wissen, obwohl sie bereits die Antwort zu kennen glaubte.
„Etliche. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Im Prinzip kann sich nämlich jeder so ein Ding ganz legal zulegen, der die entsprechende Berechtigung hat. Die zivile Version der Dragunow ist nämlich auch unter Sportschützen sehr beliebt. Außerdem sind auch noch etliche alte russische Scharfschützengewehre aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Markt, in denen dieses Kaliber verschossen werden kann. Die Munition ist viel zu gängig, um auf eine bestimmte Waffe zu schließen“, wusste Torsten.
„Aber diese eine Patronenhülse stammt definitiv noch aus NVA-Beständen?“, hakte Nina nach.
„Ja, das muss aber nicht heißen, dass die Waffe auch aus dieser Quelle stammt“, erwiderte Torsten.
Nina schüttelte den Kopf. Niemand besorgte sich ein neues Gewehr und verschoss damit alte Patronen. Umgekehrt würde es eher Sinn ergeben. Jemand besaß eine Waffe, die Munition war aufgebraucht, und er kaufte neue. Man fuhr ja auch nicht auf einem Neuwagen alte Räder. Wohingegen auch alte Autos gelegentlich neue Reifen benötigten. Sie würde also eher vermuten, dass die Waffe, die sie suchten, aus der Zeit stammte, aus der auch die Munition war, oder sie war noch älter. Andererseits könnte der Täter die Polizei aber auch mit der alten Munition verunsichern wollen. Warum hatte er die verschossene Hülse sonst am Tatort zurückgelassen?
„Reicht die Ausbildung in einem Schützenverein, um aus dieser Distanz zu treffen?“, fragte Thomas Kübler.
„Bei entsprechendem Talent und dem richtigen Trainer sollte das schon möglich sein“, antwortete Torsten, von dem Nina wusste, dass er selbst auch ein begeisterter Sportschütze war.
„Würdest du dir diesen Schuss zutrauen?“, fragte sie.
Torsten lächelte und überlegte sichtlich.
„Ich hab es noch nie ausprobiert. Aber mit ein wenig Übung … möglich wäre es schon. Zumindest kenne ich den einen oder anderen, der so etwas schon mal gemacht hat“, gab er zu.
Nina war erstaunt. Mit dieser Antwort hatte sie nicht gerechnet.
„Ich denke, das Problem ist nicht, aus so einer Entfernung auf eine Scheibe zu schießen. Das könnte vermutlich fast jeder nicht halbwegs Blinde erlernen. Nein, das Problem ist, auf einen Menschen zu schießen“, führte Torsten auf.
„Klar, der bewegt sich“, überlegte Kübler laut.
„Nein, das würde ich noch nicht einmal als das Hauptausschlusskriterium werten“, entgegnete Torsten.
„Der Schütze muss absolut konzentriert und ruhig sein. Niedriger Puls … flache Atmung … der Gedanke, in der nächsten Sekunde einen Menschen zu ermorden, ist dabei nicht gerade förderlich“, mischte Kriminalrat Dirken sich in die Diskussion ein.
Torsten nickte zustimmend. Auch Nina verstand, was ihr Chef sagen wollte. Der Gedanke war ihr bereits oben im Wald gekommen. Wie abgebrüht musste jemand sein, um sich dort hinzulegen und in aller Seelenruhe zu warten, bis Öger Mhalladi vor die Presse trat, um ihn dann, in einem Zustand vollkommener Entspannung, abzuknallen? Wer immer da geschossen hatte, hatte kein Problem damit, jemanden zu erschießen, weil er sich lange mit dem Thema auseinandergesetzt hatte und sein Opfer betrachtete, als wäre es lediglich eine Zielscheibe aus Pappkarton. So etwas lernte man nicht in einem Verein. So etwas lernte man beim Militär oder bei der Polizei.
„Okay“, schloss sie das Thema erst einmal ab, weil es sie nicht weiterbrachte, und kam zu einem, wie sie glaubte, viel interessanteren Punkt.
„Was denkt ihr, warum Öger Mhalladi erschossen wurde? Was war das Motiv?“
„Weil er ein Arschloch war?“, antwortete Holger Wolf beiläufig.
„Klar, Holger. Das weiß ich auch. Aber warum wurde er hier vor dem Amtsgericht, vor laufenden Kameras, hingerichtet?“, hakte sie nach.
„Nina, du hast es gerade selbst gesagt … Er wurde hingerichtet. Irgendwer war mit dem Urteil der Richterin nicht einverstanden und hat die Sache selbst in die Hand genommen“, meinte Holger.
„Ich würde sagen, die wenigsten der Zuschauer im Gerichtssaal waren mit dem Freispruch einverstanden. Mich eingeschlossen“, sagte nun Staatsanwalt Lambrecht zum ersten Mal etwas. Nina hatte ihn selten so still erlebt wie in den letzten Stunden.
„Gut, die Besucher der Verhandlung können wir aber alle schon mal ausschließen“, bemerkte Kübler unnötigerweise und hatte damit ja noch nicht einmal unrecht.
„Dat bringt doch nix, Nina“, fand der Kölner Kollege. „Der Mhalladi … der hatte mehr Feinde als Freunde. Wenn du da eine Liste machen willst … so viel Papier habt ihr gar nicht, dat die Namen da alle draufpassen. Selbst in dem seinen eigenen Clan dürften nit alle böse darum sein, dat der jetzt fort ist“, ereiferte Holger sich und fiel dabei, wie immer in solchen Situationen, in seinen kölschen Slang. Je mehr der Kollege sich nämlich aufregte, umso mehr kölsche Wortfetzen kamen über seine Lippen. Wobei Holger meist die Ruhe in Person war und man ihm, wenn er kontrolliert sprach, weder den Kölner noch die Tunte anmerkte.
„Wir sollten uns auf das konzentrieren, was wir wissen, und nicht wild spekulieren“, ergriff erneut Kriminalrat Dirken das Wort und wandte sich dann an Kübler.
„Was wissen wir über den Fluchtweg des Täters?“
Kübler räusperte sich.
„Die Hunde konnten die Spur des Mannes nur etwa zweihundert Meter bis an einen Forstweg verfolgen. Wir vermuten, dass dort ein Fahrzeug abgestellt wurde. Auswertbare Reifenspuren gibt es nicht, da der Boden gefroren war.“
„Wohin führt der Weg?“, wollte Dirken wissen.
„Sowohl in die Kruppstraße als auch ins Imhäusertal“, antwortete Kübler und fügte dann noch hinzu: „Aber in die Kruppstraße wird er wohl nicht geflüchtet sein, da er uns dort unweigerlich entgegengekommen wäre.“
„Wie kommst du darauf, dass es ein Mann war?“, hakte Nina nach.
„Trotz des Frostes haben wir auf dem Waldboden Fußspuren sichern können … also jetzt keine Abdrücke, die man mit Gips hätte sichern können. Das hat der gefrorene Boden nicht hergegeben. Aber auf einem Stück mit leichtem Raureif hat man deutlich Spuren gesehen, die auf einen Fußabdruck schließen lassen“, erklärte Kübler und deutete auf ein Bild, das er von seinem Laptop auf die weiß gekalkte Wand projizierte, auf der eben noch das Gewehr zu sehen gewesen war.
Man brauchte schon eine Menge Fantasie, um in den verwischten Eiskrümeln einen Schuhabdruck erkennen zu können.
„Schätzungsweise Schuhgröße zweiundvierzig bis vierundvierzig. Was also klar auf einen Mann deutet“, berichtete Kübler weiter.
„Es gibt auch Frauen mit großen Füßen“, gab Nina zum Besten.
„Laut Statistik besitzen lediglich vier Prozent der deutschen Damen die Schuhgröße zweiundvierzig. Nicht einmal ein halbes Prozent trägt dreiundvierzig“, triumphierte Kübler.
Warum nur wusste der so etwas, kam es Nina in den Sinn. Kein normaler Mensch konnte wissen, wie viele Menschen welche Schuhgröße besaßen. Sie selbst würde sich bei ihrer eigenen ja noch nicht einmal festlegen wollen. Mal brauchte sie eine Neununddreißig, mal die Vierzig. Sie besaß sogar ein Paar Gummistiefel in einundvierzig. Obwohl die schon ziemlich schlappten und sie da meist zwei Paar Wollsocken übereinander anziehen musste. Seit dem letzten Urlaub an der Nordsee hatte sie die Dinger deshalb auch nicht mehr getragen.
„Ach, Herr Wolf …“, wandte sich nun der Staatsanwalt an den Kölner Kollegen, „… ich habe im Übrigen vorhin mit Ihrem Vorgesetzten in Köln telefoniert und ihn gebeten, dass Sie uns, als Experte, was den Mhalladi-Clan betrifft, in diesem Fall hier vor Ort unterstützen. Ich hoffe, das ist in Ihrem Sinne?“
Holger lächelte und schielte kurz zu Nina.
„Kein Problem, Herr Staatsanwalt. Hätten Sie es nicht getan, hätte ich es von mir aus vorgeschlagen“, antwortete er.
Kapitel 2
Dienstag, 11. Februar 2020, 18:22 UhrBetzdorf/Steinerother Straße
„Dass wir beide noch mal ein Team werden, hätte ich auch nicht mehr geglaubt“, musste Nina jetzt einfach mal loswerden, als sie mit ihrem VW Käfer in das Wohngebiet Alsberg einbogen und dann im Schritttempo den Berg hinauf zu ihr nach Hause fuhren. Draußen hatte es zu allem Übel auch noch angefangen zu schneien.
„Nein, Schätzelein, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber nur weil wir jetzt zusammenarbeiten, musst du mich nicht auch noch bei dir wohnen lassen. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Vater Staat hätte mir auch ein Hotel gesponsert“, meinte Holger.
„Nix da. Du bist mein Gast, und gut ist. Außerdem haben wir Platz genug, und du bist ja auch nicht irgendein Kollege“, erwiderte sie.
„Bin ich nicht?“, fragte er erstaunt und wischte mit dem Ärmel seiner Jacke von innen an der beschlagenen Frontscheibe des betagten Wagens.
„Nein, bist du nicht. Ich würde dich nämlich eher in die Kategorie GUTER FREUND einordnen.“
„Oh, das ehrt mich aber.“
„Ja, mein Hase, da darfst du dir auch jetzt was drauf einbilden“, flachste sie, stoppte den Wagen vor der großen Garage des Anwesens und betätigte den Taster für das elektrische Garagentor, das sich nun vor ihnen langsam öffnete.
„Meine Herren, keine ordentliche Heizung im Auto, aber ein elektronischer Türöffner“, lästerte Holger.
„Ja, nobel geht die Welt zugrunde“, antwortete sie ganz ohne Groll. Solch kleine Neckereien konnten ihr die Feierabendlaune nicht vermiesen.
Am Haus war das Licht nun angegangen. Nina steuerte den Wagen in die Garage und schaltete den Motor ab.
„Halleluja, dat jibt et doch nit … sage mal … habt ihr im Lotto gewonnen oder hast du einen Nebenjob bei der Westerwälder Mafia?“, stieß Holger aus, als sie aus dem Fahrzeugdomizil auf den Hof vor dem Haus traten.
„Keines von beiden. Ich hab mich eben nur gut verheiratet“, lachte sie und begrüßte Klaus, der ihnen die Haustür öffnete, mit einem flüchtigen Kuss.
„Abend, Klaus“, meinte auch Holger, packte Ninas Göttergatten und drückte ihn an sich.
„Auf dat Küsschen tun wir zwei Hübschen aber dann mal besser verzichten. Nicht, dass die Frau Hauptkommissarin noch eifersüchtig wird“, lachte der Kölner.
Nina musste zugeben, dass sie die Arbeit mit Holger Wolf schon ein wenig vermisst hatte. Natürlich mochte sie auch die meisten der anderen Kollegen hier in Betzdorf, allen voran ihren ehemaligen Dienstpartner Hans Peter Thiel. Doch die Zusammenarbeit mit Kriminalhauptkommissar Holger Wolf war ihr in sehr positiver Erinnerung geblieben. Ansonsten dachte sie an die Zeit in Köln weniger gerne zurück. Die Großstadt, so schön Köln auch war, war nicht die ihre gewesen. Sie hatte sich dort immer wie ein Fremdkörper gefühlt. Die Entscheidung, den Job hinzuschmeißen und zurück in die heimische Provinz zu gehen, war ihr nicht schwergefallen. Dennoch bereute sie den Aufenthalt in der Domstadt auch nicht. Sie hatte dort viel gelernt, nette Menschen getroffen, aber auch eine Menge Elend gesehen. Köln bestand eben nicht nur aus Karneval, tollen Kneipen, dem Rhein und dem Dom.
Klaus hatte gekocht. Es gab Brokkoliauflauf mit Kartoffeln und Kassler. Den Rollentausch vor etwa einem Jahr hatten sie beide bisher noch nicht bereut. Nein, im Gegenteil. Klaus war ein besserer Hausmann, als sie jemals Hausfrau sein würde. Der Laden lief, die Bude war wesentlich ordentlicher und das Essen bekömmlicher.
„Eigentlich müsstet ihr ja froh sein, dass jemand den Typen aus dem Weg geräumt hat“, meinte Klaus irgendwann, als sie nach dem Abendbrot noch mit einem Kölsch am Küchentisch saßen und die Kinder bereits im Bett waren.
Nina ließ die Bierflasche auf den Tisch sinken und sah zwischen ihm und Holger hin und her.
„Das ändert nichts, dass der weg ist“, antwortete Holger ganz ruhig.
„Wieso?“, wollte Klaus wissen.
„Weil der Nächste schon in den Startlöchern steht, um seinen Platz einzunehmen“, erklärte der Kölner.
„Du meinst den Bruder von Öger Mhalladi … wie hieß der noch?“, fragte Nina.
Holger schüttelte den Kopf und trank einen Schluck, bevor er antwortete.
„Es ist vollkommen egal, wen ich meine. Dieser Familienclan besteht aus über tausend Mitgliedern, die alle um hundert Ecken miteinander verwandt sind. Brüder, Onkel, Tanten, Neffen … Die aber – das muss man auch zugeben – nicht alle Kriminelle sind. Im Gegenteil, die meisten von denen gehen ganz normalen, ehrlichen Jobs und Geschäften nach. Ärzte, Lehrer, sogar Polizisten. Wirklich kriminell sind die wenigsten. Aber diese wenigen geben nun mal den Ton an. Das ist wie überall. Die intelligenten, netten und ehrlichen Menschen sind vielleicht in der Überzahl, aber die Macht – das Sagen – haben die Stärkeren. Die Blöden schreien nun mal lauter als die Besonnenen. Guck dich doch nur mal in der Politik um. Trump, Putin … meinst du, die wären da, wo sie sind, weil die so nette Jungens wären? Nein, mein Lieber. Die sind da, weil die keine Skrupel haben und die stärksten Ellenbogen. Der Öger Mhalladi war auch so ein Alphatier. Jetzt ist er weg, und der nächste Wolf aus dem Rudel übernimmt die Führung. Und ja, Nina, vermutlich ist das der Hassan Mhalladi, der Bruder von Öger. Und wenn du den morgen auch abknallen würdest … dann käme der Nächste unter irgendeinem Stein hervorgekrochen und würde ihn beerben“, philosophierte Holger Wolf und kratzte dabei in Gedanken mit dem Daumen am Etikett seiner Kölschflasche herum.
„Dann frage ich mich allerdings, welchen Sinn eure Arbeit macht, wenn ihr bei diesen Verbrechern wie Don Quijote gegen Windmühlen anrennt“, meinte Klaus. Nina kannte seinen Sarkasmus und wusste, wie es gemeint war.
„Weil es jemanden geben muss, der diesen Vögeln Paroli bietet. Wir können denen ja nicht das Feld kampflos überlassen“, konterte Nina und trank einen Schluck.
„Aha … das wird sich euer Heckenschütze dann wohl auch gedacht haben“, stocherte Klaus weiter.
„Vielleicht hat er das. Aber im Gegensatz zu ihm vertreten wir Gesetz und Ordnung. Wir spielen nach Regeln“, belehrte Nina ihn.
Klaus zuckte mit den Schultern und nippte ebenfalls an seinem Bier.
„Vielleicht tut er das ja auch … vielleicht ist er ja einer von euch?“
Nina blickte zu Holger. Der Gedanke, den Klaus da gerade ausgesprochen hatte, war so abwegig, dass sie ihn, als er ihr selbst bereits am Nachmittag kurz nach dem Attentat gekommen war, direkt wieder verworfen hatte. Ein Polizist, der das Gesetz in die eigenen Hände nahm … so etwas gab es zumeist nur in schlechten amerikanischen Krimis.
„Kann sein … kann aber auch nicht sein. Ausschließen würde ich auch dies nicht. Wobei ich unseren Killer eher in den Reihen des Opfers suchen würde“, antwortete Holger.
„Du denkst an Machtkämpfe innerhalb des Clans?“, wusste Nina sofort, was er meinte.
„Ja, nicht alle in der Sippe waren mit dem einverstanden, was ihr selbst ernanntes Oberhaupt getan hat“, wusste Holger.
„Was ist mit den Angehörigen seines letzten Opfers? Die Familie des Jungen, den dieser Dreckskerl fast totgeschlagen hat. Also, wenn einer unseren Kindern so etwas antäte … dann könnte ich selbst als bekennender Pazifist und Kriegsdienstverweigerer für nichts garantieren“, ereiferte Klaus sich.
„Dem werden wir natürlich nachgehen, mein Schatz. Im Übrigen musst du dir gar keine Gedanken um deinen Zivi-Eid machen. In unserer Ehe sind diesbezüglich die Aufgaben ganz klar geregelt. Du machst lecker Abendessen … und sollte sich jemals irgendjemand an unseren Kids vergreifen, dann lege ich das Schwein eigenhändig um“, sagte Nina und meinte es auch genau so. Sie bemerkte, wie Holger grinste.
„Schätzelein, dat hab ich jetzt aber nit jehört.“
„Wisst ihr was … es ist schon spät. Ich würde sagen, wir brechen das Ganze jetzt ab und gehen ins Bett“, sagte Klaus in die Stille und erhob sich.
„Dein Mann hat recht, Nina. Morgen haben wir eine Menge Rennerei und Befragungen. Das wird ein anstrengender Tag“, fand auch Holger und stand ebenfalls auf.
„Für wann hattest du diesen Hassan Mhalladi ins Kommissariat bestellt?“, fragte Nina.
„Für um zehn“, antwortete Holger.
Sie nickte und ging im Kopf bereits den morgigen Vormittag durch. Dann hielt sie inne. War sie eigentlich verrückt? Es war kurz vor zehn abends, und sie hatte bereits seit Stunden Feierabend. Schlimm genug, dass sie sich zuvor schon stundenlang in ihren vier Wänden über die Arbeit unterhalten hatten. Sie würde das jetzt auf der Stelle bleiben lassen und erst wieder morgen früh ab halb acht über Mord und Totschlag nachdenken. Sie verabschiedete sich von Holger, wünschte ihm eine gute Nacht und ging dann nach oben, wo sich die Schlafzimmer befanden. Der Kölner Kollege würde eines der drei Gästezimmer im zweiten Flügel der geräumigen Achtzigerjahre-Villa beziehen, das Klaus ihm gerade zeigte. So ein großes Haus hatte schon seine Vorteile. Andererseits war es ohne Personal und Putzfrau auch eine Menge Arbeit. Aber alles in allem kein Grund zum Jammern. Als sie am Kinderzimmer vorbeiging, das direkt neben dem Schlafzimmer lag, konnte sie der Versuchung nicht widerstehen, die Tür zu öffnen, um hineinzusehen. Im schwachen Schein des Nachtlichtes lagen Chiara und Matteo und schliefen. Alles war gut so, wie es war.
Es schneite noch immer, als Thomas Kübler morgens kurz nach sieben zur Arbeit fuhr. Zum Glück war auf die Jungs vom Räumdienst Verlass und die Straßen zumindest einigermaßen gut befahrbar. Als er zwanzig Minuten später das Büro betrat, saß die Kollegin Laura Benning bereits an ihrem Schreibtisch und trank Kaffee.
„Morgen, Tom“, begrüßte sie ihn, ohne vom Monitor des Computers aufzusehen.
„Morgen, Laura. Und, geht es dir heute wieder besser?“, erwiderte er den Gruß und erkundigte sich nach ihrem Wohlbefinden. Laura hatte sich am Montag krankgemeldet. Irgendwas mit Übelkeit und Erbrechen. Eine unangenehme Sache, die er absolut nicht brauchte, und weshalb er froh gewesen war, dass Laura die letzten beiden Tage der Arbeit ferngeblieben war. Es reichte schon, dass seine Kinder ständig die hartnäckigsten Viren und Bazillen aus dem Kindergarten nach Hause schleppten.
„Ja, seit gestern Nachmittag kann ich endlich auch wieder was zu mir nehmen, ohne dass es gleich wieder rauskommt“, erklärte sie.
Thomas hängte seine sandfarbene Militärjacke, das gleiche Modell wie Fernsehkultkommissar Schimanski sie immer getragen hatte, an die Garderobe hinter der Tür. Die Strickmütze steckte er in die Tasche der Jacke.
„Gestern hast du hier echt was verpasst“, wechselte er jetzt einmal das Thema, da ihm bereits bei dem Gedanken an Lauras Erzählungen flau wurde.
„Ich bin bereits im Bilde“, antwortete sie zu seiner Verwunderung.
„Ähm … und woher? Hast du schon mit jemandem von den Kollegen gesprochen?“, wunderte es ihn, da er geglaubt hatte, er wäre heute wieder einmal einer der Ersten im Büro. Thomas war schon immer ein Frühaufsteher gewesen und hatte daher im Gegensatz zu manch anderem kein Problem damit, morgens früher anzufangen und dafür im Gegenzug aber auch schon mal bei Feierabend früher die Biege zu machen.
„Nein, bisher weiß ich nur das, was in der Zeitung steht … und was der Dorffunk so berichtet“, antwortete sie und deutete auf die Zeitung, die neben der Tastatur auf seinem Arbeitsplatz lag.
Thomas setzte sich hin, nahm sie, überflog die Schlagzeile auf Seite eins und blätterte dann weiter in den Regionalteil, wo dem Gerichtsverfahren gegen Öger Mhalladi und dessen Ermordung anderthalb Seiten gewidmet waren.
„Na ja, so in etwa passt es“, fand er, nachdem er den Artikel gelesen hatte, und warf das Käseblatt dann einfach in den Papierkorb.
„Hast du auch zwischen den Zeilen gelesen?“, erkundigte Laura sich.
„Ja, hab ich. Fehlt nur noch, dass die fordern, dass diesem Sniper ein Denkmal gesetzt oder das Bundesverdienstkreuz verliehen wird“, wusste Thomas sofort, was sie meinte. Der Tenor des Berichtes war ziemlich eindeutig, auch wenn es dort nicht direkt so stand. Die Polizei war doof und unfähig und dieser Heckenschütze ein Held. Thomas hatte nichts anderes erwartet. Selbst seine Frau war dieser Meinung. Und die war normalerweise eine Pazifistin par excellence.
„Ich find es gut, dass jemand diesem Dreckschwein die Rübe weggeblasen hat“, fand Laura nun auch.
Thomas sah sie mit offenem Mund an. „Du solltest besser aufpassen, was du hier von dir gibst“, sagte er scharf.
„Wieso? Dies ist ein freies Land. Da kann ich sagen, was mir passt … zumindest behaupten sie das doch immer alle. Oder?“, konterte Laura.
Thomas sagte nichts. Er kannte Lauras verschrobene Einstellung. Ihre Meinung gegenüber Andersdenkenden, Andersgläubigen und Menschen, die nicht der Norm entsprachen, nervte ihn schon mal gewaltig. Andererseits war sie eine fleißige und zuverlässige Polizistin, die zugegebenermaßen gelegentlich schon einmal über das Ziel hinausschoss. Im letzten Sommer hätte sie einer ihrer Alleingänge beinahe das Leben gekostet. Daraus gelernt schien sie auf den ersten Blick nichts zu haben. Das Einzige, was sich verändert hatte, war ihr Verhältnis zu Nina. Zwar waren die beiden Frauen noch immer keine Freundinnen und würden es auch bestimmt nicht mehr werden. Sie gifteten sich aber auch nicht mehr an. Respektvoll, aber distanziert und auf das Nötigste beschränkt, das traf es am besten. Während er seinen Computer hochfuhr und sich einen Kaffee aus dem teuren Vollautomaten zog, brachte er Laura auf den derzeitigen Stand der Ermittlungen.
„Das war mir vorher schon klar, dass dieser Dreckskerl freigesprochen wird“, meinte sie irgendwann.
„Warum?“, fragte Thomas, obwohl er ahnte, was sie damit sagen wollte.
„Na, weil die meisten dieser kleinen Angstschisser sich ja schon bei den Zeugenbefragungen nicht mehr daran erinnern konnten, was und wen sie gesehen hatten. Das stinkt doch zum Himmel, wenn ein Typ, keine fünfzig Meter vor einer Diskothek, in Anwesenheit von einem Dutzend Zeugen einen anderen zusammenschlägt und sich keiner mehr an was erinnern kann.“
„Aber das Mädchen, diese Aaina, hat ihn eindeutig erkannt und schwer belastet. Staatsanwalt Lambrecht war sich so sicher, ihn dranzukriegen. Sonst hätte der doch gar kein Verfahren angestrengt. Kein Mensch konnte ahnen, dass die Frau einfach nicht zu der Verhandlung erscheint“, schimpfte Thomas. Er persönlich war vom Verhalten Aaina Mhalladis sehr enttäuscht. Zuerst hatte sie den Angeklagten, der ihren Freund so zugerichtet hatte, schwer beschuldigt und war dann, als es ernst wurde, einfach abgetaucht. Wie die Wahnsinnigen hatten sie nach ihr gefahndet.
„Ich wette, die taucht nie mehr auf. Entweder wurde die mit irgendeinem Ziegenhirten in ihrer Heimat zwangsverheiratet oder im Wald verscharrt“, spie Laura förmlich aus.
Der Gedanke, dass Aaina tot war, war Thomas auch schon gekommen. Indizien dafür gab es allerdings nicht. Es gab auch keine Hinweise, dass sie das Land verlassen haben könnte. Sie war bereits im Herbst, kurz nach der Tat, einfach wie vom Erdboden verschwunden und hatte es in Kauf genommen, dass der Mann, der ihren Freund ins Koma geprügelt hatte, auf freien Fuß gekommen war.
„Ich bin mal gespannt, was der Bruder von Öger Mhalladi heute so zu sagen hat“, überlegte Thomas laut.
„Welcher Bruder … etwa dieser Hassan?“, wollte Laura wissen, die nun das erste Mal von ihrem Computer aufsah.
„Jep, Nina und Holger haben ihn für heute um zehn Uhr vorgeladen“, berichtete er.
„Wer ist denn Holger?“
„Ein Kollege aus Köln. Kriminalhauptkommissar Holger Wolf. Er ist Fachmann, was den Mhalladi-Clan betrifft“, klärte er Laura auf. Die Antwort schien ihr auszureichen, da sie sich wieder ihrem Computer widmete.
Thomas tat dies ebenfalls. Er überflog die Mails im Posteingang und öffnete schließlich die mit dem vorläufigen Obduktionsbericht von Öger Mhalladi. Wie erwartet, gab es nichts Neues. Todesursache war eindeutig ein Schuss frontal ins Gesicht aus großer Distanz.