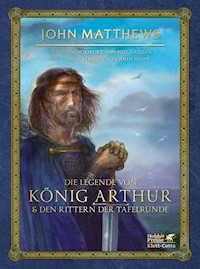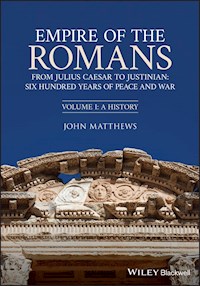5,99 €
Mehr erfahren.
Provence, August 1963: Auf dem Weg nach Hause wird der kleine Christian überfallen und getötet. Sein Mörder wird nie gefasst. Dominic Fornier, der mit den Ermittlungen betraut war, hatte stets gehofft, das Verbrechen aufklären zu können. Und nun, nach über dreißig Jahren, scheint die Chance gekommen. Er hört von Eyran, einem Jungen aus England, der von seltsamen Träumen heimgesucht wird. Eyran sieht wogende Weizenfelder und einen kleinen Jungen, der ihm etwas mitteilen möchte. Außerdem spricht er in Trance Französisch – in einem Dialekt jener Gegend, in der Christian ermordet wurde. Skeptisch, aber dennoch fasziniert besucht Fornier den Jungen – und hofft, der Wahrheit endlich auf die Spur zu kommen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 812
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
Provence, August 1963: Auf dem Weg nach Hause wird der kleine Christian überfallen und getötet. Sein Mörder wird nie gefaßt. Dominic Fornier, der mit den Ermittlungen betraut war, hatte stets gehofft, das Verbrechen aufklären zu können. Und nun, nach über dreißig Jahren, scheint die Chance gekommen. Er hört von Eyran, einem Jungen aus England, der von seltsamen Träumen heimgesucht wird. Eyran sieht wogende Weizenfelder und einen kleinen Jungen, der ihm etwas mitteilen möchte. Außerdem spricht er in Trance Französisch – in einem Dialekt jener Gegend, in der Christian ermordet wurde. Skeptisch, aber dennoch fasziniert besucht Fornier den Jungen – und hofft, der Wahrheit endlich auf die Spur zu kommen …
Autor
John Matthews war 26, als sein Debütroman »Basinkasingo« zum Bestseller wurde. Seither hat er Krimis, Actionromane, Gerichtsthriller, zwei Drehbücher und ein Jugendbuch geschrieben. Seine Bücher wurden in 12 Sprachen übersetzt, und sein bisher größter Erfolg, »Das vergessene Kind«, wurde von der Times in die Top Ten der besten Gerichtsthriller aller Zeiten gewählt.
Mehr von John Matthews:
Stadt in Angst. Historischer Kriminalroman
( Auch als E-Book lieferbar)
JOHNMATTHEWS
Das vergessene Kind
Roman
Aus dem Englischenvon Christine Frauendorf-Mössel
Die Originalausgabe erschien 1998 unter dem Titel »Past Imperfect« bei Michael Joseph, a division of the Penguin Group, London.
September 2014
Copyright © der Originalausgabe 1998
by John Matthews
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2000
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Gestaltung des Umschlags: UNO Werbeagentur München
Umschlagfoto: TIB/Pete Turner
Redaktion: Viola Eigenberz
BH · Herstellung: Str.
ISBN: 978-3-641-14767-9
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
PROLOG
Provence im Juni 1995
Drei Gestalten gingen den holprigen Weg am Stoppelfeld entlang. Zwei Männer und ein elfjähriger Junge.
Der ältere der beiden Männer, Dominic Fornier, war Ende Fünfzig; von kräftiger Gestalt, knapp einen Meter achtzig groß, mit braunem, kurzem Haar und grauen Schläfen. Gut zwanzig Meter weiter haben wir die beste Aussicht, überlegte er, und sein Blick schweifte prüfend über die sonnengebleichte, endlose Fläche des abgeernteten Weizenfeldes. Seine Augen waren von einem sanften Braun und leicht mandelförmig, was dem Blick eine gewisse Schärfe verlieh: wissende Augen, Augen, die zuviel gesehen hatten.
Der jüngere Mann, Stuart Capel, war etwas kleiner und schlanker, mit hellbraunem, fast blondem Haar. Mit Mitte Dreißig zeigten sich die ersten Sorgenfalten deutlicher als üblich, während er blinzelnd in das gleißende Sonnenlicht über dem Feld sah. Dominic bemerkte die leichte Ähnlichkeit zwischen Stuart und dem Jungen; wenn auch das Haar des Jungen eine Nuance heller war und sich einige wenige Sommersprossen auf Nasenrücken und Backen abzeichneten. Es war ein jungenhaft fröhliches Gesicht, aber Dominic spürte noch immer Reserviertheit, eine gewisse Distanziertheit in dem Jungen, die den Schmerz und die Narben der vergangenen Monate verrieten.
Die Erde knirschte unter ihren Schritten, als sie stehenblieben und Stuart fragte: »Hier? Hier ist es also passiert?«
»So ungefähr.« Dominic streckte den Arm aus. »Vielleicht fünf Meter weiter links.«
Stuart starrte auf die bezeichnete Stelle im Feld und empfand gar nichts. Die Stoppeln waren nach der Ernte im Frühsommer gut dreißig Zentimeter nachgewachsen, und der Ort mutete einfach nur still und unheimlich an. Nirgends zeigte sich auch nur die geringste Spur jener Ereignisse, die sie jetzt zu diesem Fleckchen Erde getrieben hatten. Was hatte er erwartet? Er wandte den Blick zur Seite und sah in die jungen Augen mit dem verschleierten Blick, den er mittlerweile so gut kannte. Es war nicht der Schimmer eines Wiedererkennens darin zu lesen. Wie üblich ließen diese Augen wenig oder gar nichts erkennen, solange der Junge bei vollem Bewußtsein war. Vermutlich begannen die gespenstischen Schatten aus den Randbereichen seiner Träume jetzt allmählich zu verblassen. Wachsende Akzeptanz? Stuart war sich nicht sicher.
Sechs Monate. Es kam Stuart viel länger vor, als vor seinem geistigen Auge die alptraumhafte Odyssee vorüberflimmerte, die sie letztendlich hierher geführt hatte. Und jetzt, mit dem laufenden Prozeß, würde so vieles von den Ereignissen der nächsten Tage und Wochen abhängen. War es das, worauf er gehofft hatte, als er Dominic Fornier bat, sie zu diesem Weizenfeld zu führen: auf einen Schlußstrich unter das Kapitel eines Lebens, daß die Gespenster der Vergangenheit sich endlich zur Ruhe begaben?
Rechts vom Feldweg standen Pinien und dichtes Buschwerk an einer Böschung, die steil zu dem kleinen Flüßchen abfiel. Stuart hörte das leichte Plätschern des Wassers vor dem sanften Rauschen des Windes, der über das Feld strich.
Es kam ihm in den Sinn, daß, welchen Schmerz und welche Qual er auch empfunden hatte, es für Dominic Fornier noch viel schlimmer gewesen sein mußte. Der Fall hatte über dreißig Jahre lang Forniers Leben überschattet. Hatte ihn vom jungen Gendarmen bis zum Chefinspektor begleitet, war von einem Fall aus der Provinz zu einem der bedeutendsten und faszinierendsten der Kriminalgeschichte Frankreichs geworden. ›Der Prozeß des Jahrzehnts‹ lautete die Schlagzeile in Le Monde. Gleichermaßen hatte er wohl Forniers Familienleben beherrscht.
Dominic hob den Blick vom Feld in die Ferne und auf das Dorf Taragnon. Bräunliches, getrocknetes Blut auf den ausgeblichenen Halmen. Das Gesicht geschwollen und entstellt. Dominic erschauderte. Die Bilder waren nach all den Jahren noch immer von schaudernder Lebendigkeit.
Das Feld und die Aussicht sind gleich geblieben, dachte Dominic, aber alles andere hat sich verändert. Alles. Wie oft hatte er in den vergangenen dreißig Jahren in ebendiesem Feld gestanden? Hatte nach Hinweisen und den fehlenden Puzzlestücken seines eigenen Lebens geforscht? Alles wie damals. Das letzte Mal, als er hier gewesen war, im letzten Frühjahr, hatte er geweint; geweint um die vergeudeten Jahre, um die Familie und die geliebten Menschen, die es längst nicht mehr gab, hatte geweint um die eigene und Taragnons verlorene Unschuld. Wie damals.
Einen Moment lang glaubte er sogar wieder die Glöckchen der Ziegen zu hören. Doch so sehr er sich auch anstrengte, er konnte schließlich nur das ferne Läuten der Kirchenglocken von Bauriac ausmachen, die zur Morgenandacht riefen … die zahllosen Gottesdienste im Lauf all der Jahre, die Taufen, Hochzeiten … Beerdigungen …
Dominic biß sich auf die Lippen. Er spürte mit den Erinnerungen erneut die Tränen aufsteigen und wandte sich halb von Stuart und dem Jungen ab, während diese das stumme Panorama der Felder und die üppig grünen provençalischen Hügel im Hintergrund in sich aufsogen. Als der Schmerz dieser Bilder ihm zuviel wurde, schloß er die Augen und murmelte leise und atemlos: »Oh, Gott, bitte vergib mir!«
1
Kalifornien im Dezember 1994
Felder von Gold. Verbrannter Weizen unter heißer Sonne.
Eyran fühlte den warmen Luftzug auf der Haut, während er zwischen den Halmen hindurchrannte, berauscht von der eigenen Geschwindigkeit, diffus die vorbeifliegenden und vor ihm zurückschnellenden Ähren wahrnahm, die gegen seine Beine und Schenkel peitschten. Es war England. Er wußte es instinktiv, obwohl es keine eindeutigen Landmarken in seinem Traum gab, die ihm Gewißheit verschafft hätten. Das Feld, in dem er früher in England gespielt hatte, lag auf einem Hügel, zog sich hinab zu einem kleinen Wäldchen, das sich in eine Senke schmiegte. Genau dort befanden sich einige seiner Lieblingsverstecke. Ein weiteres Weizenfeld erhob sich sanft dahinter und ging schließlich in Kohl-, Mais- und Haferfelder über. Ein farbenfrohes Flickwerk aus Grün und Gold, das sich träge bis zum Horizont hinstreckte.
Das Feld in seinem Traum jedoch lag auf flachem Gelände, und Eyran rannte hindurch und sah sich verzweifelt nach all jenen vertrauten Landmarken um: dem hohlen Baum im Hain, wo er ein Baumhaus gebaut hatte, dem kleinen Bach, der aus Richtung der Broadhurst Farm in das Wäldchen floß – wo Sarah manchmal mit ihrem Labrador spazierenging. Das Feld, das sich jetzt vor ihm ausbreitete, verlief hartnäckig auf ebenem Niveau, egal wie schnell er auch rannte und wie viele Halmreihen er durchpflügte. Die Linie des blauen Horizonts über dem Gold blieb gerade. Dabei verließ ihn nie das Gefühl, daß sich die Umgebung ändern würde, wenn er nur weiterlief, daß er irgendwann die vertraute Senke mit dem Wäldchen sehen mußte. Und er wurde schneller, eine unermüdliche Energie trieb ihn weiter. Dann wechselten mit einem Mal die Konturen. Direkt vor sich sah er etwas, das die Kammlinie eines Hügels zu sein schien. Und auch die Stellung der Sonne hatte sich verändert. Ihr Licht stach ihm in die Augen und kam näher, immer näher … blendete den Hügel vor ihm aus, dann den Horizont. Sie versengte den goldenen Weizen zu einem gleißenden Weiß und brannte in seinen Augen wie ein Blendspiegel.
Eyran wachte mit einem Schlag auf, als das Licht in seinen Augen schmerzte. Er sah aus dem Autofenster direkt in Scheinwerfer, die von einer Seite auf ihn gerichtet waren, jedoch abschwenkten, als der Wagen nach links abbog. Er erkannte keinerlei vertraute Anhaltspunkte in der Landschaft, obwohl er wußte, daß sie eine gute Strecke zurückgelegt haben mußten, seit sie ihre Freunde in Ventura verlassen hatten. Er hörte seinen Vater etwas über die Kreuzung murmeln, an der sie zum Highway Nummer 5 nach Oceanside und San Diego kommen sollten, dann knisterte Papier, als seine Mutter auf dem Beifahrersitz vergeblich versuchte, die Karte an der richtigen Stelle auseinanderzufalten. Die Fahrt des Wagens verlangsamte sich, während der Vater in Abständen immer wieder auf die Karte blickte.
»Ist das die Auffahrt, wo es nach Anaheim und Santa Ana geht, kannst du das erkennen?« fragte Jeremy. »Vielleicht sollte ich anhalten.«
»Ja, vielleicht. Ich bin eben nicht so gut im Kartenlesen.« Allison wandte sich halb dem Rücksitz zu. »Ich glaube, Eyran ist sowieso wach. Er hat morgen Schule. Wäre gut, wenn er noch etwas schläft.« Allison drehte sich um und strich sanft über Eyrans Schläfe.
Unter der beruhigenden Berührung schloß Eyran die Augen. Doch als die Mutter ihre Hand zurückzog und er merkte, daß sie wieder geradeaus sah, schlug er instinktiv die Augen auf und starrte auf ihren Hinterkopf, fixierte ihr goldblondes Haar, bis alles vor ihm verschwamm. Er wünschte sich die Wärme des Weizenfelds und des Traums zurück.
Allison bemerkte, wie Jeremy krampfhaft das Steuerrad umfaßte, als er über ein berufliches Problem sprach. Er blinzelte, als sich seine Augen an das schwindende Licht der Abenddämmerung anpaßten. Wegweiser nach Carlsbad und Escondido tauchten auf.
Allison sah verstohlen noch einmal zu Eyran hin. Er war wieder eingeschlafen, doch sie entdeckte Schweißperlen auf seiner Stirn, und der Kragen seines Hemds war feucht. Sie zog seine Decke ein Stück hinunter. Es war Anfang Dezember, und das Wetter war noch mild mit Temperaturen zwischen zwanzig und fünfundzwanzig Grad. Zwei Wochen bis zu den Schulferien und der Reise nach England, wo sie nur wenige Tage nach ihrer Ankunft Stuart und Amanda sehen würden. Ein Teil ihres Bewußtseins plante bereits: wie oft Helena während ihrer dreiwöchigen Abwesenheit nach dem Haus sehen sollte, welche frischen Lebensmittel sie ihr im Kühlschrank ließ, Kleidung, Packen, welche dicken Mäntel mitgenommen werden sollten.
»Wir dürften in einer Stunde zu Hause sein«, sagte Jeremy. »Soll ich von meinem Handy aus Helena anrufen?«
»Wie du willst. Sie wollte was vorbereiten. Allerdings kommen wir vierzig Minuten früher als angekündigt.«
Jeremy sah zur Seite, als ein Lastwagen mit Anhänger vorbeiraste. Sein Blick schweifte automatisch zum Tachometer: 90 km/h. Der Lastwagen mußte über 120 fahren. Er schüttelte kurz den Kopf.
Er sah weder das Motorrad, das vor dem Lastwagen ohne Vorwarnung die Spur wechselte, noch den plötzlichen Schlenker, den der Lastwagenfahrer machte, um dem Motorrad auszuweichen. Das erste, was er registrierte, war eine träge Schlingerbewegung des Anhängers, der plötzlich seitwärts ausbrach und sich von der Zugmaschine löste.
In diesem Augenblick schien die Zeit stehenzubleiben. Es war wie eine Momentaufnahme aus einem Film: die Straße, die Bäume, die Hinweistafeln am Straßenrand und die Werbeflächen, der graue Himmel der Abenddämmerung, die Landschaft, die noch vor kurzem an ihnen vorbeigeflogen war, erstarrt. Und dann, mit dem nächsten Wimpernschlag, flog der Anhänger auf sie zu.
Jeremy trat heftig auf die Bremse und riß das Steuer herum … ohne jedoch etwas verändern zu können. Er stöhnte laut auf. »Oh … Jesus!« Er trat noch fester auf die Bremse, kurbelte das Steuerrad in die entgegengesetzte Richtung, weg von dem großen, grauen Block, der unbeirrt auf sie zuraste, bis er die Windschutzscheibe und sein Blickfeld vollständig ausfüllte und die Motorhaube des Jeeps eindrückte.
Er hörte Allison schreien, als der Jeep beim Aufprall abrupt zur Seite wegkippte, und fühlte einen brennenden Schmerz in Magengegend und Rippen, der ihm die Luft nahm, als die Windschutzscheibe zerbarst und die Glassplitter wie Flocken in einem Schneesturm um sie herumwirbelten. Dann spürte er eher Taubheit als Schmerz, als der Motorblock in die Fahrerkabine geschoben wurde, sein rechtes Bein knapp über dem Kniegelenk abtrennte. Der Jeep überschlug sich mehrmals, so daß Himmel, Straße und Grasbankette karussellgleich um ihn kreisten. Dann war nur noch Dunkelheit.
Er erinnerte sich, daß er später noch einmal aufwachte. Er hörte Stimmen, wenn auch nur gedämpft und undeutlich. Als er versuchte, den Blick zu fokussieren, schienen die Leute weit weg zu sein, obwohl er deutlich den Arm eines Mannes erkennen konnte, der sich über ihn beugte und seinen Körper berührte. Das Atmen machte ihm Mühe. Jeder Atemzug klang gurgelnd, als habe er warmes Wasser verschluckt, und ein brennender Schmerz erfaßte seinen Magen und ein Bein. Er mußte eine ganze Weile so gelegen haben, gab sich zeitweise fast erleichtert der willkommenen Bewußtlosigkeit hin, wußte jedoch irgendwie, daß der Schmerz seine einzige konkrete Verbindung zum Leben war.
Er formte den Namen ›Eyran‹ mit den Lippen, aber der Mann an seiner Seite reagierte nicht, und Jeremy konnte die eigene Stimme nicht hören.
Als sie ihn endlich hochhoben, die Lichter flüchtig zur Seite zuckten, verstummten die Stimmen, und er versank erneut in tiefer Bewußtlosigkeit.
Stuart Capel sah auf die Uhr: 22 Uhr 40 – 14 Uhr 30 in Kalifornien. Als er seinen Bruder Jeremy das erste Mal angerufen hatte, hatte sich nur der Anrufbeantworter eingeschaltet. Daher hatte er sich vorgenommen, es am Nachmittag noch einmal zu versuchen.
Es waren nur noch zwei oder drei Wochen hin, und es gab so viel zu planen. Er hatte Jeremy und seine Familie fast zwei Jahre nicht gesehen. Über Weihnachten, wenn sie kamen, hatte er zehn Tage frei. Das einzige Problem war, daß er nicht mehr wußte, ob sie am 16. oder am 23. eintreffen würden. Der überkorrekte Jeremy hatte ihn vor fast einem Monat angerufen, ihm detailliert Flugnummern, Daten und Zeiten durchgegeben. Irgendwie waren zwar die Flugnummer und die Ankunftszeit auf seinem Telefonnotizblock gelandet, aber nicht das Datum. Und dummerweise verkehrte derselbe Flug mit derselben Nummer allwöchentlich am selben Tag zwischen Amerika und England.
Wenn er Jeremy danach fragen mußte, würde das sicher einen Kommentar provozieren. Er würde einen Rüffel einstecken müssen, der alles sagte: Ich bin organisiert, was man von dir nicht behaupten kann, ich habe Erfolg, weil ich organisiert bin, du erntest Mißerfolge, weil du nicht organisiert bist. Jeremy, der Pedant. Jeder Schritt seines Lebens war peinlich genau dokumentiert und geplant. Von der Universität in Cambridge, der Ausbildung und Zulassung als Strafanwalt in London, der Wiederholung der Examina in den Vereinigten Staaten bis zu den Monaten in Boston als Sprungbrett für eine Kanzlei in San Diego.
Stuarts Leben und berufliche Karriere standen in krassem Gegensatz dazu. Dem raketenförmigen Aufstieg in den Achtzigern als Mediendesigner folgte der Absturz. Zwei Trennungen von Partnern und Ende der Achtziger die Beinahe-Pleite. In den letzten Jahren hielt er sich gerade so über Wasser. Methodisches Planen war nie Stuarts Stärke gewesen, und fast all seine Auseinandersetzungen mit Jeremy kreisten um dasselbe Thema: Jeremy versuchte ihn zu planvollem Arbeiten zu überreden, während Stuart dagegenhielt, daß so etwas in seinem Metier nicht funktionierte. Die ganze Diskussion würde dann unweigerlich beim Thema Eyran enden.
Stuarts letzter Ausweg war regelmäßig der Vorwurf an Jeremys Adresse, er würde Eyrans Leben in einem Maß vorausplanen, daß Eyran ersticken mußte. Stuart fühlte eine verwandte Seele in seinem Neffen, eine Neugier und einen Lebenshunger, der Jeremy fremd war und den er immer zu unterdrücken versuchte, indem er das Leben seines Sohnes in von ihm vorbestimmte Bahnen lenkte. Jeremy liebte Eyran, aber er begriff nicht, wie wichtig es war, dem Kind eine gewisse Freiheit, zumindest die Möglichkeit einer eigenen Entscheidung, zu geben.
Beim letzten Zusammentreffen vor fast zwei Jahren war Stuart mit seiner Familie nach Kalifornien gereist. Während des Aufenthalts war er prompt ins Fettnäpfchen getreten, weil er Eyran auf seine alten Freunde in England angesprochen, ihn ermutigt hatte, ihnen eine Karte zu schreiben oder ihnen ein kleines Souvenir aus dem Zoo von San Diego zu schicken. Jeremy hatte ihm nur einen strafenden Blick zugeworfen und ihm später erklärt, daß ihnen Eyrans Heimweh schwer zu schaffen gemacht habe und der Junge seine englischen Freunde offenbar sehr vermisse. Erst in den letzten Monaten habe er sich besser eingelebt und sie nicht mehr erwähnt.
Später in diesen Ferien hatte Jeremy Stuarts Feuereifer, auf dem Gebiet der Multimedia-Produktionen zu expandieren, eine kalte Dusche verabreicht, und es war zu einem Wortgefecht gekommen. Stuart hatte Risiken eingeräumt, jedoch argumentiert, daß es in kreativen Berufen ohne Unwägbarkeiten nicht gehe. Aber wie immer war Jeremy nicht zu bekehren gewesen; Stuart hätte ebensogut einem Klempner das Werk von Picasso erklären können.
Stuart nahm sich vor, diesmal bei der Begegnung mit dem Bruder geistige Minenfelder zu vermeiden.
Er wählte Jeremys Nummer, aber es meldete sich nur Helena, das mexikanische Hausmädchen, und erklärte ihm, daß die Familie nicht zu Hause sei. »Sie sind in den Norden gefahren und wollen erst am Abend wieder hier sein. So gegen neun Uhr. Sollen sie zurückrufen?«
»Nein, ist schon in Ordnung. Ich stell mir früh den Wecker und versuch’s noch einmal.«
Stuart stellte den Wecker auf 6 Uhr 30 – 22 Uhr 30 kalifornischer Zeit. Er trommelte mit den Fingern auf den Hörer, nachdem er aufgelegt hatte. Eine seltsame Unruhe erfaßte ihn. Er schob das Telefon hastig von sich und gab seiner Nervosität und der Vorfreude auf den Besuch des Bruders die Schuld.
Dr. Martin Holman, mit vierunddreißig Jahren einer der jüngsten der drei leitenden Notfallmediziner in Oceanside, hörte das erregte Stimmengewirr eine Sekunde, bevor die Türen zur Notaufnahme und Unfallstation aufflogen. Sein Blick fiel auf zwei Tragen, die in unterschiedliche Teile der Notaufnahme gerollt wurden, und er richtete seine Aufmerksamkeit unwillkürlich auf den Jungen.
»Was haben wir da?«
»Unfallopfer. Zehn Jahre alt. Kopfverletzungen. Das Schlimmste scheinen aber die Quetschungen im Brustbereich zu sein. Zwei gebrochene Rippen. Vermutlich auch das Brustbein.« Die Meldung des Sanitäters kam atemlos und gehetzt, während die Trage vor einer Liege angehalten wurde.
»Irgendwann bei Bewußtsein gewesen?« fragte Holman.
»Nein. Besinnungslos, seit wir ihn eingeladen haben. Wir mußten ihn künstlich beatmen. Außerdem hat er viel Blut verloren. Kriegt eine Plasmainfusion. Das übliche. Trotzdem sind während der letzten Minuten auf dem Transport Blutdruck und Puls gefallen. Bei der letzten Messung lag die Pulsfrequenz bei achtundvierzig.«
»Okay. Heben wir ihn rüber und machen ihn fertig. Eins … zwei!« Sie hoben den Jungen im Gleichtakt auf den Operationstisch. Holman rief zwei Schwestern und den Assistenzarzt, Garvin, um den Patienten an die Überwachungsmonitore anzuschließen: Puls, Atmung, Venen- und Arteriendruck. Innerhalb einer Minute waren sämtliche Werte abrufbar, und ein Piepton veranschaulichte für Holman die Puls- und Herzfrequenz. Trotzdem war der Notfallmediziner alarmiert. Der Blutdruck lag bei 98 zu 56, der Puls war bei 42 und fiel stetig … 40. Etwas stimmte nicht.
»Mehr Plasma!« schnarrte Holman Garvin an. »Haben wir die Blutgruppe?«
»0 positiv.«
Holman gab einer Schwester die Anweisung, eine Bluttransfusion vorzubereiten, dann sah er wieder nach dem Jungen. Der Puls blieb bei erhöhter Blutplasmazufuhr einige Sekunden bei vierzig stabil, dann fiel er auf achtunddreißig ab. Holman geriet in Panik. Gegen dreißig war alles vorbei. Das Leben des Jungen hing an einem seidenen Faden.
Er untersuchte ihn hastig – der notdürftige Brustverband war blutdurchtränkt, der Junge hatte diverse Gesichts- und Schädelfrakturen – und forschte nach den Ursachen. Der Blutverlust war hoch, aber die Plasmainfusion hätte das ausgleichen müssen. Er ging um die Liege, tastete den Schädel des Jungen ab und leuchtete mit einer Taschenlampe in seine Pupillen. Keine Reaktion. Vermutlich hatte er innere Verletzungen. Holman konnte jedoch rein äußerlich keine gefährliche Schwellung im Schädelbereich feststellen, die der Grund für die gegenwärtigen Probleme hätte sein können.
»Sechsunddreißig!« meldete Garvin erregt.
Dann fiel Holman auf, daß die Brust verschoben wirkte und sich die eine Lungenhälfte nicht ausdehnte. Vermutlich steckte eine gebrochene Rippe in einem Lungenflügel.
Er nickte der Schwester eindringlich zu: »Trachealkanüle! Legen Sie eine Pleuradrainage.«
Holman schnitt den Brustverband auf und führte langsam die Kanüle, einen hohlen Metalltubus mit angeschliffener Spitze, zwischen Eyrans Rippen hindurch und in seinen linken Lungenflügel. Dann steckte er einen dünnen Plastikschlauch auf die Kanüle, und auf sein Zeichen stellte die Schwester die Pumpe an. Diese begann Blut aus der Lunge abzusaugen.
»Vierunddreißig!« meldete Garvin. Und Holman murmelte atemlos: »Komm schon … Komm schon!« Bis dahin war es ein guter Tag gewesen, mit vorwiegend leichten Verletzungen. Er hatte gehofft, seinen Dienst gegen Mitternacht ohne weitere Komplikationen beenden zu können. Stirb mir jetzt nicht!
Holman sah ängstlich zwischen der Kanüle und der Pumpe hin und her. Es war ein Wettrennen mit der Uhr. Er hoffte, daß ausreichend Blut aus den Lungen gesaugt werden konnte, um Blutdruck und Atemtätigkeit zu stabilisieren, bevor der Puls zu weit abfiel. Aber dann sackte der Blutdruck auf 92 zu 50, und Garvin meldete einen Puls von 32 – um sich nur Sekunden später auf 30 zu korrigieren. Holman merkte mit wachsender Panik, daß er dabei war, das Rennen zu verlieren.
Garvins Schrei »Herzfrequenz wird langsamer!« und der Herzstillstand des Jungen folgten auf dem Fuß. Auf dem Monitor des EKGs war nur noch eine Null-Linie zu erkennen.
Holman hatte der Schwester bereits ein Zeichen gegeben und drängte jetzt: »Defribrillieren!«
Garvin brachte die Elektroden in Position, doch Holman hielt abwehrend eine Hand hoch und zählte die Sekunden aus – sechs …sieben … Es war ein genau kalkuliertes Spiel. Holman wußte, sobald das Herz wieder zu schlagen begann, würde frisches Blut in die Lunge gepumpt. Jede weitere Sekunde würde ihm eine größere Chance geben, die Lunge zu reinigen und den Zustand zu stabilisieren. Zehn … elf … Garvin sah ihn ängstlich an, den eintönigen Piepton des Monitors unheilvoll im Nacken – dreizehn … vierzehn … »Okay! Los!«
Holman trat zurück, als Garvin den Strom anstellte. Der Stromstoß ließ den schmalen Körper heftig zucken.
Er blieb ohne Wirkung. Der Puls verlief noch immer in einer Null-Linie auf dem Bildschirm … neunzehn … Holman preßte die Kiefer aufeinander. Panische Angst, das falsche Timing gewählt zu haben, die Elektroden zu lange ausgeschaltet gelassen zu haben, befiel ihn. Einundzwanzig Sekunden hatte das Herz jetzt nicht geschlagen. Er beugte sich über den Jungen, drückte eine Hand fest auf seine Brust und begann mit einer Herzmassage. Alles war blutverklebt. Bei gebrochenen Rippen und Brustbein fürchtete Holman, nicht den notwendigen Druck ausüben zu können. Achtundzwanzig … neunundzwanzig …
Noch immer nichts! Der Piepton war eine penetrante, ärgerliche Erinnerung an ihr Unvermögen. Holman brauchte den Monitor gar nicht erst anzusehen. Er machte Garvin ein Zeichen. »Stell das Ding noch mal an!«
Ein weiterer Stromstoß durchzuckte den jungen Patienten, ohne ein Pulssignal hervorzurufen. Holman befürchtete das Schlimmste. Er beugte sich zur nächsten Massage über den Kinderkörper; die Hände glitschig von Blut auf der schmalen, zerbrechlichen Brust, versuchte er mit jedem Stoß Kontakt aufzunehmen, forderte stumm und flehentlich ein Lebenszeichen. Schweißperlen bildeten sich auf seiner Stirn. Es waren erst wenige Minuten vergangen, seit man den Jungen hereingerollt hatte, und die Nerven des Arztes lagen blank, er kämpfte, das Zittern seiner Hände unter Kontrolle zu bringen, den Rhythmus der Massage zu halten … dreiundvierzig … vierundvierzig. Wenn er den Jungen jetzt verlor, bezweifelte er, für die restliche Dienstzeit einem anderen Patienten gegenübertreten zu können.
Trotzdem wußte er, daß wenig Hoffnung bestand. Noch ein Wiederbelebungsversuch, und das war es. Zu diesem Zeitpunkt war der Junge dann fast eine volle Minute klinisch tot.
Weizenfelder, sanft im Wind wogend.
Das Gefälle änderte sich plötzlich und ohne Vorwarnung. Eyran konnte den kleinen Hain am Ende des Feldes erkennen, rannte den Abhang hinunter und darauf zu, während seine Erregung mit jedem Schritt wuchs. Drinnen im Gehölz war es dämmrig und feucht, die Luft war kühler. Er sah sich nach vertrauten Orientierungspunkten um, die ihn zum Bach führen würden, tastete sich seinen Weg durch das Halbdunkel. Einmal glaubte er, sich verlaufen zu haben, dann tauchte unvermittelt hinter einer Baumgruppe der Bach auf. Zuerst war er unsicher, denn er konnte sich nicht erinnern, daß der Bach zuvor an dieser Stelle gewesen war. Als er näherkam, sah er eine kleine Gestalt über den Wasserlauf gebeugt auf den Grund starren. Er meinte Sarah zu erkennen, doch entdeckte er nirgendwo den Hund. Die Gestalt blickte langsam zu ihm auf, und es dauerte eine Sekunde, bis ihm die Erkenntnis kam: Es war Daniel Fletcher, ein Junge aus seiner alten Schule in England, den er Jahre nicht gesehen hatte.
Er fragte Daniel, was er da mache, da dieser sonst nie am Bach spielte, und Daniel murmelte etwas davon, wie friedlich es hier unten sei. »Ich weiß«, stimmte Eyran ihm zu. »Deshalb komme ich ja hierher. Es ist so still. Sarah taucht auch manchmal auf, mit dem Hund.« Dann fiel ihm ein, daß Daniel fast zwei Meilen hinter der Broadhurst Farm wohnte. »Du mußt ja eine Ewigkeit gebraucht haben, um herzukommen. Wissen deine Eltern, daß du hier bist?«
»Nein, wissen sie nicht. Aber das ist egal. Hab sie seit Jahren nicht gesehen.«
»Seit Jahren nicht? Sehr komisch.« Doch dann merkte Eyran, daß Daniel keine Miene verzog. Er blickte erneut sehnsuchtsvoll ins Wasser und Eyran hatte wieder das Gefühl, daß etwas nicht stimmte, daß das alles nicht wirklich, ein Traum war. Und mit einem Mal fiel ihm ein, was nicht zusammenpaßte. Daniel hatte an akutem Asthma gelitten und war mit sechs Jahren nach einer schweren Bronchitis gestorben – ein Jahr, bevor Eyran nach Kalifornien gezogen war. Er erinnerte sich jetzt an den Gedenkgottesdienst in der Schulkapelle. Die ganze Schule war in Tränen aufgelöst gewesen, und alle Jungen, die Daniel wegen seiner körperlichen Schwäche gehänselt hatten, hatten sich plötzlich geschämt. Er sah, wie Daniels Hühnerbrust nach Luft rang, hörte das leise Rasseln seines Atems. Als es in den Büschen knackte und raschelte, fuhr Eyran zusammen. Er nahm sich vor, umzukehren und davonzulaufen, als er plötzlich erkannte, daß es sein Vater war, der durchs Gebüsch trat.
Eyran bekam einen Schreck, weil er seinen Vater nie zuvor im Wäldchen gesehen hatte. Er wußte instinktiv, daß er offenbar zu Hause überfällig war oder etwas Dummes gemacht hatte, und formte automatisch das Wort ›Entschuldigung‹ mit den Lippen.
Sein Vater sah nachdenklich auf Daniel herab, bevor er Eyran zuwinkte. »Du mußt jetzt nach Hause gehen, Eyran, du gehörst nicht hierher.«
Eyran begann sich zu entfernen, bis er merkte, daß sein Vater nicht folgte. Er war bei Daniel am Bachufer zurückgeblieben. »Kommst du nicht mit, Daddy?«
Sein Vater schüttelte bedächtig den Kopf, die Augen traurig und abwesend, und Eyran blickte aus dem Wäldchen auf die Felder und stellte fest, daß es draußen mittlerweile finster geworden war. Wie eine undurchdringliche, schwarze Decke hatte sich Dunkelheit über das Weizenfeld ausgebreitet, das sich bis in endlose Fernen zu erstrecken schien, ohne auch nur eine der hügeligen Konturen aufzuweisen, an denen er sich hätte orientieren können. »Aber was ist, wenn ich mich verlaufe?« bettelte er, kurz bevor sich sein Vater abwandte und in der Dunkelheit des Wäldchens verschwand.
Eyran begann zu zittern und zu weinen. Er fühlte, daß er tun mußte, was der Vater von ihm verlangte – er mußte den Weg nach Hause finden –, obwohl er gleichzeitig verzweifelt zu begreifen versuchte, warum sein Vater ihn in der Dunkelheit alleingelassen hatte. Er wußte, wenn er nur wieder nach Hause gelangen konnte, würde alles gut werden. Doch die Dunkelheit über dem Feld war undurchdringlich und endlos und ohne einen einzigen vertrauten Anhaltspunkt.
2
Provence im August 1963
Alain Duclos sah den Jungen wenige hundert Meter weiter am Straßenrand gehen. Die schmale Gestalt war wie eine Fata Morgana aus der flimmernden Augusthitze aufgetaucht.
Zuerst wollte Duclos gar nicht anhalten. Aber es war etwas in der müden Körperhaltung des Jungen, das ihn veranlaßte, den Fuß vom Gas zu nehmen. Als er schließlich neben ihm war, das lockige Haar, die olivfarbene Haut des Jungen, den Schweiß auf seiner Stirn und seine erhitzten Züge sah, beschloß er endgültig, anzuhalten. Der Junge war offenbar müde und bedrückt. Das Seitenfenster des Sportwagens war wegen der Hitze bereits heruntergedreht. Duclos lehnte sich hinüber, als er stoppte.
»Kann ich dich mitnehmen?«
Der Junge zögerte und sah sich kurz nach dem Weizenfeld um. »Nein, danke. Geht schon.«
Duclos schätzte sein Alter auf zehn, höchstens elf Jahre. Er konnte nicht umhin zu bemerken, wie schön seine Augen waren: grün, mit kleinen, bernsteinfarbenen Einsprenkelungen. Sein Blick verriet Besorgnis. »Wirklich nicht?« drängte Duclos. »Du siehst aus, als hättest du jemanden verloren.«
Der Junge blickte erneut zu den Feldern hinüber. »Mein Fahrrad ist da hinten kaputtgegangen. Ich will zu meinem Freund Stéphane. Sein Vater hat einen Traktor und kann es holen.«
»Wie weit ist es bis zu Stéphanes Haus?«
»Vier oder fünf Kilometer. Ist auf der anderen Seite vom Dorf. Aber das ist nicht schlimm. Bin schon mal zu Fuß dort hingegangen.«
Duclos nickte verständnisvoll, lächelte und stieß die Autotür auf. »Komm, du bist müde und es ist heiß. Ich fahr dich hin. Ist zu weit, um zu laufen.«
Der Junge erwiderte das Lächeln zögernd. Zum ersten Mal maß sein Blick die Länge von Duclos’ Wagen ab, und die Erregung angesichts der Möglichkeit, in einem Sportwagen mitzufahren, war ihm anzumerken. »Wenn Sie meinen, daß das für Sie okay ist.«
Erneut das bestätigende Nicken und das Lächeln, als der Junge einstieg. Duclos lehnte sich hinüber, um die Tür zu schließen, ließ den Motor zweimal aufheulen, während er in den Rückspiegel sah, und fuhr zurück auf die Straße. Der Junge saß einen Moment schweigend neben ihm, während der Wagen beschleunigte. Duclos sah, wie der Junge das Armaturenbrett und die Ledersitze begutachtete, sich dann leicht aufrichtete, um die gewölbte Motorhaube zu betrachten. Duclos befriedigte seine offensichtliche Neugier.
»Ist ein Alfa Romeo Giulietta Sprint, Baujahr 1961. Lackfarbe dunkelgrün. Ich wollte eine der klassischen italienischen Rennfarben – rot oder dunkelgrün –, aber ich fand Rot dann doch zu schrill. Ich habe ihn noch nicht mal zwei Jahre. Gefällt er dir?«
Der Junge nickte begeistert. Sein Blick schweifte zur schmalen, spartanischen Rückbank und durch das Coupéfenster nach hinten.
»Wie heißt du?« fragte Duclos.
»Christian. Christian Rosselot.«
Duclos sah auf die Uhr. Es war zwölf Uhr achtundvierzig. Er hatte seit seiner Abfahrt aus Aix-en-Provence eine hübsche Strecke zurückgelegt. Duclos war mittlerweile klar, was ihn veranlaßt hatte, anzuhalten. Der Junge erinnerte ihn an Jahlep, den algerischen Jungen, den sein Zuhälter in Marseille für ihn entdeckt hatte und der mittlerweile sein Favorit geworden war. Nur war der Junge hier noch schöner. Sein Teint war etwas heller als Jahleps, seine Haut hatte den warmen Schimmer von poliertem Holz, und seine großen grünen Augen mit den braunen Einsprenkelungen übten eine erstaunliche Faszination aus. Der Junge trug Shorts, und Duclos ertappte sich dabei, wie sein Blick zur zarten, gebräunten Haut seiner Beine schweifte. Nach gut anderthalb Kilometern Fahrt tauchte ein Hinweisschild am Straßenrand auf: Taragnon, 1,3 km. Wenn das Haus des Freundes nicht weit hinter dem Dorf lag, blieb nicht mehr viel Zeit. Duclos’ Blick schweifte erneut zu den Schenkeln des Jungen. Sein Mund wurde trocken. Er mußte eine Möglichkeit finden, irgendwo allein mit dem Jungen zu sein, und das schnell. Wenige hundert Meter weiter sah er die Einfahrt zu einem Feldweg. Duclos bremste ab und brachte den Wagen kurz hinter der Einbiegung zum Stehen.
»Mir ist da was eingefallen. Angenommen, wir kommen zu Stéphane, und sein Vater ist nicht da, kann also nicht helfen, dann ist der Umweg nur Zeitverschwendung. Ich habe Werkzeug im Kofferraum. Wenn du willst, fahre ich dich zu deinem Fahrrad zurück. Und wenn wir’s nicht reparieren können, packen wir es in den Kofferraum, und ich bringe dich nach Hause. Wo wohnst du?«
»Fast drei Kilometer hinter der Stelle, wo jetzt das Fahrrad liegt.« Christian deutete durch die Heckscheibe in östliche Richtung. »Aber das ist nicht nötig. Ich bin sicher, daß sie zu Hause sind. Stéphanes Vater arbeitet immer auf dem Hof.«
Duclos zuckte mit den Schultern. »Das Problem ist, daß du dort festsitzt, wenn sie nicht da sind.« Er stieß rückwärts in den Feldweg, sah kurz nach rechts und links und fuhr dann den Weg zurück, den sie gekommen waren. Ergreife einfach die Initiative, sagte ihm sein Instinkt. Die Proteste des Jungen fielen eher lahm aus. »Schau, ist kein Umstand für mich. Außerdem ist mir gerade eingefallen, daß ich in Varages eine Bestellung bei der Patisserie hätte abholen sollen. Ist also kein Umweg.«
Duclos fragte sich, ob der Junge mißtrauisch geworden war. Angesichts seiner Beharrlichkeit hatte er schließlich lächelnd, wenn auch zögerlich genickt und hastig aus dem Fenster gesehen. Es konnte eine normale Verlegenheit gegenüber einem Fremden gewesen sein, oder er hatte Verdacht geschöpft. Schwer zu sagen, was ihn bewegte. Aber Duclos war mittlerweile schon mehr darauf konzentriert zu vermeiden, mit dem Jungen gesehen zu werden. Nach fast einem Kilometer kam ihnen ein Lastwagen mit dem Aufdruck einer Firma entgegen. Auf der Seite stand in Großbuchstaben MARSEILLE. Bei der Höhe des Führerhauses und der Geschwindigkeit, mit der sie aneinander vorbeifuhren, bezweifelte Duclos jedoch, daß der Fahrer überhaupt auf sie geachtet hatte. Einen Moment dachte er für sich: ›Setz den Jungen einfach raus, laß ihn in Ruhe, fahr weiter nach Salernes.‹ Aber was ihn trieb, war zu stark. Es war eine Mischung aus Erregung, Neugier, gespannter Erwartung und dem Reiz des Unbekannten. Dem zu widerstehen war unmöglich. Geraden waren sie an der Stelle vorbeigefahren, wo er den Jungen aufgelesen hatte.
»Ist es noch weit?« fragte Duclos.
»Nein. Nicht mal einen Kilometer – an einem Feldweg zwischen zwei Bauernhöfen.«
Das Flickwerk von grünen und goldenen Feldern zu beiden Seiten verblaßte in der Sommerhitze. Nach einer langen Gerade machte die Straße eine Biegung, und sie kamen an einem Pfirsichgarten vorbei, der nur teilweise abgeerntet war; struppiges Gras ragte am hinteren Ende zwischen den Bäumen auf. Christian hob den Arm, um ihm den Weg zu zeigen.
Duclos bog ein und sah, daß hundert Meter weiter der Obstgarten in ein Wäldchen überging. Dort zwischen Garten und Wald führte der Weg hindurch. Der Junge deutete auf die Stelle, wo er sein Fahrrad zurückgelassen hatte.
»Da oben, wo das Gras so hoch ist. Ich habe versucht, es dort zu verstecken, damit es niemand klaut, bis ich wieder da bin.«
Der Wagen holperte über den unebenen Grund, und Duclos schaltete in den zweiten Gang. Diese Beine. Diese Augen. Sein Puls schlug schneller. Bilder dessen, was kommen würde, standen bereits vor seinem geistigen Auge. In seine Erregung jedoch mischte sich Nervosität und ein gewisses Unwohlsein. Bei Jahlep war immer alles vorbereitet, der junge Algerier ein williger Partner. Jetzt wußte er nicht, was ihn erwartete. Er war nicht sicher, wie er den ersten Schritt tun, jenen ersten Kontakt herstellen sollte, der allen Widerstand beseitigte. Hatte er den Jungen einmal berührt, waren seine Absichten klar, gab es für ihn kein Zurück mehr, soviel stand fest. Die einzige Frage, die sich stellte, war, ob er auf Zustimmung stoßen würde oder Gewalt anwenden mußte.
Duclos hielt den Wagen am Feldrain an und folgte dem Jungen nach draußen. Nach nur wenigen Schritten, dem ausgestreckten Arm des Jungen folgend, erkannte Duclos das Fahrrad, das flach im hohen Gras lag.
»Was ist damit passiert?« erkundigte er sich.
»Die Rücktrittbremse hat sich festgefressen. Deshalb konnte ich’s nicht mal mehr schieben.«
Duclos kniete nieder. Das Hinterrad ließ sich kaum bewegen. Der Junge war nur wenige Zentimeter neben ihm, kniete ebenfalls nieder und betrachtete prüfend das Rad. Duclos atmete leicht den beißenden Geruch seines Schweißes ein, in den sich der Duft von Gras und reifen Pfirsichen mischte. In diesem Moment entdeckte er die Abschürfungen und den Bluterguß am Schenkel des Jungen. Das war die Gelegenheit, nach der er gesucht hatte. Er streckte den Arm aus, berührte die Schürfwunde und ließ seine Finger leicht darübergleiten.
»Das sieht schlimm aus – du solltest die Wunde desinfizieren. Morgen hast du bestimmt einen riesigen Bluterguß. Hast du dir wehgetan, als das Fahrrad kaputtgegangen ist?«
»Als die Bremsen blockiert haben, bin ich mit dem Rad umgekippt.« Der Junge machte eine dramatische Geste und deutete seitlich ins Gras. »Mein Bein ist unters Fahrrad geraten.«
Er ist so süß, dachte Duclos. Die Augen waren gespenstisch schön, grüne feuchte Teiche, in denen er sich vergessen konnte. Bei der ersten Berührung war der Junge zusammengezuckt, war jedoch an seiner Seite geblieben. Duclos streichelte weiter, arbeitete sich vorsichtig höher. In diesem Moment sah Duclos den veränderten Ausdruck in den Augen des Jungen, die Pupillen weiteten sich, sein Blick verdüsterte sich ängstlich. Der Junge ahnte, daß etwas nicht stimmte. Als er die Muskeln anspannte, um aufzuspringen, packte Duclos ihn fest bei den Shorts.
»Hat keinen Sinn, daß du dich wehrst, du tust dir nur weh. Und ich will dir eigentlich nicht wehtun.« Duclos’ Stimme klang besänftigend und drohend zugleich.
Dann ging alles ganz schnell. Christian stieß einen Laut aus, der halb wie ein Schrei, halb wie ein Stöhnen klang, als Duclos ihm die Hose herunterriß und ihn mit dem Gesicht nach unten ins Gras warf.
Duclos streichelte zärtlich den Rücken des Jungen, schob dessen Hemd Stück für Stück höher und ließ seinen Daumen auf dem Rückgrat auf und ab gleiten. Der Schweißfilm auf der Haut des Jungen erleichterte die Bewegung, und nach ein paar Liebkosungen verlagerte Duclos seine Streicheleinheiten tiefer, auf die Gesäßbacken des Jungen und zu der Popofalte. Duclos war schnell erregt. Die Haut des Jungen war unendlich zart. Er fühlte, wie der schmale Körper unter seiner Berührung erschauderte, dann heftig und stoßweise zitterte, als er zu schluchzen begann.
Duclos empfand das Geräusch als störend, als ausgesprochenen Stimmungstöter. »Sei still, um Himmels willen! Sei still! Das nützt dir gar nichts.«
Das Weinen wurde leiser. Duclos entledigte sich seiner Kleider. Er versuchte sich in Phantasien zu flüchten, um sich vom Weinen des Jungen abzulenken, als er sich über ihn kauerte. Und plötzlich lockte Jahlep ihn neckisch mit einem Finger und inspirierte ihn lächelnd zu immer drängenderen Stößen. Die Augen des algerischen Jungen glitzerten übermütig und lustvoll. Duclos fühlte die Sonne heiß auf seinem Rücken, fühlte den Schweißfilm auf der Haut des Jungen, während seine Handflächen darüberfuhren. Er bewegte den Kopf von einer Seite zur anderen. Der Wind in den nahen Baumwipfeln blendete momentan alle anderen Geräusche aus, und Duclos fühlte sich auf einer Welle der Lust dahingleiten. Jahleps braune Augen sahen ihn schmeichelnd an, drängten ihn, ihn in die höchsten Höhen der Lust zu entführen. Aber die grünen Augen des Jungen unter ihm, die sich plötzlich vor Jahleps Bild schoben – sie blickten gehetzt, verängstigt und flehend. Er schüttelte den Kopf, um diese ernüchternden Bilder loszuwerden, die sich dennoch nicht vertreiben ließen, nicht bis zum letzten Augenblick des Orgasmus, seinem erstickten, kehligen Lustschrei vor der Geräuschkulisse des Windes in den Baumwipfeln.
Duclos brauchte danach einen Moment, um zu sich zu kommen, die Orientierung wiederzugewinnen. Er hatte sich von dem Jungen gelöst und auf der Wiese ejakuliert, während noch ein Teil seines Gesichts auf dem Rücken des Jungen lastete, er seine Wange gegen dessen nackte Haut drückte, die sich plötzlich so klebrig vor Schweiß anfühlte. Er rollte zur Seite.
Danach lag er auf dem Rücken und starrte in den Himmel. Er hörte den Jungen noch leise weinen, obwohl diese Laute teilweise im Rauschen des Windes untergingen, eins damit wurden.
Duclos wandte den Kopf. Eine dünne Blutspur verlief entlang der Schenkelinnenseite des Jungen. Er streckte den Arm aus und berührte dessen Rücken, fühlte jedoch, wie dieser unter der Berührung zurückzuckte. Er hätte gern gesagt: ›Tut mir leid‹, wäre es ihm nicht so hohl und sinnlos vorgekommen. Er wußte, daß er jetzt hart bleiben mußte, um den Jungen einzuschüchtern. Er setzte sich auf und packte ihn fest bei den Schultern.
»Sieh mich an! Sieh mich an!« Duclos faßte härter zu und schüttelte den Jungen, bis dieser aufsah. Das Gesicht des Jungen war tränenverschmiert, und er machte den vergeblichen Versuch, eine frische Träne mit dem Handrücken fortzuwischen.
»Was gerade geschehen ist, ist nie passiert, kapiert? Es ist nie passiert!« Duclos sah den Jungen eindringlich an, als könne er ihm durch Schütteln und drohende Blicke seinen Willen aufzwingen.
»Es ist unser Geheimnis, und du darfst es niemandem erzählen. Niemandem? Wenn du das tust, komme ich zurück und bringe dich um. Ich weiß jetzt, wo du wohnst, und es ist ein Leichtes für mich, dich zu kriegen.«
Der Junge nickte. Duclos schüttelte ihn zum Nachdruck noch einmal an der Schulter. »Kapiert?«
Aber auch diesmal verriet sich der Junge durch den Ausdruck seiner Augen. Außer Angst waren Unsicherheit und Verwirrung darin zu lesen. Duclos ahnte, daß er später, wenn er mit den peinlichen und bohrenden Fragen der Eltern bezüglich der Ereignisse des Nachmittags konfrontiert würde, letztendlich reden würde; gleichgültig, was er jetzt auch immer versprach. Und dann würde die Polizei verständigt. Sein auffälliger Wagen würde sie zu ihm führen, er würde vor Gericht gestellt werden, wäre öffentlicher Demütigung und einer Gefängnisstrafe ausgesetzt; sein Leben und seine Karriere wären ruiniert. Seine Träume und Pläne, in drei Jahren Stellvertretender Leitender Staatsanwalt in Limoges zu werden, könnte er begraben.
Er wußte in diesem Moment, daß ihm nichts anderes blieb, als den Jungen umzubringen.
Duclos saß im Restaurant dicht am Fenster. Von hier aus hatte er einen ungehinderten Blick auf seinen Wagen am hinteren Ende des Parkplatzes. Der Alfa stand zwar abseits des Weges, der die Gäste zum Restaurant führte, doch er konnte nicht vorsichtig genug sein.
Nachdem er sich für das Unvermeidliche entschieden hatte, hatte er fast eine Viertelstunde damit zugebracht, den Jungen ruhigzustellen, ihn mit den Fetzen seines eigenen Hemdes und einiger Lumpen aus dem Kofferraum an Händen und Füßen zu fesseln und zu knebeln. Der Platz im Kofferraum war mehr als eng, und er mußte den Jungen in einer fötalen Stellung neben das Reserverad zwängen und seine Arme um den Reifen herumlegen. Er warnte den Jungen, weder Geräusche zu machen noch sich zu bewegen. Anderenfalls werde er Auspuffgase in den Kofferraum leiten und ihn umbringen. Der Junge hatte verängstigt genickt, die Augen weit aufgerissen. Es war das letzte Bild, an das er sich erinnerte, bevor er den Kofferraumdeckel zugemacht hatte – dieses Augenpaar, das ihn anstarrte, fragend und flehentlich zugleich.
Zuerst wußte Duclos nicht recht, warum er das Ende hinausgezögert hatte. Es war ihm einfach nur falsch erschienen, den Jungen an Ort und Stelle zu töten. Und er brauchte Zeit zum Nachdenken. Aber war die Verzögerung nur dazu da, den Mut für das Unvermeidliche aufzubringen, oder wollte er es sich noch anders überlegen? Letztendlich war die entscheidende Frage, wie er seine Spuren am besten verwischen konnte. Er wollte nichts überstürzen.
Den Jungen zu fesseln und in der Hitze im Kofferraum zu verstauen hatte ihn Kraft gekostet. Erst im Auto hatte er wieder klar denken können. Puzzlestücke fügten sich zu einem harmonischen Ganzen zusammen, während er sich vorstellte, wie das Verbrechen von den Ermittlern rekonstruiert werden würde. Er hatte schließlich Erfahrung im Umgang mit der Kriminalität. Als er den Ortsrand von Taragnon erreicht hatte, standen die meisten Einzelheiten seines Plans fest, und das Restaurant war ein zentraler Teil dieses Vorhabens. Er sah auf die Uhr. 13 Uhr 41. Die Zeit war der entscheidende Faktor. Im Idealfall mußte er über eine Stunde bleiben.
Duclos hatte bereits die Speisekarte studiert und überflog sie erneut, als der Ober an seinen Tisch trat.
»Plat du jour, aber mit dem Kalbs-Cassoulet, bitte. Die Pilze als Vorspeise und die Île flotant zum Dessert.«
»Und zu trinken?« fragte der Ober.
»Rotwein bitte, und Wasser. Was ist das für ein Hauswein?«
»Château Vernet. Ist ein recht guter Tropfen. Ziemlich vollmundig.«
Duclos fragte nicht nach dem Jahrgang. Die Hausweine stammten fast ausschließlich aus der letzten Ernte. Normalerweise mischte er bei diesen hohen Temperaturen Tischweine sowieso mit Wasser, obwohl … wenn er gut war, gedachte er sich ein unverdünntes Glas zu gönnen.
Das Restaurant war das erste hinter Taragnon gewesen, das einen vernünftigen Parkplatz vor dem Haus hatte. Es war wichtig, daß er den Wagen auch beim Essen im Blick behielt. Einfach und bistroartig, lag es weniger als einen Kilometer außerhalb des Orts, und das Hinweisschild am Straßenrand, das das Tagesgericht für nur 3 Francs 40 anpries, hatte zur Mittagszeit eine ganze Menge Gäste angezogen. Die Hälfte der Tische war besetzt, und Duclos zählte abgesehen von seinem Alfa noch weitere acht Autos und zwei Lastwagen auf dem Parkplatz.
Der Ober hatte seine Bestellung weitergegeben und kehrte jetzt mit Wein und Wasser zurück. Er schenkte den Wein ein, überließ es jedoch Duclos, sich selbst von dem Wasser zu bedienen. Duclos trank einen Schluck. Der Wein hatte zwar einen vollen Körper, aber einen leicht säuerlichen Nachgeschmack. Trinkbar, aber nichts Besonderes. Duclos gab etwas Wasser dazu und merkte, daß der andere Ober hinter der Bar zu ihm herüberblickte. Er wirkte mürrischer und neugieriger als der Ober, der ihn bediente. Duclos konnte den Blick deuten, hatte ihn schon tausendmal gesehen. Er bedeutete soviel wie: junger Schnösel, schicker Wagen, Kind reicher Eltern, lebt auf deren Kosten, macht die Küste unsicher, während ich mit meinen zwanzig Jahren mich Tag und Nacht hinter der Bar abrackere.
In Duclos’ Fall allerdings war das Vorurteil falsch. Er kam vermutlich aus einer kaum besseren Familie als der Ober, sein Vater war nur ein einfacher Vorarbeiter in einer örtlichen Keramikfabrik gewesen. Es hatte seinen Vater Jahre gekostet, sich zum Vorarbeiter hochzuschuften. Dann, drei Jahre später, hatte eine schlecht gestapelte Transportkiste ihn unter sich begraben und ihn schwer am Rücken verletzt. Nach langen Behandlungen war er gezwungen gewesen, nur noch halbtags zu arbeiten, dann wollte ihn die Firma schließlich gehen lassen. Das Unternehmen war schlecht versichert, die Abfindung mager, und es war nur einem Anwalt und dessen Drohung mit einem Musterprozeß zu verdanken, daß sein Vater schließlich eine Abfindung in Höhe seines sechsfachen Monatslohns und eine Vollzeit-Bürostelle als Lagerleiter erhalten hatte.
Dem damals erst dreizehnjährigen Duclos hatte sich die praktische Lektion dessen, wieviel ein Anwalt vermochte, um eine Familie zu retten, unauslöschlich eingeprägt. Die Macht, die mit der Fähigkeit einherging, das Recht wie ein scharfes Schwert zu schwingen, so daß man im Leben bekam, was man wollte, hatte ihm imponiert. Er hatte in der Schule hart gearbeitet und Abitur gemacht, um Jura und Wirtschaftswissenschaften in Bordeaux zu studieren.
Mit einundzwanzig, drei Monate nach dem Examen, war er in die Staatsanwaltschaft in Limoges eingetreten. Das erste Jahre hatte er als stagiaire, als Praktikant, verbracht, dann waren zwei Jahre mit der Aktenvorbereitung für den Stellvertretenden Staatsanwalt und einige leichtere Fälle gefolgt, die er selbst bearbeitet hatte. Im vergangenen Jahr waren ihm wichtigere Arbeiten übertragen worden, einschließlich zweier für den Oberstaatsanwalt, der in drei Jahren in Pension gehen sollte, entscheidende Fälle. Danach würde jeder einen Rang in der Hierarchie aufsteigen, und er gehörte zu den drei Juristen, die als Anwärter auf die Stelle des Stellvertretenden Staatsanwalts gehandelt wurden. Seine Erfolgsquote bei der Bearbeitung von Fällen war höher als die der beiden Kollegen, und er galt als extrem gründlich. Noch drei weitere Jahre harter Arbeit, und der Job gehörte ihm.
Der Ober brachte die Pilze. Beim Essen sah er wieder zu seinem Wagen hinüber. Er hatte zu lange zu hart geschuftet, um all das jetzt aufzugeben.
Den Freund, bei dem er in Salernes wohnte, Claude, hatte er an der Universität von Bordeaux kennengelernt, und der Kontakt war seither nicht abgerissen. Dieses war Duclos’ sechster Besuch – innerhalb von vier Jahren hatte er jeweils drei Wochen im August oder zehn Tage zu Ostern hier verbracht. Claudes Familie gehörte eines der größten Weingüter der Gegend, das Château hatte einen eigenen Park mit Swimmingpool, und die Côte d’Azur war nur eine halbe Autostunde entfernt. Idyllisch, besonders für die Sommerferien. Duclos stahl sich mindestens zweimal pro Woche unter dem Vorwand, eine alte Tante in Aubagne zu besuchen, nach Marseille davon, um seinen Zuhälter und Jahlep zu treffen. Claude war nie mißtrauisch geworden.
Im Lauf der Jahre hatte er sich daran gewöhnt, seine Spuren zu verwischen, war mittlerweile ein Profi des Versteckspiels. Es hatte nie dauerhafte Verbindungen mit Frauen gegeben, aber er war nicht unattraktiv, und bei seiner guten Position fanden sich immer Mädchen für unverbindliche Verabredungen zum Abendessen oder beruflich begründete Beziehungen. Der Schein mußte gewahrt werden.
Nach der Pilzvorspeise wurde umgehend der Hauptgang serviert. Duclos prüfte erneut die Uhrzeit. Er war seit fünfundzwanzig Minuten im Restaurant. Möglicherweise mußte er noch Kaffee und Kognak bestellen, um die Zeit auszufüllen.
Ein kleiner Faktor fehlte noch in seinem Plan, was ihm wachsende Sorgen zu machen begann. Er brütete über dem Cassoulet darüber nach. Erst als er fast zu Ende gegessen hatte und zum dritten Mal Wasser in seinen Wein gab, kam er auf eine Idee. Er betrachtete nachdenklich die Flasche. Es konnte funktionieren, vorausgesetzt, er verfügte über genügend Wasser. Der Gedanke begann erst langsam Formen anzunehmen, als er aus den Augenwinkeln eine unerwartete Bewegung wahrnahm, die seinen Blick auf den Parkplatz lenkte. Seine Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Zwei Frauen, die gerade das Restaurant verlassen hatten, steuerten auf das Auto zu, das neben seinem Wagen parkte. Während die Fahrerin ihre Tür öffnete, schien etwas an seinem Wagen die Aufmerksamkeit der Beifahrerin zu erregen. Bewunderte sie den Alfa nur, oder hatte sie ein Geräusch gehört? Sie verharrte einen Moment neben dem Auto, sah schließlich zum Zaun des Parkplatzes hinüber und stieg dann ein. Kurz darauf stieß der Wagen rückwärts aus der Parklücke und fuhr davon. Duclos atmete auf.
Sein Seelenfrieden währte allerdings nicht lange. Minuten später fuhr ein Lastwagen auf den Parkplatz und direkt in die freie Lücke, womit Duclos der Blick auf seinen Alfa versperrt war. Alles, was er erkennen konnte, war ein hinteres Rücklicht. Er wurde nervös.
Es fiel ihm schwer, sich auf den Rest der Mahlzeit zu konzentrieren. Als die Île flotant serviert wurde, bestellte er sofort Kaffee und Kognak, um Zeit zu sparen. Noch fünfzehn Minuten, sagte er sich. Das Warten machte ihn wahnsinnig. Als der Kognak kam, war er mit seinen Nerven am Ende. Er mußte seine Hand bewußt ruhig halten, als er nach dem Glas griff. Er war nicht sicher, ob es die Nachwehen dessen waren, was bereits geschehen war, oder die Angst vor dem, was ihm noch bevorstand. Der zweite Ober sah erneut neugierig zu ihm herüber. Oder bildete er sich das ein, sah er bereits Gespenster? Er wußte nur, daß er das Restaurant so schnell wie möglich verlassen wollte. Außerdem ahnte er, daß er bald tun mußte, was er sich vorgenommen hatte, wenn ihm nicht der Mut dazu abhanden kommen sollte.
Duclos wischte sich über die Stirn und machte dem Ober ein Zeichen. Dieser servierte am übernächsten Tisch und kam dann zu ihm.
»Die Rechnung, bitte.« Der Ober hatte sich schon zum Gehen gewandt, als Duclos einfiel, daß er etwas vergessen hatte. Er deutete auf die Flasche auf dem Tisch. »Und ein Mineralwasser zum Mitnehmen.«
An der Bar war es laut geworden. Man unterhielt sich angeregt, und im Hintergrund klapperte Geschirr und Besteck.
Duclos schloß die Augen und zwang sich zur Ruhe, während er auf die Rechnung wartete. Machte er einen erregten Eindruck? Ging seine Zeitrechnung auf? Hatte die Frau vorhin neben seinem Wagen etwas gehört? Gedanken daran, was vielleicht bereits schiefgegangen war und noch schiefgehen könnte, mischten sich in seine seelische Nabelschau. Was wäre gewesen, wenn er an diesem Morgen nicht nach Aix-en-Provence gefahren wäre? Wenn er den Jungen am Straßenrand nicht gesehen hätte? Studierte er nicht seit Jahren die Aussagen von Zeitgenossen, die sich tief in den Dreck manövriert hatten, und hatte er sich nicht stets haushoch überlegen gefühlt? Er schüttelte ungläubig den Kopf.
Es dauerte weitere sechs Minuten, bis die Rechnung beglichen war und er sein Wechselgeld erhalten hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte er das Zittern seiner Hände nicht mehr unter Kontrolle. Er lächelte, hinterließ ein großzügiges Trinkgeld und hoffte, daß man ihm seine Nervosität nicht anmerkte. Er wollte zwar, daß man sich an ihn erinnerte, aber nicht auf diese Weise.
Duclos stieg in seinen Wagen, atmete tief und gleichmäßig und versuchte, das Zittern seiner Hände zu beenden, indem er das Steuerrad fest umfaßte. Übelkeit stieg in ihm auf, und der Kopf schwirrte ihm vor tausend widersprüchlichen Gedanken – bis schließlich die Nerven mit ihm durchgingen und sein Körper hilflos vornüber sackte. Er glaubte nicht mehr, der Sache gewachsen zu sein.
Das erste, dessen Christian sich in der Dunkelheit bewußt wurde, war das Geräusch seiner Atemzüge.
Ihm war heiß im Kofferraum, obwohl er kein Hemd mehr anhatte. Es war ihm gelungen, die Tränen zurückzuhalten, doch er zitterte noch immer heftig am ganzen Körper. Wie sollte er erklären, was mit seinem Hemd passiert war, wenn er nach Hause kam, und warum mußte der Mann ihn fesseln und in den Kofferraum sperren? Er hoffte nur inständig, daß sein Peiniger ihm nicht noch einmal wehtun würde. Er wußte, daß er vermutlich seiner Mutter würde erzählen müssen, was vorgefallen war. Sie würde wütend sein, sie hatte ihn so oft davor gewarnt, sich von Fremden ansprechen zu lassen. Aber der Mann hatte ihn an seinen Cousin François erinnert, der bei einer der Parfümfirmen in Grasse arbeitete – er sah ganz und gar nicht wie die bösen Männer aus, die er sich vorgestellt hatte.
Christian begann über die Drohungen des Mannes nachzudenken. Wenn du etwas sagst, bringe ich dich um … Ich weiß jetzt, wo du wohnst. Ist leicht für mich, dich zu kriegen. Vielleicht konnte er seiner Mutter das Versprechen abpressen, nichts zu verraten, und selbst wenn sie es der Polizei sagen mußte, würde diese ihn doch sicher beschützen. Und für das, was der Mann ihm angetan hatte, würde man diesen einsperren, damit er ihm nichts mehr tun konnte, und das bestimmt für lange Zeit.
Christian horchte auf das monotone Brummen des Automotors und das Summen der Räder auf dem Asphalt. Er versuchte angestrengt, auch andere Geräusche wahrzunehmen. Plötzlich war da ein fernes Rauschen, vielleicht von einem vorbeifahrenden Lastwagen, dann nichts mehr. Wie weit waren sie gefahren? Es war schwierig, die Geschwindigkeit abzuschätzen, wenn der einzige Anhaltspunkt das Echo der Gebäude war, an denen sie vorbeikamen. Das Echo hielt eine Weile an, dann war es kurz verschwunden, bevor es für eine lange, gleichmäßige Strecke wiederkehrte. Sie kamen durch Taragnon, es sei denn, sie waren abgebogen und nahmen den Weg über Bauriac. Penteves war zu weit entfernt.
Nach einer Weile war wieder das Rauschen eines vorbeifahrenden Fahrzeugs zu hören. Kurz darauf wurde ihre Fahrt langsamer; er fühlte, wie der Wagen abbog, dann hielten sie an.
Die Hitze wurde in dem engen Kofferraum unerträglich. Sein Körper war eng zusammengekauert, und allmählich meldeten sich Krämpfe in seinen Beinen. Eine Weile fragte er sich, ob der Mann verschwunden war und ihn einfach zurückgelassen hatte. Gelegentlich konnte er in der Ferne Stimmen hören und überlegte, ob er gegen die Seitenwand des Wagens treten sollte, um Aufmerksamkeit zu erregen, denn das war die einzige Aktion, zu der er trotz Fesseln und Knebel in der Lage war. Aber die Leute waren offenbar zu weit entfernt, um ihn zu hören, und was, wenn der Mann noch in der Nähe war? Er wartete.
Während die Zeit verstrich, wurde er immer ängstlicher angesichts dessen, was ihm noch bevorstand. Es fiel ihm zunehmend schwer, in der extremen Hitze zu atmen, die heiße Luft kratzte ihm unangenehm in der Kehle. Ihm wurde schwindelig. In diesem Moment erinnerte er sich der Münze in seiner Tasche: an das silberne Zwanzig-Lire-Stück, das ihm sein Großvater André geschenkt hatte. Der Glücksbringer, den er überallhin mit sich schleppte. Er steckte in seiner linken Hosentasche. Mit gefesselten Händen brauchte er eine Minute, bis er seine Tasche erreichte und die Münze schließlich in den Fingern hielt. Indem er die Arme wieder über das Reserverad schlang, faßte er das Geldstück fest in der rechten Hand und begann stumm zu beten: daß der Mann ihm nicht mehr wehtun solle, daß er bald zu Hause sein werde, daß die Polizei den Mann finden und einsperren solle und daß seine Mutter nicht zu wütend wurde, wenn er ihr erzählte, was passiert war.
Die Hitze machte ihn müde. Er war kurz davor, einzuschlafen, als Stimmen ihn aufhorchen ließen. Und plötzlich kamen diese näher, bis sie praktisch neben dem Alfa zu sein schienen. Schritte knirschten, und eine Autotür wurde geöffnet. Er zögerte nur kurz … dann trat er mit den Füßen gegen die Klappe des Kofferraums. Er wartete und horchte. Nichts, bis auf leises Rascheln und eine weitere Autotür, die geöffnet wurde. Er trat erneut zu, doch in diesem Moment ging jedes Geräusch im Rauschen eines vorbeifahrenden Autos oder Lastwagens unter. Dann hörte er, wie die Türen zuklappten. Ein Motor heulte auf. Der Wagen entfernte sich. Christian seufzte tief und biß sich auf die Lippe.
Kurz darauf gab er sich der drückenden Hitze hin und döste ein. Seine Gedanken waren um ihren Bauernhof zu Hause gekreist, und der stand auch im Mittelpunkt seines Traums. Er träumte von einer kleinen Steinmauer im großen Feld hinter dem Haus, an der wilde Erdbeeren wuchsen. In einem Sommer hatte er einen Teil der Erdbeerranken abgeschnitten und an der Mauer als Versteck ein kleines Häuschen aus Holz und Stroh gebaut. Er war in diesem Versteck, als er seinen Vater rufen hörte. Er beschloß, noch eine Weile verborgen zu bleiben und dann herauszuspringen, um seinen Vater zu erschrecken. Beim dritten Ruf kletterte er hinaus auf die Mauer. Aber sein Vater starrte weiter prüfend an ihm vorbei zum Horizont. Er hatte ihn nicht gesehen. Christian begann ihm heftig zu winken. Die Blicke seines Vaters schweiften weiter hin und her, langsamer und gründlicher jetzt, und er rief erneut seinen Namen. Einen Moment starrte der Vater weiter über die Felder, dann drehte er sich resigniert um und ging über den Hof zurück zur hinteren Küchentür.
Christian sprang von der Mauer, rief verzweifelt nach dem Vater, während er hinter ihm herrannte. Aber während er noch lief, wurde das Gras allmählich höher, versperrte ihm den Blick auf den Hof. Er wurde ganz konfus und verirrte sich. Er konnte sich nicht erinnern, daß das Gras je so hoch gestanden hatte, und jetzt, da er den Bauernhof nicht mehr sehen konnte, verlor er jede Orientierung. Er rannte weiter, rief immer verzweifelter, ohne je eine Antwort zu erhalten, fühlte sich zunehmend einsamer und wurde schrecklich müde. Es begann dunkel zu werden, und er bekam Angst. Er rief noch einmal vergeblich den Namen des Vaters, dann setzte er sich niedergeschlagen ins hohe Gras. Er begann zu weinen. Er fühlte sich von seinem Vater verlassen. Warum bist du nicht gekommen und hast mich gefunden? Mit einem Mal schien der Boden unter ihm vom lauten Dröhnen eines Motors zu beben und zu schwanken. Das Geräusch und die Vibrationen kamen völlig unerwartet, und im ersten Moment konnte sich Christian nur vorstellen, daß sein Vater den Traktor aus der Scheune gefahren hatte, um nach ihm zu suchen.
Diese hoffnungsvolle Aussicht jedoch ließ seine Tränen nicht versiegen, und er weinte noch immer, als er in der Wirklichkeit des Kofferraums erwachte und merkte, daß sie einen holprigen Weg entlangfuhren. Offenbar waren sie erneut von der Straße abgebogen. Wie lange waren sie schon unterwegs? Mit sinkendem Mut merkte er, daß er jedes Gefühl für Zeit und Entfernung verloren hatte. Vielleicht waren sie längst zu weit von Taragnon entfernt, als daß sein Vater ihn noch finden könnte. Und dann fühlte er sich tatsächlich so allein und verlassen wie in seinem Traum. Entsetzliche Angst erfaßte ihn, und er begann erneut, am ganzen Körper zu zittern.
Dann merkte er, daß er Großvater Andrés Münze nicht mehr in seiner Hand hielt, und wurde panisch. Seine Muskeln mußten sich im Schlaf so entspannt haben, daß ihm der Talisman bei der holprigen Fahrt entglitten war. Er begann in der Dunkelheit um sich zu tasten. Auf dem Reserverad lag sie nicht; die Radkappe war aus glattem Metall und wies am Rand mehrere Löcher auf. Diese waren jedoch zu klein, als daß er mit den Fingern, geschweige denn mit einer Hand hätte hindurchreichen können. Außerdem war er gefesselt. Falls die Münze durch eine dieser Öffnungen gefallen war, war sie für ihn verloren. Er suchte den ganzen Boden um den Reservereifen ab.
Dabei merkte er gar nicht, daß der Wagen angehalten hatte. Er war noch immer auf der Suche nach der Münze, als der Kofferraumdeckel aufklappte, greller Sonnenschein hereinflutete und ihn blendete.
3
Provence im August 1963