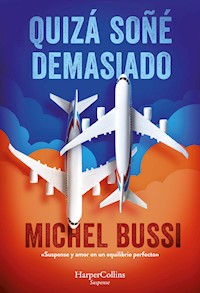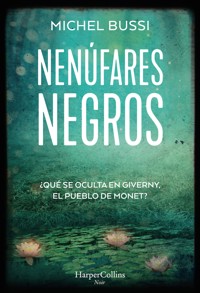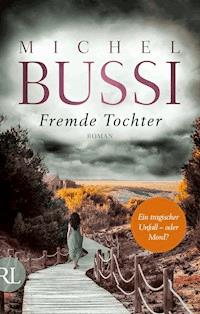8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
„Absolut packend!“ Marie Claire. Malone ist ein ganz normaler Junge. Er spielt gerne mit seinem Stofftier und liebt es, Geschichten zu erfinden. Oder sagt er etwa die Wahrheit, wenn er behauptet, dass die Frau, bei der er lebt, nicht seine leibliche Mutter ist? Keiner glaubt ihm. Keiner außer dem Schulpsychologen Vasile, dem es nach und nach gelingt, aus Malones Erinnerungsfetzen, die Wahrheit zusammenzusetzen. Doch plötzlich ist sein Leben in größter Gefahr - und das von Malone ... Eine hochemotionale Identitätssuche – von einem Bestsellerautor aus Frankreich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Informationen zum Buch
»Absolut packend!« marie claire.
Malone ist ein ganz normaler Junge. Er spielt gerne mit seinem Stofftier und liebt es, Geschichten zu erfinden. Oder sagt er etwa die Wahrheit, wenn er behauptet, dass die Frau, bei der er lebt, nicht seine leibliche Mutter ist? Keiner glaubt ihm. Keiner außer dem Schulpsychologen Vasile, dem es nach und nach gelingt, aus Malones Erinnerungsfetzen, die Wahrheit zusammenzusetzen. Doch plötzlich ist sein Leben in größter Gefahr und das von Malone …
Eine hochemotionale Identitätssuche – von einem Bestsellerautor aus Frankreich.
Michel Bussi
Das verlorene Kind
Roman
Aus dem Französischen von Eliane Hagedorn und Barbara Reitz
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
I Marianne
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
II Amanda
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
III Angélique
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Über Michel Bussi
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Für Maman, für wen sonst?
Ich habe mehrere Mütter.
Das ist etwas schwierig für mich.
Vor allem, weil sie sich nicht wirklich mögen.
Eine wird sterben.
Ist das vielleicht sogar meine Schuld?
Vielleicht ist das alles ja überhaupt nur meinetwegen passiert.
Weil ich mich nicht daran erinnern kann, welche der beiden die echte ist.
I Marianne
Kapitel 1
Flughafen Le Havre-Octeville Freitag, 6.November 2015, 16:15 Uhr
Er spürte, wie sich seine Füße vom Boden lösten, und gleich darauf konnte er die Dame hinter der Glasscheibe sehen. Sie trug eine violette Uniform, hatte ein Mondgesicht und eine ulkige Brille auf der Nase. In ihrem Glashäuschen erinnerte sie ihn an eine dieser Frauen, die Karten fürs Karussell verkaufen.
Er spürte, wie Mamans Hände ein wenig zitterten, als sie ihn so hoch hob. Die Dame sah zuerst ihm, dann Maman fest in die Augen und senkte dann den Blick auf die kleinen dunkelroten Heftchen, die sie geöffnet in der Hand hielt.
Maman hatte ihm vorher alles genau erklärt. Die Dame überprüfte jetzt die Fotos. Um sicherzugehen, dass sie es auch wirklich waren. Damit sie in dieses Flugzeug steigen durften. Nur dass die Dame nicht wusste, wohin die Reise ging. Also, wohin sie wirklich ging. Er wusste als einziger Bescheid. Nur er wusste, dass sie zum Wald der Menschenfresser flogen.
Damit Maman es leichter hatte, stützte er die Hände auf die schmale Theke des Schalters. Er betrachtete die Buchstaben auf der Jacke der Dame. Richtig lesen konnte er noch nicht, aber manche kannte er schon.
J … E … A … N …
Jetzt machte sie Maman ein Zeichen, dass sie ihn wieder absetzen konnte.
Normalerweise nahm Jeanne es nicht so genau. Vor allem hier, im kleinen Flughafen von Le Havre-Octeville, wo es nur drei Schalter, zwei Gepäckbänder und einen Kaffeeautomaten gab. Doch seit dem frühen Nachmittag war das Sicherheitsteam im Einsatz und lief hektisch zwischen Parkplatz und Rollfeld hin und her. Alle waren auf der Suche nach drei Flüchtigen, obwohl sie wohl kaum in der Lage wären, dieses Flug-Mauseloch zu passieren.
Egal. Commandante Augresse hatte sich unmissverständlich ausgedrückt. Hatte Fotos der Typen und der jungen Frau an den Wänden der Halle aufhängen lassen, jeden Zollbeamten, jedes Mitglied des Sicherheitsdienstes zur Vorsicht gemahnt.
Sie waren gefährlich. Vor allem einer der beiden Männer. Räuber zunächst. Dann Mörder. Mehrfach vorbestraft.
Jeanne beugte sich ein wenig vor. »Bist du denn schon mal geflogen, mein Kleiner? Und schon mal so weit?«
Der Junge trat einen Schritt zur Seite, um sich hinter seiner Mutter zu verstecken. Jeanne hatte keine Kinder. Ihr idiotischer Dienstplan am Flughafen lieferte ihrem Freund eine perfekte Ausrede, wenn sie das Thema ansprach. Dabei kam sie mit Kindern wirklich gut klar. Oft besser als mit den Männern.
Wieder lächelte sie.
»Du hast aber keine Angst, oder? Denn dort, wo du hinreist, gibt es …«
Sie sprach bewusst langsam, wartete, bis seine Nasenspitze hinter den Beinen der Mutter, die in hautengen Jeans steckten, wieder hervorschaute.
»Da gibt es den Dschungel … stimmt’s, mein Kleiner?«
Der Junge wich ein kleines Stück zurück und guckte sie mit großen Augen an. Fast so, als wäre er überrascht, dass die Stewardess etwas über das Land wusste, in das er reisen sollte.
Jeanne warf ein letztes Mal einen prüfenden Blick auf die Pässe, bevor sie energisch den Stempel daraufdrückte.
»Du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Deine Maman ist ja bei dir!«
Der Junge hatte sich wieder hinter seiner Mutter versteckt. Jeanne war enttäuscht. Wenn sie jetzt noch nicht mal mehr mit Kindern zurechtkam … aber dann sagte sie sich, dass so ein Flughafen auch ein ziemlich einschüchternder Ort war, vor allem jetzt, wo diese blöden Militärs mit ihren Knarren am Gürtel und den umgehängten Maschinengewehren durch die Halle liefen. Gerade deswegen war es ihr auch so wichtig gewesen, dass sich der Kleine wohl fühlte.
»Alles halb so schlimm! Frag einfach deine Maman. Sie erklärt dir dann schon, was es mit dem Dschungel auf sich hat.«
Die Mutter hatte ihr dankbar zugelächelt und ihr Sohn immerhin ansatzweise reagiert. Aber irgendetwas war seltsam gewesen. Für den Bruchteil einer Sekunde schien der Kleine abgelenkt. Er hatte quer durch die Halle geblickt, vielleicht auf das Plakat, das sie eine knappe Stunde zuvor aufgehängt hatten, das Foto der Frau und des Mannes. Alexis Zerda. Dem Mörder. Vielleicht hatte er aber auch durch die große Glasfront geschaut, hinter der gerade ein Flugzeug startete. Oder zum Meer, das in der Ferne lag. Womöglich war er mit den Gedanken schon ganz woanders. Vielleicht schon in den Wolken.
Jeanne rief sich zur Vernunft, sie ließ sich mal wieder zu sehr von ihren Emotionen leiten, das brachte nie etwas, das hatten ihr ihre letzten Beziehungen gezeigt. Seufzend schob sie die Pässe durch die Öffnung in der Sicherheitsscheibe.
»Alles ist in Ordnung, Madame. Gute Reise.«
»Danke.«
Das einzige Wort, das die Frau von sich gegeben hatte. Hinter ihr, am Ende der Startbahn, hob ein himmelblauer Airbus ab.
***
Commandante Marianne Augresse hob die Augen zu dem blauen Flugzeug am Himmel. Sie sah ihm nach, wie es über dem graublauen Meer verschwand, und setzte dann ihren beschwerlichen Aufstieg fort.
Vierhundertfünfzig Stufen.
Ihr Stellvertreter Jibé, der schon fünfzig Stufen weiter oben war, drehte sich zu ihr um und kam ihr mit federnden Schritten wieder entgegen. Als wäre das alles für ihn nur ein Spiel. Plötzlich ging er ihr höllisch auf die Nerven, mehr noch als der ganze Rest.
»Ich habe einen Zeugen!«, rief der Lieutenant, jetzt zwanzig Stufen über ihr angelangt. »Und nicht nur irgendeinen …«
Marianne klammerte sich am Geländer fest und nutzte die Gelegenheit, um kräftig durchzuatmen. Sie spürte, wie ihr der Schweiß über den Rücken lief. Vierzig war einfach ein verfluchtes Alter, kombiniert mit Fast Food zum Mittagessen, Abenden auf dem Sofa, einsamen Nächten und aufgeschobenen morgendlichen Joggingrunden.
Ihr Lieutenant sprang die letzten Stufen hinab, als lieferte er sich ein Wettrennen mit einem unsichtbaren Aufzug. Dann baute er sich vor Marianne auf und reichte ihr etwas, das an eine graue Ratte erinnerte. Weich und leblos.
»Verdammt, wo hast du das gefunden?«
»Im Gebüsch, ein paar Meter weiter oben. Alexis Zerda muss es weggeworfen haben, bevor er abgehauen ist.«
Marianne antwortete nicht. Sie begnügte sich damit, das schlaffe Plüschtier zwischen Daumen und Zeigefinger zu drücken. Das Fell war verblichen, abgenutzt vom vielen Streicheln, Lutschen und Drücken an den zitternden Körper eines kleinen Jungen. Zwei schwarze Glasaugen starrten sie, übergroß und weit aufgerissen, an. Wie vor Entsetzen erstarrt.
Jibé hatte nicht unrecht. Sie hielt tatsächlich einen Zeugen in der Hand. Einen zerfledderten, klebrigen Zeugen. Dem man das Herz herausgerissen hatte. Den man zum Schweigen gebracht hatte. Für immer.
Marianne drückte das Stofftier unwillkürlich an sich. Der Kleine hätte sein Kuscheltier niemals freiwillig hergegeben.
Sie strich das Fell mechanisch auseinander, am Ansatz der Acrylfasern waren bräunliche Spuren zu erkennen. Blut, ohne jeden Zweifel. Dasselbe, das in dem Unterschlupf einige hundert Stufen weiter unten gefunden worden war?
War es das des Jungen oder das von Amanda Moulin?
»Wir müssen uns beeilen, Jibé!«, befahl sie. »Los!«
Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, eilte Jean-Baptiste voraus. Marianne zwang sich, ihre Schritte ihren Gedanken anzupassen, um einerseits zu verhindern, dass die Müdigkeit ihr Vorankommen bremste, andererseits, um langsam und durchdacht ihre Schlussfolgerungen zu entwickeln. Obwohl sich im Grunde nur eine Frage aufdrängte: Wo war er?
Trotz des vor zwei Stunden ausgelösten Großeinsatzes verfügte Alexis Zerda über zig Möglichkeiten, ihnen zu entwischen.
Nur wie? Und: warum? War das nicht eigentlich nebensächlich? Scheute sie sich nicht nur, eine andere Frage zu stellen. Die wesentliche.
Warum wurde dieses Plüschtier weggeworfen?
Was kann so wichtig gewesen sein, dass es ihn bewog, dem Kleinen das Tier zu entreißen? Einem Jungen, der gebrüllt, sich mit Händen und Füßen gesträubt haben musste, auch nur eine weitere Stufe zu erklimmen, der lieber auf der Stelle gestorben wäre, als sich von dieser abgewetzten Ratte zu trennen, die seinen Geruch verströmte und den seiner Mutter.
Der Meereswind wehte den unerträglichen Gestank nach Erdöl herüber. Die hochbeladenen Containerschiffe stauten sich in der Fahrrinne von Le Havre wie Autos vor einer roten Ampel.
Die Adern unter den Schläfen der Commandante schwollen an. Blut und Schweiß. Die Treppe schien sich bis ins Unendliche zu erstrecken.
Warum das alles?
Weil Zerda nicht die Absicht gehabt hatte, sich mit dem Jungen zu belasten? Genauso wenig wie mit dem Plüschtier? Weil er sich des Jungen ebenfalls entledigen würde, sobald er einen unauffälligen Ort gefunden hätte?
Ein weiterer Airbus zog am Himmel vorüber. Der Flughafen lag nur zwei Kilometer Luftlinie entfernt.
Endlich, nur noch ein paar Dutzend Stufen. Lieutenant Lechevalier hatte den Parkplatz schon fast erreicht. Mariannes Finger krallten sich in die graue Stoffkugel, kneteten sie durch, wie um sich zu vergewissern, dass dieses Kuscheltier, dem sich der kleine Junge stundenlang in Gesprächen anvertraut hatte, nun wirklich tot war.
Sie ließ gedankenverloren ihre Finger durch die vor Schmutz und Blut steifen Fellhaare wandern, hielten dann unvermittelt inne und blickte auf das Fellbündel.
Was könnte ihr dieses aufgeschlitzte Stück Stoff enthüllen?
Ihr Blick verlangsamte sich, konzentrierte sich auf die verwaschenen Zeichen. Plötzlich war ihr alles klar. Mit einem Mal fügten sich die Teile des Puzzles zusammen. Sogar die, die sie als völlig unwahrscheinlich wieder verworfen hatte.
Geschichten eines Jungen mit zu viel Phantasie. Hatte sie gedacht …
Aber alles stand hier. Malone hatte nichts erfunden!
In drei Worten festgehalten, an den synthetischen Fasern dieses stummen Zeugen. Sie hatten dieses Plüschtier in der Hand gehabt, aber niemand hatte etwas bemerkt. Alle hatten sich nur auf das allzu Offensichtliche konzentriert.
Die Commandante schloss für einen Moment die Augen. Vor fünf Tagen hätte sie das nicht für möglich gehalten. Seitdem aber hatte sich viel geändert.
Das Plüschtier noch immer fest an die Brust gepresst, blickte Marianne auf die vielen Stufen hinab, die sie bereits erklommen hatte und die jetzt fast ein Gefühl von Schwindel in ihr auslösten. Sie schienen sich in der Ferne im unendlich leeren Himmel, beinah so dunkel wie das Meer, aufzulösen.
Jibé hatte bereits den Motor ihres Dienstwagens gestartet. Mit allerletzter Kraft beschleunigte sie das Tempo. In ihrem Kopf trommelte nur noch eine Frage:
War es noch möglich, sie aufzuhalten?
Vier Tage früher …
MONTAG
Der Tag des Mondes
Kapitel 2
Kleiner Zeiger auf der Acht, großer Zeiger auf der Sieben
Maman ist ganz schnell gerannt. Mich hat sie an der Hand hinter sich hergezogen. So fest, dass mir mein Arm weh tat. Sie hat nach einem Ort gesucht, wo wir beide uns verstecken können, und dann hat sie mir was zugerufen, aber ich habe es nicht verstanden, weil so viele Leute da waren.«
»Da waren viele Leute? Was denn für Leute?«, hatte er gefragt.
»Na … Leute, die eingekauft haben.«
»Es waren also Geschäfte um euch herum?«
»Ja. Viele. Nur wir hatten keinen Einkaufswagen. Bloß eine große Tasche. Meine große Tasche mit Jack und den Piraten drauf.«
»Aber du und deine Maman, ihr habt auch eingekauft?«
»Nein. Nein. Ich sollte in die Ferien fahren. Das hat Maman jedenfalls gesagt. Lange Ferien. Aber ich wollte nicht. Deshalb hat ja Maman nach etwas gesucht, um sich mit mir zu verstecken. Damit die Leute nicht sehen, dass ich Theater mache.«
»So wie in der Vorschule? Das Theater, von dem Clotilde mir erzählt hat? Weinen. Wütend werden. Alles im Klassenzimmer kurz und klein hauen wollen. Meinst du das, Malone?«
»Ja.«
»Warum?«
»Weil ich nicht mit der anderen Maman wegfahren wollte.«
»Darum ging es also?«
»…«
»Na gut, über deine andere Maman reden wir lieber später. Versuch erst einmal, dich an den Rest zu erinnern. Kannst du mir beschreiben, was du um dich herum gesehen hast? Dort, wo du mit deiner Maman so schnell gelaufen bist.«
»Da waren Geschäfte. Viele Geschäfte. Und ein McDonald’s, aber wir haben da nicht gegessen. Maman wollte nicht, dass ich mit den anderen Kindern spiele.«
»Erinnerst du dich, wie die Straße aussah oder welche anderen Geschäfte es gab?«
»Das war nicht in einer Straße.«
»Wie, nicht in einer Straße?«
»Das, wo wir waren, sah aus wie eine Straße, aber man hat den Himmel nicht gesehen!«
»Bist du sicher, Malone? Man hat den Himmel nicht gesehen? War denn draußen um die Geschäfte herum ein großer Parkplatz?«
»Weiß ich nicht. Im Auto habe ich geschlafen. Ich erinnere mich nur an später, an die Straße ohne Himmel mit den Geschäften, als Maman mich an der Hand mitgezogen hat.«
»Gut. Das ist nicht schlimm, Malone. Warte kurz, ich zeige dir Fotos, und du sagst mir, ob du etwas wiedererkennst.« Malone saß auf seinem Bett, ohne sich zu rühren.
Gouti sagte nichts mehr, als wäre er tot; aber irgendwann fing er wieder an zu reden. So machte er das oft, das war normal.
»Guck mal, Malone. Schau dir die Bilder auf dem Computer an. Kannst du dich daran erinnern?«
»Ja.«
»War es das, wo du mit deiner Maman gewesen bist?«
»Ja.«
»Bist du sicher?«
»Ich glaube schon. Da waren derselbe rote und grüne Vogel. Und auch der Papagei, der als Pirat verkleidet ist.«
»Okay. Das ist sehr wichtig, Malone. Ich zeige dir später noch andere Fotos. Jetzt aber machen wir erst mal mit deiner Geschichte weiter. Du und deine Maman, ihr habt euch also versteckt. Wo war das?«
»Auf der Toilette. Ich habe auf dem Boden gesessen. Maman hat die Tür abgesperrt, damit ich sie besser verstehe, ohne dass jemand zuhört.«
»Was hat dir deine Maman denn gesagt?«
»Dass alles, was ich im Kopf habe, verschwinden wird, wie die Träume, die ich nachts habe. Aber dass ich jedes Mal, bevor ich einschlafe, an Maman denken soll. Ganz fest. Und auch an unser Haus. An den Strand. An das Piratenschiff, das Schloss. Genau das hat sie gesagt. Damit die Bilder in meinem Kopf nicht verschwinden werden. Wenn ich im Bett nicht an sie denke, werden sie fortfliegen, wie die Blätter von den Zweigen der Bäume fliegen.«
»Das war, bevor sie dich bei deiner anderen Maman gelassen hat, richtig?«
»Die andere ist nicht meine Maman!«
»Ja, ja, Malone, das habe ich schon verstanden, deshalb habe ich ja die andere Maman gesagt. Und was hat sie dir sonst noch gesagt? Deine erste Maman, meine ich.«
»Ich soll auf Gouti hören.«
»Das hier ist wohl Gouti. Dein Kuscheltier, stimmt’s? Guten Tag, Gouti! Du solltest also auf ihn hören, hat dir deine Maman gesagt?«
»Ja! Ich soll mich verstecken und Gouti zuhören.«
»Dann ist er wohl sehr klug! Und wie hilft dir Gouti, dich an alles zu erinnern?«
»Er spricht mit mir.«
»Er spricht mit dir?«
»Ja.«
»Wann spricht er denn mit dir?«
»Das kann ich nicht sagen, das ist mein Geheimnis. Ich musste es Maman schwören. Maman hat mir noch ein anderes Geheimnis anvertraut: wie man sich vor Menschenfressern schützt, wenn sie einen in den Wald mitnehmen wollen.«
»Gut, ich verstehe, das bleibt dein Geheimnis. Aber sonst hat dir deine Maman nichts gesagt, Malone?«
»Doch. Sie hat mir genau das gesagt!«
»Was?«
»Malone!«
»Sie hat dich bei deinem Vornamen genannt, meinst du das?«
»Ja. Sie hat gesagt, dass Malone ein hübscher Name ist. Dass ich antworten soll, wenn mich jemand so nennt.«
»Hast du vorher einen anderen Namen gehabt? Erinnerst du dich noch daran?«
Malone schwieg, eine Ewigkeit.
»Das ist nicht schlimm, mein Junge. Überhaupt nicht schlimm. Hat deine Maman dir danach noch etwas gesagt?«
»Nein. Danach hat sie geweint.«
»Okay. Und das Haus, in dem du früher gewohnt hast? Nicht das, in dem du heute wohnst. Das andere. Kannst du mir davon erzählen?«
»Ein bisschen. Aber fast alle Bilder sind verschwunden, weil Gouti fast nie von dem früheren Haus spricht.«
»Verstehe. Kannst du mir trotzdem die Bilder beschreiben, die noch geblieben sind? Du hattest gerade vom Meer gesprochen? Von einem Piratenschiff? Von den Türmen eines Schlosses?«
»Ja! Es gab dort keinen Garten, da bin ich sicher, nur den Strand. Wenn man sich in meinem Zimmer aus dem Fenster gelehnt hat, ist man fast ins Meer gefallen. Von dort konnte ich das Piratenschiff gut sehen, es war auseinandergebrochen. Ich erinnere mich auch an die Rakete. Und daran, dass ich nicht weit vom Haus weggehen durfte, wegen des Waldes.«
»Des Waldes der Menschenfresser, ja?«
»Ja.«
»Kannst du ihn mir ein bisschen beschreiben?«
»Ja. Das ist einfach, die Bäume reichen bis in den Himmel. Und im Dschungel gab es nicht nur Menschenfresser, sondern auch große Affen, Schlangen, Riesenspinnen. Einmal habe ich diese Spinnen gesehen, deshalb musste ich in meinem Zimmer bleiben.«
»Erinnerst du dich noch an etwas anderes, Malone?«
»Nein.«
»Okay. Sag mal … Malone. Ich werde dich trotzdem Malone nennen, bis wir deinen Vornamen von früher herausgefunden haben, ja? Sag mal … dein Kuscheltier, was ist denn das für ein Tier?«
»Na ja, ein Gouti eben.«
»Okay, okay. Ein Gouti. Ich verstehe. Und du sagst, dass er tatsächlich mit dir spricht? Nicht nur in deinem Kopf? Ich weiß wohl, dass es ein Geheimnis ist, aber willst du mir nicht wenigstens ein kleines bisschen erzählen, wie …«
Malone hielt plötzlich den Atem an.
»Sei jetzt still, Gouti«, flüsterte er.
Er hatte Schritte auf der Treppe gehört. Er achtete immer sehr genau auf alle Geräusche im Haus, vor allem, wenn er in seinem Zimmer war, unter der Bettdecke, fast im Dunkeln, und wenn er heimlich Gouti zuhörte.
Maman-da kam die Treppe herauf.
»Schnell, Gouti«, murmelte Malone, »wir müssen so tun, als ob wir schlafen.«
Sein Kuscheltier verstummte gerade noch rechtzeitig, bevor Maman-da das Zimmer betrat. Malone drückte es an sich. Gouti war supergut darin, so zu tun, als würde er schlafen!
Die Stimme von Maman-da war immer etwas schleppend, vor allem abends, als wäre sie so müde, dass sie ihre Sätze nicht mehr würde beenden können.
»Alles in Ordnung, Liebling?«
»Ja.«
Malone hätte am liebsten gehabt, sie würde gleich wieder gehen, aber wie jeden Abend setzte Maman-da sich auf den Bettrand und strich ihm übers Haar. Heute war sie sogar noch beharrlicher. Sie legte ihre Arme um ihn und presste ihn gegen ihre Brust, so fest, wie er sein Kuscheltier an sich drückte, nur, dass es ihm ein klein wenig weh tat.
»Morgen treffe ich deine Lehrerin in der Vorschule. Weißt du das noch?«
Malone antwortete nicht.
»Anscheinend erzählst du irgendwelche Geschichten. Ich weiß ja, dass du Geschichten so gerne magst, Liebling, das ist normal für einen kleinen Jungen wie dich. Ich bin sogar sehr stolz, wenn du alle diese Dinge in deinem Kopf erfindest. Aber die Erwachsenen nehmen diese Geschichten manchmal ernst, sie denken, dass sie wahr sind. Deswegen möchte deine Lehrerin uns sehen, verstehst du?«
Malone schloss die Augen. Es dauerte lange, bis Maman-da sich endlich entschließen konnte zu gehen.
»Du bist müde, mein Liebling. Ich lasse dich schlafen. Gute Nacht.«
Sie küsste ihn, löschte das Licht und verließ endlich das Zimmer. Malone wartete, vorsichtig. Er warf einen Blick auf den Astronautenwecker.
Kleiner Zeiger auf der Acht, großer Zeiger auf der Neun.
Malone wusste, dass er sein Kuscheltier erst wecken durfte, wenn der kleine Zeiger auf der Neun stand, das hatte Maman ihm auch beigebracht.
Er betrachtete den großen Himmelskalender, der an der Wand hing, direkt über dem Astronautenwecker. Die Planeten funkelten in der Nacht. Wenn alle Lichter im Zimmer ausgeschaltet waren, sah man nur noch sie im Dunkeln. Heute war der Tag des Mondes.
Malone brannte darauf, dass Gouti ihm seine Geschichte erzählte, seine Geschichte vom Schatz am Strand. Vom verlorenen Schatz.
Kapitel 3
Das Klingeln ihres Handys riss Commandante Marianne Augresse aus ihren Gedanken. Für einen kurzen Moment ruhte ihr Blick auf ihrer nackten, kalten Haut, dann hob sie ihren Arm aus der Badewanne, in der sie seit einer Stunde döste, um nach dem Smartphone zu greifen. Ihre Hand stieß dabei gegen den kleinen Korb mit Spielzeug, der wackelig auf der Wäschetruhe stand. Die Plastikschiffchen, Aufzieh-Delphine und weitere kleine Fische in Neonfarben verteilten sich auf der Wasseroberfläche.
»Scheiße!«
Ungeduldig hoben ihre nassen Finger das Handy hoch.
Unterdrückte Rufnummer.
»Scheiße!«, wiederholte sie. Sie hatte gehofft, dass es endlich einer ihrer Lieutenants wäre, Jibé, Papy oder irgendein anderer Bereitschaftspolizist im Kommissariat von Le Havre. Seit man gestern Timo Soler im Viertel Saint-François, in der Nähe der Apotheke gesichtet hatte, konnte sie an nichts anderes mehr denken. Vier Mann hatte sie zur Beschattung postiert. Seit beinahe einem Jahr, genauer gesagt seit neun Monaten und siebenundzwanzig Tagen, waren sie hinter Timo Soler her. Die Treibjagd hatte Dienstag, den 6. Januar 2015, nach einem Raubüberfall in Deauville begonnen, in der Sekunde, als die Überwachungskameras das Gesicht des Räubers verewigt hatten, direkt bevor er auf seinem Motorrad verschwand und mit ihm eine 9-Millimeter-Kugel aus einer Parabellum, die, den Ballistikern zufolge, irgendwo zwischen seiner Lunge und seiner Schulter stecken musste. Marianne kannte sich, sie würde bis zum Morgen kein Auge zutun. Sie würde nur dösen, erst in der Badewanne, dann auf dem Sofa, vom Sofa ins Bett gehen und hoffen, mitten in der Nacht aufspringen zu müssen, um sich eilig ihre Lederkombi zu schnappen und ihr zerwühltes Bett, die eingeschalteten Lampen, ihren Teller mit den Essensresten vor dem Fernseher zurückzulassen, sich gerade noch die Zeit nehmen, Mogwai, ihrem Hauskater, eine Handvoll Trockenfutter hinzuwerfen.
Ihr Zeigefinger glitt über das feuchte Glas. »Hallo?«
Vorsichtig tupfte sie das iPhone mit einem Handtuch ab, das neben der Wanne hing, und hoffte, dadurch nicht die Verbindung zu unterbrechen.
»Commandante Augresse? Vasile Dragonman. Wir kennen uns nicht … ich bin Schulpsychologe. Eine gemeinsame Freundin hat mir Ihre Handynummer gegeben. Angélique Fontaine.«
Angie … Verflucht!, dachte Marianne. Sie würde sie wirklich bremsen müssen.
»Handelt es sich um eine dienstliche Angelegenheit, Monsieur Dragonman? Ich erwarte nämlich jeden Moment einen wichtigen Anruf auf dieser Leitung.«
»Ich kann Sie beruhigen, es dauert nicht lange.«
Er hatte eine sanfte Stimme. Die Stimme eines jungen Pfarrers, eines Hypnotiseurs. Die Stimme eines Süßholzrasplers, der selbst überzeugt ist von seinen Märchen. Eine samtige Stimme mit der Härte eines leichten osteuropäischen Akzents.
»Na, dann legen Sie mal los«, seufzte Marianne.
»Mein Anruf mag Sie erstaunen. Wie gesagt, ich bin Schulpsychologe und für die gesamte nördliche Mündungsregion von Le Havre zuständig. Seit ein paar Wochen beschäftige ich mich mit einem merkwürdigen Kind.«
»Das heißt?«
Marianne setzte sich auf und versuchte dabei, das Plätschern des Badewassers zu unterdrücken.
»Der Junge behauptet, seine Mutter sei gar nicht seine Mutter.«
Die Finger der Commandante rutschten auf ihrem nassen Oberschenkel ab.
»Wie bitte?«
»Er behauptet, seine Mutter sei nicht seine Mutter! Und übrigens sein Vater auch nicht sein Vater.«
Marianne biss sich auf die Lippen.
Ein übereifriger Psychofritze also! Auf wen war Angie da wohl wieder hereingefallen.
»Er wirkt deutlich älter, als er ist«, ergänzte er. »Zwar nicht wirklich hochbegabt, aber frühreif. Den Tests zufolge, die …«
»Aber seine Eltern sind wirklich seine Eltern?«, schnitt Marianne ihm das Wort ab. »Haben Sie das mit den Lehrern überprüft? Nichts in Richtung Adoptiv- oder Pflegeeltern?«
»Ja, es besteht kein Zweifel. Es ist tatsächlich ihr Kind. Sie behaupten, der Junge habe zu viel Phantasie. Die Schulleiterin trifft sich morgen mit ihnen.«
»Dann ist doch alles geregelt, oder?«
Sofort ärgerte sich Marianne über den etwas schroffen Ton, der im scharfen Gegensatz zu der sanften Stimme des Psychologen stand. Während sie hin- und hergerissen war, ob sie sich entschuldigen sollte, kitzelte die Rückenflosse eines beweglichen Delphins sie am Rücken. Seit gut sechs Monaten hatte Grégoire, ihr kleiner Neffe, schon nicht mehr bei ihr übernachtet. Und nachdem er jetzt bald elf wurde, war sie nicht sicher, ob er überhaupt noch mal wiederkommen würde, um sich bei seiner Tante mit Pizza vollzustopfen und DVDs reinzuziehen. Besser hätte sie alle diese Spielsachen zusammen mit den Pixar-Filmen, den Playmobilschachteln und einer großen Portion Bedauern in einen Müllsack geworfen, statt ihnen in jeder Ecke der Wohnung ständig wiederzubegegnen.
Ein heftiges »Nein« vom anderen Ende der Leitung riss sie aus ihren Gedanken. »Es ist nichts geregelt. Weil ich, so sonderbar Ihnen das auch vorkommen mag, den Eindruck habe, dass der Kleine die Wahrheit sagt.«
Na klar, da sieht man es mal wieder. Ein Psychologe, natürlich … das Kind hat immer recht!
»Und die Mutter?«
»Sie ist wütend.«
»Ach, wirklich! Kommen wir zum Punkt, Monsieur Dragonman. Was erwarten Sie von mir?«
Marianne schubste den frechen Delphin beiseite. Die Stimme dieses Fremden brachte sie durcheinander. Nackt in der Badewanne fühlte sie sich schutzlos.
Der Psychologe schwieg eine Weile. Zeit genug, dass sich Marianne angesichts all der Kinderspielsachen wieder zu Träumereien hinreißen lassen konnte. Wie gerne würde sie ihr Leben mit einem Baby teilen. Stunden damit zuzubringen, mit einem Dreikäsehoch, ebenso pummelig wie sie, im kalt gewordenen Wasser zu plantschen inmitten von Plastikspielzeug, sich einzuseifen, gegenseitig nasszuspritzen und die Ratschläge aller Kinderärzte in den Wind zu schießen.
»Was ich erwarte?«, entgegnete Vasile Dragonman plötzlich. »Ich weiß es nicht. Hilfe?«
»Soll ich Ermittlungen einleiten? Ist es das?«
»Nicht unbedingt. Aber vielleicht ein bisschen nachbohren. Angie hat mir gesagt, dass das Ihre Stärke ist. Überprüfen, was der Junge mir erzählt hat. Ich habe stundenlange Aufzeichnungen von Gesprächen, Notizen, Bilder, die er gemalt hat …«
Je länger das Gespräch dauerte, desto mehr kam die Commandante zu dem Schluss, dass es letztlich das Einfachste sein würde, diesen Vasile Dragonman zu treffen. Noch dazu, da Angie ihn geschickt hatte … Angie wusste, was sie suchte. Keinen Kerl! Männer waren Marianne piepegal. Mit ihren neununddreißig Jahren hatte sie noch mindestens zwanzig Jahre vor sich, in denen sie mit allen Männern der Welt schlafen konnte. Nein, Marianne hatte Angie ihre Botschaft an den langen Mädelsabenden, die sie zusammen verbracht hatten, eingehämmert: In den kommenden Monaten würde sich die Commandante zu einer Safari aufmachen, deren alleiniges Ziel die Jagd nach einem ganz speziellen Fabeltier war: einem Vater.
Vielleicht hatte Angie einen Hintergedanken dabei gehabt, als sie diesem Typen ihre Nummer gab … ein Schulpsychologe ist schließlich der ideale Vater! Ein Fachmann für die frühe Kindheit, der Freinet, Piaget und Montessori zitiert, wenn andere sich damit begnügen, Sport- oder Unterhaltungsmagazine zu lesen. Sie verjagte die Bilder des Raubüberfalls von Deauville und der Apotheke in Saint François. Sollte es, in dieser Nacht oder morgen, etwas Neues von Timo Soler geben, würde man sie ohnehin sofort informieren.
»Monsieur Dragonman, das übliche Verfahren im Fall einer Kindesgefährdung ist eine Meldung beim Jugendamt oder beim Kinderschutzbund. Der Fall, den Sie mir schildern, erscheint mir jedoch etwas, sagen wir mal, ungewöhnlich. Wollen Sie wirklich aufgrund der Aussagen dieses Kindes eine Meldung machen? Haben Sie den Eindruck, dass der Kleine misshandelt wird? Erscheinen Ihnen die Eltern gefährlich? Kurz, gibt es irgendeinen Grund, der uns erlaubt, ihnen den Jungen zu entziehen?«
»Nein. Auf den ersten Blick scheinen sie ganz normale Eltern zu sein.«
»Gut. In diesem Fall besteht kein Grund zur Eile. Wir können also in der Angelegenheit ganz vorsichtig ermitteln. Wir werden den Eltern nichts anhängen, nur weil ihr Sohn ein bisschen zu viel Phantasie hat …«
Ein Frösteln ergriff die Commandante. Das Badewasser war inzwischen wirklich viel zu kalt geworden.
»Es tut mir leid, Ihnen widersprechen zu müssen, Commandante. Nehmen Sie mir das bitte nicht übel, aber Sie täuschen sich! Genau deswegen war ich Angie gegenüber so hartnäckig und habe mir erlaubt, Sie gleich heute Abend anzurufen. Es ist nämlich tatsächlich Eile geboten. Für diesen Jungen muss jetzt alles ganz schnell gehen. Absolut. Ansonsten ist der Verlust irreversibel.«
Marianne hob leicht die Stimme.
»Irreversibel? Verdammt noch mal. Gerade haben Sie doch gesagt, dass der Junge nicht in Gefahr sei!«
»Hören Sie, Commandante. Alles, woran sich dieses Kind heute erinnert, kann ganz schnell wieder vergessen sein. Morgen oder in ein oder zwei Monaten.«
Marianne setzte sich auf. »Was genau wollen Sie damit sagen?«
»Dass dieser Junge sich an Erinnerungsfetzen klammert, um mir mitzuteilen, dass seine Mutter nicht wirklich seine Mutter ist. Aber in ein paar Tagen, vielleicht auch ein paar Wochen, so sicher jedenfalls, wie dieser Junge älter wird, neue Dinge lernt, die Buchstaben und alles andere der unendlich großen Welt, die ihn umgibt, werden seine älteren Erinnerungen ausgelöscht. Und diese andere Mutter, an die er sich heute noch erinnert, dieses frühere Leben, von dem er mir jedes Mal erzählt, wird dann ganz einfach nie für ihn existiert haben!«
Kapitel 4
Kleiner Zeiger auf der Neun, großer Zeiger auf der Zwölf
Lange lauschte Malone in die Stille, um sicher zu sein, dass Maman-da die Treppe nicht wieder heraufkommen würde. Seine kleinen Finger fuhren unter die Bettdecke, sie spürten das Herz von Gouti schlagen, streichelten ihn, liebkosten ihn; er war ein bisschen warm. Als Gouti richtig aufgewacht war, versteckte Malone sich mit seinem Plüschtier unter der Bettdecke und sperrte seine Ohren weit auf. Heute war der Tag des Mondes. Es war der Tag der Geschichte von Gouti und den Nüssen. Er wusste nicht, wie oft er sie bereits gehört hatte.
Malone legte sein Ohr auf Gouti, als sei dieser ein kleines, sehr, sehr weiches Kopfkissen.
***
Gouti war fünf Jahre alt, womit er in seiner Familie bereits zu den Großen zählte, denn seine Mutter war erst acht und sein betagter Großvater fünfzehn.
Sie wohnten im größten Baum am Strand, dessen Wurzeln die Form einer riesigen Spinne hatten, im dritten Stock auf dem ersten Ast links, zwischen einer Seeschwalbe, die die meiste Zeit auf Reisen war, und einer alten, humpelnden Ente im Ruhestand, die auf Piratenschiffen gedient hatte.
Maman meinte, dass Gouti viel Ähnlichkeit mit seinem Opa habe. Dass er ebenso verträumt sei wie dieser. Es stimmt, dass sein Großvater viel Zeit mit Träumereien verbrachte, aber das lag daran, dass sein Gedächtnis nachließ. Häufig fand man ihn, schlafend mit zerzaustem weißen Schnurrbart, auf einem anderen Ast oder überraschte ihn, wenn er einen grauen Kieselstein anstelle einer Eichel vergrub. Gouti wiederum liebte es, am Meer zu sitzen und sich vorzustellen, dass er ein Schiff bestieg, sich im Frachtraum versteckte, heimlich den Weizen oder Hafer aus einem der Säcke fraß, bis er eine neue Insel entdeckte. Er würde dort bleiben und eine neue Familie gründen. Er träumte oft davon und vergaß darüber alles andere.
Aber er hatte auch Aufgaben zu erledigen. Gut, nur eine einzige und immer dieselbe, aber es war eine sehr wichtige Aufgabe: Im Wald Nüsse sammeln und in der Nähe der Wohnung vergraben. Seine Familie hatte sich nämlich wegen des Waldes hier niedergelassen. Haselnüsse, Walnüsse, Eicheln, Pinienzapfen, ein wahrer Schatz fiel hier im Herbst aus dem orangefarbenen Laub zu Boden, der vor dem Winter auch wie ein solcher versteckt werden musste, damit sie auch für den Rest des Jahres genug zu essen hatten. Maman hatte keine Zeit, sich darum zu kümmern, denn sie war mit seinem kleinen Bruder Mulo und seiner kleinen Schwester Musa beschäftigt.
So trug Gouti also jeden Tag Früchte zusammen und vergrub sie, anschließend schaute er wieder auf das Meer und träumte. Und jeden Abend auf dem Heimweg zu ihrem großen Baum wurde ihm klar, dass er vergessen hatte, wo er die Nüsse vergraben hatte.
Unter einem großen Kieselstein? Zwischen den Wurzeln eines Baumes? In der Nähe einer Muschel?
Er konnte sich einfach nicht mehr erinnern!
Der arme Gouti traute sich jedoch nie, es seiner Mutter zu sagen.
So vergingen die Tage, einer wie der andere, und jeden Tag schämte Gouti sich mehr und wagte es noch weniger, seiner Mutter zu beichten, dass er für eine so verantwortungsvolle Arbeit zu zerstreut war.
Dann, eines Morgens, war der Winter da. Goutis gesamte Familie verließ ihren Ast, um sich unter dem Gespinst der Wurzeln zu verstecken. Es war ein sauberer Bau tief im Boden, den Goutis Großvater vor langer Zeit gegraben hatte. Aber da die Familie größer geworden war, reichte der Platz nicht mehr, um hier auch Vorräte zu lagern.
Sie schliefen sechs Monate lang, aber es war, als wäre nur eine Sekunde vergangen. Als sie aufwachten und nach oben kletterten, glaubten sie, auf der falschen Seite der Erde herausgekommen zu sein.
Es gab ihren großen Baum nicht mehr!
Keine Seeschwalbe und keinen Kauz mehr. Schlimmer noch, es gab auch keinen einzigen Haselnussstrauch, keinen Walnussbaum, keine Eiche und keine Pinie mehr. Keinen Wald!
Ein Sturm hatte im Winter alles entwurzelt.
Maman verstand es in jeder Situation, sich zu organisieren. Das Wichtigste ist, dass wir zu essen haben, sagte sie ruhig und bat Gouti, die Vorräte aus dem Sand auszugraben.
Da fing Gouti zu weinen an.
Der Strand war riesig. Ebenso gut konnte man eine Nadel im Heuhaufen suchen, sie würden alle verhungern, bevor er auch nur die kleinste Nuss gefunden hätte … und die Bäume am Rand dieses Strandes würden niemals wieder Früchte tragen, sie lagen alle mit zerbrochenen Ästen und den Wurzeln in der Luft im Sand.
Maman schimpfte nicht mit Gouti. Sie begnügte sich damit zu sagen: »Wir müssen weggehen, Kinder. Wir müssen einen anderen Ort finden, der uns ernährt.« Und sie bat Gouti, Musa, die noch klein war, auf seinem Rücken zu tragen, während sie seinen Großvater trug, der während der Sekunde, die ihr Winterschlaf gedauert hatte, um zwei Jahre gealtert zu sein schien.
Also unternahmen sie eine Weltreise, überquerten Ebenen und Flüsse, Berge und Wüsten. Überall naschten sie ein bisschen, in Kellern und auf Speichern, oben auf merkwürdigen Bäumen, die sie noch nie gesehen hatten, und am Grund endloser Höhlen, die unter dem Meer zu verlaufen schienen. Sie wurden mit dem Besen vertrieben, brachten Kinder in der Schule und alte Damen in der Kirche zum Kreischen, sie reisten in Lastwagen und Schiffen, einmal sogar in einem Flugzeug.
Und dann eines Tages, Monate oder vielleicht Jahre später, als sie noch ausgehungerter waren als sonst, sagte der Großvater mit dem weißen Schnurrbart, der seit Beginn der Reise kaum ein Wort gesprochen hatte: »Es ist Zeit, wieder nach Hause zu gehen.«
Maman fand das sicherlich töricht, aber da Großvater nie etwas sagte, musste man gehorchen, wenn er es doch einmal tat. So kehrten sie also nach Hause zurück. Sie waren traurig, denn sie erinnerten sich an die Bäume ihres Waldes, die im Sand lagen, an den riesigen Strand ohne ein einziges Blatt, um sich zu verstecken, an die leeren Muscheln und das morsche Holz. Eine schlimmere Wüste als die, die sie durchquert hatten!
Zuerst dachten sie, sie hätten sich im Strand geirrt.
Nur Großvater lächelte. Dabei tanzten seine weißen Schnurrbarthaare. Nun bat er die gesamte Familie, sich auf einen kleinen Sandhügel zu setzen, und begann zu erzählen: »Vor langer Zeit, als ich klein war, als ich so alt war wie Gouti, war ich bereits zerstreut und träumte davon, eine Weltreise zu machen. Wir waren arm und mager, es gab fast keine Bäume am Strand, keinen Wald, wir hatten fast nichts zu essen, und außerdem vergaß ich jedes Mal, wo ich die wenigen Haselnüsse im Boden versteckt hatte. Und dann wuchs eines Tages aus einer vergessenen Haselnuss, einer einzigen Haselnuss, ein Baum, und an seinen Zweigen reiften Hunderte Haselnüsse. Dann folgte ein weiterer Baum. Dann noch einer. Ein Wald. Der Wald, in dem ihr geboren seid …
Hier bei uns. Aber es vergeht kein Leben, ohne dass ein Sturm tobt und man wieder von vorne beginnen muss.«
Nun liefen sie weiter. Und dort, an dem verlassenen Strand, war da, wo Gouti Hunderte von Haselnüssen, Walnüssen und Eicheln vergraben und die Stellen vergessen hatte, der größte, dichteste und grünste Wald gewachsen, den man je am Meeresufer gesehen hatte. Goutis Maman nahm ihren Sohn fest in die Arme, während Mulo und Musa zwischen den Stämmen hindurchliefen und unter dem ruhigen Blick der Seeschwalbe und des Kauzes, die schon lange zurückgekehrt waren, vor Freude in ihre kleinen Pfötchen klatschten.
Goutis Großvater sagte, er sei nun sehr müde, er werde bald für eine Sekunde einschlafen, aber für eine Sekunde, die länger dauern würde als der Winter; zuvor hatte er Gouti jedoch noch eine letzte Sache mitzuteilen.
Er nahm ihn beiseite, und sie liefen, bis sie mit den Pfoten beinahe im Wasser standen und Gischt auf ihren Schnurrhaaren hatten, dann sprach er leise: »Siehst du, Gouti, die wahren Schätze sind nicht die, hinter denen man sein Leben lang herläuft, sie sind von jeher in unserer unmittelbaren Nähe verborgen. Wenn man sie eines Tages pflanzt, wenn man sie pflegt und jeden Abend gießt, selbst wenn man letztlich vergisst, warum, erblühen sie eines schönen Tages, wenn man gar nicht mehr damit gerechnet hat.«
***
Malone ließ Gouti jetzt sanft einschlafen. Sein Kuscheltier musste morgen wieder munter sein. Maman-da und Pa-di kamen in die Schule, um seine Lehrerin zu sehen. Er hatte ein bisschen Angst davor, was sie sagen würde.
Auch er musste schlafen, aber er hatte keine Lust, denn er wusste, dass die Alpträume wiederkommen würden. Er hörte bereits diesen Eisregen fallen, kalt, schimmernd, schneidend. Nicht einmal die Augen wollte er schließen.
Nicht etwa, weil er Angst vor der Dunkelheit hatte!
Wenn Malone die Augen schloss, sah er hinter seinen Lidern nur eine Farbe, als habe man alles mit einem einzigen Pinselstrich angemalt.
Eine Farbe.
Eine einzige.
Rot.
Überall.
DIENSTAG
Der Tag des Krieges
Kapitel 5
Die Aktentasche auf den Knien, wartete Vasile geduldig in der Halle. Polizisten hasteten an ihm vorüber. Wenn man die Uniformen und die abgewetzte Lederjacke des Psychologen außer Acht ließ, hätte man meinen können, er sei ein Patient, der in einem Krankenhausflur mit überlastetem Pflegepersonal ausharrte.
Endlich erschien Commandante Augresse. Sie bewegte sich langsamer als die anderen und ging in der Mitte des Flurs, wodurch alle gezwungen waren, an die Wand auszuweichen, wenn sie an ihr vorbeiwollten. Einem Kollegen, der ihr entgegenkam, rief sie zu:
»Papy, hast du schon mit dem Arzt gesprochen?«
Er blieb stehen. Alle Polizisten von Le Havre nannten ihn Papy, nicht nur, weil er in ein paar Monaten in Rente gehen würde und tatsächlich der Älteste auf dem Revier war, sondern vor allem, weil er schon mit gerade mal fünfzig Jahren sechs Enkel hatte, die über ganz Frankreich verstreut lebten. Mit rasiertem Schädel und dem graumelierten, feinen Bart, seinem treuen Dackelblick und dem durchtrainierten Körper eines ambitionierten Joggers hielten ihn die Dienstältesten der Brigade noch für jung, die anderen dagegen für alt.
»Er hat den ganzen Vormittag über Patienten«, antwortete der Lieutenant. »Er meldet sich, sobald er etwas Luft hat.«
»Und? Konnte er bestätigen, dass es Timo Soler war, den er gestern zusammengeflickt hat?«
»Ja. Er ist sich hundertprozentig sicher. Kurz nachdem man Soler in der Nähe der Apotheke gesichtet hatte, ist er zu ihm gegangen. Professor Larochelle hat ihn am Hafen im Schutz der Container am Kai verarztet.«
»Und vertraute sich anschließend der Polizei an? Na, immerhin hat er wohl kein Problem mit der ärztlichen Schweigepflicht …«
»Nein«, antwortete Papy mit einem Lächeln.
Marianne verscheuchte das Bild des verletzten Räubers und wandte sich Vasile zu.
»Kommen Sie, Monsieur? Auch ich schiebe Sie zwischen zwei Terminen ein. Und kann nicht versprechen, dass wir nicht durch einen Notfall gestört werden.«
Die Ruhe, die der Psychologe ausstrahlte, stand im scharfen Kontrast zum geschäftigen Treiben auf dem Revier. Ungerührt nahm er Platz, öffnete bedächtig seine Aktentasche, zog eine Mappe hervor und breitete Kinderzeichnungen vor der Kommissarin aus. Seine haselnussbraunen Augen hingegen schienen die Bilder in Lasergeschwindigkeit zu scannen. Sein osteuropäischer Akzent fiel ihr jetzt noch mehr auf als am Telefon.
»Das sind Zeichnungen von Malone. Ich habe ein ganzes Heft mit Anmerkungen und Kommentaren dazu. Ich bin dabei, sie in den Computer einzugeben, wenn Sie wollen, aber …«
Marianne nutzte die Gelegenheit, um ihn in Augenschein zu nehmen. Dieser Psychologe strotzte nur so vor Charme! Er war vielleicht etwas jünger als sie. Sie mochte schüchterne, zurückhaltende Männer, denen man ansah, dass sie für etwas leidenschaftlich brannten. Und sie mochte seinen osteuropäischen Charme beziehungsweise das, was sie sich darunter vorstellte: Menschen mit tragischen Schicksalen, die einem Tolstoi-Roman oder einem Tschechow-Stück entsprungen zu sein schienen.
»Entschuldigen Sie, Monsieur, könnten Sie noch mal ganz von vorne anfangen?«
»Ja, ja, verzeihen Sie. Der Junge, um den es geht, heißt Malone. Malone Moulin. Er ist in der Vorschule. In Manéglise, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wo …«
Mit einem einfachen kurzen Kopfnicken zum Stadtplan, der an der gegenüberliegenden Wand hing, hieß ihn die Kommissarin fortzufahren. Manéglise befand sich, von Feldern umgeben, rund zehn Kilometer von Le Havre entfernt. Ein kleines Dorf mit weniger als tausend Einwohnern.
»Die Schulkrankenschwester hatte mich auf ihn aufmerksam gemacht. Ihr zufolge waren die Erzählungen des Kleinen nicht stimmig. Vor drei Wochen habe ich ihn dann das erste Mal getroffen.«
»Und bei der Gelegenheit hat er Ihnen erzählt, dass seine Eltern nicht seine wahren Eltern sind?«
»So ist es. Er behauptet, sich an ein anderes, ein früheres Leben zu erinnern …«
»Und die Eltern streiten alles ab.«
»Ja.« Er sah auf die Uhr. »Übrigens, in diesem Moment haben sie ein Treffen mit der Schulleiterin.«
»Ohne Sie?«
»Sie wollten das Gespräch nicht in meiner Anwesenheit führen.«
»Die Eltern oder die Direktorin?«
»Eigentlich beide …«
»Sie gehen ihnen mit Ihrer Geschichte auf die Nerven, stimmt’s?«
Der Psychologe deutete ein betrübtes Lächeln an.
»Kann man es ihnen verdenken?«, seufzte Marianne. »Ehrlich gesagt, wenn nicht Angélique Sie zu mir geschickt hätte …«
Seine golden schimmernden Augen funkelten und wanderten von den Kinderzeichnungen zu der Commandante.
»Lassen Sie es mich Ihnen wenigstens erklären. Nur kurz diese Zeichnungen. Es dauert nicht lange …«
Marianne zögerte. Dieser Psychologe gab vor, schüchtern und unsicher zu sein, und war dabei wirklich unwiderstehlich. Sie musste Angie unbedingt fragen, wo sie ihn kennengelernt hatte.
»Okay, Monsieur Dragonman, Sie haben fünfzehn Minuten.«
Genau in dem Moment öffnete sich die Tür, und Papy vernichtete jeglichen Zauber der Situation.
»Wir haben den Arzt, live!«
»Ach du lieber Himmel! Stell ihn mir bitte auf meinen Apparat durch!«
»Ich tue sogar was noch viel Besseres«, entgegnete Papy. »Ich werde dir sein Gesicht auf deine Wand projizieren, drei mal drei Meter groß. Du hast es mit Professor Larochelle zu tun, Marianne, einer Koryphäe auf seinem Gebiet. Sein Büro ist mit dem allerletzten Schnickschnack in Sachen Videokonferenz ausgerüstet.«
Die Commandante bat Vasile Dragonman, kurz draußen zu warten, während ein zweiter Lieutenant eine Kamera und ein Mikro hereinbrachte.
»Na, zuerst müssen wir den ganzen Krempel hier mal entstauben«, meinte der Polizist, als er den Apparat vor der weißen Wand justierte.
Dann hockte er sich neben den Rollwagen. Er trug ein weißes T-Shirt und enge Jeans und mochte um die dreißig sein. Das Gesicht eines Engels und die Statur eines Bodybuilders, Turnschuhe und lässiges Outfit. Lieutenant Jean-Baptiste Lechevalier. Verheiratet. Zwei Kinder. Hingebungsvoller Ehemann und Superdaddy. Ein wahr gewordener Frauentraum.
»Beeil dich, Jibé!«, murrte Marianne.
»So, die Vorführung kann beginnen«, meinte Jibé, als er sich mit einem katzenartigen Hüftschwung wieder aufrichtete, und drückte auf die Fernbedienung. In der nächsten Sekunde verwandelte sich die weiße Wand des Kommissariats in eine Hightechkulisse. Alles im Büro des Arztes schien quadratisch oder rechteckig zu sein, angefangen bei dem Glasschreibtisch mit Designersesseln aus grauem Leder, über die Möbel aus exotischen Hölzern und den Plasmafernseher an der Wand bis hin zu dem riesigen Fenster, das den Raum mit Licht flutete. Im selben Moment erschien der Chirurg. Der weiße Kittel, den er lässig über seinem dreiteiligen Anzug trug, schien speziell auf sein bissiges Grinsen abgestimmt zu sein.
»Commandante Augresse? Es tut mir leid, ich habe nur kurz Zeit. Ich muss zu einer Frau, die bereits auf dem Tisch liegt und sich nach meiner Behandlung verzehrt!«
Er machte eine kleine Pause, als erwartete er Hintergrundgelächter, bevor er fortfuhr. »Ich muss ihr eine Leber transplantieren! Also, worauf warten wir? Sie wollten mich sprechen?«
»Sie haben gestern Timo Soler medizinisch versorgt?«
Der Chirurg führte ein Glas, in dem Eiswürfel klirrten, an die Lippen. Er nahm einen großen Schluck einer kupferfarbenen Flüssigkeit. Whisky? Red Bull?
»Heißt so der Räuber? Das habe ich doch schon alles Ihren Beamten gesagt. Ihr Flüchtiger hat mich gestern am späten Nachmittag angerufen. Ein Notfall. Er bat mich, zum Hafen zu kommen. Getroffen haben wir uns am Quai d’Osaka, wo man vor indiskreten Blicken geschützt ist. Er wartete in einem weißen Yaris auf mich. Das Kennzeichen habe ich mir selbstverständlich aufgeschrieben. Er hatte eine böse Wunde zwischen der Schlüsselbeinvene und dem oberen linken Lungenflügel, hervorgerufen durch eine 9-Millimeter-Kugel, die ihm vor ein paar Monaten oberflächlich entfernt wurde, ohne dass die Verletzung weiter versorgt worden wäre. In den letzten Tagen ist die Wunde dann, wie er mir erzählte, infolge eines unglücklichen Sturzes wieder aufgeplatzt. Er durchlitt Höllenqualen, und ich tat, was ich konnte.«
»Es ist Ihnen gelungen, ihn dort vor Ort zu operieren?«
»Natürlich nicht! Als ich sagte, ich habe getan, was ich konnte, meinte ich: Ich habe alles getan, um Ihnen zu helfen.«
»Uns zu helfen?«
»Ja. Ich wollte der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen! Sie hatten doch gemeldet, dass der Mann, den Sie schon seit Monaten suchen, sich hier aufhält. Das war doch das mindeste, was ich tun konnte, oder nicht?«
»Natürlich, Herr Professor! Was genau haben Sie denn getan, um uns zu helfen?«
»Ich habe ihm eine doppelte Dosis Nalbuphin injiziert, ein zweimal so starkes Analgetikum wie Morphium. Das hat ihn auf der Stelle ruhiggestellt und wird rund zehn Stunden seine Schmerzen lindern. Anschließend habe ich die Wunde untersucht, versorgt und wieder zugenäht. Rein äußerlich sieht es sehr gut gemacht aus.«
Der Professor näherte sich mit seinem Gesicht der Kamera.
»Aber im Inneren, Commandante, habe ich ganz schön herumgepfuscht. Ein kleiner Schnitt mit dem Skalpell mal hier und mal da. Wenn die Wirkung des Medikaments nachlässt, wird Timo Soler unerträgliche Schmerzen haben. Dann bleibt ihm keine andere Wahl, als mich erneut anzurufen … und dann erwarten Sie ihn mit der ganzen Kavallerie.«
Marianne schluckte hörbar, ehe sie antwortete.
»Natürlich, wir werden zur Stelle sein.«
Larochelle leerte sein Glas.
»Na wunderbar. Ich muss mich jetzt von Ihnen verabschieden und zu der hübschen Lady …«
Nach einem letzten, lauten Auflachen, das sich in der Stille verlor, verschwand urplötzlich die luxuriöse Umgebung, als ob sie nie existiert hätte. Einen Moment starrten die drei Polizisten die weiße Wand an.
»Ein echter Held«, sagte Papy schließlich mit einem schiefen Grinsen.
»Was würden die Ordnungskräfte nur ohne die Zivilcourage solcher Bürger machen?«, fügte Jibé hinzu.
»Okay«, sagte Marianne. »Trotzdem werden wir es uns nicht entgehen lassen, Timo Soler einzubuchten, wenn er auftaucht, um sich wieder behandeln zu lassen.«
»Du, Jibé, räum bitte deinen ganzen Krempel hier wieder weg.«
»Und Papy bleibt bitte in ständiger Verbindung mit unserem Dr. House.«
Dann wandte sie sich wieder den Kinderzeichnungen auf ihrem Schreibtisch zu. Sie griff wahllos eine aus dem Stapel: Vier ungelenke vertikale Striche in Schwarz und ein fünfter, krummer, diagonal verlaufender Strich, diesmal in Blau.
Gekritzel.
»Und jetzt«, fuhr Marianne fort, »lasst ihr mich fünfzehn Minuten mit diesem Psychologen allein, der mir erklären wird, wie das Gedächtnis eines kleinen Jungen funktioniert.«
Kapitel 6
Kleiner Zeiger auf der Zwölf, großer Zeiger auf der Eins
Die Klasse zerstreute sich, und Malone blieb allein zurück. Die eine Hälfte der Kinder stellte sich in einer lärmenden Zweierreihe auf, um in die Cafeteria zu gehen, die andere stürmte auf ihre Eltern zu. Hauptsächlich Mütter. Die Väter kamen eher am Morgen oder am Abend. Jedes Kind griff nach einer Hand, warf sich in ausgebreitete Arme oder klammerte sich an ein Bein. Nicht so Malone. Nicht heute.
»Du wartest brav hier. Es dauert bestimmt nicht lange.«
Clotilde, seine Lehrerin, hatte ihm warmherzig zugelächelt.
Und es stimmte, Malone musste nicht lange warten. Maman-da und Pa-di kamen gleich, nachdem die anderen Eltern gegangen waren. Es passierte selten, dass Maman-da zu spät dran war, aber für gewöhnlich kam sie allein, um ihn zum Mittagessen abzuholen, nie mit Pa-di.
Malone lief auf sie zu und ergriff ihre Hand. Er wusste Bescheid, denn sie hatten ihn am Morgen daran erinnert, dass sie heute Mittag nach dem Unterricht wegen der Geschichten, die er erzählte, zu einer Unterredung mit seiner Lehrerin kommen mussten. Er fand es komisch, das leere Klassenzimmer zu betreten, alle Spielsachen für sich allein zu haben.
»Monsieur und Madame Moulin? Bitte. Setzen Sie sich …«
Clotilde Bruyère deutete ein wenig verlegen auf die dreißig Zentimeter hohen Stühlchen, die einzigen, die im Klassenzimmer zur Verfügung standen. Auch die Elternabende fanden immer in diesem Raum statt, und normalerweise stellte das für die Erwachsenen kein Problem dar.
Normalerweise.
Bei einer Größe von einem Meter achtzig und mit hundertzehn Kilo wirkte Dimitri Moulin auf seinem Liliputanerstuhl wie ein Zirkuselefant, der auf einem Schemel hockte. Mit angezogenen Beinen reichten ihm die Knie fast bis ans Kinn.
Clotilde wandte sich an Malone.
»Lässt du uns kurz allein, mein Großer? Du kannst ein wenig im Hof spielen. Es dauert sicher nicht lange.«
Damit hatte Malone gerechnet. Aber es war ihm egal. Schließlich hatte er Gouti in der Puppenecke, gleich neben dem blauen Bett, deponiert. Niemandem würde sein Kuscheltier auffallen, und so konnte Gouti ihm später alles erzählen. Malone ging ins Freie und betrachtete voller Vorfreude die Rutsche und den Tunnel, Sachen, auf denen in den Pausen immer die größeren Kinder spielten und nie er. Sollte er die Gelegenheit nutzen und hinlaufen?
Andererseits war der Himmel pechschwarz, so als würde es gleich zu regnen anfangen. Und die Toiletten waren weit weg von der Rutsche und dem Tunnel, sehr weit weg, fast auf der anderen Seite vom Hof. Wenn plötzlich der Regen anfing, würde er es also nicht schnell genug schaffen, sich vor den gläsernen Tropfen in Sicherheit zu bringen.
In dem Moment hörte er Pa-di brüllen, obwohl die Klassentür geschlossen war. Armer Gouti, dachte Malone. Sein Kuscheltier hatte immer ein bisschen Angst, wenn Pa-di sich aufregte.
Dimitri Moulin hatte seine Beine auf dem Spielteppich für die kleinen Autos ausgestreckt. Nervös. Mit seinem Absatz trat er wahllos auf den aufgedruckten Häuschen, Gärten und Straßen herum.
»Madame Bruyère, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich habe anderes zu tun, als erneut zu Ihnen zu kommen! Ich habe gerade erst wieder einen Job gefunden. Und schon musste ich mit meinem Chef verhandeln, ob ich heute erst um dreizehn Uhr anfangen kann. Aber Ihnen ist so was natürlich egal, Ihr Gehalt kommt ja automatisch jeden Monat bis zur Rente, meins aber nicht.«
Die gute alte Leier von den Beamten, Clotilde nahm es gelassen hin. Sie war das gewohnt, genauso wie die Bemerkungen zu den vielen Urlaubswochen. Sie hatte sich in der Schule die untersten Klassen ausgesucht, weil sie sanft und geduldig war. Diese Eigenschaft half ihr auch, wütende Papabären zu besänftigen.
»Darum geht es hier nicht, Monsieur Moulin.«
»Okay, lassen Sie uns die Sache beschleunigen. Hier, ich habe alles mitgebracht. Sehen Sie, das ist doch sehr viel aussagekräftiger als das ganze Gerede.«
Aus seinem Rucksack, den er geschultert hatte, holte er ein paar kartonierte Umschläge.
»Die Geburtsurkunde! Das Familienbuch, abgestempelt von der Gemeinde und der Entbindungsstation. Fotoalben mit Bildern von dem Kleinen seit seiner Geburt. Sehen Sie sich alles in Ruhe an, und dann sagen Sie mir noch einmal, dass das nicht unser Kind sein soll!«
Amanda, die neben ihm saß, schwieg. Ihre Augen waren auf die Puppenecke gerichtet. Malone hatte sein Kuscheltier auf einem Hochstuhl liegen lassen. Gouti fixierte sie alle, als wolle er sich keine Silbe des Gesprächs entgehen lassen. »Monsieur Moulin, wir haben doch nie in Frage gestellt, dass Malone ihr Kind ist. Es geht einfach nur darum, …«
»Wir lassen uns nicht für dumm verkaufen!«, unterbrach sie Dimitri Moulin. »Wir haben die Anspielungen dieses Psychologen sehr wohl verstanden. Vasile irgendwer … Und Ihre Notiz im Heft meines Kindes natürlich auch.«
Clotilde hielt sich an ihre Strategie und blieb sanft und geduldig. Letztlich konnte es auch nicht schwieriger sein, Vater Moulin zu besänftigen, als die beiden Hitzköpfe der Klasse, Kylian und Noah.
»Monsieur Moulin, ich habe Ihnen beiden geschrieben und um dieses Treffen gebeten, weil Ihr Sohn Äußerungen von sich gibt, die für sein Alter ganz erstaunlich sind, vor allem, als er sich dem Schulpsychologen anvertraut hat. Ich wollte lediglich, dass wir uns treffen, damit Sie mir ein paar ergänzende Angaben liefern.«
»Sie reden wie eine von der Polizei!«
Clotilde kam ein wenig näher, hockte sich auf Augenhöhe vor Dimitri Moulin. Sie war es gewohnt, den lieben langen Tag auf achtzig Zentimetern Höhe zu leben. Die ein Meter achtzig dieses Dickhäuters bescherten ihm in ihrer Klasse keinen Vorteil. Ganz im Gegenteil.
Jetzt warf sie Moulin einen vernichtenden Blick zu.
»Wir beruhigen uns jetzt, in Ordnung? Niemand hat von Polizei gesprochen. Wir sind hier in einer Schule. In meiner Schule! Also werden wir jetzt im Interesse Ihres Kindes in Ruhe miteinander reden.«
Für einen Moment sah es so aus, als wolle sich Dimitri Moulin von seinem Zwergenstühlchen erheben, doch seine Frau legte beschwichtigend die Hand auf seinen Oberschenkel. Herausfordernd fixierte er die Lehrerin.
»Einverstanden … alles in allem scheinen Sie eine gute Lehrerin zu sein. Aber der Psychologe gefällt mir nicht.« Er legte eine kurze Pause ein. »Können die Eltern es denn nicht untersagen, dass ihr Kind zu einem Psychologen geht?«
Clotildes Antwort ließ etwas zu lange auf sich warten.
»Das ist kompliziert, alles hängt davon ab, warum er …«
»Aber das ist mir doch völlig egal«, fiel er ihr erneut ins Wort. Dennoch schien er sich beruhigt zu haben. »Und letztlich«, fuhr Dimitri Moulin fort, »sehe ich ja selbst, dass irgendwas mit unserem Kind nicht in Ordnung ist. Er spricht nicht sehr viel oder mit zu komplizierten Worten und hat zu viel Phantasie. Wenn es ihm also guttut, mit jemandem darüber zu reden, umso besser. Ich meine, mit einem Erwachsenen. Aber dieser Vasile Dragonski … Haben Sie niemand anderen? Jemand, der mehr …«
»Mehr was?«
»Sie verstehen schon, was ich sagen will.« Er lachte schallend. »Der französischer ist, aber das darf ich wohl nicht sagen, was?«
Er beugte sich vor und breitete die Fotoalben zu ihren Füßen aus, schob dafür die kleinen Autos beiseite und bedeckte einen Großteil der auf den Teppich gemalten Stadt.
»Machen wir weiter, damit wir nicht umsonst gekommen sind. Sehen Sie sich alles in Ruhe an. Und danach verschwinden wir.«
Clotilde wandte ihren Blick von den Dokumenten ab.
»Ich bin nicht Vasile Dragonmans Vorgesetzte. Er untersteht der Schulaufsichtsbehörde. Ich versuche heute zu vermitteln. Wir unterhalten uns, und dann werde ich ihm meine Schlussfolgerungen mitteilen. Auf jeden Fall wäre es wichtig, dass Sie sich noch einmal mit ihm treffen. Möglichst bald.«
Dimitri Moulin wirkte nachdenklich, und zum ersten Mal ergriff seine Frau das Wort.
»Wollen Sie damit sagen, dass der Psychologe an Ihnen vorbei eine Meldung machen kann?«
»Ja«, antwortete Clotilde. »Wenn er das Kindeswohl gefährdet sieht, kann er darüber zunächst mit dem Jugendamt sprechen, das einen Sozialarbeiter bestimmen wird …«
»Zunächst!«, brüllte Dimitri aufgebracht. »Und was kommt dann?«
Behutsam stellte Clotilde ein kleines Feuerwehrauto beiseite, das unter Moulins schwere Schuhe zu geraten drohte. Dann sagte sie mit ihrer zarten Stimme:
»Dann wird die Polizei eingeschaltet.«
»Die Polizei? Soll das ein Scherz sein, oder was?«
Clotilde brachte ein zweites Auto in Sicherheit. Sie hatte wieder die Oberhand.
»Ich habe nicht gesagt, dass ich es tun werde«, erklärte sie mit einem besänftigenden Lächeln. »Ich sehe ja, dass Malone ein bezaubernder kleiner Junge ist, der sich vollkommen normal entwickelt und um den Sie sich ganz wunderbar kümmern. Und außerdem habe ich, ganz unter uns gesagt, nicht die geringste Lust, dass die Polizei hier Ermittlungen durchführt und die Kinder und Eltern meiner Klasse befragt.« Noch immer in der Hocke, beugte sie sich weiter vor, bis sie Aug in Aug vor ihm saß – ihre bevorzugte Position, um sich bei aufrührerischen Dreikäsehochs Respekt zu verschaffen. »In einem kleinen Ort wie Manéglise will so etwas doch niemand, nicht wahr, Monsieur Moulin? Also unterhalten wir uns jetzt in aller Ruhe, und Sie versuchen mir zu sagen, warum dieser kleine Teufel behauptet, Sie seien nicht seine Eltern.«
Dimitri Moulin wollte gerade etwas sagen, aber Amanda ließ ihn nicht zu Wort kommen.
»Sei jetzt endlich still, Dimitri«, sagte sie fast flehentlich. »Sei still und lass mich reden.«
***
Draußen fiel ein erster Tropfen auf die Rutsche und glitt hinunter in den Sand.
Dann ein zweiter und ein dritter.
Einer gefährlicher als der andere.
Malone hatte Glück gehabt. Keiner hatte ihn getroffen.
Noch nicht.
Er warf einen letzten Blick hinüber zum Fenster seiner Klasse. Alle ihre Zeichnungen hingen dort, auch die Abdrücke von ihren Händen, die sie erst in Farbe getaucht und dann auf ein Blatt Papier gepresst hatten.
Seiner war knallrot.
Hinter den Fensterscheiben sprachen sie jetzt sicher über ihn. Und vielleicht von Maman, nicht von Maman-da, sondern von seiner früheren Mutter. Vielleicht redeten sie auch über die Piraten, über die Raketen und die Menschenfresser. Die Erwachsenen wussten über all das Bescheid. Er aber erinnerte sich nur dank Gouti an all diese Dinge.
Wieder ein Tropfen, diesmal auf seinen Turnschuh.
Gerade noch mal davongekommen. Malone rannte los.
Nur noch zwanzig Meter bis zur Toilettentür.
Er musste sich beeilen, sie aufmachen und sich einschließen, so wie Maman es ihm beigebracht hatte.
Kapitel 7
Vasile Dragonman breitete die Zeichnungen vor Marianne aus und deutete auf das erste, fast weiße Blatt, über das sich nur vier schwarze, vertikale Striche und eine rote Zickzacklinie zogen.
»Sehen Sie sich vor allem die Linien genau an …«
Genervt schob Marianne die Papiere zur Seite. »Nein, Monsieur Dragonman! Wir werden ganz von vorne anfangen. Wer ist dieses Kind? Wer sind seine Eltern?«
Vasile nagte an seiner Unterlippe.
»Die Eltern? Normal. Durchschnitt. Da gibt es nichts Spezielles zu erwähnen. Die Mutter, Amanda Moulin, wird Anfang dreißig sein, sieht aber zehn Jahre älter aus. Der Vater hingegen ist schon über vierzig. Sie sind seit Jahren verheiratet und wohnen in einem kleinen Reihenhäuschen in Manéglise. Sie arbeitet als Kassiererin in dem winzigen Dorfsupermarkt, er ist Elektriker oder so etwas Ähnliches und kämpft, glaube ich, um eine unbefristete Festanstellung. Man kennt ihn im Dorf, weil er die Fußballjugend trainiert.«
»Haben Sie sie mal getroffen?«
»Ja, einmal, ganz am Anfang. Aber zu diesem Zeitpunkt habe ich mir noch nicht so viele Fragen gestellt.« Es schien fast so, als wolle Vasile sich entschuldigen, als wäre es ihm unangenehm, eine unbescholtene Familie derart zu verdächtigen. Das machte ihn nur noch sympathischer.
»Gut, Monsieur Dragonman. Kommen wir wieder zu dem Jungen. Erklären Sie mir diese Zeichnungen.«
»Wie ich schon am Telefon sagte, behauptet Malone, ein anderes Leben vor dem gehabt zu haben, das er heute führt. Nicht in seinem Kinderzimmer in dem Reihenhäuschen von