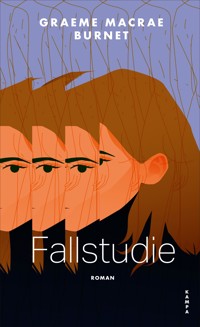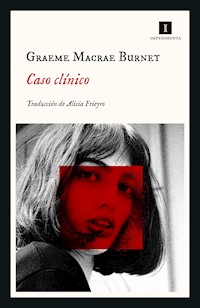Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Keine Frage: Manfred Baumann ist ein Sonderling. Obwohl als Bankdirektor der elsässischen Gemeinde Saint-Louis in guter Stellung, tut sich der 36-Jährige schwer im Umgang mit Menschen. Umso wichtiger sind für den eigenbrötlerischen Junggesellen seine gewohnten Routinen: ein penibel geplanter Tagesablauf, die regelmäßigen Ausflüge nach Straßburg zu den leichten Mädchen von Madame Simone und die Besuche in seinem Stammlokal. Tag für Tag beobachtet er dort, meist schweigend, die blutjunge Kellnerin Adèle Bedeau. Bis sie eines Abends spurlos verschwindet. Manfreds Welt gerät ins Wanken, als Kommissar Georges Gorski die Ermittlungen im Fall Adèle Bedeau aufnimmt … Wird Gorski, der noch immer schwer an einem lang zurückliegenden Ermittlungsfehler zu tragen hat, diesmal den richtigen Riecher haben und das plötzliche Verschwinden von Adèle aufklären, die wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint? Und was hat Manfred mit dem Fall zu tun, der auf einmal mit vergessen geglaubten Geistern seiner Vergangenheit kämpft? Nach seinem Bestseller "Sein blutiges Projekt" zeichnet Shootingstar Graeme Macrae Burnet erneut das Psychogramm eines Außenseiters, der von seinem eigenen Wahn an den Rand der Verzweiflung getrieben wird. In seiner schottischen Heimat wurde der Roman zum Kulthit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DasVerschwindenderAdèle Bedeau
von Raymond Brunet
Übersetzt und mit einem Nachwort versehenvon Graeme Macrae Burnet
Die englischsprachige Originalausgabe ist 2014 unter dem TitelThe Disappearance of Adè Bleedeau bei Contraband, einem Imprint von Saraband,Glasgow, Schottland, erschienen.
AUS DEM ENGLISCHEN VON CLAUDIA FELDMANN
1. eBook-Ausgabe 2018
© 2014 by Graeme Macrae Burnet
© der deutschsprachigen Ausgabe 2017
Europa Verlag GmbH & Co. KG, München
Umschlaggestaltung und Motiv: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung eines Fotos von © Anja Weber-Decker/Getty Images
Übersetzung: Claudia Feldmann
Layout und Satz: BuchHaus Robert Gigler, München
Konvertierung: Bookwire GmbH
ePub-ISBN: 978-3-95890-170-4
ePDF-ISBN: 978-3-95890-171-1
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
INHALT
Das Verschwinden der Adèle Bedeau
Nachwort des Übersetzers
Danksagung
1
Es war ein Abend wie jeder andere im Restaurant de la Cloche. Hinter dem Tresen hatte sich Pasteur, der Besitzer, einen Pastis eingeschenkt – das Zeichen, dass die Küche nun geschlossen war und alle weiteren Tätigkeiten von seiner Frau Marie und der Kellnerin Adèle übernommen wurden. Es war neun Uhr.
Manfred Baumann stand an seinem Stammplatz an der Bar. Lemerre, Petit und Cloutier saßen um den Tisch bei der Tür, die Tageszeitung als unordentlicher Haufen zwischen ihnen. Außerdem befanden sich eine Karaffe Rotwein, drei Gläser, zwei Päckchen Zigaretten, ein Aschenbecher und Lemerres Lesebrille auf dem Tisch. Bis zum Ende des Abends würden sie zusammen drei Karaffen leeren. Pasteur schlug seine Zeitung auf dem Tresen auf und beugte sich, auf die Ellbogen gestützt, darüber. Auf seinem Kopf bildete sich eine kahle Stelle, die er zu verbergen suchte, indem er die Haare nach hinten kämmte. Marie war damit beschäftigt, das Besteck einzusortieren.
Adèle brachte den beiden letzten Speisegästen einen Kaffee und wischte die Wachsdecken der anderen Tische ab. Die Krümel ließ sie dabei auf den Boden fallen, da sie später fegen würde. Manfred beobachtete sie. Er stand nicht direkt an der Bar, sondern an der Schwingtür, durch die das Essen von der Küche hereingebracht wurde. Er musste ständig ausweichen, damit die Bedienung an ihm vorbeikam, aber niemand bat ihn je, sich anderswo hinzustellen. Von seinem Platz aus konnte er das ganze Restaurant überblicken, und Fremde hielten ihn oft für den Besitzer.
Adèle trug einen kurzen schwarzen Rock und eine weiße Bluse. Um die Taille hatte sie eine kleine Schürze mit einer Tasche gebunden, in der sie ihren Notizblock aufbewahrte, um die Bestellungen aufzunehmen, und den Lappen, mit dem sie die Tische abwischte. Sie war dunkelhaarig und stämmig, mit ausladendem Hintern und großen, schweren Brüsten. Sie hatte üppige Lippen, olivfarbene Haut und braune Augen, deren Blick sie meist auf den Boden gerichtet hielt. Ihre Gesichtszüge waren zu schwer, um sie als hübsch zu bezeichnen, aber sie besaß eine erdige Anziehungskraft, die zweifellos durch die triste Umgebung um sie herum verstärkt wurde.
Als sie sich über die unbesetzten Tische beugte, drehte Manfred sich zum Tresen und beobachtete im Spiegel, der über der Bar hing, wie ihr Rock an den Oberschenkeln hinaufrutschte. Sie trug hautfarbene Nylons, darüber weiße Söckchen und schwarze Pumps. Die drei Männer am Tisch neben der Tür beobachteten sie ebenfalls, und Manfred nahm an, dass sie ähnliche Gedanken hegten wie er.
Adèle war neunzehn Jahre alt und arbeitete seit fünf oder sechs Monaten im Restaurant de la Cloche. Sie lächelte nie und sprach nur das Nötigste mit den Gästen, dennoch war Manfred sicher, dass sie deren Aufmerksamkeit genoss. Sie ließ stets die obersten Knöpfe ihrer Bluse offen, sodass man oft die Spitze ihres BHs sehen konnte. Wenn sie nicht angestarrt werden wollte, warum zog sie sich dann so aufreizend an?
Trotzdem wandte Manfred den Blick ab, als sie sich zur Bar umdrehte.
Pasteur war in einen Artikel im Mittelteil des L’Alsace vertieft. Es gab eine Krise im Libanon.
»Diese verfluchten Araber«, sagte Manfred.
Pasteur stieß nur ein kurzes Schnauben aus. Er hielt nichts von politischen Debatten an der Bar. Seine Aufgaben beschränkten sich darauf, Getränke auszuschenken und die Rechnungen einzutippen. Am Tisch zu bedienen, betrachtete er als unter seiner Würde. Diese Tätigkeiten sowie den Austausch von Freundlichkeiten überließ er Marie und Adèle oder den Aushilfen, die gelegentlich einsprangen. Manfred interessierte sich gar nicht sonderlich für die Lage im Nahen Osten; er hatte die Bemerkung nur gemacht, weil er annahm, dass sie Pasteur ebenfalls auf der Zunge gelegen hatte oder zumindest seine Zustimmung finden würde. Pasteurs Mundfaulheit kam Manfred durchaus gelegen. Die seltenen Male, wenn er etwas von sich gab, ging es meist daneben, und so war er froh, dass er sich nicht verpflichtet fühlen musste, ein Gespräch zu führen.
Am Tisch neben der Tür ließ sich Lemerre, ein Herrenfriseur, dessen Salon nicht weit vom Restaurant entfernt war, gerade über die Melkzyklen von Milchkühen aus. Er erklärte wortreich, dass der Ertrag ganz einfach gesteigert werden könne, indem man die Tiere in kürzeren Abständen melke. Cloutier, der auf einem Bauernhof aufgewachsen war, versuchte einzuwenden, dass ein solcher Gewinn unterm Strich mit dem früheren Tod der Kühe bezahlt werde, doch Lemerre schüttelte energisch den Kopf und schnitt seinem Gefährten mit einer Handbewegung das Wort ab.
»Ein weitverbreiteter Irrtum«, sagte er und fuhr mit seinem Vortrag fort. Cloutier starrte auf den Tisch und drehte sein Glas zwischen den Fingern. Lemerre war ein korpulenter Mann von Anfang fünfzig. Er trug einen bordeauxroten Pullover mit V-Ausschnitt und darunter ein schwarzes Polohemd. Die Hose hing unter seinem dicken Bauch, gehalten von einem schmalen Ledergürtel. Seine tiefschwarzen Haare, die, wie Manfred vermutete, gefärbt waren, hatte er nach hinten gekämmt, sodass die ausgeprägten Geheimratsecken zu sehen waren. Petit und Cloutier waren beide verheiratet, aber sie erwähnten ihre Frauen nur selten, und wenn, dann stets auf abwertende Art und Weise. Lemerre hatte nie geheiratet. »Ich halte nichts davon, Tiere im Haus zu halten«, lautete sein üblicher Kommentar dazu.
Von außen betrachtet, war das Restaurant de la Cloche in Saint-Louis wenig ansprechend. Der blassgelbe Anstrich war fleckig und an mehreren Stellen abgeplatzt. Das Schild über dem Fenster hatte nichts Verlockendes, aber die zentrale Lage machte Werbung überflüssig. Das Restaurant lag an einer Ecke des Platzes, auf dem der Wochenmarkt der Stadt abgehalten wurde. Neben dem Eingang hing eine Tafel, auf der das Tagesmenü geschrieben stand, und darüber befand sich ein kleiner Balkon mit einem kunstvoll geschmiedeten Eisengitter. Der Balkon gehörte zu der Wohnung von Pasteur und seiner Frau. Innen war das Restaurant überraschend geräumig, aber schlicht eingerichtet. Zwei breite Säulen unterteilten den Raum und trennten den Speisebereich rechts der Tür formlos von den Tischen am Fenster, wo die Einheimischen sich tagsüber auf ein schnelles Glas Wein oder Bier niederließen oder den Abend damit zubrachten, etwas zu trinken und sich über den Inhalt der Tageszeitung auszutauschen. Der Speisebereich umfasste etwa fünfzehn wackelige Tische, die mit bunten Wachsdecken, Besteck und Wassergläsern eingedeckt waren. An der Wand hinter dem Tresen hing, halb verdeckt von einem Glasregal mit Likörflaschen, ein großer Spiegel mit einer Werbung für elsässisches Bier, deren Art-déco-Schrift an einigen Stellen so abgeblättert war, dass man sie kaum noch lesen konnte. Dieser Spiegel sorgte dafür, dass der Raum größer wirkte, als er tatsächlich war. Außerdem gab er dem Restaurant einen Hauch verblichener Grandeur. Marie murrte oft, er sehe schäbig aus, doch Pasteur beharrte darauf, dass er dem Ganzen Charme verlieh. »Wir sind schließlich kein Pariser Bistro«, lautete seine Standarderwiderung auf jeden Verschönerungsvorschlag. Rechts neben dem Tresen waren die Türen zu den Toiletten, flankiert von zwei massigen dunklen Anrichten, in denen Geschirr, Gläser und Besteck aufbewahrt wurden. Die Anrichten standen bereits seit ewigen Zeiten dort; auf jeden Fall hatten sie, schon lange bevor Pasteur das Restaurant übernommen hatte, zur Einrichtung gehört.
Manfred Baumann war sechsunddreißig Jahre alt. An diesem Abend trug er, wie an jedem anderen Abend auch, einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und eine Krawatte, die er am Hals etwas gelockert hatte. Sein dunkles Haar war ordentlich geschnitten und zum Seitenscheitel gekämmt. Er war ein gut aussehender Mann, aber seine Augen huschten nervös umher, als versuche er, jeden Blickkontakt zu vermeiden. Infolgedessen fühlten sich die Leute in seiner Gesellschaft oft unwohl, was wiederum seine Unsicherheit verstärkte. Einmal im Monat, am Mittwochnachmittag, wenn die Bank geschlossen hatte, ging Manfred zu Lemerre, um sich die Haare schneiden zu lassen. Jedes Mal fragte Lemerre, wie er es haben wolle, und jedes Mal antwortete Manfred: »Wie immer.« Während er Manfred die Haare schnitt, plauderte Lemerre über das Wetter oder unverfängliche Nachrichten aus der Zeitung, und wenn Manfred ging, verabschiedete er sich stets mit den Worten: »Bis Donnerstag.«
Doch keine drei Stunden später saß Lemerre mit Petit und Cloutier an seinem Tisch im Restaurant de la Cloche, und Manfred stand an seinem Stammplatz am Tresen. Sie begrüßten einander aber nur mit einem knappen Nicken, als wären sie Fremde, deren Blicke sich zufällig kreuzten. Donnerstags jedoch war Manfred eingeladen, mit den drei anderen Männern Bridge zu spielen. Manfred mochte Kartenspiele nicht besonders, und die Atmosphäre war immer angespannt. Er hatte den Eindruck, dass seine Anwesenheit am Tisch den anderen unangenehm war, doch wenn er die Einladung ablehnte, würde er sie damit vor den Kopf stoßen. Die Tradition hatte drei Jahre zuvor begonnen, nach dem Tod von Le Fèvre. Am Donnerstag nach der Beerdigung fehlte den dreien der vierte Mann, und so hatten sie Manfred gefragt, ob er mitspielen wolle. Ihm war klar, dass er lediglich die Lücke füllte, die durch den Tod ihres Freundes entstanden war, und Lemerres Abschiedsgruß »Bis Donnerstag« machte deutlich, dass die Einladung sich nicht auf die übrigen Abende bezog.
Manfred bestellte sein letztes Glas Wein für den Abend. Hinter dem Tresen stand eine Flasche für ihn, und Pasteur schenkte den Rest in ein frisches Glas und stellte es ihm hin. Manfred trank immer die ganze Flasche, aber er bestellte glasweise. Dieses Arrangement bedeutete, dass er für seinen Wein doppelt so viel bezahlte, als wenn er einfach eine Flasche bestellte, aber aus Gewohnheit tat er es nie. Einmal hatte er ausgerechnet, wie viel er im Lauf eines Jahres sparen würde, wenn er seine Vorgehensweise änderte. Es war eine beträchtliche Summe gewesen, aber er war dennoch bei seiner Gewohnheit geblieben. Er sagte sich, dass es ordinär wäre, allein mit einer Flasche Wein an der Bar zu stehen. Das sähe so aus, als käme er mit der Absicht, sich zu betrinken, obgleich das die anderen Stammgäste des Restaurants gewiss nicht kümmern würde. Andererseits hatte Manfred das Gefühl, dass diese Gewohnheit möglicherweise dazu beitrug, Lemerre und seine Freunde gegen ihn einzunehmen, als würde er sich dadurch, dass er glasweise bestellte, über die drei Männer erheben, die sich Karaffen bringen ließen. Es vermittelte den Eindruck, als hielte er sich für etwas Besseres. Was er auch tat.
Pasteur kommentierte Manfreds Trinkgewohnheiten nie. Warum sollte er auch? Ihm war es egal, wenn Manfred doppelt so viel für seinen Wein bezahlen wollte.
Als die Zeiger der Uhr auf zehn vorrückten, wurden Adèles Bewegungen auf einmal munterer. Sie lief beinahe schwungvoll um die Tische herum und scherzte sogar mit den Männern neben der Tür. Lemerre machte eine Bemerkung, die offenbar zweideutig war, denn Adèle erhob mit gespielter Strenge den Zeigefinger, dann drehte sie sich um und ging mit schwingenden Hüften zurück zur Bar. Manfred hatte sie noch nie zuvor so kokett erlebt, dennoch senkte sie den Blick, als er zur Seite trat, damit sie durch die Schwingtür gehen konnte. Sie verschwand in der Küche und kam ein paar Minuten später wieder heraus. Sie trug noch denselben Rock wie zuvor, jetzt aber mit schwarzen Nylons und hochhackigen Schuhen, und die weiße Bluse hatte sie gegen ein enges schwarzes Top und eine Jeansjacke getauscht. Außerdem war sie mit Wimperntusche und Lippenstift geschminkt. Sie verabschiedete sich von Pasteur. Er sah hinauf zur Uhr und nickte ihr mürrisch zu. Adèle schien nicht zu bemerken, was ihre Verwandlung bei den verbliebenen Gästen auslöste, und verließ das Restaurant, ohne nach rechts oder links zu schauen.
Manfred trank seinen letzten Schluck Wein und legte das Geld auf den Zinnteller mit der Rechnung, die Pasteur ihm kurz zuvor hingestellt hatte. Er sorgte stets dafür, dass er den Betrag passend dabeihatte. Wenn er mit einem größeren Schein bezahlen würde, müsste er warten, während Pasteur in seiner Börse nach dem Wechselgeld kramte, und ihm dann demonstrativ ein Trinkgeld geben.
Manfred zog seinen Mantel an, der am Garderobenständer neben der Toilettentür gehangen hatte, und ging, wobei er Lemerre und seinen Kumpanen kurz zunickte. Es war Anfang September, und eine erste herbstliche Kühle hing in der Luft. Die Straßen von Saint-Louis lagen verlassen da. Als er in die Rue de Mulhouse einbog, erblickte er Adèle etwa hundert Meter vor ihm. Sie ging langsam, und Manfred merkte, dass sich der Abstand zwischen ihnen verringerte. Er konnte ihre Absätze auf dem Pflaster klackern hören. Er verlangsamte seinen Schritt – schließlich konnte er ja nicht ohne irgendeinen Gruß an ihr vorbeigehen, und daraus würde sich womöglich ein Gespräch ergeben, bei dem er sich zweifellos unbeholfen anstellen würde. Vielleicht würde Adèle denken, dass er ihr gefolgt war. Oder vielleicht war ihr kokettes Verhalten im Restaurant in Wirklichkeit auf ihn gemünzt gewesen, und sie war absichtlich in diese Richtung gegangen, um eine Begegnung zu provozieren.
Doch ganz egal, wie langsam er ging, der Abstand zwischen ihnen verringerte sich weiter. Je näher er kam, desto langsamer schien Adèle zu werden. Schließlich blieb sie stehen, stützte sich mit der Hand an einem Laternenpfahl ab und zog den Knöchelriemen ihres Schuhs zurecht. Manfred war nur noch etwa zwanzig Meter hinter ihr. Er bückte sich und tat so, als müsse er seinen Schnürsenkel neu binden. Dabei hielt er den Kopf über sein Knie gesenkt und hoffte, dass Adèle ihn nicht erkennen würde. Er hörte, wie das Klackern ihrer Absätze leiser wurde. Als er aufblickte, war sie nicht mehr zu sehen. Entweder war sie abgebogen oder in einem der Häuser verschwunden.
Er ging in seinem normalen Tempo weiter. Als er auf den kleinen Park vor der protestantischen Kirche zuging, sah er Adèle an der halbhohen Mauer stehen, die den Park vom Gehweg trennte. Sie rauchte eine Zigarette und schien auf jemanden zu warten. Als Manfred sie erblickte, war es für eine Flucht zu spät. Er erwog, die Straßenseite zu wechseln, weil dann ein kurzes Winken als Gruß genügen würde, doch Adèle hatte ihn bereits bemerkt und sah ihm entgegen. Er war nicht betrunken, aber unter ihrem forschenden Blick fühlte er sich plötzlich unsicher auf den Beinen. Ihm kam der Gedanke, dass sie womöglich auf ihn wartete, tat dies jedoch sofort als unsinnig ab.
»Guten Abend, Adèle«, sagte er, als er nur noch wenige Meter entfernt war. Dann blieb er stehen, nicht, weil er es wollte, sondern weil es unhöflich gewesen wäre, einfach an ihr vorbeizugehen, als wäre sie nur eine einfache Kellnerin und es nicht wert, ein paar Worte an sie zu richten.
»Guten Abend, Manfred«, erwiderte sie.
Bis zu dem Moment hatte er nicht einmal gewusst, dass sie seinen Vornamen kannte. Und dass sie ihn benutzte, suggerierte eine gewisse Vertrautheit zwischen ihnen. Im Restaurant hatte sie ihn stets nur mit Monsieur Baumann angesprochen. Hatte ihre Stimme nicht sogar ein wenig kokett geklungen?
»Es ist kühl«, sagte Manfred, da ihm nichts anderes einfiel.
»Ja«, stimmte Adèle zu. Mit ihrer freien Hand zog sie ihre Jacke über der Brust zusammen, entweder als Bestätigung seiner Bemerkung oder um ihr Dekolleté zu verbergen.
Beide schwiegen. »Nachts ist es immer kühler, wenn der Himmel klar ist«, fuhr Manfred fort. »Die Wolken sind wie eine Isolierung. Sie halten die Wärme fest, wie eine Bettdecke.«
Adèle sah ihn einen Moment an, dann nickte sie langsam. Sie blies einen Rauchring in die Luft. Manfred bereute, dass er das mit dem Bett gesagt hatte. Er spürte, wie ihm die Röte in die Wangen stieg.
»Warten Sie auf jemanden?«, fragte er, als klar wurde, dass sie nichts weiter sagen würde. Es ging ihn nichts an, was sie tat, aber ihm fiel wiederum nichts anderes ein. Und was, wenn sie erwiderte, dass sie nicht auf jemanden wartete? Was sollte er dann tun? Sie in seine Wohnung einladen oder in eine der Bars in der Stadt, die lange aufhatten und die er nicht kannte?
Bevor sie antworten konnte, kam zu Manfreds Erleichterung ein junger Mann mit einem Roller angefahren und hielt neben ihnen. Er nickte Manfred kurz zu. Manfred erwiderte den Gruß und verabschiedete sich von Adèle.
»Gute Nacht, Monsieur«, erwiderte sie.
Im Weitergehen warf Manfred verstohlen einen Blick über die Schulter und sah, wie Adèle sich auf den Roller schwang. Er stellte sich vor, wie der junge Mann sie fragte, wer er war. Ein Typ aus dem Restaurant, würde sie wahrscheinlich sagen.
Manfred wohnte zehn Minuten Fußweg entfernt, im obersten Stock eines Mietshauses aus den 1960er-Jahren, das ein wenig zurückgesetzt an der Rue de Mulhouse lag. Seine Wohnung bestand aus einer kleinen Küche, einem Schlafzimmer, einem Wohnzimmer, das er kaum benutzte, und einem Duschbad. Von der Küche aus blickte man auf einen kleinen Park, der von weiteren ähnlichen Mietshäusern umgeben war. Es gab Bänke für die Anwohner und einen Kinderspielplatz. An der Küche war ein schmaler Balkon, aber Manfred saß nur selten dort draußen, weil er fürchtete, die anderen Bewohner könnten denken, er hege ein ungesundes Interesse an dem Spielplatz. Die Leute dachten oft schlecht von alleinstehenden Männern in den Dreißigern, vor allem wenn sie zurückgezogen lebten. Manfreds Wohnung war stets sorgfältig aufgeräumt und geputzt.
Zu Hause angekommen, schenkte Manfred sich noch einen Absacker aus der Flasche in der Küche ein und kippte ihn hinunter. Er schenkte sich noch einmal nach und nahm das Glas mit ins Schlafzimmer. Er griff nach dem Buch auf dem Nachttisch, schlug es jedoch nicht auf.
Die Begegnung mit Adèle hatte ihn aufgewühlt, ja sogar erregt. Es war nicht nur die Tatsache, dass sie ihn mit seinem Vornamen angesprochen hatte, sondern vor allem, dass sie nach der Ankunft des jungen Mannes wieder zu »Monsieur« gewechselt hatte, als sei ihr daran gelegen gewesen, den Eindruck zu erwecken, dass zwischen ihnen nichts war. Manfred hatte nie angenommen, dass irgendetwas zwischen ihnen war, aber sie hätte sich leicht von ihm verabschieden können, ohne ihn auf die eine oder die andere Weise anzusprechen. Sie hatte es bewusst getan, um den intimen Augenblick, den sie mit ihm erlebt hatte, vor ihrem Freund zu verbergen.
Manfred rief sich das Bild ins Gedächtnis, wie Adèle vor ihm her gestöckelt war und den Knöchelriemen ihres Schuhs zurechtgerückt hatte. Er masturbierte heftiger als sonst und schlief ein, ohne seinen Erguss wegzuwischen.
2
Saint-Louis ist eine Stadt mit etwa zwanzigtausend Einwohnern, die am äußersten Rand des Elsass liegt, nur durch den Rhein von Deutschland und der Schweiz getrennt. Es ist kein besonders ansprechender Ort, und abgesehen von ein paar pittoresken Fachwerkhäusern, wie sie für die Gegend typisch sind, gibt es kaum etwas, das Besucher anlockt. Wie die meisten Grenzstädte ist Saint-Louis ein Durchgangsort. Die Leute passieren ihn auf dem Weg anderswohin, und er hat so wenig Interessantes zu bieten, dass sich seine Bewohner in ihr Schicksal gefügt zu haben scheinen. Die aufgeweckteren jungen Leute von Saint-Louis verlassen die Stadt, um zu studieren, und die meisten von ihnen kehren nie zurück.
Das Stadtzentrum, soweit Saint-Louis überhaupt ein solches vorzuweisen hat, besteht aus einer Ansammlung von unattraktiven Nachkriegsgebäuden, hier und da unterbrochen von ein paar älteren Häusern, die dem Zahn der Zeit und der Stadtplanung widerstanden haben. Die Schilder über den Geschäften sind verblichen und die Schaufensterdekorationen wenig einladend, als hätten die Besitzer es aufgegeben, Passanten zum Einkaufen verlocken zu wollen. Das Wort, das den Durchreisenden am häufigsten zu der Stadt einfällt, wenn sie sie überhaupt wahrnehmen, ist nichtssagend. Saint-Louis ist nichtssagend.
Dennoch hat die Stadt seit dreihundert Jahren eine Bevölkerung. Die Menschen dort sind ein wenig ungebildeter als die Mehrheit ihrer Landsleute, nicht ganz so wohlhabend und politisch stärker rechts orientiert, aber dennoch benötigen sie von Zeit zu Zeit ein Paar neue Schuhe oder neue Kleidung, sie brauchen jemanden, der ihnen die Haare schneidet, sich um ihre Zähne kümmert und ihre Krankheiten heilt. Sie müssen Geld abheben oder leihen. Sie brauchen Orte, an denen sie essen, trinken, tratschen oder schlicht und einfach den Zeitpunkt des Nachhausegehens hinausschieben können. Die Straßen müssen gesäubert, die Abfälle fortgeschafft werden, und es muss für Recht und Ordnung gesorgt werden. Um ihre Häuser instand zu halten, brauchen sie die Fertigkeiten von Klempnern, Elektrikern, Schreinern und Malern. Ihre Kinder müssen unterrichtet, die Alten gepflegt und die Toten begraben werden.
Kurzum, die Menschen in Saint-Louis sind genau wie die Menschen anderswo, ob in ebenso tristen oder in wesentlich reizvolleren Städten. Und wie die Einwohner anderer Orte verspüren auch die Menschen von Saint-Louis einen gewissen chauvinistischen Stolz auf ihre Stadt, obwohl ihnen deren Mittelmäßigkeit durchaus bewusst ist. Manche träumen davon, ihr zu entkommen, oder bedauern, dass sie sie nicht längst verlassen haben, als sich ihnen die Gelegenheit dazu bot. Die meisten jedoch leben einfach ihr Leben, ohne sich groß Gedanken um ihre Umgebung zu machen.
Manfred Baumann wurde auf der Schweizer Seite der Grenze geboren, als Sohn eines Schweizer Vaters und einer französischen Mutter. Gottwald Baumann, ein Brauereiarbeiter aus Basel, war ein kleiner, außergewöhnlich dunkler Mann mit einem Funkeln in den Augen. Manfreds Mutter, Anaïs Paliard, war eine lebenslustige junge Frau, die etwas kränklich veranlagt war und aus einer wohlhabenden Anwaltsfamilie aus Saint-Louis stammte. Die ersten sechs Jahre seines Lebens verbrachte Manfred in Basel. Obwohl er sich kaum an diese Zeit erinnern konnte, war Schwyzerdütsch noch immer die Sprache, in der er sich am meisten zu Hause fühlte. Er hatte sie zwar seit seiner Kindheit kaum noch gesprochen, doch wenn er sie hörte, versetzte ihn der Klang sofort in diese verschwommenen frühen Jahre zurück. Aus dieser Zeit hatte Manfred nur zwei Erinnerungen an seinen Vater. Die erste war der abstoßende Geruch, den er nach einem Abend in der Kneipe verströmte, kombiniert mit dem Kratzen des unrasierten Kinns, wenn er sich über seinen Sohn beugte, um ihm einen Gutenachtkuss zu geben.
Die zweite war Manfreds liebste Erinnerung an seinen Vater. Aus Gründen, die er nicht mehr wusste (vielleicht war es sein Geburtstag gewesen), hatte Gottwald Manfred in die Brauerei mitgenommen, in der er arbeitete. Manfred konnte noch immer den berauschenden Duft der Hefe riechen und das Donnern der leeren Fässer hören, die über das Kopfsteinpflaster gerollt wurden. Die anderen Brauereiarbeiter waren, zumindest in Manfreds Erinnerung, genauso klein, kräftig und dunkel gewesen wie sein Vater, und sie hatten sich alle breitbeinig und mit schwingenden Armen fortbewegt. Als Gottwald Manfred über den Hof führte, bemerkten die Männer ihren Kumpel und riefen: »Grüezi Gottli!«
»Weißt du, was das bedeutet?«, fragte Gottwald. »Kleiner Gott. Nicht übel, was? Kleiner Gott.« Manfred hielt die Hand seines Vaters fest und freute sich auf den Tag, an dem auch er in der Brauerei arbeiten würde.
Als Manfred sechs Jahre alt war, stand das Restaurant de la Cloche zum Verkauf, und Anaïs’ Vater kaufte es für seine Tochter und ihren Mann. Die zentrale Lage des Restaurants lockte vor allem die Ladenbesitzer und Büroangestellten im Umkreis an, und obwohl sie auch abends warme Küche anboten, machten sie den größten Teil des Umsatzes tagsüber. M. Paliard hatte wohl angenommen, dass er seinem Schwiegersohn damit ein sicheres Einkommen verschaffen würde, doch er hatte nicht mit den Brauereiarbeitermanieren seines Schwiegersohns und dessen lückenhaften Kenntnissen der französischen Sprache gerechnet. Gottwalds ruppiges Benehmen verschreckte alsbald die Stammkundschaft. Ihm fehlte die Freundlichkeit und Autorität eines erfolgreichen patron. Je schlechter das Restaurant lief, desto mehr Zeit verbrachte Gottwald auf der falschen Seite der Bar, wo er sich lauthals über die spießigen Franzosen ausließ, die nun anderswo speisten.
Nach seinem Tod wurde das Restaurant verkauft, aber Manfred und seine Mutter blieben in der Wohnung darüber, bis Anaïs’ Gesundheitszustand die beiden zwang, in das Haus ihrer Eltern am Nordrand der Stadt zurückzukehren. Manfred vermisste das Leben über dem Restaurant, die Düfte aus der Küche und die Stimmen der Leute, die über die Neuigkeiten des Tages diskutierten, während er und seine Mutter zu Abend aßen. Die Bar war der Treffpunkt der ganzen Stadt. Im Haus der Familie Paliard war Manfred hingegen von allem abgeschnitten. Für seine Großeltern war er weniger ein Quell des Stolzes als vielmehr die stete Erinnerung an den Fehltritt ihrer Tochter. Zudem hatte Manfred die linkische Art seines Vaters und die schwache Gesundheit seiner Mutter geerbt, wodurch es ihm schwerfiel, sich mit anderen Jungen anzufreunden. Als sie über dem Restaurant gewohnt hatten, hatten die älteren Männer ihn fröhlich begrüßt, wenn er aus der Schule kam, als wäre er einer von ihnen. Am Wochenende hatte er kleine Botengänge für die Stammgäste erledigt und sich so ein paar Centimes verdient. Abends hatte er oft am Fenster über dem Restaurant gesessen, den Gesprächen unter ihm gelauscht und im Stillen kluge Bemerkungen dazu gemacht. Im Haus der Paliards gab es keine Stimmen, denen man hätte lauschen können. Manfred saß in seinem Zimmer und hörte nur das langsame Ticken der Standuhr draußen auf dem Treppenabsatz.
Während seiner gesamten Schulzeit war Manfred nur »der Schweizer« gewesen, und der verhasste Spitzname klebte immer noch an ihm. Lemerre benutzte ihn jedes Mal, wenn er Manfred zum donnerstäglichen Kartenspiel einlud. »Spielst du mit, Schweizer?«, rief er quer durch den Raum. Manfred wünschte, seine Mutter hätte wieder ihren Mädchennamen angenommen, doch trotz der Mängel ihres Ehemanns bewahrte sie dessen Andenken voller Ergebenheit. Nachdem Mutter und Sohn gezwungen gewesen waren, das Restaurant de la Cloche zu verlassen, rief sie ihren Sohn oft an ihr Krankenbett. Manfred mochte den Geruch im Zimmer seiner Mutter nicht. Es war wie im Krankenhaus. Auf der Kommode standen lauter braune Glasfläschchen mit Tabletten. Zum Ende hin kam der Arzt fast täglich, um nach ihr zu sehen, ein Privileg, wie es nur Familien von Rang und Namen wie den Paliards zustand. Wenn Manfred das Zimmer betrat, lächelte seine Mutter erschöpft und streckte den Arm nach ihm aus. Oft war sie zu schwach, um sich aufzurichten. Manfred setzte sich auf die Bettkante und hielt ihre Hand.
Auf Anaïs’ Nachttisch stand ein Foto von Gottwald. Es zeigte ihn neben einem Auto in einer Haltebucht am Rand einer gewundenen Straße, irgendwo hoch oben in den Schweizer Bergen. Das Auto war ein Mercedes, den Anaïs’ Vater ihnen für die Hochzeitsreise geliehen hatte. Gottwald stand in Hemdsärmeln da, die Hände in die Hüften gestemmt, die Brust herausgestreckt und das dichte schwarze Haar mit Brillantine nach hinten gekämmt, wie es damals Mode war. Der Inbegriff der Männlichkeit.
Anaïs erzählte Manfred immer wieder gerne die Geschichte, wie sie und sein Vater sich kennengelernt hatten. Gottwald war anlässlich des französischen Nationalfeiertags über die Grenze gekommen, und auf dem Platz vor dem Restaurant de la Cloche fand ein Fest statt. Es war ein ungewöhnlich heißer Tag, selbst für Mitte Juli. Anaïs war siebzehn. Sie war mit einer Freundin an den Buden entlanggeschlendert, um zu sehen, was es dort gab. Sie hatten zwei oder drei Gläser Cidre getrunken, der ihnen sofort in den Kopf gestiegen war. Da entdeckte Elisabeth, Anaïs’ Freundin, Gottwald, der an einer Bude stand, ein Glas Bier trank und unverhohlen die Mädchen um ihn herum musterte. Elisabeth wollte unbedingt zu ihm hinübergehen und mit ihm sprechen. Anaïs zögerte, sie hatte keine Erfahrung mit Männern, aber Elisabeth war schon auf dem Weg zu ihm. Anaïs stand schüchtern neben ihrer Freundin, während diese sie beide vorstellte. Gottwald küsste ihnen die Hand und sagte: »Enchanté, Mesdemoiselles«, mit einem so starken Akzent, dass sie anfingen zu kichern. Kurz darauf schlenderten sie zu dritt durch die Menge, und Elisabeth erzählte ihm alles über sich. Sie war ein ausgesprochen hübsches, selbstbewusstes Mädchen, und Anaïs vermutete, dass sie kein unbeschriebenes Blatt war, was Männer anging. Anaïs musterte Gottwald eingehend. Er war nicht auf klassische Weise gut aussehend – dafür war er zu klein –, aber in seinem Verhalten und seinen funkelnden dunklen Augen lag etwas, das sie faszinierte. Es war offensichtlich, dass Gottwald nicht einmal die Hälfte von dem verstand, was Elisabeth sagte, aber er sah sie so gebannt an, dass Anaïs sich bei dem Wunsch ertappte, ihre Freundin möge mit dem Geplapper aufhören, damit Gottwald seinen Blick auch einmal auf sie richten könne.
Bei einer Bude blieben sie stehen, und Gottwald spendierte ihnen noch einen Cidre. Dann entschuldigte sich Elisabeth, sie müsse kurz verschwinden. Sobald sie gegangen war, sah Gottwald Anaïs direkt in die Augen und sagte: »Ich bin froh, dass sie weg ist. Sie redet zu viel. Aber dich würde ich gerne wiedersehen.«
Anaïs spürte ein Flattern in der Kehle. Der Gedanke, dass dieser dunkeläugige Fremde sie ihrer schönen, charmanten Freundin vorzog, war berauschend. Bevor sie wusste, wie ihr geschah, hatte sie eingewilligt, sich am nächsten Tag mit Gottwald zu treffen. Beide erwähnten nichts davon, als Elisabeth zurückkam.
Am nächsten Tag gingen Gottwald und Anaïs im Wald spazieren. Im Schatten der Bäume war es angenehm kühl. Sie sprachen nicht viel. Anaïs wusste nicht, worüber sie sich mit einem Mann unterhalten sollte, doch noch bevor der Nachmittag zu Ende war, küsste Gottwald sie. Sie stand mit dem Rücken an einen Baum gelehnt und war überwältigt von der Kraft und dem betörenden Geruch des Mannes. Vor Leidenschaft wäre sie beinahe ohnmächtig geworden, erzählte sie Manfred. Die Beziehung wurde im Verborgenen fortgeführt – Gottwald war nicht die Sorte Mann, die Anaïs ihrem Vater vorstellen konnte –, bis es nicht länger möglich war, sie geheim zu halten. Da fragte Gottwald sie, ob sie ihn heiraten wollte.
Anaïs starb schließlich, als Manfred fünfzehn war. Sie hatte das Haus zwei Jahre lang nicht mehr verlassen und war so dünn und durchscheinend geworden wie eine alte Frau. Kurz nach der Beerdigung kam sein Großvater eines Abends zu ihm, um mit ihm zu sprechen. Ab einem gewissen Alter, sagte er, müsse ein Mann seinen eigenen Weg in der Welt gehen. Zwei Jahre später, nachdem Manfred sein baccalauréat nicht bestanden hatte, bestellte sein Großvater ihn in sein Arbeitszimmer, einen Raum im ersten Stock des Hauses, den Manfred normalerweise nicht betreten durfte. Die Regale an den Wänden waren von oben bis unten mit juristischen Fachbüchern gefüllt, und in der Mitte stand ein großer antiker Schreibtisch. Es gab auch einen Kamin, aber M. Paliard hielt nichts von unnötigem Heizen. Selbst mitten im Winter weigerte er sich als Vorbild für die anderen Mitglieder des Haushalts, ein Feuer anzuzünden, und saß mit Hut und Schal bekleidet über seinen Papieren, eingehüllt in einer Wolke aus Atemnebel und Pfeifenrauch. Manfred wurde nur ins Arbeitszimmer bestellt, wenn Dinge von großer Wichtigkeit zu besprechen waren.
Nachdem er eingetreten war, stand Manfred gute fünf Minuten im Raum, während sein Großvater das Dokument, das er in den Händen hielt, zu Ende las. Doch das kümmerte Manfred nicht. Ihm war es egal, wie sein Großvater ihn behandelte. Schließlich nahm M. Paliard seine Lesebrille ab und bedeutete Manfred mit einer Handbewegung, sich zu setzen. Er hatte ein langes, kantiges Gesicht mit schmalen blassblauen Augen unter der mächtigen Stirn. Er war fast vollständig kahl und hatte einen drahtigen grauen Bart. Manfred hatte Mühe, sich an eine Gelegenheit zu erinnern, bei der sein Großvater gelächelt hatte.
»Ich habe mit Monsieur Jeantet gesprochen, einem guten Bekannten von mir«, begann er ohne Einleitung. »Jeantet ist Filialleiter der Société Générale an der Rue de Mulhouse. Er hat sich bereit erklärt, dich einzustellen, was unter den gegebenen Umständen sehr großzügig von ihm ist. Du fängst kommenden Montag an und bekommst nach zwei Wochen deinen ersten Lohn. Ich schlage vor, du siehst dich sofort nach einer Wohnung um. Das Geld für die erste Miete und die Kaution leihe ich dir.«
Am Ende dieser kleinen Ansprache tat M. Paliard etwas, was er noch nie getan hatte. Er stand auf, ging zu einer Karaffe mit Sherry, die auf einem Silbertablett auf der Fensterbank stand, und füllte zwei kleine Gläser. Manfred hatte die Karaffe noch nie dort stehen sehen und fragte sich, ob sein Großvater sie extra zu diesem Anlass hatte heraufbringen lassen. Nicht nur, dass er noch nie eingeladen worden war, etwas mit seinem Großvater zu trinken, er hatte auch noch nie gesehen, dass dieser sich selbst etwas einschenkte. Normalerweise war dafür das Hausmädchen zuständig. Diesmal jedoch übernahm M. Paliard das Einschenken selbst, und er reichte Manfred sogar sein Glas, bevor er wieder Platz nahm. Die beiden Männer (denn diese Geste war eindeutig dazu bestimmt, Manfreds Aufnahme in den Kreis der Erwachsenen zu würdigen) tranken schweigend ihren Sherry. Zehn Minuten später erhob sich M. Paliard ein wenig unbeholfen und gab damit zu verstehen, dass die Audienz beendet war.
Am nächsten Tag fuhr Manfreds Großmutter mit ihm nach Mülhausen, um ihm einen Anzug schneidern zu lassen. Während der Schneider mit dem Maßband um ihn herumturnte, bestand Mme Paliard zu Manfreds Verlegenheit darauf, dass der Anzug auf Zuwachs geschnitten werden sollte. Dennoch genoss Manfred diese neue Erfahrung. Einen Anzug zu tragen verlieh ihm etwas Würdevolles. Der junge Mann, der ihm aus dem Spiegel des Schneiders entgegensah, hatte nichts mehr mit dem linkischen Schuljungen gemein, den er so verachtete. Anschließend aßen sie in einem schicken Bistro zu Mittag. Während des Essens plauderte Mme Paliard munter darüber, was für eine großartige Chance diese neue Stelle war. Manfred wusste, dass sie in Wirklichkeit enttäuscht von ihm war, aber er widersprach ihr nicht. Gemeinsam tranken sie eine Flasche Wein – etwas, das sie niemals getan hätten, wenn Manfreds Großvater dabei gewesen wäre –, und nach dem Dessert brach Mme Paliard in Tränen aus und sagte zu Manfred, er könne jederzeit zum Essen nach Hause kommen, und sein Zimmer stehe immer für ihn bereit. Manfred hatte seine Großmutter gern, und sie tat ihm leid, weil sie nun mit seinem Großvater alleine war. Er dankte ihr und versprach, regelmäßig zu Besuch zu kommen.
Als Manfred am Montagmorgen in der Bank ankam, führte M. Jeantet ihn sofort in sein Büro. Er war ein rundlicher Mann mit rotem Gesicht und Backenbart, der einen altmodischen Fischgrätanzug und darunter eine mottenzerfressene grüne Strickjacke trug. M. Jeantet bemühte sich stets um joviale Freundlichkeit. Er begrüßte seine Kunden mit kräftigem Handschlag und reichlich Schulterklopfen und behandelte sie wie lange vermisste Freunde. Er tätschelte sämtlichen weiblichen Angestellten den Po und machte gerne anzügliche Bemerkungen zu ihrem Aussehen oder ihrer Wochenendgestaltung. Dies tat er ohne jede Unterscheidung nach Alter oder Schönheit, zweifellos um niemanden durch Auslassung zu beleidigen. Anfangs wunderte sich Manfred, wie gutmütig seine neuen Kolleginnen dieses Verhalten hinnahmen, doch er merkte bald, dass sie hinter seinem Rücken eine Menge wenig schmeichelhafter Spitznamen für ihren Chef hatten. Es fiel ihm schwer zu glauben, dass sein Großvater diesen Mann als »guten Bekannten« betrachtete.
Jeantet führte Manfred am Arm in sein Büro und zu zwei Ledersesseln, wobei er wortreich betonte, wie sehr er sich freue, einen so aufgeweckten jungen Mann an Bord zu haben.
»Setz dich, mein Junge, setz dich«, drängte er. »Einen schicken Anzug hast du da an. Sitzt ein wenig locker, wenn ich das anmerken darf, aber ihr jungen Leute tragt das ja heutzutage so. Ich bin eher altmodisch, das findet zumindest meine Frau. Aber ich sage immer, Qualität kommt nie aus der Mode. Was, mein Junge? Ha ha.«
»Ganz recht«, sagte Manfred.
»Na, darauf müssen wir anstoßen, findest du nicht?« Und obwohl es noch nicht einmal neun Uhr war, griff der Filialleiter nach einer Karaffe, die auf dem Beistelltisch zwischen ihnen stand. Er schenkte zwei Gläser großzügig ein und brachte einen Trinkspruch auf ein langes und fruchtbares Miteinander aus. Manfred nippte an seinem Glas und hatte den Eindruck, in eine archaische Gesellschaft von Sherrytrinkern aufgenommen worden zu sein.
»Es ist wichtig, Beziehungen zu festigen«, fuhr Jeantet fort. »Das wirst du noch lernen. Ich habe dir viel beizubringen – bei der Leitung einer Bank geht es nämlich nicht etwa um Geld, oh nein. Es geht um Menschen.« Er legte eine Kunstpause ein und sah Manfred eindringlich an.
Dann schien plötzlich ein Schatten über Jeantets Gesicht zu ziehen; er stellte sein Glas ab, lehnte sich in seinem Sessel zurück und faltete die Hände über seinem Bauch. Auch Manfred stellte sein Glas hin.
»Nun«, sagte er in deutlich ernsterem Tonfall. »Dein Großvater – ein feiner Mann –, hat mir erzählt, dass du dein baccalauréat nicht bestanden hast. Das ist nicht besonders ruhmreich, und normalerweise würde ich niemanden einstellen, bei dem ich mir nicht sicher bin, dass er ordentlich was im Kopf hat.« Er tippte sich an die Schläfe. »Doch dein Großvater hat mir versichert, dass du ein aufgeweckter junger Mann bist, und ich bin bereit, ihm das zu glauben. Ich hoffe, du wirst dich des Vertrauens, das ich dir entgegenbringe, würdig erweisen.«
Er nickte bedächtig, dann nahm er wie zum Zeichen, dass der ernste Teil vorbei war, wieder sein Glas.
»Akademische Qualifikationen sind ja schön und gut, aber was im Leben zählt, sind harte Arbeit und ein gutes Gespür für menschliches Verhalten. Ich zum Beispiel bin ein passionierter Beobachter des menschlichen Wesens. Ich will nicht drum herumreden: Mit mir hast du einen Glückstreffer gelandet. Schau zu und lerne, und du wirst es weit bringen.«
Er beugte sich über den Tisch und bedeutete Manfred, dasselbe zu tun, dann flüsterte er deutlich hörbar: »Unter uns gesagt, ich habe vor, in ein paar Jahren in den Ruhestand zu gehen. Diese grässlichen alten Schachteln da draußen«, er deutete mit dem Daumen zur Tür, »haben nicht für fünf Francs Verstand. Ihre Arbeit könnte auch ein Affe erledigen. Das Einzige, was sie interessiert, ist der Tratsch und der Gehaltsscheck, den sie am Monatsende kriegen. Aber ein pfiffiger junger Bursche in einem guten Anzug, so wie du, der kann in ein paar Jahren auf meinem Stuhl sitzen, wenn er es geschickt anstellt. Na, was hältst du davon, mein Junge?«
Manfred widerstand der Versuchung zu erwidern, dass er sich lieber in den Rhein stürzen würde, als auch nur eine Minute länger als nötig in der Saint-Louiser Filiale der Société Générale zu arbeiten.
»Ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit«, sagte er.
Noch am gleichen Tag erkundigte sich Manfred nach der Wohnung über dem Restaurant de la Cloche, aber dort wohnte der neue Besitzer mit seiner Frau. Daraufhin nahm er übergangsweise die Wohnung an der Rue de Mulhouse.
3
Donnerstag war Markttag. Um halb eins war das Restaurant de la Cloche bis auf den letzten Platz besetzt. Manfred kannte die meisten der Gäste und grüßte diejenigen, deren Blicke er kreuzte, mit einem Nicken oder einem angedeuteten »Guten Tag«. Mehr Austausch fand zwischen ihm und den anderen Stammgästen nicht statt. Unter denen, die jeden Tag hier zu Mittag aßen, herrschte wie unter Zugpendlern eine stillschweigende Übereinkunft über die Grenzen der Kommunikation. Manfred nahm seinen Platz an dem Ecktisch ein, den Marie für ihn reserviert hatte. Das Mittagsmenü wechselte von Tag zu Tag, wiederholte sich aber von Woche zu Woche. Es gab stets zwei Vorspeisen, zwei Hauptspeisen und eine Spezialität des Tages, dazu eine Nachspeise und Kaffee. In den nahezu zwanzig Jahren, die er nun hierherkam, hatte sich die Auswahl nie geändert. Donnerstags war die Spezialität des Tages pot-au-feu. Etwa einmal im Monat fragte Manfred Pasteur im Scherz, ob er die Karte nicht einmal ändern wolle. »Sehen Sie hier irgendwo einen Kummerkasten?«, entgegnete der Besitzer darauf stets.
Adèle kam zu Manfreds Tisch, um die Bestellung aufzunehmen. Bei ihrem Anblick überkam ihn eine unerklärliche Erregung.
»Hallo, Adèle.« Er versuchte, Blickkontakt mit ihr aufzunehmen, hoffte auf eine Bestätigung dessen, was am vergangenen Abend zwischen ihnen geschehen war.
»Monsieur«, erwiderte Adèle ausdruckslos. Ohne von ihrem Notizblock aufzusehen, ratterte sie seine übliche Donnerstagsbestellung herunter (Zwiebelsuppe, pot-au-feu, crème brûlée), bevor er Gelegenheit hatte, noch irgendetwas zu sagen. Manfred erwog kurz, seine Bestellung plötzlich zu ändern, nur um ihre Aufmerksamkeit zu wecken, doch als sie sich mit unverhohlen gelangweilter Miene abwandte, war er froh, dass er es nicht getan hatte. Das hätte nur dazu geführt, dass Pasteur zu ihm an den Tisch gekommen wäre, um zu fragen, was diesen Sinneswandel ausgelöst habe. Manfred stellte sich vor, wie er brüllte: »Ich hatte einfach mal Lust auf etwas anderes!«, seinen Tisch umstieß und aus dem Restaurant stürmte, wobei er die Weingläser der anderen Gäste an die Wand schleuderte.
Er schlug den Wirtschaftsteil des L’Alsace auf und starrte blicklos auf die Aktienkurse. Adèle brachte ihm seine Suppe. Noch immer ließ sie sich nichts von der Vertrautheit des vorigen Abends anmerken. Vielleicht sollte er sie, wenn sie mit dem Hauptgang zurückkam, beiläufig fragen, ob sie einen schönen Abend gehabt hatte. Was könnte daran falsch sein? Schließlich hatte er die beiden zusammen gesehen. War es da nicht nur natürlich, sie darauf anzusprechen? Manfred hatte das Glas Wein, das im Menü inbegriffen war, bereits geleert. Die Suppe war wässrig und zu schwach gewürzt.
Unablässig kamen und gingen Gäste. Wenn viel los war, lief das Restaurant de la Cloche wie eine gut geölte Maschine. Marie blieb oft bei einem der Stammgäste stehen, um ein paar Worte zu wechseln, aber ihr Blick hielt unablässig Ausschau nach leer gegessenen Tellern und Gästen, die zahlen wollten. Auf ein kleines Zeichen hin wurde die Rechnung von Pasteur hinter dem Tresen zusammengestellt und ausgehändigt. Tische wurden abgeräumt und mit militärischer Effizienz neu eingedeckt. Aus der Küche drang unablässiges Geschepper, und man hörte die Rufe der Bestellungen, die fertig waren. Gäste unterhielten sich lautstark mit vollem Mund, da sie wussten, dass sie sich nicht allzu viel Zeit mit dem Essen lassen sollten. Die meisten verzichteten auf den Kaffee zum Abschluss. Und wenn sie doch einen wollten, wurde er zusammen mit der Nachspeise gebracht. Adèle bediente die anderen Gäste mit derselben mürrischen Art, die sie auch Manfred gegenüber an den Tag legte. Sie bewegte sich langsam und schwerfällig wie eine Kuh auf dem Weg zum Melken, aber auf ihre Weise war sie ebenso tüchtig wie die herumwirbelnde Marie.
Im Vorbeigehen sammelte Adèle seinen Suppenteller ein, während sie das Geschirr eines anderen Tisches auf dem Arm balancierte. Jetzt war kaum der richtige Moment, um mit ihr zu plaudern. Doch bevor sie verschwinden konnte, sagte Manfred: »Entschuldigen Sie, Adèle, aber wenn es nicht allzu viel Mühe macht, würde ich meine Bestellung gerne ändern. Ich nehme lieber das choucroute garnie.«
Das würde ihre Aufmerksamkeit wecken! Adèle drehte sich um und sagte: »Natürlich, Monsieur.« Ihre Miene blieb ausdruckslos. Manfred bewunderte ihre Nonchalance, während sie auf die Küche zusteuerte.
»Und, Adèle«, fügte er ein wenig lauter hinzu, damit sie ihn über den Lärm hinweg hörte, »noch ein Glas Wein.«
Das musste er ihr lassen, sie ließ sich nichts anmerken. Noch während er zusah, wie sie sich durch die Schwingtür in die Küche schob, stellte er sich vor, welch ein Aufruhr ausbrechen würde, wenn sie verkündete, dass Manfred Baumann seine Bestellung geändert hatte. Und er wollte ein zweites Glas Wein! Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück und musterte die anderen Gäste. Doch sie merkten nichts von den dramatischen Ereignissen, die sich gerade abspielten.
Manfred wartete darauf, dass der Besitzer an seinen Tisch kam, um sich zu erkundigen, ob ihm der pot-au-feu nicht mehr schmecke. Doch Pasteur blieb hinter seinem Tresen und schenkte Wein in Karaffen, als wäre nichts weiter vorgefallen. Er sah nicht einmal in Manfreds Richtung.
Adèle kam mit seinem choucroute. »Bon appétit«, sagte sie.
Das Eisbein war fett und zu lange gegart, das choucroute zu sauer. Er vermisste das Schmorfleisch, auf das Marie so stolz war. Zumal pot-au-feu sein Lieblingsessen der ganzen Woche war, aber darum ging es nicht. Er aß seinen Teller leer. Schließlich würde es sehr töricht wirken, wenn er seine Bestellung änderte und das Gewählte dann nicht entsprechend genoss. Er leerte sein zweites Glas Wein und lehnte sich mit einem Gefühl tiefer Befriedigung zurück.
In der Bank merkte Manfred die Wirkung des zusätzlichen Weins. Er ertappte sich dabei, wie er an seinem Schreibtisch einnickte, und bat seine Sekretärin, ihm einen Kaffee zu bringen. Er hatte einen Termin mit einem Bauern namens Distain, bei dem es darum ging, die Rückzahlungsfrist für einen Kredit zu verlängern. Manfred hörte eine Viertelstunde lang mit halbem Ohr zu, während der graubärtige Bauer über den Preisdruck der Supermärkte, die Ungerechtigkeit der Marktregulierung und den Niedergang der französischen Lebensart schwadronierte. Ein Blick auf seine Akte verriet Manfred, dass der Bauernhof bereits seit zehn Jahren Verlust machte. Er gewährte Distain eine dreijährige Aussetzung der Raten, das Maximum dessen, was möglich war. Distain konnte es gar nicht fassen. Einen schrecklichen Moment lang fürchtete Manfred, der Mann würde vor lauter Dankbarkeit anfangen zu weinen. Als er ihn aus seinem Büro geleitete, musste Manfred buchstäblich seine Hand aus Distains Griff befreien.
Manfred graute es jede Woche vor dem Donnerstagabend. Er kam zur üblichen Zeit in das Restaurant de la Cloche und nahm seinen Platz am Tresen ein. Er bestellte sein erstes Glas Wein und trank es rasch aus. Lemerre und Cloutier saßen an ihrem Tisch. Petit verspätete sich. Im Spiegel hinter der Bar sah Manfred, wie Lemerre die Karten herausholte und sie geistesabwesend mischte. Petit kam herein, zog seine Jacke aus und hängte sie über die Lehne seines Stuhls. Lemerre und Cloutier hatten die erste Karaffe des Abends bereits zu zwei Dritteln geleert. Die drei Männer unterhielten sich ein paar Minuten leise, dann rief Lemerre (es war immer Lemerre) zur Bar hinüber: »Schweizer, machst du uns den vierten Mann?«
Manfred wartete stets, bis er auf diese Weise aufgefordert wurde. Es gab keinen Grund, weshalb er sich nicht direkt bei seiner Ankunft zu den Männern an den Tisch setzen sollte, aber er tat es nie. Stattdessen setzte er jedes Mal, wenn Lemerre ihn herbeirief, eine überraschte Miene auf, als hätte er ganz vergessen, dass es der Abend des Kartenspiels war – auch wenn ihm die Absurdität dieser Scharade durchaus bewusst war.
Gehorsam nahm Manfred sein Glas und setzte sich an den Tisch. Die drei Freunde saßen stets auf denselben Plätzen, sodass Manfred den Stuhl des Toten, wie er ihn im Geiste nannte, nehmen musste. Es gab keine Diskussion darüber, wer mit wem spielte, denn jede Veränderung hätte einen Platzwechsel erfordert. So spielte Manfred mit Cloutier und Lemerre mit Petit. Cloutier war ein katastrophaler Spieler, unfähig, Manfreds Gebote zu interpretieren, und ängstlich in seinem Spiel. Lemerre und Petit wiederum arbeiteten mit einem System kaum verhohlener Mauschelei: Sie kratzten sich an der Nase, husteten oder klopften auf den Tisch. Ihr Code war so primitiv, dass Manfred ihn mit Leichtigkeit durchschaute. Sie hätten ebenso gut ihre Karten offen auf den Tisch legen können. Und obwohl Cloutier wie ein Idiot spielte, gewannen sie jedes Mal. Einmal hatte Lemerre Manfred sogar vorgeworfen, er würde schummeln. Meistens jedoch schüttelten Lemerre und Petit nur den Kopf über das Glück ihrer Gegner.
Adèle brachte eine neue Karaffe Wein und ein Glas für Manfred. Als sie sich über den Tisch beugte, blickte Manfred verstohlen in ihren Ausschnitt und dachte an den jungen Mann, den er am Abend zuvor gesehen hatte.