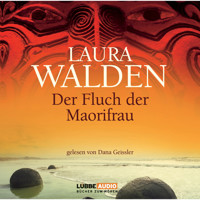9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Whisky-Brennerei mit langer Tradition, ein Schloss auf der wildromantischen Isle of Skye, dazu ihr liebevoller Verlobter Gordon - was könnte sich die junge Shona MacLeod mehr wünschen? Doch die Wahrheit ist alles andere als rosig, denn die Brennerei steht kurz vor dem Aus und der angeblich so aufmerksame Gordon spinnt eine finstere Intrige, um Shona endgültig an sich zu binden. Er ahnt nicht, dass sein vermeintlicher Helfershelfer für Shona zum Retter in der Not werden möchte...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 700
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Zitat
Portree, September 1924
London, Dezember 2014
Portree, Dezember 2014
Portree, Dezember 1919
Portree, Dezember 2014
Portree, Dezember 1919
Portree, Dezember 2014
Portree, Hogmanay 1919
Portree, Dezember 2014
Portree, Hogmanay 1919
Portree, Dezember 2014
Edinburgh, Januar 1921
Portree, Dezember 2014
Edinburgh, Januar 1921
Portree, Dezember 2014
Portree, März 1921
Portree, Dezember 2014
Portree, März 1921
Portree, Dezember 2014
Portree, April 1921
Portree, Dezember 2014
Portree, April 1921
Portree, Dezember 2014
Portree, Dezember 2014
Portree, Juli 1922
Portree, Dezember 2014
Portree, Juli 1922
Portree, Dezember 2014
Portree, Oktober 1922
Portree, Dezember 2014
Portree, Oktober 1922
Portree, Dezember 2014
Portree, Oktober 1922
Portree, Dezember 2014
Portree, November 1922
Portree, Dezember 2014
Portree, November 1922
Portree, Dezember 2014
Portree, Juni 1923
Portree, Dezember 2014
Portree, Juli 1924
Portree, Dezember 2014
Portree, September 1924
London, Dezember 2014
Portree, Dezember 2014
Portree, Januar 2015
Portree, Juli 2015
Rezept
Über die Autorin
Laura Walden studierte Jura und arbeitete einige Jahre als Rechtsanwältin in Hamburg. Doch dann siegte ihre Leidenschaft fürs Erzählen spannender Geschichten, und so entschied sie sich, die Schriftstellerei zu ihrem Beruf zu machen. Wie weise dieser Entschluss war, zeigt der Erfolg ihrer mitreißenden Romane, bei denen es immer um dunkle Familiengeheimnisse vor atemberaubender Landschaft geht.
Laura Walden
DAS VERSTECKAM ENDEDER KLIPPEN
Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Antje Steinhäuser
Titelillustration: © getty-images/Simon Cameron Photography;
© iStockphoto/Andreyuu
Umschlaggestaltung: Jeannine Schmelzer
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-0693-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
O my Luve’s like a red, red roseThat’s newly sprung in June;0 my Luve’s like the melodieThat’s sweetly play’d in tune.
As fair art thou, my bonnie lass,So deep in luve am I:And I will luve thee still, my dear,Till a’ the seas gang dry:
Till a’ the seas gang dry, my dear,And the rocks melt wi’ the sun:1 will luve thee still, my dear,While the sands o’ life shall run.
And fare thee well, my only LuveAnd fare thee well, a while!And I will come again, my Luve,Tho’ it were ten thousand mile.
»A Red, Red Rose«, Song von Robert Burns, 1794
PORTREE, SEPTEMBER 1924
Die junge Frau sang mit brüchiger Stimme: »O zorn’gen Schicksals welkend Weh’n, bleicht’ meine Blätter so, O!«
Es klang nicht rein und erhaben, wie einst, als sie es mit dem Chor vorgetragen hatte. Nicht glasklar und engelsgleich, wie früher, wenn sie es an einem 25. Januar anlässlich der Feierlichkeiten im Gedenken an den großen schottischen Dichter Robert Burns dargebracht hatte. Weil sie den schönsten Sopran von allen und als Einzige eine ausgebildete Stimme besaß, hatte der Chorleiter sie vor vielen Jahren auserwählt, am Festtag das Solo zu singen. Nun war ihre Stimme heiser vom vielen Schreien, ermattet von den Tränen und krank von dem Husten, der sie seit Tagen marterte. Doch trotz der Schmerzen in ihrer Brust und in den Gliedern, die in der nasskalten Höhle steif gefroren waren, fuhr sie unbeirrt fort: »Mein Stamm war stark, mein Laub war grün, die Knospe schwellte froh, O! Der Tau fiel frisch, die Sonne schien, wie wuchs das Zweigwerk so!« Ihr Singen wurde immer mehr zu einem Krächzen, doch sie fuhr unbeirrt fort, ihrer Kehle diese grässlich klingenden Töne zu entlocken. Allein der Text und der Gedanke daran, dass es ein Leben vor dieser Hölle gegeben hatte, erwärmten sie für einen winzigen Augenblick, doch dann durchfuhr ein eisiges Zittern ihren Körper. Ein vom Meer kommender Windzug signalisierte ihr, dass das Ende nah war. Fast trotzig sang sie gegen diese Gewissheit an. »Doch zorn’gen Schicksals welkend Weh’n, bleicht’ meine Blätter so, O! Doch zorn’gen Schicksals welkend Weh’n, bleicht’ meine Blätter so, O!«
Ihre Stimme war lauter geworden. Das war kein Gesang mehr, das war ein Schrei, ein letzter Hilfeschrei, bevor sie in verzweifeltes Schluchzen ausbrach.
»Liebster, hörst du mich?« Sie strich über das dicke, drahtige Haar des Mannes, dessen Kopf leblos auf ihrem Schoß lag und den sie nicht einmal sehen konnte, denn draußen herrschte finstere Nacht. Am Tag drangen wenigstens ein paar Lichtstrahlen durch die Mauer aus Geröll und Steinen in das Innere der Höhle, aber nun war es stockdunkel. Sie fuhr mit den Fingern zärtlich über sein Gesicht, erspürte seinen Mund, der halb geöffnet war, und hielt die Hand davor in der Hoffnung, seinen Atem zu spüren, aber da war nichts. Kein Hauch von Leben mehr. Ihre Hand tastete sich tiefer unter seine Jacke zu seiner Brust. Sie erschauderte, als sie in das klebrige Nass fasste, aber sie brauchte Gewissheit und ließ die Hand auf der Stelle liegen, an der sie so oft sein pochendes Herz gespürt hatte. Aber in seiner Brust war alles still.
Als sie die Hand nach einer halben Ewigkeit zurückzog, roch es metallisch. Er hatte viel Blut verloren. Sie hatte die Wunde zwar verbunden, nachdem ihn der mörderische Strumpf-Dolch knapp unter dem Herzen getroffen hatte, aber nur notdürftig, mit einem Taschentuch. Trotzdem hätte er diesen gemeinen Anschlag auf sein Leben sicher überlebt, wenn nicht … Mit Schaudern dachte sie daran, wie nur wenige Augenblicke, nachdem sein Peiniger geflüchtet war, ein ohrenbetäubender Lärm das Innere der Höhle erschüttert hatte. Sie hatte den Verletzten an der Hand gepackt und in Todesangst geschrien: »Raus hier, das ist ein Felsabbruch oben auf den Klippen!« In dem Moment hatte es bereits Steine von oben geregnet, und der Ausgang war im Nu verschüttet gewesen. Sie hatte nach Hilfe gerufen in der Hoffnung, dass er zurückkehren und sie retten würde, hatte er doch bereits mit dem Dolch seine bittere Rache genommen. Er hätte den Tod ihres Liebsten sicher in Kauf genommen, aber niemals den ihren. Dessen war sie sich so sicher gewesen. Dann jedoch war sein irres Lachen bis in das Innere der Höhle vorgedrungen.
»Das ist die Strafe Gottes. Auf immer vereint. Das habt ihr doch gewollt. Jetzt hat euch das Schicksal diesen Wunsch erfüllt!«
»Aber unser Kind. Wer soll sich denn um unser Kind kümmern?«, hatte sie gefleht.
Seine Antwort war ein lautes krankes Lachen gewesen. »Um den Bastard kümmere ich mich. Hörst du? Bastard! Bastard! Bastard!«
Obwohl ihr dieses irre Lachen eiskalte Schauer über den Rücken jagte, hatte sie sich in diesem Augenblick immer noch an die Hoffnung geklammert, lebend zu ihrem Kind zurückzukehren. Sie hatte ihn angefleht, Hilfe zu holen, aber er war schließlich, weiterhin wie ein Irrer lachend, davongeeilt.
Ein Hustenanfall schüttelte ihren geschwächten Körper. In ihrer Brust brannte es wie Feuer. Und trotzdem konnte sie kaum mehr die Augen offen halten. Sie hatte in den vergangenen Stunden mit letzter Kraft gegen das Einschlafen gekämpft, weil sie wusste, sie würde dann nicht mehr aufwachen, sondern in den ewigen Schlaf hinüberdämmern. Wenigstens ein letztes Schnippchen wollte sie dem sicheren Tod noch schlagen, aber nun war ihr Kampfgeist genauso erschöpft wie ihr geschundener Körper.
»Liebster, ich komme zu dir«, flüsterte sie ihm zu und schloss die Augen. Die letzten Tage zogen an ihr vorüber wie ein wirrer Traum. Sie hatte alles in ihr Tagebuch eingetragen, das sie bei sich trug. Seit Langem vertraute sie ihre geheimsten Gedanken dem geduldigen Papier an. Die vollgeschriebenen Bücher hatte sie ihrem Cousin zur Aufbewahrung anvertraut, seit sie eine Ahnung hatte, dass ihr womöglich Gefahr drohte. Das Schreiben in der Höhle hatte ihr die Kraft gegeben, nicht den Verstand zu verlieren. Er hatte die meiste Zeit geschlafen und im Schlaf gestöhnt. Ihr einstiges Paradies war zu einer einzigen Hölle geworden. Nur das Schreiben hatte sie daran gehindert, sich neben ihn zu legen und einzuschlafen.
Sie faltete ihre Hände und betete, dass eines Tages jemand die verschüttete Höhle am Ende der Klippen entdecken und ihr Sohn die Wahrheit erfahren möge. Ja, nicht dem Liebsten galt ihr letzter Gedanke, sondern dem unschuldigen Kind, das der Willkür eines feigen Mörders ausgeliefert war.
Und dann dachte sie an gar nichts mehr, sondern hörte nur das Rauschen der anrollenden Wellen und das grollende Donnern, wenn sie sich mit voller Wucht an den Klippen unter ihnen brachen.
LONDON, DEZEMBER 2014
Fröstelnd stand Dona MacLeod am Fenster ihres Zimmers und suchte dort draußen die Themse, doch was sie sah, war nichts als Nebel. Sie war Nebel gewöhnt, nirgends war es so neblig wie in ihrer Heimat, der Isle of Skye, der Hauptinsel der Inneren Hebriden. Aber irgendwie war der Nebel nach ihrem Empfinden hier anders. Er lag wie eine zähe graue Masse über der Stadt, als wäre er aus Beton. Der Nebel zu Hause in Portree war mehr wie eine Wolke, die sich genauso schnell wieder auflöste, wie sie gekommen war. Anders als in London, wo das Wetter manchmal tagelang gleich bleiben konnte, gebärdete es sich auf der Insel wie eine launische Diva. Regen, Sonne, Hagel, Sturm und Nebel wechselten sich in rasantem Tempo ab. Schon von Kindheit an war Dona darauf eingestellt, dass sich ein strahlend blauer Himmel urplötzlich durch vom Meer kommende dunkle Wolken in völlige Finsternis verwandeln – wie auch ein düsterer Himmel von einer Minute zur anderen aufreißen konnte. In ihrer Schultasche war neben den Büchern, Heften und der Federtasche stets ein Regenschutz gewesen. Den hatte Dona allerdings zur großen Sorge ihrer Mutter selten benutzt. Sie liebte es nämlich, ungeschützt gegen Sturm und Nässe anzukämpfen, und war so manches Mal klitschnass aus der Schule gekommen. »Du bekommst eine Lungenentzündung«, hatte ihre Mutter sie stets gewarnt, aber merkwürdigerweise war sie wesentlich seltener an Grippe erkrankt als jene Schulfreundinnen, die sich in Wind und Wetter nur geschützt herausgewagt hatten.
Warum muss ich bloß jetzt an Portree denken, fragte sich Dona, sie hatte so lange nicht mehr an Zuhause gedacht. Sie wandte sich ab und legte sich noch einmal unter das warme Federbett. Es war neun Uhr, und sie hatte einen ekelhaften Kater. Warum sollte sie aufstehen? Sie musste heute nicht ins Restaurant. Das Tianavaig hatte gestern seine Pforten für immer geschlossen. Bis tief in die Nacht hatten sie Abschied gefeiert und alles vernichtet, was die Whisky-Bar noch hergegeben hatte. Sie ballte die Fäuste, wenn sie nur daran dachte. Das Tianavaig war gerade auf Erfolgskurs gewesen, aber der Vermieter versprach sich mehr davon, an einen Modeladen zu vermieten, und hatte ihnen gekündigt. Damit war ihr Traum vom eigenen Restaurant wie eine Seifenblase geplatzt.
Dona war kaum eingeschlafen, als es an ihrer Tür klopfte. Verschlafen setzte sie sich auf. »Wer stört?«, brummte sie und spürte das Hämmern in ihrem Schädel deutlich. Sie hatte eindeutig zu viel getrunken.
Ihre beste Freundin und Mitbewohnerin Amy trat zögernd ins Zimmer. Sie sah auch nicht besser aus als sie, sondern verquollen und übernächtigt.
»Ginge, ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber auf unserer Reservierungsnummer war ein Anruf für dich.«
Amy hatte ihr den Spitznamen »Ginge« verpasst, weil sie behauptete, noch niemals zuvor so dickes, langes rotes Haar gesehen zu haben.
»Was kümmert uns, wer auf den Anrufbeantworter vom Tianavaig quatscht. Wir müssen ja nicht jedem Gast persönlich vom Ende unseres Traums berichten«, erwiderte Dona trotzig und wollte sich wieder die Bettdecke über den Kopf ziehen, aber etwas in der Miene ihrer Freundin hielt sie davon ab.
»Ich glaube nicht, dass es ein Gast war. Er gab sich als alter Freund von dir aus und meinte, es sei dringend. Er bittet um Rückruf. Ich habe dir mal seinen Namen und seine Nummer notiert.« Amy reichte Dona einen Zettel.
»Gordon MacArran? Ach du Schreck, woher hat der denn unsere Nummer?«
»Einer deiner vielen Verehrer?«, lachte Amy.
Dona stieß einen tiefen Seufzer aus. »Schlimmer, wir waren mal verlobt!«
»Was? Du warst mal verlobt? Davon weiß ich ja gar nichts!« Amy setzte sich auf die Bettkante der Freundin: »Erzähl!«
»Da gibt es nicht viel zu erzählen. Er war mein erster Freund. Die Familien kannten sich. Schon als wir Kinder waren, orakelte man in Portree über unsere gemeinsame Zukunft. Eigentlich war das für alle ziemlich klar. Ich heirate Gordon und bekomme viele kleine MacArrans …« Es war Dona gar nicht lieb, derart überraschend von ihrer Vergangenheit eingeholt zu werden.
»Und dann?«
Dona rollte genervt mit den Augen. »Willst du es wirklich wissen? Es ist nicht gerade ein Ruhmesblatt für mich.«
»Dann erst recht. Ich habe mich immer schon gewundert, dass du so wenig aus deiner Jugend erzählst. Ich habe es mir damit erklärt, dass Mädchen aus Portree braver sind als Girls, die in London aufgewachsen sind.«
»Genau, dabei könnten wir es doch belassen. Ich hatte nur einen Freund, Gordon, mit dem ich verlobt war und …«
»Und?«
»Okay, okay, du gibst ja eh keine Ruhe, bis ich dir die ganze Geschichte erzählt habe … Also, die Hochzeit war geplant. Meine Mutter ist völlig darin aufgegangen, sie war sogar mit mir nach Edinburgh gefahren, um das Hochzeitskleid zu kaufen. Ich sah aus wie ein Baiser, aber ich habe mich nicht gewehrt, weil ich schon längst Zweifel an dem Theater hatte. Mir war das alles zu vorgezeichnet, wenn du verstehst?«
»Oh ja, mich hätte keiner in einen Baiser gezwängt. Aber wie war er? Hast du ihn geliebt? Konntest du nicht mit ihm reden und ihm sagen, dass dir das ganze Drumherum zu viel wird?«
Es fiel Dona nicht leicht, über diesen Teil ihres Lebens zu reden, den sie gern für immer verdrängt hätte. Und sofort kam auch wieder das schlechte Gewissen Gordon gegenüber hoch. Und nicht nur ihm, sondern auch ihren Eltern gegenüber.
»Sagen wir mal so. Ich mochte ihn. Ich kannte ja keinen anderen, jedenfalls nicht näher. Und mit sechzehn war ich auch sehr verknallt in ihn, weil Gordon einfach der attraktivste Typ der ganzen Insel war. Er war umschwärmt und studierte schon in Edinburgh Jura. Er stammt aus einer traditionellen Notarfamilie, und für ihn gab es keinen Zweifel, dass er in die Fußstapfen von Vater, Großvater und Urgroßvater treten würde, so wie ich dann …« Sie unterbrach sich, denn es kostete sie wirklich Überwindung, über diese alte Geschichte zu sprechen. Sie warf einen flüchtigen Blick auf den Zettel in der Hoffnung, dass es sich um einen anderen Gordon handelte, aber es gab keinen Zweifel. Auch die Telefonnummer sprach Bände. Keine Frage: Es war die Vorwahl von Portree.
»So wie du?«, hakte Amy ungeduldig nach.
»Wie ich die Whisky-Destillerie meines Vaters erben sollte.«
»Wow, deshalb deine fundierten Kenntnisse.«
»Ja, ich habe gleich nach der Highschool dort gearbeitet.«
»Nun lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen! Wie ging es weiter?« Aus Amys Augen blitzte die nackte Neugier.
»Wir haben uns nur am Wochenende gesehen, und die ersten Jahre war es auch schön, vor allem bin ich gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass ich ein anderes Leben führen dürfte als das, was alle von mir erwarteten. Aber kurz vor der Hochzeit kamen mir erhebliche Zweifel. Ich hatte plötzlich das Bedürfnis, doch zu studieren, wie ich es eigentlich schon immer gewollt hatte, und über den Tellerrand hinauszusehen.«
»Und warum hast du das deiner Familie und deinem Verlobten nicht genauso gesagt?«
»Habe ich«, seufzte Dona. »Mein Vater hat gesagt, du musst nicht Wirtschaft studieren, um unser Unternehmen weiterzuführen, du musst dich nur von mir anlernen lassen. Damit war für ihn das Thema durch. Und Gordon hat ihm beigepflichtet. Nach dem Motto: Du wirst vor Ort gebraucht. Du bist die Stütze deines Vaters, bla bla bla, die beiden Männer waren jedenfalls immer einer Meinung.«
»Hm, klingt doch nicht so märchenhaft, wie ich anfangs dachte. Ich sah dich schon als reiche Highlandprinzessin.«
»Haha, aber ich habe mich einfach nicht getraut, ihnen die Wahrheit zu sagen. Dass ich ersticke, wenn ich mich nicht wenigstens einmal in die Welt da draußen wage. Weißt du, es ist schwer, wenn die anderen dein Schicksal bereits besiegelt haben.«
»Und was hast du getan? Hast du deinen Gordon etwa am Traualtar stehengelassen?«
Dona lachte gequält. »Nicht ganz. Ich habe eine Woche vor der Hochzeit meine Sachen gepackt und mich heimlich davongeschlichen. Erst nach Edinburgh und dann weiter nach London.«
»Oh je, und wie haben sie reagiert?«
Dona zuckte die Schultern. »Ich weiß es nicht. Ich habe Gordon und auch meinen Eltern Briefe dagelassen, in denen ich versucht habe, mich zu erklären. Und nach ein paar Monaten habe ich zu Hause angerufen, mein Vater war dran, und weißt du, was er sagte?«
»Ich kann es mir fast denken«, stöhnte Amy und nahm ihre Freundin in den Arm.
»Ich habe keine Tochter mehr, hat er ins Telefon gebrüllt«, murmelte Dona und die ganze verdrängte Trauer nahm so von ihr Besitz, dass sie in Tränen ausbrach. Amy wiegte die Freundin tröstend in ihrem Arm, bis Dona sich seufzend aufrichtete.
»Jetzt kennst du meine Geschichte. Und du kannst dir vorstellen, dass ich nicht mehr daran denken wollte. Diese Mischung aus schlechtem Gewissen und der Verletzung, dass mein Vater mich verstoßen hat, war unerträglich.«
»Vielleicht hat er das nur im Zorn gesagt und es gar nicht so gemeint.«
»Was meinst du, wie oft ich mir das vorgestellt habe und den Hörer in der Hand hatte, um zu Hause anzurufen, aber ich habe mich nicht getraut.«
»Und wie lange ist das her?«
»Acht Jahre.«
Amy deutete auf den Zettel mit Gordons Nummer, den Dona immer noch verkrampft in ihrer Hand hielt.
»Und wirst du ihn anrufen?«
»Wenn ich das wüsste. Ich frage mich nur, wie er überhaupt an die Reservierungsnummer vom Tianavaig gekommen ist.«
»Keine Ahnung. Finde es heraus. Er scheint dich jedenfalls nicht vergessen zu haben. Er klang aufgeregt und hatte eine sehr schöne Stimme.«
Dona lächelte. »Ja, Gordon MacArran hatte den wohlklingendsten Bass der Isle of Skye.«
»Soll ich rausgehen oder dir beistehen, während du es hinter dich bringst?«, fragte Amy mitfühlend.
»Ich glaube, ich wäre lieber allein.«
Amy strich Dona noch einmal über die rote Mähne. »Ach, meine Ginge«, raunte Amy und verließ das Zimmer.
Dona blieb eine ganze Weile wie erstarrt auf ihrem Bett sitzen, bevor sie schließlich aufstand und nach ihrem Telefon griff. Ihr Herz klopfte bis zum Hals, als sie Gordon MacArrans Nummer wählte. Und ihr Herzschlag drohte beinahe auszusetzen, als er sich meldete.
»Gordon MacArran.«
Diese Stimme, durchfuhr es sie, die mich damals für ihn eingenommen hat, neben seiner stattlichen Größe von fast einem Meter neunzig und seinen blonden Locken. Donas Mund war so trocken, dass sie befürchtete, kein Wort hervorzubringen, doch dann räusperte sie sich und sagte mit heiserer Stimme: »Hier spricht Dona, Dona MacLeod. Du hast eine Nachricht auf unserer Restaurantnummer hinterlassen, dass ich zurückrufen soll.«
»Dona«, stieß er in einem Ton aus, als könnte er es nicht glauben. »Dona, bist du es wirklich? Ich habe es gar nicht zu hoffen gewagt, aber ich war mir sicher, dass das in der Zeitschrift dein Foto war.«
Dona dämmerte sofort, worauf er anspielte. Im letzten Jahr hatte es eine euphorische Gastrokritik über das Tianavaig in einer großen britischen Zeitschrift gegeben. Mit Fotos von Amy und ihr.
»Du hast den Artikel gelesen?«
»Ja, und da habe ich gedacht: Wow, Dona hat ihren Weg gefunden, obwohl es ein bisschen merkwürdig war, zu lesen, dass du ein Restaurant betreibst. Also, als Gastronomin habe ich dich nie gesehen.«
»Ich habe Betriebswirtschaft studiert, und das Tianavaig war schon im Studium mein Lieblingsrestaurant. Und als die alten Besitzer es aufgeben wollten, haben sie mich gefragt, ob ich es nicht übernehmen wollte. Da war ich gerade sehr unzufrieden mit meinem Job als Assistentin der Geschäftsführung und habe zugegriffen. Du hast dann auch sicher gelesen, dass es die beste Whisky-Bar Londons hatte?«
»Ja, das ist mir nicht entgangen. Vielleicht hätte das deinen Vater versöhnt.«
Jetzt konnte Dona nicht länger an sich halten: »Oh Gott, wie geht es Mom und Dad?«
Gordon antwortete nicht gleich, sondern stieß stattdessen ein paar tiefe Seufzer aus.
Dona spürte einen Kloß im Hals. Sie hatte noch keinen einzigen Gedanken an die Frage verschwendet, was es bedeuten konnte, dass Gordon sie nach so vielen Jahren aufgespürt und kontaktiert hatte … Die Erkenntnis, dass es nicht unbedingt etwas Gutes zu bedeuten haben konnte, breitete sich wie ein schleichendes Gift in ihrem Körper aus, und ihr wurde übel.
»Dona, ich muss dir …« Gordons Stimme brach ab.
Dona ließ sich stumm auf einen Stuhl gleiten. Sie war kein Mensch, der in hysterische Schreie ausbrach, wenn ihr etwas wirklich Schlimmes widerfuhr, sondern sie verfiel eher in einen Zustand der Lähmung.
»Es ist ein Unglück geschehen. Deine Eltern sind mit dem Boot rausgefahren und nicht von ihrer Tour zurückgekommen. Eben hat man sie in der Holloman Bay auf Raasay gefunden …« Er brach ab und fragte besorgt: »Dona, bist du noch dran?«
Dona nickte stumm, doch dann fiel ihr ein, dass er ein Lebenszeichen von ihr erwartete.
»Ja, ja, sie haben also ihre Leichen am Strand gefunden … aber wie konnte das passieren? Die ›Rosedale‹ ist das sicherste Boot, das es überhaupt gibt«, sagte sie mit monotoner Stimme.
»Sie haben sich ein neues Schiff gekauft, aber von der neuen Rosedale gibt es keine Spur. Es ist offenbar zwischen Portree und Raasay gesunken.«
»Ja, so wird es sein«, murmelte Dona.
»Sag mal, hast du wirklich begriffen, was geschehen ist?«, erkundigte sich Gordon.
»Meine Eltern sind tot. Was ist daran nicht zu verstehen?«, antwortete sie unwirsch.
»Ich meine nur, weil du keinerlei Regung zeigst. Da mache ich mir Sorgen. Ich dachte, ich setze mich jetzt ins Auto und hole dich ab. Das sind tausend Kilometer. Ich bin also in etwa zehn Stunden bei dir, ich schlafe eine Runde, und dann fahren wir zurück.«
»Das ist lieb von dir, Gordon, aber ich werde einen Flieger nach Inverness nehmen und dort einen Mietwagen. Lass mich erst mal begreifen, was geschehen ist.«
»Aber ich weiß nicht, ob ich dich allein lassen kann.«
Wenn es nicht alles so traurig wäre, Dona hätte laut aufgelacht. Offenbar war für Gordon MacArran die Zeit stehen geblieben.
»Gordie, ich war acht Jahre allein, und ich bin nicht mehr die kleine Dona«, erwiderte sie schroffer als beabsichtigt. Aber immerhin hatte sie ihn bei seinem Kosenamen genannt.
»Entschuldigung, ich wollte dir nicht zu nahe treten. Und wahrscheinlich hast du auch einen Herren an deiner Seite, der dich begleiten wird.« Das klang gekränkt, und sofort meldete sich Donas schlechtes Gewissen. Es war doch unglaublich großzügig von ihm, ihr seine Hilfe anzubieten. Schließlich hatte sie ihn vor der Hochzeit verlassen und damit schwer kompromittiert.
»Du musst dich nicht entschuldigen. Verzeih mir, aber ich bin völlig durcheinander. Trotzdem will ich dir das nicht zumuten, diese Strecke zu fahren«, bemerkte sie versöhnlich, ohne auf die Anspielung bezüglich des ›Herren‹ einzugehen. Ihr stand nicht der Sinn danach, Gordon nach so langer Zeit aus ihrem unglücklichen Beziehungsleben zu berichten. Natürlich hatte es diverse Männer in den vergangenen acht Jahren gegeben, aber es waren mehr oder minder unbedeutende Affären geblieben. Und das hatte bestimmt nicht an den Männern gelegen, sondern eindeutig an ihr. Immer, wenn es ernster geworden war, hatte sie einen Vorwand gesucht, um sich zurückzuziehen. Ihre Freundin Amy nannte sie manchmal ›die schottische Herzensbrecherin‹, denn Dona konnte sich einfach nicht auf etwas Verbindliches einlassen.
»Gut, soll ich für dich im Internet gucken, wann ein Flug geht?«, fragte Gordon.
Dona atmete tief durch. Da war es wieder, das Gefühl, das sie oft während ihrer Beziehung beschlichen hatte: Gordon behandelte sie wie ein unmündiges Kind, aber sie wollte ihn nicht schon wieder vor den Kopf stoßen.
»Ja, dann schau doch eben mal«, seufzte sie.
»Gut, ich rufe dich gleich an. Ich habe ja deine Nummer, wenn es dein Telefon ist, von dem du mich angerufen hast.«
»Ist es«, erwiderte Dona knapp. Täuschte sie sich oder versuchte Gordon gerade herauszubekommen, ob sie das Telefon eines Mannes benutzte? »Bis gleich!«
Eine Zeitlang blieb sie auf dem Stuhl sitzen und rührte sich nicht. Ihr Verstand wusste zwar, was geschehen war, doch in ihrem Herzen war die grausame Nachricht noch nicht angekommen.
Ihr Herz klopfte zum Zerbersten, und sie fühlte sich wie gelähmt. Hastig griff sie zu der Packung mit Tranquilizern, die ihr ein Arzt verschrieben hatte, als sie ihm von ihren seit geraumer Zeit auftretenden Ängsten berichtet hatte. Er behandelte sie bereits seit Längerem wegen ihrer Migräneanfälle und hatte ihr deutlich gemacht, dass das mit den Beruhigungstabletten keine langfristige Lösung wäre – sich aber bereit erklärt, sie ihr bei dem ganzen Stress um die Kündigung des Tianavaig zu verschreiben. Tatsächlich hatte ihr das Mittel dabei geholfen, ihre innere Unruhe und die diffusen Ängste in Schach zu halten. Wer hätte gedacht, dass es noch schlimmer kommen würde, fragte sich Dona und malte sich in Gedanken aus, was der Tod ihrer Eltern für Konsequenzen haben würde. Sie musste, ob sie es wollte oder nicht, zumindest zur Beerdigung zurück in ihre Heimat, an jenen Ort, an dem auch ihr körperliches Leiden angefangen hatte. Und zwar genau an dem Abend, an dem sie sich zum ersten Mal verzweifelt gefragt hatte, ob es nicht irgendeinen Ausweg aus der Misere geben konnte, da hatte der Kopfschmerz sie zum ersten Mal überfallen und aus ihr in kürzester Zeit ein am Boden kriechendes Bündel gemacht. Nachdem sie am nächsten Tag wieder zum Menschen geworden war, hatte ihr Entschluss festgestanden: Sie musste dem Ganzen entfliehen!
Dona massierte sich vorsorglich die Schläfen, aber in diesem Augenblick verspürte sie weder einen Anflug von Kopfschmerzen, noch wurde sie von Ängsten gemartert. Im Gegenteil, in ihr herrschte gähnende Leere, als ob die schreckliche Nachricht gar nicht zu ihr durchgedrungen wäre.
Dona merkte nicht, wie die Tür leise aufging und Amy sich ihr vorsichtig näherte.
»Was ist geschehen? Du siehst aus wie der Tod«, sagte die Freundin und ihr Blick blieb an der Packung Buspiron hängen.
»Was ist passiert? Was hat dir der Kerl getan? Und was ist das da?«
»Ich muss packen«, entgegnete Dona und stand auf. Urplötzlich setzten ihre Empfinden wieder ein. Ein Beben durchfuhr ihren ganzen Körper und sie kam ins Schwanken, doch Amy konnte sie auffangen, bevor sie stolperte.
»Du sagst mir jetzt sofort, was los ist«, befahl Amy.
»Meine Eltern … meine Eltern sind beide tot!«
Amy schlug entsetzt die Hände vors Gesicht. »Oh Gott, oh Gott«, stammelte sie und drückte Dona ganz fest an sich.
Diese Geste der Freundin ließ bei Dona alle Dämme brechen. Sie schluchzte verzweifelt auf. »Verdammt, sie können sich doch nicht einfach aus dem Staub machen, bevor wir uns versöhnt haben.«
»Heul dich aus, Ginge, heul dich richtig aus«, murmelte Amy, während sie der Freundin tröstend übers Haar strich. »Aber seit wann nimmst du die denn?«, hakte sie schließlich nach.
»Ach, die nehme ich ja gar nicht regelmäßig«, versuchte Dona abzuwiegeln und ließ die Tabletten in einer Schublade verschwinden, als könnte sie dieses heikle Thema damit aus der Welt schaffen.
Amy ließ es dabei bewenden und fragte mit Rücksicht auf den desolaten Zustand der Freundin nicht weiter nach.
Dona löste sich abrupt aus Amys Umklammerung. »Ich muss jetzt packen!«
»Du willst in diesem Zustand fahren?«
»Ich muss. Ich kann es erst glauben, wenn ich sie sehe. Verstehst du? Ich muss sie noch einmal sehen.«
»Gut, dann komme ich mit!«, erklärte Amy entschieden.
»Aber du kannst doch nicht alles stehen und liegen lassen«, entgegnete Dona schwach, die nichts lieber gehabt hätte, als Amys Begleitung auf ihrer Reise in die Vergangenheit zu sein.
Amy lachte trocken auf. »Was liegenlassen? Schon vergessen? Wir haben das Tianavaig gestern für immer geschlossen. Was mich erwartet, ist das Klinkenputzen bei allen halbwegs anständigen Londoner Restaurants. Und ganz ehrlich, ich reiße mich nicht darum. Außerdem läuft mir das nicht weg. In einer Woche kriege ich auch noch einen neuen Job, oder eben nicht.«
»Sie werden sich um dich reißen! Alle haben den Artikel gelesen und wissen, dass du eine Meisterin der neuen englischen Küche bist. Ich zitiere: Fettig, schwer und geschmacksneutral war einmal! Und Jamie Oliver ist lange nicht mehr der Einzige, der den Gaumen mit englischer Küche zum Schmelzen bringt …«
»Das wissen sie aber auch noch nächste Woche. Hand aufs Herz. Möchtest du, dass ich dich begleite, oder stört es dich eher?«
Dona fiel Amy zum Dank um den Hals. »Das wäre der schönste Freundschaftsdienst, den du mir erweisen könntest. Natürlich möchte ich, dass du mitkommst. Ich habe Angst, Angst und noch mal Angst.«
»Gut, dann packe ich auch. Wann fliegen wir?«
Dona zuckte mit den Achseln. »Gordon sucht einen Flug für mich raus und ruft gleich zurück.«
In dem Augenblick klingelte Donas Telefon. Es war Gordon, der ihr mitteilte, dass es auf dem Flug nach Inverness um 18 Uhr einen freien Platz gebe, den er für sie angesichts des akuten Notfalls telefonisch reservieren dürfe.
»Super, dann reserviere doch bitte zwei Plätze für die 18-Uhr-Maschine«, sagte sie hastig.
»In Ordnung! Dann bräuchte ich noch den Namen deines Begleiters.« Der unwirsche Unterton in seiner Stimme entging Dona nicht.
»Henderson. Amy Henderson!«
»Amy? Das ist aber ein Frauenname.«
»Ja, Amy Henderson ist eine Frau!«
Dona spürte förmlich, wie es in Gordons Hirn arbeitete und er sich fragte, ob sie lesbisch geworden war, aber sie sagte nichts, nur: »Dann bis nachher. Ich melde mich, sobald wir in Portree angekommen sind. Wahrscheinlich wird es so spät, dass wir uns erst morgen sehen. Weißt du, wie wir ins Haus kommen?«
»Ich sage Miss Armstrong Bescheid, dass ihr kommt.«
Miss Armstrong? Wie lange hatte Dona nicht mehr an die gute Seele des Hauses MacLeod gedacht. Sie war nicht nur Haushälterin, sondern auch ihr Kindermädchen gewesen.
»Oh ja, bitte sag ihr Bescheid, dass sie uns vielleicht das Gästezimmer herrichten könnte. Und Gordon, ich möchte sie sehen. Hörst du?«
»Kein Problem. Sie werden in der Kapelle aufgebahrt.« Seit Dona ihm gesagt hatte, dass sie nicht allein nach Portree kommen würde, hatte Gordon einen geschäftsmäßigen Ton angeschlagen.
»Bis dann«, sagte sie und beendete das Gespräch.
»Und freut er sich, dich wiederzusehen trotz des schrecklichen Anlasses?«, fragte Amy neugierig.
»Ich glaube, er denkt, dass du meine Freundin bist.«
»Bin ich doch auch. Und deine beste dazu, hoffe ich doch.«
»Amy, er hält dich wohl für meine Geliebte.«
»Lass ihn doch. Das würde ihm erklären, warum du bei Nacht und Nebel abgehauen bist.«
»Hast du schon gepackt? Wir müssen um halb fünf am Flughafen sein.«
»Kein Problem. Ach, ich bin so froh, dass ich dich nicht allein deinem Schicksal überlassen muss.«
»Und ich erst! Ich habe es zwar immer noch nicht ganz begriffen, aber ich bin heilfroh, dass ich morgen nicht allein bin, wenn ich sie …« Ihr traten Tränen in die Augen.
Amy nahm ihre Hand und drückte sie. »Keine Sorge, ich weiche nicht von deiner Seite, auch nicht, wenn du deine Eltern zum letzten Mal siehst.« Sie unterbrach sich und kämpfte nun selber mit den Tränen.
Wie in Trance packte Dona ihren Koffer. Es kam ihr so vor, als wäre sie in einem Albtraum gefangen, aus dem es kein Erwachen gab. Hastig holte sie die Tabletten aus der Schublade und stopfte die Packung in ihre Handtasche, aber nicht, ohne vorsichtshalber noch eine weitere Tablette zu schlucken.
PORTREE, DEZEMBER 2014
Es war kurz vor 16 Uhr, als sich über die kleine Hafenstadt Portree bereits der Mantel der Dämmerung legte. Da bis vor einer halben Stunde die Sonne geschienen hatte, herrschte am Himmel ein atemberaubendes Lichterspiel. Wild aufgetürmte Wolkenberge waren von blutroten Wolkenbändern durchzogen. Es sah aus wie gemalt. Besonders, wenn man wie Gordon MacArran von dem Fenster eines viktorianischen Stadthauses in der Beaumont Crescent einen bezaubernden Blick auf die bunten Häuser in der Quay Street genoss. Die rosa, hellblau und zartgrün getünchten Fassaden wirkten im Licht der Dämmerung über dem grauen Meer wie verspielte Farbkleckse. Dieser südländisch wirkenden Kulisse am Hafen hatte Portree sein italienisches Flair zu verdanken.
Der Anwalt und Notar aber hatte kein Auge für die Schönheiten der Natur. Er tigerte nervös von einem Ende seines Büros zum anderen, warf nur hin und wieder einen flüchtigen Blick aus dem Fenster, nahm aber nichts von dem wahr, was sich dort draußen abspielte. Er war in seinen Gedanken gefangen, denn das Telefonat mit Dona hatte ihn bis in sein Innerstes aufgewühlt. Und es missfiel ihm außerordentlich, dass sie nicht allein nach Portree kam. Selbst wenn diese Amy nicht ihre Geliebte war, sie störte in jedem Fall. Er hatte gehofft, sich als starke Schulter und Tröster unentbehrlich zu machen, und der Platz schien nun besetzt.
Gordon ballte die Fäuste. Nicht auszudenken, wenn die Anwesenheit dieser Fremden seine Pläne durchkreuzte.
Er hatte Dona nie vergessen können. Und er hatte ihr bis heute nicht verziehen, was sie ihm angetan hatte. Es war nicht nur der Schmerz über ihren Verlust gewesen, der ihn an den Rand des Wahnsinns getrieben hatte. Nein, sie hatte mit ihrer Flucht viel mehr zerstört als nur sein Herz. Monatelang war die geplatzte Hochzeit der beiden das Inselgespräch gewesen. Er hatte weder zum Bäcker noch zum Arzt gehen können, ohne dass ihn diese mitleidigen Blicke getroffen hätten. Fremde Leute am Hafen hatten ihm Trost zugesprochen. Wie er diese hohlen Sprüche gehasst hatte: Das Leben muss weitergehen! oder Die Zeit heilt alle Wunden! Nichts war wie vorher, in seiner Seele gab es eine eiternde Wunde, die nicht heilen wollte. Nach außen hatte er funktioniert, wie es sein Vater und auch Donas Vater von ihm erwarteten. Ein Junge weint nicht, das hatte er so verinnerlicht, dass er keine einzige Träne ihretwegen vergossen hatte. Und dort, wo die Trauer nicht wohnen durfte, war der Hass gewachsen.
Natürlich hatten alle, die Leute aus dem Ort und die Familien, auf seiner Seite gestanden. Keiner hatte Verständnis für Donas Verhalten gehabt. Wie oft hatte er in der Zeit danach mit Donas Vater nachts in der Bar der Destillerie gesessen und sich mit ihm bis zur Besinnungslosigkeit besoffen. Auch Jamie MacLeod hatte keine Schwäche zugelassen, sondern stereotyp verkündet, dass er keine Tochter mehr habe. Die Einzige, die Trauer zugelassen hatte, war seine Frau Alison gewesen. Man hatte sie nur noch mit einer Sonnenbrille durch den Ort schleichen sehen, um ihre verweinten Augen dahinter zu verbergen. Sie hatte sich wohl niemals von dem Schock erholt, ihre Tochter auf diese Weise verloren zu haben. Wenn es nach ihr gegangen wäre, so hätte sie sicherlich Nachforschungen über Donas Aufenthaltsort angestellt, aber niemals hätte sie den Mut aufgebracht, es hinter Jamies Rücken zu tun. Umso mehr hatte sich Gordon darüber gewundert, dass der knallharte Jamie bei ihm als seinem Testamentsvollstrecker vor knapp einem Jahr sein Testament hinterlegt hatte mit dem Hinweis, seine Tochter erbe alles.
Gordon hatte natürlich einen Blick auf das Dokument geworfen und sich über die Maßen darüber geärgert, dass Jamie das Testament nicht von ihm als seinem Notar durch die zweite Unterschrift, die nach schottischem Recht erforderlich war – und zwar von jemandem, der nicht im Testament bedacht wurde –, hatte bezeugen lassen, sondern von seinem Brennmeister Alister Broun. »Was hat der Kerl mit deinen privaten Angelegenheiten zu tun?«, hatte Gordon seinen Freund gefragt. »Ich vertraue ihm voll und ganz«, hatte Jamie erwidert. »Und mir nicht?«, hatte Gordon beleidigt erwidert, weil das erneut ein Zeichen war, wie sehr Gordon und Jamie sich voneinander entfremdet hatten.
Sehr zu Gordons Missfallen war Jamies Vertrauter seit geraumer Zeit sein neuer Braumeister, der Gordon schon auf den ersten Blick suspekt gewesen war. Er war ein Fremder von der Insel Islay und übte mittlerweile erheblichen Einfluss auf Jamie aus. Die beiden Männer hatten für ihre Single Malts besonders gute Sherryfässer aus Spanien beziehen können, von deren Aromen alle Welt schwer begeistert war, nachdem der erste Malt aus dieser Serie jüngst in Flaschen abgefüllt worden war. Außerdem fand ein achtzehnjähriger Malt gerade reißenden Absatz, nachdem der Braumeister Jamie auch beim Marketing offensichtlich mit Rat und Tate zur Seite gestanden hatte. Jedenfalls munkelte man in Portree, der Mann sei ein wahrer Zauberer, wenn es um Whisky ging.
Statt in die drohende Pleite abzudriften, schrieb das Unternehmen, seit dieser Kerl Jamies rechte Hand geworden war, wieder schwarze Zahlen. Ein Grund, dass der Kaufpreis, den ein großer Konzern Jamie MacLeod geboten hatte, überdurchschnittlich hoch war. Die Brennerei Dunvegan war die zweite – und im Vergleich zu Talisker die kleinere – auf der Insel. Dafür gehörte sie zu den wenigen in Privathand verbliebenen Destillerien ganz Schottlands. Der große Konkurrent Talisker war nie ein Familienbetrieb gewesen wie Dunvegan. Schon in den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts hatte der legendäre John Walker Anteile an der Destillerie erworben. Gordons Meinung nach war eine Destillerie in Privathand ein Auslaufmodell, das früher oder später an den Erfordernissen des modernen Markts scheitern musste. Das alles hatte er Jamie in aller Deutlichkeit klargemacht und ihn schließlich davon überzeugen können, dass auch er keine andere Wahl hatte, als den Vertrag mit Dessos zu unterschreiben. Was war bloß geschehen, dass er einen Rückzieher gemacht hatte?
Gordon hatte diesen ominösen Braumeister in Verdacht, dass er Jamie in die falsche Richtung beeinflusst hatte. In seinen Augen war der Mann ein Träumer und ein Spinner, der mit seinen Ansichten, dass der Whisky nur in der alten Tradition und unter Aufsicht schottischer Brennmeister zu seiner einzigartigen Qualität heranreifen konnte, nicht hinter dem Berg hielt. Dabei war er keinesfalls ein alter Kauz, sondern ein junger agiler Kerl, den er nicht viel älter schätzte als sich selbst und dem die jungen Ladies reihenweise zu Füßen lagen. Aber Gordon war sich sicher, dass der eingebildete Brennmeister schon bald der Vergangenheit angehören und Portree auf schnellstem Weg verlassen würde, sobald der Verkauf über die Bühne gegangen war. Er konnte sich jedenfalls kaum vorstellen, dass dieser von sich überzeugte und stolze Kerl unter dem Dach der Dessos weiter für Dunvegan arbeiten würde. Einmal davon abgesehen, dass sie diesen Querulanten nicht weiterbeschäftigen würden.
Das alles ging Gordon durch den Kopf, während er über den Umschlag, in dem das Testament verwahrt wurde, strich. Er war sehr gespannt auf Donas Gesicht, wenn er Jamies letzten Willen verlas. Daneben auf dem Schreibtisch lag der Kaufvertrag mit dem Spirituosen-Konzern, den Dona sicher, ohne mit der Wimper zu zucken, unterzeichnen würde. Was seine geschäftlichen Pläne anging, war Gordon jedenfalls äußerst zuversichtlich. So wie er sie kannte, würde sie ihm die Füße küssen, dass er sie mit einem Federstrich zu einer vermögenden Frau machte. Aber wie verhielt es sich mit seinem ganz persönlichen Plan?
Er setzte sich und strich sich nervös durch das volle dunkelblonde Haar, durch das sich noch immer keine einzige graue Strähne zog. In seine Gedanken drängte sich nun mit Macht der Streit, den er vor ein paar Tagen mit Jamie ausgefochten hatte, als der sich plötzlich geweigert hatte, den Vertrag mit dem Konzern zu unterzeichnen.
»Nur über meine Leiche«, hatte sein einstmals bester Freund und zukünftiger Schwiegervater gebrüllt, dass die Wände gewackelt hatten.
Gordon aber war vorerst ruhig geblieben und hatte mit Engelszungen auf seinen Freund eingeredet, diese Wahnsinnschance beim Schopf zu packen und an den Konzern zu verkaufen, und er hatte darauf verwiesen, dass sie sich doch einig geworden waren. Was er Jamie an dieser Stelle verschwieg, war die Tatsache, dass Mr Fuller von Dessos ihm ein großzügiges »Beraterhonorar« in Aussicht gestellt hatte, falls er Jamie endlich zum Verkauf dieser Goldgrube würde bewegen können. Eigentlich waren alle Bedenken ausgeräumt, und Gordon war an jenem Tag wie vor den Kopf geschlagen, weil sein Freund in seinen Augen einfach wortbrüchig wurde. Und ohne seine Unterschrift wäre die ganze Vorarbeit, die Gordon geleistet hatte, um den Vertrag einzutüten, umsonst gewesen. Das wollte und konnte er nicht akzeptieren, und seine Wut auf diesen Braumeister war nur noch mehr gewachsen. Er hatte es wirklich mit allen Mitteln versucht, Jamie ins Gewissen zu reden.
»Jamie, du hast eingeschlagen! Du kannst doch jetzt nicht einfach einen Rückzieher machen! Das ist deine letzte Chance, dass Dunvegan als Marke überlebt. Und Dessos ist ein fairer Vertragspartner. Der Beste, den du finden kannst. Weltweit agierend, erfolgreich an der Börse.«
»Dunvegan Whisky wurde seit Generationen von meiner Familie hergestellt, und das wird so bleiben!«
»Aber Jamie, du bleibst doch dein Boss. Sieh es mal so, du arbeitest nur unter einem sicheren Dach.« Gordon war es so leid gewesen, gebetsmühlenartig zu wiederholen, dass Jamie bei diesem Geschäft gar nicht verlieren konnte. Im Gegenteil! Warum stellte der alte Sturkopf einfach alles infrage? Das war nicht fair!
»Red kein dummes Zeug! Ich will doch kein Dessos-Sklave werden, sondern mein eigener Herr bleiben!«
An diesem Punkt der Diskussion hatte Gordon sehr mit sich kämpfen müssen, um nicht seinerseits loszubrüllen.
»Ich war dir immer ein guter Berater, ach, was rede ich? Mein Großvater war schon der beratende Freund deines Großvaters. Unsere Familien sind seit Generationen in Freude und Leid verbunden! Wer hat sich damals aufopfernd um deinen Vater gekümmert, nachdem er Waise geworden ist? Kein Geringerer als mein Urgroßvater Glen. Wie ein eigenes Kind hat er ihn aufgezogen.« Gordon tat das nicht gern, die Hypotheken der Vergangenheit auf die Waagschale zu legen, aber er hatte keine andere Wahl. Es stand zu viel auf dem Spiel – auch für ihn –, sodass er Jamie mit allen Mitteln an sein Wort ketten würde!
Der Hinweis auf die alten Familienschulden zeigte dann auch seine Wirkung.
»Junge, was dein Ur-Großvater Glen für meinen Vater getan hat, wird man niemals vergessen. Das werden sich noch meine Enkelkinder erzählen …« Er hatte sich hastig unterbrochen. »Und auch ich stehe in deiner Schuld, weil meine Tochter dich im Regen hat stehen lassen, aber du musst mir verzeihen. Ich kann nicht anders, als meinem Herzen zu folgen. Es tut mir leid, dass ich dir Hoffnungen auf diesen Verkauf gemacht habe, aber ich kann seitdem keine Nacht mehr ruhig schlafen. Nein! Ich kann den verdammten Vertrag einfach nicht unterschreiben. Ich habe Albträume, in denen ich vor meinem Vater, meinem Großvater und meinem Urgroßvater auf der Anklagebank sitze. Versteh doch, ich habe geglaubt, wir steuern unweigerlich auf den Ruin zu, aber dank Alisters unermüdlichen Einsatzes für Dunvegan geht es bergauf. Junge, ich muss auf mein Herz hören, und das schreit: Nein!«
Gordon hatte einen verächtlichen Zischlaut ausgestoßen. »Hier geht es nicht um dein Herz, hier geht es um ein Geschäft. Um ein verdammt gutes Geschäft für dich! Du kannst den Laden nicht ewig leiten, und du hast nun mal keine fähigen Nachfolger. Die Firma wird früher oder später verkauft. Das weißt du genau. Darum nutze doch die Chance, dein vieles Geld zu Lebzeiten auszugeben.«
»Junge, ich habe alles, was ich brauche. Ein wunderbares Anwesen, ein neues Boot, ich mache jedes Jahr an Ostern mit Alison Urlaub an der Côte d’Azur … Ich brauche meine Arbeit, ich möchte in der Destillerie meinen letzten Atemzug tun. Mit Geld, mein Junge, kannst du mich nicht locken.«
»Verdammt, dann denk mal darüber nach, was du mir damit antust. Ich habe ein halbes Jahr dafür geschuftet, damit die Herren von Dessos und du euch einig werdet.«
»Schick mir eine Rechnung«, stöhnte Jamie.
»Nein, du kannst jetzt nicht mehr aussteigen. Das kannst du mir nicht antun. Wie stehe ich da? Als Vertragsbrüchiger!«
»Ich habe noch nichts unterschrieben, mein Junge, merk dir das. Und man hat mir die Augen geöffnet, dass es ein Wahnsinn wäre, wenn ich, Jamie MacLeod, mich dem Diktat der Konzerne beuge.«
»Interessant! Man hat dir die Augen geöffnet. Gib doch zu, dass es dieser arrogante Alister Broun war, der dir eine Gehirnwäsche verpasst hat! Der Kerl ist kein Geschäftsmann, der ist nichts anderes als ein eingebildeter Whiskypanscher …«
»Es reicht, Gordon, was Alister und ich auf die Beine gestellt haben, das hat mich zutiefst erfüllt. Unser Whisky ist einzigartig, und du siehst doch, dass der Erfolg mir Recht gibt. Unsere Abnehmer sind die besten Lokale der ganzen Welt. Wir haben gerade einen Riesenauftrag mit einem Abnehmer in Nova Scotia abgeschlossen. Ich brauche den Konzern nicht. Kapier das endlich, und nimm es wie ein Mann!«
Daraufhin war Jamie einfach aufgesprungen und hatte Gordons Büro grußlos verlassen. Aber Gordon war nicht bereit, sich dieser Launenhaftigkeit des Alten zu beugen. Nein, er würde einen Weg finden, ja, finden müssen. Es hatte Gordon viel Überredungskunst gekostet, mit Mr Fuller, dem Vertreter von Dessos, der für die Abwicklung des Vertrags zuständig war, einen letztmaligen Aufschub der Vertragsunterzeichnung auszuhandeln, aber er hatte einen Eid geschworen, dass es nur noch eine Formalie wäre. Und nun stand er vor dem Nichts! Einmal abgesehen davon, dass diese Schlappe seinem beruflichen Ansehen schaden würde, würde Fuller ihm die unter der Hand ausgehandelte Erfolgsprovision verweigern, und das konnte ihn Kopf und Kragen kosten …
Ach, wenn das doch mit dem Testament erst einmal reibungslos über die Bühne gegangen wäre, dachte Gordon. Nach der Vertragsunterzeichnung würde er alles daran setzen, Dona zurückzuerobern. Er konnte nur hoffen, dass sie nicht zum anderen Ufer gewechselt oder in London doch noch irgendein Kerl war, dem sie sich verpflichtet fühlte. Ob sie sich sehr verändert hatte? Auf dem Foto in der Zeitung hatte sie jedenfalls fantastisch ausgesehen. Verträumt öffnete er seine Schreibtischschublade und holte den ausgeschnittenen Artikel hervor. Zärtlich strich er über das Bild. Wenn sie erst meine Frau wird, dann kann ich ihr alles verzeihen, dachte er seufzend. Dann hören die Albträume auf, in denen ich ihr einfach nur den Hals umdrehen möchte. Ja, dessen war er sich sicher: Wenn er sie erst wieder besaß, würde sich der Hass wieder in unverbrüchliche Liebe verwandeln. Einen Hauch dessen hatte er ja bereits bei dem Telefonat mit ihr gespürt. Allein ihre wunderschöne samtene Stimme ließ ihn weich werden. Bis zu dem Moment, in dem sie ihm von ihrer Begleitung erzählt hatte. Das hatte ihn sehr erbost. Wenn es nur eine gute Freundin ist, werde ich gewinnen, sprach er sich gut zu. Er ließ den Artikel hastig zurück in die Schublade gleiten. Nicht dass der Artikel auf seinem Schreibtisch lag, wenn Dona zur Testamentseröffnung in sein Büro kam. In diesem Augenblick fiel Gordon ein, dass er Miss Armstrong noch gar nicht Bescheid gesagt hatte.
Die Haushälterin brach in Tränen aus, als Gordon ihr Donas Ankunft in Portree avisierte.
»Oh Gott, wenn das doch Mrs MacLeod noch hätte erleben können! Das Kind kommt zurück, aber dann muss ich doch was kochen. Sie liebt Hummer, aber wo bekomme ich den am Sonntag her?«
»Miss Armstrong, die Damen – sie bringt eine Freundin mit – werden wahrscheinlich erst am späten Abend bei Ihnen eintreffen. Machen Sie sich keine großen Umstände. Sorgen Sie für einen kleinen Imbiss, und bereiten Sie ihnen bitte das Gästezimmer vor. Ich glaube nicht, dass Dona nach großem Menü zumute ist. Der Anlass ihrer Rückkehr ist ja nicht gerade erfreulich.«
»Ja, ja, Mr MacArran, Sie haben völlig recht. Ich kann es ja auch noch nicht fassen. Es ist eine Tragödie.« Die Haushälterin schniefte laut ins Telefon.
»Bis morgen. Ich werde gegen zehn Uhr bei Ihnen sein und die Formalitäten mit Dona besprechen. Machen Sie es gut.«
Hastig beendete Gordon das Gespräch. Er war ganz bestimmt nicht in der Verfassung, Miss Armstrong tröstende Worte zu spenden.
Sein Blick fiel auf eine alte, verstaubte Kiste, die er beim Ausmisten des Archivs seines Urgroßvaters im Keller gefunden hatte. Gordon hatte dringend Platz für seine Akten benötigt und viel von dem alten Kram einfach entsorgt. In der hintersten Ecke hatte er diese Kiste gefunden mit der altmodischen Aufschrift. Mairie MacLeod. Interessiert hatte er den Deckel gehoben und einen Blick hineingeworfen. Mairie MacLeod war Donas Urgroßmutter, die einst für einen handfesten Skandal im beschaulichen Portree gesorgt hatte, als sie ihren Ehemann bei Nacht und Nebel zusammen mit ihrem Geliebten verlassen und ihren Sohn Finlay einfach mutterlos zurückgelassen hatte. Es liegt in der Familie, diese Leichtlebigkeit der MacLeod-Frauen, hatte er verächtlich gedacht, als er die verstaubten Tagebücher der Geächteten aus der reichlich mit Intarsien verzierten Kiste geholt hatte, um sie sofort wieder ungelesen hineinzustopfen. Er hatte gehofft, etwas Wertvolles in der Kiste zu finden, aber das Geschreibsel einer untreuen Ehefrau interessierte ihn nicht im Geringsten. Weggeworfen hatte er sie dennoch nicht. Wer wusste schon, wozu diese alten Aufzeichnungen noch einmal gut waren? Vorhin hatte er sie aus dem Keller geholt. Er konnte sich nämlich gut vorstellen, dass Dona sich über diese Entdeckung freuen würde. Er würde ihr diese Kiste mit großzügiger Geste bei der Testamentseröffnung überlassen. Und dann dezent darauf hinweisen, dass es sein Urgroßvater Glen gewesen war, der ihren Großvater Finlay einst wie einen eigenen Sohn aufgenommen hatte.
Mit spitzen Fingern öffnete er erneut den Deckel und nahm das obere von vier eng beschriebenen Heften zur Hand. Es roch entsetzlich nach altem Papier und Mottenpulver, aber die Schrift war noch einwandfrei zu lesen. Gordon wunderte sich, dass sie auf Englisch geschrieben waren, denn bei den MacLeods wurde damals genau wie bei den MacArrans auch in der Schriftsprache vorwiegend das Gälische benutzt. Gordon hätte wahrscheinlich nicht angefangen, in dem Tagebuch zu lesen, wenn er beim Durchblättern nicht über eine verräterische Stelle gestolpert wäre.
Glen hatte Tränen in den Augen, als er mir schwor, er hätte, wie ich, für einen Augenblick daran gedacht, Portree hinter sich zu lassen und mit mir irgendwo anders ein neues Leben anzufangen, aber er könne nicht.
Gordon wusste zwar, dass Mairie und Glen Großcousine und Großcousin gewesen waren, aber das klang so gar nicht nach der Wertschätzung eines entfernten Cousins. Nein, diese Zeilen erregten seine Neugier. Und vielleicht konnte er sich mit dieser Lektüre von seinen quälerischen Gedanken ablenken, die ihn unwillkürlich überfallen und wie eine Krake umklammern würden, sobald er das Büro verlassen hatte und allein in seinem großen Haus am Seafield Place saß …
PORTREE, DEZEMBER 1919
Mir ist schon den ganzen Tag zum Heulen zumute. Natürlich ist es für alle anderen Beteiligten ein wunderschönes Ereignis, dass Glen heute seine Albiona heiratet. Sie macht ihrem Namen jedenfalls alle Ehre. Sie hat einen weißen ebenmäßigen Teint, der mich zum Erblassen bringt. Sie ist wirklich sehr anmutig. Das muss ich ihr lassen, wenngleich der Stachel der Eifersucht in mir bohrt.
Ich werde nie vergessen, wie ich vor einem Jahr in das Haus der MacArrans kam. Als Kriegswaise, weil mein Vater im August 1917 in Frankreich von deutschen Soldaten erschossen worden war. Meine Mutter war schon lange tot. Sie ist bei meiner Geburt gestorben. Mich brachte man in ein Waisenheim in Glasgow, und ich hatte mich darauf eingestellt, in dieser Institution bis zur Volljährigkeit zu bleiben. Die Nonnen handelten willkürlich. Einige schlugen mich, andere steckten mir heimlich Bücher zu. Ich hatte mich scheinbar in mein Schicksal gefügt. Was hätte ich auch tun sollen? Rebellieren? Was hätte mir das gebracht? Nur erneute Repressalien. Ich machte mich unsichtbar, während mein Herz vor Rebellion vibrierte und ich darauf sann, wie ich es ihnen heimzahlen würde, sobald ich wieder in Freiheit wäre. Und dann, eines Tages, rief mich die Oberin in ihr Büro. Ich fragte mich, ob sie wohl Gedanken lesen können und mich dafür bestrafen würden, doch dann kam alles anders. Im Büro saß ein Ehepaar. Die Frau eine elegante, hochgewachsene Dame, der Mann ein schlanker gut aussehender, sehr schottisch gekleideter Herr.
Ich senkte beschämt die Augen, weil ich nicht wusste, was das zu bedeuten hatte.
»Liebe Mairie, du kannst dich glücklich schätzen«, sagte die Oberin schließlich. »Das sind Carden und Galissa MacArran, Verwandte deines Vaters, die dich zu sich holen wollen.«
Ich glaube, ich habe die beiden ziemlich ungläubig angesehen. Sollte es wirklich Wunder geben und mir eine Zukunft in einer Familie beschieden werden? Ich meine, ich wusste, dass Vater einen Cousin auf der Isle of Skye hatte, aber die beiden Männer hatten seit Ewigkeiten keinen Kontakt mehr zueinander. Ich konnte mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass ich den beiden schon jemals zuvor begegnet war. Und trotzdem waren sie hergekommen, um mich zu retten. Ich konnte mein Glück kaum fassen und brachte keinen Ton heraus. Das war also das Wunder, das ich manchmal in meine Gebete eingeschlossen hatte, an das ich aber nie wirklich hatte glauben können.
»Ja, mein Kind, der Freund deines Vaters, dein Vormund, hat uns geschrieben, dass du nach dem Tod meines Vetters in ein Heim gekommen bist, weil er dich leider nicht in seinem Haus aufnehmen konnte. Und dass er gehört habe, die Zustände im Heim wären einer gesunden Entwicklung nicht zuträglich …«
Er wurde in scharfem Ton von der Mutter Oberin unterbrochen.
»Ich weiß ja nicht, was das Mädchen ihrem Vormund bei seinen Besuchen erzählt hat, aber bei uns gibt es keinen Grund zu klagen. Wenn Lügen über uns verbreitet werden, dann tun es die Mädchen, um sich wichtig zu machen.«
Stumm streckte ich ihr meine rechte Hand entgegen, über deren Rücken sich ein blauer Striemen zog.
»Das war die Strafe, weil ich mir das Gesicht nicht mit eiskaltem Wasser abwaschen wollte«, erklärte ich ungerührt.
»Oh, mein Gott«, rief die Tante entsetzt aus.
Wir nehmen dich sofort mit nach Portree«, sagte der Mann entschlossen, während er der Oberin einen strengen Blick zuwarf.
»Ja, wir würden dich sehr gern mitnehmen, mein Kind«, bemerkte nun auch die Frau, die ein sehr freundliches und offenes Gesicht hatte.
Ich nickte eifrig. Alles war besser, als mein Dasein in diesem Heim zu fristen, zumal ich nach dem Hinweis auf den Striemen am Handrücken, der von einer Reitgerte herrührte, die Schwester Martha stets bei sich führte, sicherlich mehr Repressalien ausgesetzt sein würde als zuvor.
»Heißt das, du kommst mit uns?«, fragte der elegante Herr. »Obwohl wir Fremde für dich sind?«
»Ja, sicher, ich weiß doch, dass du Onkel Carden bist. Vater hat viel von dir erzählt«, log ich, denn mein Vater hatte, wenn überhaupt, auf seine eingebildeten Verwandten auf der Isle of Skye geschimpft, aber ich wollte freundlich zu meinem Retter sein.
»Gut, dann können Sie unsere Mairie mitnehmen«, erklärte die Oberin gönnerhaft, während sie mich mit einem vorwurfsvollen Blick maß. Ich glaube, sie war in diesem Augenblick froh, mich loszuwerden.
Und ich war überglücklich bei der Vorstellung, dieser Hölle zu entkommen, aber der Abschied von den Freundinnen war bitter. Auf keine von ihnen wartete ein solches Wunder in Gestalt eines zugewandten Onkels und einer treusorgenden Tante.
Erst im Wagen kamen mir Zweifel. Die beiden Menschen waren mir doch wirklich völlig fremd. Ich saß allein hinten im Auto und fragte mich plötzlich, ob sie es eventuell nur auf das Vermögen meines Vaters abgesehen hatten. Dass er Geld hinterlassen hatte, wusste ich von einer der netten Schwestern. Sie hatte mir einmal im Vertrauen gesagt, dass ich einen Sonderstatus genösse, weil mich ein nicht unbeträchtliches Erbe erwarten würde.
»Du bist kein armes Waisenkind, sondern eine reiche Erbin«, hatte sie mir wörtlich gesagt.
Ich hatte das gar nicht ernst genommen, weil ich fand, dass ich im Heim nicht anders behandelt wurde als die übrigen Mädchen. Doch wenn ich es jetzt bedenke, ich habe zwar auch meine Blessuren davongetragen, war aber niemals Opfer von willkürlichen Misshandlungen von den beiden grausamsten Schwestern, die gern grundlos und brutal auf einige der Mädchen eingeprügelt haben.
Ich weiß auch nicht, woher ich den Mut genommen habe, als ich dort hinten im Wagen allein saß.
»Nehmt ihr mich nur wegen meines Geldes auf?«, hörte ich mich plötzlich in scharfem Ton fragen.
Der Mann am Steuer brach zu meiner großen Verwunderung in ein lautes Lachen aus.
»Mädchen, Geld haben wir selbst genug. Ich hätte es nicht ertragen, wenn meine Großnichte in diesem Heim vor sich hinvegetieren würde. Nein, ich habe mit deinem Vater, diesem Sturkopf, zwar meine Schwierigkeiten gehabt: Das ging so weit, dass wir nach einem Streit kein Wort mehr miteinander gesprochen haben …« Er brach ab. Offensichtlich war es ihm peinlich, dass er so viel preisgegeben hatte.
In diesem Augenblick drehte sich seine Frau um und lächelte mich an. »Du bist ja kein Kind mehr. Also, worum geht es bei zwei Jungspunden, wenn sie kein Wort mehr miteinander reden?«
Ich konnte es mir schon denken, worauf sie anspielte, aber ich wollte nicht vorlaut sein.
»Sie waren alle beide in deine schöne Mutter verliebt, aber mein Schatz hatte keine Chance gegen seinen charismatischen Cousin«, lachte sie.
»Galissa, nun übertreib mal nicht. So unwiderstehlich war mein lieber Cousin nun auch wieder nicht.«
Das zauberte mir ebenfalls ein leises Lächeln auf die Lippen, denn mir gefiel, wie offen und humorvoll die beiden waren und mich damit ganz offensichtlich aufzuheitern versuchten.
»Ich hätte mich doch immer für dich entschieden, aber damals hattest du ja noch kein Auge für mich«, flötete seine Frau.
»Du warst vierzehn, Liebling, und für kleine bezopfte Mädchen hatte ich in der Tat keinen Blick.«
»Also, mein Kind«, sagte Tante Galissa, die sich mir immer noch zugewandt hatte, mit warmer Stimme. »Als uns der Freund deines Vaters angeschrieben hat, haben wir uns sofort in den Wagen gesetzt, um dich zu retten. Was auch immer zwischen den beiden jungen Herren für Differenzen geherrscht haben mögen, du gehörst doch zur Familie.«
Einige Zeit später hielt Onkel Carden vor einem Anwesen, nachdem er uns mit seinem schicken Wagen kreuz und quer durch die Highlands gekurvt hatte und wir mit der letzten Fähre zur Insel Skye übergesetzt hatten.
»Wir sind da«, sagte seine Frau. »Ich hoffe, du fühlst dich bei uns wohl.«
Neugierig stieg ich mit meinem Köfferchen in der Hand aus und folgte meinen neuen Eltern zum Haus. Es war ein großes Anwesen, das etwas außerhalb des Ortes in einem prächtigen Park lag.
Und in der Eingangshalle habe ich ihn dann zum ersten Mal gesehen und war hingerissen. Groß wie ein Baum, mit einem wunderschönen kantigen Gesicht und einem schwarzen Lockenkopf stand er vor mir, lächelte und nahm mir mein Köfferchen ab.
Wenn es etwas gäbe wie Liebe auf den ersten Blick, dann wäre er es, ging es mir verschämt durch den Kopf.
Doch ich wurde jäh aus meinen romantischen Gedanken gerissen, als die Dame des Hauses uns einander vorstellte. »Das ist mein Sohn Glen, und das ist deine Cousine Mairie.«
Er reichte mir die Hand. »Herzlich willkommen, Mairie«, sagte er, und der Zauber verwandelte sich in eine höfliche Begrüßung unter Verwandten.
Jedenfalls äußerlich, denn ich ahnte, dass mich mein Gefühl nicht getrogen hatte. Auch Glen sah vom ersten Augenblick etwas anderes in mir als nur eine entfernte Cousine. Doch schon an demselben Abend wurde mir seine Verlobte Albiona als seine zukünftige Frau präsentiert.
Ich habe in der ersten Nacht im Hause MacArran in meine Kissen geweint, aber ich war vernünftig genug, meinem frischgebackenen Vetter Glen möglichst aus dem Weg zu gehen. Mir kam sehr entgegen, dass er in Edinburgh studierte und nur jedes zweite Wochenende nach Portree kam. Vor ein paar Wochen haben wir der magischen Anziehung zwischen uns gegen alle Vernunft nachgegeben. Wir haben uns – ein einziges Mal nur – heiß und innig geküsst, aber in dem unvergleichlichen Moment, in dem wir uns danach in die Augen gesehen haben und unser Leben vielleicht doch noch eine andere Wendung hätte nehmen können, kam seine Schwester Caillin um die Ecke, und wir fuhren erschrocken auseinander.
»Lasst euch nicht stören«, bemerkte sie in gehässigem Ton, und ich konnte nur hoffen, dass sie den Kuss selbst nicht beobachtet hatte.
Als Caillin verschwunden war, wollte ich meiner Sorge Ausdruck verleihen, aber da teilte mir Glen hektisch mit, dass er demnächst Albiona heiraten würde. Ich fiel aus allen Wolken, denn während wir uns küssten, hatte ich mich für ein paar träumerische Momente der Illusion hingegeben, dass unsere Gefühle füreinander alle Hindernisse, die unserer Liebe im Weg standen, würden beseitigen können.
Glen hatte Tränen in den Augen, als er mir schwor, er hätte, wie ich, für einen Augenblick daran gedacht, Portree hinter sich zu lassen und mit mir irgendwo anders ein neues Leben anzufangen, aber er könnte nicht.
Ich habe ihn an dem Tag einfach stehen gelassen, bin auf mein Zimmer gerannt und habe stundenlang geweint.