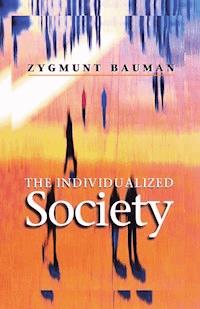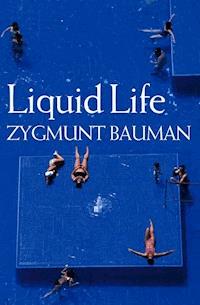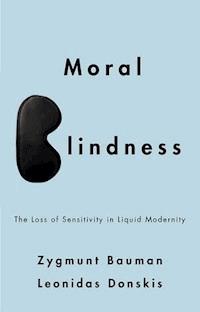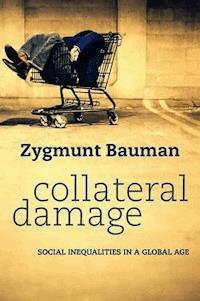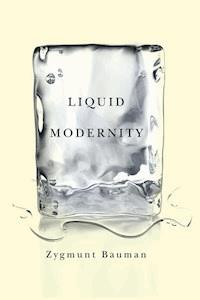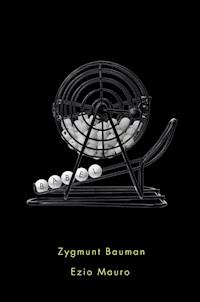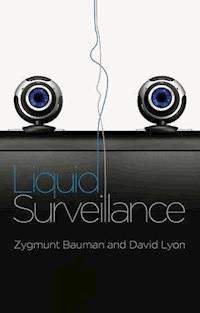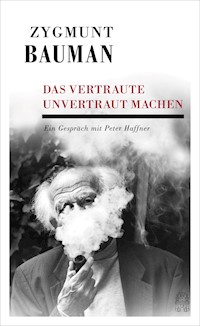
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Zygmunt Bauman, der im Januar 2017 starb, war einer der wichtigsten Soziologen und Denker des 20. Jahrhunderts, der unter anderem den Begriff der flüchtigen Moderne geprägt hat. Gelesen auf allen Kontinenten der Welt, war der als »Kopf der Globalisierungsgegner« und »Prophet der Postmoderne « bezeichnete Gelehrte eine Ausnahmeerscheinung in der Welt der Geisteswissenschaften. In seinem Werk ist – wie auch in diesem Gesprächsband – Politisches und Persönliches nicht zu trennen: Weshalb wir die Fähigkeit zu lieben verlernen oder Mühe mit moralischen Urteilen haben, sind Fragen, deren gesellschaftliche wie individuelle Aspekte Zygmunt Bauman gleichermaßen gründlich auslotet. Intellekt und Engagement, Macht und Identität, Religion und Fundamentalismus, Glück und Moral, Utopie und Geschichte sind einige der Themen, die ihn zeit seines Lebens beschäftigten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 190
Ähnliche
Zygmunt Bauman
Das Vertraute unvertraut machen
Gespräche mit Peter Haffner
Hoffmann und Campe
Vorwort
Als ich Zygmunt Bauman zum ersten Mal besuchte, war ich verblüfft über das, was mir als Widerspruch zwischen Person und Werk erschien. Der wohl einflussreichste Soziologe Europas, dessen Zorn auf die herrschenden Verhältnisse in jeder Zeile seiner Bücher zu spüren ist, bezauberte mit verschmitztem Humor, entwaffnendem Charme und einer Lebensfreude, die ansteckend war.
Seit seiner Emeritierung 1990 von der University of Leeds hatte Zygmunt Bauman in geradezu beängstigender Geschwindigkeit ein Buch nach dem anderen veröffentlicht. Die Themen reichen von Intimität bis zur Globalisierung, vom Reality TV bis zum Holocaust, vom Konsumismus bis zum Cyberspace. Gelesen auf allen Kontinenten der Welt, war der als »Kopf der Globalisierungsgegner«, »Führer der Occupy-Bewegung« oder »Prophet der Postmoderne« bezeichnete Gelehrte eine Ausnahmeerscheinung in der Welt der Geisteswissenschaften. Deren Fragmentierung in scharf voneinander abgegrenzte und eifersüchtig verteidigte Fachgebiete ignorierte er mit dem unstillbaren Interesse eines Renaissance-Menschen. In seinen Betrachtungen sind Politisches und Persönliches nicht getrennt; weshalb wir die Fähigkeit zu lieben verlernen oder Mühe mit moralischen Urteilen haben, sind Fragen, deren gesellschaftliche wie individuelle Aspekte Zygmunt Bauman gleichermaßen gründlich auslotet. Die Ergebnisse sind so wenig ein Anlass zur Beruhigung wie die Warnung, dass die fabrikmäßige Auslöschung von Menschen kein Akt der Barbarei einer Vergangenheit ist, die nicht wiederkehren kann.
Es war diese epische Weltsicht, die mich faszinierte, als ich seine Bücher zu lesen begann. Was Zygmunt Bauman schreibt, kann einen nicht gleichgültig lassen, selbst wenn man diesem oder jenem nicht zustimmen mag oder gar mit dem Ganzen nicht einverstanden ist. Wer sich mit seinem Werk auseinandersetzt, sieht die Welt und sich selber nicht mehr in gleicher Weise wie zuvor. Er sehe seine Aufgabe darin, das Vertraute unvertraut und das Unvertraute vertraut zu machen, sagte Zygmunt Bauman, der dies als die Aufgabe der Soziologie schlechthin betrachtete.
Das kann nur, wer den ganzen Menschen im Auge hat und über sein Fachgebiet hinausgreift in Philosophie und Psychologie, Anthropologie und Geschichte, Kunst und Literatur. Zygmunt Bauman ist kein Mann der Details, der statistischen Analysen und Umfragen, der Zahlen, Fakten und Hochrechnungen. Er malt mit breitem Pinsel auf große Leinwand, stellt Behauptungen auf, wirft Thesen in die Diskussion und provoziert Auseinandersetzungen. In der berühmten Kategorisierung von Denkern und Schriftstellern, die Isaiah Berlin nach dem Diktum des griechischen Dichters Archilochos vorgenommen hat – »Der Fuchs weiß viele Dinge, aber der Igel weiß eine große Sache« – ist Zygmunt Bauman Igel und Fuchs zugleich. Er hat den Begriff der »flüchtigen Moderne« geprägt, unserer Gegenwart, die alle Lebensverhältnisse in bisher unbekanntem Tempo verändert – Liebe, Freundschaft, Arbeit, Freizeit, Familie, Gemeinschaft, Gesellschaft, Religion, Politik und Macht. »Mein Leben besteht darin, Information zu recyceln«, meinte er einmal. Das klingt bescheiden, bis man sich vergegenwärtigt, um welche Mengen Stoff es sich dabei handelt.
In einer Zeit der Angst und Unsicherheit, wo so viele sich von den Patentrezepten des Populismus blenden lassen, ist die kritische Analyse der Probleme und Widersprüche unserer Gesellschaft und der Welt nötiger denn je. Sie ist die Voraussetzung dafür, über Alternativen nachdenken zu können, selbst wenn solche nicht in Griffweite sind. Zygmunt Bauman, einst Kommunist, gab allen gescheiterten Hoffnungen zum Trotz den Glauben an die Möglichkeit einer besseren Gesellschaft nicht auf. Sein Interesse galt nicht den Gewinnern, sondern den Verlierern, den Entwurzelten und Entrechteten, der wachsenden Zahl von Unterprivilegierten, zu denen nicht mehr nur arme Farbige in fernen Ländern zählen, sondern auch Angehörige der westlichen Arbeiterschaft. Die Furcht, den Boden unter den Füßen zu verlieren, der in den guten Jahren der Nachkriegszeit so fest schien wie Fels, ist heute ein weltweites Massenphänomen, von dem auch die Mittelschicht nicht verschont bleibt. In einem Klima, das verlangt, sich mit dem Gegebenen abzufinden und diese Welt im Sinne von Leibniz für die beste aller möglichen zu halten, verteidigt Zygmunt Bauman die Utopie. Nicht als Bauanleitung für ein Luftschloss der Zukunft, sondern als Ansporn zur Verbesserung der Umstände, unter denen wir hier und jetzt leben.
Zygmunt Bauman empfing mich zu vier langen Gesprächen über sein Lebenswerk in seinem Haus im englischen Leeds. Ein verwunschener Vorgarten mit moosüberwachsenen Stühlen, der Tisch von Gebüsch in Besitz genommen, grenzt das Anwesen an eine stark befahrene Straße, als wollte es illustrieren, dass erst der Gegensatz die Dinge so richtig zur Geltung bringt. Schlank und hochgewachsen, war Zygmunt Bauman mit seinen 90 Jahren so lebhaft und geistig präsent wie eh und je; mit weiträumigen Handbewegungen untermalte er seine Ausführungen, als dirigierte er ein Orchester, oder haute mit der Faust auf die Armlehne des Sessels, um einer Aussage Nachdruck zu verschaffen. Wenn er ab und an vom nahen Tod sprach, tat er es mit der Gelassenheit dessen, der als Soldat im Zweiten Weltkrieg, als polnischer Jude, Flüchtling in Sowjetrussland und Opfer der antisemitischen »Säuberung« Polens 1968 die dunkle Seite der »flüssigen Moderne«, deren Theoretiker er wurde, am eigenen Leib erfuhr.
Immer war das Couchtischchen überladen mit Croissants und Biskuits, Canapés und Fruchttörtchen, Keksen und Krabbencrème, flankiert von heißen und kalten Getränken und Säften wie polnischem »Kompott«, und der Hausherr ließ seinen Gast an seinen Gedankengängen teilhaben, ohne zu vergessen, ihn immer wieder zu ermahnen, auch ja alles aufzuessen, was er da an Köstlichkeiten bereitgestellt hatte.
Zygmunt Bauman redete über das Leben, die Versuche, es zu gestalten, die das Schicksal immer wieder vereitelt, und das Bestreben, dabei ein Mensch zu bleiben, der sich selber in die Augen sehen kann. Er wünsche mir, sagte er zum Abschied, meine beiden Hände ergreifend, dass ich so alt werde wie er, habe doch jedes Alter, ungeachtet aller Beschwerlichkeiten, seine schönen Seiten.
Zygmunt Bauman starb am 9. Januar dieses Jahres in seinem Haus in Leeds.
Diese letzten Gespräche mit ihm verstehen sich als Einladung an Leserinnen und Leser, sie fortzusetzen, wo und mit wem auch immer.
Peter Haffner
Januar 2017
Liebe und Geschlecht
Partnerwahl: Warum wir das Lieben verlernen
Beginnen wir mit dem Wichtigsten: der Liebe. Sie sagen, wir seien dabei, das Lieben zu verlernen. Wie kommen Sie darauf?
Der Trend, einen Partner im Internet zu suchen, folgt dem Trend zum Internetshopping. Ich selber gehe nicht gern in Läden, kaufe die meisten Sachen online, Bücher, Filme, Kleider. Wollen Sie ein neues Jackett, zeigt Ihnen die Webseite des Onlineladens einen Katalog. Suchen Sie einen Partner, zeigt Ihnen die Dating-Webseite auch einen Katalog. Das Muster der Beziehungen zwischen Kunden und Waren wird zum Muster der Beziehungen zwischen Menschen.
Was ist der Unterschied zu früher, als man die künftige Lebensgefährtin auf einem Dorffest oder Ball in der Stadt kennenlernte? Da hatte man doch auch seine Präferenzen?
Leuten, die unter Schüchternheit leiden, kann das Internet sicher helfen. Sie müssen sich nicht überwinden, eine Frau anzusprechen, weil sie fürchten, zu erröten. Sie können leichter eine Bindung knüpfen, sind nicht so blockiert. Doch im Onlinedating geht es um das Bemühen, die Eigenschaften des Partners zu definieren, die den eigenen Sehnsüchten entsprechen. Man wählt ihn aus nach Haar- und Hautfarbe, Größe, Figur, Brustumfang, Alter, Interessen und Hobbys, Vorlieben und Abneigungen. Dahinter steckt die Idee, man könne ein Liebesobjekt aus einer Anzahl messbarer körperlicher und sozialer Eigenschaften zusammensetzen. Dabei gerät das Entscheidende aus dem Blick: die menschliche Person.
Aber selbst wenn der Typus, auf den man steht, so definiert wird, ändert sich doch alles, sobald man der Person begegnet. Die ist ja viel mehr als die Summe solcher Äußerlichkeiten.
Die Gefahr ist, dass das Muster von Beziehungen so wird wie das Verhältnis zu einem Gebrauchsgegenstand. Einem Stuhl schwört man nicht Treue. Warum sollte ich schwören, ich werde auf diesem Stuhl sterben? Wenn er mir nicht mehr gefällt, kaufe ich einen neuen. Es ist kein bewusster Prozess, aber es ist die Art, in der wir lernen, die Welt und die Menschen zu sehen. Was passiert, wenn man jemanden trifft, der attraktiver ist? Es ist wie bei der Barbiepuppe. Kommt eine neue Version auf den Markt, tauscht man die alte gegen diese aus.
Sie meinen, man trennt sich voreilig.
Eine Beziehung geht man ein, weil man sich Befriedigung verspricht. Bekommt man das Gefühl, eine andere Person werde einem mehr geben, bricht man sie ab und beginnt eine neue. Um eine Beziehung zu beginnen, braucht es die Vereinbarung von zwei Personen. Um sie abzubrechen, nur eine. Das bedeutet, dass beide Partner in ständiger Angst leben, verlassen zu werden. Dass man weggeräumt wird wie ein Jackett, das aus der Mode ist.
Das liegt doch in der Natur jeder Vereinbarung.
Sicher, doch früher war es kaum möglich, eine Beziehung abzubrechen, selbst wenn sie nicht befriedigte. Eine Scheidung war schwierig, eine Alternative zur Ehe sozusagen inexistent. Man litt, blieb aber zusammen.
Und weshalb ist die Freiheit, auseinandergehen zu können, schlechter als der Zwang, unglücklich zusammenbleiben zu müssen?
Man gewinnt etwas, verliert aber auch etwas. Man ist freier, leidet jedoch darunter, dass der Partner das auch ist. Es führt zu einem Leben, in dem Beziehungen und Partnerschaften nach dem Muster des Mietkaufs geformt werden. Wer sich aus Bindungen lösen kann, muss sich nicht anstrengen, sie zu erhalten. Menschen sind nur so lange wertvoll, wie sie Befriedigung verschaffen. Dahinter steht der Glaube, dauerhafte Bindungen stünden der Suche nach dem Glück entgegen.
Und das sei ein Irrtum, schreiben Sie in Liquid Love, Ihrem Buch über Freundschaft und Beziehungen.
Es ist das Problem der »flüchtigen Liebe«. In turbulenten Zeiten benötigt man Freunde und Partner, die einen nicht hängenlassen. Die für einen da sind, wenn man sie braucht. Der Wunsch nach Stabilität ist wichtig im Leben. Die 16 Milliarden Dollar für Facebook kapitalisieren dieses Bedürfnis, nicht allein zu sein. Andererseits scheut man jedoch die Verpflichtung, sich auf jemanden einzulassen und sich zu binden. Man fürchtet, man verpasse etwas. Man will einen sicheren Hafen, aber gleichzeitig die Hände frei haben.
Sie waren 61 Jahre mit Janina Lewinson verheiratet, die 2009 starb. Nach ihrer ersten Begegnung, schreibt sie in ihren Erinnerungen A Dream of Belonging, seien Sie nicht von ihrer Seite gewichen. Sie hätten jedesmal gerufen, »Was für ein glücklicher Zufall!«, dass Sie auch dorthin müssten, wo sie hinwollte. Und als sie Ihnen mitteilte, dass sie schwanger ist, hätten Sie auf der Straße getanzt und sie geküsst, als uniformierter Hauptmann der polnischen Armee, was Aufsehen erregte. Noch Jahrzehnte nach der Heirat, schreibt Janina, hätten Sie ihr Liebesbriefe geschickt. Was macht wahre Liebe aus?
Als ich Janina sah, wusste ich sofort, dass ich nicht weiter zu suchen brauchte. Es war Liebe auf den ersten Blick. Innerhalb von neun Tagen machte ich ihr den Heiratsantrag. Wahre Liebe ist jene schwer fassbare, aber überwältigende Lust am »ich und du«, am Füreinander da sein, am Einswerden. Das Vergnügen, dass es auf einen ankommt in einer Sache, die nicht nur für einen selber wichtig ist. Gebraucht zu werden oder gar unersetzlich zu sein ist ein beglückendes Gefühl. Es ist schwer zu erlangen. Und unerreichbar, wenn man in der Einsamkeit des Egoisten verharrt, der nur an sich selber interessiert ist.
Liebe verlangt also ein Opfer.
Wenn das Wesen der Liebe in der Neigung besteht, dem Liebesobjekt in allem beizustehen, es zu unterstützen, zu fördern und zu loben, dann muss der Liebende bereit sein, die Sorge um sich selbst zugunsten der Geliebten zurückzustellen. Bereit, das eigene Glück als eine Nebensache, eine Nebenwirkung des Glücks des anderen zu betrachten. Dem man, um es mit dem griechischen Dichter Lukian zu sagen, »sein Schicksal verpfändet«. In einer Liebesbeziehung sind Altruismus und Egoismus nicht, wie man immer annimmt, unvereinbare Gegensätze. Sie verbinden sich, verschmelzen und können schließlich nicht mehr voneinander unterschieden oder getrennt werden.
Die Amerikanerin Colette Dowling nannte die Angst der Frauen vor der Unabhängigkeit den »Cinderella-Komplex«. Die Sehnsucht nach Sicherheit, Wärme und Umsorgtsein sei eine »gefährliche Regung«, sagte Dowling und mahnte ihre Geschlechtsgenossinnen, sich nicht selber ihrer Freiheit zu berauben. Was stört Sie an dieser Mahnung?
Dowling warnte vor dem Impuls, für andere zu sorgen und damit die Möglichkeit zu verlieren, nach Belieben auf einen neuen Zug aufzuspringen. Es ist typisch für die privaten Utopien der Cowboys und Cowgirls des konsumistischen Zeitalters, dass sie einen enormen Freiraum für sich beanspruchen. Sie halten sich für den Nabel der Welt und sind auf Solovorstellungen aus. Davon können sie nie genug bekommen.
Die Schweiz, in der ich aufgewachsen bin, war keine Demokratie. Bis 1971 hatten die Frauen, die Hälfte der Bevölkerung, kein Wahlrecht. Noch immer gibt es keine Lohngleichheit für gleiche Arbeit, und in den Führungsetagen von Unternehmen sind Frauen untervertreten. Haben Frauen denn nicht allen Grund, sich von Abhängigkeiten zu befreien?
Gleichberechtigung in diesen Bereichen ist wichtig. Doch im Feminismus gibt es zwei Strömungen zu unterscheiden. Die eine ist, Frauen von Männern ununterscheidbar zu machen. Sie sollen in der Armee dienen und in den Krieg ziehen können, und die Frauen fragen: Warum ist es uns nicht gestattet, Leute zu erschießen, wie das die Männer dürfen? Die andere Strömung ist, die Welt femininer zu machen. Das Militär, die Politik, alles, was geschaffen worden ist, ist von Männern für Männer. Vieles, was heute falsch läuft, kommt davon. Gleiche Rechte, sicher. Aber sollen die Frauen nun auch Werten folgen, die von Männern kreiert worden sind?
Muss man in einer Demokratie diese Entscheidung nicht den Frauen selber überlassen?
Nun, ich erwarte jedenfalls nicht, dass die Welt sich sehr verbessern wird, wenn Frauen so funktionieren, wie das die Männer taten und tun.
In den ersten Jahren Ihrer Ehe waren Sie ein Hausmann »avant la lettre«. Sie kochten, hüteten die beiden kleinen Kinder, während Ihre Frau in einem Büro arbeitete. Das war ziemlich ungewöhnlich im damaligen Polen, nicht?
Das war nicht so ungewöhnlich, auch wenn Polen konservativ war. In dieser Hinsicht waren die Kommunisten revolutionär, da sie Männer und Frauen als gleichwertige Arbeitskräfte betrachteten. Die Neuheit im kommunistischen Polen war, dass sehr viele Frauen in die Fabrik oder in ein Büro arbeiten gingen. Um damals eine Familie durchzubringen, brauchte man zwei Löhne.
Das hatte eine Änderung der Stellung der Frau zur Folge und damit eine Änderung des Verhältnisses zwischen den Geschlechtern.
Es war ein interessantes Phänomen. Die Frauen versuchten, sich selber als ökonomischen Faktor zu verstehen. Im alten Polen war der Ehemann der alleinige Versorger gewesen, verantwortlich für die ganze Familie. Tatsächlich aber war der Beitrag der Frauen zur Wirtschaft enorm. Frauen erledigten einen ganzen Haufen von Arbeiten, aber das zählte nicht und wurde nicht in marktwirtschaftliche Werte umgerechnet. Ein Beispiel: Als die erste Wäscherei in Polen eröffnet wurde und man seine schmutzige Wäsche hinbringen und waschen lassen konnte, sparte das enorm viel Zeit. Ich erinnere mich, wie meine Mutter zwei Tage in der Woche mit dem Waschen, Trocknen und Bügeln der Wäsche für die Familie verbrachte. Aber die Frauen zögerten, von der neuen Möglichkeit Gebrauch zu machen. Journalisten wollten wissen weshalb, sie sagten den Frauen, die Wäsche waschen zu lassen komme sie doch viel billiger, als es selber zu tun. »Wie denn das?« riefen die Frauen und rechneten den Journalisten vor, dass die Kosten für Waschpulver, Seife und Brennstoff für die Öfen zur Erhitzung des Wassers zusammengezählt geringer seien, als wenn sie die Wäsche in der Wäscherei waschen ließen. Sie rechneten ihre Arbeit nicht mit ein. Es kam ihnen nicht in den Sinn, dass auch sie einen Preis hat.
Im Westen war das nicht anders.
Es brauchte mehrere Jahre, bis die Gesellschaft sich an die Tatsache gewöhnte, dass das, was die Frauen an Hausarbeit leisten, auch ein Preisschild hat. Aber als es einmal im Bewusstsein war, gab es in Polen bald sehr wenige Familien mit traditionellen Hausfrauen.
In ihren Memoiren schreibt Janina, Sie hätten für alles gesorgt, als sie nach der Geburt der Zwillingstöchter an Kindbettfieber erkrankte. Sie standen nachts auf, wenn die beiden Babys Lydia und Irena schrien, gaben ihnen die Flasche, wechselten die Windeln, wuschen diese am Morgen in der Badewanne und hängten sie zum Trocknen in den Hinterhof. Sie brachten Anna, die Erstgeborene, in den Kindergarten, holten sie wieder ab und standen in den langen Schlangen vor den Läden, um einzukaufen. All dies, während Sie Ihren Pflichten als Dozent nachgingen, Ihre Studenten betreuten, Ihre Doktorarbeit schrieben und an politischen Treffen teilnahmen. Wie haben Sie das geschafft?
Wie es damals im akademischen Leben üblich war, konnte ich über meine Zeit weitgehend selber verfügen. Ich ging zur Universität, wenn ich musste, weil ich ein Seminar oder eine Vorlesung hatte. Abgesehen davon war ich ein freier Mann. Ich konnte in meinem Büro bleiben, nach Hause gehen, spazieren, tanzen und tun, wozu ich immer Lust hatte. Janina hingegen arbeitete in einem Büro. Sie begutachtete Drehbücher, sie war Übersetzerin und Redakteurin bei der staatlichen polnischen Filmgesellschaft. Da gab es eine Stempeluhr, und so war es klar, dass ich für die Kinder und die Hausarbeiten da bin, wenn sie im Büro oder krank war. Das führte zu keinen Konflikten, das war selbstverständlich.
Janina und Sie sind in unterschiedlichen Verhältnissen aufgewachsen. Sie kam aus einer wohlhabenden Arztfamilie, in Ihrer eigenen Familie war Geld immer knapp. Janina war wohl auch nicht darauf vorbereitet, Hausfrau zu sein, zu kochen, zu putzen, all die Arbeiten zu erledigen, wofür im Elternhaus Bedienstete da gewesen waren.
Ich bin in der Küche aufgewachsen, Kochen war eine normale Arbeit für mich. Janina kochte, wenn es nötig war. Sie kochte nach Rezept, mit einem Kochbuch vor Augen, was furchtbar langweilig ist. Deshalb liebte sie es auch nicht. Ich habe jeden Tag meiner Mutter zugesehen, wie sie am Herd Wunder vollbrachte, aus nichts etwas kreierte. Wir hatten wenig Geld, und sie vermochte aus den schrecklichsten Rohstoffen noch eine schmackhafte Mahlzeit zuzubereiten. So eignete ich mir das Kochen auf natürliche Weise an. Es ist kein Talent, und es wurde mir auch nicht beigebracht. Ich sah einfach zu, wie es ging.
Janina sagte von Ihnen, Sie seien die »jüdische Mutter«. Sie lieben es heute noch zu kochen, obschon Sie nicht mehr müssten.
Ich liebe es, weil Kochen Kreativität ist. Ich habe erkannt, dass das, was man in der Küche tut, sehr dem gleicht, was man am Computer tut, wenn man schreibt: Man schafft etwas. Es ist eine schöpferische Arbeit, interessant, nicht langweilig. Im Übrigen: Ein gutes Paar ist nicht die Kombination von zwei identischen Personen. Ein gutes Paar ist eines, das sich ergänzt. Was einem Partner fehlt, hat der andere. Janina und ich waren so. Sie liebte Kochen nicht besonders, ich schon, und so ergänzten wir einander.
Erfahrung und Erinnerung
Schicksal: Wie macht man Geschichte, von der man gemacht wird
1946 traten Sie der Polnischen Arbeiterpartei PPK bei, der kommunistischen Partei Polens, ein Jahr vor Leszek Kołakowski, dem 2009 verstorbenen Philosophen, der am All Souls College in Oxford forschte. Sie traten 1968 aus der Partei aus, er war zwei Jahre zuvor ausgeschlossen worden. Kołakowski wurde, im Unterschied zu Ihnen, später ein erklärter Antimarxist.
Kołakowski und ich haben unseren Beitritt zur kommunistischen Partei nicht miteinander abgestimmt. Wir wussten damals noch gar nicht voneinander, wir waren uns nicht begegnet. Als wir rückblickend versuchten, uns unsere damaligen Gefühle in Erinnerung zu rufen, erst in Polen, dann im Exil und schließlich nach dem Fall der Berliner Mauer 1989, stimmten wir in einem Punkt überein: Wir beide hatten geglaubt, dass das Programm der polnischen Kommunisten von 1944/45 das einzige war, das Anlass zur Hoffnung gab, unser Land aus der Rückständigkeit der Vorkriegszeit und der Verheerung des Krieges herauszuholen. Das einzige Programm, das die Nation aus der moralischen Verwüstung, dem Analphabetismus, der Armut und der sozialen Ungerechtigkeit herausbringen konnte. Die Kommunisten wollten den verarmten Bauern Land geben, wollten die Lebensbedingungen der Arbeiter in den Fabriken verbessern, die Industrien nationalisieren. Sie wollten für eine breite Bildung sorgen, und dieses Versprechen haben sie tatsächlich gehalten. Es gab eine Bildungsrevolution, die Kultur blühte trotz der Günstlingswirtschaft; der polnische Film, das polnische Theater, die polnische Literatur waren auf dem höchsten Niveau. Das gibt es heute in Polen nicht mehr. In meinem kleinen Buch Wir Lebenskünstler …
… ein wundervolles Buch, mein Lieblingsbuch von Ihnen …
… in diesem Buch erörtere ich den Gedanken, dass die Reise des menschlichen Lebens auf zwei interagierenden Faktoren beruht. Der eine ist das Schicksal. Schicksal ist die Kurzbezeichnung für das, worüber man keine Kontrolle hat. Und der andere Faktor sind die realistischen Optionen, die das Schicksal ermöglicht. Ein New Yorker Mädchen, das in Harlem geboren ist, hat ein anderes Schicksal als ein Mädchen, das am Central Park geboren ist. Weil das Set von Optionen, das sie haben, unterschiedlich ist.
Aber beide haben ein solches Set, haben eine Wahl. Was entscheidet denn, welche seiner Möglichkeiten jemand zu realisieren versucht?
Der Charakter. Das Set von realistischen Optionen, die einem vom Schicksal gegeben worden sind, lässt sich nicht überspringen. Aber verschiedene Leute werden eine unterschiedliche Wahl treffen, und das ist eine Frage des Charakters. Deshalb hat man zur selben Zeit Anlass zu Pessimismus und Optimismus. Pessimismus, weil es unüberwindbare Grenzen der Möglichkeiten gibt, die einem offenstehen, und das ist es, was wir Schicksal nennen. Optimismus, weil man, im Unterschied zum Schicksal, an seinem Charakter arbeiten kann. Für mein Schicksal trage ich keine Verantwortung, das ist die Entscheidung Gottes, wenn man so will. Aber ich trage Verantwortung für meinen Charakter, weil der etwas ist, das geformt, gereinigt und verbessert werden kann.
Wie war das denn bei Ihnen persönlich?
Meine Reise war wie jede andere auch eine Kombination von Schicksal und Charakter. Gegen das Schicksal konnte ich nichts machen. Was meinen Charakter angeht: Ich gebe nicht vor, er sei perfekt, aber ich übernehme die Verantwortung für jede Entscheidung, die ich getroffen habe. Das ist irreversibel. Ich habe getan, was ich getan habe, und mit dem Schicksal allein kann es nicht erklärt werden.
Wenn Sie zurückschauen auf Ihr Leben, was würden Sie anders machen?
Was ich anders machen würde? Oh nein, diese Art von Fragen beantworte ich nicht.
In Ordnung.
Was ich anders machen würde? Als ich sehr jung war, noch ein Knabe, schrieb ich einen Roman, eine Biographie von Hadrian, einem der Kaiser im alten Rom. Bei der Recherche fand ich einen Satz, den ich nie vergessen habe. Dieser Satz handelt von der Sinnlosigkeit des Nachdenkens, von Fragen wie dieser, was würden Sie anders machen. Er lautet: »Wenn das Trojanische Pferd Nachwuchs gehabt hätte, wäre die Versorgung von Pferden sehr billig.«
Die Macht und die Ohnmacht des Wörtchens »wenn«.