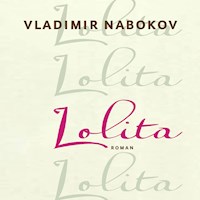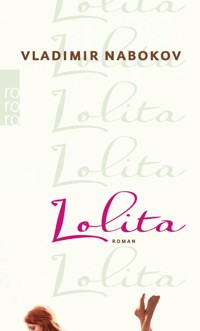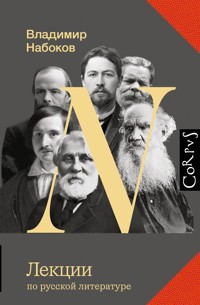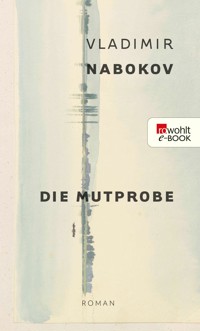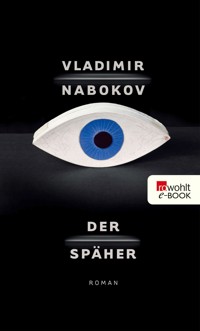9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nabokov: Gesammelte Werke
- Sprache: Deutsch
Ein Mann, Exilrusse, versucht das wahre Leben seines Halbbruders, des Schriftstellers Sebastian Knight, zu rekonstruieren. Als er sich ans Werk macht, besitzt er nichts als ein paar Jugenderinnerungen, einige magere Informationen, eine intime Kenntnis der Knightschen Bücher - und sehr viel Bewunderung, Liebe und Enthusiasmus. Eine abenteuerliche literarische Detektivgeschichte nimmt ihren Anfang.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Vladimir Nabokov
Das wahre Leben des Sebastian Knight
Roman
Über dieses Buch
Ein Mann, Exilrusse, versucht das wahre Leben seines Halbbruders, des Schriftstellers Sebastian Knight, zu rekonstruieren. Als er sich ans Werk macht, besitzt er nichts als ein paar Jugenderinnerungen, einige magere Informationen, eine intime Kenntnis der Knight’schen Bücher – und sehr viel Bewunderung, Liebe und Enthusiasmus. Eine abenteuerliche literarische Detektivgeschichte nimmt ihren Anfang.
Vita
Vladimir Nabokov ist einer der wichtigsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.
Er entstammte einer großbürgerlichen russischen Familie, die nach der Oktoberrevolution von 1917 emigrierte. Nach Jahren in Cambridge, Berlin und Paris verließ Nabokov 1940 Europa und siedelte in die USA über, wo er an verschiedenen Universitäten arbeitete.
In den USA begann er, seine Romane auf Englisch zu verfassen, «Lolita» war Nabokovs Liebeserklärung an die englische Sprache, wie er im Nachwort selber schrieb. Nach einer anfänglich schwierigen Publikationsgeschichte wurde «Lolita» zum Welterfolg, der es Nabokov ermöglichte, sich nur noch dem Schreiben zu widmen.
Nabokov zog in die Schweiz, wo er schrieb, Schmetterlinge fing und seine russischen Romane ins Englische übersetzte.
Er lebte in einem Hotel in Montreux, wo er am 2. Juli 1977 starb.
Der Herausgeber, Dieter E. Zimmer, geboren 1934 in Berlin, 1959 bis 1999 Redakteur der Wochenzeitung «Die Zeit», seit 2000 freier Autor. Zahlreiche Veröffentlichungen über Themen der Psychologie, Biologie und Anthropologie, literarische Übersetzungen (u.a. Nabokov, Joyce, Borges).
Das Gesamtwerk von Vladimir Nabokov erscheint im Rowohlt Verlag.
Impressum
Geschrieben 1938/39 auf Englisch in Frankreich.
Erstveröffentlichung 1941 unter dem Titel «The Real Life of Sebastian Knight» mit einem Vorwort von Conrad Brenner im Verlag New Directions, Norfolk, Connecticut, USA. Die deutsche Übersetzung von Dieter E. Zimmer erschien 1960 und 1996 als Band 6 der Gesammelten Werke im Rowohlt Verlag, Reinbek. Sie wurde 1996 und 2016 überarbeitet.
Der Text folgt: Vladimir Nabokov, Gesammelte Werke, Band 6, herausgegeben von Dieter E. Zimmer.
Überarbeitete Ausgabe November 2018
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, November 2018
Copyright © 1960, 1969, 1999, 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«The Real Life of Sebastian Knight» Copyright © 1941 by Valdimir Nabokov
Veröffentlicht im Einvernehmen mit The Estate of Vladimir Nabokov
Lektorat Hans Georg Heepe
Umschlaggestaltung any.way, Cordula Schmidt
Umschlagabbildung akg-images, August Macke
ISBN 978-3-644-00234-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Véra
Kapitel 1
Sebastian Knight wurde am 31. Dezember 1899 in der ehemaligen Hauptstadt meiner Heimat geboren.[1] Eine alte russische Dame, die mich aus einem dunklen Grunde bat, ihren Namen nicht zu nennen, zeigte mir in Paris zufällig einmal das Tagebuch, das sie in vergangenen Zeiten geführt hatte. So ereignislos waren jene Jahre (dem Anschein nach) verlaufen, dass die Sammlung täglichen Einerleis (die immer eine armselige Art der Selbstbewahrung ist) kaum mehr enthielt als kurze Wetterbeschreibungen; und es ist merkwürdig, dass sich auch die persönlichen Aufzeichnungen von Staatenlenkern, welche Bedrängnisse ihre Reiche sonst auch heimsuchen, vorzugsweise an denselben Gegenstand halten. Wie es so geht, wenn man das Glück sich selbst überlässt – hier bot sich mir, was ich bei planmäßiger Suche vielleicht niemals aufgetrieben hätte. So bin ich in der Lage mitzuteilen, dass es ein schöner, windstiller Morgen war, als Sebastian geboren wurde, und zwölf Grad (Réaumur)[2] unter null … Das jedoch ist auch schon alles, was die gute Frau der Niederschrift für wert gehalten hatte. Bei nochmaligem Nachdenken sehe ich eigentlich keine Notwendigkeit, ihre Anonymität zu wahren. Dass sie dieses Buch jemals zu Gesicht bekommt, ist überaus unwahrscheinlich. Ihr Name war und ist Olga Olegowna Orlowa – eine eierbetonte Alliteration, die für mich zu behalten jammerschade gewesen wäre. Ihr trockener Bericht kann dem unbereisten Leser kaum die Freuden eines St. Petersburger Wintertages vermitteln, wie sie ihn beschreibt; den reinen Luxus eines wolkenlosen Himmels, nicht dazu bestimmt, den Körper zu wärmen, sondern allein, dem Auge zu gefallen; das Glitzern von Schlittenspuren im festgestampften Schnee weiter Straßen, mit einer bräunlichen Tönung an den mittleren Spuren, die vom reichlichen Pferdemist herrührte; das bunte Luftballonbündel, das ein geschürzter Händler feilbot; den sanften Bogen einer Kuppel, deren Gold der Anhauch puderigen Frostes getrübt hatte; die Birken in den Parkanlagen, bei denen auch noch der winzigste Zweig weiß umsäumt war; das Scharren und Läuten des winterlichen Verkehrs … Und wie seltsam übrigens auch, wenn einem bei der Betrachtung einer alten Postkarte (wie jener, die ich vor mir auf den Tisch gelegt habe, um das Kind Erinnerung einen Augenblick lang zu unterhalten) zu Bewusstsein kommt, wie die alten russischen Droschken aufs Geratewohl irgendwo und irgendwie abbogen, sodass man statt des geraden und eingedämmten modernen Verkehrsstromes – auf dieser kolorierten Photographie – einer traumweiten Straße ansichtig wird, wo die Droschken kreuz und quer stehen und fahren, unter einem unglaubwürdig blauen Himmel, der sich weiter entfernt automatisch in einen rosa Tupfen mnemotechnischer Banalität auflöst.
Ich war nicht in der Lage, ein Bild von Sebastians Geburtshaus zu beschaffen, aber ich kenne es gut, denn sechs Jahre später wurde ich selber dort geboren. Wir hatten denselben Vater: Bald nach der Scheidung von Sebastians Mutter hatte er wieder geheiratet. Seltsam, dass diese zweite Ehe in Goodmans Tragödie des Sebastian Knight (das Buch erschien 1936, und ich werde Gelegenheit haben, mich näher damit zu befassen) nicht erwähnt wird, sodass ich also für die Leser des Goodman’schen Buches gar nicht existent zu sein scheine – ein falscher Verwandter, ein geschwätziger Hochstapler. Aber in seinem am stärksten autobiographischen Buch (Verlorenes Eigentum) sagt Sebastian selber ein paar freundliche Worte über meine Mutter – und ich meine, sie hat sie wohl verdient. Auch trifft es nicht zu, dass sein Vater, wie es in der britischen Presse nach Sebastians Hinscheiden hieß, in einem 1913 ausgetragenen Duell getötet wurde; vielmehr erholte er sich zusehends von der Schusswunde in seiner Brust, als er sich – einen ganzen Monat später – eine Erkältung zuzog, der seine halb verheilte Lunge nicht gewachsen war.
Er war ein guter Soldat, ein warmherziger, humorvoller, lebhafter Mann mit einem guten Schuss jener abenteuerdurstigen Ruhelosigkeit, die Sebastian als Schriftsteller von ihm erbte. Als sich das Gespräch um Sebastians unzeitigen Tod drehte, soll letzten Winter bei einem literarischen Lunch in South Kensington ein gefeierter alter Kritiker, dessen Wissen und Geistesschärfe ich immer bewundert habe, die Bemerkung gemacht haben: «Der arme Knight! Er hatte eigentlich zwei Perioden – in der ersten war er ein langweiliger Mann, der gebrochenes Englisch schrieb, in der zweiten war er ein gebrochener Mann und schrieb langweiliges Englisch.» Ein hässlicher Stich, und zwar hässlich in mehr als einer Hinsicht, denn es ist allzu leicht, über einen toten Autor hinter den Rücken seiner Bücher zu reden. Ich möchte gerne glauben, dass der Spaßvogel bei der Erinnerung an diesen Witz keinen Stolz empfindet, zumal da er sich weit größere Zurückhaltung auferlegte, als er vor einigen Jahren Sebastian Knights Werk besprach.
Dennoch muss man zugeben, dass Sebastians Leben, obwohl alles andere als langweilig, in gewissem Sinn der enormen Heftigkeit seines literarischen Stils entbehrte. Jedes Mal, wenn ich eins seiner Bücher aufschlage, sehe ich meinen Vater ins Zimmer stürzen – er hatte eine ganz eigene Art, die Tür aufzustoßen und sofort über einen begehrten Gegenstand oder ein geliebtes Wesen herzufallen. Mein erster Eindruck von ihm bleibt immer der atemlose Augenblick, da er mich unversehens vom Fußboden emporriss, während mir noch die Hälfte einer Spielzeugeisenbahn in der Hand hing und mein Kopf den Kristallklunkern des Kronleuchters gefährlich nahe kam. So plötzlich, wie er mich hochgehoben hatte, setzte er mich immer wieder ab, und genauso plötzlich trägt Sebastians Prosa den Leser empor, um ihn dann jäh in das fröhliche Antipathos des nächsten wilden Absatzes fallen zu lassen. Auch scheinen einige der liebsten Scherze meines Vaters in typischen Knight-Geschichten phantastisch aufzublühen, etwa in Albinos in Schwarz oder Der komische Berg (vielleicht seine beste, diese wundervoll absurde Erzählung, die mich immer an ein im Schlafe lachendes Kind denken lässt).
Es war im Ausland, in Italien, soviel ich weiß, dass mein Vater, damals Gardist auf Urlaub, Virginia Knight kennen lernte. Ihre erste Begegnung Anfang der 1890er Jahre stand irgendwie mit einer Fuchsjagd in Rom in Zusammenhang, aber ob meine Mutter mir das erzählt hat oder ob ich mich unbewusst an irgendein verblasstes Photo in einem Familienalbum erinnere, wüsste ich nicht zu sagen. Er warb lange um sie. Sie war die Tochter von Edward Knight, einem begüterten Gentleman; mehr weiß ich nicht von ihm, aber aus dem Umstand, dass meine Großmutter, eine strenge und eigenwillige Frau (ich entsinne mich ihres Fächers, ihrer Handschuhe, ihrer kalten weißen Finger), sich dieser Heirat mit Nachdruck widersetzte und die Legende ihrer Einwände selbst dann noch wiederholte, als mein Vater längst zum zweiten Mal geheiratet hatte, möchte ich schließen, dass die Familie Knight (was auch immer sie darstellte) nicht ganz den Ansprüchen genügte (was auch immer diese gewesen sein mögen), welche die élegants in Russlands Ancien Régime stellten. Ich bin mir auch nicht sicher, ob diese Heirat meines Vaters nicht irgendwie gegen die Traditionen seines Regiments verstieß – jedenfalls begannen seine eigentlichen militärischen Erfolge erst während des Russisch-Japanischen Krieges, also nachdem ihn seine Frau verlassen hatte.
Ich war noch ein Kind, als ich meinen Vater verlor, und erst sehr viel später, nämlich 1922, einige Monate vor ihrer letzten und tödlich verlaufenen Operation, hielt meine Mutter es für richtig, mich einiges wissen zu lassen. Die erste Ehe meines Vaters war nicht glücklich gewesen. Eine seltsame Frau, ein ruheloses, rücksichtsloses Geschöpf – aber ihre Ruhelosigkeit war von anderer Art als die meines Vaters. Seine war ein stetiges Streben, das seinen Gegenstand erst wechselte, wenn es ihn erreicht hatte; ihre war eine halbherzige, launenhafte und ziellose Jagd, die einmal weit am Ziel vorbeischoss, ein anderes Mal es auf halbem Wege vergaß, so wie man seinen Regenschirm in einem Taxi vergisst. Auf ihre Art hat sie meinen Vater wohl gemocht – eine sprunghafte Art, um mich vorsichtig auszudrücken –, aber als es ihr eines Tages in den Sinn kam, dass sie in einen anderen verliebt sein könnte (dessen Namen mein Vater aus ihrem Mund nie zu hören bekam), verließ sie Gatten und Kind so plötzlich, wie ein Regentropfen zur Spitze eines Fliederblattes hinuntergleitet. Das Hochschnellen des verlassenen Blattes, vordem schwer unter seiner glänzenden Last, muss meinem Vater grimmigen Schmerz bereitet haben, und ich male mir nicht gern jenen Tag in einem Pariser Hotel aus, an dem ein ratloses Kindermädchen nur schlecht auf den damals ungefähr vierjährigen Sebastian aufpasste und mein Vater sich in seinem Zimmer eingeschlossen hatte, «in einem jener besonderen Hotelzimmer, die sich so gut zum Schauplatz der schlimmsten Tragödien eignen: eine alte polierte Uhr (ihr gewichster Schnurrbart zehn Minuten vor zwei) unter einer Glasglocke auf einem bösartigen Kaminsims, das französische Fenster mit seiner verwirrten Fliege zwischen Tüll und Scheibe und ein einzelner Briefbogen des Hotels auf einer verschmierten Löschpapierunterlage». Das ist ein Zitat aus Albinos in Schwarz und steht im Textzusammenhang in keinerlei Beziehung zu jenem Missgeschick, aber es enthält die ferne Erinnerung an ein missmutiges Kind auf einem kahlen Hotelteppich, das nichts zu tun hat und dem die Zeit sich unheimlich dehnt, eine wuselnde, wuchernde Zeit …
Der Krieg im Fernen Osten verschaffte meinem Vater jene glückliche Betätigung, die ihm zwar nicht half, Virginia zu vergessen, die aber doch wenigstens dazu beitrug, sein Leben wieder lebenswert zu machen. Sein kräftiger Egoismus war nur eine Form männlicher Vitalität und daher durchaus im Einklang mit einem im Grunde großmütigen Charakter. Dauerndes Elend oder gar Selbstzerstörung musste ihm als etwas Schäbiges, eine beschämende Kapitulation vorkommen. Als er 1905 wieder heiratete, fühlte er sicherlich befriedigt, in seinen Händeln mit dem Schicksal die Oberhand gewonnen zu haben.
1908 tauchte Virginia wieder auf. Sie hielt es nirgends lange aus, war unablässig auf Reisen und in jeder beliebigen kleinen Pension ebenso gut zuhause wie in einem teuren Hotel, denn zuhause sein bedeutete für sie nur die Annehmlichkeit dauernden Wechsels. Von ihr erbte Sebastian seine seltsame, fast romantische Vorliebe für Schlafwagen und die großen europäischen Expresszüge, «das leise Knarren glänzender Holztäfelung in der blauschattigen Nacht, das lange traurige Seufzen der Bremsen auf vage erahnten Bahnhöfen, das Hochgleiten eines gemusterten Ledervorhangs, das dem Blick einen Bahnsteig freigibt, einen Mann, der Gepäck vor sich her karrt, die milchige Lichtkugel einer Lampe, um die ein bleicher Nachtfalter taumelt; die Schläge eines unsichtbaren Hammers, der die Bremsen prüft; die Gleitbewegung in die Dunkelheit; den flüchtigen Anblick einer einsamen Frau, die aus ihrer Reisetasche auf dem blauen Plüsch eines beleuchteten Abteils silbrig glitzernde Dinge in die Hand nimmt».
An einem Wintertag traf sie ohne jede Ankündigung mit dem Nordexpress ein und verlangte in einem knappen Brief, ihren Sohn zu sehen. Mein Vater war zu einer Bärenjagd aufs Land gefahren; so brachte meine Mutter Sebastian in aller Stille zum Hotel d’Europe[3], wo Virginia für einen einzigen Nachmittag abgestiegen war. Dort in der Lobby sah sie die erste Frau ihres Gatten, schlank, ein wenig eckig, mit einem kleinen bebenden Gesicht unter einem großen schwarzen Hut. Sie hatte ihren Schleier über die Lippen gehoben, um den Knaben zu küssen, und kaum hatte sie ihn berührt, da brach sie in Tränen aus, als wäre Sebastians warme zarte Schläfe die eigentliche Quelle und Sättigung ihres Leids. Gleich darauf zog sie ihre Handschuhe an und erzählte meiner Mutter in schlechtem Französisch eine sinnlose und vollkommen gleichgültige Geschichte von einer Polin, die im Speisewagen versucht hatte, ihr die Handtasche zu stehlen. Dann drückte sie Sebastian eine kleine Schachtel mit kandierten Veilchen in die Hand, lächelte meiner Mutter nervös zu und folgte dem Gepäckträger, der ihre Sachen hinausschaffte. Das war alles, und im Jahr darauf starb sie.
Durch einen ihrer Cousins, H.F. Stainton, erfuhr man, dass sie in den letzten Monaten ihres Lebens in ganz Südfrankreich herumgereist war, ein oder zwei Tage lang in irgendeiner kleinen, heißen Provinzstadt blieb, in die nur selten Touristen kamen – fieberhaft, einsam (sie hatte ihren Liebhaber im Stich gelassen) und wahrscheinlich sehr unglücklich. Man könnte meinen, dass sie vor irgendetwas oder irgendjemand auf der Flucht war, denn ihre Reisen führten sie kreuz und quer durch das Land. Wer mit ihren Launen vertraut war, mochte andererseits in diesem hektischen Umherirren nur die letzte Übertreibung ihrer gewohnten Ruhelosigkeit sehen. Sie starb im Sommer 1909 an Herzversagen (Lehmann’sche Krankheit[4]) in der kleinen Stadt Roquebrune[5]. Es bereitete einige Schwierigkeiten, den Leichnam nach England expedieren zu lassen; ihre Angehörigen waren schon längere Zeit tot; bei ihrem Begräbnis in London war allein Mr. Stainton zugegen.
Meine Eltern waren glücklich miteinander. Es war eine stille und zarte Ehe, der das hässliche Geschwätz gewisser Verwandter nichts anhaben konnte, die sich zuraunten, dass mein Vater, obwohl ein guter Ehemann, hin und wieder zu anderen Frauen hingezogen wurde. Während eines Spaziergangs auf dem Newskij-Prospekt erwähnte eines Tages, es mag Weihnachten 1912 gewesen sein, zufällig eine seiner Bekannten, eine sehr reizende und gedankenlose junge Frau, dass der Verlobte ihrer Schwester, ein gewisser Paltschin, mit seiner ersten Frau bekannt gewesen sei. Mein Vater sagte, dass er sich an den Mann erinnere, sie hätten sich vor zehn Jahren in Biarritz kennen gelernt, oder war es vor neun …
«Aber er war auch noch später mit ihr in Verbindung», sagte die Frau, «er hat nämlich meiner Schwester gestanden, dass er nach Ihrer Trennung mit Virginia zusammengelebt hat … Dann hat sie ihn irgendwo in der Schweiz sitzenlassen … Komisch, niemand wusste etwas davon.»
«Na schön», sagte mein Vater ruhig, «wenn es bisher nicht herausgekommen ist, dann besteht kein Grund, dass die Leute jetzt nach zehn Jahren noch anfangen zu klatschen.»
Ein niederträchtiger Zufall wollte, dass sich ein guter Bekannter der Familie, Hauptmann Bjelow, gleich am folgenden Tag bei meinem Vater erkundigte, ob seine erste Frau wirklich aus Australien stammte – er hätte sie immer für eine Engländerin gehalten. Mein Vater erwiderte, dass ihre Eltern, soviel er wisse, eine Zeitlang in Melbourne gelebt hätten, aber dass sie in Kent geboren sei.
«… Warum fragen Sie?», fügte er hinzu.
Der Hauptmann antwortete ausweichend, seine Frau sei bei einer Gesellschaft oder irgendwo gewesen, wo jemand gewisse Dinge gesagt habe …
«Gewisse Dinge werden einfach aufhören müssen, fürchte ich», sagte mein Vater.
Am nächsten Morgen suchte er Paltschin auf, der ihn liebenswürdiger als nötig empfing. Er sei viele Jahre im Ausland gewesen, sagte er, und freue sich, alte Bekannte wiederzusehen.
«Eine gemeine Lüge wird hier verbreitet», sagte mein Vater, ohne sich zu setzen, «und ich glaube, Sie wissen, welche.»
«Hören Sie, lieber Freund», sagte Paltschin, «es hat keinen Zweck, dass ich so tue, als wüsste ich nicht, worauf Sie hinauswollen. Es tut mir leid, dass die Leute darüber geredet haben, aber wir brauchen uns deswegen wirklich nicht aufzuregen … Schließlich ist es niemandes Schuld, dass Sie und ich einmal im gleichen Boot gesessen haben.»
«Unter diesen Umständen», sagte mein Vater, «werden meine Sekundanten Sie aufsuchen.»
Paltschin war ein Narr und ein Schuft – so viel wenigstens entnahm ich der Erzählung meiner Mutter, welche in ihrem Mund jene lebendige, unmittelbare Form annahm, die ich hier beizubehalten versucht habe. Aber gerade weil Paltschin ein Narr und Schuft war, fällt es mir schwer zu begreifen, warum ein nicht unbedeutender Mann wie mein Vater sein Leben aufs Spiel setzte, um – ja, um wem Genüge zu tun? Virginias Ehre? Seiner eigenen Rachbegier? Wie Virginias Ehre durch die Tatsache ihrer Flucht unwiderruflich verwirkt war, so hätten für meinen Vater doch auch alle Rachegelüste in den glücklichen Jahren seiner zweiten Ehe ihren bitteren Reiz verlieren müssen. Oder war es einfach das Nennen eines Namens, das Auftauchen eines Gesichts oder der plötzliche groteske Anblick eines Menschen, der mit Füßen trat, was bis dahin ein zahmes, gesichtsloses Gespenst gewesen war? Und war – alles in allem genommen – dies Echo einer fernen Vergangenheit (und Echos sind selten mehr als ein Bellen, gleichgültig wie rein die Stimme des Rufenden ist) das Unglück unserer Familie und das Leid meiner Mutter wert?
Das Duell wurde bei Schneesturm am Rand eines zugefrorenen Baches ausgetragen. Zwei Schüsse wurden gewechselt, ehe mein Vater mit dem Gesicht nach unten auf einen blaugrauen Militärmantel aufschlug, der im Schnee ausgebreitet war. Paltschin zündete sich mit zittrigen Händen eine Zigarette an. Hauptmann Bjelow rief die Kutscher, die bescheiden in einiger Entfernung auf der verschneiten Straße warteten. Die ganze scheußliche Angelegenheit hatte drei Minuten gedauert.
In Verlorenes Eigentum schildert Sebastian seine Eindrücke von jenem düsteren Januartag. «Weder meine Stiefmutter noch sonst jemand im Hause», schreibt er, «wusste von dem bevorstehenden Handel. Am Vorabend warf mein Vater beim Essen über den Tisch hinweg mit Brotkugeln nach mir: Ich hatte den ganzen Tag über schlechte Laune gehabt, eines scheußlichen Wollhemds wegen, das ich auf Anordnung des Arztes tragen sollte, und nun versuchte mein Vater, mich aufzuheitern – aber ich wurde ärgerlich, errötete und wandte mich ab. Nach dem Abendessen saßen wir zusammen in seinem Arbeitszimmer, er schlürfte seinen Kaffee und hörte sich an, wie meine Stiefmutter ihm von Mademoiselles lästiger Angewohnheit erzählte, meinem Stiefbruder noch im Bett Zuckerzeug zu bringen. Und ich saß in der anderen Ecke des Zimmers und blätterte in Chums[6]: ‹Lass dir nicht die Fortsetzung dieser spannenden Geschichte entgehen!› Witze unten auf den großen dünnen Seiten. ‹Der Ehrengast war in der Schule herumgeführt worden: Was hat Sie am stärksten berührt? – Eine Erbse aus einem Blasrohr.› Expresszüge dröhnten durch die Nacht. Der Oxforder oder Cambridger Kricketspieler, der das Messer, welches ein hinterhältiger Malaie nach seinem Freund geworfen hatte, wie einen Kricketball abfing … Jene ‹zwerchfellerschütternde› Fortsetzungsgeschichte mit den drei Jungen, von denen der eine ein Schlangenmensch war und mit der Nase wackeln konnte, der zweite ein Zauberer und der dritte ein Bauchredner … Ein Reiter, der über einen Rennwagen setzt …
In der Schule kam ich am nächsten Morgen mit der Geometrieaufgabe, die wir in unserem Schuljargon ‹Pythagoras’ Hosen› nannten, überhaupt nicht zurecht. Es war ein so dunkler Vormittag, dass im Klassenzimmer das Licht angemacht werden musste, und das verursachte mir immer ein unangenehmes Schädelbrummen. Etwa um halb vier nachmittags kam ich nach Hause – mit dem klebrigen Gefühl der Unsauberkeit, das ich immer aus der Schule mitbrachte und das diesmal von der juckenden Unterwäsche noch verstärkt wurde. In der Diele schluchzte der Bursche meines Vaters.»
Kapitel 2
In seinem flüchtigen und sehr irreführenden Buch zeichnet Goodman mit ein paar schlecht gewählten Sätzen ein lächerlich falsches Bild von Sebastian Knights Kindheit. Es ist etwas ganz anderes, das Leben eines Schriftstellers zu beschreiben, als sein Sekretär zu sein; und wenn hinter einem solchen Unternehmen der Wunsch steht, sein Buch auf den Markt zu bringen, solange das Begießen der Blumen auf einem frischen Grab etwas einbringt, dann ist es noch eine ganz andere Sache, geschäftstüchtige Eile mit gründlicher Recherche, Fairness und Weisheit zu verbinden. Ich bin nicht darauf aus, jemandes Ruf zu schädigen. Es ist keine Verleumdung, wenn ich behaupte, nur der Schwung einer klappernden Schreibmaschine könne Goodman zu der Bemerkung veranlasst haben, dass «einem kleinen Jungen, dem der starke Einschlag englischen Blutes in seinen Adern immer bewusst blieb, eine russische Erziehung aufgezwungen wurde». Unter diesem Einfluss, fährt Goodman fort, «litt der Knabe so heftig, dass er in seinen späteren Jahren nur mit einem Schauder an die bärtigen Mushiks, die Ikonen und das Balalaikageklimper denken konnte, die eine gesunde englische Erziehung verdrängt hatten».
Es ist kaum der Mühe wert, darauf hinzuweisen, dass Goodmans Vorstellung von einer russischen Umgebung nicht richtiger ist als beispielsweise die eines Kalmücken von England, der dabei an einen finstren Ort denkt, wo kleine Jungen von rotbärtigen Schulmeistern zu Tode geprügelt werden. Vielmehr sollte betont werden, dass Sebastian in einer Atmosphäre intellektuellen Raffinements aufwuchs, in der sich die geistige Anmut eines russischen Haushalts mit den größten Schätzen europäischer Kultur verband, und dass Sebastians Einstellung zu seinen russischen Erinnerungen – wie auch immer sie im Einzelnen beschaffen war –, der komplexe und besondere Charakter seiner russischen Umgebung gewiss nie auf die vulgäre Ebene absank, die ihr sein Biograph unterstellt.
Ich sehe Sebastian, sechs Jahre älter als ich, als Knaben vor mir, wie er verschwenderisch mit seinen Tuschfarben herumschmiert – im behaglichen Schein einer stattlichen Öllampe, deren rosa Seidenschirm jetzt, da sie in meiner Erinnerung leuchtet, von seinem sehr nassen Pinsel hingemalt scheint. Ich sehe mich als vier- oder fünfjähriges Kind, das zappelnd und auf Zehenspitzen gereckt versucht, einen Blick über den hin- und herfahrenden Ellbogen meines Stiefbruders zu werfen; ein klebriges Rot und Blau, so sehr schon ausgehöhlt und aufgebraucht, dass in den Mulden die Emaille hervorschimmert. Wenn Sebastian seine Farben innen auf dem Blechdeckel mischt, klappert es jedes Mal leise, und das Wasser im Glas vor ihm wölkt sich in wundersamen Farbtönen. Sein kurz geschnittenes Haar lässt über dem rosaroten durchsichtigen Ohr ein Muttermal frei – ich bin inzwischen auf einen Stuhl geklettert –, aber er beachtet mich auch jetzt noch nicht, bis ich mit einem tapsigen Griff versuche, in den blauesten Riegel seines Tuschkastens zu fassen, und er mich mit einer Schulterbewegung fortschiebt, still und unnahbar wie immer in seinem Verhältnis zu mir. Ich erinnere mich, wie ich über das Treppengeländer spähe und ihn nach der Schule die Treppe heraufkommen sehe, in der vorgeschriebenen schwarzen Uniform mit dem Ledergürtel, nach dem es mich heimlich gelüstete – er stieg langsam, schleppend und schleifte die scheckige Schultasche hinter sich her, eine Hand auf dem Geländer, und hin und wieder zog er sich zwei oder drei Stufen auf einmal herauf. Mein Mund spitzt sich, ein wenig weiße Spucke löst sich und fällt und fällt, aber Sebastian trifft sie nie; und nicht, um ihn zu ärgern, tue ich das, es ist nur ein sehnsuchtsvoller und vergeblicher Versuch, ihn auf meine Existenz aufmerksam zu machen. Ich erinnere mich auch lebhaft, wie er auf einem Fahrrad mit sehr niedriger Lenkstange auf einem sonnenfleckigen Pfad im Park unseres Landhauses umherfuhr, langsam und mit ruhenden Pedalen dahinrollend, während ich hinterherlaufe – ein wenig schneller, als seine Sandale die Pedale hinunterdrückt; ich tue mein Bestes, um mit seinem surrenden und klickenden Hinterrad Schritt zu halten, aber er nimmt keine Notiz von mir und lässt mich bald ganz außer Atem und immer noch rennend hoffnungslos zurück.
Später dann, als er sechzehn war und ich zehn, half er mir manchmal bei den Schularbeiten; aber er erklärte mir alles so hastig und ungeduldig, dass seine Hilfe niemals Früchte trug und er nach einer Weile gewöhnlich seinen Bleistift in die Tasche steckte und steifbeinig hinausstakste. Damals war er groß und bleich und hatte einen dunklen Schatten über der Oberlippe. Sein Haar war jetzt glänzend gescheitelt, und in ein schwarzes Heft, das er in sein Schubfach einschloss, schrieb er Gedichte.
Ich bekam einmal heraus, wo er den Schlüssel versteckt hatte (in einem Spalt in der Wand neben dem weißen Kachelofen in seinem Zimmer), und öffnete den Tischkasten. Das Heft war darin, auch ein Photo der Schwester eines Schulkameraden, ein paar Goldmünzen und ein kleiner Musselinbeutel mit veilchenfarbenen Bonbons. Die Gedichte waren auf Englisch. Nicht lange vor dem Tod meines Vaters hatten wir zuhause Englischstunden erhalten, und obwohl ich die Sprache niemals fließend sprechen konnte, fiel es mir verhältnismäßig leicht, sie zu lesen und zu schreiben. Ich erinnere mich undeutlich, dass die Gedichte sehr romantisch waren, voll von dunklen Rosen und Sternen und dem Ruf der See; aber eine Einzelheit hat sich meiner Erinnerung mit vollkommener Klarheit eingeprägt: Die Unterschrift unter jedem Gedicht war ein Spiel mit der Bedeutung seines englischen Namens, eine kleine, mit Tinte gezeichnete Schachfigur – der Springer.
Ich habe mich bemüht, mir ein klares Bild davon zu machen, was ich in jenen Kinderjahren ungefähr zwischen 1910 (dem ersten Jahr, das ich bewusst erlebte) und 1919 (als er nach England ging) von meinem Stiefbruder sah. Aber es will mir nicht gelingen. Sebastians Bild scheint kein Teil meiner Kindheit und also auch nicht endloser Auswahl und Entwicklung unterworfen zu sein, auch ist es keine Folge vertrauter Szenen – es sind ein paar helle Flecken, so als wäre er bei uns gar kein ständiges Familienmitglied gewesen, sondern ein unregelmäßiger Besucher, der durch ein erleuchtetes Zimmer geht und dann für lange Zeit von der Nacht verschluckt wird. Ich erkläre mir das nicht sosehr durch den Umstand, dass meine eigenen kindischen Beschäftigungen jede bewusste Beziehung zu einem Menschen ausschlossen, der nicht jung genug war, um mein Spielgefährte, und nicht alt genug, um mein Mentor zu sein, sondern mit Sebastians ständiger Distanziertheit, die, obwohl ich ihn doch zärtlich liebte, meiner Zuneigung niemals Anerkennung oder Nahrung zuteilwerden ließ. Vielleicht könnte ich beschreiben, wie er ging oder lachte oder nieste, aber das wären nur einzelne Stücke eines zerschnittenen Kinofilms, die nichts mit dem eigentlichen Drama zu tun hätten. Und es war ein Drama. Sebastian konnte seine Mutter nicht vergessen – und ebenso wenig, dass sein Vater ihretwegen gestorben war. Dass ihr Name bei uns zuhause nie erwähnt wurde, fügte dem Zauber der Erinnerungen, die seine empfängliche Seele durchtränkten, einen makabren Glanz hinzu. Ich weiß nicht, ob er sich mit einiger Deutlichkeit an die Zeit erinnern konnte, da sie die Frau seines Vaters war; wahrscheinlich konnte er es in gewisser Weise, als an einen sanften Schimmer im Hintergrund seines Lebens. Auch weiß ich nicht, welches seine Empfindungen waren, als er mit neun Jahren seine Mutter wiedersah. Meine Mutter sagt, er wäre teilnahmslos und wortkarg gewesen und habe jene kurze und rührend unvollständige Begegnung später nie wieder erwähnt. In Verlorenes Eigentum deutet Sebastian eine unbestimmte Bitterkeit gegenüber seinem glücklich wiederverheirateten Vater an, ein Gefühl, das sich in ekstatische Verehrung verwandelte, als er den Grund des tödlichen Duells erfuhr.
«Meine Entdeckung Englands», schreibt Sebastian (Verlorenes Eigentum), «erweckte meine intimsten Erinnerungen zu neuem Leben … Nach der Zeit in Cambridge machte ich eine Reise auf den Kontinent und verbrachte ruhige vierzehn Tage in Monte Carlo. Ich glaube, es gibt dort so etwas wie ein Casino, wo die Leute spielen, aber wenn, dann ist es mir entgangen, denn die meiste Zeit verwendete ich auf die Niederschrift meines ersten Romans – einer hochgestochenen Angelegenheit, die glücklicherweise von ebenso vielen Verlegern abgelehnt wurde, wie mein nächstes Buch Leser fand. Eines Tages machte ich eine lange Wanderung und kam in einen Ort, der Roquebrune hieß. In Roquebrune war meine Mutter dreizehn Jahre vorher gestorben. Ich entsinne mich deutlich des Tages, da mein Vater mir von ihrem Tod erzählte und auch den Namen der Pension nannte, wo er sich ereignet hatte. Sie hieß ‹Les Violettes›[7]. Ich fragte einen Chauffeur, ob er solch ein Haus kenne, aber er hatte keine Ahnung. Dann wandte ich mich an einen Obsthändler, und der wies mir den Weg. Ich kam schließlich zu einer blassrosa Villa mit den typischen runden roten Dachziegeln der Provence; auf das Tor war, wie ich bemerkte, unbeholfen ein Veilchenstrauß gemalt. Das also war das Haus. Ich durchquerte den Garten und sprach mit der Pensionswirtin. Sie sagte, dass sie die Pension erst kürzlich von ihrer Vorgängerin übernommen habe und von der Vergangenheit nichts wisse. Ich bat sie um die Erlaubnis, eine Weile im Garten sitzen zu dürfen. Von einem Balkon herunter starrte mich ein alter und – soviel ich von ihm sehen konnte – nackter Mann an, aber sonst war kein Mensch da. Ich setzte mich auf eine blaue Bank unter einem großen Eukalyptusbaum, dessen Rinde sich teilweise abschälte, wie anscheinend immer bei diesen Bäumen. Dann versuchte ich, das rosa Haus und den Baum und die ganze Physiognomie des Ortes so zu sehen, wie meine Mutter sie gesehen hatte. Ich bedauerte, dass ich nicht wusste, welches genau das Fenster ihres Zimmers gewesen war. Nach dem Namen der Villa zu urteilen, hatten ihre Augen sicherlich dasselbe Beet mit den violetten Stiefmütterchen gesehen. Allmählich steigerte ich mich in einen solchen Zustand hinein, dass einen Augenblick lang das Rosa und das Grün wie hinter einem Nebelschleier zu verschwimmen und zu flimmern schienen. Meine Mutter, eine undeutliche, schlanke Gestalt mit einem großen Hut, ging langsam die Stufen hinauf, die sich scheinbar in Wasser auflösten. Ein kräftiger dumpfer Aufschlag brachte mich wieder zur Besinnung. Eine Apfelsine war aus der Papiertüte auf meinem Schoß hinuntergerollt. Ich hob sie auf und verließ den Garten. Einige Monate später traf ich in London zufällig einen ihrer Cousins. Eine Wendung des Gesprächs veranlasste mich zu erwähnen, dass ich den Ort aufgesucht hätte, wo sie gestorben war. ‹Aber nein›, sagte er, ‹es war doch das andere Roquebrune, das im Var.›»
Es ist bezeichnend, dass Goodman, der ebendiese Stelle zitiert, sich mit dem Kommentar begnügt: «Sebastian Knight war (ohne doch von Natur aus verhärtet oder zynisch zu sein) so verliebt in die groteske Seite des Lebens und so unfähig, dessen ernsten Kern zu begreifen, dass er sich über die tiefsten Gefühle lustig machte, die dem Rest der Menschheit zu Recht heilig sind.» Kein Wunder, dass dieser feierliche Biograph mit seinem Helden an keinem Punkt zurechtkommt.
Aus den schon erwähnten Gründen versuche ich nicht, Sebastians Kindheit in systematischem Zusammenhang zu beschreiben, wie es sich normalerweise gehörte, wäre er eine Romanfigur. In diesem Fall könnte ich hoffen, meine Leser mit der Schilderung der reibungslosen Entwicklung meines Helden vom Kind zum jungen Mann zu belehren und zu unterhalten. Versuchte ich das jedoch mit Sebastian, so käme dabei eine jener «biographies romancées»[8] heraus, bei weitem die schlimmste aller bisher erfundenen Literaturgattungen. So möge also die Tür geschlossen bleiben und nur unten einen schmalen straffen Lichtstreif durchlassen; auch das Licht im Nebenzimmer, wo Sebastian zu Bett gegangen ist, mag verlöschen; das schöne, olivgrüne Haus am Ufer der Newa, es mag langsam in der graublauen, frostigen Nacht verlöschen, indes fallende Schneeflocken gemächlich durch das mondweiße Licht der hohen Straßenlaterne gleiten und die mächtigen Gliedmaßen zweier bärtiger Gebälkfiguren bedecken, die mit atlasgleicher Anstrengung den Erker am Zimmer meines Vaters abstützen. Mein Vater ist tot, nebenan schläft Sebastian oder verhält sich wenigstens mäuschenstill – und ich liege hellwach im Bett und starre in die Dunkelheit.
Ungefähr zwanzig Jahre später fuhr ich nach Lausanne, um eine alte Schweizerin[9] ausfindig zu machen, die erst Sebastians und dann meine Gouvernante gewesen war. Sie muss etwa fünfzig gewesen sein, als sie uns 1914 verließ; wir schrieben uns schon seit langem nicht mehr, sodass ich 1936 nicht sicher war, ob ich sie noch am Leben finden würde. Doch, sie lebte noch. Wie ich herausfand, gab es einen Verband alter Schweizerinnen, die vor der Revolution Gouvernanten in Russland gewesen waren. Sie «lebten in der Vergangenheit», wie mir der sehr nette Herr auseinandersetzte, der mich hinführte, und verbrachten ihre letzten Lebensjahre damit – die meisten dieser Damen waren kränklich und klapprig –, Tagebücher zu vergleichen, untereinander kleine Fehden auszutragen und sich über die Zustände zu beklagen, die sie nach ihrem langjährigen Russland-Aufenthalt in der Schweiz vorgefunden hatten. Ihre Tragödie lag in dem Umstand, dass sie während all der Jahre in einem fremden Land gegen seinen Einfluss völlig immun geblieben waren (sie hatten sich nicht einmal die allereinfachsten russischen Ausdrücke angeeignet); dass sie ihrer Umgebung immer ein wenig feindselig gegenübergestanden hatten – wie oft habe ich Mademoiselle ihr Exil bejammern hören, wie oft fand sie sich bedauernswert zurückgesetzt und unverstanden und sehnte sich in ihr schönes Heimatland zurück; aber als diese armen irrenden Seelen dann heimkehrten, kamen sie sich in der veränderten Heimat völlig fremd vor, sodass sich Russland (das für sie in Wirklichkeit immer ein unbekannter Abgrund gewesen war, aus dem es in der lampenhellen Ecke eines muffigen Hinterzimmers mit seinen perlmuttgerahmten Familienbildern und einem Aquarell von Schloss Chillon entfernt grollte) – sodass sich das unbekannte Russland in einer sonderbaren Gefühlsumkehrung nun ausnahm wie ein verlorenes Paradies, wie ein ungeheurer, undeutlicher, aber in der Rückschau freundlicher, von wehmütigen Erinnerungen bevölkerter Ort. Ich fand Mademoiselle sehr taub und grau, aber so redselig wie je, und nach den ersten überschwänglichen Umarmungen begann sie, sich Kleinigkeiten aus meiner Kindheit ins Gedächtnis zu rufen, die entweder hoffnungslos entstellt oder mir so fremd waren, dass ich an ihrer einstigen Wirklichkeit meine Zweifel hegte. Vom Tode meiner Mutter wusste sie nichts – und ebenso wenig, dass Sebastian vor drei Monaten gestorben war. Nebenbei bemerkt hatte sie auch keine Ahnung, dass er ein großer Schriftsteller gewesen war. Sie war sehr weinerlich, und ihre Tränen waren durchaus aufrichtig, aber irgendwie schien es sie zu stören, dass ich nicht mitweinte. «Du warst immer so beherrscht», sagte sie. Ich teilte ihr mit, dass ich im Begriff sei, ein Buch über Sebastian zu schreiben – ob sie mir nicht von seiner Kindheit erzählen könne. Sie war bald nach der zweiten Heirat meines Vaters ins Haus gekommen, aber die Vergangenheit war in ihrem Kopf so verwischt und verdreht, dass sie von der ersten Frau meines Vaters («cette horrible Anglaise») sprach, als hätte sie sie genauso gut wie meine Mutter («cette femme admirable»)[10] gekannt. «Mein armer kleiner Sebastian», jammerte sie, «er war so lieb zu mir, so edel. Ach, ich erinnere mich, wie er mir immer seine Ärmchen um den Hals warf und sagte: ‹Ich kann niemand leiden außer dir, Zelle, nur du verstehst meine Seele.› Und dann, als ich ihm einmal leicht auf die Hand klapste – une toute petite tape[11] –, weil er zu deiner Mutter ungezogen war … – der Ausdruck seiner Augen … ich hätte weinen mögen … und dann seine Stimme, als er sagte: ‹Ich bin dir dankbar, Zelle. Es soll nie wieder vorkommen …›»
In dieser Art fuhr sie eine Weile fort – es bereitete mir elendes Unbehagen. Nach mehreren vergeblichen Versuchen gelang es mir endlich, dem Gespräch eine andere Wendung zu geben – ich war schon ziemlich heiser, weil sie ihr Hörrohr verlegt hatte. Dann erzählte sie von ihrer Nachbarin, einem dicken kleinen Frauenzimmer, das noch älter war als sie und dem ich auf dem Hausflur begegnet war. «Die gute Frau ist ziemlich taub», stöhnte sie, «und lügt wie gedruckt. Ich weiß ganz genau, dass sie den Kindern von Fürstin Demidow nur Privatstunden gegeben hat, gewohnt hat sie da nie.» – «Schreib nur das Buch, das herrliche Buch», rief sie, als ich ging. «Mach daraus ein Märchen und aus Sebastian einen Prinzen. Der verzauberte Prinz … Wie oft habe ich ihm nicht gesagt: ‹Sebastian, pass auf, die Frauen werden dir zu Füßen liegen.› Und er hat dann immer lachend geantwortet: ‹Na, ich ihnen auch …›»
Ich wand mich innerlich. Sie gab mir schmatzend einen Kuss und streichelte meine Hand und heulte schon wieder. Ich sah ihre verschleierten alten Augen, den stumpfen Glanz ihres Gebisses, die wohlvertraute Granatbrosche auf ihrem Busen … Wir nahmen Abschied. Es regnete in Strömen, und ich schämte und ärgerte mich, mein zweites Kapitel unterbrochen zu haben, um diese nutzlose Pilgerfahrt zu unternehmen. Ein Eindruck wurmte mich besonders. Sie hatte keine einzige Frage über Sebastians späteres Leben gestellt, keine einzige Frage über die Art seines Todes, nichts.
Kapitel 3
Im November 1918 beschloss meine Mutter, mit Sebastian und mir den Fährnissen Russlands zu entfliehen. Die Revolution war in vollem Gange, die Grenzen waren geschlossen. Sie setzte sich mit einem Mann in Verbindung, der es sich zum Beruf gemacht hatte, Flüchtlinge über die Grenze zu schleusen, und gegen ein bestimmtes Entgeld, von dem die Hälfte im voraus zu entrichten war, wurde ausgemacht, dass er uns nach Finnland hinüberschaffen würde. Wir sollten kurz vor der Landesgrenze aussteigen, auf dem letzten Bahnhof, bis zu dem zu fahren erlaubt war, und dann auf geheimen Pfaden die Grenze überschreiten – der starken Schneefälle in jenen stillen Gegenden wegen doppelt und dreifach geheim. Am Ausgangspunkt unserer Bahnfahrt standen wir da, meine Mutter und ich, und warteten auf Sebastian, der mit dem heldenmütigen Beistand von Hauptmann Bjelow das Gepäck vom Haus zum Bahnhof schaffte. Der Zug sollte fahrplanmäßig um 8 Uhr 40 abfahren. Halb neun, und immer noch kein Sebastian. Unser Führer saß schon im Zug und las ruhig eine Zeitung; er hatte meiner Mutter eingeschärft, auf keinen Fall vor aller Augen mit ihm zu sprechen, und als jetzt die Zeit verging und der Zug jeden Augenblick abfahren konnte, überkam uns ein würgendes Gefühl dumpfer Panik. Wir wussten, dass der Mann, den Gepflogenheiten seines Berufes gemäß, kein Unternehmen wiederholen würde, das gleich zu Beginn fehlgeschlagen war. Wir wussten auch, dass wir uns die Kosten der Flucht kein zweites Mal leisten konnten. Die Minuten vergingen, und in meiner Magengrube fühlte ich ein verzweifeltes Knurren. Es war einfach nicht auszudenken, dass sich der Zug in ein oder zwei Minuten in Bewegung setzen würde und wir auf unseren dunklen kalten Dachboden zurückkehren müssten (unser Haus war einige Monate vorher enteignet worden). Auf dem Weg zum Bahnhof waren wir an Sebastian und Bjelow vorbeigekommen, die einen schwer beladenen Schubkarren durch den knirschenden Schnee schoben. Das Bild stand unbeweglich vor meinen Augen (ich war dreizehn und sehr phantasiebegabt) – wie verzaubert und zu gelähmter Ewigkeit verdammt. Die Hände in die Ärmel gesteckt und in der Stirn eine graue, unter dem wollenen Kopftuch hervorquellende Haarsträhne, ging meine Mutter auf und ab und versuchte, den Blick unseres Führers aufzufangen, wenn sie an seinem Fenster vorüberkam. Acht Uhr fünfundvierzig, acht Uhr fünfzig … Der Zug hatte Verspätung, aber schließlich ertönte die Pfeife, eine heiße, weiße Dampfwolke jagte mit ihrem Schatten auf dem braunen Schnee des Bahnsteigs um die Wette, und in diesem Augenblick kam Sebastian angerannt – die Ohrenklappen seiner Pelzmütze flatterten im Wind. Wir drei kletterten in den fahrenden Zug. Es dauerte einige Zeit, bis es ihm gelang, uns zu erzählen, dass Hauptmann Bjelow auf der Straße genau vor unserem früheren Haus verhaftet worden war, dass er selber das Gepäck seinem Schicksal überlassen hatte und verzweifelt zum Bahnhof gelaufen war. Einige Monate später erfuhren wir, dass unser armer Freund zusammen mit zwanzig anderen erschossen worden war, Schulter an Schulter mit Paltschin, der so tapfer starb wie Bjelow.
In seinem letzten Buch, Die zweifelhafte Asphodele