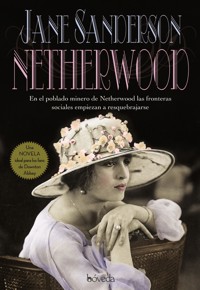14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dan war der erste Junge, den Ali geliebt hat. Der Erste, der ihr eine Musikkassette aufgenommen hat. Aber das ist dreißig Jahre her, und Ali hat schon lange nicht mehr an ihn gedacht. Genauso wenig wie an den Tag, an dem sie ihr altes Leben überstürzt hinter sich lassen musste. Doch dann taucht Dans Name plötzlich auf ihrem Telefon auf, und für einen kostbaren Moment ist Ali keine mitten im Leben stehende Frau und Mutter von fünfzig Jahren. Sie ist wieder sechzehn und zurück in ihrer Heimatstadt Sheffield, tanzend in zu engen Jeans. Und als Dan ihr ein Lied von damals schickt, muss Ali sich fragen: Was, wenn all das, was hätte sein können, noch vor ihr liegt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 606
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Dan war der erste Junge, den Ali geliebt hat. Der erste Junge, der ihr eine Musikkassette aufnahm. Aber das ist dreißig Jahre her, und Ali hat schon lange nicht mehr an ihn gedacht. Genauso wenig wie an den Tag, an dem sie ihr altes Leben als Teenager überstürzt hinter sich lassen musste. Bis sie eine Nachricht von Dan erhält. Er hat ihr ein Lied aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit geschickt, Elvis Costellos »Pump It Up«. Für einen kostbaren Moment ist Ali keine mitten im Leben stehende, verheiratete Frau von fünfzig Jahren mit zwei temperamentvollen Töchtern. Es ist wieder 1978, sie ist sechzehn und zurück in ihrer Heimatstadt Sheffield, tanzend in viel zu engen Jeans. Sie kann nicht anders, als ihm ihrerseits mit einem Lied zu antworten, »Picture This« von Blondie. Und irgendwie ist es so, als würden die vielen Jahre, die zwischen ihnen stehen, dahinschmelzen. Bis sie sich schließlich einer Frage stellen müssen: Was, wenn all das, was hätte sein können, noch vor ihnen liegt?
Alis und Dans Songliste auf Spotify:
www.goldmann-verlag.de/schönstezeit
Autorin
Jane Sanderson ist Journalistin und Schriftstellerin. Bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete, war sie lange Zeit als Produzentin für den renommierten Hörfunksender BBC Radio 4 tätig. Die Autorin lebt mit ihrem Mann auf dem Land in Herefordshire, das Paar hat drei Kinder und besitzt ein Hausboot in London.
Jane Sanderson
Das war
die schönste Zeit
Aus dem Englischen
von Jörn Ingwersen
Für Melanie
1
SHEFFIELD,
23. DEZEMBER 1978
Da gehen die beiden, ganz zu Anfang, als sie noch jung waren: Daniel Lawrence und Alison Connor. Er ist achtzehn, sie sechzehn. Es ist Samstagabend, und sie schlendern durch die winterlichen Straßen von Sheffield, auf dem Weg zu Kev Carters Weihnachtsparty. Sie haben noch nicht viel gesagt, seit er sie vom Bus abgeholt hat, doch sie sind sich beide der Gegenwart des anderen mehr als bewusst. Ihre Hand in seiner fühlt sich viel zu gut an, als dass es nur irgendeine Hand sein könnte, und während er so neben ihr läuft, wird ihr Mund ganz trocken, und ihr Herz schlägt viel zu schnell, pocht viel zu laut. Seite an Seite gehen sie auf dem Bürgersteig. Es ist nicht weit von der Haltestelle bis zu Kevs Haus, und schon bald ist die Stille zwischen ihnen von lauter Musik erfüllt. Er sieht zu ihr herab, so wie sie zu ihm aufblickt, und beide lächeln. Mit einem Mal spürt er dieses reine Verlangen, wie immer, wenn Alison ihn ansieht, und sie … nun, sie könnte nicht sagen, ob sie im Leben je glücklicher war.
Kevs Haustür stand offen, hieß den Abend willkommen. Musik kam ihnen entgegen, und Licht fiel auf das Unkraut und die kaputten Gehwegplatten, die durch den Garten führten. Kev war Daniels Freund, nicht Alisons – sie besuchten nicht dieselbe Schule. Auf dem Weg ins Haus ließ sie sich etwas zurückfallen, damit es aussah, als würde Daniel sie hinter sich herziehen. Sie genoss das Gefühl, von diesem Jungen ins Haus geführt zu werden. Alle sollten sehen, dass sie ihm gehörte und er ihr. Im Kassettendeck lief Blondie, »Picture This« – viel zu laut, sodass der Bass zerrte und vibrierte. Alison mochte den Song. Am liebsten wäre sie gleich ihren Mantel losgeworden, sie wollte sich was zu trinken holen und tanzen. Doch schon im nächsten Augenblick ließ Daniel ihre Hand los, um Kev zuzuwinken. Er brüllte gegen die Musik an und lachte über Kevs Antwort. Dann nickte er Rob Marsden zu, sagte: »Alles klar bei dir?«, und lächelte Tracey Clarke an, die vielsagend grinste. Sie stand an eine Wand gelehnt, allein, bei der Küchentür, als wartete sie auf den Bus. Kippe in der einen Hand, Dose Strongbow in der anderen. Dunkelblondes Haar mit Farrah-Fawcett-Locken, pflaumenfarbener Lippenstift und kajalgeschminkte Augen. Sie bedachte Alison mit einem kühlen, nachdenklichen Blick, nahm einen tiefen Zug von ihrer Zigarette und blies den Rauch zur Seite aus.
»Hast du was mit ihm?«, fragte sie und deutete mit dem Kopf in Daniels Richtung. Tracey – älter und weiser, kein jungfräuliches Schulmädchen mehr – verdiente schon eigenes Geld und hatte einen Freund mit Auto. Das war alles, was Alison über sie wusste. Unwillkürlich wurde sie rot.
»Ja«, sagte sie verlegen, »hab ich.« Daniel war inzwischen außer Reichweite, also starrte Alison nur konzentriert seinen dunklen Hinterkopf an, in der Hoffnung, dass er sich zu ihr umdrehte. Höhnisch grinsend zog Tracey eine Augenbraue hoch. Rauch hing zwischen ihnen in der Luft. Alisons Schuhe brachten sie um.
»Dann pass mal gut auf ihn auf«, sagte Tracey. »Der ist gefragt.« Es folgte ein kurzer Moment des Schweigens, weil Alison nichts erwiderte, dann zuckte Tracey mit den Schultern. »Getränke gibt’s da drinnen.«
Sie meinte die Küche hinter ihr, und durch die offene Tür sah Alison einen Haufen Leute, die sich um einen grünen Resopal-Tisch drängten, auf dem eine Unmenge Flaschen, Knabberkram und Plastikbecher standen. Sie flüchtete vor der leicht boshaften Aufmerksamkeit dieser Tracey und schob sich hinein. Daniel hätte ihr ruhig was zu trinken besorgen können, dachte Alison. Aber na ja, im Gegensatz zu ihr kannte er hier Hinz und Kunz, und die wollten halt alle was von ihm. Jetzt lief Jilted John vom Band, sodass plötzlich alle mitsangen, aber keiner mehr tanzte, und hinter Alison drängten noch mehr Leute in die winzige Küche. Sie sah kein einziges vertrautes Gesicht, und das, obwohl es hier so voll war. Sie schob sich zum Tisch mit den Getränken durch. Es roch nach Zigarettenqualm und Cider, und plötzlich nach Old Spice.
»Alles okay bei dir, Alison?«
Sie drehte sich um und sah Stu Watson. Mit seiner Jeansjacke und Joe Strummers mürrischer Miene auf dem T-Shirt wirkte er peinlich um Verwegenheit bemüht. Jede Wette, dass er keinen einzigen Song von The Clash kannte. Aber dennoch freute sie sich, endlich jemand Vertrautes zu sehen. Mit zusammengekniffenen Augen musterte Stu sie bewundernd.
»Du siehst jedenfalls ganz okay aus«, sagte er.
»Na, und du ziemlich besoffen, Stu.«
»Eben erst gekommen?«
»Scheint so«, sagte sie und deutete auf ihren Mantel. »Du bist offensichtlich schon ein Weilchen da.«
»Der frühe Vogel eben«, sagte Stu. »Was trinkst du?«
»Noch nichts. Martini. Schätze ich.«
Stu zog eine Grimasse. »Wie kannst du den Scheiß bloß trinken? Schmeckt doch wie Medizin.«
Alison ignorierte ihn. Ihr war heiß, aber sie wusste nicht, wo sie ihren Mantel ablegen sollte, also ließ sie ihn ein Stück weit über die Schulter gleiten. Schon wanderte Stus Blick über ihre nackte Haut. Alison sah sich nach Daniel um. Er stand noch immer drüben im Wohnzimmer. Allerdings suchte er gar nicht nach ihr, wie sie gehofft hatte, sondern unterhielt sich mit einem anderen Mädchen. Mandy Phillips. Alison kannte sie aus dem Schulbus. Klein wie ein Kind, hennarote Locken, Elfennäschen. Sie blickte unentwegt zu Daniel auf, sonnte sich im Licht seiner Aufmerksamkeit. Er hielt die Arme verschränkt und ja, er stand zwar ein kleines Stück von Mandy entfernt, und doch schien es Alison, als könnte er sich kaum an ihr sattsehen. Alison beobachtete, wie Mandy Daniel an der Schulter zu sich herabzog, ihre zarte Hand an sein Ohr hielt und ihm etwas zuflüsterte. Daniel schenkte ihr sein typisches Lächeln: zögerlich, im Grunde nur ein halbes Lächeln. Ein paar Haarsträhnen fielen ihm vor die Augen, und Alison hätte sie am liebsten zurückgestrichen.
Stu folgte ihrem Blick. »Mein Name ist Mandy, und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug«, sagte er. »Wohl eher einen angenehmen Fick.«
»Ach, verpiss dich, Stu«, sagte Alison. Sie griff sich eine Flasche Martini Rosso vom Tisch, schenkte sich einen Becher voll und nahm einen großen Schluck. Er hatte recht, das Zeug war wirklich eklig bitter. Aber auch sehr vertraut. Also nahm sie noch einen Schluck. Dann wischte sie sich mit dem Handrücken über den Mund, stellte ihren Becher auf den Tisch und zog ihren Mantel aus, hängte ihn über einen Stuhl. Sie trug eine Wrangler-Jeans, mit der sie extra in der Wanne gelegen hatte, damit sie hauteng saß, und eine neue Bluse, die gut aussah, sogar verdammt gut, das wusste sie. Schließlich hatte sie sich lange genug im Schlafzimmerspiegel betrachtet. Die Bluse war weiß und fühlte sich an wie Satin, und auf dem Weg zum Bus hatte Alison sie noch ein Stückchen weiter aufgeknöpft. Stu konnte den Blick gar nicht mehr von ihr wenden. Doch sie ließ ihn einfach stehen, nahm ihren Becher und schob sich durch die Menge, raus aus der Küche.
Alison unterhielt sich mit Stu Watson, diesem fiesen Frettchen, diesem Widerling mit den gierigen Augen, der seine Finger nicht bei sich behalten konnte. Daniel sah die beiden in der Küche stehen, aber er kam nicht weg von Mandy Phillips. Die blöde Kuh ließ gerade ein paar Tränchen kullern, während sie ihm erzählte, wie Kev Carter mit ihr Schluss gemacht hatte, heute Abend, auf seiner eigenen Party, der Scheißkerl. So ging es Daniel oft. Mädchen schütteten ihm ihr Herz aus. Er musste sie nicht dazu ermutigen, sie witterten einfach etwas an ihm, von dem er selbst nicht wusste, was es war, und dann hörten sie nicht mehr auf zu reden. Alison Connor war anders. Vor ein paar Tagen hatte er sie gefragt, ob sie mit ihm ausgehen würde, und sie hatte Ja gesagt. Nur dass sie in den kurzen Momenten, in denen sie seither zusammen gewesen waren, kaum einen Satz mit ihm gewechselt hatte. Dennoch wollte er sie an seiner Seite haben, wusste irgendwie, dass sie etwas Besonderes war. Aber mit diesem blöden Stu Watson hatte sie in der Küche jetzt schon länger geredet als jemals mit ihm. Mittlerweile war Mandy beim zweiten Durchgang derselben traurigen Geschichte, und es wurde immer deutlicher, worauf sie hinauswollte: erst ein verführerischer Blick, dann ein Kuss, die Aussicht auf mehr. Kev alberte derweil mit ein paar anderen herum, doch plötzlich sah er herüber und hielt den Daumen hoch, als wäre Daniel auf seine abgelegten Freundinnen angewiesen. Für Kev Carter war das Leben nur ein Spiel. Natürlich hatte er Mandy heute Abend abgeschossen – er hatte einen Sinn für Dramatik, und wo blieb der Spaß, wenn man schon vorher wusste, wem man später ins Höschen greifen würde?
Jetzt plärrte »Night Fever« aus den Lautsprechern, und Mandy fing an, ihre Schultern im Rhythmus der Musik zu wiegen. Mitten im Zimmer übte ein Gruppe Mädchen Seite an Seite Travolta-Moves, während ein paar Jungs lachend versuchten, es ihnen nachzumachen. Mandy zog an Daniels Schulter, und er beugte sich zu ihr vor, damit sie ihre kleine Hand an sein Ohr legen konnte.
Mit warmem Atem flüsterte sie ihm etwas ins Ohr, doch es war zu laut um sie herum, er verstand sie nicht.
Er richtete sich wieder auf und lächelte sie an. »Was?«
»Möchtest du …?« Sie stockte und erwiderte sein Lächeln. »Du weißt schon … tanzen?« Sie sagte »tanzen« auf eine Art und Weise, die weit, weit mehr andeutete. Keine Tränen mehr. Kev war längst vergessen.
»Nein«, sagte Daniel und wich zurück. Er sah zur Küche hinüber, suchte Alison, konnte sie aber nicht finden, und Stu auch nicht. Er hätte bei ihr bleiben, ihr den Mantel abnehmen, ihr was zu trinken holen sollen. Wieso hatte er sich bloß von Mandy vollquatschen lassen?
»Echt nicht?«, fragte Mandy, diesmal laut genug, um sich gegen die Musik durchzusetzen.
Daniel war inzwischen voll damit beschäftigt, sich nach Alison umzusehen. »Nein, Mandy, ich möchte ganz bestimmt nicht mit dir tanzen.« Leise Panik machte sich in ihm breit, als er sich fragte, ob Alison überhaupt noch auf der Party war. Vielleicht war sie schon abgehauen. Er wünschte, er würde sie gut genug kennen, um zu wissen, wie sie tickte.
»Du bist so ein Arsch, Daniel Lawrence!«, kreischte Mandy und wollte ihm eine runterhauen, was ihr allerdings nicht gelang, weil sie zu betrunken war, und so erwischte sie ihn nur mit den Fingernägeln und zerkratzte ihm die Wange.
»Spinnst du?« Fassungslos starrte er sie an.
Verdächtig leicht brach sie in Tränen aus und wandte sich ab, auf der Suche nach einer anderen Schulter, an der sie sich ausheulen konnte. Daniel strich über seine brennende Wange. Nicht zu fassen. Und er hatte noch nicht mal ein Bier gehabt. Tolle Party. Als er sich eben auf den Weg zur Küche machte, fanden die Bee Gees ein brutales Ende, weil Kev die Kassette aus dem Rekorder riss und eine andere einlegte. Mit einem Mal ertönte das drängende Schlagzeug-Bass-Intro von »Pump It Up«, und Daniel blieb wie angewurzelt stehen. Ehrfurchtsvoll wartete er darauf, dass Elvis Costellos Stimme ihren Weg an sein Ohr fand.
Und, o Gott, da entdeckte er sie. Alison. Sie tanzte allein in der Menge. Sie hatte ihre Schuhe ausgezogen und tanzte mit geschlossenen Augen, ohne ihre nackten Füße zu bewegen, auch wenn ansonsten der ganze Körper von der Musik gefangen war und ihre Arme wilde, wundervolle Formen über ihrem Kopf beschrieben. Sie tanzte wie niemand sonst. Andere versuchten, ihren Tanzstil zu kopieren. Doch immer wenn es ihnen fast gelang, änderte sie etwas, ließ sich von der Musik treiben, ohne sich dabei vom Fleck zu bewegen. Daniel betrachtete sie, war vollkommen fasziniert. Noch nie hatte er etwas gesehen, das so schön, so ungehemmt, so verdammt sexy war, in seinem ganzen Leben nicht.
2
EDINBURGH
10. OKTOBER 2012
Journalisten waren bei Gigs immer leicht zu erkennen. Standen ganz hinten, tranken nichts, taten, als hätten sie alles schon mal gehört und gesehen. Und dann verdrückten sie sich schnell, sobald das Konzert zu Ende war. Dan Lawrence war auch so einer, und nun stand er in der Queen’s Hall und hörte sich Bonnie »Prince« Billy an, der seine spröden, eingängigen Songs über den Tod der Liebe sang. Dan setzte sich nie hin. Man sollte bei Konzerten nicht sitzen. Es war kein Theater, kein Kino, es war Musik. Kurz nachdem er nach Edinburgh gezogen war, hatte er einmal eine Freikarte für Prefab Sprout in der Queen’s Hall bekommen und sich eingesperrt auf dem Balkon wiedergefunden, auf einem nummerierten Sitz. Er war trotzdem aufgestanden, hatte direkt auf die Köpfe der Band heruntergesehen und versucht, deren Setliste zu entziffern, die unter ihm auf dem Bühnenboden klebte. Heute aber stand er an seinem Lieblingsplatz, so nah wie möglich am Ausgang. Dan mochte Billy – diesen fusselbärtigen Countrysänger aus Louisville –, auch wenn man es seiner ausdruckslosen Miene nicht ansah. Er machte sich nicht mal Notizen, sog nur das in sich auf, worüber man gut schreiben konnte, während er gleichzeitig überlegte, was sich damit sonst noch anfangen ließe, im Tausch gegen Geld.
Hinterher trat er auf die Clerk Street hinaus. Er hielt weder nach bekannten Gesichtern Ausschau, noch gönnte er sich ein Bier. Katelin war sicher schon im Bett, schlief tief und fest, flach auf dem Rücken, die Arme über dem Kopf, wie ein Kind. Oft hatten Dan und Katelin einen gegensätzlichen Tagesrhythmus, und wenn er sich zu ihr ins Bett legte, half ihm ihr gleichmäßiger Atem in den Schlaf, wie ein sanftes Metronom. Sie rührte sich im Grunde nie. Schlief den Schlaf der Gerechten.
Er befand sich auf der falschen Seite von Edinburgh. Die Uhr zeigte schon halb zwölf, doch diese Stadt hatte etwas an sich, das ihn animierte, zu Fuß zu gehen, nicht den Bus zu nehmen oder ein Taxi anzuhalten. Diese Stadt war die architektonische Liebe seines Lebens, streng und imposant, aber zunehmend hip – steinalt und gleichzeitig modern. Im Vergleich zu Sheffield – dem Sheffield, das er Anfang der Achtziger hinter sich gelassen hatte – war Edinburgh eine Offenbarung. Zugegebenermaßen hatte Katelin ihn hierhergelockt, ohne die er diese Stadt möglicherweise weniger attraktiv gefunden hätte, aber trotzdem … Dan hatte sich hier sofort wohlgefühlt, und mittlerweile war Edinburgh sein Zuhause geworden.
Jetzt überquerte er die George IV Bridge, mit gesenktem Blick, die Hände tief in seiner Lederjacke vergraben, Ohrhörer drin, iPod auf Shuffle. Deshalb erschreckte er sich fast zu Tode, als ihn plötzlich jemand von hinten an der Schulter packte wie ein Polizist mit einem Haftbefehl.
»Meine Fresse, Duncan!«, rief Dan. Er riss sich die Stöpsel aus den Ohren. »Scheiße, willst du mich umbringen?«
Duncan lachte und schlug Dan zwischen die Schulterblätter. »Mann, ich renn dir schon eine halbe Meile hinterher, um dich einzuholen. Bist du auf der Flucht, oder was?«
»Will nur schnell nach Hause.«
»Warst du bei Bonny Billy?«
»Ja, du auch?«
»Jep, hab kurzfristig noch ’ne Freikarte gekriegt. Verdammt, der ist aber auch manchmal eine trübe Tasse, oder?«
»Sind wir das nicht alle?«
»Na, stimmt auch wieder. Hör mal …« Duncan streifte seinen Army-Rucksack von den Schultern, kramte in dessen Tiefen herum und holte eine CD heraus, ohne Cover, ohne Bild, nur eine Plastikhülle mit handschriftlicher Titelliste.
Dan lächelte. »Was hast du da?«, fragte er. »Das nächste große Ding? Mal wieder?«
»Willie Dundas, ein Fischer aus East Neuk, ob du’s glaubst oder nicht. Spielt Gitarre wie Rory Gallagher, singt wie John Martyn.«
»Schon klar.«
»Ungelogen. Hör’s dir an!«
Er gab Dan die CD. Duncan hatte ein feines Ohr für schrullige, horizonterweiternde Talente. Ständig lernte er in seinem schlecht laufenden Plattenladen an der Jeffrey Street irgendwelche Nerds kennen, die zu introvertiert waren, um sich selbst zu loben, und die zu Hause im stillen Kämmerlein Texte und Melodien schrieben, die ohne Duncan niemand jemals hören würde. Schon immer hatte er Dan mit seinen Entdeckungen belagert, dem das allerdings nichts ausmachte. Denn was war das Leben anderes als die ewige Suche nach dem einen perfekten Album, das noch in der Sammlung fehlte, aufgenommen von diesem einen Genie, das sonst keiner kannte? Dan ließ sich auf Duncans entspannteren Schritt ein, und so schlenderten sie nebeneinander durch die spätabendliche Stille der Altstadt von Edinburgh.
»Bock auf einen Single Malt?«, fragte Duncan.
»Schon mal auf die Uhr geguckt?«
»Ach, stell dich nicht so an. Du weißt doch, wenn man mit Duncan Lomax unterwegs ist, gibt es keine Sperrstunde.« Dan lachte. Duncan boxte ihn freundschaftlich. »Nur einen kleinen Absacker«, sagte er. »Kann doch nicht schaden, oder?«
Dan kam zu dem Schluss, dass es tatsächlich nicht schaden konnte, ganz und gar nicht, und so änderten sie ihren Kurs in Richtung Niddry Street, wo sie sich ins zwielichtige Whistle Binkies drückten – geöffnet bis drei Uhr nachts, jeden Abend Live-Musik und selbst um kurz nach Mitternacht noch ausgesprochen gut besucht.
Er war morgens um halb drei nach Hause gekommen und hatte sich leise reingeschlichen, mit der übertriebenen Vorsicht eines Angetrunkenen. Dennoch war McCulloch, der beherzte kleine Jack Russell, aufgewacht und hatte sein Körbchen mit der Schicksalsergebenheit eines ältlichen Dieners verlassen, um Dan ganz bis hinauf in sein Büro unterm Dach zu folgen. Der Raum verdiente kaum seinen Namen, mit seinen schrägen Wänden und diesem einen kleinen Fenster. Aber das zeigte zumindest nach Westen, sodass an wolkenlosen Abenden Sonnenlicht auf den dunklen Holzfußboden fiel. Mittendrin stand ein ramponierter Metallschreibtisch, darauf eine verstellbare Messinglampe aus einer alten Fabrik. Ein originaler Eames-Stuhl, schwarzes Leder, Metallrahmen. Plattenspieler, CD-Player und iPod-Dock. Drei speziell angefertigte Stahlschränke für LPs und Singles und ein vierter für CDs. Dan bewahrte auch alle seine Musikkassetten auf – es waren Hunderte –, aber die lagerte er im Keller in Plastikkisten. Eine Wand stand voller Bücher, an einer anderen hing eine riesige Weltkarte, und die dritte war von Erinnerungen übersät, die Dan allesamt am Herzen lagen. Ein signiertes Schwarz-Weiß-Foto von ihm und Siouxsie Sioux nach einem Gig in Manchester 1984. Ein offizielles gerahmtes Foto der Mannschaft von Sheffield Wednesday nach deren Finalsieg um den League Cup von 1991. Ein Werbeplakat der Amerika-Tour von Echo & The Bunnymen für ihr Album Evergreen. Die Tour, die er mitgemacht hatte, so richtig mitgemacht hatte, um die Bandgeschichte zu recherchieren und aufzuschreiben. Fotos von Alex, Filzer- und Kreidebilder von Alex und ein ausgiebig illustriertes Gedicht vom damals achtjährigen Alex, zum Vatertag:
Er spielt Gitarre, fährt das Auto, kauft mir manchmal Bienenstich.
Er spielt gern Fußball, steht im Tor, sein Lieblingsmensch bin ICH.
Fotos von Katelin mit Alex – wie sie ihn auf dem Arm hielt, wie sie ihn auf der Schaukel anschubste, wie sie seine Füße hielt, während er Kopfstand übte. Ein Foto von allen dreien, freudestrahlend an dem Abend, an dem Alex sein überragendes Abschlusszeugnis bekommen hatte. Und in der Mitte von allem ein Foto von Dan und Katelin, auf dem sie wie Kinder aussahen, vor einer Bougainvillea in einer schattigen Gasse von Cartagena. Sie blickten nicht in die Kamera, sondern lächelten einander an, wie zwei, die über einen heimlichen Scherz lachten. Damals kannten sie sich noch kaum. Dan wusste nicht einmal mehr, wer das Foto eigentlich aufgenommen hatte.
Am Schreibtisch sitzend ließ er den Blick über seine Vergangenheit schweifen. Diese Wand erzählte die Geschichte seines Lebens, gab ihm Halt hier in ihrem Haus in Stockbridge, mit dem langen, schmalen Garten, dem Fahrradschuppen, der Haustür in Sheffield-Wednesday-Blau. Anfangs hatten Katelin und er sich schwer damit getan, sich irgendwo richtig niederzulassen. In fünf Jahren waren sie genau fünfmal umgezogen. Doch dann hatte er eine detailbesessene Geschichte des New Musical Express verfasst und dafür einen in der Branche ungewöhnlich hohen Vorschuss bekommen. Mit einem Mal war die Zeit des Lotterlebens vorbei – die Zeit der Matratzen auf dem Boden, des Schimmels an der Decke, der nackten Glühbirnen, des Wandteppichs vor dem Schlafzimmerfenster, der permanent für schummeriges Licht sorgte. Aber, verdammt, es war eine tolle Zeit gewesen. Katelin studierte damals Spanisch an der Uni, und Dan verbrachte seine Tage damit, unaufgefordert Musikkritiken für den Scotsman zu schreiben. Sie lebten von Katelins Studienbeihilfe und dem gelegentlichen Zehner, den Dan mit seinen Artikeln verdiente. Kennengelernt hatten sie sich in Kolumbien, in einer Bar in Bogotá. Damals war Katelin absolut unerschrocken gewesen, ein stämmiges rothaariges Mädchen aus Coleraine mit milchweißer Haut, selbst noch nach zwei Monaten in Südamerika. Sie sprach fließend Spanisch, trank wie ein Bauarbeiter, und wenn sie einen im Tee hatte, sang sie schmutzige irische Lieder – »Schmuddelballaden« sagte sie dazu. Zum ersten Mal, seit er im Land war, genoss Dan seinen Aufenthalt.
Sie hielten Kontakt. Katelin war wieder zurück an die Uni gegangen, um im September ihren Abschluss zu machen, und Dan hatte seine Eltern in Sheffield besucht, um diese über seine Zukunftspläne in Kenntnis zu setzen. Dann trampte und wanderte er mit seinem Rucksack und der Gitarre auf dem Rücken den ganzen Weg bis nach Edinburgh. Als er an die Tür von Katelins Wohnung in der Marchmont Road klopfte, hatte er Löcher in den Turnschuhen, Blasen an den Füßen und seit anderthalb Tagen nichts gegessen. Er hatte dort gestanden, benommen, halb verhungert, und in den zwei Minuten, die sie brauchte, um zur Tür zu kommen, zog er zum ersten Mal die Möglichkeit in Betracht, dass sie vielleicht entsetzt sein würde, ihn zu sehen, oder aber dass sie – schlimmer noch – gar nicht wirklich existierte. Doch dann ging die Tür auf, und Katelin stand da, in Fleisch und Blut, genau so, wie Dan sie in Erinnerung hatte. Sie lächelte und sagte: »Du hast ganz schön lange gebraucht«, und damit war alles klar.
Das war inzwischen lange her – sehr, sehr lange. Dan saß am Schreibtisch, hoch oben in seinem Turm, morgens um kurz vor drei, und ließ seinen von Whisky befeuerten Gedanken freien Lauf. Darüber, mit welch unfassbar grausamer Geschwindigkeit die Zeit verging. Er war auf dem besten Wege, melancholisch zu werden, als ihm gerade noch rechtzeitig Willie Dundas einfiel. Er zog die Scheibe aus seiner Jackentasche, schob sie in den CD-Player, und augenblicklich war das kleine Büro erfüllt von einem Gitarrenintro, das Dan grinsen ließ: erst ein einzelner Akkord, der in der Luft hing wie ein Versprechen, dann ein schnelles, bluesiges Riff und schließlich Willies Stimme, tief, weich, gefühlvoll, er nuschelte wie betrunken, als hätte er kaum noch die Kraft, sich zu artikulieren. Dieser Fischer war schon irgendwie genial – aber das hatte Dan mit Duncans Entdeckungen schon öfter erlebt. Meist waren diese Künstler dermaßen integer, dass man sie kaum aus ihrem Schlafzimmer, ihrem Schuppen oder eben ihrer Fischerhütte locken konnte. Dan ließ die Musik laufen, während er den Mac hochfuhr, um noch mal kurz bei Twitter reinzuschauen, falls es was Neues gab, und er stellte sich Willie Dundas vor, wie dieser auf seinem Kutter draußen auf der Nordsee sang. Ob man den Mann wohl dazu überreden konnte, vor lauter Fremden in einem Laden wie dem Whistle Binkies zu singen?
Twitter erstrahlte hellblau auf dem Bildschirm, und eine Flut von Tweets erschien in ihrer ganzen egomanen Pracht und Herrlichkeit. Achtundzwanzig Benachrichtigungen von Leuten, mit denen Dan kaum etwas zu tun hatte. Sieben persönliche Nachrichten von Leuten, die er tatsächlich kannte, aber nichts, worum er sich morgens um drei kümmern musste. Man sollte besser aufpassen, dass man nicht einsam wirkte, wenn man mitten in der Nacht antwortete, unter dem Einfluss von Laphroaig. Beiläufig scrollte er durch den Nachrichtensumpf, mit dieser müden Gleichgültigkeit, die Twitter immer bei ihm auslöste, und eben wollte er den Computer schon herunterfahren und ins Bett gehen, als eine neue Meldung auf dem Bildschirm blinkte. Kev Carter. Kevs Nachrichten waren immer lesenswert, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Dan beugte sich dichter an den Bildschirm heran, dann wich er abrupt zurück, als hätte man ihm einen Schlag versetzt.
Hey Mann @DanLawrenceMusic kennst du noch Alison Connor? Guck mal, was die so treibt … voll berühmt!
@CarterK9
@AliConnorWriter
Alison Connor. Wow. Dan starrte ihr Foto an.
Alison Connor.
Alison Connor.
@AliConnorWriter.
Zum ersten Mal seit bestimmt dreißig Jahren sah er sie wieder. Großer Gott. Sie sah noch ganz genauso aus: älter natürlich, aber sonst genauso. Er klickte ihren Namen an, und ihre Seite baute sich auf. Dann klickte er auf ihr Foto. Es füllte den Bildschirm aus. Sein Mund wurde ganz trocken, was ihn doch erstaunte, denn immerhin war es drei Jahrzehnte her, dass er sich Alison Connor aus dem Kopf geschlagen hatte. Aber sie sah immer noch genauso süß aus, so klug, so verletzlich irgendwie. Großer Gott. Er betrachtete ihr Gesicht. Ja, sie sah einfach unglaublich aus. Er klickte zurück zu ihrem Profil.
Ali Connor
@AliConnorWriter
Schreibe meine Bücher, höre meine Songs, freue mich des Lebens.
Tweets
Folgt
Follower
165
180
67.2K
Adelaide, SA
Beigetreten November 2011
Dan lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und verschränkte die Arme. Er dachte über die Welt nach, in der nicht nur er lebte, sondern tatsächlich auch Alison Connor. Offenbar war sie nach Südaustralien gezogen und Bestsellerautorin geworden, wenn man den Zahlen glauben durfte.
»Meine Güte, Dan, was machst du denn um diese Zeit noch am Computer?«
Katelin war aus dem warmen Bett gestiegen und die Treppe heraufgekommen. Jetzt stand sie in der Tür und musterte ihn, offensichtlich leicht verstimmt. Er hatte sie gar nicht gehört. Sofort bekam er ein seltsam schlechtes Gewissen und ging in die Defensive.
»Ach, alles Mögliche«, erwiderte er. »Während die einen schlafen, ist die andere Hälfte der Menschheit wach.«
»Ich schlafe nicht, Dan. Deine Musik hat sich in meine Träume geschlichen.«
»Oh, entschuldige. Hab ich dich geweckt?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Na ja, nein, ich musste aufs Klo, aber als ich wach war, konnte ich die Musik hören.« Sie fuhr sich mit einer Hand durch ihre Haare, die jetzt kreuz und quer abstanden, und sie sah tatsächlich etwas komisch aus, mit ihrer leicht mürrischen Miene und ihrem karierten Pyjama.
»Okay«, sagte er. »Tut mir leid. Willie Dundas, Fischer aus East Neuk.«
»Ganz toll. Machst du aus und kommst ins Bett?«
»Na klar.« Er sah sie lächelnd an, stellte seinen Mac jedoch keineswegs aus. »Ich will mir nur noch ein paar Sachen zu Bonnie Prince Billy aufschreiben.« Verdammt, dachte er. Warum lüge ich?
Sie verdrehte die Augen. »Jetzt? Im Ernst? Kann das nicht warten?«
»Noch fünf Minuten. Dann bin ich bei dir. Versprochen.«
»O Gott, McCulloch ist ja auch hier oben!«
»Er ist mir hinterhergelaufen. Ich nehme ihn gleich mit runter.«
»Fünf Minuten.«
»Jep.«
Sie sah ihn an, als sei ihm nicht zu helfen, dann tappte sie wieder die Treppe hinab. Er sollte wirklich runtergehen. Er musste sich zu Bonnie Prince Billy nichts aufschreiben. Es gab keinen Grund, noch weiter hier oben zu bleiben, und er war hundemüde. Trotzdem blieb er da. Und dachte über @AliConnorWriter nach. Nur noch eine Minute. Zwei Minuten. Drei Minuten. Es fiel ihm schwer, sich von ihr zu trennen, nachdem er sie gerade erst wiedergefunden hatte. Am Ende wurden daraus fast zehn Minuten, in denen er sich ihre Fotos ansah, sich durch ihre Tweets scrollte, ihren Namen googelte und eine Fülle von Informationen zum unaufhaltsamen Aufstieg der Ali Connor fand. Dann dachte er: scheiß drauf! Er ging noch mal zu ihrem Twitter-Account, klickte auf den Folgen-Button, klappte sein Notebook zu, stellte Willie Dundas aus und nahm McCulloch mit nach unten.
3
ADELAIDE,
12. OKTOBER 2012
Sheila, eine Freundin von Alisons Mutter, war 1967 nach Australien ausgewandert. Mit ihrem Namen passe sie bestens nach Australien, sagte sie immer. Im Rahmen einer staatlich organisierten Überfahrt war sie von Southampton aus mit dem Schiff nach Australien gereist und so dem Versprechen auf ein neues Leben in Elizabeth und einen Job in der Holden-Autofabrik gefolgt. Dort hatte sie Kalvin Schumer kennengelernt, einen Ingenieur. Er war ein waschechter Australier – Sohn deutscher Eltern, aber geboren und aufgewachsen in Adelaide – und der schmuckste Kerl, dem Sheila je begegnet war. An den Wochenenden machte er ihr den Hof und fuhr mit ihr in die Wüste, wo er rote Riesenkängurus jagte, um sie an seine Hunde zu verfüttern, und Schlangen tötete, indem er sie mit bloßen Händen im roten Staub packte und auf einen Felsen schlug, wie eine Peitsche.
Das alles stand in ihren Briefen, die nach ihrer Abreise noch eine Weile nahezu monatlich eintrafen, eine pflichtbewusste, lyrische Korrespondenz, die Catherine Connor allerdings ziemlich auf den Wecker ging. Sie kannte Sheila Baillie schon seit Ewigkeiten. Sie waren in derselben Straße aufgewachsen, bis die Familie Baillie nach Liverpool gezogen war. Danach hatte Catherine Sheila nur noch ein einziges Mal gesehen, bei ihrer eigenen Hochzeit mit Geoff Connor. Und dennoch hatte Sheila an der Freundschaft festgehalten – ohne allerdings so recht das Ausmaß von Catherines Desinteresse mitzubekommen oder die Tatsache, dass Catherine an der Flasche hing. Daher wusste sie auch nicht, dass ihre Briefe, aus denen der ganze enthusiastische Eifer einer Emigrantin sprach, nur noch mehr Verbitterung in Catherines Seele brachten – weil sie ein lebhaftes Bild einer Welt zeichneten, die so ganz anders war als ihr eigener trister Alltag.
Und Sheilas Briefe hatten in der Tat nichts Tristes an sich, ganz im Gegenteil. Mit schwungvoller Handschrift beschrieb sie detailliert ihre Abenteuer. Dabei spickte sie ihre Sätze mit Ausrufungszeichen, als wären das tropische Klima und die tödlichen Spinnen und endlosen Horizonte nicht exotisch und abenteuerlich genug. Als müsste die Aufmerksamkeit ihres Publikums extra noch darauf gelenkt werden, damit es nicht das Beste verpasste. Hätte Catherine diese Briefe, die auf hellblauem serviettendünnem Luftpostpapier bei den Connors eintrudelten, je beantwortet, wären die Berichte über das Leben down under sicher weitergegangen, aber Alisons Mum trank lieber, als dass sie las oder schrieb. Nur dem allerersten Brief hatte sie überhaupt Beachtung geschenkt, und der hatte sie richtig wütend gemacht, wenn Alison auch nicht wusste, wieso eigentlich. Danach nahm sie die Briefe jedes Mal angewidert von der Fußmatte, mit spitzen Fingern, als handele es sich um ein gebrauchtes Taschentuch, und sagte abfällige Sachen wie: »Hitze, Staub und Spinnen. Meint sie etwa, das interessiert uns?« Dann warf sie den ungeöffneten Umschlag in den Küchenmülleimer. Doch später, wenn die Luft rein war, fischte Alisons Bruder Peter – sechs Jahre älter als sie – den Brief zwischen Teeblättern und Kartoffelschalen hervor, nahm sein Taschenmesser, schlitzte den Umschlag mit großer Piratengeste auf und veranstaltete in seinem Zimmer eine »Märchenstunde« – was bedeutete, dass er seiner Schwester den Brief laut vorlas, während beide im Schneidersitz auf seinem Bett hockten.
Sheilas Briefe vermittelten Alison so etwas wie Mut und Entschlossenheit. Sie sammelte sie unter ihrer Matratze wie einen Schatz, und als irgendwann keine Briefe mehr kamen, als Sheila Catherine nicht mehr schrieb, fühlte Alison sich geradezu beraubt. Es war ihr nie in den Sinn gekommen, dass sie ja selbst hätte zurückschreiben können. Sie war so jung gewesen, wusste weder, wie man das machte, noch hatte sie das Geld für eine Briefmarke, und außerdem war Catherine ihre Mutter. Aber sie hütete die Briefe wie ihr kostbarstes Kleinod, las sie immer wieder. Bis Catherine eines Tages den Stapel fand und ihn ins Feuer warf, um ihre Tochter für ihren Verrat zu bestrafen. Doch Alison kannte die besten Stellen bereits auswendig. Ehrfürchtig rezitierte sie ganze Absätze, als wären es Sonette oder Psalmen.
Kakadus sitzen hier in den Bäumen, weiß mit gelbem Schopf. Die machen einen Mordskrach! Sie klauen die Pflaumen aus unserem Garten und starren uns mit ihren frechen schwarzen Augen an. Die niedlichen Koalas rollen sich oben auf den Ästen der Eukalyptusbäume ein, schlafen endlos lange, wie alte Männer nach dem Sonntagsbraten. Die Spinnen sind groß wie gespreizte Männerhände. Stell dir das mal vor! Aber das sind nicht die, vor denen man sich in Acht nehmen muss – gefährlich sind die Rotrücken, viel, viel kleiner, aber tödlich, wenn sie sich bedroht fühlen. Kalvin meint, man sollte immer erst einen Blick in den Briefkasten werfen, bevor man reingreift!
Und erst die Hitze! Der Rasen hinter dem Haus dampft morgens, wenn die Sonne aufgeht, und manchmal schmilzt sogar die Straße! Trotzdem pflanzen wir Blumen. Der Pfauenstrauch wächst gut, aber auch Petunien und Veilchen gedeihen, wenn sie genug Wasser bekommen! Doch selbst im Garten weht der Staub um meine Füße, obwohl die Wüste noch ein ganzes Stück weit weg ist. Irgendwie ist sie immer präsent, heiß und rot, und erinnert mich daran, dass es sie gibt.
Es ist ein wundervolles Land, Catherine, ein glückliches Land, und du wirst verstehen, was ich meine, wenn ihr mich besuchen kommt. Kommt doch!
Diese letzten Worte waren Alison immer im Gedächtnis geblieben. Du wirst verstehen, was ich meine, wenn ihr mich besuchen kommt. Erwartete diese Sheila sie denn? Sollten Alison und Peter etwa die Chance erhalten, an einem fernen Ort namens Elizabeth aufzuwachsen, statt in Attercliffe? Peter wusste es nicht, und die Mutter konnten sie nicht fragen: das nicht und auch sonst nichts. Catherine Connor hatte keine Geduld für Fragen. Die erinnerten sie nur daran, dass sie Verantwortung zu tragen hatte.
Diese Erinnerungen also – aller Schmerz und alle Freude auf ihre Essenz reduziert – erwachten jedes Mal in Ali Connor, wenn sie von Journalisten zu ihrem Erfolg interviewt und gefragt wurde, was sie einst nach Adelaide geführt hatte. Das Klima, sagte sie dann. Die Adelaide Hills, die kultivierte Stadt, der endlose Ozean, das Essen, die bunten Papageien, die leuchtenden, sonnendurchfluteten Morgen, die pechschwarzen Nächte, die Ruhe zu schreiben. Ja, das alles waren Gründe gewesen zu bleiben. Aber hergekommen war sie deshalb nicht. Die Gründe dafür hatte sie für sich behalten, hatte nicht mal ihrem Mann davon erzählt, nicht mal Cass Delaney, die glaubte, Alis dunkelste Geheimnisse zu kennen.
Die beiden Freundinnen saßen zusammen in einem Café in North Adelaide, wiedervereint nach Cass’ Arbeitswoche in Sydney, und sie hatte Ali heute schon dreimal gehört, zweimal im Fernsehen bei News Breakfast und Sunrise und einmal im Radio. Und nachher musste Ali wieder in die ABC-Studios für eine Aufzeichnung der BBC. Cass freute sich, dass ihre Freundin derart gefragt war, war begeistert über ihren Erfolg – aber warum nur, wollte sie wissen, klang Ali immer, als wollte sie nicht mit der Sprache heraus?
»Immer diese Gemeinplätze!«, sagte Cass. »Lass einfach den Quatsch mit der Landschaft. Das klingt so abgedroschen.«
»Dann hör einfach nicht hin«, erwiderte Ali. »Das wäre mir, offen gesagt, sowieso lieber. Es macht mich nervös.«
»Du kommst total verklemmt rüber, als wolltest du lieber woanders sein. Du bist ein Aussie, Mädchen! Benimm dich auch so, lass alles raus! Erzähl ihnen, wie du Michael in Spanien aufgegabelt hast, dass er dir wochenlang gefolgt ist wie ein Hündchen, bis du nachgegeben hast und mit ihm durch die Welt gezogen bist.«
Ali lachte, dann nippte sie an ihrem Kaffee. »Ehrlich, Cass, so bin ich eben. Wenn es nach mir ginge, würde ich das mit der Publicity ganz sein lassen. Ich mache das nur für diese nette Jade vom Verlag. Die gibt sich so viel Mühe, dass ich mich verpflichtet fühle.«
»Ach, komm schon! Du solltest das Scheinwerferlicht genießen, solange es auf dich gerichtet ist.«
»Ich wünschte, du könntest das für mich übernehmen. Du wärst so viel besser darin.«
»Aufmerksamkeit habe ich noch nie gescheut, das stimmt.«
»Und ich sitze lieber allein am Schreibtisch und denke mir Geschichten aus. Da muss ich mich nicht hübsch anziehen und mir die Haare waschen, wenn mir nicht danach zumute ist.«
»Denk doch mal nach!«, sagte Cass. »Du bist jetzt berühmt, ob es dir gefällt oder nicht. Wenn du nicht langsam etwas warmherziger rüberkommst, werden die Leute das Interesse an dir verlieren. Das Blatt soll sich doch nicht wenden, oder?«
»Ach, Quatsch. Ich bin überhaupt nicht berühmt«, erwiderte Ali. Sie blickte sich um, betrachtete die Leute um sich herum, die aßen und sich unterhielten, ohne von ihr Notiz zu nehmen. »Siehst du? Es kümmert keinen. Mein Buch ist bekannt, aber ich wette, kaum die Hälfte der Leser könnte sagen, wer es geschrieben hat. Gott sei Dank!« Sie beugte sich vor und stützte das Kinn auf ihre Hände. »Und wie war deine Woche?«
»So lala«, sagte Cass. »Irre viel zu tun, wie immer. Hab gerade einen langen Artikel für die Zeitung abgegeben. ›Die Gier als neue ökonomische Orthodoxie‹, falls es dich interessiert.«
Ali schüttelte den Kopf. »Nein, nicht wirklich.«
Cass lachte. »Hey, kommst du in nächster Zeit mal nach Sydney? Ich hab einen neuen Verehrer, Halbchinese. Bisschen klein für mich, aber im Liegen sind sie alle groß genug.«
»Ohoo, wie heißt er denn?«
Cass tat einen Moment, als müsste sie überlegen. »Nö«, sagte sie, »fällt mir nicht mehr ein.«
Ali lachte. »Sieht aber gut aus?«
»Na ja, er ist nicht gerade so heiß, dass die Oper von Sydney in Flammen aufgehen würde«, meinte Cass, »aber er ist ganz süß. Komm vorbei und guck ihn dir an. Aber beeil dich, bevor ich ihn wieder in die Wüste schicke.«
»Das mache ich vielleicht sogar. Meine Lektorin sitzt mir im Nacken, dass ich mich mit ihrem Chef treffe, um mit ihm über eine Fortsetzung zu sprechen.«
»Hast du denn schon eine Fortsetzung?«
»Nein.«
»Immer noch keine Idee?«
»Doch, mehr als genug, aber keine passend zu Tell the Story, Sing the Song.«
»Ah, verstehe. Die wollen noch mal dasselbe in Grün.«
»Genau. Ich bin noch nicht sicher, ob ich mich wirklich so weit verbiegen will, dass ich sie zufriedenstellen könnte.«
»Du hast die neuen Dornenvögel geschrieben, Süße. Du kannst tun und lassen, was du willst. Isst du deinen Kuchen noch?«
Ali schüttelte den Kopf. »Ich hab dir doch gesagt, ich will keinen. Eigentlich wollte ich nur Kaffee.«
»Komm schon! Man soll doch im Radio nicht dein Magenknurren hören.«
Ali schüttelte den Kopf und sah auf ihrem Handy nach der Uhrzeit. »Hör zu, ich schau vor dem Interview noch mal kurz zu Hause vorbei.«
»Was? Wieso?« Cass sollte sie eigentlich zum Termin fahren. Das war der Plan.
»Weiß auch nicht. Möchte ich eben.« Ali stand auf und trank ihren Kaffee aus. »Ist noch Zeit genug. Ich muss erst in einer Dreiviertelstunde in Collinswood sein. Mach dir keine Sorgen. Ich fahre selbst.«
»Aber du wirst zu spät kommen!«
»Werde ich nicht!«
»Ehrlich, Ali, lass die BBC nicht warten. Das sind schließlich deine Leute.«
Ali lachte. »Cass, manchmal redest du wirklich Quatsch. Vor ein paar Minuten hast du mich noch als Aussie bezeichnet.« Sie schlang ihren kleinen schwarzen Lederrucksack um die Schulter, strich sich ein paar Strähnen aus dem Gesicht und klemmte sie sich hinters Ohr. Wie blass sie ist, dachte Cass. Müde Augen hat sie, und zu dünn ist sie auch.
»Zum Glück ist es Radio«, sagte Ali, als könnte sie Gedanken lesen. »Da ist es doch egal, wie ich aussehe.«
»Du siehst hinreißend aus, wie immer«, sagte Cass. »Aber ein bisschen Lippenstift könnte nicht schaden. Für den Fall, dass da Autogrammjäger sind.«
»Sehr witzig«, erwiderte Ali, warf ihr eine Kusshand zu und wandte sich zum Gehen.
Cass sah ihr hinterher. Wenn sie sich auf einer einsamen Insel entscheiden müsste zwischen Ali Connor und dem jungen Paul Newman, müsste sie Paul leider zurück ins Meer stoßen, denn ohne Ali könnte sie nicht sein, nie im Leben. Cass hatte reihenweise Freunde in Sydney, Männer wie Frauen, und sie liebte das Nachtleben dort. Und dennoch kehrte sie oft genug spätestens am Donnerstag oder Freitag wieder zu ihren Wurzeln nach Adelaide zurück, und der entscheidende Grund dafür war Ali. Sie beobachtete, wie ihre Freundin sich einen Weg durch das gut besuchte Café bahnte, die Tür zur Straße öffnete und ins grelle Tageslicht hinaustrat, wo sie kurz stehen blieb, um ihre Sonnenbrille aufzusetzen. Dann war sie weg.
»Ich bin immer für dich da, Süße«, murmelte Cass, während sie ihr hinterherblickte.
Es war nur etwas mehr als ein Kilometer von der Jeffcott Street bis zu ihrem Haus, aber trotzdem beeilte sich Ali, denn sie wusste, dass sie sich vermutlich verspätete, wenn sie erst nach Hause lief, um dann von dort aus rüber nach Collinswood zu fahren. Sie hätte bei Cass bleiben können – sollen –, hätte noch einen Kaffee trinken und sich dann von ihr im klimatisierten Mercedes zu den ABC-Studios fahren lassen sollen, um entspannt und pünktlich dort zu sein. Aber sie hatte heute schon drei Moderatoren zu ihrem Privatleben Rede und Antwort gestanden und deshalb das übermächtige Bedürfnis, einen Moment die Tür hinter sich zuzumachen, um die Welt auszusperren, sogar Cass. Wild entschlossen eilte sie durch die Straßen von North Adelaide, mit gesenktem Blick, und als sie zu Hause ankam, bedeckte ein leichter Schweißfilm ihre nackte Haut. Erleichtert zog sie die Tür hinter sich zu und stand einen Moment schwer atmend auf dem polierten Parkettboden in der Eingangshalle. So wartete sie auf die beruhigende Wirkung des Hauses, darauf, dass sich ihre Anspannung löste und sich ein Gefühl von Geborgenheit einstellte.
Es war ein besonders schönes Haus. Ein imposantes Herrenhaus, Michaels Erbe. Sie waren schon Mann und Frau gewesen, als er sie zum ersten Mal mit hierherbrachte, um sie seiner Familie vorzustellen. Trotzdem war sie von seiner Mutter in einem der Gästezimmer einquartiert worden. Erst nachdem sie ein Jahr verheiratet waren, erlaubte sie den beiden, offiziell im selben Zimmer zu schlafen, in einem Doppelbett. Margaret McCormack war eine Naturgewalt gewesen, eine unmögliche, unbezwingbare, hochfahrende Zuchtmeisterin von einer Frau, die glaubte, ihr Sohn sei Ali auf den Leim gegangen. Was hatte dieses Mädchen schon zu bieten? In Alis englischem Akzent sah Margaret kein Gütesiegel, und auch ihre unübersehbare Schönheit konnte sie nicht beeindrucken. Als sie erfuhr, dass Ali sich einen Job hinter dem Tresen eines Pubs in der Hutt Street gesucht hatte, schäumte sie vor Empörung beinahe über. Aber das junge Paar hielt durch, und Michael versicherte Ali, seine Mutter würde sie letzten Endes schon noch in ihr Herz schließen – solange sie sich im Haus nur an ihre Regeln hielten. Außerdem sei dieses Haus ein Geschenk. Warum irgendwo für eine schlechtere Unterkunft bezahlen, wo sie doch momentan gar kein Geld hatten? Und so schlich Michael – obwohl er erwachsen war, verheiratet, Mediziner – über den teuren türkischen Teppich im ersten Stock zu Ali, die keusch in ihrem schmalen Bett auf ihn wartete. Es war schwer vorstellbar, dass eine solche Situation unkommentiert bleiben würde, wenn Margaret etwas davon mitbekäme. Also perfektionierten sie die Kunst der lautlosen Liebe, und Margaret – die sicher wusste, was los war, denn nur ein Dummkopf hätte es nicht wissen können, und sie war kein Dummkopf – schien damit zufrieden, dass ihre Oberhoheit ungeschmälert blieb. Als Ali auf den Tag genau ein Jahr nach ihrer Ankunft im Herrenhaus ihr Zimmer betrat, war das Bett abgezogen, und ihre Sachen – Kleider, Toilettenartikel, Kosmetika – waren weg. »Deine Kleider sind in Michaels Zimmer«, sagte Margaret, die mit einem Mal hinter ihr stand. »Ich habe Beatriz gebeten, sie dorthin zu bringen, während du unterwegs warst. Kein Grund, ihr zu danken. Sie wird mehr als angemessen entlohnt. Bei mir allerdings darfst du dich bedanken.«
Margaret hatte inzwischen längst das Zeitliche gesegnet, aber Beatriz war noch da. Als Ali in die Küche kam, saß die alte Dame am Küchentresen und schälte Erbsen. Wie üblich hatte sie ihre langen grauen Haare zu einer Art Turban aufgetürmt, und sie trug einen skurrilen altmodischen Kittel mit buntem Blumenmuster und goldenen Knöpfen, um ihre Kleidung zu schützen. Mit geschickten Fingern bearbeitete sie die Schoten, und als sie Ali sah, verzog sich ihr breites, freundliches Gesicht zu einem liebevollen Lächeln.
»Ali, mein Mädchen«, sagte sie. Sie reichte ihr eine Erbsenschote, die Ali nahm und aufbrach, um sich die Reihe von Erbsen in den Mund zu schütten. Beatriz betrachtete sie mit aufrichtiger Zuneigung.
»Ich kann nicht lange bleiben«, sagte Ali mit dem Mund voller Erbsen. »Ich muss rüber nach Collinswood, zu den Fernsehstudios.«
Traurig schüttelte Beatriz den Kopf. Ihre Augen waren so ausdrucksvoll, dass sie jedes Gefühl vermitteln konnten: Freude, Sehnsucht, Trauer, Verachtung, Zorn, Heiterkeit. Im Moment zeigten sie nur Mitgefühl.
»Emsig, emsig, emsig«, sagte sie. »Immer emsig, immer auf dem Weg wohin, nie mal Zeit, bei mir zu sitzen und Erbsen zu pulen.« Ihr portugiesischer Akzent war selbst nach einem halben Leben in Adelaide noch unvermindert ausgeprägt. Man musste sich einfach nur darauf einlassen, so als lernte man eine fremde Musik kennen.
Sie neigte den Kopf, widmete sich wieder ihrer Aufgabe. Ali betrachtete sie einen Moment lang, dann fragte sie: »Was macht deine Hüfte, Beatriz?«
Beatriz blickte auf. »Nicht besser, nicht schlechter.«
»Du solltest nicht zu lange sitzen«, meinte Ali. »Geh spazieren oder spring ins Wasser. Hauptsache, du bewegst dich!«
Beatriz lachte schallend. »Du weißt, dass ich nicht gern nass werde.«
»Schwimmen ist sehr gesund, Beatriz«, erwiderte Ali. »Und wir haben da draußen einen Pool, den keiner mehr nutzt.« Sie nahm ein Glas aus dem Schrank und schenkte sich Eiswasser aus dem Kühlschrank ein. Die Kälte war ein Schock. Ali spürte einen stechenden Schmerz in Schläfen und Zähnen. Beatriz konzentrierte sich bereits wieder auf ihre Erbsen, und Ali ging zur offenen Hintertür hinaus in den Garten, wo die Sprinkleranlage den Rasen bewässerte. Ein kleiner Schwarm von leuchtend bunten Loris tanzte in dem hohen Bogen aus feinen Tröpfchen, und als Ali ihre Sandalen abstreifte und sich zu ihnen auf das feuchte Gras gesellte, hatten die Tiere sie mit ihren schwarzen Knopfaugen genau im Blick, ließen sich aber nicht vertreiben. Sie lief über den Rasen zum Swimmingpool – einem schmalen Rechteck in Türkis, im scharfen Kontrast zu den alten Steinplatten, von denen es eingefasst war –, raffte ihren Rock zusammen und setzte sich auf den Rand vom Pool, sodass ihre Beine im Wasser hingen, fast bis zu den Knien. Dann legte sie sich hin und genoss die Wärme der Steine und das kühle Gras, während das Wasser kaum merklich um ihre Beine schwappte. Sie schloss die Augen vor dem viel zu blauen Himmel und lauschte dem quäkenden Schnattern der Vögel und dem Prasseln des Wassers aus dem Sprinkler, ließ ihren Gedanken freien Lauf. Da fiel ein Schatten auf ihr Gesicht, und sie hörte Stellas Stimme.
»Mum, dein Rock wird klatschnass.«
Ali schlug die Augen auf. Ihre Tochter blickte auf sie herab. Sie war siebzehn und hatte Alis dunkelbraune Haare, Alis Haselnussaugen, Alis Nase, Mund und Kinn. Aber ihren eigenen Kopf.
»Was machst du da überhaupt? Du siehst so komisch aus.«
»Ich ruh mich ein bisschen aus«, antwortete Ali, und dann, nach kurzer Pause: »So was sagt man nicht, Stella.«
Das Mädchen ließ sich neben ihr auf den Boden sinken, im Schneidersitz, und Ali warf einen Blick auf ihre jüngere Tochter. Diese kaute am Nagel ihres linken Daumens und starrte ins Wasser.
»Alles okay?«
Stella zuckte mit den Schultern.
»Was ist?« Ali richtete sich auf, und im Sitzen merkte sie, dass Stella recht hatte. Ihr Rock war klatschnass. »Stella, was ist los?«
Vom Haus her rief Beatriz: »Ali, Cass ist mit dem Auto da und sagt, sie fährt dich nach Collinswood.« Stella sah ihre Mutter an und verdrehte stöhnend die Augen.
»Cass kann warten«, meinte Ali zu Stella. »Sie sollte eigentlich gar nicht herkommen.«
»Schon okay«, erwiderte Stella und wandte sich ab, mit so etwas wie düsterem Fatalismus. »Geh ruhig.«
»Stella«, insistierte Ali. »Was ist passiert, Süße?«
Da hörte sie Cass’ Stimme laut und deutlich durch die offene Hintertür. »Ali Connor, du musst los!«, rief ihre Freundin.
»Halt die Klappe, Cass!«, rief Ali zurück.
»Versuch bloß nicht, cool zu sein, Mum«, sagte Stella mit dem ausdruckslosen Tonfall eines Teenagers.
»Ich versuche nicht, cool zu sein. Ich bin nur sauer auf Cass. Was ist los mit dir, Stella?«
»Huhu, Stella, Schätzchen!«, rief Cass und winkte wie wild vom anderen Ende des Gartens her. Doch Stella ignorierte sie.
»Im Ernst, Mum, geh ruhig.«
»Na gut, okay, ich sollte lieber los. Aber wir reden nachher, okay? Nachher oder morgen früh? Ich muss noch mal ins Studio, es geht um …«
»… dein Buch. Ich weiß, ich weiß. Geh schon.« Stella sprach mit dieser ausdruckslosen, desillusionierten Stimme, mit der sie endlose Langeweile kommunizierte, und Ali wusste, dass man mit ihr nicht reden konnte, wenn sie in dieser Stimmung war. Also ließ sie ihre Tochter am Pool zurück, wo sie mürrisch die kleinen Wellen auf dem Wasser anstarrte.
»Oh-oh. Ärger?«, fragte Cass, als sie das Haus verließen.
»Das geht vorbei«, meinte Ali.
Das Buch. Das Buch. Ein dicker, lesbarer Wälzer, hundertfünfzigtausend Wörter, direkt ins Taschenbuch, und Alis Meinung nach nicht besser oder schlechter als ihre vorherigen drei Romane, die in Australien einigermaßen gut angenommen worden waren, von denen der Rest der Welt aber nichts gehört hatte. Tell the Story, Sing the Song dagegen war ein echtes Phänomen. Nach der Veröffentlichung war es erst nur langsam angelaufen, doch dann folgte eine Flut von einflussreichen Online-Rezensionen, die Verkäufe zogen an, die Buchclubs liefen heiß, kurze Aufregung beim Verlag, weil sie mit dem Nachdrucken nicht hinterherkamen. Dann ein Anruf bei ihrem Agenten Anfang Oktober, von Baz Luhrmanns Büro: Nennen Sie Ihren Preis für die Rechte, hatten sie gesagt. Baz will dieses Buch, Nicole ist mit an Bord, ebenso Hugh. Tausende Bücher gingen weltweit jede Woche über den Ladentisch, und Alis lumpiger Vorschuss war in Rekordzeit wieder eingespielt. Zum ersten Mal im Leben verdiente sie mit ihren Büchern Geld, und im Interview für Woman’s Hour auf BBC Radio 4 fragte Jenni Murray sie, wie sich das anfühlte.
»Unwirklich«, sagte Ali unter Kopfhörern, ganz allein am grünen filzbespannten Tisch in einem Studio der ABC. Direkt hinter der Glasscheibe sah sie Cass sitzen, die mit ins Studio gekommen war. Sie saß mit am Mischpult und frischte ihr Make-up auf, während sie ihrer Freundin lauschte. Eine junge Toningenieurin kaute gelangweilt Kaugummi, behielt aber die Pegel und Mikros im Blick.
»Unwirklich und leicht obszön«, fügte Ali hinzu.
»Obszön?«, fragte Jenni Murray. »Das ist eine ungewöhnliche Wortwahl.«
»Na ja, ich befinde mich ja auch in einer ungewöhnlichen Lage«, sagte Ali. Sie spürte es schon wieder. Spürte, wie sie in die Defensive ging. Und staunte über den Klang ihrer Stimme. Ihre Familie und ihre Freunde in Adelaide amüsierten sich immer über ihren englischen Akzent. Doch jetzt hörte sie die volltönende, gepflegte Stimme der Moderatorin, und damit war ihre eigene Stimme ganz und gar nicht zu vergleichen. Ihr fehlte es an Substanz. Hinter der Scheibe wedelte Cass raumgreifend mit den Armen, drängte sie, weiter ins Detail zu gehen. Ali nickte. Ja, ja, bleib locker.
»Ist Ihnen das Geld unangenehm?«
»Es bringt mich zum Nachdenken«, erwiderte Ali, »über das willkürliche Wesen des Erfolges.«
»Als Sie die Idee für Tell the Story hatten, wussten Sie also nicht, dass Sie auf eine Goldader gestoßen waren?«
»Nein, natürlich nicht«, sagte Ali. »Meine drei anderen Bücher hatten nichts dergleichen erreicht, und eigentlich finde ich, sie hätten es ebenso verdient, zumindest aber nicht weniger als dieses neue. Ich schätze, manchmal entspricht ein Buch einfach der Vorstellungswelt eines größeren Publikums.«
»Was glauben Sie denn, warum es ein solcher Erfolg wurde?«
»Ich bin nicht sicher«, erwiderte Ali. »Wenn ich es wüsste, hätte ich es wahrscheinlich schon früher geschrieben.« Sie hatte es lustig gemeint, doch sobald die Worte heraus waren, wusste sie, dass sie unhöflich klangen. »Nein, im Ernst«, fuhr sie fort, in dem Versuch, die Scharte auszuwetzen. »Ich denke, es sagt ein paar Wahrheiten über das Leben in Australien, über unsere kollektive Vergangenheit. Und es ist zugänglich, regt dabei aber auch zum Nachdenken an. Zumindest war das meine Absicht. Es spiegelt viel von den Ängsten und Sorgen der rechtschaffenen Australier wider.«
»Die Not der indigenen Völker, meinen Sie?«
»Unter anderem, ja, und dazu habe ich auch einiges zu sagen. Aber in meiner Geschichte geht es um Armut, und auch wenn die in erster Linie und historisch gesehen Farbige betrifft, können auch weiße Menschen unter ihr leiden, besonders in den ländlichen Gegenden im Süden von Australien. Ich weiß nicht, wie gut Sie sich hier auskennen, aber die ländlichen Gegenden sind unermesslich weit. Es gibt hier eine Rinderfarm, die ist größer als Wales, falls das hilft, einen Eindruck zu vermitteln.«
»Das tut es allerdings. Da wird einem ja ganz schwindlig. Und wie viel mussten Sie recherchieren? Es ist ein so vielschichtiges Buch … Vielleicht spricht es deshalb ja eine derart breit gefächerte Leserschaft an.«
»Danke, ja. Ich hoffe, das tut es. Für einige Aspekte habe ich ausgiebig recherchiert, für andere nicht so sehr. Die Musik zum Beispiel, die junge Sängerin der Aborigines, die hatte ich fix und fertig im Kopf.«
»Das ist eine wundervolle Figur. Ist sie real?«
»Ja und nein«, sagte Ali. »Wie das Meiste in diesem Buch.«
»Also, ich konnte es nicht aus der Hand legen«, meinte Jenni Murray. »Sie haben ein faszinierendes Buch geschrieben, und als ich diese Woche mit dem Zug nach London fuhr, habe ich viele Leute gesehen, die darin vertieft waren.«
»Offenbar interessiert sich der Rest der Welt mehr für Australien, als wir dachten«, erwiderte Ali. »Außerdem spielt die Geschichte in Adelaide, und man hört nicht so viel von dieser Stadt. Ich denke, das unterscheidet das Buch vielleicht von anderen und macht es interessant.«
»Weil Adelaide anders und interessant ist?«
»Ja, ich glaube schon. In Sydney und Melbourne bezeichnet man uns als langweilig, aber ich denke, die sind nur neidisch. Mir jedenfalls kommt es hier immer vor wie im Paradies.«
»Na, wenn das kein Lob ist!«, sagte Jenni Murray, und da das keine Frage war, reagierte Ali nicht, sodass Jenni Murray das Schweigen rasch überbrückte.
»Sie leben nun also seit gut dreißig Jahren in Adelaide, aber geboren sind Sie in Sheffield?«
»Ja«, sagte Ali. »Das stimmt.«
»Und wie haben die Menschen zu Hause auf Ihren Erfolg reagiert?«
»Zu Hause?«, fragte Ali.
»Verzeihung, ich meinte: in Sheffield, in Attercliffe.«
»Oh«, sagte Ali ausdruckslos. Sie zögerte, dann fügte sie hinzu: »Ich weiß nicht, ich meine, ich habe keinen Kontakt zu irgendwem dort, nicht mehr, nach all den Jahren.«
»Adelaide ist also Ihr Zuhause, in jeder Hinsicht?«
»Zu hundert Prozent.«
Hinterher, in Cass’ Wagen, scrollte sie sich durch die unzähligen Nachrichten und Benachrichtigungen, die auf dem Bildschirm ihres Smartphones schon auf sie warteten. Sie hatte sich geweigert, dem Vorschlag Ihrer Presseagentin nachzukommen und sich bei Facebook anzumelden, doch sie war widerwillig bereit gewesen, Twitter zu nutzen, und noch immer staunte sie, wie etwas im Grunde derart Triviales und Selbstdarstellerisches so breite Verwendung fand. Jeden Tag bekam sie neue Follower, und immer, wenn sie etwas postete, wurde es sofort »geliked« und immer und immer wieder »retweeted«. Hätte sie nicht einen harten Kern von Sheffield-Bescheidenheit und gesundem Menschenverstand in sich gehabt, hätte sie vielleicht glauben mögen, dass sie von Tausenden geliebt und bewundert wurde. Das ist alles so ein Quatsch, dachte sie, aber wenn es sein muss …
»Ich werde Jade zuliebe einen Tweet über die wundervolle Woman’s Hour posten«, sagte sie zu Cass.
»Braves Mädchen, das solltest du tun. Du hast dich gut gemacht da drinnen, Schätzchen, du klangst sehr aufgeweckt.« Ihre Freundin beugte sich vor und stellte das Radio an. Motormouth Maybelle sang »Big, Blonde And Beautiful«. Cass stimmte juchzend mit ein.
Ali stöhnte auf. »Echt jetzt?«, sagte sie. »Hairspray?«
»Ein Hoch auf Queen Latifah!«, erwiderte Cass und drehte lauter.
Ali lachte. »Du solltest es wirklich mal mit Musicals probieren.« Sie widmete sich wieder ihrem Telefon, ging die Liste der Nachrichten durch.
»Oh«, sagte sie plötzlich, und sie hörte selbst, wie seltsam ihre Stimme mit einem Mal klang.
»Was?«, fragte Cass, augenblicklich beunruhigt. »Trolle?«
»Nein, nein«, sagte Ali. »Nein. Nein.«
»Das sind ziemlich viele ›Neins‹.«
Ali schwieg. DanLawrenceMusic folgt dir.
»Ali?«
Jetzt sah sie Dans Gesicht – ein unspektakuläres Foto, keine Gimmicks, nur er im weißen T-Shirt, den Blick geradeaus gerichtet –, und nach der langen Zeit, nach all den Jahren war er ihr zutiefst vertraut. Daniel Lawrence. Ach du meine Güte, dachte sie. Sie zwang sich, tief einzuatmen, zitterte aber beim Ausatmen und verriet sich damit.
»Ali? Was ist mit dir?«
Sie zwang sich zu einem Lächeln. »Ach, nichts, nichts, ein Name aus alten Zeiten, mehr nicht. Hat mich nur kurz überrascht.«
Sie tippte auf Dans Namen, um sein Profil zu öffnen, dann starrte sie den Bildschirm ihres Telefons an.
Dan Lawrence
@DanLawrenceMusic
Folgt dir
I know, it’s only Rock’n’Roll but I like it. WTID.
Folgt
Follower
825
28.3K
Edinburgh, Schottland
Beigetreten Juli 2009
»Ich bin hier echt im Nachteil, Babe«, sagte Cass. »Ich kann nicht sehen, was dich umtreibt.«
Dan Lawrence.
Daniel Lawrence.
Daniel. Dieser süße Junge, inzwischen ein Mann, lächelte sie wieder an.
»Ali?«, insistierte Cass besorgt, denn ihre Freundin starrte ihr Handy auf höchst untypische Art und Weise an, und sie antwortete nicht, war gar nicht mehr richtig da, irgendwie verloren.
»Komm schon, rede mit mir«, sagte Cass und stellte Maybelle ab. »Was guckst du dir da an?«
Ali sagte immer noch nichts, aber weil sie an einer roten Ampel standen, hielt sie den Bildschirm so, dass Cass einen Blick darauf werfen konnte.
»Mmmh, nett«, erwiderte sie. »Genau mein Beuteschema. Cooler Drei-Tage-Bart. Wer ist das?«
»Das war Daniel«, sagte Ali.
»Jetzt offensichtlich Dan. Was ist das?« Sie zeigte mit dem Finger. »WTID? Ist das so was wie ein Code? Hat das was zu bedeuten?«
»Ja«, sagte Ali. »Es bedeutet Wednesday Till I Die.«
»Wednesday? Warum Wednesday? Wieso nicht irgendein anderer Wochentag?«
»Lieblingsmannschaft«, sagte Ali. »Fußball.«
»Engländer?«
»Jep.«
»Nicht schlecht«, meinte Cass und beugte sich vor, um besser sehen zu können. »Oh ja, Baby, der könnte mir auch gefallen.«
4
SHEFFIELD,
23. DEZEMBER 1978