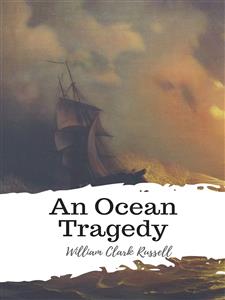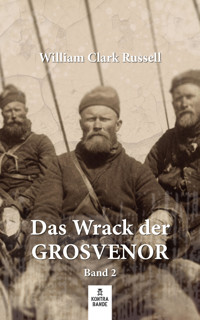
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: kontrabande Verlag, Köln
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Grosvenor - Aufstand und Rebellion Der zweite Band führt die Leser in die dunklen Tiefen menschlicher Verzweiflung und Wut. Die Besatzung der Grosvenor sieht sich nicht nur den Gefahren des Ozeans ausgesetzt, sondern auch inneren Konflikten, die zu einem offenen Aufstand führen. Angeführt von einem charismatischen, aber unberechenbaren Matrosen, bricht unter den Seeleuten ein erbitterter Machtkampf aus. Während die Grosvenor weiterhin auf den Wellen schwankt, entwickelt sich eine spannende Geschichte um Loyalität, Verrat und die unaufhaltsame Eskalation von Gewalt an Bord. Ein packendes Psychodrama auf offener See.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kopierschutz
Mit deinem Kauf hast du unabhängige Literatur unterstützt – danke dafür.
Dieses E-Book enthält ein unsichtbares digitales Wasserzeichen. Es beeinträchtigt weder Inhalt noch Lesbarkeit, ermöglicht uns aber, unrechtmäßige Kopien dem ursprünglichen Käufer zuzuordnen.
Bitte sei fair und gib dieses Buch nicht weiter.
Über dieses Buch
Das Wrack der Grosvenor zählt zu den eindrucksvollsten Seegeschichten des 19. Jahrhunderts. William Clark Russell erzählt die dramatische Geschichte eines Handelsschiffes, dessen Besatzung nicht nur gegen die Naturgewalten, sondern auch gegen Ungerechtigkeit und Verrat kämpfen muss.
Mit eindringlicher Präzision schildert Russell die raue Wirklichkeit des Lebens auf See, die Kameradschaft unter den Seeleuten und die Herausforderungen, die sie auf ihrer gefährlichen Reise bewältigen müssen. Ein zeitloser Klassiker, der die Härte und die Schönheit des maritimen Lebens in unvergesslichen Bildern einfängt.
Was bisher geschah
Der erste Band von Das Wrack der Grosvenor beginnt mit der Einführung von Mr. Royle, dem ersten Offizier des gleichnamigen Handelsschiffes, das unter dem Kommando eines unerbittlichen Kapitäns steht. Schon bald wird deutlich, dass die Besatzung unter harten Bedingungen arbeitet und der Kapitän keinerlei Nachsicht mit seinen Männern hat. Sein erster Offizier, Mr. Duckling, ist ebenso skrupellos und führt Befehle ohne Rücksicht auf Verluste aus. Royle gerät in Konflikt mit der autoritären Schiffsführung, als er versucht, sich für die Männer einzusetzen.
Während die Grosvenor ihre Reise fortsetzt, zieht ein schwerer Sturm auf. Die Mannschaft kämpft gegen die Naturgewalten, doch gleichzeitig wächst die Unzufriedenheit unter den Seeleuten, die sich gegen die unmenschliche Behandlung durch den Kapitän zu wehren beginnen. Inmitten dieser Spannungen entdeckt man auf hoher See ein Schiff mit Schiffbrüchigen, darunter eine junge Frau und ihr Vater. Trotz des Widerstands des Kapitäns werden sie an Bord genommen.
Die Anwesenheit der Geretteten verschärft die ohnehin angespannte Lage, da sich herausstellt, dass sie von einem anderen Schiff stammen, das durch eine Meuterei übernommen wurde. Der Kapitän zeigt sich unerbittlich und weigert sich, ihnen Schutz zu gewähren. Royle, der sich zunehmend gegen seinen Vorgesetzten stellt, erkennt, dass er nicht länger untätig bleiben kann. Die Feindseligkeiten zwischen Kapitän, Offizieren und Besatzung eskalieren, und es wird deutlich, dass sich eine offene Rebellion anbahnt. Der erste Band endet mit wachsender Spannung, die sich in einer Meuterei entladen, während das Schiff weiter durch unsichere Gewässer fährt.
Über das Buch
Nach der blutigen Meuterei auf der Grosvenor hat die Besatzung das Kommando übernommen. Mr. Royle, der gezwungenermaßen die Navigation übernimmt, ist sich bewusst, dass er nur am Leben gelassen wurde, weil die Männer jemanden brauchen, der sie sicher ans Ziel bringt. Doch je näher die Grosvenor ihrem Bestimmungsort kommt, desto stärker wächst seine Furcht, dass die Meuterer ihn und die beiden Schiffbrüchigen, die er gerettet hat – die junge Mary Robertson und ihren geschwächten Vater – beseitigen werden, um keine Zeugen zu hinterlassen.
Während das Schiff seinen Kurs hält, spitzen sich die Spannungen an Bord zu. Die Mannschaft, ursprünglich von ihrem Hass auf den ehemaligen Kapitän angetrieben, ist zunehmend misstrauisch. Die Gefahr eines erneuten Gewaltausbruchs wächst. Royle und Mary erkennen, dass einige der Männer eine Intrige gegen sie schmieden. Der skrupellose Zimmermann Stevens scheint einen perfiden Plan zu verfolgen, und Royle wird klar, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Lage eskaliert.
In einem verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit sucht Royle nach einem Ausweg. Er versucht, heimlich Verbündete unter den Männern zu finden und eine Möglichkeit zur Flucht zu ersinnen. Doch die Mannschaft wird zunehmend unberechenbar, und jeder falsche Schritt könnte für ihn und die Robertsons den sicheren Tod bedeuten.
Über den Autor
William Clark Russell war ein produktiver britischer Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, dessen Werke ihn zum Meister der Seegeschichte machten. Er wurde 1844 in New York als einer von vier Söhnen des englischen Komponisten Henry Russell und seiner Frau Isabella Lloyd geboren, die ihm ihre literarische Leidenschaft und ihren Sprachwitz vererbten. Russell verbrachte seine Schulzeit in England und Frankreich und plante sogar eine Reise nach Afrika, bevor er mit 13 Jahren die Schule verließ, um zur britischen Handelsmarine zu gehen.
Seine Jugendjahre auf See prägten ihn tief und dienten ihm später als unerschöpfliche Quelle für seine Geschichten. An Bord der „Duncan Dunbar“ lernte er die Härte und Strenge des Seemannslebens kennen und reiste bis nach Asien und Australien. Eindrücke wie die Eroberung der Taku-Festungen vor der chinesischen Küste oder die dramatische Begegnung mit einem psychisch labilen Offizier inspirierten ihn, seine Erlebnisse aufzuschreiben. Diese Berichte führten schließlich zu einer Karriere als Schriftsteller, die ihm trotz gesundheitlicher Rückschläge großen Erfolg brachte.
Russells Werk ist bekannt für seine packenden Schilderungen des Lebens auf See und die Darstellung menschlicher Schicksale vor dem Hintergrund der rauen Natur. Sein bekanntestes Buch, The Wreck of the Grosvenor (1877), zählt zu den bedeutendsten Seefahrtsromanen seiner Zeit und vermittelt dem Leser Einblicke in die Gefahren und sozialen Dynamiken des viktorianischen Schiffsalltags. Russell verstand es, Spannung mit Authentizität zu verbinden und prägte damit das Genre des Seefahrerromans entscheidend.
Auch wenn sein Bekanntheitsgrad heute nicht an den seiner Zeitgenossen Charles Dickens oder Robert Louis Stevenson heranreicht, bleibt Russell für Liebhaber der Seefahrtsliteratur eine wichtige Figur. Werke wie The Frozen Pirate (1887) und An Ocean Tragedy (1890) zeigen seine Fähigkeit, Abenteuer und Übernatürliches miteinander zu verweben und die psychologische Tiefe seiner Figuren auszuloten. Neben seinen Romanen verfasste Russell zahlreiche Kurzgeschichten und Essays, die von der Seefahrt und dem Überlebenswillen der Menschen handeln.
Russells Werk umfasst auch biografische und historische Werke über die britische Seefahrtsgeschichte, die von seiner profunden Kenntnis und Leidenschaft für dieses Thema zeugen. Seine Erzählungen sind nicht nur Abenteuergeschichten, sondern auch eindrucksvolle Porträts der menschlichen Natur, von Mut und Verzweiflung bis hin zu Hoffnung und Sehnsucht. William Clark Russells Vermächtnis bleibt eine eindrucksvolle literarische Brücke in eine Zeit, als die Seefahrt noch Abenteuer und Entbehrung bedeutete und das Meer Bedrohung und Verheißung zugleich war.
Neben seinen Romanen war Russell auch für seine Kurzgeschichten und Essays bekannt, die oft in Zeitschriften veröffentlicht wurden und sich mit Themen der Seefahrt und des menschlichen Überlebenswillens befassten. Sie zeugen von seinem ausgeprägten Sinn für dramatische Erzählungen und seinem tiefen Respekt für die Menschen, die ihr Leben auf See verbrachten.
Russells literarisches Spektrum umfasste auch biografische und historische Werke, in denen er die Geschichte der britischen Seefahrt und berühmter Schiffsreisen nachzeichnete. Diese Schriften tragen zum Umfang seines Werks bei und zeugen von seinem umfassenden Wissen und seiner Leidenschaft für das Thema.
Zusammen bilden diese Werke ein beeindruckendes Vermächtnis, das den Leser in eine Zeit zurückversetzt, in der das Meer sowohl Verheißung als auch Bedrohung war - eine Welt, die Russell mit unvergleichlicher Detailtreue und erzählerischer Kraft wiedergab.
Inhalt
Cover
Digitales Wasserzeichen
Kurzübersicht
Was bisher geschah
Über das Buch
Über den Autor
Copyright
Disclaimer
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Hilf uns
Himmelsstürmer
Der Job
Nirgendwann
Zwei Jahre vorm Mast
Anne auf Green Gables
Guide
Contents
Impressum:
Erschienen im kontrabande Verlag, Köln.
Landsbergstraße 24 . 50678 Köln
Ungekürzte Ausgabe © 2025 kontrabande Verlag
Erstmals 1877 erschienen im Verlag Sampson Low, Marston, Searle & Rivington, London, unter dem Titel „The Wreck of the Grosvenor“
Umschlagbild & Umschlaggestaltung: kontrabande Verlag, Köln.
Übersetzung: Mac Conin, kontrabande Verlag, Köln.
Titelgeneration unter Verwendung von Teilen von midjourney.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkungen nicht erkennbar. E-Book-Herstellung im Verlag.
ISBN 978-3-911831-38-3 Ebook
ISBN 978-3-911831-04-8 Taschenbuch
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website www.kontrabande.de
Viel Spaß beim Lesen.
Die Übersetzung wurde in Teilen leicht überarbeitet, um sie dem heutigen Sprachgebrauch anzupassen.
Kapitel I.
Die Männer waren die ganze Nacht wach gewesen. Daher riet ich dem Zimmermann, zu ihnen zu gehen und ihnen mitzuteilen, dass die Wachen nicht geändert würden und dass die Mannschaft, die gerade unter Deck sein sollte, sich schlafen legen könne.
Einige verlangten offenbar, dass ihnen Rum ausgegeben werde. Doch der Zimmermann entgegnete, dass es erst zum Frühstück wieder etwas gäbe. Falls sie zu sehr über Alkohol redeten, werde er mit einer Ahle ein Loch in die Fässer stechen und den Inhalt auslaufen lassen. Denn wenn die Männer zu trinken anfingen, musste das Schiff unweigerlich ins Chaos geraten. Und in dem Fall könnten sie leicht von der Besatzung eines anderen Schiffs aufgebracht und nach England gebracht werden. Und dort würde sie nichts Geringeres als der Galgen oder die Verbannung erwarten.
Diese deutliche Warnung aus dem Mund des Mannes, der bei der Planung der Meuterei an vorderster Front gestanden hatte, zeigte Wirkung. Diejenigen, die nach Rum gefragt hatten, wurden sofort von ihren Kameraden lautstark zurechtgewiesen. In ihrer Gereiztheit hätten die meisten wohl sogar zugestimmt, wenn der Zimmermann vorgeschlagen hätte, die Fässer über Bord zu werfen. Und damit wäre die Sache wäre erledigt gewesen.
Das alles berichtete mir der Bootsmann, der mit dem Zimmermann das Achterdeck verlassen hatte, aber vor ihm zurückgekehrt war. Da ich nun mit ihm allein war, nutzte ich die Gelegenheit, ihm einige Fragen zur Meuterei zu stellen. Besonders wollte ich wissen, was es mit jener geheimen Absicht auf sich habe,, die der Mann namens „Bill“ dem Zimmermann zur Weitergabe an mich anvertraut hatte, die dieser aber nicht erklären wollte.
Der Bootsmann, der im Grunde ein ehrlicher Kerl war, beteuerte, er habe keine Ahnung, worum es ging. Doch er versprach, das Geheimnis aus Johnson oder einem der anderen herauszubekommen und es mir mitzuteilen.
Dann erzählte er mir, dass er sich der Meuterei angeschlossen habe, weil er sah, dass die Männer fest entschlossen waren – und weil sie glaubten, er stünde auf der Seite des Kapitäns, was für ihn äußerst gefährlich gewesen wäre.
Wie das Ganze ausgehen würde, konnte er nicht voraussehen. Die Idee der Männer, das Schiff zu verlassen und mit offenen Booten das Ufer zu erreichen, sei zwar nicht unmöglich, doch das Risiko einer Gefangennahme wäre trotzdem enorm. Falls sie unterwegs auf ein Schiff träfen, könnten sie sich kaum weigern, an Bord genommen zu werden. Und da einige der Meuterer grobe, ungebildete Männer seien, würde die Wahrheit früher oder später ans Licht kommen.
Ebenso riskant wäre es, an Land zu entkommen – die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Aussagen bei einer Befragung so stark voneinander abwichen, dass sie sich selbst verrieten, stünde eins zu fünfzig.
Doch an dieser Stelle wurde unser Gespräch unterbrochen, als der Zimmermann nach achtern kam, um mich zu bitten, die Wache zu übernehmen, während er und der Bootsmann sich hinlegten. Er sei völlig erschöpft und zu nichts mehr zu gebrauchen, ehe er sich nicht ausgeruht habe.
Inzwischen war es heller Tag. Der Osten erstrahlte im silbernen Glanz der aufgehenden Sonne.
Ich entdeckte eine Segelfläche in Luv, auf Steuerbordbug, nach Osten steuernd. Durch das Fernrohr erkannte ich sie als kleine Toppsegelschooner, doch da wir mit frischem Wind frei segelten, versank ihr Rumpf bald hinter dem Horizont.
Der Anblick dieses Schiffes jedoch brachte mich ins Grübeln über meine eigene Lage. Was würde man denken, und wie würde man mit mir verfahren, wenn ich – vorausgesetzt, ich erreichte jemals das Land – die Geschichte dieser Meuterei erzählte? Doch das war nur ein zweitrangiger Gedanke. Viel drängender war die Frage, wie die Männer handeln würden, wenn ich sie an den Ort gebracht hatte, den sie erreichen wollten.
Würden sie einem Zeugen ihrer mörderischen Taten wie mir die geringste Chance lassen, mit dem Leben davonzukommen? Ich, dessen bloße Aussage die Justiz auf die Spur eines jeden von ihnen setzen konnte?
Ich konnte ihren Versprechungen nicht trauen. Die Schwüre von Halunken wie diesen waren wertlos. Sie würden mich ohne den geringsten Skrupel umbringen, wenn sie dadurch ihre eigenen Chancen auf Flucht verbesserten.
Und ich war mir sicher, dass ich das gleiche Schicksal wie Coxon und Duckling geteilt hätte – trotz der Sympathie, die ich ihnen entgegengebracht hatte. Trotz ihrer Behauptung, mein Leben nicht zu wollen, hätten sie bestimmt nicht erkannt, dass sie jemanden brauchten, der das Schiff für sie navigieren konnte. Und dass ich für ihre Zwecke nützlicher war als die beiden Männer, die sie ermordet hatten.
Meine Unruhe war größer, als ich mir eingestehen mochte. In Gedanken wälzte ich verschiedene Fluchtpläne hin und her. Doch stets war mir bewußt, dass zwei hilflose Menschenleben vollständig von meinem eigenen Überleben abhingen.
Einmal überlegte ich, den Bootsmann ins Vertrauen zu ziehen, heimlich Vorräte in einem der Beiboote zu verstauen und mit ihm sowie unseren Passagieren in einer dunklen Nacht davonzusegeln.
Dann wiederum dachte ich daran, ihn herauszufinden zu lassen, ob sich unter der Mannschaft Verbündete finden ließen, mit denen wir uns gegen die gefährlichsten Meuterer zur Wehr setzen könnten.
Eine weitere Idee war, vorzugeben, den Kurs des Schiffs falsch zu berechnen, und es in einen Hafen zu steuern.
Doch so leicht solche Pläne zu ersinnen waren, so wenig schienen sie sich tatsächlich umsetzen zu lassen.
Um den Männern zu zeigen, dass ich meine Aufgabe ernst nahm, blieb ich bis sechs Uhr morgens ununterbrochen an Deck. Der Morgen war wunderschön. Die warme, würzige Brise aus Süden trug einen betörenden Duft, das Wasser leuchtete so blau wie der Himmel.
Dann weckte ich den Zimmermann in der Kabine, die früher mir gehört hatte. Ich fand ihn in meiner Koje auf meiner Matratze, die Stiefel noch an den Füßen, eine meiner Pfeifen in der Hand. Ich sagte ihm, dass das Schiff nun alle Segel vertragen könne, und riet ihm, die Segel setzen zu lassen.
Er kam in ziemlich guter Laune aus der Koje und schlurfte durch den Salon. Doch als er gerade die Niedergangstreppe hinaufsteigen wollte, rief ich ihm hinterher, ob er nicht den Steward sprechen und ihm Anweisungen zur Ausgabe der Vorräte geben wolle. Ich zog es vor, dass er sich darum kümmerte – so entsprach es am besten den Wünschen der Mannschaft.
Die Wahrheit war jedoch, dass ich möglichst viel Verantwortung auf ihn abwälzen wollte, um mich selbst so wenig wie möglich vor den Männern rechtfertigen zu müssen.
„Ja, ja. Hol ihn raus. Wo steckt der Kerl?“ antwortete er und drehte sich um.
„Steward!“ rief ich.
Nach einer kurzen Pause öffnete sich die Tür der Kapitänskajüte, und der Steward trat heraus. Noch nie hatte ich einen so elenden Anblick gesehen – ein Gesicht totenbleich, ausgemergelt, die Augen rot unterlaufen, der Mund bebend, die Arme kraftlos herabhängend wie bei einem Irren, das Haar verfilzt, die Knie schlotternd.
„Na, mein Junge“, sagte der Zimmermann (wobei der Steward immerhin an die vierzig war), „was denkst du, was mit dir geschehen soll? Ist Erhängen zu gnädig? Oder wäre Ertränken mehr nach deinem Geschmack? Oder soll dich vielleicht der Smutje sezieren? Der ist nämlich ein ziemlich geschickter Schnippler.“
Der Steward richtete seine blutunterlaufenen Augen auf mich. Seine bleichen Lippen bewegten sich, doch kein Laut kam heraus.
„Mr. Stevens macht nur einen Scherz“, rief ich schnell aus. Und ich hätte in diesem Moment ein Jahresgehalt gegeben, um den Kerl für sein grausames Spiel mit der Angst dieses unglücklichen Mannes niederzuschlagen. „Er will mit dir über die Vorräte im Salon sprechen.“
Der Zimmermann musterte ihn mit finsterem Blick, als würde er sich an der Angst des Mannes weiden. Der arme Kerl stammelte: „Ja, Sir?“ Er hob demütig die Augen zum Zimmermann und faltete unwillkürlich die Hände, als flehte er um Gnade.
„Hör mal gut zu, mein Junge“, sagte der Zimmermann, steckte die Hände in die Taschen und lehnte sich gegen den Besanmast. „Hier an Bord sind jetzt alle gleich. Keiner steht über dem anderen – außer dir, aber du bist im Moment ein absolutes Nichts. Weil du dem Skipper am Rockzipfel hingst, als der uns mit den Vorräten vergiften wollte, die du, verdammt noch mal, auch noch mit Freude ausgegeben hast! Jetzt pass auf: Du wirst dich nützlich machen und zu den richtigen Zeiten die Vorräte aus dem Salon an die Männer verteilen. Außerdem kriegt jeder Mann am Tag drei Portionen Grog. Mr. Ryle wird dir sagen, wie lange unsere Fahrt dauern wird. Und du berechnest dann den Lebendvorrat so, dass jede Wache ihren Anteil an Schweinen und Geflügel bekommt. Aber du“, er spuckte einen Schwall Tabaksaft aus, „rührst nichts an außer dem Proviant, den auch die Mannschaft frisst! Merk dir das! Wenn wir dich auch nur an einem einzigen Keks aus dem Salon erwischen, bei lebendigem Donner, dann baumelst du am Vormarsbaum!“
Er schüttelte die Faust vor dem Gesicht des Stewards und wandte sich dann an mich. „Mehr gibt’s nicht zu sagen, oder?“
„Nein, das war alles“, erwiderte ich. Der Steward kroch duckmäuserisch davon und torkelte in Richtung Pantry, während der Zimmermann die Niedergangstreppe hinaufstieg.
Ich betrat die Kabine, die ich zur besseren Orientierung weiterhin als Kapitänskajüte bezeichnen werde, und ließ mich auf einen am Boden verschraubten Stuhl vor einem breiten Tisch nieder.
Die Kabine war durchaus komfortabel eingerichtet. Bücherregale hingen an den Wänden, eine große Weltkarte prangte daneben, einige kolorierte Schiffsdrucke schmückten den Raum, eine bequeme Koje stand bereit, und Mahagonitruhen mit gepolsterten Deckeln dienten als Sitzgelegenheiten.
Zwischen Schreibmaterialien, einem Etui mit mathematischen Instrumenten, einem Bootskompass und allerlei Kleinkram auf dem Tisch entdeckte ich einen amerikanischen Fünfkammer-Revolver. Ich nahm ihn in die Hand, untersuchte ihn. Er war geladen. Ohne zu zögern steckte ich ihn ein. Nach einigem Suchen fand ich auch eine Schachtel mit Patronen, die ich ebenfalls einsteckte.
Dieser Fund kam mir wirklich höchst gelegen. Ich wusste nie, wann ich eine Waffe brauchen könnte, und selbst wenn ich sie nie einsetzen musste, war sie in meinen Händen allemal besser aufgehoben als in denen der Männer.
Ich stand auf und durchsuchte nun die Truhen in der Hoffnung, weitere Waffen zu finden. Ich kann nicht beschreiben, mit welcher fieberhaften Hast ich die Suche betrieb. Ich war überzeugt, dass sollte es dem Bootsmann gelingen, auch nur einen einzigen Mann aus der Crew auf unsere Seite zu ziehen, könnten drei entschlossene Männer, bewaffnet mit Revolvern oder irgendeiner anderen Feuerwaffe, im richtigen Moment genug Meuterer ausschalten oder verwunden, um den Rest zur Aufgabe zu zwingen.
Doch zu meiner bitteren Enttäuschung blieb die Suche ergebnislos. In den Truhen fand ich nur Captain Coxons Kleidung, eine Menge Papiere, alte Seekarten und Logbücher, einige Päckchen Zigarren und einen Beutel mit etwa dreißig Pfund in Silbermünzen.
Während ich noch mit meinen Nachforschungen beschäftigt war, klopfte es an die Tür. Ich rief „Herein!“, und das Mädchen trat ein.
Ich erhob mich, verneigte mich leicht und bat sie, Platz zu nehmen. „Wie geht es Ihrem Vater?“ fragte ich.
„Er ist immer noch sehr schwach“, antwortete sie, „aber es geht ihm heute Morgen nicht schlechter. Ich habe Ihre Stimme gehört und gesehen, wie Sie hierher kamen. Ich hoffe, Sie lassen mich mit Ihnen sprechen. Ich habe Ihnen so viel zu sagen.“
„In der Tat“, erwiderte ich, „ich habe bereits ungeduldig auf diese Gelegenheit gewartet. Dürfte ich zuerst Ihren Namen erfahren?“
„Mary Robertson. Mein Vater ist ein Kaufmann aus Liverpool, Mr. Royle, und das Schiff, auf dem wir untergingen, war sein eigenes.“
Plötzlich presste sie die Hände an ihr Gesicht. „Oh! Wir haben so viele Stunden damit verbracht, jeden Moment den Tod zu erwarten. Ich kann nicht glauben, dass wir gerettet sind! Und manchmal kann ich nicht glauben, dass das alles wirklich geschehen ist! Ich dachte, ich werde wahnsinnig, als ich Ihr Schiff sah. Ich hielt das Boot für eine Fata Morgana und befürchtete, es würde sich im nächsten Augenblick in Luft auflösen. Es war entsetzlich, mit der Leiche und diesem wahnsinnigen Matrosen eingeschlossen zu sein! Der Matrose verlor schon am ersten Tag den Verstand. Kurz darauf richtete sich der Passagier, denn der Tote, der auf dem Deck lag, war ein Passagier, plötzlich in seinem Bett auf. Er stieß einen furchtbaren Schrei aus und fiel tot nach vorn. Der wahnsinnige Matrose deutete auf ihn und heulte! Und weder Papa noch ich konnten aus der Kajüte hinaus, weil das Wasser dagegen schlug und uns über Bord gespült hätte.“
Während sie mir das erzählte, hielt sie die Hände vor ihr Gesicht, ihr blondes Haar fiel ihr offen über die Schultern, und in dieser Haltung wirkte sie anrührend und wunderschön zugleich.
Doch plötzlich blickte sie auf, mit einem Lächeln von wunderbarer Sanftheit, ergriff meine Hand und sagte: „Wie viel verdanken wir Ihnen für Ihre edlen Bemühungen! Wie gut und tapfer Sie sind!“
„Sie loben mich zu sehr, Miss Robertson. Gott weiß, dass nichts Edles an meinem Handeln war und kein Wagnis darin lag. Selbst wenn ich mein Leben wirklich riskiert hätte, um Sie zu retten, hätte ich kaum mehr als meine Pflicht getan. Wie hat man Sie gestern behandelt? Ich hoffe, gut.“
„Oh ja. Der Kapitän sagte dem Steward, dass er uns geben solle, was wir brauchen. Ich glaube, der Wein, den er uns schickte, hat Papas Leben gerettet. Er war völlig erschöpft, doch nachdem er etwas davon getrunken hatte, kam er wieder zu Kräften.“
Dann seufzte sie und ein schwaches Rot trat in ihre Wangen. „Ich bin in einer traurigen Lage“, sagte sie, „ich habe nicht einmal ein Band, um mein Haar zusammenzubinden.“ Sie nahm eine Strähne ihres wunderschönen Haars in die Hand und lächelte.
„Gibt es in dieser Kabine nichts, was Ihnen nützlich sein könnte?“ fragte ich. „Hier ist eine Haarbürste, die sieht noch ganz ordentlich aus. Ob wir irgendwo ein Band auftreiben können, weiß ich nicht, aber ich bin eben auf eine Rolle Serge gestoßen. Falls Sie damit und mit Nadel und Faden etwas anfangen können, lasse ich es Ihnen in Ihre Kabine bringen. Hier sind außerdem genug Kleidungsstücke, um Ihren Vater einzukleiden, zumindest solange, bis seine eigenen wieder in Ordnung gebracht sind. Aber wie kann ich Ihnen helfen? Das beschäftigt mich schon die ganze Zeit.“
„Ich könnte den Serge gut gebrauchen, wenn ich ihn denn haben darf“, antwortete sie auf die liebenswerteste Weise, die man sich vorstellen konnte.
„Hier“, sagte ich und zog die Stoffrolle aus der Truhe. „Und Nadel und Faden besorge ich Ihnen gleich. Kein Seemann geht ohne sein ‚Hausweib‘ auf Fahrt. Sie können mein Nähzeug haben. Und wenn Sie einen Moment warten, finde ich vielleicht noch etwas anderes, das Ihnen nützlich sein könnte.“
Damit eilte ich in meine frühere Kabine, schloss meine Truhe auf und holte ein neues Paar Hausschuhe aus Teppichstoff heraus.
„Ein Stück Tuch oder Serge in die Schuhe genäht, und sie werden Ihnen passen“, erklärte ich und reichte sie ihr. „Und ich habe noch ein paar weitere Ideen, Miss Robertson, mit denen ich hoffe, Ihnen nach und nach ein wenig mehr Komfort zu verschaffen. Lassen Sie das mal einen Seemann machen. Wir wissen immer, wie man sich helfen kann.“
Sie nahm die Hausschuhe mit einem anmutigen Lächeln und legte sie neben die Rolle Serge. Dann wurde ihr Gesicht ernst, und mit eindringlicher Stimme bat sie mich, ihr zu sagen, was die Männer nun mit dem Schiff vorhatten, da sie es in ihre Gewalt gebracht hatten.
Ich erzählte ihr offen alles, was ich wusste, verschwieg jedoch jede Befürchtung, die ich hinsichtlich meiner eigenen Sicherheit, der ihres Vaters oder ihrer eigenen hatte. Stattdessen versuchte ich, unsere Lage in möglichst positivem Licht zu schildern.
„Meine Vermutung ist,“ sagte ich, „dass die Männer uns nicht erlauben werden, mit ihnen zu gehen, wenn die Zeit kommt, das Schiff zu verlassen. Sie werden uns zwingen, an Bord zu bleiben. Das wäre das Beste, was passieren könnte. Ich bin sicher, dass auch der Bootsmann hierbleiben wird, und mit seiner und des Stewards Hilfe gibt es nichts, was uns daran hindern könnte, die Grosvenor in den nächsten Hafen zu bringen oder sie treiben zu lassen, bis wir ein Schiff sichten und Hilfe herbeirufen können.“
Ich hatte den Eindruck, dass sie mir widersprechen wollte, doch stattdessen rief sie aus: „Ganz egal, was kommt, Mr. Royle, mit Ihnen an unserer Seite fühlen wir uns sicher.“ Dann erhob sie sich plötzlich und bat mich, mitzukommen, um ihren Vater zu sehen.
Ich folgte ihr sogleich in die Kabine.
Der alte Mann lag in einer oberen Koje, mit einer Decke über sich. Sein weißes Gesicht wirkte noch totenähnlicher durch das wirre, schneeweiße Haar auf seinem Kopf und den langen weißen Bart. Er lag völlig reglos da, die Augen geschlossen, die dünnen Hände über der Decke gefaltet.
Ich glaubte, er schlafe, und machte seiner Tochter ein Zeichen, doch sie beugte sich zu ihm und flüsterte: „Papa, Mr. Royle ist hier.“