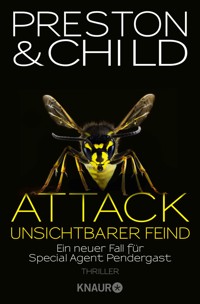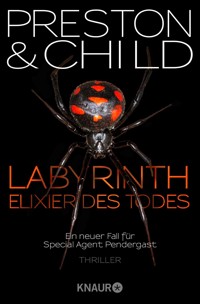9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Special Agent Pendergast
- Sprache: Deutsch
Wie stoppt man einen Serienkiller, der seit 100 Jahren tot ist? Im 21. Abenteuer-Thriller der Bestseller-Autoren Preston & Child um FBI Special Agent Aloisius Pendergast geht es weit in die Vergangenheit zurück – buchstäblich! Nach außen ist Constance Green eine ebenso kluge wie bildhübsche Mittzwanzigerin – doch das Mündel von Special Agent Pendergast ist 140 Jahre alt! Ende des 19. Jahrhunderts ermordete Pendergast wahnsinniger Vorfahre, der Serienkiller Dr. Enoch Leng, nicht nur die Geschwister von Constance, er führte auch düstere Experimente an der jungen Frau durch, die sie bis heute nicht mehr altern lassen. Als Constance nun eine Möglichkeit findet, durch die Zeit zurückzureisen und Leng erneut entgegenzutreten, ergreift sie diese sofort. Doch ihr waghalsiger Plan könnte direkt in eine Falle führen. Im New York der Gegenwart muss Agent Pendergast alles daran setzen, Constance vor ihrer Vergangenheit zu retten … Mit den schlafraubend spannenden, actionreichen Thrillern um Kult-Ermittler Aloisius Pendergast landen Douglas Preston und Lincoln Child nicht nur in den USA regelmäßig auf den Bestseller-Listen. Die abenteuerliche Thriller-Reihe ist auf Deutsch in folgender Reihenfolge erschienen: - Relic – Museum der Angst - Attic – Gefahr aus der Tiefe - Formula – Tunnel des Grauens - Ritual – Höhle des Schreckens - Burn Case – Geruch des Teufels - Dark Secret – Mörderische Jagd - Maniac – Fluch der Vergangenheit - Darkness – Wettlauf mit der Zeit - Cult – Spiel der Toten - Fever – Schatten der Vergangenheit - Revenge – Eiskalte Täuschung - Fear – Grab des Schreckens - Attack – Unsichtbarer Feind - Labyrinth – Elixier des Todes - Demon – Sumpf der Toten - Obsidian – Kammer des Bösen - Headhunt – Feldzug der Rache - Grave – Verse der Toten - Ocean – Insel des Grauens - Bloodless – Grab des Verderbens - Death – Das Kabinett des Dr. Leng - Poison – Schwestern der Vergeltung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Douglas Preston / Lincoln Child
Death – Das Kabinett des Dr. Leng
Ein neuer Fall für Special Agent Pendergast
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Frauke Czwikla
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Nach außen ist Constance Green eine ebenso kluge wie bildhübsche Mittzwanzigerin, – doch das Mündel von Special Agent Pendergast ist 140 Jahre alt! Ende des 19. Jahrhunderts ermordete Pendergasts wahnsinniger Vorfahre, der Serienkiller Dr. Enoch Leng, nicht nur die Geschwister von Constance, er führte auch düstere Experimente an der jungen Frau durch, die sie bis heute nicht mehr altern lassen. Als Constance nun eine Möglichkeit findet, durch die Zeit zurückzureisen und Leng erneut entgegenzutreten, ergreift sie diese sofort. Doch ihr waghalsiger Plan könnte direkt in eine Falle führen. In der Gegenwart muss Agent Pendergast alles daran setzen, Constance vor ihrer Vergangenheit zu retten …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
An die Leser
Über die Autoren
1
Das von einem Dunst aus Rauch und Staub gefilterte Morgenlicht fiel schwach auf die Kreuzung Broadway/Seventh Avenue. Die Straße war nicht besser als ein Feldweg, dessen schlaglochübersäte Oberfläche von Pferden und Wagen so festgetreten war, dass sie so undurchlässig wie Zement zu sein schien, abgesehen von den schlammigen Bereichen rund um die Gleise der Straßenbahn und den im Dung versinkenden Pfosten zum Anbinden der Pferde.
Die Kreuzung trug den Namen Longacre. Sie war das Zentrum der Fuhrgeschäfte, ein Randbezirk der rasch wachsenden Stadt, in dem Mietställe standen und die Stellmacher ihrem Handwerk nachgingen.
An diesem kühlen Morgen war es in Longacre und den davon abzweigenden Gassen und Straßen bis auf gelegentliche Fußgänger und vorbeifahrende Pferdekarren ruhig. Niemand schenkte der jungen Frau mit den kurzen dunklen Haaren, die in ein lilafarbenes Kleid von ungewöhnlichem Schnitt und Stoff gekleidet war, viel Aufmerksamkeit, als sie aus einer Gasse trat und sich mit zusammengekniffenen Augen und gerümpfter Nase umschaute.
Constance Greene blieb stehen und ließ die erste Welle der Eindrücke auf sich wirken, sorgsam darauf bedacht, sich den Aufruhr der Gefühle, der sie zu überwältigen drohte, nicht anmerken zu lassen. Die Anblicke, Klänge und Gerüche weckten unerwartet Tausende von Kindheitserinnerungen in ihr, Erinnerungen so fern, dass sie kaum wusste, dass sie sie besaß. Der Gestank der Stadt traf sie zuerst und am heftigsten, eine Mischung aus Erde, Schweiß, Pferdemist, Kohlenrauch, Urin, Leder, gegrilltem Fleisch und dem stechenden Ammoniakgeruch von Lauge. Als Nächstes die Anblicke, die einst alltäglich für sie gewesen und nun so fremd waren – die Telegrafenmasten, unweigerlich in geraden Reihen, die Gaslaternen an den Ecken, die zahllosen Karren, die auf oder neben den Gehsteigen standen, die allgegenwärtige Schäbigkeit. Alles kündete von einer Stadt, die so rasch wuchs, dass sie kaum mit sich selbst Schritt halten konnte. Seltsamerweise fehlte das weiße Rauschen des modernen Manhattan: das Tosen des Straßenverkehrs, das Hupen der Taxis, das Summen der Kompressoren, Turbinen, Klimaanlagen, das unterirdische Rumpeln der U-Bahn. Stattdessen war es relativ ruhig: klappernde Pferdehufe, Rufe, Pfiffe und Gelächter, gelegentliches Peitschenknallen und aus einem nahe gelegenen Saloon der blecherne Klang eines verstimmten Klaviers. Sie hatte sich so an den Anblick der Boulevards Manhattans als vertikale Stahlschluchten gewöhnt, dass es ihr schwerfiel, die Szenerie zu verarbeiten, in der, so weit das Auge reichte, die höchsten Gebäude nicht mehr als drei oder vier Stockwerke hatten.
Nach einer Weile holte Constance tief Luft. Dann wandte sie sich nach Süden.
Sie kam an einem schäbigen Restaurant vorbei, das Ochsenschwanzgulasch, Kalbssülze oder Schweinsfuß mit Kraut für jeweils fünf Cent anbot. Davor stand ein emsiger Zeitungsjunge mit dem Arm voller Zeitungen, dessen helle schrille Stimme die Schlagzeilen des Tages verkündete. Sie ging langsam weiter und starrte ihn an, als er ihr hoffnungsvoll eine entgegenstreckte. Sie schüttelte den Kopf und lief weiter, aber nicht, ehe sie das Datum registriert hatte: Dienstag, der 27. November 1880.
November 1880. Ihre neunzehn Jahre alte Schwester Mary wurde bei der Arbeit im Five Points House of Industry halb zu Tode geschunden. Und ihr Bruder Joseph, zwölf, saß seine Strafe auf Blackwell’s Island ab.
Und ein gewisser Arzt hatte kürzlich mit seinen grausigen mörderischen Experimenten begonnen.
Bei der Vorstellung, dass sie alle am Leben waren, begann ihr Herz schneller zu schlagen. Vielleicht kam sie noch rechtzeitig.
Sie langte in den Überwurf ihres Kleids und berührte den beruhigenden Griff ihres antiken Stiletts und die achthundertfünfzig Dollar in zeitgenössischen Scheinen. Sie schritt schneller aus, in Richtung Herald Square, einem besseren Teil der Stadt.
Ein Dutzend Blocks in Richtung Süden entdeckte sie eine Schneiderei, die zusätzlich zu maßgeschneiderten Kleidern auch vorgefertigte Ausstattungen verkaufte. Eine Stunde später trat sie wieder heraus, einen Verkäufer, beladen mit einer Hutschachtel und zwei großen Taschen, im Schlepptau. Statt des lilafarbenen Kleids trug Constance nun ein pfauenblaues Turnürenkleid aus Seide mit weißen Rüschen und dazu passend eine Haube und einen schweren Blazer. Als sie rasch zum Straßenrand schritt, folgten ihr eher bewundernde als neugierige Blicke. Constance wartete, während der Verkäufer einen Hanson für sie heranwinkte.
Der Kutscher wollte gerade vom Bock steigen, als Constance schon selbst den Schlag öffnete und – einen Fuß im Knöpfstiefel auf dem Trittbrett – mühelos in das Abteil sprang.
Der Kutscher zog die Augenbrauen hoch und kletterte zurück auf den Bock, während der Verkäufer die Hutschachtel und die Taschen in die Droschke stellte. »Wohin, Ma’am?«, fragte er und griff nach den Zügeln.
»Zum Fifth Avenue Hotel«, sagte Constance und hielt ihm eine Dollarnote hin.
»Sehr wohl, Ma’am«, erwiderte der Kutscher und steckte sie ein. Ohne ein weiteres Wort trieb er sein Pferd an, und innerhalb eines Augenblicks hatte sich das Gefährt nahtlos in den fließenden Mittagsverkehr eingereiht.
Es waren noch ein Dutzend Blocks bis zu ihrem Ziel, dem opulenten fünfstöckigen Palast aus Marmor und Backstein, der an der Fifth Avenue den gesamten Block gegenüber dem Madison Square Garden einnahm. Die Droschke kam vor dem Hotelportal zum Stillstand. »Brr, Rascal«, rief der Fahrer.
Constance öffnete die kleine Klappe auf der Rückseite des Dachs. »Würden Sie bitte auf mich warten?«, fragte sie.
Er sah von seinem erhöhten Sitz auf sie hinab. »Gewiss, Ma’am.« Er löste die Türverriegelung, und sie stieg aus. Augenblicklich stürzten zwei Türsteher nach vorn, um ihre Taschen und die Hutschachtel zu ergreifen. Ohne zu warten, schritt Constance zügig unter den Reihen korinthischer Säulen hindurch und über den weiß-roten Marmorboden der Eingangshalle.
Hinter einem Frisiersalon, dem Telegrafenbüro und einem Restaurant entdeckte sie den großen, aus Holz geschnitzten und auf Hochglanz polierten Empfangstresen. Dahinter standen mehrere Männer in identischen Livreen. Einer von ihnen sprach sie an.
»Sie suchen nach dem Damensalon, Madam?«, fragte er ehrerbietig. »Sie finden ihn in der ersten Etage.«
Constance schüttelte den Kopf. »Ich hätte bitte gern ein Zimmer.«
Der Mann zog die Augenbrauen hoch. »Für Sie und Ihren Gatten?«
»Ich reise allein.«
Die Augenbrauen wanderten diskret wieder nach unten. »Ich verstehe, Madam. Ich fürchte, unsere Standardzimmer sind bereits ausgebucht –«
»Dann eine Suite«, erwiderte Constance.
Die Empfangshalle des Hotels war ein großer Saal mit hoher Gewölbedecke, und die stete Prozession plaudernder Gäste, deren Schritte vom schachbrettgemusterten Marmor widerhallten, machte es ihr schwer zu hören.
»Sehr wohl, Madam.« Der Mann drehte sich zu einem Wandregal hinter ihm, zog ein ledergebundenes Buch heraus und schlug es auf. »Wir verfügen über zwei freie Suiten in der dritten Etage und mehrere in der ersten, wenn Sie nicht geneigt sind, die senkrechte Bahn zu nutzen.«
»Die was?«
»Die senkrechte Bahn. Sie hält in jeder Etage des Gebäudes.«
Constance begriff, dass er den Aufzug meinte. »Nun gut. Der erste Stock ist ausgezeichnet.«
»Hätten Sie gern Räume mit Ausblick auf –«
»Geben Sie mir einfach die beste verfügbare, wenn Sie so freundlich sein wollen.« Constance hätte schreien mögen. 27. November. In dem Wissen, dass sie rechtzeitig eingetroffen war, um ihre Schwester zu retten, schien jeder an solche Trivialitäten verschwendete Augenblick eine Ewigkeit.
Der Hotelmanager war zu gut ausgebildet, um ihre Ungeduld zu kommentieren. Er schlug eine schwere Seite im Gästebuch um und tauchte seine Feder in ein danebenstehendes Tintenfass. »Gewiss, Madam. Dort ist eine ausgezeichnete Ecksuite frei, komplett mit Salon, Schlafzimmer, Ankleideraum und Bad.« Er hob die Feder. »Wir berechnen sechs Dollar pro Tag oder dreißig Dollar die Woche. Wie lange möchten Sie bei uns bleiben?«
»Eine Woche.«
»Dienstmädchen?«
»Wie bitte?«
»Ihre Dienstmädchen? Wie viele reisen mit Ihnen, Madam?«
»Keine … Zwei.«
»Zwei. Sehr gut. Wir können sie im Dienstbotenquartier unterbringen. Natürlich mit Mahlzeiten?«
Constance, die immer unruhiger wurde, nickte.
»Darf ich um Ihren Namen bitten?«
»Mary Ulcisor«, sagte sie nach winzigem Zögern.
Er kritzelte in das Gästebuch. »Das macht dann fünfunddreißig Dollar und fünfzig Cent.«
Sie reichte ihm vier Zehn-Dollar-Noten. Als sie sich umdrehte, sah sie zwei Träger, die geduldig mit ihrem bescheidenen Gepäck auf sie warteten.
»Lassen Sie die bitte auf meine Zimmer bringen«, wies sie den Manager an, der ihr das Wechselgeld herausgab. »Ich komme später … gemeinsam mit meinen Dienstmädchen.«
»Gewiss.«
Constance gab jedem der Träger einen Vierteldollar und dem Manager einen ganzen. Er blickte überrascht und nahm ihn dankbar entgegen. Sie verließ die Hotelhalle und kehrte zum Eingang zurück, wobei sie nur kurz stehen blieb, um eine Straßenkarte von Manhattan zu erwerben.
Fahrer und Droschke warteten draußen vor dem Portal im Staub und Lärm der Fifth Avenue. Im Näherkommen musterte Constance den Mann genauer. Er war vermutlich Mitte vierzig und stämmig, aber eher muskulös als untersetzt. Seine Kleidung war sauber, seine Manieren gut, aber etwas an seinem kantigen Kiefer und dem krummen Nasenrücken verriet ihr, dass er auf sich aufpassen konnte.
Sie sprach ihn an. »Haben Sie Interesse, noch etwas mehr zu verdienen?«
»Stets bereit für ein Geschäft, Ma’am.« Sein irischer Akzent war deutlich zu hören – County Cork, nahm sie an; noch etwas, das nützlich werden konnte.
»Ich muss nach Downtown.«
»Wie weit hinein, Ma’am?«
Sie klappte die Straßenkarte auf, die sie soeben erworben hatte, suchte darauf eine Kreuzung und zeigte sie ihm.
»Entschuldigung, Ma’am«, sagte er, »sind Sie sicher?«
»Ganz sicher. Ich werde dort jemanden abholen und sie mit hierhernehmen.«
Der Gesichtsausdruck des Kutschers schwankte zwischen Besorgnis und Verwunderung. »Das ist kein Ort für eine Lady, Ma’am.«
»Deshalb brauche ich jemanden, der sich auskennt. Und der über –«, sie kramte gedanklich in ihren Gälisch-Kenntnissen, »liathróidí cruach verfügt.«
Dem Mann klappte vor Verblüffung der Mund auf, aber er schwieg, als sie in ihre Börse griff, zwei Fünf-Dollar-Scheine herausnahm und ihm entgegenstreckte – wobei sie keinen Versuch machte, ihr Stilett zu verbergen. »Weitere zehn bekommen Sie, wenn Sie uns sicher hierher zurückgebracht haben.«
Er stieß einen Pfiff aus. »Der Anblick von Blut macht Ihnen wohl keine Angst, was?«
»Nicht nach dem Frühstück.«
»Da soll mir doch einer …« Lachend nahm er das Geld entgegen. »Steigen Sie ein. Willy Murphy ist noch nie vor etwas davongerannt.« Er zwinkerte ihr ein wenig anzüglich zu. »Falls ich in die Ewigkeit eingehe, ist es mir lieber, man findet mich mit einem Zehner in der Tasche.«
»Falls Sie auf dem Weg dorthin sind«, entgegnete Constance, während einer der Türsteher ihr in die Droschke half, »leiste ich Ihnen auf der Reise Gesellschaft.«
Der Kutscher lachte wieder, schüttelte ungläubig den Kopf, zog den Hebel, um das Passagierabteil zu verriegeln, ließ die Peitsche über Rascals Kopf knallen, und sie trabten los.
2
Als die Droschke den Broadway hinunterrollte, lehnte sich Constance in dem kleinen Abteil zurück. Das Leder des Sitzes war abgewetzt und rissig, und bei jedem Schlagloch spürte sie das Stechen der gebrochenen Federn in der Polsterung.
Sie schätzte, dass sie vor ungefähr zweieinhalb Stunden eingetroffen war. Demnach musste es früher Nachmittag sein. Gut, je früher am Tag sie an ihr Ziel gelangten, desto weniger gefährlich war es dort vermutlich.
Sie hatte diese Zeit und diesen Ort sicher erreicht. In einer halben Stunde, vielleicht sogar weniger, würde sie mit Mary wiedervereint sein und sie aus ihrem elenden Dasein aus Überarbeitung und sicherem Tod befreien. Beim Gedanken an den Tod wurde sich Constance ihres heftigen Herzklopfens bewusst. Sie konnte die Geschehnisse der letzten vierundzwanzig Stunden kaum verarbeiten – und wenn sie sich gestattete, dabei zu verweilen, würde die Vorstellung sie rasch überwältigen. Sie musste sich auf ein einziges Ziel konzentrieren: die Rettung ihrer Schwester. Auf dem kurzen Stück die Fourteenth Street hinunter, ehe die Droschke erneut Richtung Südosten trabte, schloss Constance in langer Übung die Augen und drängte alle Klänge und Eindrücke um sich herum in den Hintergrund, befreite sich von unnötigen Grübeleien. Als sie die Augen wieder aufschlug, hatte die Droschke gerade die East Houston Street überquert und die Fourth Avenue war zur Bowery geworden. Sie legte zwei Finger an ihr Handgelenk und maß ihren Puls: vierundsechzig.
Das würde genügen.
Nun ließ sie die Außenwelt wieder zu. Die Gegend hatte sich seit der wohlhabenden Umgebung des Fifth Avenue Hotel dramatisch verändert. Hier sah man mehr Karren als Droschken, mit brüchigen Rädern und unter fleckigen Planen verzurrten Waren. Die Fußgänger, die sich auf den Gehsteigen drängten, trugen Westen und Jacken aus gröberem Material. Man sah nur wenige Frauen. Alle Männer, ebenso gleichgültig wie ungepflegt, trugen Kappen oder Hüte. Der ebenmäßige Straßenbelag der Fifth Avenue war Kopfsteinpflaster gewichen.
Sie spürte, wie die Droschke langsamer wurde. Einen Augenblick später ertönte ein Klopfen vom Dach.
Sie griff nach oben und öffnete die Klappe. »Ja?«
Der Kopf von Murphy, dem Kutscher, erschien. Er hatte die Ohrenklappen seiner Mütze über die Ohren gezogen. »Verzeihen Sie, Missus, aber ich würde Sie lieber nicht direkt durch die Points fahren.«
»Gewiss. Bitte halten Sie einen Moment am Rand.«
Während die Droschke wartete, konsultierte sie ihren Straßenplan. »Ich würde vorschlagen, Richtung Westen auf der Canal zu fahren und dann südlich die Center zu nehmen.«
»Und dann … links auf die Worth?«
»Exakt. Bekommen Sie das hin?«
»Ich wende an der Ecke.«
»Sehr gut. Und Mr Murphy?«
»Ja, Ma’am?«
»Falls es Ärger gibt, müssen Sie uns nicht zum Hotel zurückfahren. Der Union Square reicht. Ich möchte nicht, dass Sie in etwas hineingeraten, das … Ihnen Schwierigkeiten bereitet. Ich muss nur meine Freundin in Sicherheit bringen.«
»Ich bitte um Vergebung, Ma’am, aber wenn sie im Arbeitshaus eingesperrt ist, muss es einen Grund dafür geben.«
»Sie hatte das Pech, nach Einbruch der Dunkelheit unterwegs zu sein, und geriet in eine Razzia der Polizei, die nach Straßenmädchen suchte.«
»Die haben es vermutlich nicht besonders eilig, sie auf freien Fuß zu setzen.« Es schien, dass der Kutscher immer vertraulicher – oder zumindest pragmatischer – wurde, je weiter sie ihn zum Komplizen machte.
»Ich werde sie auf dieselbe Weise überreden wie Sie. Bitte zweimal klopfen, wenn wir angekommen sind.« Damit schloss Constance die Klappe.
Die Droschke setzte sich in Bewegung, und Constance lehnte sich erneut zurück. Sie wusste, dass ihre Stimme fest geklungen hatte, innerlich jedoch war sie alles andere als gelassen. Mit jedem Hufschlag des Gauls versank sie tiefer in ihrer eigenen fernen Erinnerung. Und während ihre Umgebung immer schmutziger und armseliger wurde, überfielen sie Gerüche, die sie längst vergessen hatte: der Duft von billigen Pasteten, Schafsfüßen und gedünsteten Austern; der Geruch von Druckerfarbe, die für das Einfärben der morgigen Platten vorbereitet wurde; beißender Kohlenrauch. Und der Lärm. Die Rufe der Straßenverkäufer »Kaufen Sie! Was wollen Sie haben?«, der Gesang der Kinder, die in seliger Unwissenheit ihrer Armut Himmel und Hölle spielten oder seilsprangen.
Johnny gab mir eine Birne,
Johnny gab mir eine Nuss,
Johnny gab mir einen Taler,
wollt’ auf der Treppe einen Kuss
Und dann – die Droschke bog gerade von der Center auf die Worth ab – veränderte sich erneut alles, diesmal zum Schlimmeren. Constance fühlte sich, als hätte sie den verbotenen Schleier der Isis geteilt und wäre in die unnatürliche Welt dahinter getreten. Die Luft war nun schwer von den schmierigen Dämpfen der illegalen Gerbereien, die die Gegend bevölkerten. Der Gesang der Kinder, die Rufe der Händler verhallten. Während eine verfrühte Dämmerung auf die sich verdichtende Atmosphäre herabsank, begann Constance, neue Klänge wahrzunehmen: verzweifeltes, schmerzerfülltes Wimmern, Grunzen und Flüche, das Gackern und Kreischen der Straßenmädchen, das ekelerregende Geräusch von Ziegeln, die auf Fleisch trafen. Auch daran erinnerte sie sich, aber es waren Erinnerungen, die sie lange verdrängt hatte.
Die Droschke bog um die Ecke und kam schwankend zum Halt. Zwei Schläge, und die Klappe öffnete sich einen Spalt. »Ich will Rascal nur eben die Scheuklappen anlegen, Ma’am«, sagte Murphy. Seine Stimme klang angespannt.
Constance machte sich bereit, eine Hand in der Tasche mit der Börse und dem Stilett. Einen Augenblick später erklang ein Klirren, dann öffnete sich der Schlag des Fuhrwerks, und Murphy streckte ihr die Hand entgegen, um ihr hinauszuhelfen. Die andere Hand lag auf einem langen Holzknüppel mit Metallkern, der halb aus seiner Manteltasche ragte.
»Keine Angst, Ma’am«, sagte er. »Nur mein alter Spazierstock.« Doch sein Versuch, einen heiteren Ton anzuschlagen, scheiterte, und seine Augen waren in ständiger Bewegung. Constance bemerkte, dass seine Haltung die eines Mannes war, der jeden Moment mit einem Angriff rechnete. Zweifellos wünschte er sich, er wäre in der Stadt geblieben. Aber es war ebenso klar, dass er eine Dame, die er an einen solchen Ort begleitet hatte, nicht im Stich lassen würde.
Mit diesem Gedanken tat Constance einen Schritt nach vorn, noch einen – doch als sie den Blick hob, erstarrte sie und keuchte unwillkürlich auf.
3
Sie waren an der Ecke ausgestiegen. Vor ihnen, am anderen Ende des Blocks, lag eine verwirrende Kreuzung schlammiger Straßen. Vier der fünf Zufahrten waren dicht mit verfallenden Backsteingebäuden bebaut, deren obere Stockwerke sich gefährlich über die Gehsteige neigten. An der fünften befand sich ein kleiner Platz mit nichts weiter als einem Brunnen für die öffentliche Wasserversorgung, der von einer stinkenden Schweinesuhle umgeben war, in die alle möglichen Abfälle und Unrat geworfen worden waren. Hier und dort kauerten noch wenige alte Holzbauten in katastrophalem Zustand aus dem vorigen Jahrhundert. Frei laufende Hühner und Schweine pickten und wühlten unbeachtet. Fenster ringsumher waren geborsten, einige mit Wachspapier verklebt, andere mit Brettern vernagelt oder offen den Elementen ausgeliefert. Keine Schilder ragten über die dunklen Ladenfronten; was einst an Handel betrieben worden sein mochte, war Schnapsbuden, Kneipen und Bordellen gewichen. In den Eingängen lungerten trinkende Männer, die Schleim oder gelben Tabaksaft spuckten. Auch Frauen waren auf den Straßen, sie lagen sinnlos betrunken auf dem Boden oder lockten potenzielle Kunden mit erhobenen Röcken oder entblößter Brust, um ihre Ware anzupreisen. In der Gosse spielte eine Gruppe kleiner Jungen mit einem aus einer Zeitung gefalteten Papierboot.
Das war Five Points – die schlimmste Kreuzung im übelsten Slum von ganz New York. Für Constance war das Spektakel doppelt traumatisierend, da sie es auf ganz persönliche Weise wiedererkannte. Vor fast hundertfünfzig Jahren war sie selbst als kleines Mädchen durch diese Straßen gehuscht und hatte dieselben Dinge gesehen, hungrig, frierend, in Lumpen gehüllt.
»Ma’am«, hörte sie den Kutscher sagen, während er ganz leicht ihren Ellbogen drückte. »Wir machen besser rasch.« Er drehte sich zu den Jungen, zog einen Silberdollar aus der Tasche, ließ ihn aufblitzen und steckte ihn wieder ein. Sie starrten voller Verlangen. »Der gehört euch, wenn Pferd und Droschke noch hier sind, wenn wir zurückkommen.«
Erneut stemmte sich Constance gegen den Wirbelsturm aus Erinnerungen, den dieser Anblick aufrührte. Sie musste stark sein, um Marys willen – sie konnte sich später, in Sicherheit, um die emotionalen Folgen kümmern.
Murphy führte sie. Sie ging mit starr geradeaus gerichtetem Blick neben ihm her, ignorierte den über den Bordstein auf die Gehsteige quellenden Schlamm und Unrat, verschloss die Ohren vor den anzüglichen Rufen und Pfiffen und den Flüchen der anderen Frauen, die sie beim Anblick ihrer gut geschnittenen Kleidung und ihrer reinen Haut als unlautere Konkurrenz betrachteten. Sie weigerte sich, in die dunklen, schmalen Gassen zu blicken, die von der Straße abzweigten – verwinkelte Gassen, auf denen wadenhoch der Schlamm stand, der Himmel darüber verdeckt von Wäscheleinen, gesäumt von Männern mit Melonen auf den Köpfen, die die versteckten Eingänge zu Kellerspelunken bewachten. Diese Gassen verströmten einen eigenen Gestank, den man wegen seiner Abscheulichkeit nur schwer verdrängen konnte: Sepsis, verrottendes Fleisch, Abwässer.
Sie stolperte über einen Pflasterstein und spürte die stützende Hand Murphys an ihrem Ellbogen. Sie waren mittlerweile den halben Block hinuntergelaufen, und zu ihrer Linken ragte das alte Gebäude des House of Industry mit den Rissen in der rußverschmierten Fassade und den vernagelten Fenstern empor.
Dort drin war Mary. Mary. Constance begann, den Namen stetig zu wiederholen wie ein Mantra.
Sie warf einen Blick auf ein großes Gebäude auf der anderen Straßenseite, das besser erhalten war als seine Nachbarn. Hier hatte einst die Old Brewery gestanden, das berüchtigtste Mietshaus New Yorks, so groß und luftleer, dass die meisten Innenräume keine Fenster hatten. Seine Eingänge trugen Spitznamen wie Diebeshöhle, Mördergasse oder Rascher Tod. Die Missionsgesellschaft für Frauen hatte es abgerissen und durch die Five-Points-Mission ersetzt, die sich der Unterstützung von einheimischen Frauen und Kindern widmete. Constance kannte das Gebäude gut; als junge Waise hatte sie oft am Kücheneingang in der Baxter Street um Brot gebettelt. Eigentlich hätte Mary in der Mission untergebracht und verpflegt sein sollen, doch korrupte Interessen hatten sie und so viele andere stattdessen in das House of Industry verbracht, um in den Genuss billiger Arbeitskräfte zu kommen. Dort war sie die ganze Zeit eingesperrt und arbeitete sechzehn Stunden am Tag in überfüllten, verlausten Räumen.
Mit diesem anspornenden Gedanken im Kopf warf sie Murphy einen Blick zu, der bereitwillig nickte. Die Hand auf dem abgewetzten Messing, drehte er den Knauf. Vergeblich.
»Oi!«, sagte er. »Abgeschlossen.« Er wollte klopfen, doch Constance hielt ihn zurück.
Sie zog eine Haarnadel aus ihrer Haube, bückte sich zum Schloss und führte sie ein. Nach wenigen Augenblicken ertönte ein Klicken. Sie trat von dem verkratzten, verbeulten Knauf zurück.
»Der Herr schlage mich mit Blindheit«, sagte der Kutscher.
»Das Überraschungsmoment ist wichtig«, erwiderte sie. »Finden Sie nicht?«
Murphy nickte.
»Dann nach Ihnen, bitte.«
Der Kutscher packte erneut den Knauf, den Knüppel fest in der anderen Hand. In einer raschen Bewegung öffnete er die Tür und trat ein. Constance folgte ihm. Er schloss hinter ihr die Tür.
Rasch blickte Constance sich um. Der Eingangsbereich wurde von einem hölzernen Tresen mit Scharnieren geteilt, den man zum Durchgehen anheben konnte, ähnlich wie in einer Bank. Türen links und rechts führten in weitere größere Räume mit hohen Zinnblechdecken. Sie nahm den stechenden Geruch von Urin und Lauge wahr. In den Ecken häuften sich Hühnerfedern und Austernschalen.
Hinter dem Raumteiler saß ein nur von der Hüfte aufwärts sichtbarer Mann, gekleidet in ein abgetragenes Jackett und ein weißes Hemd mit schmutzigem Kragen, das am Hals offen stand. Zwei Krepp-Bänder zierten seine Arme direkt über den Ellbogen, und seine Fingernägel starrten vor Dreck.
Er schob seine tintenfleckige Kappe aus der Stirn und schaute von einem zum anderen. »Was soll das? Wer sind Sie?«
»Wir sind wegen Mary Greene hier«, sagte Constance und trat einen Schritt vor.
»Sind Sie das?«, erwiderte der Mann, scheinbar ungerührt von ihrer wohlhabenden Erscheinung und der Fähigkeit, das Schloss zu knacken. »Und was haben Sie mit ihr zu schaffen?«
»Das geht Sie nichts an. Ich wünsche sie zu sehen – sofort.«
»Ach, tatsächlich? Sie ›wünschen sie zu sehen‹. Was glauben Sie, was das hier ist? Ein Zoo?«
»Riecht jedenfalls so«, bemerkte Murphy.
So schnell wie möglich. So schnell wie möglich. Constance griff in ihre Tasche. »Lassen Sie mich deutlich werden. Sie haben die Gelegenheit, für wenig Arbeit eine hübsche Summe einzustreichen. Finden Sie Mary Greene. Bringen Sie sie hierher. Und im Gegenzug erhalten Sie zwanzig Dollar.« Sie zeigte ihm das Geld.
Die Augen im rußverschmierten Gesicht des Mannes wurden weit. »Nellie Greene, sagten Sie? Bei Gott, Sie hätten gleich sagen sollen, dass Geld den Besitzer wechselt. Geben Sie es mir, dann hole ich sie.« Er streckte den Arm über den Tresen.
Constance steckte das Geld zurück in die Tasche. »Sie heißt Mary. Nicht Nellie.«
Murphy trat einen Schritt auf den Schreiber-Wärter zu. »Geld gibt’s später«, sagte er den Knüppel schwingend.
»Nein, nein, mein Freund«, sagte der Mann und streckte ihm beschwichtigend die Hand entgegen. »Jetzt.«
»Gib das Mädchen raus«, sagte Murphy in drohendem Ton.
Stille trat ein. Schließlich erwiderte der Mann hinter dem Tresen: »Euch würde ich nicht mal den Dampf meiner Pisse geben.«
»Verfluchtes Schlitzohr!«, schrie Murphy, stürmte zum Tresen, packte den Mann am Hemd und zerrte ihn buchstäblich hinauf und hinüber. Doch der mittlerweile aus Leibeskräften brüllende Kerl hatte unter dem Tresen ein Schlachtermesser gegriffen und stach damit nach Murphy.
Constance nutzte die Schlägerei und schlich sich in den Raum auf der linken Seite. Ursprünglich musste es sich um eine Kapelle gehandelt haben, aber nun waren die Fenster vergittert, und anstelle von Kirchenbänken standen dort Reihen von Feldbetten, zwischen denen Stroh auf dem Boden lag. Es war grausig kalt. Die Matratzen waren so dünn, dass sich die Roste darunter abzeichneten. Unter den Betten lagen Lumpen und abgetragene schmutzige Kleidungsstücke. Wo der Putz von den Wänden gebröckelt war, hatte man das bloßgelegte Lattenwerk mit Zeitungen und Ölpapier ausgebessert.
Fast verrückt von dem Verlangen, ihre Schwester zu finden, rannte sie in den nächsten Raum, voller schmutziger Kleidung und Spültische, und weiter in den nächsten, in dem ein Klappern und Dröhnen die Luft erfüllte. Dort, in dem weiten dämmrigen Saal, saßen zwei Reihen Mädchen und Frauen. Sie kauerten auf einer Art Melkschemeln und waren in verschmutzte Einteiler gekleidet. Vor jeder stand ein pedalbetriebener mechanischer Webstuhl.
Nach und nach verstummte das Dröhnen. Eine nach der anderen stellte die Arbeit ein und starrte schweigend in ihre Richtung.
Als Constance sich näherte und verzweifelt die Gesichter nach ihrer Schwester absuchte, kam ein Uniformierter vom anderen Ende des Raumes auf sie zu, einen Knüppel im Gürtel, seine genagelten Stiefel hallten laut auf dem Holzboden. »Was soll das? Wer sind Sie?«
Constance warf sich herum, rannte aus dem Saal in Richtung Eingang und zog im Laufen ihr Stilett. Am Eingang traf sie auf Murphy, der den Schreiber im Schwitzkasten hatte. Das Messer lag auf dem Boden, und der Mann stöhnte und bettelte.
In diesem Moment sprang eine Tür am anderen Ende des Eingangsflurs auf, und eine Frau marschierte herein.
»Loslassen! Aufhören!«, durchschnitt ihre Stimme die Luft.
Sie war groß und dünn, beinahe ausgezehrt, und trug ein langes braunes, von der Taille bis zum Hals geknöpftes Kleid. Ihr Blick war scharf und intelligent, und sie verströmte eine solche Aura eisiger Autorität, dass beide Männer den Kampf einstellten.
»Was hat dieser Aufruhr zu bedeuten?«, fragte sie von einem zum anderen schauend, bis ihr Blick auf Constance verharrte.
Constance spürte, wie ihr der scharfe Blick das Blut gefrieren ließ. »Wir sind wegen Mary Greene hier«, sagte sie, das Stilett fest umklammert. »Und wir werden sie mitnehmen – komme, was wolle.«
Die Frau lachte freudlos. »Kein Grund, melodramatisch zu werden, junge Dame.« Sie wandte sich an die beiden Männer, die einander losgelassen hatten und nun keuchend und zerzaust vor ihr standen. »Royds«, schnappte sie, »kümmern Sie sich um Ihre Arbeit.«
Während der Mann mit einem letzten verächtlichen Blick über die Schulter davonschlich, trat die Frau zu einem der Regale und zog ein großes Geschäftsbuch heraus, legte es auf den Tresen und blätterte, bis sie zu einer mit einem Lesebändchen markierten Seite kam, die sie glatt strich. »Hab ich es mir doch gedacht. Man hat sie gestern weggebracht.«
»Weggebracht?«
»Ins Sanatorium. Der Doktor stellte fest, dass sie krank ist, und geruhte, ihr den Gefallen seiner besonderen Aufmerksamkeit zu erweisen.« Die Frau hielt inne. »Welches Interesse haben Sie an dieser Angelegenheit?«
»Sie ist eine Freundin der Familie«, sagte Constance.
»Dann sollten Sie dankbar sein. Nur wenige unserer Bewohnerinnen haben das Glück, von Dr. Leng behandelt zu werden.«
»Dr. Leng«, wiederholte Constance. Einen Moment hatte sie das Gefühl, der Boden unter ihr würde in Flammen aufgehen und sie ins Innere der Erde stürzen.
»Ja. Seine Ankunft letzten Sommer war ein wahrer Segen. Bereits fünf unserer jungen Damen wurden zur Erholung in sein Privatsanatorium gebracht.«
Constance konnte kaum sprechen. Die Frau schaute sie weiter zweifelnd an, eine Augenbraue gehoben.
»Wo … ist dieses Sanatorium?«, fragte Constance.
»Es steht mir nicht zu, den Doktor infrage zu stellen. Ich bin sicher, dass es sich um ein ausgezeichnetes Haus handelt.« Die Frau sprach geziert, aber ihr Ton war stählern. »Zum Schutz seiner Patientinnen ist die Adresse streng vertraulich.«
Wie in einem Albtraum zog Constance das Buch zu sich heran. Auf der Seite standen ein knappes Dutzend Einträge – mehrere Neuankömmlinge, eine Entlassung nach abgesessener Strafe, eine Typhustote, vom Leichenwagen abgeholt … und zwei weitere mit der Notiz ZUR BEOBACHTUNG INS SANATORIUM VERBRACHT. Der jüngste Eintrag lautete auf Mary. Sie war am Montag, den 26. November, verlegt worden. Gestern. Neben dem Eintrag, dessen Tinte ihren Schimmer noch nicht gänzlich verloren hatte, stand eine Unterschrift: E. LENG.
Gestern. Constance schwankte und hob das Stilett.
Die Bewegung mit Aggression verwechselnd, sagte die Frau: »Tun Sie Ihr Schlimmstes, ich bin bereit, meinem Schöpfer gegenüberzutreten.« Und sie starrte Constance voll trotziger Verachtung an.
»Wir gehen«, sagte Murphy, als der Schreiber nach der Alarmglocke griff. Er packte Constances Arm und drängte sie zum Ausgang. Sie ging widerstandslos mit. Kurz bevor die Tür sich hinter ihnen schloss, schrie er dem Mann zu: »Buinneach dhearg go dtigidh ort!«
Constance torkelte eher zur Droschke, als dass sie lief, ohne die Rufe der Zuschauer oder den Gestank der Straße zu bemerken. Als sie wieder zu sich kam, befanden sie sich erneut auf der Canal Street und waren unterwegs zum Hotel.
Die Dachklappe öffnete sich einen Spalt. »Es tut mir sehr leid, Ma’am, dass wir nicht mehr tun konnten.«
»Danke, Mr Murphy«, gelang es ihr zu antworten. »Sie haben getan, was in Ihren Kräften stand.«
Als die Droschke vor dem Hotelportal hielt und der Türsteher herbeieilte, um den Schlag zu öffnen und Constance behilflich zu sein, klopfte sie an die Klappe. Murphy öffnete. Sie reichte ihm zehn Dollar nach oben. »Mr Murphy? Ich frage mich, ob ich Sie exklusiv für die gesamte nächste Woche anheuern könnte.«
»Wie Sie wünschen, Ma’am. Und verbindlichsten Dank.«
»Ausgezeichnet. Bitte seien Sie morgen früh um neun Uhr hier und warten auf mich am Droschkenstand.«
»Sehr wohl, Ma’am.«
»Und Mr Murphy? Vielleicht könnten Sie den sonnigen Nachmittag nutzen, um mir einen kleinen Gefallen zu tun?«
»Worum geht es denn, Ma’am?«
»Reparieren Sie diesen klumpigen Sitz.«
Grinsend legte er die Hand an die Kappe. »Wird erledigt, Ma’am.«
Als sich die Klappe schloss, kletterte sie aus der Droschke, erklomm die Marmorstufen und trat durch die Bronzetüren in die große Lobby, wobei sie flüsternd den Kinderreim beendete, den sie eine Stunde zuvor, noch voller Hoffnung, gehört hatte.
Zurück gab ich die Birne,
zurück gab ich die Nuss,
zurück gab ich den Taler,
schubste ihn runter mit Genuss.
4
Constance stand am Erkerfenster ihres Salons und sah zu, wie die Laternenanzünder die Gaslaternen entlang der Fifth Avenue entzündeten. Sie stand einige Zeit reglos dort, während die Nacht sich über die Stadt senkte und Winternebel vom Hafen heranrollte und die Lampen der vorbeifahrenden Droschken in Glühwürmchen und die Beleuchtung des Madison Square in ein Sternbild weich leuchtender Kreise verwandelte.
Finsternis hatte sich über sie gesenkt, und für eine Weile war jedes rationale Denken erloschen. Während sie in die Dunkelheit starrte, kehrten langsam Gefühle und Vernunft zurück. Als Erstes der Zorn, blinder, sinnloser Zorn auf die Laune des Schicksals, die sie einen Tag, nur einen Tag, zu spät zurückgebracht hatte, um ihre Schwester zu retten. Dr. Leng hatte Mary in seinem »Sanatorium« in seiner Gewalt – und Constance gute Gründe, der Frau im House of Industry zu glauben, als sie angab, den Standort nicht zu kennen. Leng wünschte sicher nicht, dass er bekannt wurde, da sein Sanatorium kein Ort war, den Leute geheilt verließen – oder überhaupt verließen.
Constance wusste, dass Leng dem House of Industry seit dem Sommer seine »Dienste« angedeihen ließ. Bereits vor ihrer Rückkehr war ihr bewusst gewesen, dass sie womöglich zu spät kommen würde. Sie konnte ein wenig Trost – sehr schwachen – darin finden, dass ihre Schwester die nächsten Wochen relativ sicher sein würde. Leng würde sie eine Zeit lang auf eine spezielle Diät setzen und beobachten, ehe er seine Operation durchführte … und die Ernte aus ihrem Körper holte.
Das dringendere Problem war ihr Bruder Joseph, der gerade zwölf geworden und auf Blackwell’s Island inhaftiert war. Constance wusste, dass man ihn Heiligabend entlassen würde. Ebenso wie sie wusste, dass man ihn am folgenden Tag – Weihnachten – bei einem gescheiterten Taschendiebstahl zu Tode prügeln würde. Sie wusste es, weil sie selbst Augenzeugin dieses grauenhaften Ereignisses gewesen war.
Die verstörende und brutale sechsmonatige Haft auf Blackwell’s Island sollte Joseph verändern: Bei seiner Entlassung würde er ein anderer Mensch sein, geschickt – aber nicht geschickt genug – in der Kunst des Diebstahls, der so rasch zu seinem Tod führte. Jeder Tag in Haft zerstörte ihn weiter, entfernte ihn von seinem früheren unschuldigen, vertrauensvollen Selbst.
Zudem musste sie ihren eigenen Doppelgänger bedenken. In dieser parallelen Realität gab es eine andere Constance Greene, neun Jahre alt, frierend und hungrig, die durch die Straßen von Five Points irrte. Dies war die seltsamste Laune von Zeit und Multiversum: dass sie ihr eigenes Ich finden und retten musste. Nun, da Mary geholt worden war, konnte die junge Constance nicht einmal mehr auf die Brotrinden zählen, die ihre Schwester ihr durch die vergitterten Fenster des House of Industry zuzuwerfen vermocht hatte. Aber die junge Constance dieser Ära, dieser Parallelwelt, würde überleben. Constance wusste es – weil sie selbst überlebt hatte.
Sie musste sich zusammenreißen und einen Plan schmieden. Sie wusste, dass sie nicht als Mary Ulcisor weitermachen konnte. Eine junge, unverheiratete Alleinreisende würde Aufmerksamkeit von falscher Seite auf sich ziehen. Sie bedauerte, dass sie im House of Industry eine Szene gemacht hatte – sie hätte vorsichtiger sein müssen. Zum Glück hatte sie ihren Namen nicht genannt, aber den Auftritt würde die eisenharte Frau dort nicht so rasch vergessen.
Sie wandte sich vom Fenster ab, ging zum Schreibtisch und setzte sich. Auf dem Tisch lagen mehrere Dinge: die Nachmittagszeitung, ihre Straßenkarte von New York, das Stilett – und ein Beutel mit Edelsteinen und zwei gefaltete Pergamente, die sie in den letzten Jahren immer bei sich geführt hatte.
Für die kommende Woche war das Fifth Avenue Hotel eine akzeptable Bleibe – für sie und ihre beiden nichtexistenten Dienstmädchen. Aber für das, was sie vorhatte, brauchte sie eine sichere Operationsbasis, einen Ort, an den sie sich zurückziehen konnte, der ihr und anderen Ungestörtheit und Sicherheit bot. Außerdem brauchte sie eine Identität und Geschichte, die ihre Anwesenheit erklärte und ihr ermöglichte, ohne unziemlichen Klatsch von der New Yorker Gesellschaft akzeptiert zu werden. Und Komplizen, denen sie vertrauen konnte. Murphy war ein guter Anfang. Doch würde sie noch weitere brauchen, die verschiedene Aufträge übernahmen und ihr dabei halfen, sich in dieser befremdlichen, kaum erinnerten Zeit zurechtzufinden.
Geld machte all das möglich. Eine faszinierende, wohlhabende junge Frau von großer Schönheit und mit mysteriöser Vergangenheit konnte sich Zutritt zur Gesellschaft verschaffen – falls sie klug und vorsichtig vorging.
Eine mysteriöse Vergangenheit. Sie schlug die Zeitung auf und blätterte rasch hindurch, bis sie auf den Artikel über ein tragisches Schiffsunglück stieß, der ihr zuvor aufgefallen war. Sie tauchte die Feder in das Tintenfass und kringelte ihn ein. Dann stellte sie die Feder zurück und zog den Beutel und die Pergamente zu sich heran.
Mary war erst einmal in Sicherheit. Ihr eigenes jüngeres Ich würde leicht zu finden sein und befand sich nicht in unmittelbarer Gefahr. Joe war ihre oberste Priorität. Joe, der in diesem Moment auf Blackwell’s Island auf Arten schikaniert wurde, die sie sich kaum vorstellen konnte.
Doch als Allererstes musste sie ihren eigenen Mythos schaffen. Sie musste wie Phönix aus der Asche ihrer Zukunft aufsteigen. Voraussetzung dieser merkwürdigen Verwandlung war ein äußerst subtiler Plan – den sie im Grunde bereits entworfen hatte.
5
George Frederick Kunz saß in seinem Büro in der ersten Etage von Tiffany & Company. Der Lärm und die Unruhe des Union Square wurden von den massiven Steinmauern des Gebäudes gedämpft, und durch hohe, schmale Fenster – natürlich nach Norden weisend – fiel indirektes Licht auf eine Reihe von verglasten Schaukästen. Die Kästen waren gefüllt, nicht mit Diamanten, Smaragden und Saphiren wie in der außergewöhnlichen Ausstellung im Erdgeschoss, sondern mit langweiligen, hässlichen Mineralien. Nichts an den grauen, braunen und beigen Gesteinsbrocken hinter den Glasscheiben glitzerte. Die Brillanz kostbarerer Steine floss jeden Tag wie Wasser durch Kunz’ Finger. Aber diese Trophäen in den Kästen waren seine, und nur seine. Niemand außer Charles Lewis Tiffany selbst hatte ihn jemals danach gefragt, und die Kunden, die sein Büro betraten, waren zu sehr mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt, um ihrer Umgebung viel Aufmerksamkeit zu schenken. Aber Kunz kannte ihren wahren Wert, weil er sie entdeckt und aus dem Gneis der Hügel New Hampshires und dem vulkanischen Gestein der Batholithen von North Dakota gegraben hatte. Jede hatte ihren besonderen Platz in seiner autodidaktisch erworbenen Meisterschaft der Mineralogie, und die gesammelte Feldforschung, die sie repräsentierten, hatte ausgereicht, um ihn mit dreiundzwanzig Jahren zum Vizepräsidenten von Tiffany’s und dessen Chef-Gemmologen zu machen.
Nun richtete Kunz seine Manschetten und schlug seinen Terminkalender auf. Die meisten seiner späten Vor- und frühen Nachmittage waren der Prüfung und dem Erwerb von Edelsteinen gewidmet, und heute bildete keine Ausnahme. Der Morgen hatte sich als ziemlich langweilig erwiesen: ein ungeschliffener Opal von sieben Karat – Kunz war ein überzeugter Befürworter des neuen metrischen Dezimalsystems der Edelsteinbewertung und machte in seinen Arbeiten häufig Gebrauch davon – und eine Reihe minderwertiger Süßwasserperlen, die er abgelehnt hatte. Das einzig interessante Objekt war ein zwölf Gramm schwerer, nicht facettierter Rubin gewesen, den ein belgischer Schiffskapitän aus Ceylon mitgebracht hatte. Obgleich Kunz dem Beharren des Kapitäns, dass es sich um einen Rubin handelte, nicht widersprochen hatte, war er wegen der isometrischen Kristallbildung und einigen anderen Faktoren recht sicher, dass es sich um das Exemplar einer Variante handelte, die man als Spinell kannte. Sehr selten und von einem schönen Taubenblutrot, das in seiner Tiefe fast an tyrisches Purpur gemahnte.
Er lächelte in sich hinein, während seine Gedanken zu dem Ausstellungsraum im Erdgeschoss und den dortigen Mitarbeitern wanderten. Unter Charles Tiffany hatte sich das Unternehmen von einem Laden für »Galanteriewaren« zum bedeutendsten Juwelier des Landes entwickelt. Die Crème der Gesellschaft erwarb hier Ringe, Zeitmesser, Armbänder und seltene Edelsteine; die Verkäufer, die sie bedienten, waren die besten der Branche und wurden dementsprechend bezahlt. Doch auch wenn sie mit Diamanten handelten, waren sie am Ende des Tages nur Händler. Wenn er morgens und abends auf dem Weg in sein und von seinem Büro in diesem »Palast der Geschmeide« am Union Square West an ihnen vorbeiging, nickten sie ihm lächelnd zu, während sie sich um ihre Tresen kümmerten. Aber Kunz bezweifelte, dass ihnen jemals der Gedanke kam, dass dieser junge Mann verantwortlich für die ausgestellten Waren war. Er erwarb sie, beschaffte sie, und bei besonders erfreulichen Gelegenheiten kreierte und schuf er sie.
Nur sechs Wochen nach seiner Einstellung als Chef-Gemmologe segelte er nach Paris, wo ein Stein auf ihn wartete – ein riesiger, roher gelber Kiesel aus den Kimberley-Minen in Südafrika. Charles Tiffany, der eine verständliche Schwäche für gelbe Diamanten besaß, hatte ihn für eine gewaltige Summe erworben, und sein neuer Gemmologe sollte sicherstellen, dass Tiffany eine gute Investition getätigt hatte.
Es war die Chance seines Lebens. Vielleicht war es seine Jugend, die zu einer Entscheidung führte, die ältere, erfahrenere Männer als tollkühn betrachtet hätten. Fasziniert von der einzigartigen Farbsättigung des Steins, entschied er sich für einen Schliff, der die Strahlkraft und nicht nur die Größe betonte. Statt der achtundfünfzig Facetten des traditionellen Brillantschliffs forderte er unerhörte zweiundachtzig Facetten. Die gewagte Entscheidung hatte zum Tiffany-Diamanten geführt, einem kanariengelben Edelstein von einzigartiger Größe und Farbtiefe. Er begründete Tiffany’s als Marke – und die Karriere von Kunz.
Kunz war bewusst, dass er diesen frühen Erfolg vielleicht nie übertreffen würde. Seine Expertise war mittlerweile äußerst gefragt, und er wusste, dass er als Gutachter bei Sotheby’s oder sogar Lloyds of London mehr Geld verdienen würde. Aber Charles Tiffany hatte einen Traum, den er mit Kunz teilte. Er wollte als der König der Diamanten bekannt werden – nicht nur, weil er die größten Mengen hortete, sondern als Entdecker der interessantesten und seltensten. Und er scheute sich nicht, für dieses Ziel enorme Summen zu investieren. Weshalb Kunz, obgleich er annahm, dass in der Zukunft irgendeine Art grundlegender Arbeit auf ihn wartete – vielleicht eine beratende Position im Amerikanischen Museum –, unbedingt Teil von Tiffanys Traum sein wollte.
Seufzend konzentrierte er sich wieder auf seinen Kalender. Ein letzter Termin für heute – tatsächlich in wenigen Minuten. Er versprach interessant zu werden: eine junge Frau adliger Abstammung aus einem osteuropäischen Herzogtum oder Reichslehen oder der Himmel wusste, was – dort brachen so oft Territorialkriege aus, und Länder wechselten so häufig den Namen, dass Kunz sich keine Mühe mehr gab, auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich waren diese Länder eine reiche Quelle betrügerischer Fürstinnen und Grafen, die ihre ebenfalls falschen Juwelen aus Glas oder minderwertigen Steinen verkaufen wollten. Kunz jedoch hatte einen fähigen, diskreten Assistenten namens Gruber, der nicht nur seine Termine organisierte, sondern auch als eine Art Pförtner fungierte – oder vielleicht war Goldwäscher die passendere Metapher, jemand, der Goldklumpen aus dem gewöhnlichen Schlamm siebte. Gruber hatte ihm empfohlen, sich mit der Frau zu treffen, die er für echt hielt, wenn auch ein wenig rätselhaft. Er hatte sich sogar zu der Bemerkung verstiegen, Kunz würde sie »bemerkenswert interessant« finden. Aus dem Mund des phlegmatischen Gruber war das eine sehr positive Empfehlung. Deshalb – und in der Annahme, dass die Dame unter anderem Diamanten anbot – hatte Kunz das Treffen für dreizehn Uhr anberaumt. Später am Tag wäre das durch die Nordfenster fallende Tageslicht für eine präzise Schätzung nicht mehr hell genug.
Als hätte er seine Gedanken gelesen, ertönte Grubers typisches Klopfen gegen das geriffelte Glas seiner Bürotür. »Die Dame ist eingetroffen, Sir.«
»Bitte führen Sie sie herein«, sagte Kunz.
Gruber öffnete die Tür, und einen Moment später betrat eine Frau das Büro. Kunz erhob sich umgehend – eher aus Instinkt als Höflichkeit. Sie sah umwerfend aus. Von mittlerer Größe, schlank, mit einem Pelzumhang über den Schultern, den Gruber ihr abnahm. Darunter trug sie ein elegantes Kleid aus rosa Seide – die diesjährige Modefarbe –, dessen Ärmel des Baskenmieders mit Mechelner Spitze gesäumt waren. Trotz des ausgezeichneten Sitzes und Stil des Kleides war es anders als die meisten, die Kunz Tag für Tag bei Tiffany’s sah. Es hatte keine Turnüre und zeigte wesentlich mehr von der Figur der Frau, als gemeinhin üblich war. Insgesamt war es ein wenig … gewagt war vielleicht ein zu starker Begriff, aber gewiss sah man so etwas häufiger in Pariser Salons als in New York. Sie war eine sehr schöne Frau.
Gruber räusperte sich. »Ihre Gnaden, die Herzogin von Inow… Inow…«
»Inowrazlaw«, beendete die Frau für ihn die Vorstellung. Sie hatte eine tiefe, aber angenehm modulierte Stimme.
Kunz trat hinter seinem Schreibtisch hervor und zog einen Polsterstuhl heraus. »Bitte, Euer Gnaden, setzen Sie sich doch.«
Sie dankte ihm, trat vor und nahm mit einer Bewegung Platz, die gleichzeitig sittsam und geschmeidig war. Gruber schloss leise die Tür und setzte sich dann auf einen Stuhl daneben. Er war nicht nur Kunz’ Sekretär und Pförtner, sondern auch seine Leibwache, eine Pistole zur Hand, falls jemand einen Raubüberfall im Sinn hatte. Kunz selbst trug einen doppelläufigen Derringer in der Jackentasche; bei der Arbeit im Palast der Juwelen schon beinahe ein Muss.
Kunz bot ihr eine Erfrischung an – die sie ablehnte – und setzte sich wieder hinter seinen Schreibtisch. Er lächelte und begann das Gespräch mit einem Austausch von Höflichkeiten, gleichzeitig ein Test ihrer Echtheit. Die Frau sprach ausgezeichnet Englisch mit nur dem Hauch eines Akzents, und nichts an ihren Manieren, ihrer Haltung oder ihrem Benehmen ließ vermuten, dass sie nicht von Adel war. Die übliche Entourage fehlte. Ihre Adresse war die eines Hotels – zugegebenermaßen das erste Haus am Platz –, und Gruber hegte den Verdacht, dass sie sich dort unter einem Pseudonym eingemietet hatte. All das musste noch genauer überprüft werden. Selbstverständlich wären die bemerkenswerten Juwelen, die sie bei sich zu tragen behauptete, der stärkste Beweis.
Nun lächelte er erneut, nickte und legte die Handflächen auf den Tisch. »Soweit ich verstanden habe, Euer Gnaden, besitzen Sie gewisse Edelsteine, die Sie uns anbieten möchten.«
Die Frau neigte den Kopf.
»Sehr gut. Da dies geklärt ist, frage ich mich, ob Sie so freundlich wären, mir etwas über deren Hintergrund zu erzählen und wie sie in Ihren Besitz gelangten.«
Schweigen setzte ein. Dieser Moment war häufig unbehaglich.
»Sie verstehen gewiss«, fuhr er fort, »dass wir als führender Anbieter von Edelsteinen verpflichtet sind, die Qualität und Herkunft der von uns verkauften – und damit auch der von uns erworbenen – Edelsteine mit größter Sorgfalt zu prüfen.«
»Selbstverständlich«, erwiderte die Herzogin. »Und ich werde Ihre Bitte mit Freuden erfüllen, so gut ich kann. Im Gegenzug indes bitte ich um einen Gefallen: Ich möchte unter vier Augen mit Ihnen sprechen, was nicht nur Ihre Neugier befriedigen, sondern auch meine persönliche Sicherheit gewährleisten sollte.«
Kunz überlegte einen Moment, dann bedeutete er Gruber mit einem diskreten Nicken, das Büro zu verlassen. Es war sicher nicht unschicklich, mit dieser Frau in Geschäftsräumen allein zu sein. Und was ihre Motive anging, was für eine Teufelei konnte sie schon zu bewerkstelligen hoffen: ihn anspringen, womöglich mit einem glitzernden Dolch in der Hand? Lächerlich, das hier war New York in den 1880er-Jahren, nicht irgendein Groschenroman. Nichtsdestotrotz kontrollierte er mit dem rechten Ellbogen das Vorhandensein seines Derringer, als Gruber den Raum verließ.
Kunz stockte unwillkürlich der Atem, als er der Adligen direkt in die Augen blickte: ein ungewöhnlicher Violett-Ton und eine Tiefe, die einen unauslöschlichen Eindruck von Intelligenz, Erfahrung und Selbstvertrauen signalisierte. Diese Frau hatte mehr erlebt, als ihr Alter vermuten lassen würde.
»Ich erzähle Ihnen meine Geschichte«, sagte sie, »aber ich muss Sie um absolute Vertraulichkeit bitten, denn dadurch lege ich buchstäblich mein Leben in Ihre Hände. Und ich tue es nur, damit Sie verstehen, wenn Sie die Edelsteine sehen.«
Als sie innehielt, bedeutete Kunz ihr, fortzufahren. »Bitte, Mylady.«
»Ich heiße Katalyn«, begann sie. »Ich komme aus dem ehemaligen Fürstentum Transsilvanien, wo meine Familie untergetaucht war, aber meine Vorfahren stammen aus dem Herzogtum Inowrazlaw in Galizien. Ich gehöre zu den Piasten und kann meine Abstammung bis zu Kasimir IV., dem Herzog von Pommern, zurückverfolgen. Er starb, angeblich kinderlos, 1377 in der Schlacht gegen Wladislaus den Weißen, sein Nachfolger war Wladislaus II., der 1380 exkommuniziert wurde – anscheinend als letzter Herzog von Inowrazlaw. Was der landhungrige Wladislaus jedoch nicht wusste, war, dass Kasimir einen Sohn hatte – Kasimir V. –, der als Gegenleistung für die Unterstützung Ludwigs I. von Ungarn während der Unruhen nach dem Tod von Wladislaus sein rechtmäßiges Herzogtum, seine Ländereien und Juwelen beanspruchen durfte. Ludwig verlangte unerschütterliche Lehnstreue, und meine Familie überlebte und kam zu Reichtum, indem sie unseren Königen die Treue hielt und Loyalität über Ehrgeiz stellte: a băga mâna în foc pentru cineva. Diese Tradition wurde jedoch gebrochen, als das Gebiet 1772 von Preußen annektiert wurde. Mein Vorfahre, der damalige Herzog von Inowrazlaw, floh nach Transsilvanien. Leider folgten Unruhen: Mein Großvater starb 1848 während der ungarischen Revolution und mein Vater vor dreizehn Jahren im Ausgleich des Siebenwöchigen Krieges. Nur meine Mutter und ich blieben übrig, die Letzten des einst so stolzen Herzogtums von Inowrazlaw. Unser Titel blieb erhalten – er wurde von meinem Vater über die weibliche Linie vererbt – ebenso wie unser beträchtliches Vermögen. Als meine Mutter jedoch im letzten Jahr starb, wurde meine Existenz einigen anderen Angehörigen der Piasten bekannt, einer Linie, die auf den Adoptivsohn von Boleslaus V. dem Keuschen zurückgeht. Falls ich ohne Erben sterbe, fallen mein Titel und mein Vermögen an diese Linie.« Sie hielt inne. »Ich wusste, dass mein Leben keinen Heller mehr wert sein würde, falls ich in Transsilvanien bliebe. Deshalb verließ ich nach dem Tod meiner Mutter heimlich Europa. Ich reiste allein, unter einem angenommenen Namen. Mein Haushalt mit all meinen Habseligkeiten sollte mir sechs Monate später nach Amerika folgen – und zu diesem Zeitpunkt wollte ich dann meinen Titel und mein Geburtsrecht öffentlich machen.«
Sie verstummte, offensichtlich am Ende ihrer Geschichte.
»Und sind diese sechs Monate vorüber?«, fragte Kunz. Er hatte in diesem Gewirr von Titeln und Ereignissen völlig den Faden verloren.
Sie nickte.
»Wenn ich so kühn sein darf zu fragen: Warum dann der Zwang zur Geheimhaltung?«
»Weil meine acht Bediensteten zusammen mit meinem gesamten Hausrat und Familienbesitz Anfang des Monats von Liverpool aus in See gestochen sind – mit der SS City of London. Sie versank mit einen Großteil meines Vermögens, mit Ausnahme meiner Juwelen.«
Kunz benötigte einen Augenblick, um den Zusammenhang herzustellen. Ein Passagierdampfschiff dieses Namens, so erinnerte er sich, war vor einigen Wochen auf der Route nach New York verschwunden. Einundvierzig Seelen waren umgekommen.
»Lieber Gott«, murmelte er. »Mein Beileid.«
Anstelle einer Antwort griff die junge Herzogin eine große Handtasche, entnahm einen geölten Lederumschlag und reichte ihn über den Tisch. Ebenso wortlos nahm Kunz ihn entgegen, öffnete ihn und zog ein gefaltetes Pergament heraus. Er legte es auf den Tisch und entfaltete es mit großer Vorsicht.
Er hatte schon etliche ähnliche Patentbriefe gesehen, echte und gefälschte. Im Kopf der Seite standen drei farbige Wappen auf Goldgrund, der mittlerweile so krakeliert war wie altes Porzellan. Der Rest des Dokuments war in schwarzer Tinte verfasst. Es begann mit den Worten Louis Király Nevében in kalligrafischen Lettern im römischen Stil. Am Fuß der Seite hielt ein großes Wachssiegel mit einem Riss in der Mitte ein dreifarbiges Band. Kunz untersuchte das Pergament, die Wappen und das Siegel mit einer scharfen Lupe von seinem Schreibtisch – nachdem er die Herzogin um Erlaubnis für sein Vorgehen gebeten hatte. Obgleich er kein Wort von dem verstand, was er für Ungarisch oder vielleicht Rumänisch hielt, reichte seine Expertise, was Adelspatente betraf, vollkommen aus, um dieses für echt zu halten. Alle Vorbehalte, die Kunz gegenüber dieser Dame, ihrer Geschichte und der Abstammung ihrer Familie gehegt hatte, waren damit ausgeräumt.
Er faltete das Dokument vorsichtig und steckte es zurück in den Umschlag, den er der Herzogin reichte. »Ich danke Ihnen, Mylady. Mit Ihrer Erlaubnis können wir nun fortfahren.«
»Ich hoffe auf Ihre Zustimmung«, erwiderte sie. »Soweit ich verstanden habe, sprechen Sie in dieser Angelegenheit für Tiffany und Compagnie. Aus Gründen, die wohl auf der Hand liegen, benötige ich eine Kreditlinie bei einem Bankhaus, um meine Ausgaben zu decken. Vorausgesetzt, dass wir uns wegen der Edelsteine einig werden, bitte ich Sie um einen auf die Wall-Street-Zweigstelle der Bank of New York lautenden und auf Tiffany ausgestellten Wechsel mit Datum von heute. Dieser soll als Teilzahlung dienen. Zweifellos möchten Sie oder Mr Tiffany Ihren eigenen Firmenbankier hinzuziehen, um die gesamte Summe zu überweisen. Wir können auch die Verträge aufsetzen, um ein Datum abzustimmen, das Ihnen und mir zusagt.«
Während Kunz die erste Bedingung verstand, amüsierte ihn die zweite. Als Fremde wusste sie eindeutig nicht, dass Tiffany’s, der größte Juwelier der Stadt, in seinen Kellergewölben viele Tausende in Bargeld aufbewahrte, mit Sicherheit genug, um den Preis ihrer Edelsteine zu decken.
»Ich glaube, Sie können beruhigt sein, Mylady«, erwiderte er. »Zweifellos können wir ohne Schwierigkeiten eine Vereinbarung über die Auszahlung treffen – falls unsere, äh, Einschätzung einen solchen Schritt erfordert.«
Die Frau nickte.
»Sollen wir nun also fortfahren? Ich hoffe, Sie verstehen, dass helles Tageslicht erforderlich ist.«
»Gewiss«, sagte die Herzogin.
Kunz rief Gruber, der wieder hereinkam, die Tür verriegelte, die Jalousien an den Fenstern ganz nach oben zog und dann seine vorherige Position wieder einnahm. Kunz legte die Lupe beiseite, öffnete seinen Tisch und entnahm ihm eine Reihe von Instrumenten, ein Kännchen mit Mineralöl, eine Juwelierslupe und zwei große Quadrate feinen schwarzen Filz, die er nebeneinander auf die Mitte des Schreibtischs legte. Dann streifte er ein Paar weiße Handschuhe über, rückte seine Weste zurecht und wandte sich an die Frau, die ihm gegenübersaß.
»Euer Gnaden«, sagte er mit einem ehrerbietigen Nicken. »Wollen wir beginnen?«
6
Die Herzogin griff mit ihrer behandschuhten Hand in ihre Tasche. Kunz und Gruber wechselten einen Blick. Trotz der Hunderte, wenn nicht Tausende von Malen, die er diesen Moment erlebt hatte, wurde er Kunz nie langweilig.
»Ich werde Ihnen erzählen, was ich über die einzelnen Steine weiß«, sagte sie, während sie einen kleinen, mit hauchdünnem Goldfaden verschnürten Satinbeutel aus der Tasche zog.
Kunz nickte zustimmend, den Blick auf den Satinbeutel gerichtet, den die Frau ihm nun reichte. Vorsichtig nestelte er mit seinen in weißen Handschuhen steckenden Fingern den goldenen Faden auf und ließ den Stein darin auf eine der Filzunterlagen gleiten.
Er hatte es sich zur Regel gemacht, sich niemals etwas anmerken zu lassen und keine Miene zu verziehen, und diese Regel brach er auch diesmal nicht. Aber er war enttäuscht. Auf dem Filz lag ein Smaragd ordentlicher Größe in achteckigem Treppenschliff. Sicher, er war pastellgrün – aber nicht von diesem dunklen, fast algenfarbigen Ton, den die besten Steine regelmäßig aufwiesen. Eher ein helles Chartreuse, hübsch, aber keine der begehrtesten Farben. Irgendwie hatte er etwas Besseres erwartet.
»Dieser Stein war unter dem griechischen Namen Elysion bekannt«, sagte die Frau. »Ich glaube, er bezieht sich auf die Elysischen Gefilde. Ursprünglich stammt er aus Neu-Granada – oder den Vereinigten Staaten von Kolumbien, wie ich vielleicht lieber sagen sollte.«
Kunz murmelte zustimmend, klemmte sich die Juwelierlupe ins Auge, hob den Stein mit einer gepolsterten Pinzette sanft auf und prüfte ihn intensiv, wobei er ihn in alle Richtungen drehte. Die meisten Smaragde, besonders die größeren, hatten Einschlüsse, aber dieser Stein war fast rein.
Er war sich nur allzu bewusst, dass das Feld der Edelsteinkunde, in dem es stets turbulent zuging, gegenwärtig im Wandel begriffen war. Die Grundlagen für die Bewertung von Edelsteinen – Reinheit, Farbe und insbesondere Größe – wurden von den Verfechtern verschiedener Theorien unterschiedlich gehandhabt, und eine Einigung schien nur ganz allmählich zu erfolgen. Erst vor drei Jahren hatte die Syndikatskammer, eine Vereinigung einflussreicher Pariser Juweliere, das vorgeschlagene »internationale Karat« von 205 Milligramm standardisiert. Kunz zog das metrische Karat von 200 Milligramm vor – exakt ein fünftel Gramm – und benutzte diesen Wert bei seinen Gutachten. Selbstverständlich war alles besser als in jenen Tagen, da man Karat bestimmt hatte, indem man Edelsteine gegen die Samen des Johannisbrotbaums abwog. Er schätzte diesen Stein auf ungefähr 1900 Punkte, und das Wiegen bestätigte seine Schätzung: 18,9 Karat.
Nach ein paar Minuten legte Kunz den Stein zurück auf den Filz. Er wusste, dass Smaragde dieser Größe nur selten makellos waren – und ein farbiger Stein, bei dem man mit bloßem Auge keine Einschlüsse sah, wurde als augenrein bezeichnet. Dazu gehörte dieser Stein nicht; seine winzigen Einschlüsse waren mit bloßem Auge gerade noch sichtbar und unter dem Vergrößerungsglas deutlich zu erkennen. Dennoch war er, was Reinheit und Sättigung betraf, ein ausgezeichnetes Exemplar, das einen Platz in einer der zentralen Schauvitrinen von Tiffany’s verdiente.
Er räusperte sich. »Ein sehr schöner Smaragd, Mylady. Die Färbung ist reizend. Nur die Transparenz ist zweite Klasse.« Er lehnte sich zurück. »Wir wären bereit, Ihnen dafür einen wirklich guten Preis zu zahlen. Tatsächlich sogar dreitausendfünfhundert Dollar.«
Es war mehrere Wochen her, dass er eine so hohe Summe für einen Stein angeboten hatte, und nun wartete er auf den erfreulichen Ausdruck des Entzückens seiner Kundin. Er wurde rasch enttäuscht.
»Sir«, erwiderte die Frau, »falls Sie andeuten wollen, dass der Stein drittklassig ist, muss ich bei allem Respekt widersprechen. Die Diaphanität ist offensichtlich, und ich möchte Sie bitten, noch einmal einen Blick darauf zu werfen, insbesondere darauf, wie Proportionen und Schliff des Steins Reflexion und Brechung des Lichts verstärken.«
Kunz nahm den Stein noch einmal auf, nicht so sehr, um ihn zu prüfen, sondern um jedes Anzeichen von Verlegenheit zu überspielen. Diese Herzogin kannte sich mit Edelsteinen aus – zumindest mit dem, den er soeben prüfte. Diaphanität. Während dieser Begriff eher von Mineralogen als Gemmologen verwendet wurde, war er doch treffend, ebenso wie der Rest ihrer Ausführungen. Und ihr Hinweis, dass die Einstufung eines Edelsteins in erste, zweite oder dritte Klasse veraltet war, traf ihn an einer sehr empfindlichen Stelle.
»Selbstverständlich«, unterbrach die Frau seinen Gedankengang, »sind Sie der Experte, nicht ich. Und letzten Endes gilt das Urteil des Experten. Ich hatte und habe die Hoffnung, meine gesamten Geschäfte hier mit Ihnen abwickeln zu können, statt meine Tarnung zu riskieren, die ein Besuch bei den Händlern in der Maiden Lane mit sich bringen würde, ganz abgesehen von der aufgewandten Zeit.«
Dieser Hinweis auf die sogenannte Diamantengasse war eine Drohung, wenn auch eine höflich formulierte. Auch Kunz würde lieber die Geschäfte der Dame abwickeln – und war zunehmend neugierig auf das, was sich noch in ihrer Handtasche verbarg.
Sie hatte nicht mit ausgestreckter Hand um die Rückgabe des Steins gebeten.
»Sie haben völlig recht«, sagte er und legte den Smaragd zurück auf den Filz. »Bei näherer Betrachtung glaube ich, dass wir unser Angebot auf viertausendfünfhundert Dollar erhöhen könnten.«
»Er war der Lieblingsstein meiner Großmutter. Ich würde mich nie für weniger als sechstausend davon trennen.«
»Nun, äh, darüber müssen wir nachdenken«, sagte Kunz nach einem Moment. Alles hing davon ab, was sich noch in dieser Handtasche befand. Er steckte den Smaragd zurück in seinen Satinbeutel und legte ihn zur Seite. »Können wir dann den nächsten Edelstein sehen, Mylady?«
Die Frau reichte Kunz einen zweiten Beutel. Er öffnete ihn und ließ den Stein herausgleiten – und starrte auf ein erstaunliches Exemplar eines roten Diamanten, der seltensten Farbe der Welt. Da wirklich »ausgefallene« Diamanten – farbige Diamanten – so selten waren, war die Intensität wichtiger als die Reinheit. Dieses Exemplar war in einem ungewöhnlichen dreieckigen Brillanttyp geschliffen, den er noch nie gesehen hatte, der jedoch die rote Färbung perfekt zur Geltung brachte.
»Dies ist der Napnyugta«, erzählte ihm die Frau. »Der Sonnenuntergangs-Diamant. Er wurde meinem Großvater vom König für seine persönliche Tapferkeit in den ersten Tagen der ungarischen Revolution überreicht.«
Kunz hörte sie kaum. Er starrte noch immer auf den Diamanten. Im Lauf seiner Karriere hatte er nur wenige rote Diamanten gesehen, und mit Sicherheit keinen dieser Größe – er schätzte ihn auf fünfundzwanzig Karat, vielleicht sogar mehr.
Einmal mehr klemmte er sich die Lupe ins Auge und spähte in seine Tiefen. Innen makellos mit nur hauchdünnen Federn. Es gab weltweit keinen anderen roten Diamanten von dieser Größe oder Perfektion. Er brauchte einen Moment, ehe er seine Stimme wiederfand.
»Ein wunderschöner Diamant, Mylady«, sagte er.
»Danke.«
Was war er wert? Die Dame wartete. Diesen Stein konnte er sich einfach nicht entgehen lassen.
»Ich wäre mit einhunderttausend Dollar einverstanden, Sir«, sagte die Herzogin.
Kunz schluckte. So viel hatte er noch nie für einen Stein bezahlt. »Würden Sie fünfundsiebzig in Betracht ziehen?«
»Nein, danke, das würde ich nicht.«
Kunz steckte den Stein zurück in den Beutel und reichte ihn Gruber. »Wir kaufen zu Ihrem Preis, Mylady.«
Ein neuer Satinbeutel wurde geöffnet. Heraus glitt der nächste Stein: ein tiefvioletter Cabochon-Saphir mit Zwillingsstern – Asterismus –, der statt der üblichen sechs zwölf Spitzen aufwies. Mit nur einem kurzen Blick wusste Kunz, dass er dem Midnight Star im American Museum ebenbürtig war.
»Er stammt aus Mogok in Burma«, sagte die Herzogin, während er ihn mit der Lupe prüfte.
Kunz beschloss, ihr lieber zuvorzukommen und seinen Preis zu nennen. »Für diesen Stein können wir Ihnen vierzigtausend Dollar anbieten, Mylady.«
»Fünfzigtausend – zusammen mit dem Smaragd.«
»Einverstanden.«
Sie wanderten zurück in ihre Beutel und wurden Gruber übergeben.
Kunz sah sie an, gespannt auf den nächsten Stein, musste aber feststellen, dass sie einfach nur seinen Blick erwiderte, die Hände über der Tasche verschränkt. »Die nächsten – und letzten – beiden Steine sind von besonderem Wert. Ich meine als …Weltschätze.« Sie schien mit einer Art emotionaler Wallung zu kämpfen.
»Ich verstehe, Euer Gnaden.« Weltschätze? Sein Herzschlag beschleunigte sich.