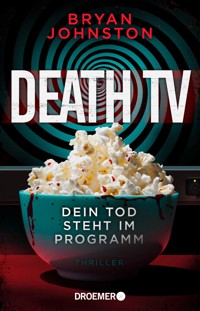
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein tödliches Spiel um Leben und Tod: Frankie Percival muss in einer Fernsehshow sterben, um ihren Bruder zu retten! Frankie Percival ist verzweifelt! Um ihren Bruder vor dem finanziellen Ruin zu bewahren, erklärt sich die alleinstehende Bühnenkünstlerin und Mentalistin bereit, sich in der beliebtesten Fernsehshow der Welt umbringen zu lassen. Kaum dass sie ihr Todesurteil unterschrieben hat, werden ihr durch Hypnose die Erinnerungen genommen, sodass sie keine Ahnung hat, bald zur weltweiten Unterhaltung und auf spektakuläre Weise getötet zu werden. Nichts ahnend, dass jeder es auf ihr Leben abgesehen haben könnte, erhält Frankie plötzlich ein Angebot, das ihren beruflichen Durchbruch bedeuten könnte. Die Lösung ihrer Probleme scheint zum Greifen nah, wenn nicht ihr Tod schon fest im Programm stehen würde … Ein nervenaufreibender Thriller, der Auftragsmord und Zaubershow kombiniert – für Fans der Netflix-Serie Squid Game und Kinohit Die Unfassbaren - Now You See Me. "Ein wirklich fesselnder Thriller [...] eine überzeugende Geschichte über die Magie der Bühnenkunst und die Stärke gutherziger Menschen, die gemeinsam einen Wandel von Bedeutung anstreben." – Criminal Element "Ein subtiles, aber effektives Worldbuilding, geschickt gezeichnete Figuren und eine explosive Grundlage heben Johnstons Werk hervor, das abwechselnd ein spekulativer Thriller, ein entschieden unkonventioneller Krimi und ein Liebesbrief an alle Formen der Bühnenmagie ist." – Mystery Scene Magazine
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Bryan Johnston
Death TV
Dein Tod steht im ProgrammThriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Sabine Schilasky
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Als Frankie Percival bei der Produktionsfirma des preisgekrönten TV-Formats Death Warrant aufschlägt, um mehr über die Gestaltung des Programms und die Auswahl der Teilnehmenden zu erfahren, hat sie längst die Hoffnung aufgegeben, die Schulden ihres durch einen Autounfall verunglückten Bruders auf andere Weise begleichen zu können. In Aussicht auf eine Gage in Millionenhöhe beschließt sie, das Auswahlverfahren zu durchlaufen, das darüber entscheidet, ob ihr Leben als Mentalistin genug Einschaltquoten generieren kann und sie interessant genug ist, um live vor einem Millionenpublikum umgebracht zu werden.
Der Clou an der ganzen Sache? Jedem, der Informationen über Death Warrant einholt, werden im Anschluss durch Hypnose die Erinnerungen genommen, und so weiß auch Frankie kurz vor ihrem beruflichen Durchbruch nicht mehr, dass sie ihr Todesurteil bereits unterschrieben hat …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
PROLOG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
KAPITEL 41
KAPITEL 42
KAPITEL 43
KAPITEL 44
KAPITEL 45
KAPITEL 46
KAPITEL 47
Für Boots, Trixie, Rocco, Pisken, Bella, Lakota, Leo,
Sadie, Petey und Rookie.
Meine pelzigen Freunde für immer.
PROLOG
Herrgott, dachte Joey und blieb stehen, um wieder zu Atem zu kommen, während er sich im Geiste tadelte, weil er den Namen des Herrn missbraucht hatte. Sie hatten gesagt, dass die Wanderung anspruchsvoll sei, selbst für abgehärtete norwegische Bergsteiger. Nur war ihm nicht klar gewesen, dass »anspruchsvoll« ein Code für »deine Lunge wird bluten« war. Wahrscheinlich war es für jemand Jüngeren nicht allzu anstrengend, doch er gestand sich widerwillig ein, dass er nicht mehr in jene Kategorie fiel. Das fortgeschrittene »mittlere Lebensalter« machte seine kleinen Abenteuer umso wichtiger für ihn. Er trank einen Schluck aus seiner Wasserflasche und sah auf die Uhr. Die Zeit war nicht schlecht. »Deshalb hast du sechs Monate lang trainiert, Blödmann«, sagte er sich zum zigsten Mal, auch wenn ihn niemand hören konnte. Er hatte ein paar Wanderer den Berg herunterkommen gesehen, zu seiner Verwunderung jedoch niemand anderen, der den Aufstieg unternahm. Joey hatte mit Absicht einen Zeitpunkt außerhalb der Touristensaison für diesen Punkt auf seiner »Bucket List« gewählt, wenn hier nicht meterhoch Schnee lag, trotzdem hätte er erwartet, ein paar mehr Leute zu sehen. Nicht dass er sich beklagte; er genoss die Einsamkeit. Als er ein letztes Mal durchgeatmet hatte und der Kupfergeschmack in seinem Mund nachließ, machte er sich auf zur letzten Etappe.
Beim Aufstieg hatte er begonnen, mit sich selbst zu reden, führte laute Unterhaltungen, in denen er die Rollen aller Beteiligten sprach. Es war überaus kurzweilig, und es half dabei, ihn bei dem fünfstündigen Aufstieg vom Milchsäurebrennen in seinen Oberschenkeln abzulenken.
»Warum in aller Welt muss es denn Norwegen sein? Das ist doch so weit weg«, imitierte Joey den patentierten Jammerton seiner Frau Joanie. Dreißig Ehejahre hatten ihm reichlich Zeit zur Feinabstimmung gegeben.
»Weil da die Trolltunga ist, Schatz!«, antwortete Joey.
Er erinnerte sich noch genau, wie die Holo-Broschüre angekommen war. »Hast du so etwas schon mal gesehen?«, hatte er sie gefragt. Hatte sie nicht. Das von der Broschüre projizierte 3-D-Bild war eindrucksvoll gewesen, das konnte nicht einmal seine Frau bestreiten. Die Trolltunga war eine tausendeinhundert Meter hohe Felsformation am Nordende eines norwegischen Sees, dessen Namen Joanie nie aussprechen konnte und von deren Spitze eine horizontale Klippe geradezu absurd weit über den See ragte wie die riesige Laufplanke eines Piratenschiffs. Als er zugesehen hatte, wie sich das Bild langsam über der Broschüre auf ihrem Esstisch drehte, war für ihn alles klar gewesen.
Joey schmeckte wieder Kupfer, marschierte aber weiter. Er wusste, dass er es beinahe geschafft hatte.
»Du hättest den Stock mitnehmen sollen, du Genie«, brummelte er vor sich hin. »Dazu sind Wanderstöcke da.« Doch er hatte befürchtet, irgendein unachtsamer Mensch beim Gepäckdienst könnte ihn beschädigen. Der Stock war ihm zu wichtig. Die gesamte Pfadfindergruppe hatte ihre Namen sowie den Satz »Danke für deine vielen Dienstjahre« hineingeritzt. Joey war nicht sicher, wer stolzer auf das Geschenk war, er oder Joanie. Trotzdem wäre der Stock eine Hilfe gewesen.
Seine Recherche hatte ergeben, dass Auf- und Abstieg zusammen zweiundzwanzig Kilometer weit waren – fünfundvierzigtausend Schritte –, was dreihunderteinundvierzig Stockwerken zu Fuß gleichkam. Er schätzte, dass er jetzt im hundertsiebzigsten Stock war, also fast da.
Als er um einen großen Felsen bog, dachte er an das viele Training, die Vorbereitungen und, zugegeben, auch die Umstände, die er Joanie zugemutet hatte, und zitierte einen Lieblingstadel seiner Frau: »Joey Dahl, ich schwöre, du bringst mich noch ins Grab.« Doch dann ließ ihn das, was er sah, abrupt stehen bleiben. In diesem Moment fühlte er sich vollends bestätigt. Und er verstand, warum die Trolltunga einen solchen Reiz auf Abenteurer ausübte. Die Klippe war so lang, dass dieser Blick allein ein Foto hergab, das man sich rahmte und in sein Wohnzimmer hängte. Wo jeder einen darauf ansprechen würde.
Mit so etwas durfte man angeben. Den anderen Diakonen in der Kirche würde es bald zu den Ohren herauskommen.
»Oh Babe«, sagte Joey, diesmal mehr zu sich selbst, »wenn du das nur sehen könntest.« Dabei war schon vor einem halben Jahr klar gewesen, dass das nicht geschehen würde, nicht in ihrer gesundheitlichen Verfassung. Doch sie nahm ihm diese Reise nicht übel. Nicht, nachdem er seit Jahren davon geträumt hatte.
Man musste schon zu einem gewissen Menschenschlag gehören, einem, der frei von Höhenangst und Schwindel war, um an den Rand dieser Klippe zu treten und hinauszuschauen. Joey war so ein Mensch. Er stellte sein kleines, tragbares Stativ auf und befestigte sein Handy darauf, um per Fernbedienung Fotos und Videos zu machen; er konnte es kaum erwarten, sie Joanie und den Kindern zu zeigen. Nach einigem Herumprobieren hatte er schließlich die richtige Kameraeinstellung gefunden und schritt auf die Klippe hinaus. An ihrem Rand drehte er sich zur Kamera um und breitete in einer »Seht, was ich erreicht habe«-Pose die Arme aus. Die Kamera klickte einmal, zweimal, dreimal.
Und dann traf ihn die Kugel direkt über dem linken Auge.
Joey Dahl fiel wie Ikarus, kippte rückwärts von der Klippe ins Nichts. Wie ein Base-Jumper ohne Flügelanzug oder Fallschirm. Sein Körper stürzte an der kahlen Felsfront hinab, ohne sie je zu berühren. Dafür sorgten die starken Luftströmungen von dem See am Fuß der Trolltunga. Sie drückten ihn vom Felsen weg, sodass sein Körper, abgesehen von der Schusswunde, unversehrt blieb, bis er schließlich aufschlug, neben einem See, dessen Namen seine Frau nie aussprechen konnte. Doch da war er schon lange tot.
Knapp zehntausend Kilometer weit entfernt applaudierte ein ganzer Raum voller Leute in ausgezeichnet geschnittenen Maßanzügen und Kostümen, die alles aufmerksam beobachtet hatten. Eine von ihnen, eine Frau mit strengem Pony, drehte sich geschmeidig von der Monitorwand weg und blickte zu einem anderen, kleineren Bildschirm hinüber, auf dem in Echtzeit Zahlenfolgen erschienen. Sie gestattete sich den Anflug eines Lächelns. Die Einschaltquoten waren da. Vielleicht nicht ganz so hoch wie beim Tod des Popstars im letzten Sommer, aber immer noch besser, als das Management erwartet hatte. Genug, um ihr einen Bonus zu sichern. Vielleicht würde sie mit den Kindern in den Freizeitpark fahren.
KAPITEL1
Januar
Wenn man schon standrechtlich exekutiert werden soll, wünscht man sich zumindest, dass da, wo der eigene Tod arrangiert wird, ein paar hübsche Teppiche liegen. Nur um des schönen Scheins willen. Niemand will sich von irgendeinem zwielichtigen Verein ausknipsen lassen, der IKEA für das Nonplusultra der Büroeinrichtung hält. Wie sich herausstellt, war meine Sorge unbegründet. Ich hatte eigentlich keine Ahnung, was ich erwarten sollte, in der Werbung zeigen sie die Geschäftsräume ja nicht. Mir war klar, dass es wahrscheinlich nicht wie ein Steuerberaterbüro in einer Ladenzeile aussehen würde – ein winziger Raum mit billigem Mobiliar aus Kunstleder und Pressspanplatten. Es ist alles andere als das, und sofort habe ich ein gutes Gefühl und fühle mich in meiner Überzeugung bestätigt, dass ich die richtige Wahl treffe. Die Eingangstüren sind eine kunstvolle Kombination aus bernsteinfarbenem Holz, Glas und Metall, vermutlich Messing, aber gebürstet, um schlicht zu wirken. Elegant. Man hat das Gefühl, einen wichtigen Ort zu betreten, wo im Minutentakt kritische Entscheidungen gefällt werden, was wohl auch stimmt.
Drinnen begrüßt mich ein freundlicher Herr mit offenen Armen.
»Willkommen, Ms Percival, wir sind sehr erfreut, Sie zu sehen«, sagt er vollkommen ernst. »Unsere Empfangsdame wird sich all Ihrer Wünsche annehmen.«
Ich brauche eine Sekunde, um zu begreifen, dass der Mann ein Hologramm ist. Dann trete ich einen Schritt näher und stupse ihn an, was der holografische Gentleman lächelnd duldet. Einzig ein kaum merkliches Flackern verrät seine wahre Identität. Noch aus gut einem Meter Entfernung würde man schwören, der Mann sei aus Fleisch und Blut. Hologramme sind dieser Tage weitverbreitet, doch dieses schießt den Vogel ab. Offenbar verwenden sie hier die allerbeste Technik. Der Begrüßung nach zu urteilen, haben sie mich gescannt und identifiziert, sobald ich durch die Tür gekommen bin.
Sofort bemerke ich den Geruch: Lavendel. Subtil, aber unverkennbar. Bei näherer Betrachtung der ideale Duft. Wahrscheinlich der entspannendste überhaupt. Gerüche sind stärker mit Erinnerungen verknüpft als irgendein anderer Sinneseindruck, und ich spüre bereits, wie ich den Duft diesem Erlebnis zuordne. Wie hat mein Highschool-Lehrer immer gesagt? Einmal in der Nase, für immer im Gedächtnis. Das stimmt. Wahrscheinlich werde ich den Geruch bis ins Grab mit diesem Ort assoziieren. Haha, bis ins Grab, miese Wortwahl für diesen Besuch.
Im Eingangsbereich liegen Perserteppiche auf dem Holzboden, die so weich sind, dass man sofort die Schuhe ausziehen will, um sie richtig zu fühlen. Das hier mutet eher wie die Lobby eines Viersternehotels an: geschmackvoll, elegant, unaufdringlich zeitgemäß. Die Frau hinter dem Empfangstresen fügt sich perfekt ins Bild. Sie muss Ende dreißig sein und ist attraktiv, aber nicht einschüchternd schön. Ihr Aufzug gefällt mir, wie meine Mum sagen würde. Ihre Kleidung ist professionell und trotzdem modisch. Müsste ich raten, würde ich sagen, dass sie wahrscheinlich von einem Berater für sie ausgewählt wurde, so wie Nachrichtensprecher ihre Anzüge und Kostüme gezielt aussuchen, um ein Image der Vertrauenswürdigkeit zu vermitteln. Als ich auf den Tresen zugehe, erstrahlt eins der gewinnendsten Lächeln auf ihrem Gesicht, die ich gesehen habe. Ich beuge mich ein wenig vor und kneife die Augen zusammen, um mich zu vergewissern, dass sie real ist. Jep, eine auf Kohlenstoff basierende Lebensform.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragt sie, und ich glaube ihr sofort, dass sie es ernst meint.
»Ich bin hier, um mich umlegen zu lassen.« Mit den Fingern forme ich eine Pistole und feuere ein paar Schüsse auf sie ab, bevor ich den imaginären Qualm vom Lauf puste. Wenn ich nervös bin, rede ich Blödsinn. Ich werde blöd oder bissig. Blöd, bissig oder sarkastisch. Seit zehn Jahren versuche ich, es auf nur eines davon herunterzukochen, mit mäßigem Erfolg. Es soll sich anhören, als wäre es kein großes Ding, hier zu sein, doch meine Stimme klingt schrill, und ich bezweifle ernsthaft, dass mein Deo dieser Herausforderung gewachsen ist.
Unbeeindruckt von meiner allzu lässigen Haltung, nickt die Frau mit einem netten Lächeln. »Natürlich. Sie können mit einem unserer Verkäufer sprechen. Nehmen Sie bitte Platz. Es wird gleich jemand bei Ihnen sein.«
Sie zeigt auf einen gemütlichen Wartebereich mit einem halben Dutzend bequemer Sessel. In einem davon blättert eine distinguiert wirkende Frau in einer Ausgabe von Vanity Fair, einer der letzten Zeitschriften, die sich noch an die putzige Idee von Druckausgaben klammern. Auf der Titelseite erkenne ich eine bekannte Schauspielerin in knallroter Reitjacke, heller Reithose und kniehohen Stiefeln. Ich kann förmlich das Gebell der Hundemeute hören. Die Schauspielerin ist gerade schwer angesagt und gilt als sichere Preiskandidatin für ihre Rolle in einem hochkarätigen neuen Drama, das die Fantasie des ganzen Landes beflügelt hat. Ein Historienschinken über Verrat, unglückliche Liebe und das Überwinden unüberwindlicher Widrigkeiten. Oder zumindest machte mich das der Trailer glauben.
Ich drehe mich zu der Empfangsdame um. »Also, wie läuft das?«
»Wie bitte?«, fragt sie unschuldig.
»Ich meine, darf man sich etwas aussuchen? Aus dem Hinterhalt erschossen? In die Luft gejagt? In ein Säurefass gestoßen? Da gab’s mal eine Folge, echt brutal, da haben sie ein Klavier auf den Typen fallen lassen, wie in einem Comic.« Ich plappere auch viel, wenn ich nervös bin.
Das Lächeln der Empfangsdame wankt nicht. »An die erinnere ich mich gut.« Sie nickt höflich und sagt: »Ihr Verkäufer wird alle Ihre Fragen beantworten.« Dann neigt sie den Kopf in Richtung der Frau mit der Zeitschrift.
Mit einem Augenzwinkern feuere ich noch eine Runde imaginäre Schüsse auf die Empfangsdame ab, stecke die Hände in die Taschen und drehe mich zum Wartebereich um. Mein Gott, sie muss mich für eine Idiotin halten. Ich nehme mehrere Sessel von meinem silberhaarigen Pendant entfernt Platz. Sie blickt zu mir auf und schenkt mir ein winziges Lächeln – einen Tick länger als nötig –, ehe sie sich wieder ihrer Zeitschrift widmet. In diesem einzigartigen Moment werden wir zu Komplizinnen, beide aus demselben Grund hier, und sie erkennt in dem kurzen Austausch an, dass ich – wir –, unabhängig von Ethnie, Geschlecht, Sozialstatus oder der politischen Einstellung, im Begriff sind, Mitglieder eines ziemlich einmaligen Clubs zu werden. Alle für eine, eine für alle.
Meine distinguierte Vereinskollegin sieht, na ja, prominent aus. Der Schnitt ihres Kostüms kündet von Dinnerpartys der Betuchten, bei denen Gespräche über Debütantinnen und Figurentanz nach wie vor nicht veraltet wirken. Und das ist das Rätselhafte. Ich hatte nicht angenommen, dass die oberen Zehntausend hier aufschlagen würden. Ich meine, warum sollten sie diese Maßnahme ergreifen müssen? Die sind doch alle schwerreich. Sie haben die Mittel, um für ihre Familienmitglieder zu sorgen, ohne auf die Extremlösungen zurückzugreifen, die dieser Laden anbietet. Dann dämmert mir, dass vielleicht nicht jeder wegen des Geldes hier ist. Aber warum sonst? Aus Ruhmsucht? Aus Langeweile?
Einen Augenblick später erscheint eine schlanke Frau mittleren Alters mit makelloser Frisur und spricht meine Vereinskollegin an. Sie erhebt sich, schüttelt die dargebotene Hand der Verkäuferin, und sie gehen. Jetzt sind nur noch ich und die Hochglanzzeitschrift übrig.
Ich komme gar nicht dazu, das Magazin aufzuheben, bevor mein Verkäufer auftaucht, um mich zu begrüßen. Falls es je eine Verkörperung von Wärme und Mitgefühl gegeben hat, so steht sie in seiner Gestalt vor mir. Er stellt sich als Benjamin vor, und ich kann ihn ebenso wenig Ben nennen, wie ich mit den Armen wedeln und zum Mond fliegen kann. Ihn mit Ben anzusprechen, wäre ein Affront. Er ist Benjamin, der Typ Mann, der sich einen Schritt hinter seiner Frau hält, der einen Raum voller Fremder mit einer Hand in ihrem Kreuz betritt, um sie wissen zu lassen, dass er bei ihr ist. Benjamin ist eindeutig ein Mann, der mehr zuhört als spricht und gründlich überlegt, bevor er den Mund aufmacht. Das ist mein Drei-Sekunden-Eindruck.
Benjamin scheint vielleicht zehn Jahre älter zu sein als ich, im Anfangsstadium des fortgeschrittenen Alters, mit grau meliertem Haar, das, um einen Baseballausdruck zu bemühen, an den Kraftgassen auf seiner Stirn schon ein wenig zurückgeht.
Er trägt einen gut sitzenden dunkelblauen Anzug mit feinsten Nadelstreifen. Seine braunen Schuhe passen zu seinen Augen. Und es sind die Augen, die alles tragen. Sein ganzes Auftreten, seine Wärme strahlen von diesen dunklen Augen ab. Doch bei genauerem Hinsehen erkenne ich, dass es das dazugehörige Lächeln ist, das den Deckel draufmacht. Das Lächeln und der Blick arbeiten parallel. Das eine ohne das andere ist immer noch stark, beides zusammen jedoch ist unanfechtbar. Ich würde eine Rolex aus dem Kofferraum dieses Typen kaufen.
Benjamin schüttelt meine Hand und bittet mich in sein Büro, wo wir plaudern können. Das sagt er – plaudern, nicht reden. Das ideale Wort, um mich zu beruhigen.
Einfach nur zwei Freunde.
Sein Büro ist klein, aber hübsch eingerichtet und hat ein Fenster, das auf einen städtischen Park voller Bäume hinausgeht. Der Lavendelduft folgt uns dorthinein, worüber ich froh bin. Benjamin bietet mir einen Stuhl vor seinem Schreibtisch an und setzt sich mir gegenüber. Der Schreibtisch ist aufgeräumt, leer bis auf ein paar gerahmte Familienfotos, einen Becher mit der Aufschrift »Okayester Mitarbeiter der Welt« und ein gläsernes Tablet auf einem kleinen Gestell, das es aufrecht hält, falls Benjamin es so nutzen möchte.
Er faltet die Hände auf dem Schreibtisch und sieht mich mit diesen Schokoladenkuchenaugen unverwandt an.
»Also, Frances«, beginnt er. Nicht Ms Percival, sondern Frances. »Sie möchten gern mehr darüber erfahren …« Er schaut auf sein gläsernes Tablet und blickt mit einem kleinen Lächeln wieder auf. »… wie man sich umlegen lässt.«
»Ja, so ziemlich. Und Sie können mich übrigens Frankie nennen.«
»Gewiss doch, Frankie. Und übrigens ist es okay, wenn Sie’s beim offiziellen Namen nennen, Death Warrant, Todesurteil.«
»In Ordnung.«
»Wie viel wissen Sie über den Prozess?«, fragt Benjamin ruhig. Er spricht das O in Prozess sehr lang. Benjamin hat etwas, das man früher als transkontinentalen Akzent bezeichnete. In alten Filmen mit Schauspielern wie Katherine Hepburn und Cary Grant hat man das andauernd gehört. Irgendwo in der Mitte zwischen einem britischen und einem amerikanischen Akzent; wie etwas, das auf Internaten in New England gelehrt wird. Es klingt göttlich.
Ich zucke die Schultern. »Nicht viel. Wie kommt es, dass kaum etwas darüber im Internet zu finden ist? Ich meine, das ist doch ziemlich irre, dass Sie das alles so geheim halten können.«
Benjamin nickt und lächelt verständnisvoll. »Recht erstaunlich, nicht wahr? Man sollte meinen, irgendjemand würde reden. Es redet ja immer jemand. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich weiß es wirklich nicht.«
Und ich glaube ihm.
»Und trotzdem taucht in den Medien praktisch nichts auf«, bemerke ich vielleicht ein bisschen spitzer als beabsichtigt.
Doch Benjamin scheint das nichts auszumachen. Er streckt die Hände zur Seite und hebt in der klassischen Keine Ahnung-Pose die Schultern. »Das sind die inneren Mechanismen der Maschine, die sogar mir ein Rätsel sind. Fragen Sie mich, wie spät es ist, und ich kann es Ihnen verraten. Fragen Sie mich, wie die Uhr funktioniert, und ich muss passen. Viele der Informationen werden rein nach dem Need-to-know-Prinzip gehandhabt.«
»Und Sie müssen das nicht wissen?«, frage ich.
»Das liegt weit über meiner Gehaltsstufe. Wir sind hier strikt unterteilt.« Er sieht mir meine Skepsis an. »Seien Sie versichert, die meisten Ihrer Fragen kann ich beantworten.«
Er lehnt sich auf seinem Stuhl zurück, und da fällt es mir auf. Die Augen. Braun. Die der Empfangsdame waren braun. Die Augen der anderen Verkäuferin waren braun. Fragt mich nicht, wieso mir das aufgefallen ist. So ist es nun mal. Mir fällt alles Mögliche auf. Deshalb war ich auch immer schon ein Fan von Sherlock-Holmes-Geschichten. Dem ist auch alles Mögliche aufgefallen. Während andere hinsahen, hat er Dinge bemerkt. Ich fand das cool. Wir waren verwandte Seelen. Natürlich war meine Beobachtungsgabe nichts gegen seine. Doch eines spricht für mich, nämlich dass ich kein fiktiver Charakter bin. Ich lebe in der realen Welt. Was ich nicht habe, ist ein Sir Arthur Conan Doyle, der dafür sorgt, dass ich einen Kratzer auf einem Schuh bemerke und daraus schließe, dass der Schuldige einen Kantstein gestreift hat, weil er unbedingt den Fünfer-Bus erwischen wollte. Das ist Blödsinn, aber unterhaltsamer Blödsinn. Stattdessen hat mich meine Fähigkeit, Dinge in einem hohen, aber realistischeren Maße wahrzunehmen, in meinem Beruf einigermaßen erfolgreich gemacht – ich bin Mentalistin. Es ist mein Job, zu beobachten. Dinge wahrzunehmen. Zuzuhören und Punkte miteinander zu verbinden, die andere nicht sehen. Ich könnte wohl auch Polizistin oder Privatdetektivin sein, aber das kommt mir vor wie richtige Arbeit. Mentalistin sein dagegen macht Spaß. Wir sind wie Zauberer, nur ohne das kitschige Brimborium. Kann ich tatsächlich wahrsagen und hellsehen? Manchmal fühlt es sich verdammt danach an. Sagen wir, ich habe den Dreh raus. Ein Nebenprodukt meiner wachen Beobachtungsgabe ist allerdings eine hyperaktive Fantasie. Bisweilen sehe ich mehr in irgendwelchen Dingen, als wirklich da ist. Doch das macht das Leben interessant.
Zurück zu den braunen Augen. Natürlich. Braune Augen sind sanft. Sie sind mitfühlend. Blaue Augen sind auffällig, aber an einem Ort wie diesem will man nichts Auffälliges; hier soll alles das Xanax des äußeren Scheins sein. Beruhigend. Ich wette, sämtliche Mitarbeiter mit Außenkontakt haben braune Augen. Genau genommen würde ich meinen, dass sie alle ausnahmslos von einem Beraterteam auf Herz und Nieren geprüft werden, ob sie bestimmte Kriterien erfüllen. Ein solches Unternehmen stellt wahrscheinlich nur Personen ein, die Freundlichkeit ausstrahlen. Ich frage mich, wie sie die messen. Es muss eine Methode geben, die Freundlichkeit und das Mitgefühl einer Person zu quantifizieren, außer sich fünf Minuten lang mit ihr in einem Raum aufzuhalten. Mit der heutigen Technik hat sicher schon jemand die passenden Analyseverfahren entwickelt. Um so etwas messbar zu machen.
Ein Lächeln, so kuschelig wie eine elektrische Heizdecke, erscheint auf Benjamins Gesicht. »Also, was möchten Sie wissen?«
»Äh, wie wäre es, wenn Sie mir erzählen, was Sie können, und ich stelle die Fragen, die mir dabei einfallen?«
Benjamin nickt kurz. »Gewiss. Fangen wir mit einem groben Überblick an, um der Klarheit willen. Ich werde mich umgangssprachlich ausdrücken, auch wenn ich das theoretisch eigentlich nicht sollte. Sie werden umgebracht, und Ihr Sterben wird im Fernsehen übertragen.«
»Das ist echt verdammt umgangssprachlich«, stelle ich fest.
Benjamin lächelt immer noch. »Ja, ich weiß. Und recht schnell auf den Punkt gebracht.«
»Was haben Sie damit gemeint, dass Sie eigentlich keine Umgangssprache benutzen sollen?«, frage ich.
»Das ist Teil der internen Politik. Unternehmenskultur«, antwortet Benjamin freundlich. »Unsere Sendungen werden als ›Folgen‹ bezeichnet, nicht als ›Shows‹. Es gibt keine ›Opfer‹, sondern ›Teilnehmer‹ oder ›Seelen‹. Und alle ›Teilnehmer‹ werden mit dem größtmöglichen Respekt und der größtmöglichen Würde gezeigt.«
»Echt nett von Ihnen.«
»Danke«, sagt Benjamin und sieht wirklich aus, als wäre er mir dankbar, obwohl das sarkastisch gemeint war. »Schauen wir mal, ob ich Ihre nächste Frage erraten kann. Wie läuft das ab?«
»Sie haben so was schon mal gemacht, Benjamin.«
»Ein- oder zweimal. Wir haben jede Menge Paketlösungen, aus denen Sie sich etwas aussuchen können, je nach Ihrem Budget, dem Zeitrahmen und anderen Faktoren.«
»Was für Faktoren?«
Benjamin schaut auf sein gläsernes Tablet und tippt und wischt ein wenig, um die richtige Information aufzurufen. »Interessiert es Sie, ob es sauber oder chaotisch vonstattengeht? Wünschen Sie es schnell und schmerzlos, oder wollen Sie es lieber deutlich fühlen? Möchten Sie ein gewöhnliches Ende oder eher etwas Exotischeres?«
»Wer will denn intensiv erleben, dass er stirbt?«
»Sie würden sich wundern. Es gibt Leute, die ihre letzten Momente auf Erden bewusst erleben wollen. Mir wurde gesagt, sie glauben, dass sie sich dann am lebendigsten fühlen.«
»Komplett irre.«
»Wem sagen Sie das, Frankie?« Einfach nur zwei gute Kumpels.
»Was meinen Sie mit exotisch?«
Benjamin lehnt sich wieder zurück und blickt für einen Moment zur Decke, um seine Gedanken zu sortieren. »Nun, vor ein paar Jahren war da mal einer, der mir sehr außergewöhnlich vorkam und noch dazu spektakulär schwierig.«
»Und was war das?«
»Ein Piranha-Angriff. Und er hat in der Stadt gelebt.«
»Echt?«
»Das hat der Produktion einiges abverlangt. Wir mussten die Crew verdoppeln. Aber es hat sich gelohnt; die Einschaltquoten waren herausragend.«
»Wie herausragend?«, will ich wissen.
»Sind Sie mit Einschaltquotenberechnungen vertraut?«
»Ein bisschen.«
Benjamin tippt auf sein Tablet. »Piranha-Angriff … Einschaltquote 48,8 Prozent, live 71 Prozent.«
Er erklärt mir, dass sich die Prozentzahl auf die Gesamtzahl der Zuschauer bezieht, die befragt werden, und der Live-Anteil auf diejenigen, die den fraglichen Moment mitangesehen haben. Was bedeutet, dass beinahe das halbe Land zugesehen hat und über siebzig Prozent der Leute ihre Fernseher, Computer oder sonstigen Geräte im Moment des Piranha-Angriffs zugeschaltet hatten. Ich frage mich, was die anderen dreißig Prozent gesehen haben.
»Heilige Scheiße! Das sind ja Super-Bowl-Zahlen.«
»Tatsächlich ein wenig höher.«
»Und ich habe gelesen, dass ein Dreißig-Sekunden-Werbespot bei diesem Spiel zehn Millionen Dollar kostet.«
Benjamin überlegt kurz. »Zehn Komma zwei Millionen, als ich das letzte Mal nachgesehen habe.«
Und hier wird es ernst, denn nun kommt das Geld ins Spiel.
»Also, wie läuft so was? Geldtechnisch, meine ich.«
Benjamin faltet die Hände vor sich, und sein Gesicht nimmt einen Ausdruck erstaunlicher Anmut an. Ich habe keinen Schimmer, was sie ihm hier bezahlen, aber es ist nicht genug.
Mein Gehirn hat Mühe, zu verarbeiten, dass dieser Mann, der aussieht und klingt wie ein warmes Bad, für eine Firma arbeitet, die für Geld Menschen tötet.
»Richtig«, sagt er. »Deshalb sind Sie ja hier. Damit Ihre Familie nach Ihrem Ableben hinreichend versorgt ist.«
Er kommt mir vor wie ein Bestattungsunternehmer, der über die Kosten für den Sarg, die Blumen und den Organisten redet. Ein heikler Balanceakt. Die Kundin beruhigen, während man seinen Job macht, um die Firma in den schwarzen Zahlen zu halten – der Besitzer soll ja weiter seine Gasrechnung und die Hypothekenraten bezahlen und mit seinen Kindern nach Disneyland fahren können.
»Wenn Sie sich entschließen, unseren Service in Anspruch zu nehmen, zahlen Sie eine Gebühr, gewissermaßen eine Anzahlung. Die Höhe richtet sich nach einigen der Kriterien, die ich bereits genannt habe – Zeitrahmen, Komplexität.« Benjamin legt eine Pause ein, als sei es ihm wichtig, dass der nächste Satz auch ja zu mir durchdringt. »Die Gebühr soll sicherstellen, dass man uns nicht als Ausbeuter der Verzweifelten sieht.«
»Ja, ich kann mir vorstellen, dass dieser Eindruck entstehen könnte«, antworte ich mit ernster Miene.
Benjamin quittiert mein Verständnis mit einem Lächeln. »Sobald unser Service geleistet und Ihr Ableben bestätigt wurde, erhält die begünstigte Partei – der Unterhaltsberechtigte, wenn man so will – einen Prozentanteil der Werbeeinnahmen, die sich aus der Fernsehproduktion ergeben.«
»Und ich nehme an, je ausgefeilter die Produktion, desto höher die Einschaltquoten und folglich auch die Summe für die … wie nannten Sie es noch gleich? Begünstigte Partei?«
Benjamin zieht eine Augenbraue hoch. »Für gewöhnlich ja, aber nicht notwendigerweise. Ich habe schon einige recht durchschnittliche Terminationen gesehen, die wegen der Hintergrundgeschichte gute Einschaltquoten erzielt haben.«
»Hintergrundgeschichte?«
»Nun, eine Geschichte, die der Folge ein bisschen mehr Dramatik verleiht. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel.« Benjamin zieht wieder diese Nummer ab, bei der er an die Decke starrt, um Erinnerungen wachzurufen. »Da gab es eine Folge, bei der die Todesart eine simple Explosion war. Sprengstoff, der zu einer festgelegten Zeit an einem festgelegten Ort explodiert ist. Nicht übermäßig dramatisch. Aber sie hat einen zusätzlichen Twist bekommen, denn am vorgesehenen Tag beschloss unser Kunde, mit seinem Hund Gassi zu gehen. Eine unerwartete Abweichung von seinem normalen Tagesmuster. Darauf waren wir geradezu peinlich unvorbereitet. All unsere Recherchen hatten eine neunundneunzigprozentige Chance ergeben, dass er zum Zeitpunkt der Detonation allein sein würde. Doch das Schicksal wollte, dass diese Fehlberechnung unsererseits zu einem Glücksfall in Sachen Einschaltquoten wurde.«
»Was hatte denn ein Hundespaziergang damit zu tun?«, frage ich.
Chris Miller ahnte nicht, dass Max, sein grauschnäuziger kleiner Labradormischling, der neben ihm hertapste, vier Bundesstaaten entfernt für hysterische Ausbrüche sorgte. Nun ja, tapsen war großzügig formuliert, eher humpelte oder watschelte er. Max ging in Menschenjahren auf die achtundneunzig zu und war gebaut wie eine Krakauer Räucherwurst – was hauptsächlich Chris’ weichem Herzen und Essensresten geschuldet war. Chris fand, dass Max verflucht noch eins alles fressen durfte, was er wollte, solange er lebte. Vor sieben Jahren waren Chris und Max zum Wandern im Zion National Park gewesen, als Chris in eine Schlucht stürzte und dort eingeklemmt war. Er hatte nur für ungefähr einen Tag Wasser gehabt. Doch Max war losgerannt und hatte Hilfe geholt, wie in einem klassischen »Lassie«-Szenario. Seitdem verwöhnte Chris seinen alten Hund nach Strich und Faden.
Und das war es, was die Leute in dem Fernsehstudio nicht vorhergesehen hatten.
»Wie lange noch, bis er die optimalen Detonationskoordinaten erreicht?«, fragte der Regisseur. Er wischte sich zum dutzendsten Mal in den letzten fünfzehn Minuten mit einem bereits feuchten Taschentuch die Stirn.
»Zehn Minuten«, antwortete die Aufnahmeleiterin angespannt. Sie knüllte einen Pappbecher in der Hand, der noch Momente zuvor halb voll Wasser gewesen war. Das hatte sie in einem Zug hinuntergekippt und sich dabei inständig gewünscht, es wäre etwas Stärkeres. »Mein Team hat den Bereich geräumt. Da sind keine Zivilisten mehr. Jedenfalls erst mal nicht. Vorerst ist alles klar.«
Nichts ist klar, dachte der Regisseur. Die Lage war alles andere als klar. Aber er musste Ruhe bewahren. Er blickte zu der Reihe von Bildschirmen an der Wand des Kontrollraums. Ein halbes Dutzend oder so zeigten die Zuschauer überall auf der Welt, die meisten auf spontanen Death Warrant-Partys. Bei diesen Anlässen schienen die Menschen zusammenzufinden. Der Regisseur sah immer gern, wie das Publikum auf die jeweiligen Umstände reagierte; es half ihm, Story-Bögen zu entwerfen und zu erkennen, was sich emotional bei den Leuten tat, worauf sie reagierten. Im Augenblick drehten die Zuschauer gerade im Allgemeinen am Rad. Niemand wollte sehen, wie ein niedlicher, wenn auch fetter kleiner Hund in Fetzen gesprengt wurde. In der Vorschau bekam das Publikum Gelegenheit, die Todesart zu erfahren. Es ließ sich unmöglich vorhersagen, wie sie sich von einer Folge zur nächsten entschieden. Manchmal wollten sie es wissen, manchmal wollten sie überrascht werden.
An diesem Abend jedoch hatten sie für Wissen gestimmt. Und als die Verantwortlichen enthüllt hatten, dass es eine Explosion wäre, waren die ersten Reaktionen überwältigend positiv gewesen. Explosionen waren immer gern gesehen. Doch je näher der Moment rückte, desto kribbeliger wurden die Zuschauer. Sie kannten den genauen Zeitpunkt nicht, doch sie wussten, dass ein kleiner Hund sehr wahrscheinlich in die Schusslinie geraten würde, und flippten folglich aus.
»Wieso hat das keiner kommen sehen?«, schrie ein großer, imposanter Manager ganz hinten im Raum, in dessen Sprachmelodie ein Hauch von einem deutschen Akzent mitschwang. Keiner traute sich, Blickkontakt mit ihm aufzunehmen oder eine dürftige Ausrede vorzubringen; das wäre einem karrieretechnischen Selbstmord gleichgekommen. Unter Umständen wie diesem verließen die Mitarbeiter sich auf ihre Ausbildung, ihre Erfahrung und Professionalität, und davon gab es in dem Kontrollraum zuhauf. Sie gehörten zur Crème de la Crème und bildeten sich gern ein, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein.
Der Regisseur drehte sich zu einem kleinen, ernst dreinblickenden Mann in der Studioecke um, der über einen Computerbildschirm gebeugt war. »Statistik. Was zum Teufel soll das? Warum der Hund? Er sollte doch allein sein!«
Der leitende Statistiker zuckte die Achseln. »In den letzten zweihundertfünfundvierzig Tagen seit Annahme des Auftrags war der Teilnehmer zweihundertzweiunddreißigmal in dem Park.« Der Mann schaute wieder auf seinen Monitor. »Immer zwischen sechs und zehn nach sechs.« Jetzt sah er den Regisseur an. »Das war, vereinfacht gesagt, sein Abendspaziergang. Man konnte die Uhr danach stellen. Und von den zweihundertzweiunddreißig Mal hatte er seinen Hund gerade zweimal dabei.« Der Mann zeigte auf seinen Bildschirm. »Basierend auf unseren Zahlen lag die Wahrscheinlichkeit, dass der Teilnehmer seinen Hund mitnimmt, bei weniger als einem Prozent. Weit unter unserer Schwelle.«
Die Aufnahmeleiterin räusperte sich. »Ähm, anscheinend hat auf der anderen Seite des Parks gerade ein neues Hunde-Café aufgemacht. Ihr wisst schon, einer von diesen Trendläden, die Hundekekse und Cappuccinos anbieten? Wir können nur vermuten, dass Mr Miller, äh, seinen Hund als Belohnung dahin ausführt.«
In der Ecke zuckte der Statistiker abermals die Schultern. »Das menschliche Naturell ist immer der unberechenbare Faktor.«
Das menschliche Naturell? Der Regisseur starrte den Mann an, bis der kleine Statistiker unter seinem Blick einknickte und hinter seinen Computermonitor flüchtete. Das menschliche Naturell … du willst mich wohl verarschen, dachte der Regisseur. Sie hatten Algorithmen bis zum Abwinken und reihenweise Computer, deren alleiniger Daseinszweck darin bestand, das beknackte menschliche Naturell in Grund und Boden zu rechnen. Schulterzucken und Ausreden akzeptierte er nicht. Er wandte sich an die Sprengstoffexpertin, die drei Stühle weiter saß und das Ganze ruhig beobachtete. »Wie groß ist der Wirkradius der Ladung?«
»Der entspricht einem Umkreis von sechs Metern«, kam die Antwort. »Im Grunde wie eine kleine Landmine, nur konzentrierter.« Sie schaute weiter auf die Monitore, und ihr Tonfall blieb ruhig und gefasst. »Ich habe noch nie einen Zivilisten durch Friendly Fire verloren, und ich werde jetzt nicht damit anfangen.«
»Tja, na ja, wir könnten einen Hund verlieren, wenn wir nicht aufpassen.«
Der Hund war ein entscheidender Faktor gewesen, als Chris für die Teilnahme ausgewählt worden war. Das Kreativteam hatte entschieden, dass die Geschichte mit der Lebensrettung im Zion National Park genau der richtige emotionale Aufhänger sei.
Einige der neueren Crewmitglieder fragten sich zweifellos, warum das Team eine Termination ausgesucht hatte, bei der es zu Kollateralschäden kommen könnte. Doch die, die schon länger dabei waren, wussten: Die Leute liebten eine schöne Explosion. Ganz besonders Death Warrant-Explosionen. Die Sprengstoffexperten waren enorm stolz auf ihr Können. Vor allem diese. Sie hatten für ihre Arbeit in der hohen Kunst, Dinge in die Luft zu jagen, einen Emmy gewonnen, für eine Folge im vorherigen Jahr mit einer Dentalhygienikerin und Drachenfliegerin. Die Einschaltquoten waren sagenhaft gewesen. Das Sprengteam hatte Unmengen Zeit darauf verwandt, exakt den richtigen Knalleffekt zu erzeugen; der musste den Umständen angemessen sein und im Fernsehen gut aussehen. Damals hatten sie nur eine kleine Ladung gebraucht – gerade genug für eine Person –, und das Ganze hatte immer noch ansprechend für die Sinne sein müssen. Bei den meisten realen Detonationen entstand nur wenig Feuer, sofern nicht sehr viel Brennstoff im Spiel war. Sie verursachten für gewöhnlich nur einen lauten Knall, und das war’s. Doch wegen der Spezialeffekte in Filmen waren die Leute an feurige Explosionen gewöhnt. Und die Munitionsexperten bei dem Job damals waren echte Künstler gewesen. Sie hatten monatelang gearbeitet, um genau die richtige Menge an Flammen im Verhältnis zur Ladung und zum Sound zu erzeugen.
Der Regisseur beugte sich zu seiner Assistentin hinüber und raunte: »Hast du gehört, wie groß die Ladung hier ist?« Die Assistentin zeigte mit Daumen und Zeigefinger einen Abstand von zweieinhalb Zentimetern, was wahrscheinlich übertrieben, aber eine klare Aussage war. Der Regisseur stieß einen leisen Pfiff aus. Er war genauso gespannt auf das Ergebnis wie alle anderen.
Und trotzdem hallten ihm die Worte des Managers durch den Kopf: »Wieso hat das keiner kommen sehen?«
Eine Stunde zuvor hatten weltweit Millionen Menschen, die eine Death Warrant-App auf ihren Geräten installiert hatten, ein »Ping« gehört, das ihnen ankündigte, dass bald für jemanden die letzte Stunde schlagen würde. Auf dieses Ping hin kam die Zivilisation zum Stillstand, und alle Blicke klebten an Bildschirmen. Der gekonnt produzierte Vorspann erinnerte die Zuschauer daran, dass sie nun die beliebteste Sendung aller Zeiten sehen würden. Die Moderatoren waren wie immer sympathisch, professionell und mitfühlend. Über den Teilnehmer, Chris Miller, wurde eine rührende, gefühlvolle Hintergrundgeschichte erzählt, und er hatte nicht den blassesten Schimmer, dass er am Ende der Sendung tot sein würde.
Chris Millers Schwester, die Multimillionärin sein würde, wenn sie abends zu Bett ging, saß mit Freundinnen in einem Café, als das Ping ertönte. Als sie sah, dass die »Seele«, deren »Termination« geplant war, ihr eigen Fleisch und Blut war, rief sie sofort hysterisch ihren Bruder an. Sie war vollkommen perplex, als sie nicht durchkam. Übrigens erging es Tausenden anderen, die Anrufe tätigen wollten – mit Ausnahme des Notrufs –, in einem Umkreis von hundertfünfzig Kilometern um Chris und Max ebenso. Sie alle stießen auf dieselbe unsichtbare Barriere und konnten ihre Zielperson nicht erreichen. Außerdem erhielt niemand in dieser Zone das Ping-Signal, also waren die Menschen in dem Bereich genauso ahnungslos wie Chris. Die Anwälte von Death Warrant hatten diese Todeszone mit der staatlichen Kommunikationsaufsicht aushandeln können und dafür zu Weihnachten satte Boni erhalten. Folglich bekam Chris keine Anrufe oder Warnungen und wusste nicht, dass er nie wieder einen Sonnenaufgang würde sehen werden.
Nach Wochen der Überlegungen und Dutzenden Simulationen hatten sich alle auf ein einstündiges Vorprogramm geeinigt. Man brauchte Zeit, um dem Publikum die Vorgeschichte zu erzählen und einen anständigen Einstieg zu bieten. Und die Logik dahinter war, dass sich, wenn man zu weit im Voraus in die Übertragung ging, das Risiko ungeplanter Vorkommnisse erhöhte. Das Leben war unberechenbar, wie die Anwesenheit des Hundes an diesem Abend allzu deutlich demonstrierte. Bei einer Livesendung ist nichts frustrierender für Produzenten oder Regisseure als höhere Gewalt.
Die Countdown-Uhr im Studio näherte sich der geplanten Sprengzeit, während der Regisseur sich langsam den Schmelz von den Backenzähnen knirschte und seine Assistentin mit ihrem Kugelschreiber in Überschallgeschwindigkeit auf den Tisch klopfte. Die Studiobosse, die dies alles aus der Ferne anschauten, wussten nichts von dem Drama im Kontrollraum und fanden die Übertragung wunderbar.
Der Regisseur schaute zur Uhr hinauf, die gnadenlos tickte. Ihm gingen die Optionen aus, und in Gedanken überschlug er fieberhaft, wie sehr er seine gut vierhunderttausend im Jahr vermissen würde, sollte er gefeuert werden.
Dann gab es plötzlich ein gutes, altmodisches unerwartetes Ereignis von der netten Sorte.
»Äh, Sir?«, sagte jemand vom Produktionsteam, dessen Kamera auf den Hund gerichtet war. »Mit dem Hund stimmt was nicht.«
Sämtliche Blicke richteten sich auf den dicken kleinen Mischling, der nicht mehr neben Chris ging, sondern erst nach links, dann nach rechts getorkelt und schließlich umgekippt war, ähnlich einer der dressierten Ziegen, die im Zirkus auf Kommando in Ohnmacht fielen. Die Hundezunge hing leuchtend rosa aus dem Maul.
»Biometrie!«, rief der Regisseur in sein Headset. »Was seht ihr?«
Das medizinische Team war in einem anderen Teil des Gebäudes damit beschäftigt, Chris’ Vitalfunktionen und seine Körpertemperatur bis auf die dritte Nachkommastelle exakt zu überwachen. Rasch schwenkten sie ihre Scanner auf den reglosen Hund. Die Kosten für die Geräte, die nun auf den Vierbeiner fokussiert waren, entsprachen dem Bruttoinlandsprodukt eines Entwicklungslandes. Und all die irrsinnig teure Technik kam in diesem Moment zu einem einstimmigen Ergebnis.
»Scheiße, er ist tot.«
Der Regisseur, selbst ein Hundeliebhaber, der seinen Drahthaarterrier schamlos verwöhnte, musste all seine Professionalität aufbieten, um nicht laut zu lachen. Dabei wäre es kaum aufgefallen, denn im Kontrollraum brandete eine Kakofonie aus Jubel und Applaus auf. Zum Teufel mit Professionalität.
»Wie nahe ist die Zielperson bei der vorgesehenen Stelle?«, rief der Regisseur über den Lärm hinweg der Aufnahmeleiterin zu.
»Nahe genug. Der Bereich ist sauber. Niemand im Umkreis von fünfzehn Metern.«
Der Regisseur blickte zu dem Manager hinüber, der seinerseits die Sprengstoffexpertin ansah. Die Frau nickte beiden kurz zu.
Nun grinste der Regisseur breit und knackte mit den Fingerknöcheln. Verstohlen schaute er auf die Monitore, die einzelne Zuschauer zeigten. Viele weinten ganz offen um den toten Hund. Aber würden sie auch weinen, wenn dessen Halter in Fetzen gerissen wurde? Eher nicht. »Feuer frei.«
Die Explosion war atemberaubend in ihrer Symmetrie, ihrem Klang und ihrer Farbe. Eine Mona Lisa der Pyrotechnik. Und keine zivilen Opfer.
»Unglaublich«, entfährt es mir.
»Wir konnten es auch nicht fassen«, antwortet Benjamin, der richtig strahlt. »Ich meine, wir wussten, dass der Hund alt war, gut um die fünfzehn Jahre und nicht direkt schlank, falls Sie verstehen, was ich meine. Aber ernsthaft, wie groß war die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Hund buchstäblich zwei Minuten vor dem Knall tot umfällt?«
»Astronomisch.«
Benjamin tippt auf sein Tablet. »Unser Team hat es ausgerechnet. 1.353.482 zu eins. Wir hätten Lottoscheine kaufen sollen.«
»Aber eines verstehe ich nicht«, sage ich. »Der Typ ist doch stehen geblieben. Er hatte die Stelle mit der Bombe noch nicht erreicht. Die haben gesagt, ›nahe genug‹.«
Benjamin grinst mich an. »Wer hat denn behauptet, dass es eine bestimmte Stelle war?«
Ich überlege einen Moment. »Die Bombe war an ihm dran?«
Er nickt. »Sein Schrittzähler. Wir schätzen Ironie sehr.«
Ich lehne mich zurück und fächele mir Luft zu, weil mein Gesicht ganz heiß ist. »Wow.«
»Oh ja, wow. Und deshalb die Einschaltquote von zweiundvierzig und siebenundsechzig. Die Folge hat es in unser Special zum Jahresende geschafft. Und den Publikumspreis gewonnen, wenn ich mich recht erinnere.«
Eine Weile sitzen wir schweigend da und kosten das Ende der Geschichte aus. Doch schließlich spreche ich wieder das Wesentliche an: »Über wie viel Geld reden wir hier? Die Auszahlung, meine ich.«
»Wie gesagt, das hängt von den Einschaltquoten ab, aber angenommen …« Er tippt und wischt abermals auf seinem Tablet, »… Sie bekommen eine durchschnittliche Einschaltquote, so fünfunddreißig Prozent.«
»Das ist der Durchschnitt?«, frage ich verwundert.
»Ein bisschen darunter, aber eine Zahl, mit der man gut arbeiten kann. Bei fünfunddreißig Prozent läge die Auszahlung irgendwo um … (tipp, tipp, wisch) … sieben Komma zwei Millionen Dollar.«
»Also ich sterbe, und mein Begünstigter kassiert sieben Millionen?«
»Komma zwei. Vor Steuern.«
»Besser als eine Lebensversicherung«, sage ich ein wenig nachdenklich.
»Dem stimme ich zu. Wobei wir viele damit vergleichbare Vorkehrungen treffen. Beispielsweise nehmen wir keine Kunden an, bei denen eine tödliche Krankheit diagnostiziert wurde und die ihr ohnehin bereits nahendes Ableben zu Geld machen wollen. Sie müssen, wie es in Testamenten so schön heißt, im Vollbesitz ihrer geistigen und körperlichen Kräfte sein.«
»Schlau.«
»Das finden wir auch.«
Wieder herrscht Stille, die jedoch bald durch ein repetitives Quietschen unterbrochen wird.
Ich wippe, wenn ich nervös bin. Sofort bremse ich mich, lehne mich weiter nach hinten, strecke die Beine aus und versuche, entspannt auszusehen.
»Wie hoch sind die Vorlaufkosten?«, frage ich mit einem Handwedeln. »So ungefähr. Alles in allem.«
Benjamin ist so höflich, meinen lahmen Versuch, lässig zu sein, nicht zu kommentieren. »Bei einem typischen Auftrag mit durchschnittlicher Vorbereitungszeit würde ich sagen, fünfzigtausend Dollar.«
»Fünfzigtausend, um sieben Millionen zu kassieren? Kommt mir wie ein Schnäppchen vor.«
»Sieben Komma zwei. Wir finden, dass unser Service für jeden erschwinglich sein muss, ungeachtet des sozialen Status.«
»Na ja, fünfzig Riesen sind nicht gerade ein Klacks. Die hat nicht jeder herumliegen.«
»Da haben Sie recht, aber wir können ja schlecht Ratenzahlung vereinbaren.«
»Würden Sie jemanden ohne Vorauszahlung annehmen und Ihre Gebühr von dem Gewinn abziehen?«
»Nein, das erlauben wir nicht.«
»Warum nicht?«, frage ich.
Benjamin schüttelt den Kopf.
»Das hat etwas Unschickliches. Wir möchten, dass unsere Kunden sich das Ganze sorgfältig überlegt und entsprechend geplant haben. Wir wollen nicht, dass hier einfach irgendwer von der Straße hereinspaziert, der auf leichte Art Geld verdienen will. So etwas darf kein spontaner Einfall sein. Alle unserer Kunden werden von einem Team aus Therapeuten, Psychologen und Beratern evaluiert, um sicherzugehen, dass sie emotional bereit sind, wie geplant zu verfahren.«
»Nehmen Sie jeden, der Ihre Kriterien erfüllt?«, frage ich.
»Nein, das tun wir nicht.«
Mein Stuhl beginnt wieder zu quietschen, doch ich fange mich und höre auf zu wippen, ersetze das Schaukeln allerdings damit, dass ich mich auf dem Stuhl hin und her drehe.
»Ähm, wie kommt’s?«
»Sie würden staunen, wie viele Bewerber wir haben. Würden wir die alle annehmen, verlöre die Sendung ihren Reiz. Die Einschaltquoten würden leiden. Wir müssen sehr umsichtig auswählen.«
Ich bekomme das Drehen in den Griff und nicke weise. »Das leuchtet ein«, sage ich. »Bestimme ich, wie ich sterben werde?«
»Leider nein. Wir können für viele Faktoren einen Plan erstellen, aber die Methode bleibt bis zur Ausstrahlung geheim. Aus offensichtlichen Gründen.«
»Was ist die häufigste Methode?«
»Ein Gewehrschuss in den Kopf. Nicht schrecklich dramatisch, aber das können wir aus weiter Entfernung bewerkstelligen, es ist schmerzlos, und es funktioniert auch in einer Menge.«
»Erinnern Sie mich daran, mich nicht in dieser Menge aufzuhalten«, sage ich mit einem lächerlichen Zwinkern und tue abermals so, als sei mein Finger eine Pistole und ich würde ein paar Schüsse abfeuern. Gott, ich bin erbärmlich! Benjamin lächelt nur, während ich mich wieder konzentriere.
»Woher bekommen Sie Ihre Leute?«
»Wir engagieren nur die besten Schützen. Fast alle sind von der Regierung ausgebildet. ›Wet Boys‹, wie sie im CIA-Jargon genannt werden, also de facto Heckenschützen oder die, die für die Drecksarbeit zuständig sind. Haben Sie die Folge in Norwegen gesehen? Auf der Trolltunga? Reine Poesie.«
»Werden auch Leute mit bloßen Händen umgebracht? Genick brechen oder so?«, frage ich.
»Hin und wieder, aber das ist selten und riskant. Es bedarf enormer Kraft, um einem Menschen mit bloßen Händen das Genick zu brechen.« Benjamin nickt bedächtig.
»Sie haben gesagt, manche Leute möchten das Sterben sehr bewusst erleben. Was hat es damit auf sich?«
»Wir haben schon ehemalige Angehörige der Spezialkräfte gehabt, die ihren Tod sehr nahe erleben wollten. Meiner Meinung nach ein interessanter Plan. Nicht ganz mein Fall, aber wer bin ich, zu urteilen?« Er verstummt kurz. »Sie wollten im letzten Moment wissen, dass es passiert.«
»Warum?«
»Weil sie versuchen wollten zu überleben.«
»Augenblick mal, was?«
»Das sind Spezialeinsatzkräfte. Riesiges Ego. Sie halten sich für die übelsten Männer und Frauen auf dem Planeten und sind bereit, fünfzigtausend auszugeben, in der Hoffnung, dass sie den Angriff überleben.«
»Aber dann würde die Person, der, äh …«
»Der Begünstigte.«
»Genau. Dann würde der Begünstigte doch nichts bekommen.«
Benjamin gibt ein kleines Lachen von sich. »Wir machen uns diesbezüglich keine Sorgen.«
»Warum nicht?«
Hier stockt Benjamin, als sei der Gedanke mehr als lachhaft.
»Die Vorbereitungen und die Planung, die in unsere Projekte fließen …« Er sucht nach den richtigen Worten. »Die Chance, dass jemand überlebt, ist astronomisch gering.« Nun zeigt er zu seinem Tablet. »Ich kann die Zahlen nachsehen.«
»Nein, schon okay, nicht nötig.«
»Außerdem«, fährt er fort, »wollen so gut wie alle unsere Teilnehmer sterben. Sie möchten einem geliebten Menschen die nötigen finanziellen Mittel zukommen lassen.« Er sieht mich an. »Nicht wahr?«
Ich schürze die Lippen und schaue zur Seite. Nach einem ungemütlichen Moment sehe ich ihn wieder an.
»Sie sagen also, es ist noch keiner dem Tod entkommen?«, frage ich grinsend, um die Stimmung zu entkrampfen.
Benjamin lächelt. »Oh nein, das wäre schlecht fürs Geschäft. Sollte jemals jemand überleben, hätte ich keinen Job mehr.« Er stockt und beißt sich auf die Unterlippe. »Obwohl ja einer mal nahe dran war. Ein früherer Navy Seal, ungefähr in meinem Alter, aber noch verblüffend gut in Form. Wir hatten es so arrangiert, dass sich unser Mann ihm gegenüber in ein Straßencafé setzt, die Waffe bereits gezogen unter dem Tisch. Der Seal hat ein wenig verwundert aufgeschaut, und dann wurde sein Kennwort gesagt.«
»Kennwort?«
Benjamin spreizt die Hände. »Wie schon gesagt, manche Leute wollen es wissen, wenn es passiert, aber damit das funktioniert, müssen wir ein Kennwort benutzen, das sie buchstäblich aufweckt und ihnen verrät, dass es so weit ist.«
»Ich bin verwirrt.«
Jetzt erwärmt Benjamin sich noch mehr für das Gespräch. Dies ist eindeutig ein Lieblingsthema von ihm.
»Hypnose«, sagt er schlicht.
»Hypnose?«, wiederhole ich.
»Ist Ihnen das Konzept vertraut?«
»Ich bin professionelle Mentalistin, also ja«, antworte ich mit einem Anflug von Stolz.
»Wirklich?«, fragt Benjamin. Er sieht ehrlich überrascht und beeindruckt aus, obwohl ich sicher bin, dass er das schon gewusst hat. »Das muss faszinierend sein!«
»Es hat seine guten Momente.«
»Hervorragend. Dann kennen Sie das Prinzip natürlich. Die Person wird für Suggestion empfänglich gemacht. Für unsere Zwecke muss die Empfänglichkeit sehr stark sein. Stellen Sie es sich als Hypnose auf Steroiden vor. Wir haben überaus effektive Methoden entwickelt«, erklärt Benjamin. »In diesem Fall wurde unserem Kunden bei seiner ersten Beratung ein Kennwort eingegeben, das ihm im entscheidenden Moment die Situation bewusst macht.«
»Er wurde also darauf programmiert, es zu merken, wenn er angegriffen wird«, sage ich.
»Genau.«
»Wie Der Manchurian Kandidat, nurumgekehrt.«
»Verzeihung?«, fragt Benjamin.
»Entschuldigung. Der Manchurian Kandidat. Alter Film. Ein Attentäter geht durchs Leben und weiß nicht, dass er darauf programmiert ist, jemanden zu ermorden, bis ein bestimmtes Stichwort – ein Kennwort – fällt. Als das passiert, erledigt er seine Aufgabe. In Ihrem Fall wird dem Opfer im fraglichen Moment bewusst, dass ein Attentat auf ihn verübt werden wird. Also wie Der Manchurian Kandidat, nur umgekehrt.«
Benjamin sieht ziemlich beeindruckt aus. »Faszinierend. Ich habe noch nie gehört, dass es jemand so beschrieben hat.«
»Und was ist passiert?«, frage ich.
»Oh.« Benjamin schaltet wieder zu seiner Geschichte zurück. »Der Kunde hat die Situation sofort erfasst, hat alle Möglichkeiten der Verteidigung ignoriert und ist direkt in den Angriffsmodus übergegangen. Er hat unserem Mann sein Wasserglas ins Gesicht geschleudert und sich über den Tisch gestürzt. Unser Mann hat geschossen, und die Kugel hat den Kunden verletzt, aber nicht gestoppt. Der Kunde konnte unseren Schützen entwaffnen, indem er ihm sein Steakmesser in die Waffenhand gerammt hat. Sie haben mehrere Sekunden gekämpft, und offen gesagt, es war knapp. Doch letztlich hat unser Mann gewonnen, der jung und sehr gut ausgebildet war. Er konnte den Kunden in einen Würgegriff nehmen und ihm besagtes Steakmesser ins Auge stechen.«
»Igitt.«
»Fürwahr. Aber es war großartiges Fernsehen. Es wundert mich, dass Sie es nicht gesehen habe. Die Folge ist sehr beliebt.«
»Pech gehabt«, sage ich und gebe mir Mühe, aufrichtig zu klingen. Die große Mehrheit der Bevölkerung ist süchtig nach Death Warrant; es ist die beliebteste Sendung weltweit. Ich hingegen bin nicht ganz so begeistert wie alle anderen. Bei keiner anderen Serie hat es jemals ein solches Ausmaß an Koma-Glotzen gegeben. Ich weiß nicht mehr, wann wir uns als Gesellschaft an den Tod gewöhnt haben. Es war ein langsamer, schleichender Prozess, der sich über Jahrzehnte hinzog, aber als Death Warrant erstmals ausgestrahlt wurde, war die Reaktion sofort allumfassend und enorm. Man sollte meinen, dass es einen Teil der Zivilisation gab, eine Fraktion, die noch Hochachtung vor dem Leben hatte, doch falls sie existierte, machte sie sich nicht bemerkbar. Wer weiß, vielleicht wäre diese Sendung schon vor fünfzig Jahren ein Hit gewesen und uns war nur nicht klar, wie emotional tot wir waren, bis irgendein Überflieger dem Manager eines Senders diese Idee präsentierte.
Benjamin fährt fort: »Also, ein Gentleman kam und wünschte sich eine ganz schnelle Variante. Das Äquivalent zu einem Mafia-Mord. Nicht besonders dramatisch; deshalb fahren diese schnellen Nummern nicht dieselben Summen ein. Die Sponsoren wollen ein bisschen mehr Vorgeschichte. Obwohl ja auch einiges für das Überraschungsmoment spricht. Die Zuschauer wissen, dass es eine Blitznummer wird, also sind sie neugierig, wie wir so eine Aufgabe sehr kurzfristig bewältigen.«
»Vielleicht wollte er, dass es schnell geht«, bemerke ich, »um nicht den Stress zu haben, an jeder Ecke mit dem Sensenmann zu rechnen.«
»Ah.« Benjamin reckt einen Finger in die Höhe. »Das ist ja das Schöne daran. Die Kunden wissen es nicht, bis es zu spät ist.«
»Wie meinen Sie das, sie wissen es nicht? Wenn ich unterschreibe und zur Tür hinausgehe, habe ich das doch rund um die Uhr im Kopf. Bei jeder Person da draußen werde ich mich fragen, ob er oder sie eine Kugel mit meinem Namen im Lauf hat.« Ich halte inne und massiere mir die Schläfen. »Und bei diesem Teil des Ganzen tut mir immer das Gehirn weh. Die Leute, die in der Sendung sterben, wirken nie ängstlich oder paranoid. Sie schauen sich nicht dauernd nervös um. Wie kann das sein? Sie haben doch unterschrieben und wissen, dass sie sterben werden!« Ich rege mich richtig auf, denn dieses Rätsel hat mich von Anfang an umgetrieben.
Doch mein kleines Ausflippen schreckt Benjamin kein bisschen; er schaltet auf ein Mitgefühl-Level hoch, das zum Steinerweichen ist. »Frankie, Sie haben doch selbst gesagt, es gibt praktisch keine Informationen darüber online, wie wir vorgehen. Und ist Ihnen aufgefallen, dass auch niemand, mit dem Sie gesprochen haben, etwas weiß? Wir nehmen unsere Betriebsgeheimnisse sehr ernst. Das Fernsehgeschäft ist mörderisch, da kämpft jeder gegen jeden. Glauben Sie, ich würde Ihnen das alles erzählen, wenn ich denken würde, dass Sie hier rausgehen und diese Informationen an Ihren Mann weitergeben, oder an Ihren Friseur oder einen Barkeeper?«
»Äh, das habe ich mich auch schon gefragt.«
»Erinnern Sie sich an den Navy Seal? Die Hypnose?« Benjamin lehnt sich zurück und breitet die Hände aus, die Handflächen nach oben. »Bitte sehr.«
»Moment mal«, platze ich heraus. »Heißt das, Sie werden mich hypnotisieren?«
Benjamin leuchtet förmlich. »Eigentlich ist es recht simpel. Wenn Sie gehen, werden Sie sich an nichts von dem erinnern, was wir besprochen haben.«
»Sie meinen, ich spaziere hier raus und weiß nichts mehr hiervon?« Ich dürfte nicht überrascht sein. Es ist ja vollkommen logisch.
»Keine Einzelheiten«, antwortet Benjamin ziemlich vernünftig. »Stellen Sie sich einmal vor, wir würden diese Maßnahmen nicht ergreifen. Es wäre schrecklich. Erstens würden unsere Einschaltquoten enorm einbrechen, sollte bekannt werden, wie so etwas abläuft. Ein Großteil des Mysteriums wäre dahin. Zweitens wäre es grausam. Wollen Sie in permanenter Angst leben? Manche Terminationen sind erst in einem Jahr an der Reihe. Wir könnten niemals dazu beitragen, dass ein Kunde so lange Zeit unnötigen Stress hat und leidet. Das ist sittenwidrig.«
»Ja, das leuchtet mir ein.«
»Mitgefühl ist unsere Berufung«, versichert Benjamin.





























