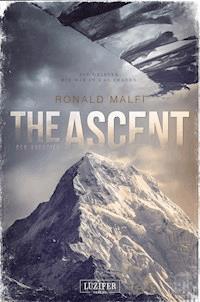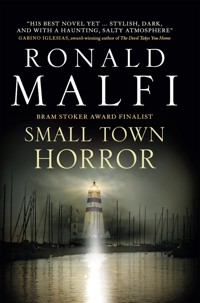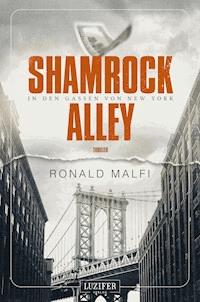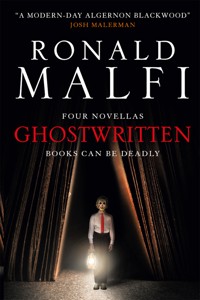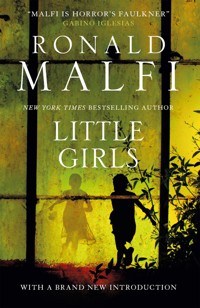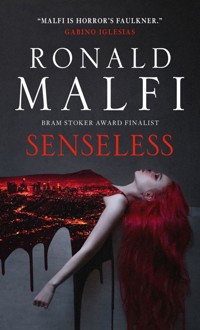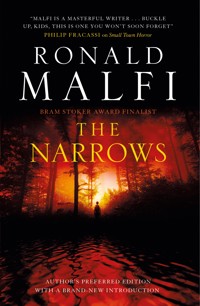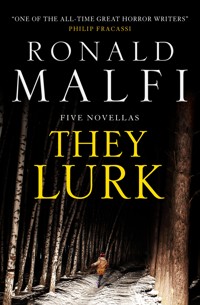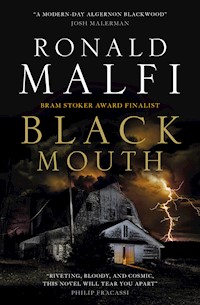Inhalte
December Park
Widmung
Copyright
Impressum
Danksagungen
Erstes Buch
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Zweites Buch
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Drittes Buch
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Viertes Buch
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Epilog
Der Autor
Gewinner des Beverly Hills international Book Awards in 2015 - Kategorie Suspense (Spannungsliteratur)
Für Grandpa, der das Kommando führte
Und für Madison – meine Tochter, meine Schülerin, meine Lehrerin
Copyright © 2014 by Ronald MalfiDie Originalausgabe erschien 2014 bei Medallion Press, Inc., USA, unter dem Titel „December Park“.Dieses Buch wurde vermittelt von der Literaturagentur erzähl:perspektive, München (www.erzaehlperspektive.de), in Zusammenarbeit mit Gloria Goodman.
The original edition was published in 2014 at Medallion Press, Inc., USA, under the title “December Park”.
Impressum
überarbeitete AusgabeOriginaltitel: DECEMBER PARK
Copyright Gesamtausgabe © 2024LUZIFER Verlag
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert
Übersetzung: Ilona Stangl
ISBN E-Book: 978-3-95835-033-5
Fann folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen und senden Ihnen kostenlos einen korrigierten Titel.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Danksagungen
In jedem guten Schriftsteller steckt mindestens eine gute Geschichte über seine Kindheit. Diese hier ist meine. Danke an D.G., D.S., S.S., J.T. und C.S. für eine großartige Kindheit und ein Leben voller wunderbarer Erinnerungen.
Danke an meine liebenswürdige und engagierte Lektorin Lorie und alle Mitarbeiter bei Medallion Press. Danke auch an meine Familie und Freunde, die mir während der Arbeit an diesem Buch mit Geduld zur Seite standen; ich weiß, welch eine Herausforderung das manchmal sein kann. Zuletzt möchte ich besonders meiner Frau und meiner Tochter danken, die mir jeden Tag neue Erinnerungen zu den ganzen wundervollen alten schenken.
Während ich dieses Buch schrieb, ging mein Großvater von uns. Ich habe ihn sehr geliebt, weshalb mir die Passagen über den Großvater meines Protagonisten besonders schwer fielen. Grandpa legte mir aber seine Hand auf die Schulter und begleitete mich ohne von meiner Seite zu weichen bis ans Ende der Geschichte, genauso, wie er mich im wirklichen Leben begleitet hatte. Er gab mir die Kraft, dieses Buch zu vollenden.
– RM
06.09.2013
ERSTES BUCH
Willkommen in Harting Farms
(Oktober 1993 – Januar 1994)
Im Herbst 1993 legte sich ein dunkler Schatten über Harting Farms. Die Zeitungen nannten ihn den Piper – wie den Rattenfänger aus dem Märchen der Gebrüder Grimm, den Barden, der all die Kinder weglockte. Es gab jedoch auch düsterere Namen. Namen, welche man die Kinder in den Gängen der Stanton School flüstern hörte und die sie in die Holzstühle der Bibliothek wie schmutzige, schauderhafte Geheimnisse ritzten. Die Schulkantine brodelte nur so vor Gerüchten über entflohene Geisteskranke aus Sheppard Pratt und verrückte, nach Kinderblut dürstende Seeleute, die in Baltimore an Land gingen und den Weg in unser verschlafenes Küstenstädtchen fanden.
Im Klassenzimmer zeichnete Michael Sugarland Bilder von Werwölfen mit triefenden Reißzähnen und Klauen wie Bajonette, bis ihn Mr. Johnson kopfschüttelnd und mit resigniertem Blick ermahnte, es sei respektlos gegenüber den Vermissten. Man sprach von den Kindern nicht alsDie Toten, denn keines von ihnen wurde gefunden – zumindest anfangs nicht; sie warenDie VermisstenoderDie Verschwundenen. Von den Ersten dachte man sogar, sie wären lediglich von Zuhause weggelaufen.
Doch all das sollte sich bald ändern, und meine Freunde und ich waren mittendrin.
KAPITEL EINS
Der Winter kam früh in diesem Jahr
Wir standen an der Kreuzung von Point und Counterpoint, ließen uns lässig die Zigaretten aus dem Mundwinkel hängen, als wollten wir cool unsere Neugier überspielen, und fröstelten im Wind. Etwas weiter die Counterpoint Lane hinauf hüllten Blinklichter von Polizeiwagen die Bäume abwechselnd in roten und blauen Schein.
Es war erst Anfang Oktober, doch eine vorzeitige Kältewelle war über die Chesapeake Bay in die Stadt gekommen und hatte das Wasser um die Fischerboote unten an den Docks gefrieren lassen. Die Topfpflanzen und Farne an den Blumenständen entlang der Straße waren buntem Mais und leuchtend orangefarbenen Kürbissen gewichen, und obwohl es zu dieser Jahreszeit noch viel zu früh für Schnee war, sah der Himmel bereits mehr als verdächtig danach aus.
Es war Peters Idee gewesen, nach der Mittagspause abzuhauen. Und wir hatten uns direkt zu Solomon’s Field aufgemacht, um ein paar Zigaretten zu rauchen und Steine über den Drunkard’s Pond hüpfen zu lassen. Die Kinder der Gegend hatten dem Weiher diesen Namen wegen der Obdachlosen verpasst, die nicht selten unter der Überführung der Solomon’s Bend Road Whiskey tranken. Richtig hieß er eigentlich Deaver’s Pond, benannt nach einem ehemaligen Polizisten aus den 1970ern laut meinem Vater, der solche Dinge wusste.
Peter, Scott und ich beobachteten die lange Schlange von Streifenwagen, die sich nach und nach auf der Counterpoint Lane gebildet hatte. Auf der anderen Seite der Leitplanke fiel eine Böschung bis in den dichten Wald ab, der die Straße vom Rand des weitläufigen Parks aus unterhalb säumte. Dieser Wald war auch als Satan’s Forest bekannt und man munkelte, dass es dort spukte. Ein Großteil der Bäume hatte bereits sein Laub verloren, doch strahlte der Teil der Blätter, der noch an den Ästen hing, in einem solch leuchtenden Orange, als stünden die Baumwipfel in Flammen.
Ein Krankenwagen kam mit erloschenen Lichtern auf den Seitenstreifen gefahren. Zwei Absperrböcke mit orangenen Blinklichtern zwangen alle anderen Fahrzeuge, der Counterpoint Lane auszuweichen. Ein einzelner Polizeibeamter stand hinter den Absperrungen und starrte zutiefst gelangweilt auf den umgeleiteten Verkehr.
»Wir sollten hier nicht rumhängen«, merkte ich an. »Sieht so aus, als wäre hier irgendwas Größeres am Laufen.« Was auch bedeutete, dass mein Dad hier sein konnte, und ich wollte alles andere, als mich von ihm erwischen zu lassen, wie ich auf dem Gehweg herumlungerte und rauchte.
»Glaubt ihr, da ist schon wieder ein Auto runter?«, fragte Peter und fixierte prüfend die auseinanderklaffenden Reste der Leitplanke und tiefen Spuren im Schlamm, die von schlingernden Reifen herrührten.
Zwei Tage zuvor war eine College-Studentin namens Audrey MacMillan, die betrunken von der Shooter’s Galley in der Center Street nach Hause gefahren war, von der Straße abgekommen, durch die Leitplanke gekracht und unten im Wald gelandet. Sie hatte Glück gehabt, sich nichts Schlimmeres als ein gebrochenes Bein dabei zugezogen zu haben. Bevor ein Abschleppwagen das demolierte Fahrzeug wieder aus dem Wald befördern konnte, hatte die Stadt einige Männer nach unten geschickt, um ein paar der größeren Bäume zu fällen und den Weg frei zu machen. Es war das reinste Fiasko gewesen.
»Keine Ahnung«, meinte ich, »aber grundlos haben sie die Straße nicht abgesperrt.«
»Nie im Leben ist da schon wieder ein Auto runter«, kommentierte Peter skeptisch. »Ich meine, zwei in einer Woche?«
»Zumindest gibt es keine neuen Reifenabdrücke oder Bremsspuren«, stellte ich fest.
»Schau doch mal in deiner Unterhose nach«, feixte Peter mit breitem Grinsen. Er war um nur wenige Monate der Älteste unserer Truppe, obwohl ihm seine paar zusätzlichen Pfunde auf den Rippen ein jüngeres Aussehen verliehen. In seinen blassgrünen Augen lag stets ein wacher Blick und ihre Farbe und Intensität wurden von einem roten Strubbelschopf ergänzt, den er im Nacken viel zu lang trug. Er war mein bester Freund, seit wir vor all den Jahren drüben in den Palisades zufällig im selben Sandkasten gelandet waren.
Die achteckigen Schirmmützen zweier weiterer uniformierter Officers tauchten auf der anderen Seite der Leitplanke auf. Ein vierter stieg aus einem der Streifenwagen, lehnte sich gegen die Motorhaube und schien trotz seiner dickgefütterten Jacke zu frieren.
Scott nickte in Richtung der Polizeiwagen: »Kommt schon. Lasst uns mal nachsehen.«
»Die könnten uns fürs Schwänzen eins auf den Deckel geben«, befürchtete ich. »Ich bin bei meinem Dad bereits wegen der ganzen Sache mit Langhalsnik in Ungnade gefallen.«
Mr. Naczalnik, wegen seines Profils wie ein Wasserhahn und eines Halses wie dem von Ichabod Crane auch als Langhalsnik bekannt, war mein Englischlehrer in der Stanton School. Vergangenen Monat hatte ich eine Hausarbeit nicht abgegeben und Langhalsnik, stets bereit, einem armen Schüler das Leben schwer zu machen, hatte ohne mit der Wimper zu zucken unverzüglich meinen Vater benachrichtigt. Er hatte mich zu einer Woche Hausarrest verdonnert.
Peter warf einen Blick auf seine Casio. »Schule ist doch schon seit zwanzig Minuten aus.«
Wir überquerten hintereinander die Kreuzung und gingen den flachen Hang der Counterpoint Lane zu den Polizeiautos und dem Krankenwagen hinauf.
Als wir einen der blinkenden Absperrböcke erreichten, kam der gelangweilt aussehende Cop auf uns zu. »Sorry, Jungs. Die Straße ist gesperrt.«
»Was ist denn passiert?«, fragte Peter neugierig und versuchte, um den Polizisten herumzulugen.
»Ihr müsst von der Straße runter. Ihr könnt von der anderen Seite aus zusehen.«
»Ist schon wieder jemand von der Straße abgekommen?«, fragte ich.
»Nein.« Der Polizist war jung und kam mir irgendwie bekannt vor. Ich sah auf sein Namensschild, doch der Name sagte mir nichts. »Macht schon, Jungs. Schwingt die Hufe.«
»Das ist ein freies Land«, protestierte Peter schwach. Er war immer noch zu sehr mit seinem Versuch beschäftigt, einen Blick über die Schulter des Cops zu erhaschen.
Der Cop hob eine Augenbraue. »Ach ja? Tja, auf der anderen Straßenseite kannst du so frei sein, wie du willst.«
»Nicht einmal einen klitzekleinen Blick?«, drängte Peter.
Der junge Cop sah nun mich an. »Bring deine Freunde wieder zurück über die Straße, Angelo.«
Dass er meinen Namen kannte, überraschte mich kein bisschen. Mein Vater war Detective des Harting Farms Police Departments. Sämtliche Polizisten kannten mich, selbst wenn ich ihnen noch nie zuvor begegnet war. »Kommt schon, Jungs«, trieb ich sie an und stieg auf den Gehweg.
»Danke.« Der Officer nickte mir zu, dann wandte er sich an meine Freunde. »Ihr seid noch zu jung zum Rauchen.« Darauf warf er einen prüfenden Blick auf seine Uhr – und bemerkte vielleicht, dass es wahrscheinlich noch viel zu früh war, als dass wir schon so weit von der Schule entfernt sein konnten – und schritt über die Straße davon.
Dort drüben kam nun langsam Bewegung in die Sache, obwohl sich das meiste auf der anderen Seite der durchbrochenen Leitplanke und weiter unten an der Böschung abspielte. Zwei Männer in weißen Kitteln gingen umher, rauchten und unterhielten sich, den Blick auf ihre Schuhe gerichtet. Einmal sprachen sie kurz mit einem uniformierten Officer. Ihren lässigen Bewegungen und der entspannten Art nach zu schließen, ging wohl nichts allzu Dringliches auf der anderen Seite der Leitplanke vor sich.
»Du kennst den Kerl?«, flüsterte Scott, obwohl sich der Polizist bereits wieder außer Hörweite befand.
Ich schüttelte den Kopf.
»Es ist arschkalt hier draußen.« Peter zog den Reißverschluss seiner Jacke zu und pustete in seine Fäuste. »Was machen die da überhaupt? Was ist da drüben los?«
Ich zuckte die Schultern. Erst jetzt fielen mir die leisen, blechernen Töne von Metallica auf, die aus den Kopfhörern um Scotts Hals drangen.
Scott Steeple machte seinem Nachnamen alle Ehre – er war groß, schlank und hatte von Natur aus einen fast schon athletischen Körperbau, um den ihn viele beneideten. Er hatte feine Gesichtszüge, war gutaussehend, sein Blick introspektiv und doch aufmerksam. Scott war vor einem Monat fünfzehn geworden und somit der Jüngste unserer Truppe. Eigentlich hätte er in der Klasse unter uns sein sollen, doch sein helles Köpfchen hatte es ihm damals ermöglicht, die zweite Klasse zu überspringen, und so hatte ihn das Schicksal in Mrs. Brocks dritter Klasse an den leeren Tisch neben mich gesetzt, woraus dann schließlich unsere Freundschaft entstanden war.
»Kommt ihr heute Abend mit zu den Docks runter?«, wollte Peter wissen, der mit den Händen in den Hosentaschen langsam auf und ab ging. Hin und wieder blieb er kurz stehen, um auf einem Fuß zu balancieren, während der andere ein paar Zentimeter über dem Boden kreiste.
»Denke schon«, meinte Scott.
»Angie?«
»Weiß ich nicht, Mann«, entgegnete ich ihm. »Wann wollt ihr denn los?«
»Vielleicht so gegen neun.«
»Schätze mal, das hängt davon ab, ob mein Dad zu Hause ist oder nicht. Ich habe doch diese neueAusgehsperreaufs Auge gedrückt bekommen.«
»Aber es ist Freitag!«, wandte Peter entrüstet ein.
»Du kennst doch meinen Dad.« Grundsätzlich durfte ich an Wochenenden bis dreiundzwanzig Uhr außer Haus, doch seit den Fällen verschwundener Jugendlicher in unserer Stadt hatte mein Vater mein Ausgehlimit um eine Stunde zurückgeschraubt. Wenn sich die Jungs also um neun treffen wollten, blieb mir herzlich wenig Zeit, um noch etwas mit ihnen abzuhängen. Ich fragte mich, ob es die ganze Sache wert sein würde.
Peter blickte mürrisch drein. »Alter, dumusstkommen. Sugarland wird diese dumme Kuh versenken, schon vergessen?«
»Ja, ich weiß.«
»Seht mal«, unterbrach uns Scott und trat einen Schritt vom Gehsteig hinunter. »Sie kommen hoch.«
Weitere Köpfe tauchten hinter der Böschung auf, und mich überkam plötzlich ein gemischtes Gefühl von Aufregung und Beklemmung. Die Officers an der Spitze der Gruppe waren die Einzigen, von denen eine Art Dringlichkeit ausging; sie führten den Rest eilig an und verteilten sich entlang der Counterpoint Lane, vermutlich um sicherzustellen, dass keine Verkehrsteilnehmer die Straßensperre missachteten. Zwei von ihnen drehten synchron ihre Köpfe direkt in unsere Richtung und sahen meine Freunde und mich kerzengerade an. Falls sie in Betracht zogen, uns fortzuscheuchen, so wurde ihnen von der dazukommenden Flut von Officers, die nun so zahlreich auf dem Plan waren, dass ich sie nicht alle hätte zählen können, ohne dabei den Faden zu verlieren, ein Strich durch dieses Vorhaben gemacht.
Ein paar der Männer trugen monochrome Anzüge und schmale schwarze Krawatten. Detectives. Einmal mehr fragte ich mich, nicht ohne eine gewisse Beklommenheit, ob wohl mein Vater auch unter ihnen war.
»Was …?« Peter tat einen weiteren Schritt in ihre Richtung, doch wir waren immer noch zu weit entfernt, als dass wir irgendwelche wichtigen Details hätten mitbekommen können. »Was tragen die da? Siehst du es, Angie?«
»Ja«, antwortete ich. »Sehe ich.«
Es war lang und weiß. Es war ein Tuch. Es war ein Tuch, das etwas bedeckte. Mir wurde flau im Magen. Ich hatte genug ferngesehen, um zu erkennen, was ich da vor Augen hatte.
»Oh, heilige Scheiße«, fluchte Peter mit zittriger Stimme. »Das ist ein Mensch.«
Die Leiche wurde auf einer Stahltrage mit eingeklappten Füßen getragen und von einem einfachen weißen Tuch bedeckt, das teilweise an der Trage angebunden war. Einer der uniformierten Officers hielt eine Hand auf die Mitte des Tuches gedrückt, um zu vermeiden, dass der Wind es trotz der Befestigung aufbauschen konnte.
Eine Leiche.
Sie brachten die Trage auf die uns abgewandte Seite des Krankenwagens und verschwanden somit kurz aus unserer Sicht. Als sie am Heck des Krankenwagens wieder zum Vorschein kamen, hatten sie ihre Positionen getauscht.
Nicht in der Lage, meinen Blick von der Szenerie loszureißen, bemerkte ich, dass der Officer, der seine Hand auf das Tuch gehalten hatte, nicht mehr dort war – und als hätte meine Beobachtung direkt den Zorn des Schicksals provoziert, fegte eine eisige Windböe über die Böschung, knisterte durch die Bäume wie durch Geschenkfolie und wirbelte Sand und tote Blätter auf.
Eine Seite des Stoffes blähte sich im Wind wie ein gewaltiges Schiffssegel. Plötzlich stülpte sich die lose Ecke des Tuches um und entblößte das ausgemergelte, gräuliche Profil einer Frau mit einem nassen, verfilzten Geflecht aus schwarzen Haaren und Laub auf dem Kopf. Angedeutet sah man einen geprellten Arm, die Rippen, die sich an ihrer Seite deutlich abzeichneten, und die Wölbung einer winzigen weißen Brust.
Es war die erste Leiche, die ich jemals gesehen hatte, und seltsam irreal. Die Unmengen von Kunstblut und Eingeweiden, die sich meine Freunde und ich jedes Wochenende in Form von seichten Horrorfilmen im Juniper reinzogen, fühlten sich irgendwie wesentlich authentischer als all das hier an.
Der Kopf war leicht nach links geneigt und ich sah etwas, das man nur als blutige Delle in der rechten Seite ihres Kopfes beschreiben konnte. Diese Seite sah wie eingedrückt aus und das rechte Auge blinzelte gerade so unter der unnatürlichen Einbuchtung ihres Schädels hervor.
»Heilige Scheiße«, entfuhr es Scott. Offensichtlich hatte er es auch gesehen.
Die Sanitäter hatten alle Mühe, den Körper wieder zu bedecken. Sie überstürzten jedoch ihr Vorhaben und machten sich hektisch nestelnd am Tuch zu schaffen. Eine Sekunde lang sah es fast schon nach Tauziehen aus, bevor sie den Stoff schließlich wieder über den Kopf des toten Mädchens drapiert bekamen. Einer der Polizeibeamten steckte das Tuch, um es zusätzlich zu fixieren, sicherheitshalber unter ihr fest.
Zu meiner Linken starrte Scott über die Straße und seine Kopfhörer lieferten eine eher unpassende musikalische Untermalung der Situation, die sich vor unseren Augen abspielte. Peter stand, die Hände in die zu engen Hosentaschen seiner Jeans gezwängt, knapp vor uns, und die Seiten seiner Jacke schlugen im aufziehenden Wind. Auch er hatte es gesehen.
Niemand sagte auch nur ein einziges Wort. Wir verfolgten, wie sie den Leichnam in den Krankenwagen luden. Alle Beteiligten bewegten sich mit einer derart unglaublichen Gemächlichkeit, dass es schon unangemessen schien. Der Fund einer Leiche im Wald sollte doch nicht Anlass zu solch einer Trägheit geben. Das konnte nicht echt sein – nichts davon!
»Der Piper«, flüsterte Scott verschwörerisch.
»Nein.« Ich konnte immer noch nichts von all dem fassen. Das Gesicht des toten Mädchens ging mir nicht mehr aus dem Kopf und ich befürchtete, es würde in der Nacht meine Träume heimsuchen. »Sie haben die Opfer des Pipers nie gefunden. Und überhaupt, vielleicht gibt es ja nicht mal einen Piper.«
»Es gibt einen Piper«, widersprach Scott mit unerschütterlicher Bestimmtheit.
»Glaubt ihr, es ist jemand, den wir kennen?«, fragte Peter. »Habt ihr von irgendwelchen weiteren Vermissten gehört?«
Ich schüttelte den Kopf, doch er nahm mich nicht wahr, da er den Sanitätern dabei zusah, wie sie den Krankenwagen anließen.
Eine Rauchwolke stieß aus dem Auspuff und ich wartete darauf, dass die Sirenen einsetzten, doch sie taten es nicht. Natürlich nicht. Warum sollten sie auch? Welchen Anlass zur Eile sollte es jetzt noch geben? Aus irgendeinem Grund jedoch wollte ich, dass sie sich beeilten. Es kam mir gegenüber der Person unter diesem Tuch, wer auch immer sie sein mochte, pietätlos vor, dass diese Polizisten und Sanitäter nur so gemächlich handelten.
»Konntet ihr einen Blick darauf werfen?«, fragte Peter weiter. »Hast du sie erkannt, Angie?«
»Ich glaube nicht. Schwer zu sagen. Ihr Gesicht war nicht …« Doch ich musste den Satz erst gar nicht zu Ende bringen. Ihr Gesicht war zertrümmert gewesen und Peter und Scott hatten es genauso klar und deutlich gesehen wie ich selbst.
»Ich frage mich, ob sie jemand aus der Schule war«, überlegte Peter und drehte sich schließlich zu uns um. Seine Wangen waren rot von der Kälte und seine Augen glänzten. »Denkt ihr, sie könnte auch auf die Stanton gegangen sein?«
»Ich habe von niemandem gehört, der sonst noch vermisst wird«, berichtete ich.
»Sie war noch jung«, meinte Scott. Ich bemerkte einen Anflug von Zweifel in seiner Stimme. »Keine Erwachsene meine ich. Habt ihr sie gesehen?«
»Ja«, entgegnete ich. »Hab ich! Hab ich!«
»Sie könnte in Stanton gewesen sein«, meinte Peter. »Ich habe sie zwar nicht erkannt, aber es könnte durchaus möglich sein …«
Die Blicke zu vieler Cops waren nun auf uns gerichtet. Nach all dem Tumult waren wir nicht mehr länger nur neugierige Schaulustige. In unseren Leinenparkas mit Nirvana- und Metallica-Aufnähern an den Ärmeln mussten wir vielmehr wie halbstarke Unruhestifter aussehen.
»Lasst uns abhauen«, beschloss ich.
Wir trotteten die Counterpoint gegen den Wind hinunter. Das Treffen heute Abend unten bei den Docks sausen zu lassen, war vielleicht gar keine schlechte Idee. Allein die Vorstellung des eiskalten Windes, der über das schwarze Wasser der Chesapeake Bay hereinpeitschte, reichte, um etwas tief in meiner Körpermitte zusammenkrampfen zu lassen.
Diese eingestoßene Seite des Kopfes, diese widernatürliche Einwölbung ihrer rechten Gesichtshälfte. Habe ich das alles wirklich gesehen?
Ich schauderte.
In kollektivem Schweigen suchten wir in einem Bushaltestellenhäuschen am Ende des Blocks Schutz vor der Kälte. Scott wechselte die Kassetten in seinem Walkman und Peter ließ eine Runde neuer Zigaretten herumgehen. Rauchend beobachteten wir den Verkehr auf dem Governor Highway. Die zwei- und dreistöckigen Betonbauten auf der anderen Straßenseite sahen im grauen und allmählich nachlassenden Licht des Nachmittags wie Bleistiftzeichnungen aus. Bunte Vinylfahnen flatterten über dem halbleeren, mit Schlaglöchern übersäten Parkplatz des örtlichen Gebrauchtwagenhändlers OK Used Kars.
Weiter die Straße hinunter gingen abrupt die Lichter in der Bagel Boutique aus, die ihr Geschäft für den Tag beendete. Vergangenen Sommer hatte ich dort gearbeitet. Jeden Tag um vier Uhr früh hatte ich mich aus dem Bett schleifen müssen, nur um Teig zu Ringen zu formen, diese dann in einen Kessel mit kochendem Wasser zu geben und danach die kurz angekochten Bagels bei etwa dreihundert Grad in den Ofen zu schieben. Obwohl ich dabei immer Handschuhe getragen hatte, war die Hitze so stark gewesen, dass sich meine Fingernägel an den Spitzen vom Nagelbett gelöst hatten. Eine unmenschliche Angelegenheit – besonders für einen Faulpelz wie mich.
»Was denkt ihr, ist mit ihr passiert?«, fragte Scott. »Irgendjemand hat ihr das angetan. Irgendjemand hat sie umgebracht.«
»Vielleicht war es Lucas Brisbee«, mutmaßte Peter.
»Wer ist das?«, wollte ich wissen.
»Du hast noch nichts von Lucas Brisbee gehört?« Peter betrachtete prüfend die glühende Spitze seiner Zigarette, während seine Augen vom Wind tränten.
»Ich schon«, sagte Scott.
Ich lehnte mich gegen die Seitenwand des Bushäuschens. »Wer ist Lucas Brisbee?«, fragte ich noch einmal.
»Amanda Brisbees großer Bruder«, erklärte Peter. »Er hat vor etwa fünf Jahren seinen Abschluss in Stanton gemacht. Du kennst doch Amanda, oder?«
»Klar«, meinte ich. Amanda Brisbee war eine Klasse unter uns. Sie war in ihrem ersten Jahr im Feldhockey-Team der Mädchen gewesen, bis sie sich ihre Haare an einer Kopfhälfte abrasierte, anfing, sich die Nägel schwarz zu lackieren, und mit den falschen Leuten abhing. Ich kannte sie hauptsächlich über gemeinsame Bekanntschaften – ich war zufällig mit den falschen Leuten befreundet –, jedoch wechselten wir nie ein Wort.
»Dann spitzt mal die Lauscher«, leitete Peter ein, und seinem leichten Grinsen nach zu schließen, freute er sich schon darauf, die Story an den Mann zu bringen. »Vergangenen Monat hatte Lucas immer wieder unseren Geschichtsunterricht besucht, um uns vom Golfkrieg zu berichten. Er kam jeden Mittwoch in seinem Camouflage-Overall-Dingens vorbei, um darüber zu erzählen, wie es drüben im Irak so war.«
»Er war auch einmal in Mrs. Burstroms Stunde da«, fiel Scott mit ins Gespräch. »Das war vielleicht bizarr. Er trug einen dieser Helme, wie die Typen inM*A*S*H, und man konnte sehen, wie er sich in dem Ding förmlich zu Tode schwitzte.«
»Auf jeden Fall«, fuhr Peter fort, »tauchte er anscheinend diesen Mittwoch pünktlich wie immer auf, und marschierte in voller Montur vom Parkplatz der Zwölftklässler aus über das Football-Feld. Nur hatte er dieses Mal sein Gewehr über der Schulter hängen.«
»Ach hör schon auf!«, tat ich ungläubig ab.
»Das ist mein voller Ernst.«
»Schwör bei Gott«, klinkte sich Scott mit ein.
»Mr. Gregg war mit einer Sportklasse draußen, als es passierte«, erzählte Peter weiter. »Er befahl allen, zurück ins Gebäude zu gehen, dann sprach er mit Lucas. Die ganze Sache endete in einem Streit und Mr. Gregg musste ihn tatsächlich niederringen. Ein paar Cops tauchten auf und schafften den Kerl weg.«
»Woher weißt du das alles?«, fragte ich ihn.
»Jen und Michelle Wyatt. Sie waren in der Sportgruppe und sahen Lucas, als er über das Football-Feld gegangen kam, bevor Gregg sie hineinschickte. Sie sagten, dass sie das Gewehr auf seinem Rücken hatten sehen können und dass er auf sie zugestiefelt war wie ein Nazi.«
»Das ist doch gelogen«, sagte ich und ließ meinen Blick über die Straße wandern.
Eine kühle Dunkelheit hatte sich über die Stadt gelegt. Straßenlaternen gingen an. Die Schaufenster auf der anderen Straßenseite leuchteten wie kleine elektrische Rechtecke. Ich beobachtete die Rücklichter einer Reihe Autos, die an der nächsten Kreuzung am Fuß einer Ampel warteten.
»Zum Teufel, das ist nicht gelogen!«, bekräftigte Peter.
»Ich hätte in den Nachrichten davon gehört«, hielt ich weiter dagegen. »Oder zumindest von meinem Dad.«
Peter zuckte mit den Schultern. »Erzählt dein Dad dir alles? Und überhaupt, vielleicht wurde Brisbee bisher einfach noch nicht angeklagt oder so.«
»Vielleicht war die Waffe ja nicht geladen«, spekulierte Scott.
»Das Schrägste an der ganzen Sache ist: Offensichtlich hat er nie auch nur einen Fuß in den Irak gesetzt«, schloss Peter. »Der Freak war überhaupt nicht einmal dem verdammten Militär beigetreten. Seit seinem Abschluss hatte er drüben in Woodlawn als Mechaniker gearbeitet – Reifen und Öl gewechselt und den ganzen Scheiß. Der Schweinepriester hat das Ganze nur erfunden.«
»Ach komm schon«, entgegnete ich.
»Nein, das stimmt«, fügte Scott nickend hinzu. »Ich hab es auch gehört.«
»Ist das alles noch zu fassen?«, wandte Peter sich von uns ab. Er hatte seine Zigarette bis zum Filter heruntergeraucht. »Ein Kerl hat nicht mehr alle Nadeln an der Tanne und hält einen ganzen Monat lang Vorträge an unserer Highschool.«
Ein Auto fuhr rasch vorbei und hupte uns zu. Den Fahrer konnte ich nicht erkennen.
»Vielleicht hat sie ja auch gar niemand umgebracht. Vielleicht war es nur ein Unfall.« Doch schon während ich diese Worte sprach, glaubte ich kein einziges davon. Vor meinem geistigen Auge sah ich immer noch ihren eingeschlagenen Schädel und den fahlen, fischbauchfarbenen Ton ihrer Haut.
»So wird es wohl sein«, stimmte mir Peter zwar zu, klang selbst aber auch nicht gerade überzeugt davon.
Scott warf einen Blick auf seine Uhr. »Wird langsam spät.«
»Ja.« Peter schnippte seinen Zigarettenstummel auf den Boden.
Ich stellte meinen Jackenkragen auf. »Also, bis dann Jungs. Ich muss für meine Großmutter noch ein paar Besorgungen machen.«
»Sollen wir mitkommen?«
»Nein, schon in Ordnung. Trotzdem danke.«
»Hey!« Peter kniff mich in den Unterarm. »Du kommst heute Abend, klar?«
Ich seufzte.
»Vielleicht gibt dir dein Dad ja ne kleine Verlängerung«, meinte er. »Ist ja nicht so, als würden wir die ganze Nacht fort sein.«
»Das wird lustig«, versprach Scott.
Ich schob meine Hände in die Taschen. »Mal sehen.«
»Cool.« Peter grinste mich an. Dann drehte er sich um und schob Scott auf den Gehweg. Sie warteten auf eine Verkehrslücke, bevor sie eilig über den Governor Highway liefen. Ich verlor sie aus den Augen, als sie im Schatten eines unbeleuchteten Parkplatzes verschwanden.
Ich bewegte mich parallel zur Straße, bis ich an die Fußgängerkreuzung kam und darauf wartete, dass die Ampeln umschalteten. Pastore’s Deli war ein kleiner familienbetriebener Lebensmittelladen am Ende einer Ladenzeile. Er befand sich auf der anderen Straßenseite gegenüber des Generous Superstore, dem bombastischen Einkaufszentrum mit dem Slogan Komfort ist König!Trotzdem war meine Großmutter schon seit meiner Kindheit Stammkundin bei Pastore’s und ich erinnerte mich nur zu gerne zurück an Mr. Pastore, wie er mich mit Boar’s-Head-Wurstscheiben und Stinkekäsestückchen fütterte, während meine Großmutter ihren Einkauf erledigte.
Für gewöhnlich war er recht menschenleer, doch an diesem Abend bemerkte ich einen leichten Tumult vor dem Laden. Mehrere Erwachsene standen bei ihren Autos auf dem Parkplatz und unterhielten sich angeregt. Mit gesenktem Kopf schob ich mich an ihnen vorbei und betrat den Laden.
»Hallo, Angelo.« Mr. Pastore linste mich über die Zweistärkenbrille hinweg an, die er auf seiner Nasenspitze sitzen hatte. Er war ein dunkelhäutiger älterer Herr mit weißen Haarbüscheln über den Ohren. Vor dem Tresen stand ein Mann, den ich nicht kannte, und es schien, als hatte meine Ankunft ihre Unterhaltung gestört.
»Hi, Mr. Pastore«, grüßte ich ihn zurück und zog den Reißverschluss meiner Jacke auf. In dem kleinen Laden herrschte eine Bullenhitze wegen eines zu hoch aufgedrehten Heizgerätes über der Ladentür.
Am hinteren Ende des Ladens holte ich einen Leib vorgeschnittenes italienisches Brot und widmete mich dann dem Süßwarenregal, das die Wand säumte. Pastore’s hatte immer die besten Süßigkeiten – das Zeug, das man anderswo sonst nur schwer auftreiben konnte: Astro Pops, große Sugar Daddies, Fruchtgummischnüre und schwarze Lakritz-Drops, Jujubes, Candy Buttons auf weißen Papierstreifen, Fruchtgummilippen, Gummifläschchen mit flüssiger Füllung, Traubenzuckerflöten, Erdnusskrokant, Ocean-City-Kaubonbons und exotische Jelly Beans. Nach einiger Überlegung fiel meine Wahl schließlich auf einen großen Sugar Daddy und eine Packung Trident-Kaugummi, um meinen Raucheratem zu überdecken.
Ich ging zum Tresen, wo Mr. Pastore wie üblich bereits den Rest der Bestellung meiner Großmutter vorbereitet hatte.
Er unterhielt sich mit gedämpfter Stimme mit dem Unbekannten. Zwischenzeitlich blickte er mich einmal flüchtig über die Schulter des Mannes hinweg an und lächelte gezwungen.
Der Mann, der einen marineblauen Pullover und eine Chinohose trug, trat zur Seite, damit ich das Brot und die Süßigkeiten auf den Tresen legen konnte.
Mr. Pastore zwinkerte mir zu, dann fischte er unter der Theke herum und holte mehrere Packungen in Wachspapier gewickelten Aufschnitt hervor. »Ich habe imCallergelesen, dass du den ersten Platz bei ihrem Wettbewerb im kreativen Schreiben belegt hast«, sagte er, während er die Waren in die Kasse eintippte. »Das ist echt klasse, Angelo. Gratuliere.«
»Danke.«
»Wird die Siegergeschichte veröffentlicht?«
»Naja, so hatte es anfänglich zumindest geheißen, danach meinten sie aber, die Geschichte sei zu lang«, erklärte ich. »Aber sie haben mir einen Scheck über fünfzig Mäuse zugeschickt.«
»Fantastisch!« Mr. Pastore schob sich seine Brille den Nasenrücken hoch und las die Gesamtsumme von der Kasse ab.
Ich reichte ihm zwanzig Dollar und wartete auf mein Wechselgeld.
Der Mann in dem marineblauen Pullover neben mir tappte nervös mit dem Fuß auf den Boden. Ich drehte mich um und sah ihn an. Unsere Blicke trafen sich. Er hatte kleine dunkle Augen, die ebenso nervös schienen, wie sein tappender Fuß sich anhörte. Eine Sekunde später wandte er sich ab.
KAPITEL ZWEI
Die Shallows
Als ich nach Hause kam, war es bereits dunkel. Im alten Dunbar-Haus nebenan brannte Licht und ein Auto parkte in der Einfahrt. Die neuen Nachbarn waren vor ein paar Tagen eingetroffen, aber ich war noch keinem von ihnen begegnet. Bislang hatte ich auch noch keinen Umzugswagen vor dem Haus gesehen, also nahm ich an, dass sie wohl noch immer nicht vollständig eingezogen waren.
Mein Vater hätte an diesem Abend eigentlich frei haben sollen, doch sein Zivilstreifenwagen stand nicht in der Einfahrt und ich fragte mich, ob er wohl wegen des toten Mädchens trotzdem arbeiten musste. Bevor ich ins Haus ging, klopfte ich mir den Schmutz von meinen Sneakers am Türpfosten des Cape-Cod-Hauses ab, in dem ich schon mein ganzes Leben lang wohnte.
Als ich die Haustür öffnete und eintrat, wurde ich von einem Schwall warmer Luft und dem einladenden Aroma der Pasta Fagioli meiner Großmutter, die auf dem Herd simmerten, begrüßt. In ein mit dem Duft italienischer Küche erfülltes Haus zu kommen, hatte etwas unheimlich Behagliches an sich. In der Diele trat ich mir achtlos die Sneakers von den Füßen und spürte ein Kribbeln in den Lippen und Fingerspitzen, die sich allmählich aufzuwärmen begannen.
Ich ging den Flur entlang und steckte den Kopf ins Wohnzimmer, um nach meinem Großvater zu sehen, der, eingetaucht in den flimmernden blauen Schein des Fernsehers, friedlich in seinem Wohlfühlsessel vor sich hinschlummerte.
In der Küche legte ich die Einkäufe auf den Tisch, ließ mir meine Jacke von den Schultern rutschen und hängte sie über eine Stuhllehne. Meine Großmutter stand vor dem Herd, dirigierte ein Orchester aus dampfenden, sprudelnden Töpfen und Pfannen, und sah in ihrem geblümten Schürzenkleid wie eine Tapete aus. Ihr silbernes Haar war streng zu diesem typischen stahlfarbenen Dutt zurückgebunden, der bei Frauen über fünfundsechzig äußerst beliebt war und nie aus der Mode zu kommen schien.
»Wo ist Dad?«, erkundigte ich mich.
»Na«, tadelte meine Großmutter, »das nenne ich ja mal eine feine Begrüßung.«
»Tut mir leid.« Im Vorbeigehen zum Kühlschrank gab ich ihr einen Kuss auf die Wange. »Riecht lecker.«
»Schläft dein Großvater?«
»Er sieht fern«, flunkerte ich.
»Schläft …«, murmelte sie mehr zu sich selbst. »Dann wälzt er sich wieder die ganze Nacht wach im Bett hin und her.«
Ich öffnete mir zischend eine Dose Pepsi und erntete dabei einen missbilligenden Blick von meiner Großmutter. Aus welchem Grund auch immer und mit keinerlei Belegen, um ihre Hypothese zu untermauern, war sie felsenfest davon überzeugt, dass alle Softdrinks krebserregend seien. »Also, wo ist Dad nun?«
»Er hat einen Anruf bekommen.«
»Wegen eines Mädchens?«
»Eines Mädchens?«
»Arbeitstechnisch.«
»Er erzählt mir ja nichts, mein lieber Herr Sohn. Und Gott bewahre, ich werde mich auch nicht nach seiner Arbeit erkundigen.« Sie rührte die Pasta Fagioli mit einem großen hölzernen Kochlöffel um. Der Topf war fast so groß wie ein Kessel. Daneben brutzelten und zischten Hühnchenschnitzel in einer Pfanne mit Pflanzenöl. »Was für ein Mädchen meintest du da gerade?«
»Die Cops haben hinter der Counterpoint Lane ein Mädchen im Wald gefunden. Die Jungs und ich haben es auf dem Heimweg von der Schule gesehen.«
»Sie hatte sich verlaufen?«
»Sie war tot.«
»Oh, Madonn’!« Betroffen legte sie ihren Löffel auf einem Ofenhandschuh ab. »Was ist passiert?«
»Keine Ahnung. Vielleicht irgendein Unfall.« Doch ich wusste genau, dass es kein Unfall hatte sein können – gemessen daran, dass sie nackt gewesen war, und an ihrem säuerlichen Gesichtsausdruck unter diesem Tuch; und an der Tatsache, dass ihr Kopf eingeschlagen war. Zum ersten Mal fragte ich mich, wie lange sie wohl schon dort im Wald gelegen hatte, bevor die Polizei sie fand. »War sie hier aus der Gegend?«, wollte meine Großmutter wissen.
»Ich weiß nicht, wer sie ist … oder war …«, korrigierte ich mich.
»Wie entsetzlich.«
»Hat Dad irgendetwas gesagt, wann er heute Abend nach Hause kommt?«
»Wie ich gerade schon sagte, der Mann erzählt mir einfach nichts. Aber nun geh dir vor dem Abendessen noch kurz die Hände waschen, ja? Und wecke bitte deinen Großvater auf – er ist schon wieder vor dem Fernseher eingeschlafen. Ich weiß es genau. Du brauchst für ihn nicht zu schwindeln.«
Wir aßen, begleitet vom Gezeter meines Großvaters, der schon, seit ich denken konnte, an allem und jedem auf diesem Planeten etwas auszusetzen hatte. In letzter Zeit war es schon so schlimm geworden, dass ihm meine Großmutter verboten hatte, sich die Fernsehnachrichten anzusehen oder eine Zeitung zu lesen, da die Ungerechtigkeiten, über die darin täglich berichtet wurde, genug waren, um den alten Mann zu einem ausschweifenden Monolog von derart kreativer Obszönität zu bewegen, dass er ein ganzes Regiment von Hafenarbeitern zum Mitschreiben inspiriert hätte.
Im August 1990, nachdem Präsident Bush amerikanische Truppen nach Saudi-Arabien entsandt hatte – darunter mein großer Bruder Charles – hatte mein Großvater noch einmal seine eigenen Memorabilien aus dem Zweiten Weltkrieg durchstöbert. Unsere Familie machte Scherze über seinen Entschluss, sich im Alter von achtundsiebzig Jahren neben meinem Bruder verpflichten zu wollen.
Unter den gesammelten Gegenständen aus seiner Militärzeit im Südpazifik fanden sich neben anderen Dingen mehrere Schächtelchen mit Orden und Medaillen, ein Aschenbecher aus Patronenhülsen verschiedener Größen, zusammengesetzt zu einer Miniaturnachbildung einer B-29 Superfortress, und, das wohl eindrucksvollste Stück der Sammlung, ein Samuraischwert, das mein Großvater der Leiche eines japanischen Soldaten abgenommen hatte, der in Neuguinea gefallen war.
»Ich habe ihn direkt aus dem Baum geschossen«, hatte mir mein Großvater mehr als nur einmal geschildert, »und dieses Schwert fiel mit ihm. Es steckte mit der Klinge voran im Erdboden und federte dort nach wie eine Stimmgabel.«
Es war ein imposantes, stattliches Schwert, das nur so glänzte. Bunte Edelsteine waren in das Heft eingesetzt und die filigrane Insigne eines Drachen mit Tigerkopf in die Schwertscheide geätzt.
Nach dem Krieg hatte mein Großvater über mehrere Jahre hinweg immer wieder ein Schreiben nach dem anderen von einem Anwalt aus New York erhalten, den mein Großvater prompt als »Juristenschleimer« abstempelte und welcher die Familie Takahashi bei ihrem mehrfachen Gesuch um die Rückgabe des Schwertes an die Familie des toten japanischen Soldaten vertrat. Es war ein Familienerbstück, und die Takahashis wollten bereitwillig jedweder Preisforderung nachkommen, nur damit das Schwert sicher und unbeschadet auch wieder in den Besitz der Familie zurückkehren konnte. Ich hatte die Briefe selbst gesehen, sie waren auf dem exklusiven Briefpapier einer Kanzlei mit Absenderadresse aus Manhattan verfasst und höflich und wohlwollend gegenüber meinem Großvater formuliert. Doch mein Großvater hatte sich geweigert, sich ihre Angebote auch nur ansatzweise durch den Kopf gehen zu lassen.
Nachdem sie sich schließlich der Tatsache gebeugt hatten, dass mein Großvater ein sturer alter Esel war, bekam er noch einen allerletzten Brief von der Familie Takahashi. Ich hatte den Brief auch gelesen. Alles, was darin stand, waren die Hinweise und Anleitung für die sachgemäße Reinigung, Aufbewahrung und Pflege des Samuraischwertes. Wenn sie es schon nicht zurückbekamen, dann würden sie wenigstens sicherstellen, dass man es ordentlich behandelte.
Doch es war nicht das Schwert oder gleichermaßen interessante Gegenstände, die mein Großvater an diesem Tag im August in der Garage ausgrub. Was er hervorholte, war ein abgegriffenes Fotoalbum mit Ledereinband, das von Gummibändern zusammengehalten wurde. Es war voller Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus dem Krieg und dem Jahr, das er als Strandwächter in Australien verbracht hatte. Er ging mit dem Album in den Vorgarten, zerriss die Fotografien und ließ sie wie Konfetti in eine der Metallmülltonnen rieseln.
Zu dieser Zeit und in meiner Naivität versuchte ich, diesem einfachen Akt irgendeine größere symbolische Bedeutung zuzuschreiben, doch kam ich beim besten Willen nicht darauf, was es hätte sein können. Ich konnte einfach nicht umhin, meinen Großvater zu fragen, weshalb er seine Fotografien vernichtet hatte. Mit der Nüchternheit eines Mathematikers gab er mir zur Antwort, dass ihn die Berichterstattungen über die zunehmenden Spannungen im Mittleren Osten jeden Abend in den Nachrichten lediglich daran erinnerten, dass er noch einen Haufen alten Krempel in der Garage herumliegen hatte und es schon längst höchste Zeit war, all das Zeug loszuwerden. Das Ganze war also nicht symbolträchtiger gewesen als ein Frühjahrsputz.
Wir saßen beim Abendessen am Küchentisch, während der Fernseher im Wohnzimmer weiter vor sich hinbrabbelte. Meine Großmutter hatte die Vorhänge der Küchenfenster aufgezogen für den Fall, dass mein Vater von der Arbeit nach Hause kam. Für gewöhnlich lief es so ab, dass meine Großmutter, sobald sie die Scheinwerfer seines Wagens in die Einfahrt biegen sah, aufstand, meinem Vater das Essen auf den Teller gab und diesen in perfektem Timing mit dem Geräusch der aufgesperrten Haustür auf den Tisch stellte. Mein Vater wusch sich dann immer die Hände in der Küchenspüle und setzte sich noch in Hemd und Krawatte an den Tisch, um mit uns zu Abend zu essen.
Da mein Vater an solchen Abenden wie diesem, wenn er zu einem Einsatz gerufen wurde, jedoch nur selten vor Tagesanbruch nach Hause kam, würde er dieses Mal auch nicht rechtzeitig zum Abendessen erscheinen, doch die Vorhänge blieben zur Seite geschoben und meine Großmutter weiter wachsam, da sie niemand war, der so einfach mit einer Tradition brach.
»Wie war es in der Schule?«, erkundigte sie sich.
»Ganz okay.«
»Nichts Interessantes zu erzählen?«
Da nie auch nur ansatzweise irgendetwas Interessantes passierte, erzählte ich also Peters Geschichte über Lucas Brisbee, der mit Uniform und Gewehr in unsere Schule gekommen war und dann von einem Sportlehrer auf dem Schulparkplatz hatte überwältigt werden müssen.
Meine Großmutter schüttelte fassungslos den Kopf. »Wer macht denn so etwas?«
»So was passiert doch ständig, Flo«, tat mein Großvater ab. »Das ist nichts Neues. Man hört nur noch von Jugendlichen, die Waffen mit zur Schule nehmen, in den Klassenzimmern herumballern und Bomben in ihren Garagen bauen.«
»So war es auch wieder nicht«, wandte ich ein.
»Behauptet wahrscheinlich, er würde unter einem Kriegstrauma leiden«, spöttelte mein Großvater.
»Aber er war doch nicht einmal im Krieg! Das ist ja gerade das Ding an der ganzen Geschichte. Er hatte die ganze Zeit drüben in Woodlawn gelebt.« Trotz meiner anfänglichen Skepsis während Peters Erzählung, bemerkte ich nun, dass ich die Geschichte nicht nur mit so viel Spannung und Glaubwürdigkeit, wie ich aufbringen konnte, nacherzählt hatte, sondern sie inzwischen auch noch in jeder Hinsicht selbst glaubte.
»Wie im Vietnam«, fuhr mein Großvater fort, ohne mich weiter zu beachten. »Dieses ganze Agent-Orange-Fiasko. Jeder sucht ständig nach irgendwelchen Ausflüchten, danach, die Schuld für die eigenen Probleme bei anderen zu suchen. Denkt ihr, es gab damals im Südpazifik nicht genug, über das man sich hätte beschweren können? Beschwere ich mich etwa? Und wenn man nicht dem Krieg die Schuld geben kann, dann sucht man sie eben bei den eigenen Eltern, der Erziehung – oder der Musik, die man hört.«
»Aber er war doch gar nicht im Krieg!«, wiederholte ich nachdrücklich. »Er …«
»Wer?« Mein Großvater zog seine buschigen Augenbrauen zusammen. Er machte ein Gesicht wie jemand, den man mit einer komplexen Rechenaufgabe überrumpelt hatte. »Wen meinst du?«
»Den Typ, der in meine Schule gekommen ist.«
»Was ist das für ein Kerl?«, fragte er, obwohl sich sein Mundwinkel schon zu einem Lächeln kräuselte – er hatte mich also nur aufgezogen.
Ich lachte. »Vergiss es einfach.«
Ein Paar Scheinwerfer kamen die Worth Street entlang, woraufhin meine Großmutter prompt von ihrem Stuhl aufsprang und aus dem Fenster sah. Selbst nachdem es längst offensichtlich war, dass es sich nicht um meinen Vater handelte, beobachtete sie weiter aufmerksam die Straße.
»Ich gehe heute Abend noch ein wenig raus«, verkündete ich schließlich.
»Ja? Wohin denn?«, fragte meine Großmutter.
»Zu Peter.« Es war eine Lüge. Ich mochte meine Großeltern nicht anlügen, doch ich konnte ihnen unmöglich erzählen, dass wir alle runter zu den Docks wollten, um Michael Sugarland dabei zuzusehen, wie er die Homecoming-Kuh versenkte.
»Soll ich dich hinfahren?«, bot mein Großvater an. Er war immer besorgt, wenn ich nachts alleine unterwegs war, sogar schon vor den jüngsten Vermisstenfällen.
»Nein, schon in Ordnung. Ich nehme das Rad.«
Trotz der Tatsache, dass ich bereits fünfzehneinhalb und somit alt genug für meinen Lernführerschein war, hatte mein Vater die alleinige Entscheidung gefällt, dass ich noch immer viel zu wenig Verantwortungsbewusstsein für irgendetwas dergleichen hatte. Ich wusste genau, dass mir noch ein gänzlich neuer Kampf bevorstehen würde, wenn ich erst einmal sechzehn war und meinen richtigen Führerschein machen durfte.
Meine Großmutter nahm eine fertige Kanne Kaffee aus der Maschine und schenkte zwei Tassen ein, während ich meinen Teller zum Spülbecken brachte und meine Hände wusch.
»Zieh dich warm an«, sagte sie. »Es ist kalt draußen.«
»Mach ich.«
»Und bitte«, fügte sie in einem etwas anderen Tonfall noch hinzu, »komm nicht zu spät nach Hause.«
»Werde ich nicht.«
Nachdem ich mich geduscht hatte, schlüpfte ich hastig in eine Jeans, ein Nirvana-T-Shirt und einen Kapuzenpulli. Ich war etwas kleiner als der Durchschnitt und hatte den Körperbau eines Läufers, wenn ich auch nicht unbedingt der geborene Athlet war. Meine Züge waren dunkel und klassisch mediterran – nicht wie ein Filmstar, sondern auf die nachdenkliche Art, die man mit den jugendlichen Kriminellen aus Filmen der 1950er verbindet.
Erwachsene sagten, ich sei äußerst höflich, zuvorkommend und aufmerksam, doch würde ich mein Potential nicht voll ausschöpfen. Sie hielten mich immer für attraktiv, doch das konnte ich nicht nachvollziehen. Meine Nase war viel zu groß, mein Haar steif und wellig, wenn ich es kurz trug, und zum Fetten neigend und widerspenstig, wenn es, so wie momentan, länger war. Ich hatte relativ kleine Hände, und als ich einmal einem Arzt erzählte, dass ich Gitarre spielen konnte, schien dieser sichtlich überrascht zu sein.
Trotz der Tatsache, dass es mir durchaus bewusst war, von einer Reihe vollblütiger Italoamerikaner abzustammen, wäre es mir nie in den Sinn gekommen, dass ich irgendwie anders sein könnte als der Großteil der Kinder in Stanton oder gar Harting Farms – bis letztes Jahr. Die Erkenntnis traf mich kurz vor den Sommerferien, als ich in ein paar Geschäften im Ort vorbeischaute, um Bewerbungen für einen Ferienjob auszufüllen.
In einem Laden in der Canal Street, hatte mich Mr. Berke, der speckbäuchige Inhaber mit seinem faltenzerfurchten Gesicht, gebeten, mit in sein Büro zu kommen, während er meine Bewerbung durchging. Er hatte die ganze Zeit vor sich hingebrummelt und einmal bemerkte ich sogar, wie seine Augenbrauen immer weiter in Richtung seines Haaransatzes wanderten.
»Stimmt irgendwas nicht?«, hatte ich schwitzend vor Nervosität gefragt.
»Oh ja.« Er legte die Bewerbung auf seinen Schreibtisch nieder, der zwischen uns in dem beengten kleinen Büro stand, und deutete auf den Abschnitt zur Nationalitätsangabe. »Du hast das KästchenKaukasischangekreuzt.«
»Bedeutet das denn nichtWeiß?«
»Tut es. Du aber bist Italiener, oder etwa nicht?«
»Also, äh, ja …« Mein Blick wanderte zurück auf das Papier. Gab es wohl ein Kästchen für Italoamerikanisch, das ich übersehen hatte? Doch nein, nichts dergleichen stand zur Auswahl. Als ich wieder zu Mr. Berke hochsah, konnte ich seinen Gesichtsausdruck nicht deuten.
»Dashier bist du«, klopfte er mit dem Finger auf das Kästchen neben dem WortAndere. »Siehst du, du fällst unterAndere.« In seinem Lächeln lag nicht die geringste Spur von Humor und es grub ihm seine Furchen nur noch tiefer ins Gesicht. »Siehst du? Siehst du, wie einfach wir das Problem aus der Welt geschafft haben?«
»Oh«, sagte ich nur.
Als ich eine Woche später noch einmal im Laden vorbeigesehen hatte, um mich nach dem Stand meiner Bewerbung zu erkundigen, bedachte mich Mr. Berke wieder mit demselben humorlosen Lächeln wie schon zuvor und setzte mich darüber in Kenntnis, dass er beschlossen hatte, dieses Jahr überhaupt keine Sommeraushilfe einzustellen. Natürlich glaubte ich ihm anstandslos, weshalb es mich umso mehr verwirrte, als ich Wochen später erfuhr, dass Billy Meyers, der in unserem Hauptklassenzimmer neben mir saß, nun dort arbeitete.
Kurzzeitig hatte ich überlegt, meinem Dad von der ganzen Sache zu berichten, doch mich dann eines Besseren besonnen, da ich mich ohne Zweifel noch unangenehmer dabei gefühlt hätte, meinem Vater die Geschichte zu erzählen, als ich es tat, während ich Mr. Berke gegenüber in seinem muffigen kleinen Büro gesessen hatte. Deshalb ließ ich die ganze Angelegenheit einfach unter den Tisch fallen.
Ich holte meine Nikes aus dem Schrank und schnürte sie mir auf dem Bett zu. Mein Zimmer war meinen Leidenschaften gewidmet; die Wände voller Poster alter Universal-Filmmonster und den modernen Psychopathen, wie Jason Voorhees und Freddy Krueger. Eine Nachtleuchtfigur der Kreatur ausDer Schrecken vom Amazonasstand auf meiner Kommode, umgeben von Star-Wars-Figuren, die sie wie irgendeinen Abgott zu beschützen schienen.
Ein paar Videokassetten stapelten sich unter meinem Nachttisch. Filme wieDer weiße Hai, GremlinsundJäger des verlorenen Schatzesneben ein paar alten Springsteen-Plattenalben und Kassetten. In einer Ecke lehnte eine Fender-Akustikgitarre an der Wand neben einem Poster von John Lennon mit seinem Markenzeichen – der Brille mit den runden Gläsern.
Vor allem jedoch war mein Zimmer das reinste Bücherparadies. Ich hatte jede Menge von Stephen King, Dean Koontz, Robert McCammon, Peter Straub und Ray Bradbury, da Horrorgeschichten meine Favoriten waren. Es fanden sich aber auch nicht wenige Klassiker in der Masse, wie Daniel DefoesRobinson Crusoe, Victor HugosDer Glöckner von Notre-Dame, StokersDracula, Mary ShelleysFrankensteinund eine beachtliche Romansammlung von Robert Louis Stevenson in Festeinband.
Auf meinem Schreibtisch stand eine alte Olympia-De-Luxe-Schreibmaschine, die mit ihrem meeresgrün-ecru-farbenen Metallgehäuse an das zweifarbige Chassis eines 1950er Chevrolets erinnerte. Hin und wieder blieben ein paar Tasten stecken und der Buchstabe O neigte gerne dazu, Löcher in das Papier zu stanzen, falls man etwas zu energisch tippte, doch die De Luxe war mein wertvollster Besitz. Sie bedeutete mir sogar noch mehr als mein Fahrrad.
Sorgfältig neben die Schreibmaschine gelegt, befand sich der jüngste Artikel aus demCaller, der Lokalzeitung von Harting Farms, in dem mein Name als Gewinner ihres Wettbewerbs im kreativen Schreiben in schlichten fetten Lettern gedruckt stand. Mit Büroklammer an den Artikel geheftet hing ein an mich adressierter brauner Umschlag mit einem Scheck über fünfzig Dollar, und neben dem Zeitungsartikel lag meine dreizehn-seitige, einzeilig formatierte Siegergeschichte mit dem Titel: Angeln nach Chessie. Sie handelte von dem Versuch zweier Brüder an der Chesapeake Bay, Chessie, die Chesapeake-Version des Monsters von Loch Ness, zu fangen. Leider glückt der Fang nicht, doch sehen die beiden am Ende der Geschichte die riesigen grauen Buckel des Monsters aus dem Wasser ragen.
Es war eine recht einfache Story und offensichtlich genau, wonach derCallergesucht hatte; doch die Geschichte, die ich eigentlich hatte einreichen wollen, war eine Horrorgeschichte mit dem Titel »Angst«. Darin ging es um einen Jungen, der entdeckte, dass zwischen dem Erdgeschoss und ersten Stock seines Zuhauses eine Parallelwelt existierte. Der Eingang zu dieser anderen Dimension befand sich in einem Wäscheschrank, und der Junge als Protagonist der Geschichte fand heraus, dass dort ein Monster lebte, das diese Welt beherrschte und kleine Kinder aus seiner Nachbarschaft verschlang. Am Ende trat der Junge dem Monster schließlich gegenüber und vernichtete es.
Ich hatte die Geschichte für perfekt gehalten und sie voller Stolz und Erfolgsgefühl meiner Großmutter zum Lesen vorgelegt.
Während sie meinen Schreibstil wirklich gut fand, war sie jedoch der Meinung gewesen, dass derCallersich wohl eher Einsendungen von etwas bekömmlicherer Natur erhoffte. »Mit anderen Worten: Keine toten Kinder«, hatte sie gesagt, was aber keineswegs kritisch, sondern nur wohlwollend gemeint gewesen war.
Meine Schreibtischschubladen waren voller solcher Geschichten über Werwölfe und Vampire, Geister und Kobolde – ein paar davon schamlos von anderen Storys abgekupfert, die ich gelesen hatte, wenngleich ich nur Handlung und Stil nachempfinden wollte, um zu lernen, wie es dem Autor so bemerkenswert gelungen war, den Leser zu fesseln. Andere Geschichten stammten wiederum gänzlich aus meiner Feder – den Untiefen meiner eigenen Kreativität entsprungen. Vergangenes Frühjahr hatte ich mir die neueste Ausgabe desWriter’s Market zugelegt und erst vor kurzem begonnen, Post-it-Zettel auf einige der Seiten zu kleben, die detaillierte Informationen zu Einsendungsrichtlinien für diverse Genre-Zeitschriften enthielten.
Ich wollte nichts sehnlicher, als Schriftsteller werden.
Als ich zum Aufbruch bereit war, hatten sich meine Großeltern bereits ins Wohnzimmer zum Fernsehen zurückgezogen. Ich gab beiden von oben einen Kuss auf den Kopf und schlüpfte dann hinaus in die Nacht. Noch ehe ich das Ende unseres Plattenwegs erreichte, hatte ich mir bereits eine Zigarette zwischen die Lippen geklemmt. Ich fischte mein Dirtbike aus dem dichten Efeuteppich, der sich die Hausseite emporrankte, stieg auf und trat flott in die Pedale, ohne mich auf den Sattel zu setzen.
Es war klirrend kalt. Die Straßen im Wohnviertel waren düster und nur spärlich beleuchtet und fast keine Autos waren unterwegs. Anstatt auf den Straßen zu bleiben, beschloss ich, die Abkürzung zu nehmen. Ich fegte die Einfahrt der Mathersons hinauf, schnitt quer über ihren Rasen und preschte durch eine Gruppe Hemlocktannen, die mächtig und schwarz bedrohlich vor dem Nachthimmel aufragten.
Einen Augenblick später ratterte ich auf einem Pfad durch den Wald und meine Zähne klapperten mit der Vibration meines Rads. Der Wald war nicht allzu dicht hier und ließ gelegentlich die Verandalichter der nahegelegenen Häuser durch das Gebüsch blinzeln, sodass ich mich fühlte wie Magellan, dem die Sterne den Weg zeigten. Ich hatte diese Abkürzung bereits unzählige Male benutzt – meistens nachts – doch sie war jedes Mal anders. Der Wald war ständig in Bewegung, ständig im Wandel.
In flottem Tempo ließ ich die letzten Bäume hinter mir und brauste auf ein offenes Feld, das zwar weitgehend nur aus Buschland und wildwucherndem Wiesenrispengras bestand, doch jemanden auf einem alten Dirtbike mit abgefahrenen Reifen ganz schön ins Kämpfen geraten ließ. Das Feld fiel nach Osten hin langsam in eine kleine, von noch mehr Wald umgebene Senke ab. Ein kleines weißes Farmhaus, das schon solange ich zurückdenken konnte herrenlos war, lag inmitten dieser Senke und wurde in dieser Nacht von einem schweren Nebelschleier verdeckt. Das Einzige, was ich erkennen konnte, war der Schein der einsamen Straßenlaterne am Rand des Anwesens, der wie eine gespenstische gelbe Lichtnadelspitze durch den Nebel stach.
Meine Freunde und ich nannten es Werwolfhaus, weil es genauso aussah, wie die verfallene Landhütte aus einem Werwolf-Film, den wir uns ein paar Jahre zuvor im Juniper angesehen hatten.
Hinter dem Werwolfhaus lag das Butterfield-Gehöft.
Im Winter nach starkem Schneefall tummelten sich auf der Familienfarm der Butterfields immer zahllose Kinder aus der Umgebung, die farbenfrohe Plastikschlitten umherzogen und sich gegenseitig mit eisigen Schneebällen bewarfen. Jetzt in der Herbstzeit aber war der Hof schier überfüllt mit verschiedensten Kürbissen, buntem Mais, Cider in etikettenlosen Plastikflaschen und einer unglaublichen Vielfalt an Obst und Gemüse.
Am hinteren Ende des Anwesens standen Holstein-Rinder – massige, träge Tiere – und wenn man ein paar Büschel Gras abrupfte, konnte man an sie herantreten und durch die Zaunlatten ihrer Weide füttern, wobei ihre lilafarbenen, schleimigen Zungen aus ihren dampfenden Mäulern schleckten und sich wie die Tentakel eines Oktopus um die Halme schlangen. Während sie fraßen, konnte man die Hände auf das glatte Fell ihrer Flanken legen und fühlen, wie die Hitze von ihren Körpern abstrahlte.
Ich trat fester in die Pedale. Die Grashalme peitschten gegen meine Schienbeine und ich hielt das Gesicht gegen den eisigen Wind gesenkt. Die Kälte trieb mir Tränen aus den Augen und durch den Gegenwind liefen sie meine Schläfen entlang, wo sie mir kühl an der Haut trockneten. Als ich das Gräserdickicht überwunden hatte und den schummrigen, natriumfarbenen Schein der Straßenlaternen vor mir durch den sich lichtenden Nebel ausmachte, konnte ich getrost wieder ruhiger treten, ohne befürchten zu müssen, dass sich meine Reifen und die Kette im hohen Gras verfingen und mich mit einem plötzlichen Ruck jäh zum Stehenbleiben zwangen.
Ein Paar Scheinwerfer tauchte in etwa hundert Metern Entfernung zu meiner Linken auf. Kurz darauf hörte ich das keuchende Brummen des Wagens, der sich relativ schnell in meine Richtung bewegte. Zuerst dachte ich mir nichts dabei, denn es war nicht ungewöhnlich, dass jemand, besonders bei Nacht, zum Geländefahren in dieses Feld kam. Stattdessen richtete ich meine Aufmerksamkeit auf die Lichtpunkte der Laternen entlang der Straße vor mir. Das Gras war gefrorenem, holprigem Erdboden gewichen, und es fühlte sich an, als würde ich über den Brustkorb eines gewaltigen Gerippes poltern.
Der Pick-up scherte seitlich aus und ich verlor seine Scheinwerfer aus dem Augenwinkel, konnte aber weiterhin den Motor hören; seltsamerweise aber etwas lauter als noch einen Moment zuvor. Mir wurde erst klar, dass mich der Wagen tatsächlich verfolgte, als sein Scheinwerferlicht meinen Schatten auf den kalten schwarzen Boden vor mir warf und ihn immer länger werden ließ. Ich konnte förmlich die Hitze der Scheinwerfer auf meinem Rücken spüren.
Ich riskierte einen Blick über meine Schulter. Es war wirklich ein Pick-up, und sein Fahrer schien ohne Zweifel nicht hier zu sein, um nur zum Spaß Kreise ins Feld zu fahren. Der Wagen war mir dicht auf den Fersen – keine zwanzig Meter mehr entfernt – und kam rasch näher und näher. Ironischerweise hallten mir Mr. Pastores Worte in den Ohren, sofort nach Hause zu gehen und nicht herumzutrödeln.
Ich blickte wieder nach vorne. Meine Beine pumpten wie eine Maschine und mein Atem keuchte mir stoßweise die Luftröhre empor. Ich hätte schwören können, selbst über das Knurren des Motors hinweg zu hören, wie die Grashalme gegen den massiven Kühlergrill peitschten und die Reifen sich in die kompakte, gefrorene Erde schürften und dabei Steine zu Staub zermalmten.
Ich hatte fast die Straße erreicht. Aus irgendeiner Lächerlichkeit heraus setzte ich das Erreichen der Straße mit dem eines Freimals beim Fangenspielen gleich, als mir schlagartig und schmerzlich bewusst wurde, dass Pick-ups auf Asphalt sogar noch schneller waren.
Der Fahrer des Pick-ups ließ den Motor aufheulen. Trotz der Kälte fühlte ich, wie sich Schweißperlen auf meiner Stirn bildeten und dort eiskalt stehen blieben.
Die Straßenlaternen kamen näher. Durch den Nebel konnte ich die spitzen Giebeldreiecke der nächsten Häuser ausmachen wie die Silhouette eines entfernten Gebirgsmassivs.
Inzwischen war ich mir sicher: Ich konnte die Hitze des Wagens spüren, der mir im Nacken saß, konnte die von den Reifen aufgewirbelten Staub- und Schmutzpartikel im Licht der Scheinwerfer tanzen sehen. Auch bildete ich mir ein, die winzigen Steinchen und Splitter, die an meine Waden katapultiert wurden, zu spüren.
Das plötzliche Aufschmettern der Hupe fuhr mir durch Mark und Bein und ich geriet ins Schlingern. Ich verriss den Lenker und mein Vorderreifen krachte über eine Furche im starren Erdboden. Bevor ich wusste, wie mir geschah, wurde ich vom Fahrrad gerissen und landete im Dreck.
Der Pick-up kam keine zwei Meter von mir entfernt bebend zum Stehen. Dampf stieg aus dem Grill empor und ich konnte den verbrannten Reifengummi riechen. Es zischte, simmerte, klickte. Wie gelähmt vor Angst starrte ich einfach zum Wagen hinauf. Plötzlich öffnete sich die Fahrertür und vor dem Schein der Deckenleuchte zeichnete sich der Umriss meines besten Freundes Peter Galloway ab, der von einem hysterischen Lachanfall geschüttelt wurde.
»Das«, sagte er und ließ sich aus dem Fahrerhaus des Pick-ups hängen, »war unbezahlbar! Heilige Scheiße! Ich wusste ja gar nicht, dass dusorasen kannst. Ich wette, du hast mich für irgendeinen Irren gehalten, was?«
»Hätte ich da so falsch gelegen?« Ich stand auf und klopfte mir den Dreck von der Hose. Der Stoff über meinem linken Knie war zerrissen. »Vollidiot. Was zum Teufel machst du da überhaupt? Ist das der Pick-up deines Stiefvaters?«
Immer noch vor sich hin prustend stieg er aus dem Fahrerhaus herunter und ging zu meinem Rad. Mit einer Schuhspitze hob er den Lenker aus dem Dreck, bis er ihn, ohne sich danach bücken zu müssen, greifen konnte. »Überraschung! Hab gestern nach der Schule meinen Schein bekommen.«
»Ohne Scheiß? Das ist ja hammermäßig!«