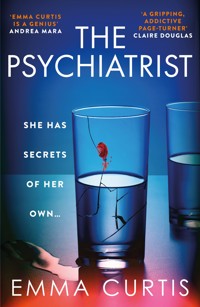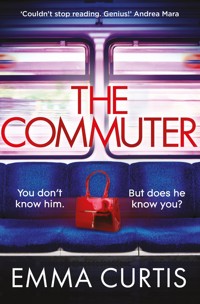2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zwanzig Minuten nur verlässt Vicky das Haus, während ihr Baby schläft. Als sie zurückkehrt, ist die Katastrophe geschehen, und nichts ist mehr wie zuvor. In ihrer Not vertraut sich Vicky ihrer besten Freundin Amber an, die der Polizei gegenüber behauptet, dass die beiden Frauen die ganze Zeit bei dem Kind gewesen seien. Doch dann geschehen weitere Unglücke. Bald wird klar, dass jemand das Leben von Vickys Familie sabotiert – jemand in ihrer unmittelbaren Nähe. Ein Albtraum beginnt, der Vicky bis an ihre äußersten Grenzen treibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Roman
Zwanzig Minuten nur verlässt Vicky das Haus, während ihr Baby schläft. Doch als sie zurückkehrt, ist die Katastrophe geschehen und nichts ist mehr wie zuvor. In ihrer Not vertraut sich Vicky ihrer besten Freundin Amber an, die der Polizei gegenüber behauptet, dass die beiden Frauen die ganze Zeit bei dem Kind gewesen seien. Doch dann geschehen weitere Unglücke. Bald wird klar, dass jemand das Leben von Vickys Familie sabotiert – jemand in ihrer unmittelbaren Nähe. Ein Albtraum beginnt, der Vicky bis an ihre äußersten Grenzen treibt.
»Ein düsterer und hoch spannender Roman über Freundschaft, Verrat und Lügen.« Woman & Home
Zur Autorin
Die englische Bestsellerautorin Emma Curtis wurde in Brighton geboren und wuchs in London auf. Ihre Faszination für die dunklen Seiten des Lebens inspirierte sie zu ihrem Roman. Emma Curtis lebt mit ihren beiden Kindern und ihrem Ehemann in Richmond bei London.
EMMA CURTIS
Dein
perfektes
Leben
PSYCHOTHRILLER
Aus dem Englischen
von Gabriele Weber-Jaric
Für Rose und Brian Knox-Peebles
Prolog
Lautlos öffne ich die Tür zu Joshs Zimmer. Vor einem halben Jahr habe ich sie ausgehängt und unten einen Zentimeter abgehobelt, damit sie nicht über den Teppichboden schabt. Ja, ich habe es selbst gemacht, in solchen Dingen bin ich ein Ass, die perfekte Heimwerkerin. Im Zimmer riecht es nach meinem Sohn, nach Talkumpuder und Baby-shampoo; ein warmer, dunkler Raum, der mit Josh zu atmen scheint. Die Verdunklungsrollos sind heruntergelassen, die Vorhänge so fest geschlossen, dass kein Licht hindurchdringen kann. Es dauert einen Moment, bis meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt haben. Josh schläft tief und fest. Er hat die Pfote seines Pandabären umklammert und ist leicht verschwitzt.
Ich will Josh hochheben, doch ich habe ihn kaum berührt, da tritt er schon mit einem Fuß aus und schürzt die Lippen. Ich weiche zurück. Er darf nicht wach werden, damit kann ich jetzt nicht umgehen, dazu bin ich zu müde, zu sehr durch den Wind. Ich trete ans Fenster, schiebe das Rollo ein Stückchen zur Seite und sehe zu, wie der Regen auf die Autos fällt und sich in Fäden über ihre Dächer zieht. Die Rinnsteine können die Wassermassen kaum noch aufnehmen, es bilden sich Pfützen. Der Druck auf meiner Brust will nicht vergehen, auch nicht das Gefühl von Dringlichkeit. Ich weiß, das sind Bedingungen, die vernünftige Entscheidungen unwahrscheinlich machen. Doch dann höre ich, dass Joshs Atem wieder tief und regelmäßig ist.
Ich werfe einen Blick auf die Uhr, verlasse das Zimmer, schließe die Tür und eile die Treppe hinunter. Wenn Josh morgens ein Schläfchen hält, wacht er nicht auf. Das gab es noch nie. Nie. Falls er nachts nicht durchgeschlafen hat, holt er das am nächsten Morgen mit einem anderthalbstündigen Tiefschlaf nach. Demnach habe ich einen ordentlichen Zeitpuffer, denn länger als zwanzig Minuten brauche ich nicht.
Ich streife meinen Mantel über, nehme meinen Schirm und trete hinaus in den Regen.
1
Ein Tag zuvor – Sonntag, 3. Januar 2010
Ich fahre auf den Hof vor unserem Haus. Eine Szene, überdeutlich und so lächerlich, dass es schon wehtut, springt vor meinem inneren Auge auf. Sie zeigt mich in Unterwäsche zusammen mit einem nackten Mann. Er hat den Körper eines Mannes in mittleren Jahren und das Lächeln eines unartigen Jungen. Ich raffe meine Kleidungsstücke zusammen, streife sie über, verheddere mich in den Ärmeln meines Pullovers. Ausreden und Entschuldigungen stürzen aus meinem Mund. Das Lächeln des Mannes verblasst. Es wird durch eine verwirrte, dann konsternierte Miene ersetzt.
Ich öffne die Augen. Ich bin zu Hause. Alles ist gut. Es ist nichts passiert.
Unser Weihnachtsbaum lehnt einsam und seines Schmucks beraubt an den Mülltonnen. Die Straßenlaterne über mir taucht die alte Magnolie in ein gespenstisches Licht. Sie beginnt schon zu knospen. Ich erinnere mich, wie verzaubert ich angesichts der rosigen Blüten mit den elfenbeinfarbenen Streifen war, als wir das Haus erstmals besichtigten.
Hinter dem Fenster flackert das Licht des Fernsehers auf den Gesichtern meiner Familie. Auf dem großen roten Sofa bilden die vier eine Kuschelgruppe. Tom, meine Ehemann, hat sich zurückgelehnt, in jedem Arm eine Tochter. Josh liegt schlafend mit gespreizten Beinen auf der Brust seines Vaters. Seine Händchen umfassen Toms Hemdkragen. Er gleicht einem Frosch.
Was um alles in der Welt habe ich mir dabei gedacht? Ich halte mich am Lenkrad fest, schließe die Augen und fluche. Als ich wieder aufschaue, ist Polly hinter ihrem Vater auf das Sofa geklettert und umschlingt seinen Hals. In diesem Augenblick entdeckt Tom, dass ich zurück bin. Er legt Polly auf ihrer großen Schwester ab, springt mit Josh in den Armen auf und öffnet die Haustür. Das ist mein Ehemann: Tom Seagrave, ein humorvoller, manchmal nerviger, aber warmherziger und geselliger Mann. Und er liebt mich. Warum also?
Ich schnäuze mir die Nase. Emily und Polly pressen ihre Gesichter an die Fensterscheibe. Ihre platt gedrückten Nasen sehen aus wie Schweinerüssel. Tom kommt in den Plastikclogs, mit denen er im Garten arbeitet, heraus ans Auto. Ich steige aus dem Wagen und nehme ihm das Baby ab, bevor ich mich hochrecke und Tom einen Kuss gebe.
»Wart ihr auch brav?«
Im Haus hebe ich Polly hoch, drücke Emily an mein Bein und plappere diesen albernen Satz, um von meinem Erröten abzulenken.
»Wir waren mit Daddy und Amber auf dem Spielplatz«, erzählt Emily.
»Ach. Na, das war bestimmt toll. Wo war Robert?«
»Ackert anscheinend wie verrückt«, sagt Tom. »Amber hat ihn seinem Schicksal überlassen.«
Im Haus riecht es noch nach Weihnachten, ein tröstlicher Duft nach Gewürzen und den Tannennadeln, die der Staubsauger verfehlt hat. An den Pfosten des Treppengeländers haften die letzten Lametta-Reste. Auf dem Küchentisch liegen die eingegangenen Weihnachtskarten ordentlich gestapelt, damit ich sie durchsehen kann, bevor sie im Papiermüll landen.
»Ah, du warst fleißig.« Ich greife nach dem Stapel und blättere ihn geistesabwesend durch. »Worüber habt ihr denn geredet, Amber und du?«
»Nichts Besonderes. Hauptsächlich über Schulangelegenheiten.«
Ich werfe ihm einen Blick zu und frage mich, warum er klingt, als hätte er mir nicht alles erzählt. Aber ich kann nicht nachhaken, denn Tom kommt mir zuvor und fragt: »Und wie geht es meiner lieben Schwiegermutter? Reißt sie sich immer noch die Bluse vom Leib und heult in den Wind?«
Erleichtert lache ich über Toms abgedroschenen Witz, der mir zeigt, dass alles im Lot ist. Tom tut gern, als hätte er eine festgefasste Meinung über meine Mutter. Zu seinen Lieblingsszenarien gehört, dass sie ein exzentrisches, alternatives Leben führt, die Sonnenwende mit einem Hexenzirkel in den South Downs feiert und ihr Bed and Breakfast bloß eine Fassade für ein Haus voller Sexsklaven ist. All das erkennt er angeblich an ihrer Vorliebe für dunkle Farben und weite, mehrlagige Kleidung, an ihrer Neigung zu extravaganten Gesten und wahnsinnigen Übertreibungen, und weil sie, seit Tom sie kennt, ein halbes Dutzend Liebhaber hatte.
»Sag so was nicht, das ist gemein.«
»Entschuldige, war nicht so gemeint.«
»Weiß ich.« Ich küsse ihn versöhnlich. Die Haut seines Gesichts fühlt sich anders an als bei David – als wäre sie verletzbarer. »Peter fehlt ihr.«
Die Lüge kommt mir leicht über die Lippen. Zum einen habe ich heute Morgen mit meiner Mutter telefoniert, zum anderen geht es sowieso immer wieder um das Gleiche. Als ich geboren wurde, war meine Mutter siebzehn Jahre alt. Ihre Liebhaber haben in ihrem Gefühlshaushalt stets Chaos angerichtet und unser Leben, seit ich denken kann, auf den Kopf gestellt. Doch wenn ich mir überlege, dass ich die Stabilität meines Lebens um ein Haar für einen dummen Seitensprung aufs Spiel gesetzt hätte, frage ich mich, was das aus mir macht. Wie die Mutter, so die Tochter?
»Schade, dass sie sich getrennt haben. Ich mochte ihn.«
Ich stelle meine Handtasche ab. »Du magst jeden. O Gott, ich wünschte, sie würde langsam erwachsen.« Einen Moment lang weiß ich nicht, ob ich meine Mutter oder mich meine, doch dann nimmt Tom mich in die Arme, quetscht die Mädchen zwischen uns zusammen und den Gedanken aus mir heraus.
»Sei nicht so kleinlich. Sie ist erst siebenundvierzig.«
»Sechsundvierzig«, murmele ich glücklich. Ich küsse Toms Kinn, doch dann habe ich Angst, dass ich es übertreibe, und löse mich von ihm. Die Mädchen flüchten, rennen zurück ins Wohnzimmer und werfen sich aufs Sofa.
»Müde?« Tom streicht mir über den Kopf.
Ich nicke. »Hundemüde.«
»Sollen wir Robert und Amber absagen? Ich kann seinen Passantrag auch ein andermal mit ihm durchsehen.«
»Nein, nein, kein Problem.«
In bin unendlich erleichtert. Alles geht vorbei. Das habe ich von meiner Mutter gelernt.
2
»Wo ist mein Glas Wein?«, fragt Amber, umarmt mich und mustert mich. »Alles in Ordnung?«
»Erzähl ich dir später«, flüstere ich. Sophie, ihre Tochter, ist im gestreiften Schlafanzug, flauschigen Bademantel und Häschenpantoffeln erschienen. Sie stürmt sofort die Treppe hinauf auf der Suche nach Emily.
Ich schenke Amber ein Glas Rotwein ein und reiche Robert eine Flasche Bier. Amber und ich lehnen uns an die Kücheninsel und stippen Kartoffelchips in eine Schale Taramosalata. Tom und Robert sitzen am Tisch, lesen Roberts Antragsformular durch und gehen, sobald sie damit fertig sind, zum Thema Fußball über. Tom setzt sich zurück und verschränkt die Hände hinter dem Kopf, während Robert sich noch einmal über das Formular beugt und gedankenverloren am Arm kratzt.
Ich sehe Amber an und verdrehe die Augen. Sie nimmt sich eine Handvoll Chips.
»Und?«, fragt sie. »Wie war’s im schönen Bognor?«
»Kalt.«
Ich spüre mein Erröten. Ich habe sie belogen und weiß nicht einmal, warum. Vermutlich liegt es an einer Mischung aus Scham und mädchenhafter Aufregung, die mein schreckliches, großes Geheimnis in mir weckt. Manchmal bin ich mir selber peinlich. »Habe ich dir schon die neuen Vorhänge in Joshs Zimmer gezeigt?«
Ihr Blick wird forschend. »Nein, ich glaube nicht.«
Wir steigen die Treppe hinauf und betreten Joshs Zimmer. Amber bewundert die Vorhänge pflichtgemäß und lobt die ordentlichen Stiche, die ich beim Nähen gemacht habe. Die Vorhänge sind längs gestreift, blau und weiß, mit Schiffchen an der oberen Kante. Ich setze mich auf das Einzelbett. Neben mir liegt Josh schlafend in seinem Bettchen und schnauft.
Amber fragt: »Was soll die große Geheimnistuerei?«
Ich schaue zur Seite, glätte und falte ein Mulltuch. Ich sollte es nicht erzählen, aber ich kann nicht anders.
»Schwöre, dass du es niemandem weitersagst. Nicht einmal Robert.«
»Okay, ich schwöre. Was ist los, Vicky? Langsam machst du mir Angst.« Ihr Blick weitet sich. »O Gott, bist du wieder schwanger?«
Ich werfe einen Blick auf meinen neun Monate alten Sohn. »Nein. Ich habe eine – hätte beinah eine – Riesendummheit gemacht.«
»Was für eine?«
»Ich war …« Ich sehe sie immer noch nicht an und spüre ihren Blick. »Es gibt da einen Mann.«
Amber stößt einen kleinen Schrei aus und schlägt sich die Hand vor den Mund. »Bitte erzähl mir nicht, dass du eine Affäre hast.«
»Nein. Aber um ein Haar. Da war ich heute. Bei ihm.«
»Dann warst du also gar nicht bei deiner Mutter?«
Ich schüttele den Kopf.
»Ach du Schande.«
»Ich weiß. Dann habe ich – nein, haben wir erkannt, wie viel wir riskieren. Amber, ich liebe Tom. Wirklich. Es war einfach eine Dummheit.« Ich verberge mein Gesicht in den Händen und stöhne. »Ich muss verrückt gewesen sein.«
»Du hast aber nichts gemacht, oder?«
Ich seufze schwer. »Nein.«
Das trifft nicht ganz zu. Wir haben uns geküsst. Wann immer es möglich war, haben wir uns getroffen und uns unterhalten. Wenn es nicht möglich war, haben wir uns Nachrichten geschickt. Aber das gilt noch nicht als »machen«.
Abrupt stehe ich auf und beuge mich über Joshs Bettchen. Er ist so süß, wenn er schläft und dabei leise schnuffelt. Sanft berühre ich seinen Kopf und streiche mit dem Daumen über seine Härchen.
»Los, spuck alles aus. Wer hat den Anfang gemacht? Wie weit seid ihr gegangen?«
»Weit genug. Aber ohne richtig … na, du weißt schon.«
»Ohne Penetration?«
Wir werden zu zwei albern kichernden Schulmädchen.
»Oh, hör auf! Nein, wir haben uns nur geküsst und ein bisschen rumgemacht, bis ich total panisch geworden bin und er nicht mehr wusste, woran er war.« Ich höre auf zu lachen und reiße mich zusammen. »Ich bin nicht gerade stolz auf mein Benehmen und unglaublich froh, dass nichts passiert ist.«
Amber steht die Neugier ins Gesicht geschrieben. »Wer ist es?«
»Das sage ich nicht.«
»Gut, dann lass mich raten. Wohnt er hier in der Gegend?« Anscheinend nimmt sie meine Weigerung nicht ernst.
»Kein Kommentar.«
»Das interpretiere ich als Ja.«
»Amber, bitte. Es ist vorbei, und ich will wirklich nicht darüber reden. Es ist auch so schon unangenehm genug.«
»Vertraust du mir nicht?«
»Darum geht es nicht. Ich möchte nicht, dass es jemand weiß.«
»Auch ich nicht?« Stille breitet sich aus. Dann fragt sie: »Wie lange geht das schon?«
Was sie tatsächlich wissen will, ist, seit wann ich sie schon belüge. Ich senke den Kopf und hole tief Luft. »Anfangs war es ja noch nichts. Höchstens Blickkontakte, die ich nicht mal vor mir selbst zugeben wollte. Es hat Monate gedauert, bis wir es uns eingestehen konnten.« Mein Mund ist trocken geworden. »Das war vor drei Monaten.«
Amber seufzt, dann zuckt sie mit den Schultern.
»Es tut mir leid.«
Stunden später krieche ich ins Bett, schließe die Augen und sinke in einen tiefen Schlaf.
In einem wilden Traum komme ich nach Hause und finde die halbe Nachbarschaft im Flur und auf der Treppe versammelt. Ich bahne mir einen Weg durch sie hindurch, doch meine schweren Einkaufstüten ziehen an meinen Armen und Schultern, als wollten sie mich zurückhalten. In den Tüten befinden sich Packungen mit Eiscreme und tiefgefrorene Erbsen. Ich muss an den Menschen vorbei zum Kühlschrank und rufe, sie sollen mir Platz machen. Schließlich gelange ich in die Küche, wo Tom über Josh kniet. Die Steinfliesen sind voller Blut.
Ich schrecke aus dem Traum auf, desorientiert und verängstigt. Josh weint. Ich presse mein Gesicht ins Kopfkissen, denn ich will nicht, dass Tom meinen keuchenden Atem hört. Für lange Zeit dachte ich, meine gewaltträchtigen Träume hätten mit Schwangerschaftshormonen zu tun, denn nach den Geburten meiner Töchter haben sie jedes Mal wieder aufgehört. Nach Joshs Geburt jedoch nicht. Nach jedem dieser Träume bin ich zutiefst verstört, habe einen trockenen Mund, und mein Herz rast.
Ich ziehe das Kissen über meinen Kopf und lege den Unterarm darauf. Ich kann einfach nicht mehr. Doch ich höre ihn durch das Kissen hindurch. Aus seinem Kummer wird Wut, sein Geschrei vibriert in meinem Körper. Ich ziehe die Knie an meinen Bauch, krümme mich und zwinge mich, gegen meinen Instinkt anzugehen. Wenn ich jetzt aufstehe, ihn tröstend in die Arme nehme und seinen kleinen Körper an mich drücke, wird er nie aufhören, nachts nach mir zu schreien.
Während meines letzten Semesters an der Bristol University bin ich zum ersten Mal schwanger geworden. Es geschah nach den Prüfungen, in jener fließenden Zeit, die aus Picknicks und Bällen besteht, aus trägen, sorglosen Tagen. Tom, ich und unsere Freunde waren voller Pläne und schwebten förmlich auf einer euphorischen Wolke. Wir waren achtlos, jung und naiv. Mit dem Semester endete auch jener Teil unseres Lebens. Wir verbrachten drei Monate in Indien, und als wir zurückkamen, registrierte mein Gehirn zwar die Fakten, wie die Übelkeit am Morgen eine Woche nach unserer Rückkehr, doch ich redete mir ein, dass ich mir in Indien einen Magen-Darm-Virus eingefangen hätte.
Ich wollte meine Lehrerausbildung beginnen, und Tom hatte vor, für ein Jahr nach Lateinamerika zu gehen, mit der Aussicht auf einen Job in Buenos Aires. Dann kam der Abend, an dem wir im Brockwell Park auf einer Bank saßen, Herbstlaub um unsere Füße wehte, der Mond wie eine silberne Scheibe über uns am Himmel stand, und wir beschlossen zu heiraten. Wir waren einundzwanzig Jahre alt. Als Emily geboren wurde, war ich zweiundzwanzig, bei Polly, dem einzigen geplanten Kind, vierundzwanzig. Josh war eine Überraschung und kam sechs Monate vor meinem achtundzwanzigsten Geburtstag zur Welt. Er ist ein griesgrämiger kleiner Kerl, mit dem keiner mehr gerechnet hatte, aber ich liebe ihn.
Der Radiowecker ertönt. Tom wälzt sich zu mir herum und lächelt mich verschlafen an. Zeit, aufzustehen.
3
Montag, 4. Januar 2010
An diesem Morgen sind die Mädchen früh auf den Beinen, springen in ihren rotbraunen Schuluniformen herum und können es kaum erwarten, nach drei Wochen Ferien endlich ihre Freunde und Freundinnen wiederzusehen. Es ist der erste Schultag. Die Vorboten des Frühlings werden langsam sichtbar, und die ersten Spitzen der Narzissen durchstechen unseren Rasen wie dunkelgrüne Zähne. Tom findet es idiotisch, dass ich die Zwiebeln im Herbst in den Rasen setze, wo die Blumen später zertreten werden können, aber ich mag die Vorstellung, dass sie im Frühjahr mal hier, mal da sprießen, als wären sie einem Beet entlaufen. Außerdem überleben jedes Jahr so viele von ihnen, dass es mir die Sache wert ist. Wenn sie blühen, mag Tom sie auch.
Eine Katze mit rötlichem Fell springt über den Zaun. Ich klopfe an die Fensterscheibe. Die Katze wendet den Kopf, wirft mir einen Blick zu, spaziert davon und hinterlässt die Abdrücke ihrer Pfoten im Tau des Rasens. Der heutige Tag steht für einen Neubeginn, aber ich bin zu erschöpft, um intensiver darüber nachzudenken. Ich weiß, dass es mich schmerzen wird – tut es ja schon –, aber darüber hinaus kann ich noch nichts sagen. Ein Tag nach dem anderen.
Tom kommt mit Josh auf dem Arm die Treppe herunter. Er ist rasiert und angekleidet: rosa-weiß gestreiftes Hemd, Lederhose, Paisley-Socken. Der maßgeschneiderte Anzug und die modisch schmal geschnittenen Schuhe warten in seinem Büro, denn Tom fährt mit dem Motorrad zur Arbeit. Er ist in der Werbebranche tätig und folgt einer Laufbahn, die er nie angestrebt hat, doch mittlerweile ist er damit glücklich. Die Filmgesellschaft, bei der er als Produzent tätig ist, heißt Marzipan. Tom arbeitet in Soho. Es ist ein toller Job, aber er hat auch seine Schattenseiten. Im Sommer herrscht dort Hochkonjunktur, was uns zwingt, in den Osterferien Familienurlaub zu machen. In den Sommerferien miete ich ein Häuschen am Strand von Pagham, wo die Kinder und ich den August verbringen. Die Mädchen würden gern in Bognor Ferien machen, und meine Mutter bietet jedes Mal an, uns in ihrem Bed and Breakfast zu beherbergen, doch das möchte ich nicht, denn dann hätte sie unseretwegen einen Verdienstausfall.
Unser Frühstückswahnsinn beginnt. Die Mädchen zanken sich. Tom versucht, über ihren Lärm und das eingeschaltete Radio hinwegzureden, während ich den Matsch zubereite, der als Babynahrung gilt. Ich mache mich daran, Josh zu füttern. Er sitzt angegurtet auf seinem Hochstuhl, brüllt, schlägt den Löffel fort, dreht sein Gesicht weg und tritt gegen den Tisch. Im Radio debattieren Experten über Immigranten. Polly und Emily streiten sich um die Packung Cornflakes. Tom fährt sie an und lacht, als er Pollys bestürzte Miene sieht. Dann will er sie trösten und wirkt schuldbewusst, als aus Pollys großen, braunen Augen zwei dicke Tränen kullern. Ich tue mein Bestes, um alles zusammenzuhalten, schaufele Brei in Joshs Mund, der zum größten Teil auf dem Fußboden, meinem T-Shirt, dem Tisch und Emilys Haaren landet. Also feuchte ich einen Lappen an und säubere zuerst mich, dann Emily. Josh hebe ich mir bis zuletzt auf, denn das wird wieder ein Kampf. Als wir fertig sind, Emily aufgehört hat zu fragen, was mit Josh los sei, Polly nicht mehr weint und Tom es mit seinem Charme geschafft hat, die Gunst seiner Töchter zurückzugewinnen, scheuche ich die Mädchen zum Zähneputzen nach oben.
Als Emily noch ein Baby war, gab es keine selbstgefälligeren Eltern als Tom und mich. Wenn irgendwelche Freunde darüber klagten, wie erledigt sie seien, wie schwierig das Leben mit einem Kind sei, trafen sich Toms und mein Blick, und wir lächelten einvernehmlich. Wir wussten nicht, was das Theater sollte. Bereits mit acht Wochen schlief Emily nachts durch. Tagsüber war sie hinreißend, jammerte so gut wie nie, erreichte pünktlich jeden Meilenstein in ihrer Entwicklung. Polly war ebenso unproblematisch. Anders als ihre eigenständige Schwester, war sie jedoch am glücklichsten, wenn sie geknuddelt wurde und wie ein kleines Beuteltier an uns hing. Tom und ich beglückwünschten uns erneut.
Und dann kam Josh. Unsere Meinung, wir hätten eine natürliche Begabung, Eltern zu sein, wurde von jetzt auf gleich widerlegt. Wir machten alles wie vorher, benutzten die gleichen Anreize wie bei den Mädchen, doch statt sich wie Emily an die Regeln zu halten oder so sanftmütig wie Polly zu sein, ist Josh ein Rebell. Als Erwachsener wird ihm das vielleicht zugutekommen, doch im Moment bedeutet er vor allen Dingen harte Arbeit. Es gibt Zeiten – wie heute Morgen –, an denen ich verzweifeln könnte.
Hannah, Toms ältere Schwester, sagte mir einmal: »Als Säugling war Tom mehr wie deine Töchter, ein lieber Junge, der gern geschlafen hat. Josh muss nach dir kommen.« Und meine Mutter erklärte: »Du warst genau wie Josh, ein Horrorkind. Aber mach dir keine Sorgen, mit der Zeit bist du ruhiger geworden.«
»Alles okay mit dir?«, fragt Tom.
»Schlecht geschlafen, aber geht schon.«
Er gibt mir einen Kuss auf die Stirn. »Das verstehe ich.«
Ich lächele unsicher.
»Sieh zu, dass du dich ein bisschen ausruhen kannst. Und kauf dir einen Donut mit Füllung.«
Ich lache, doch als Tom sich umdreht, flüstere ich: »Ich liebe dich.«
Er hört mich nicht, denn Polly hat ihre Arme um seine Beine geschlungen. Tom hebt sie hoch, und die beiden schauen sich mit bedingungsloser, sklavischer Liebe an.
»Kann ich für die Pause einen Schokoriegel haben?«, fragt Emily.
Tom ist vor einer Stunde losgefahren. Pünktlich um halb acht ist er durch die Tür, glatt rasiert und nach Seife riechend. In seiner schwarzen Lederkluft wirkt er voluminös, die schweren Stiefel lassen seine Füße riesig wirken. Während die Mädchen ihre Betten machen, setze ich mich mit Josh ins Wohnzimmer und nehme mir eine kleine Auszeit. Das Wetter ist grauenhaft. In den Autos, die an unserem Haus vorbeirauschen, malen Schulkinder Strichmännchen auf die beschlagenen Scheiben. Im Haus gegenüber öffnet sich die Eingangstür, Kinder und Hunde stürzen heraus. James Boxer läuft unter einem schwarzen Regenschirm zum Bahnhof. Seine Frau Millie jongliert mit zwei Schultaschen. Ihre Füße verheddern sich in den Leinen der beiden Dackel, die aufgeregt hin und her rennen. Das Baby liegt im Kinderwagen, die beiden Jungen sind damit beschäftigt, ihr Frühstücksbrot zu essen, ihre Haare noch vom Schlaf zerwühlt. Ich muss langsam in die Gänge kommen. Weiter unten auf der Straße lässt jemand den Motor seines Wagens aufheulen, ein ums andere Mal.
Was wird David gerade machen? Wahrscheinlich das Gleiche wie Tom vorhin, nämlich seine Frau und Tochter zum Abschied küssen und sich auf den Weg zur Arbeit begeben. Die Erinnerung an sein durchtriebenes Lächeln trifft mich wie ein Messerstich, so scharf, dass meine Lider zucken. Ich brauche Zeit, um mit dem, was geschehen ist, fertig zu werden. Da ich kein Teenager mehr bin, fehlt mir der Luxus, mich in mein Zimmer zu verkriechen und schnulzige Popsongs zu hören, was sehr schade ist.
Hinter mir spielt Josh auf dem Fußboden mit bunten Bauklötzchen aus Kunststoff. Er wirft eines davon, es prallt gegen das Kamingitter und rollt unter einen Sessel. Josh wird langsam mobil, legt sich auf die Seite und späht in den dunklen Hohlraum unter dem Sessel. Ich bücke mich und hole das Klötzchen hervor.
»Mummy!«
Wie lange steht Emily schon da? Ich konzentriere mich und erinnere mich an die Frage, die ich mit halbem Ohr gehört habe. Schokoriegel.
»Ja. Pack auch für Polly einen ein. Zieh deine Schuhe an und sieh nach, wo Pollys Schuhe sind. Sobald ich Josh fertig gemacht habe, geht’s los.«
»Polly soll ihre Schuhe selber suchen. Sie ist doch kein Baby mehr.«
Emily reckt bockig das Kinn vor und zieht die Brauen zusammen. Am liebsten würde ich über ihre gefurchte Stirn streichen und sie glätten. Über Emily könnte ich manchmal lachen. Ihre Selbstgerechtigkeit und überlegene Miene, ihre Strenge, selbst wenn es um Banalitäten geht, ihre höhere Vorstellung von dem, was richtig und falsch ist, all das ist zu komisch. Aber ich lache nicht, denn wenn es um ihre Würde geht, fehlt Emily jeglicher Sinn für Humor.
»Bitte, Emily. Du würdest mir sehr helfen. Wenn wir warten, bis Polly ihre Schuhe findet, kommen wir zu spät.«
Emily fällt die Kinnlade runter. »Ich will nicht zu spät kommen.«
Sie rennt aus dem Zimmer und ruft nach Polly. Ich nehme Josh auf und verfrachte ihn in seinen Schneeanzug. Das bringt ihn in Rage. Zum Dank für meine Mühen haut er auf mein Ohr. Mir steigen Tränen in die Augen.
Als wir an der Schule angelangt sind, kommen mehr Menschen aus dem Eingangstor heraus, als mit uns hineingehen. Eine fröstelnde Hilfslehrerin mit aufgespanntem Regenschirm streckt die Hand aus, damit die Kinder sie schütteln können. Verstohlen schaue ich mich nach David um, aber ohne großes Herzflattern. Die Chance, dass er morgens an der Schule auftaucht, geht gegen null.
»Vicky!« Imogen Parker marschiert auf mich zu, die Zwillinge im Schlepptau. »Wie war dein Weihnachten?«
Ich knipse mein Lächeln an. »Schön. Einfach wundervoll. Und wie war es bei euch?«
Millie Boxer tritt zu uns und auch Charlotte Grunden, die aussieht, als müsste ihr Baby jeden Moment kommen; dann Amber, bereits professionell gekleidet, in schickem Trenchcoat, hohen schwarzen Stiefeln, das Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Plötzlich scheint mir alles gar nicht mehr so schrecklich zu sein. Diese Frauen sind meine Freundinnen. Ich kann in mein altes Leben zurückschlüpfen, bin begnadigt worden. Vor Erleichterung wird mir ein wenig schwindlig.
»Guten Morgen.«
Ambers Blick ist prüfend. »Dir auch einen guten Morgen. Hast du überhaupt geschlafen?«
»Nicht viel. Josh ist um zwei Uhr wach geworden.«
Die vier Frauen wechseln sich mit Ratschlägen ab, von denen ich bereits jeden einzelnen befolgt habe. Genau genommen habe ich so viele Dinge versucht, dass ich alles nur noch schlimmer gemacht habe. Inzwischen ist Josh ebenso verwirrt wie ich. Ich soll ihn aufnehmen, wenn er schreit. Soll ihn nicht aufnehmen. Soll zu ihm gehen, nicht zu ihm gehen. Soll etwas sagen, damit er weiß, dass ich ihn nicht vergessen habe, dann wieder verschwinden. Soll nichts sagen, mich ihm nur zeigen. Soll ihn ignorieren. Ein Baby darf man nie ignorieren. Manchmal denke ich, dass ich darüber noch den Verstand verliere.
Und dann sehe ich sie: David und Hellie North mit Astrid in ihrer Mitte, an den Händen ihrer Eltern. Ich hätte es wissen müssen. Wenn Vater und Mutter berufstätig und nicht in der Lage sind, ihr Kind täglich zur Schule zu bringen, machen sie am ersten Schultag oft eine Ausnahme.
Ich habe das Schlimmste überhaupt getan, nämlich mich mit dem Vater einer meiner Schülerinnen an der Schule einzulassen, auf die auch meine Töchter gehen – dass ich zurzeit noch in der Elternzeit bin, ist dabei nicht ausschlaggebend. Es spielt keine Rolle, dass wir es nicht zu Ende gebracht haben oder dass ich diejenige war, die im letzten Moment die Notbremse gezogen hat. Es war trotzdem falsch. Die Grey Coat School, eine liebe kleine Grundschule, die im Jahr lediglich eine einzige neue Klasse aufnimmt, liegt nur wenige Blocks von unserem Haus entfernt. Ich habe mir selbst ein Bein gestellt, wie man so schön sagt. Ich bin Lehrerin. Die Eltern meiner Schüler erwarten von mir Ratschläge und Unterstützung, und nicht, dass ich ihre Familie zerstöre.
Imogen und Charlotte gehen weiter, um noch andere Freunde zu begrüßen. Ich unterhalte mich weiter mit Millie und Amber, bis die Norths den Garderobenraum in der Eingangshalle verlassen haben und über den Schulhof zum Hinterausgang der Schule laufen. Dann führe ich meine beiden Töchter in das Schulgebäude, streife ihnen Mäntel, Schals und Handschuhe ab, klappe ihre Regenschirme zusammen und klemme die Schirme zwischen Aufsatz und Gestell des Kinderwagens. Ich ziehe Josh aus seinem Gurt heraus, nehme ihn auf den Arm und hetze mit den Mädchen zu ihren Klassenzimmern. Eine Weile lungere ich noch an der Tür zu Emilys Raum herum, bis ich sicher bin, dass die Luft rein ist. Schließlich eile ich die Treppe hinunter und laufe direkt in David hinein.
Wir starren uns an. Jeder drückt sich an eine Wand, um den anderen vorbeizulassen.
»Entschuldige.« Ich will weiterhasten, aber David stellt sich mir in den Weg.
»Schön, dich zu sehen«, sagt er. »Du siehst toll aus.«
Ich weiß genau, dass dem nicht so ist, aber meine Mundwinkel heben sich zu einem verräterischen Lächeln. Josh beäugt David und greift nach seiner Nase. »Ich muss weiter.«
»Ich möchte mit dir reden.«
Ich schüttele den Kopf. »Keine gute Idee.«
Hellie taucht auf und lächelt mich an. »Hallo, Vicky, wie geht es dir?« Ihr schwedischer Akzent gibt allem, was sie sagt, einen förmlichen Beiklang. Ich überlege, ob sie einen Verdacht hat, immerhin hat David sie schon mal betrogen. Einen scheußlichen Moment lang stelle ich mir vor, wie sich ihre Blicke treffen und Hellie stillschweigend fragt: Ist das die Neue? Die da? Nicht gerade eine Schönheit.
»Danke, mir geht’s gut.«
»Und dem Kleinen?«
Hellies Blick wandert zu Josh, dessen Wangen gerötet und tränennass sind.
»Er ist kein Morgenmensch.«
»Das sieht man.«
»Ich muss los. Josh muss sein Schläfchen halten.«
Amber wartet auf mich. Ich wage ein vorsichtiges Lächeln, und sie strahlt mich an. Sie hat mir die Geheimniskrämerei verziehen, und Erleichterung durchflutet mich. Wir spazieren bis zur nächsten Ecke, wo sich unsere Wege trennen. Ich werde mit Josh nach Hause gehen, und Amber wird zu dem Immobilienbüro auf der Tennyson Street laufen, in dem sie dreimal in der Woche vormittags arbeitet.
»Alles in Ordnung?«, fragt sie und drückt auf den Knopf der Fußgängerampel. Das grüne Männchen erscheint, und wir setzen uns in Bewegung. »Du bist so blass.«
Ich kann ihr nicht erzählen, wem ich gerade begegnet bin. »Ich hasse mich.«
»Tust du nicht. Du bist bloß groggy. Versuch zu schlafen, wenn Josh sein Nickerchen macht. Versprich mir das.«
»Versprochen. Magda kommt heute Morgen und putzt. Sie bringt mich wieder zu Verstand.«
Als ich die Haustür aufschließe, signalisiert mein Handy, dass ich eine neue Textnachricht bekommen habe. Ich ziehe mein Handy aus der Handtasche und lese sie. Es dauert einen Moment, bis ich die Botschaft erfasse.
Hallo, Vicky. Entschuldigung aber viel Übergeben heute Morgen und Diaro. Später machen wir neu. Ich rufe an. Magda.
Ich lese die Zeilen noch einmal und breche noch in der Haustür in Tränen aus, in meinem dicken Mantel und mit einer Hand am Kinderwagen.
Jugendstrafanstalt Fairhaven
Juli 1992
Die Erwachsenen sprachen im Flüsterton über sie. Was sollte das? Dachten sie etwa, sie wäre dämlich und wüsste nicht, um was es ging? Der Kinderpsychiater war eingetroffen und sah anders aus, als sie angenommen hatte. Sie hatte sich jemanden in Anzug und Schlips vorgestellt, mit Silberhaar und Brille, und dass sie ihn Doktor Soundso nennen müsse. Dieser Typ jedoch hatte braune Haare, keine Brille und trug ein gestreiftes Hemd und ein Jackett, das er ablegte. Als sie ihn nach seinem Namen fragte, sagte er, er sei Doktor Adam Kozlowski, erwarte aber nicht, dass sie sich den Namen merke, deshalb könne sie ihn Adam nennen.
Katya saß in einem grauen Jogginganzug mit Kapuzenjacke auf dem knarzenden schwarzen Ledersofa. Sie hatte Angst und fühlte sich allein. Sie sprach mit niemandem. Warum sollte sie jemandem etwas erzählen? Man hatte ihr bislang nicht zugehört, warum also sollte es jetzt jemand tun? Erwachsene hörten sowieso nur das, was sie hören wollten, ansonsten waren sie stocktaub. Wo war Maggie? Warum war sie nicht gekommen?
Sie kam fast um vor Hunger. Der Duft von gekochtem Gemüse, Bratkartoffeln, womöglich auch Frikadellen drang aus der Kantine zu ihnen herüber, und ihr lief das Wasser im Mund zusammen. Sie zog die Beine an, schlang die Arme darum, drückte die Schenkel an ihre Brust und die Nase auf ihre Knie. Dabei versuchte sie, sich einzureden, sie wäre woanders. Das konnte sie gut. Das hatte sie immer getan, wenn ihre Mum im Schlafzimmer beschäftigt gewesen war. Sie hatte sich zusammengerollt und war in Gedanken davongeflogen, hatte sich in ein Märchen hineinversetzt. Wenn es zu schlimm wurde, kam ein Prinz auf seinem pechschwarzen Ross über den Horizont galoppiert. Sie wollte, dass er sich sputete. Manchmal jedoch fragte sie sich, woher sie wusste, dass es ein Prinz war, denn sie hatte ja noch nie einen kennengelernt, und es gab ja sogar Prinzen, die selbst nicht wussten, dass sie welche waren.
Irgendwo im Gebäude lachte jemand. Das Geräusch hallte von den Wänden wider, und in diesem Widerhall – davon umhüllt – ertönte das Klappern von Geschirr und das Gebrüll und Fluchen einer Jungenstimme, Sprache, die immer weiter ging wie ein Endlosgedicht: Scheiße, du beschissener … verfickte Fotze, dich krieg ich, du Arsch, du beschissener Kopfwichser.
Adam steckte den Kopf durch die Tür und rief: »Könnte mal jemand dafür sorgen, dass er Ruhe gibt?«
Schlagartig wurde es still. Adam schloss die Tür.
»Möchtest du etwas essen?«
Ihr Magen knurrte, aber sie schüttelte den Kopf. Da würde sie nicht hingehen. Nicht bei so vielen Kindern. Sie überlegte, ob sie schon alle Bescheid wussten, ob es sich herumgesprochen hatte.
»Ist Maggie gekommen?«, fragte sie.
Es waren noch nicht viele Tage vergangen. Erst eine Woche, glaubte sie, war sich aber nicht sicher. Es war so viel passiert.
»Nein, ist sie nicht. Es tut mir leid. Bedeutet sie dir etwas?«
Vielleicht wurde Maggie von ihr ferngehalten. Vielleicht gehörte das zu ihrer Strafe. Die Ungerechtigkeit machte sie wütend, doch sie unterdrückte ihren Zorn, weil man ihn sonst gegen sie verwenden könnte. Es kam ihr so unfair vor, in diesem Loch gelandet zu sein, das so gut wie ein Gefängnis war. Und alles nur, weil sie nicht die richtigen Worte hatte und niemand sich die Mühe machen wollte herauszufinden, was sich in ihrem Kopf abspielte. Sie schaute zu Adam hoch, der zu warten schien.
»Wenn Sie Maggie kommen lassen«, sagte sie, »werde ich mich benehmen.«
»Katya, wenn Maggie dich besuchen möchte, weiß sie, dass sie dazu nur deine Aufseherin fragen muss. Niemand verbietet ihr zu kommen.«
Sie hatte gedacht, Maggie wäre ihre gute Fee, aber anscheinend war sie auch nur eine normale Erwachsene. Aber das tat nicht so weh wie Emilys Schweigen. Warum hatte sie sich nicht gemeldet? Aber vielleicht hatte sie ebenfalls Angst. Vielleicht dachte sie, Katya wolle ihr Maggie wegnehmen. Sie wünschte, sie hätte die Möglichkeit, Emily zu erklären, dass sie bloß zu ihnen gehören wollte und Maggies Liebe für sie nicht bedeutete, dass Emily von Maggie weniger geliebt würde. Sie fing an zu weinen. Es tat so gut, den Tränen freien Lauf zu lassen, Trost zu suchen und wieder Kind sein zu dürfen.
4
Josh schreit. Ich lehne mich gegen die Tür seines Zimmers und schlage mir die Hände vors Gesicht. Wenn ich jetzt nachgebe, schläft er nicht, und dann wird er den Rest des Tages ungenießbar sein. Sein Schreien zeigt lediglich, wie müde er ist.
Ich gehe nach unten, schließe die Küchentür und schalte das Babyfon aus. Josh hört man auch ohne das Gerät. Ich mache mir einen Kaffee, schwarz, trage ihn zu meinem PC und rufe meine liebste Immobilienwebseite auf. Ich habe eine heimliche Leidenschaft, nämlich die Hausanzeigen zu studieren. Man kann es fast schon als Sucht bezeichnen. Wenn ich Tom auf ein interessantes Objekt aufmerksam mache, verdreht er nur die Augen, aber ich habe gute Gründe, die Angebote zu verfolgen. Unser jetziges Haus war eine Bruchbude, als wir es kauften, aber so konnten wir uns wenigstens etwas in einer aufstrebenden Gegend leisten. Wir hatten Glück, denn nur wenig später schossen die Preise hier in die Höhe. Für solch ein Projekt wäre ich jederzeit wieder zu haben, trotz der Arbeit, die damit verbunden ist. Für mich bedeutet das, unser Kapital zu erhöhen und uns ein finanzielles Polster zuzulegen. Es ist für den Notfall, falls Tom entlassen wird oder ich meine Arbeit nach der Elternzeit nicht mehr aufnehmen kann, um nur zwei Beispiele zu nennen.
Tom versteht dieses Sicherheitsbedürfnis nicht, er hat sich sein Leben lang sicher gefühlt. Ich aber weiß, wie wankelmütig das Leben sein kann, und finde, Tom hat mehr mit seiner Schwiegermutter gemein, als ihm bewusst ist. Das Motto der beiden ist: Warum sich schon im Voraus Gedanken machen? Meins dagegen lautet: Auf alles vorbereitet sein. Ich weiß noch, wie mein Leben innerhalb weniger Tage auf den Kopf gestellt wurde, wie meine Sachen in Plastiktüten verstaut wurden – ohne Vorwarnung, ohne dass ich von jemandem Abschied nehmen konnte. Deshalb hat das Gefühl, dass es Mächte jenseits meines Einflussvermögens gibt, mich nie verlassen.
Es kann immer etwas passieren. Niemand kann davon ausgehen, dass die guten Zeiten ewig so weitergehen.
Ich trinke meinen Kaffee in kleinen Schlucken. Joshs Geschrei über mir lässt nach, die Abstände zwischen den einzelnen Ausbrüchen werden länger.
Er verstummt.
Ich halte den Atem an. Zähle bis zehn. Nichts.
Mit einem erleichterten Seufzer atme ich aus.
Gleich darauf scrolle ich durch die Immobilienanzeigen und entdecke ein interessantes Objekt auf der Browning Street, nur fünf Minuten von uns entfernt. Meine Antennen richten sich auf. Quer über eine Ecke des Fotos steht dick und in Rot »Neu«. Das Haus wird von Johnson Lane angeboten, dem Immobilienmakler, für den Amber arbeitet. Es ist in einem desolaten Zustand, ich kenne es vom Vorbeilaufen. Für die Lage ist es jedoch preiswert, was bedeutet, es muss reichlich investiert und monatelang mit einer Baustelle gerechnet werden. Auf lange Sicht ist das Potenzial allerdings immens. Mit der Zeit und bei vorsichtiger Finanzplanung können wir daraus etwas richtig Schickes machen. Adrenalin schießt durch meine Adern. Ich greife nach dem Telefon.
Sarah Wilson, Ambers Chefin, meldet sich. »Sie sind nicht die einzige Interessentin«, sagt sie. »Das Objekt wird nicht lange auf dem Markt sein. Baugesellschaften, Sie wissen schon.«
Ja, weiß ich. Mit denen hatten wir hier auf der Coleridge Street schon zu kämpfen. »Kann ich mir das Haus heute noch ansehen?«
»Leider nicht, wir haben einen Besichtigungstermin nach dem anderen. Sie wissen, wie es nach den Weihnachtsferien ist. Kaum sind sie zu Ende, bringen die Leute ihre Häuser auf den Markt. Mein Telefon klingelt in einer Tour. Das ist der Weihnachtsfluch.«
»Der was?«
»Statistisch gesehen zerbrechen die meisten Ehen in der Weihnachtszeit.«
»Ach.« Einen Moment lang denke ich über diese deprimierende Statistik nach. »Ich bin sicher, Amber kann mich noch irgendwo unterbringen.«
»Sekunde.« Sarah seufzt. Vor meinem geistigen Auge sehe ich sie in ihren Terminkalender schauen und mit ihren leuchtend rosa lackierten Fingernägeln auf den Schreibtisch trommeln.
Ich nehme einen Stift, schreibe »Browning Street« auf einen Zettel und unterstreiche den Namen. Es ist genau das Richtige, ich spüre es in den Knochen.
»Also gut«, sagt Sarah. »Amber ist gerade in dem Haus. Wenn Sie es in den nächsten zehn Minuten schaffen, kann sie Sie zwischen zwei Terminen rasch mal herumführen. Ich rufe sie an.«
Ich werfe einen Blick zur Zimmerdecke hinauf. »Geht es auch später?«
»Tut mir leid, heute nicht. Jetzt oder nie, fürchte ich.«
Ich zaudere. Verdammte Magda.
»Sind Sie noch da?«
»Ja. Einverstanden. Ich mache mich sofort auf den Weg.«
Und das tue ich – genau das tue ich und begehe den größten Fehler meines Lebens.
5
Draußen regnet es in Strömen. Es kostet mich Kraft, den Schirm aufzuspannen, und dann fährt der Wind hinein und klappt ihn um. Ich werfe einen Blick zurück auf unser Haus, auf das Giebelfenster von Joshs Zimmer. Er wird weiterschlafen, und ich werde mich sputen. Unten an der Straße bin ich schon mit Baufantasien beschäftigt, sehe mich mit Blaupausen und Handwerkern, reiße im Geist Wände ein, lasse Licht in Räume fluten.
Unsere Gegend ist großartig, so weitläufig, dass man keine Platzangst bekommt, und doch so begrenzt, dass wir eine Gemeinschaft bilden. Sie liegt nicht im besten Teil des südöstlichen Londons, besitzt jedoch die typischen Anzeichen allmählicher Gentrifizierung. Es gibt Immobilienmakler, die unsere Ecke jetzt schon auf schamlose Weise als »Szeneviertel« bezeichnen. Wir haben kleine, ausgefallene Cafés, einen gehobenen Weinladen und einen Edel-Pub am Marktplatz, auf dem man einen Spielplatz und einen Ententeich findet. Auf der London Road dagegen florieren McDonald’s, KFC und Döner-Läden, sodass alles zusammen eine schön durchmischte Bevölkerung ergibt. Früher habe ich in Streatham gewohnt, deshalb lag es nahe, dass wir uns dort nach unserem ersten Haus umsahen. Danach bewegten wir uns etwas weiter fort, suchten ein Schnäppchen und stießen auf eine Ecke Londons, in der die Straßen nach englischen Dichtern benannt waren. Die Häuser waren groß. In den Siebzigern und Achtzigern des letzten Jahrhunderts waren sie zu Wohnungen umgebaut worden, aber dann wurden sie langsam wieder zu Einfamilienhäusern. Ein weiteres Plus war, dass wir von dort aus die Ausfallstraße nach Bognor für den Besuch bei meiner Mutter gut erreichen konnten.
Als ich an dem Haus auf der Browning Street ankomme, verabschiedet Amber gerade ein Paar mit einem Kind im Kinderwagen und einem vielleicht zweijährigen Mädchen, das auf den Schultern seines Vaters thront, die Kapuze bis auf die Nase heruntergezogen. Amber schüttelt der Frau und dem Mann die Hand. Die kleine Gruppe kommt auf mich zu und debattiert offenbar über das Haus. Die Frau ist begeistert, der Mann verhaltener. Als sie an mir vorbeikommen, schaue ich in den Kinderwagen. Das Baby ist älter als Josh. Es schläft tief und fest, liegt so sackartig da, wie es nur Babys können, Kinn auf der Brust, alle viere von sich gestreckt, durch und durch entspannt.
»Nick«, sagt die Frau. »Ich will dieses Haus.« Sie erinnert mich an mich selbst.
Nicks Antwort entgeht mir, denn ich laufe zu Amber. Vor meinem inneren Auge steht das Bild von Josh, der in seinem Bettchen liegt und schläft, doch dann beginnt eine leise Sorge, an meiner Zuversicht zu nagen.
Browning Street Nummer 17 ist ein Reihenhaus. Der Eingang liegt in der Mitte und wird links und rechts von gleichgroßen Fenstern flankiert. Das Haus sieht schlimm aus. Die beiden Nachbarhäuser machen jedoch einen guten Eindruck, da haben die Besitzer ordentlich investiert, Lamellenjalousien angebracht, den Weg zum Eingang in schwarz-weißem Schachbrettmuster gepflastert, die Haustüren in gedämpften Farben gestrichen.
Vor sechs Jahren standen Tom und ich vor unserem Haus auf der Coleridge Street, mit Emily im Kinderwagen. Vor Aufregung brachten wir kaum einen Ton hervor und hielten uns fest an der Hand. Sarah von Johnson Lane mühte sich mit dem Schloss ab und brummelte irgendetwas über den Albtraum eines Immobilienmaklers. Irgendwann stieß sie dann endlich triumphierend die Tür auf, und diese schlug gegen einen Stapel Post, der sich flutartig über den Flur ergoss. Wir stellten den Kinderwagen auf einem sonnenbeschienenen Fleck ab. Sarah hielt sich zurück. Wahrscheinlich hatte sie erfasst, dass sie sich nicht mehr ins Zeug legen musste, wohingegen Tom und ich naiverweise dachten, wir könnten ihr etwas vormachen. Tom ließ kritische, gekünstelt klingende Bemerkungen fallen. Ich legte die Hände auf meinen sich gerade erst abzeichnenden Schwangerschaftsbauch und studierte ostentativ eine feuchte Ecke an der Decke des Wohnzimmers. Wie kleine Kinder, die einen Schatz entdecken, durchwanderten wir das Haus. Als wir den Garten erreichten, wo die Vögel sangen und langstielige Kletterrosen blühten, warf ich meine Arme um Toms Hals.
»Können wir uns das Haus leisten?«
Tom lachte. »Nein, aber wir finden einen Weg.«
Es folgte eine wundervolle, verrückte Zeit. Wir kampierten in den Räumen, die bewohnbar waren, und renovierten abends und an den Wochenenden, während Emily im Dreck herumkrabbelte. Dann kam Polly dazu, neugeboren und winzig. Wenn ich Polly nicht gerade stillte, strich ich Fensterrahmen, legte neue Dielen, brachte Vorhänge an und restaurierte beschädigte Originalstrukturen. Ich verbrachte viele lange Sommertage im Overall, fand Verschönerungsmöglichkeiten, die nicht viel kosteten. Ich war ohne Vater aufgewachsen, in einem verlotterten Haus am Strand, dessen Zimmer von meiner Mutter vermietet wurden. Sie und ich haben uns eine eindrucksvolle Palette handwerklicher Fähigkeiten angeeignet. Inzwischen können wir so gut wie alles reparieren.
Zwei Jahre lang behalfen Tom und ich uns mit einer provisorischen Küche und liefen über rohe Dielen, doch das machte uns nichts aus. Wir liebten uns, liebten unsere Zukunft, unsere Babys und unser Haus. Ich hatte nicht gewusst, wie hoffnungslos Tom als Heimwerker war, aber auch das war nicht weiter tragisch. Wenn es etwas zu tun gab, bei dem er nicht wusste, wie man es machte, hatte er auch kein Problem damit, stattdessen stundenlang Holz abzuschleifen.
Jetzt liegt mein Werkzeug ungenutzt im Keller. Es fehlt mir.
»Mein Gott, dieser Regen, komm rein.« Amber lässt mich ein und wirft einen Blick auf ihre Uhr. »Wir haben nur eine Viertelstunde, also los.«
Ich folge ihr und atme den Geruch des Hauses ein, eine schwere Mischung aus altem Teppich, Feuchtigkeit und süßlich riechendem Verfall. Mit der Hand fahre ich über die braun gestrichene Sockelleiste und schaue zu der Stuckleiste hinauf. Ihre Farbe blättert ab, aber sie ist breit und wirkt großzügig, das Profil mit Ein- und Ausbuchtung ist schlicht und elegant.
»Gefällt es dir?«, fragt Amber und zieht eine Augenbraue hoch.
»Sehr.«
Ein Anflug von Verdruss huscht über ihre Miene und verdunkelt für einen Moment ihren Blick. Es ist nur ein flüchtiger Augenblick, doch er mahnt mich, meine Begeisterung im Zaum zu halten.
»Könnte es sich um eine Art Übertragung handeln?«
»Was?«
»Na, könnte es nicht sein, dass du nur ein Ventil für deine aufgestaute sexuelle Energie suchst?«
Das ist natürlich als Witz gemeint. »Nein. Oder vielleicht ein bisschen. Aber du weißt doch, wie sehr ich alte, muffig riechende Gemäuer mag.«
»Sprichst du von dem Haus oder von deinem geheimnisvollen Mann?«
Ich lache. »Dem Haus. Definitiv.«
Amber zieht mich zur Treppe. Ein versifftes Geländer aus Mahagoni führt das Auge über drei Stockwerke in die Höhe bis zu einem Oberlicht. Das Glas ist verschmutzt und voller Vogeldreck, sodass nur milchiges Licht hindurchfällt, aber ich kann mir vorstellen, wie wunderschön es an einem Sonnentag oder in einer Mondnacht wirkt. Amber zeigt mir die Küche im hinteren Teil des Hauses, einen Raum mit vergilbten Wänden, einer Tür zum Garten und einem kleinen Fenster. Zwischen hässlichen, dreckverklebten gelben Einbauschränken befindet sich eine Spüle an der Wand. Amber drückt auf den Lichtschalter. Neonlicht flackert auf.
»Gut, dass du Josh nicht mitgebracht hast. Das kleine Mädchen bei dem Paar vorhin war ein Albtraum.«
»Dafür hat das Baby geschlafen.« Um meine Sorge um Josh zu überspielen, bücke ich mich und ziehe eine Ecke des brüchigen Linoleumbelags hoch. Die Dielen darunter machen einen soliden Eindruck.
»Sicher, aber sie haben beide Kinder unten bei mir gelassen. Unfassbar, oder? Ich bin doch kein Babysitter. Und weißt du, was sie gesagt hat?« Amber schnaubt. »›Nehmen Sie das Baby bitte nicht aus dem Kinderwagen.‹ Als wäre es so süß, dass ich nicht widerstehen könnte. Also wirklich.«
Ich ringe mir ein Lächeln ab. »Ich habe nie jemanden aus diesem Haus kommen oder hineingehen sehen. Seit wann steht es schon leer?«
»Noch nicht lange. Die Dame, der es gehört, ist letzte Woche in ein Pflegeheim gekommen. Sie ist dreiundneunzig und hat offenbar sehr zurückgezogen gelebt. Die Besitzverhältnisse müssen noch geklärt werden, aber ich glaube nicht, dass das Haus noch lange zu haben ist. Wenn du es willst, fang schon mal an, die Krallen zu wetzen.«
Ich streiche über die braune Tapete und zupfe an einem Riss. »Ich muss Tom überreden, das wird eine Weile dauern. Wenn es nach ihm ginge, würden wir immer noch in unserer alten Mietwohnung hocken.«
Ambers Miene zerfällt.
»Entschuldige, so war das nicht gemeint.«
»Schon gut.«
Ist es nicht. Ich habe sie gekränkt. Robert ist selbstständig, und die beiden zahlen eine horrende Miete, um in einer Gegend zu wohnen, die für seine Kunden gut erreichbar ist. Die Anzahlung auf ein Haus haben sie bisher noch nicht aufbringen können. Normalerweise umgehe ich dieses Thema. Man muss vorsichtig sein, wenn man die eigene Karriere zur gleichen Zeit wie seine Freunde gestartet und diese dann überholt hat. Meine Taktlosigkeit muss an den Ereignissen des vergangenen Tages und an der unruhigen Nacht liegen.
»Du bekommst schon noch das, was du dir wünschst. Du bist der zielstrebigste Mensch, den ich kenne.«
Amber verdreht die Augen. »Wenn du meinst.«
»Ja, natürlich. Es ist nur eine Frage der Zeit.«
»Hoffentlich.«
Wir gehen in den nächsten Raum. Amber wartet, während ich mich umschaue. Ich spüre, dass sie etwas sagen möchte.
»Du solltest das, was du hast, nicht als selbstverständlich hinnehmen«, sagt sie.
»Meinst du Tom oder unser Haus?« Bei ihren Worten fühle ich mich unbehaglich, aber wahrscheinlich habe ich das verdient.
»Beides. Du weißt nicht, wie gut du es hast.«
»Doch.«
»Warum setzt du es dann aufs Spiel?«
»Weil ich jemand bin, der Risiken eingeht. Deshalb bin ich mit einundzwanzig schwanger geworden. Deshalb gehört uns ein Haus auf der Coleridge Street. Das Haus konnten wir uns nicht leisten, aber wir haben es trotzdem gekauft. So etwas könnt ihr übrigens auch tun.«
»Vielleicht.«
»Amber …«, beginne ich, aber da hat sie den Raum schon verlassen.
Ich folge ihr ins Wohnzimmer. Es ist besser in Schuss als die anderen Räume, und der Marmorkamin ist großartiger als der in unserem Haus. Auf den breiten Dielen liegt ein Perserteppich. Die Lücken zwischen den Dielen haben sich in das Gewebe des Teppichs gegraben. Die Wand über der Gardinenstange ist feucht, doch sonst sind die unteren Räume schön geschnitten, und ich kann mir gut vorstellen, hier zu wohnen. Im Geist überschlage ich die Kosten. Wir könnten es schaffen. Die Hypothekenzinsen sind immer noch niedrig, und Tom hat von seinem Großvater ein wenig Geld geerbt, das wir verwenden könnten. Es wird eng werden, ganz ohne Zweifel, sich aber auf lange Sicht auszahlen. Am liebsten würde ich jetzt schon ein Angebot abgeben. Zum ersten Mal seit Tagen lebe ich auf, lasse mich von diesem Projekt verlocken und gebe mich den rosigsten Fantasien hin.
»Komm weiter«, sagt Amber, wieder ganz geschäftsmäßig. »Ich zeige dir noch die oberen Etagen, und dann kannst du einen Blick in den Garten werfen.«
Durch das Rauschen des Regens höre ich es zuerst nicht. Wir stehen im Hauptschlafzimmer und begutachten den Wasserschaden an den Fensterrahmen. Amber erklärt, wie wundervoll das Zimmer aussehen wird, wenn erst die Fensterläden restauriert sein werden. Es ist nur ein schwaches Geräusch, mir jedoch so vertraut, dass ich herumfahre und die Ohren spitze. Ich laufe zur Tür und lausche. Es kommt von oben. Dort weint ein Baby.
»Vicky?« Amber berührt meinen Arm.
Ich beachte sie nicht und steige die Treppe hinauf. Auf den Stufen zum obersten Stockwerk liegt kein Teppich. Sie sind verstaubt, als hätten die Bewohner des Hauses diesen Teil schon vor langer Zeit aufgegeben. An den Wänden hängen zusammengewürfelte Bilder – altmodische Jagdszenen, nichtssagende Aquarelle, banale Ölgemälde der Art, wie sie als Restposten bei Auktionen auftauchen oder in einem gemeinnützigen Laden einsam und unbeachtet an der Wand lehnen. Das Weinen zieht mich an wie ein Magnet. Aber auf dem Flur oben bleibe ich verunsichert stehen. Die Zimmertüren sind geöffnet, die Räume leer, und doch höre ich es deutlich. Es ist das Schluchzen eines Kindes, zu dem niemand kommt, um es zu trösten.
»Es ist das Baby im Nachbarhaus«, sagt Amber. »Sie haben ein kleines Mädchen. Das Geschrei geht einem durch und durch, findest du nicht?«
»Ich muss nach Hause«, antworte ich übergangslos.
»Du hast doch den Garten noch gar nicht gesehen.« Draußen vor dem Fenster ist es so dunkel wie an einem Nachmittag im November. Es regnet noch immer wie aus Eimern. Auf dem Ast eines Baums hockt eine dicke Taube und wirkt unglücklich.
»Ich komme morgen noch mal, wenn ich keine Arche brauche.«
Ich bin in einer solchen Eile, dass ich auf der Treppe ausrutsche und meinen Ellbogen an der Wand aufscheuere. Amber packt meinen Arm und zieht mich hoch.
»Mach langsam. Was soll die Panik? Die nächsten Interessenten kommen erst in ein paar Minuten. Sag mir, wie dir das Haus gefällt.«
»Es ist fantastisch. Ich rufe dich an, aber jetzt muss ich los. Magda soll putzen, sie kann nicht auch noch auf Josh aufpassen.«
»Morgen Abend ist sie bei uns als Babysitter«, sagt Amber, tritt zurück und wischt ein wenig Staub vom Saum ihres Trenchcoats. »Ich weiß nicht, was ich ohne sie machen würde.«
Mist. Was ist, wenn Magda ihr erzählt, dass sie heute gar nicht bei mir war? Ich hätte Josh nicht allein lassen dürfen. Was habe ich mir nur dabei gedacht?
»Ach, und nur damit du es weißt: Ich habe Magda auch schon für die Cocktailparty der Forsyths als Babysitter engagiert.«
Amber sieht mich an und wartet auf meine Reaktion.
»Entschuldige.« Ich öffne die Haustür. »Das Haus ist wunderbar. Ich brauche noch Zeit, um nachzudenken und mit Tom zu sprechen, aber ich würde es sofort nehmen.«
»Soll ich vorbeikommen und euer Haus schätzen?«, ruft Amber mir nach. »Würde dir das helfen?«
Irgendetwas liegt in ihrer Stimme, ein Hauch Verzweiflung, der mir nachschwebt, als ich durch den Regen nach Hause laufe.
Amber steht im Türrahmen, schaut Vicky nach und verzieht mitfühlend das Gesicht, als ihre Freundin auf der Straße von einem vorbeifahrenden Auto nass gespritzt wird. Sie wundert sich über Vickys Hektik, doch dann zuckt sie mit den Schultern und schaut durch den Regen auf einen Wagen, der sein Tempo drosselt. Die nächsten Interessenten. Die Frau auf dem Beifahrersitz gibt dem Fahrer ein Zeichen. Amber vergisst Vicky, winkt den beiden fröhlich zu und nimmt sie mit aufgespanntem Schirm in Empfang.
»Mrs. Tarrant?«, fragt sie. »Hallo. Ich bin Amber Collins.«
Mr. und Mrs. Tarrant wissen genau, was sie wollen, und brauchen Ambers Verkaufsrede nicht. Das Haus hat so etwas auch gar nicht nötig. Das Objekt Browning Street Nummer 17 verkauft sich von allein. Amber fährt mit der Hand über das splittrige Holz der Fensterbank in einem der oberen Zimmer. Ihr ist, als hätte sie sich in das Haus verliebt, als läge in seinem Geruch etwas moschusartig Männliches und die Wände wären Arme, die sie umfangen wollen. Es ist verrückt, aber fast möchte sie die sich abschälende Tapete mit dem Mund berühren, sich an die Wand schmiegen. Warum können sie und Robert nicht so ein Haus haben? Vielleicht sollte sie tatsächlich Vickys Rat befolgen und auch ein Risiko eingehen. Amber blickt sich um und malt sich aus, die mit neuem Teppich ausgelegte Treppe hinaufzusteigen, in einer Badewanne mit Löwentatzen zu liegen, sich in einer todschicken Küche zu bewegen. Nein, einen solchen Schritt würde sie nicht wagen. Oder doch? Nein, das würde Vicky ihr niemals verzeihen.
Amber nagt an ihrer Unterlippe. Aber vielleicht würde ihr das gar nichts ausmachen. Immerhin hat Vicky das oberste Gebot ihrer Freundschaft gebrochen. Sie hat gelogen. Sie, Amber, wollte immer wie Vicky sein, aber jetzt ist sie sich dessen nicht mehr sicher. Sie kann nicht fassen, dass ihre Freundin bereit war, alles, was sie hat, für ein billiges, kleines Liebesabenteuer aufs Spiel zu setzen. Armer Tom. Arme Kinder.
»Wie sieht es mit den Schulen in der Umgebung aus?«
Amber fährt zusammen. Sie hat die Tarrants nicht zurückkommen hören. Mit ihrem strahlendsten Lächeln dreht sie sich zu ihnen um.
»Staatliche oder private?«
»Private.«
Sie unterhalten sich über Erziehung und kleine Kinder, unverfängliche Themen, die Amber wieder erden. Mrs. Tarrant durchquert den Raum, schaut aus dem Fenster und betrachtet mit gerunzelter Stirn die verzogenen Fensterrahmen. Ambers Handy klingelt.
»Geht um den Termin um elf«, sagt Sarah. »Die Leute haben abgesagt.«
Amber wirft einen Blick auf ihre Uhr. Jetzt kann sie in dem eiskalten Haus eine halbe Stunde lang die Zeit totschlagen. Na großartig.
Die Handtasche schlägt gegen meine Hüfte, und ich bin schon außer Atem, noch bevor ich die nächste Straße erreiche. Ich werde langsamer, keuche und lege die restliche Strecke im Eilschritt zurück. Mein Gehirn fühlt sich überhitzt an.
Amber wird erfahren, was ich getan habe.
Vielleicht kann ich Magda ja bestechen.
Doch das würde bedeuten, dass ich Magda die Wahrheit sagen müsste.
Ich könnte Magda eine SMS schicken, ihr raten, den verdorbenen Magen und Darm bei Amber lieber nicht zu erwähnen, wenn sie dort am kommenden Abend babysitten will. Dann könnte sie Amber auch nicht erzählen, dass sie heute nicht bei mir war.
Ja, das wäre das Beste.
Josh schreit. Damit habe ich nicht gerechnet, und es überläuft mich kalt. Er ist so laut, dass man ihn sogar auf der anderen Straßenseite hört. Als ich meinen Schlüssel ins Schloss ramme, klingelt das Telefon. Da ich angeblich zu Hause bin, stürze ich ins Wohnzimmer und an das Telefon auf der Anrichte.
»Vicky?«
»Ich kann jetzt nicht, Mum, ich rufe dich zurück.«
»Es ist nur eine kleine Sache, ich …«
»Mum, Josh hat gerade einen Wutanfall. Bitte. Ich melde mich wieder.«
Irgendetwas stimmt nicht. Als ich aufgebrochen bin, stand die Tür des Wohnzimmers offen. Wir schließen sie nur selten. Langsam stelle ich das Telefon zurück. Die Türen zur Terrasse sind nur angelehnt, auf dem Fußboden liegen Glas- und Holzsplitter.
»Verdammt.«
Ich rase die Treppe hinauf, stürme in Joshs Zimmer, bleibe abrupt stehen und schreie auf. Da ist jemand, eine große Gestalt im Dämmerlicht, die hier nichts zu suchen hat. Es ist ein dunkel gekleideter Mann. Er hat Josh an seine Brust gedrückt und hält ihm den Mund zu. Josh wirkt erstarrt, wehrt sich nicht und ist verstummt. Seine tränenglänzenden Augen sind riesig und schauen verwirrt um sich.
»Tun Sie ihm nichts.« Meine Arme hängen herunter. »Bitte.« Noch nie hat mich ein solches Entsetzen befallen. Es betäubt meinen Körper und lähmt mein Hirn.
Unten beginnt das Telefon, wieder zu klingeln, ein Geräusch, das sich schlagartig auf die Szene auswirkt. Noch bevor ich reagieren kann, macht der Mann einen Satz, wirft mir mein Baby zu und rennt an mir vorbei. Ich taumele zurück, stoße gegen die Kante der halb offenen Tür und treffe mit dem Musikknochen auf. Der Schmerz rauscht bis in mein Handgelenk, sodass ich Josh nicht richtig fange und er mit einem schrecklichen Geräusch auf den Boden fällt. In meinem Rücken reißt der Mann die Tür weiter auf. Ich will ihm aus dem Weg springen und gleichzeitig Josh aufheben, doch dabei stoße ich mit dem Fuß gegen Josh, und er schreit vor Schmerz auf. Dann ist es vorbei. Der Mann ist fort. Ich höre ihn die Treppe hinunterrennen und wiege meinen schreienden Sohn in den Armen.
Im nächsten Augenblick spüre ich die Gegenwart eines anderen Menschen, richte mich langsam auf und drehe mich um. Amber steht im Türrahmen und starrt mich mit offenem Mund an. Scham mischt sich in die Erleichterung, die ich bei ihrem Anblick empfinde. Ich sehe sie an und bitte sie stumm, mich nicht zu verurteilen.
6
»Mein Gott, Vicky!« Amber lässt sich an meiner Seite nieder. »Ist alles in Ordnung?«
»Nein«, flüstere ich.
»Gib mir Josh, bevor du in Ohnmacht fällst.«
Sie will ihn mir abnehmen, aber ich weiche zurück und lege schützend den Arm um ihn. Amber lässt mich gewähren, steht auf und hält mir eine Hand hin. Mit ihrer Hilfe stolpere ich zu dem Schaukelstuhl im Zimmer und setze mich. Vorsichtig lege ich Josh auf meine Schenkel, mit dem Gesicht zu mir. Er ist so still, dass es mir Angst macht.
»Ich muss mit ihm in die Notaufnahme. Ich glaube, er hat sich den Arm gebrochen.«
Amber öffnet die Vorhänge und zieht die Rollos hoch. Der graue Morgen wirft verwaschenes Licht ins Zimmer. Joshs Gesicht ist blass, und um den Mund herum ist die Haut bläulich.
»Ich fahre dich.«
Erst jetzt bin ich in der Lage, meine Aufmerksamkeit auf sie zu richten. »Was ist aus deinem Besichtigungstermin geworden?«
Amber kommt und streicht Josh über die Stirn. Er schaut sie mit großen Augen an. »Wurde abgesagt. Ich dachte, ich springe kurz bei dir vorbei. Was um alles in der Welt ist denn passiert? Ich habe einen Mann aus dem Haus laufen sehen.«
»Das war ein Einbrecher. Ich habe ihn überrascht.«
»Allmächtiger.«
Auf dem Flur oben hängt sein Geruch noch in der Luft. Abgestandener Zigarettenrauch und Schweiß. Wir gehen nach unten. Vor der Tür zum Schlafzimmer bleibe ich stehen. Amber betritt es zuerst, verharrt und stemmt die Hände in die Hüften. Die kleinen Holzschubladen an meiner Frisierkommode sind aufgezogen, der glitzernde Inhalt liegt auf dem Bett. Es ist nichts Wertvolles darunter.
»Er hat deinen Safe nicht gefunden. Wenigstens etwas.«