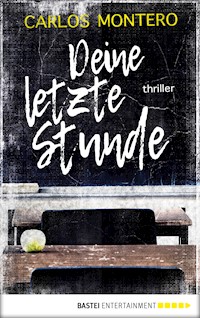
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Und du, wann stirbst du wohl?" Das steht auf dem Zettel, den die junge Lehrerin Raquel an ihrem ersten Tag an der neuen Schule findet. Kurz nachdem sie erfahren hat, dass ihre Vorgängerin Viruca sich das Leben genommen hat. Warum, kann ihr keiner erklären. Wurde Viruca wirklich von ihren Schülern in den Tod getrieben, wie ihr Exmann behauptet?
Raquel hat schon bald Grund genug, diese gewagte Hypothese zu glauben. Denn die Schüler scheinen mit ihr das gleiche perfide Spiel zu wiederholen - bis auch sie mit den Nerven völlig am Ende ist ...
Eine beängstigend realistische Geschichte, die mit harmlosen Schülerstreichen beginnt und sich zu einem atemberaubenden Psychothriller entwickelt
Ausgezeichnet mit dem Premio Primavera 2016
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
CoverInhaltÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmungZitatKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36Kapitel 37Kapitel 38Kapitel 39Kapitel 40Kapitel 41Kapitel 42Kapitel 43Kapitel 44Kapitel 45Kapitel 46Kapitel 47Kapitel 48Kapitel 49Kapitel 50Kapitel 51Mein Dank geht anÜber dieses Buch
»Und du, wann stirbst du wohl?« Das steht auf dem Zettel, den die junge Lehrerin Raquel an ihrem ersten Tag an der neuen Schule findet. Kurz nachdem sie erfahren hat, dass ihre Vorgängerin Viruca sich das Leben genommen hat. Warum, kann ihr keiner erklären. Wurde Viruca wirklich von ihren Schülern in den Tod getrieben, wie ihr Exmann behauptet? Raquel hat schon bald Grund genug, diese gewagte Hypothese zu glauben. Denn die Schüler scheinen mit ihr das gleiche perfide Spiel zu wiederholen – bis auch sie mit den Nerven völlig am Ende ist … Eine beängstigend realistische Geschichte, die mit harmlosen Schülerstreichen beginnt und sich zu einem atemberaubenden Psychothriller entwickelt Ausgezeichnet mit dem Premio Primavera 2016.
Über die Autorin
Carlos Monetro wurde 1972 in der spanischen Region Galizien geboren, wo auch dieser Roman spielt. Nach dem Studium der Kommunikationswissenschaften in Madrid hat er sich als Drehbuchautor einen Namen gemacht. Neben mehreren Kurzfilmen war er an zahlreichen Fernsehserien und einer Kinoproduktion beteiligt. Für seinen zweiten Roman »Deine letzte Stunde« wurde Carlos Montero 2016 mit dem hochdotierten Premio Primavera de Novela ausgezeichnet.
CARLOS MONTERO
Deine letzte Stunde
Thriller
Aus dem Spanischen vonLutz Kliche
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © Carlos Montero Castiñeira, 2016, © Espasa Libros S. L. U., 2016
Titel der spanischen Originalausgabe: »El desorden que dejas«
Originalverlag: Headline Book Publishing, A division of Hodder Headline
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Doris Engelke, Frankfurt am Main
Umschlaggestaltung: Manuela Städele-Monverde
Titelillustration: © Source/gettyimages; © Marilyn Volan/shutterstock
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-6094-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Guille, wegen so vielem.Für meine Schwester, immer.
In der modernen spanischen Gesellschaft wird der Gebrauch des Du (tú) gegenüber dem Sie (usted) viel zwangloser gehandhabt als im Deutschen, auch zwischen Lehrern und Schülern. Dies ist zugunsten größerer Authentizität in der deutschen Übersetzung beibehalten worden.
Kapitel 1
Der Fotograf, ein beleibter Mann Mitte fünfzig, ermunterte das Brautpaar, bis an das sumpfige Seeufer zu gehen, hinter die Becken mit den heißen Quellen aus der Römerzeit. Sein umfangreicher Bauch hinderte den Mann nicht daran, sich zu bücken, rückwärtszugehen und über alles hinwegzusteigen, was ihm im Weg lag, um die besten Bilder zu schießen. Im Winter befüllte das Wasser des Stausees für gewöhnlich die Becken, doch weil es im vergangenen Herbst kaum geregnet hatte, ließ der niedrige Wasserspiegel einen Teil der römischen Ruinen und ein sandiges Ufer erkennen, das eher einem Strand glich. Den Sand bedeckten Tausende trockener Blätter, deren Bäume sich ängstlich vom Wasser zurückgezogen zu haben schienen. Dabei war eigentlich das Wasser wegen der Dürre vor ihnen geflohen. An diesem kalten Wintertag schufen die heißen Quellen mit ihrem Dampf eine gespenstische Atmosphäre, nichts Besonderes für die Einwohner der Provinz Ourense, doch für Fremde immer noch ein eindrucksvolles Schauspiel. Heiße Quellen waren wieder in Mode gekommen und hatten den Río Miño an Orten wie A Chubasqueira oder Outariz zur Touristenattraktion gemacht. Gleiches galt für den Stausee von As Conchas am Rio Lima, im Süden der Provinz, fast an der Grenze zu Portugal. Tausende von Besuchern kamen Jahr für Jahr hierher, um im warmen Wasser dieser natürlichen Whirlpools zu baden. »Was brauchen wir Island?«, pflegten stolz die Einwohner zu sagen. »Wir haben doch Galicien!«
»Der Himmel über dem Stausee gibt sicher einen prächtigen Hintergrund ab«, meinte der Fotograf und wischte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn.
»Ist es am Ufer nicht zu nass?«, fragte die Braut. »Ich möchte mir das Kleid nicht schmutzig machen!«
Der Fotograf bückte sich und prüfte mit der rechten Hand den Sand.
»Trocken. Kommt ruhig her.«
Das Brautpaar gehorchte, obwohl es nicht gänzlich überzeugt wirkte, etwas, woran der Fotograf gewöhnt war; ein Teil seiner Arbeit bestand darin, Braut und Bräutigam dazu zu bringen, für zwanzig Minuten die Hektik des Tages und die Verpflichtungen ihren Gästen gegenüber zu vergessen. Er hatte ein Repertoire passender Kommentare parat, um das Brautpaar abzulenken: Leg ihr den Arm um die Taille, schau sie mal so an wie früher, als du noch in sie verliebt warst. Wie wär’s mit einem Kuss? Warum nicht auf den Mund? Vielleicht muss ich ja auch in der Hochzeitsnacht dabei sein und euch zeigen, wie das alles geht, ihr scheint wirklich noch ein bisschen grün zu sein.
Normalerweise verfehlte dieser Humor, so lahm er auch sein mochte, nicht die beabsichtigte Wirkung. Das Brautpaar entspannte sich und konnte den Augenblick sogar genießen. Aber diesmal schien es nicht zu funktionieren.
»Lasst uns schnell machen, die Leute werden schon unruhig«, sagte der Bräutigam und schaute zum zigsten Mal auf sein Smartphone.
»Kannst du denn nicht mal bei deiner Hochzeit das Handy in Ruhe lassen?«, schimpfte die Braut.
»Die meisten Nachrichten schickt mir dein Vater. Was soll ich denn machen?«
»Wir sind sofort fertig, ich schwör’s euch«, versicherte der Fotograf. »Noch zwei Aufnahmen und das war’s. Andrea, schau doch mal zum See. Stell dir vor, du siehst da eine tolle Segelyacht, und die zeigst du deinem Mann.«
»Mein Mann … Klingt irgendwie komisch.«
»Daran wirst du dich jetzt wohl gewöhnen müssen«, gab der gut gelaunt zurück.
»Na dann, mein lieber Mann, schau mal, was für eine tolle Yacht dort vorbeisegelt.«
Lächelnd führten die beiden ihre kleine Pantomime auf, bis die Braut plötzlich erschrocken das Gesicht verzog.
»Was schwimmt denn da im Wasser?«, stieß sie hervor und zeigte auf ein Bündel, das etwa hundert Meter vom Ufer entfernt trieb. »Ist das ein Floß?«
»Wo denn? Ohne Brille fällt’s mir schwer …
»Da drüben.«
Der Mann kniff die Augen zusammen und verstand sofort das Entsetzen seiner frischgebackenen Ehefrau.
»Das ist ein Körper … nackt … und …«
»Wo denn?«, fragte der Fotograf.
»Ist das eine Leiche?«
Der Fotograf tauschte, so schnell seine dicken Finger es erlaubten, das 50mm-Objektiv seiner Kamera gegen ein 200mm-Teleobjektiv und suchte damit den See ab. Schließlich bekam er den Gegenstand in den Sucher. Tatsächlich: Das, was da im Wasser trieb, war eine Leiche. Ein aufgedunsener Körper, die Haut bläulich verfärbt, die Lippen violett, Schaum vor dem Mund, die Gesichtszüge entstellt, das Haar wirr. Er sah genauso aus wie die Leichen in den Krimiserien, die seine Frau fast jeden Abend anschaute. In schneller Folge drückte er auf den Auslöser.
»Kannst du was erkennen? Ist es ein Toter?«, fragte der Bräutigam entsetzt. Die Braut krallte sich in seinen Arm und wartete voller Angst auf die Antwort des Fotografen.
»Eine Tote. Es ist eine Frau. Nicht sehr alt«, bestätigte der Fotograf. »Besser, du rufst die Guardia Civil.«
Die Braut konnte ein Würgen nicht unterdrücken. Sie musste sich übergeben. Erbrochenes spritzte auf ihr Kleid. Ihr Mann reichte ihr ein Taschentuch, damit sie sich säubern konnte.
»Lass nur, lass nur.« Plötzlich schien es ihr fehl am Platz, sich um ein paar Flecken auf ihrem Kleid zu sorgen.
Eine Stunde später erreichten mehrere Funkstreifen den Schauplatz. Nur der Fotograf befand sich noch vor Ort, er hatte es für seine Pflicht gehalten, auf die Hüter des Gesetzes zu warten.
Mit einem Schlauchboot gelang es, den leblosen Körper an Land zu bringen. Wenig später trafen auch der Untersuchungsrichter und die Gerichtssekretärin ein.
»Ich glaube, das ist sie, Herr Richter«, konstatierte der Wachtmeister Giménez.
»Wer denn?«
»Die Lehrerin aus Novariz, die seit einer Woche verschwunden ist. Armes Mädchen.«
Kapitel 2
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass die Gründe für den schlimmsten Stress folgende sind: der Tod eines geliebten Menschen, das Ende einer Liebesbeziehung und ein Umzug.
Der Tod eines geliebten Menschen: passt. Oder besser gesagt: passt genau.
Umzug: der, den mein Mann und ich gerade in Angriff nehmen. Wir geben unsere Wohnung im Montealto-Viertel von A Coruña auf, wo wir die letzten sechs Jahre gelebt haben.
Das Ende einer Liebesbeziehung: Das sehe ich kommen, wenn wir uns verdammt noch mal nicht einigen können, was wir wegwerfen und was wir behalten sollen.
»Diesen Mantel hast du nicht mehr angezogen, seit du auf der Uni warst.«
»Den hat mir aber mein Vater geschenkt. Viele Erinnerungsstücke an ihn habe ich ja nicht.«
»Germán, hatten wir nicht verabredet, dass es jetzt langsam reicht mit dem: ›Mein Vater ist vor Kurzem gestorben‹?«
»Aber es ist doch nicht einmal vier Monate her …«
»Okay, dann probier ihn mal an. Wenn du wirklich meinst, dass er dir noch steht, dann kommt er in die Umzugskisten.«
Germán zieht ihn über und blickt in den Spiegel.
»Na, wie findest du ihn?«, fragt er. Im Spiegel sieht er etwas, das ihm nicht gefällt, fährt sich mit der Hand übers Haar und seufzt missmutig. »Es werden immer weniger. Ich glaube, ich habe während der Monate im Krankenhaus viele verloren. Niemand sagt dir etwas über die Begleiterscheinungen, wenn dein Vater krank ist.«
»Du wirst schon keine Glatze kriegen.«
»Das will ich hoffen. Gefällt dir der Mantel?«
Ich schaue ihn an und weiß nicht genau, was ich antworten soll.
»Er sieht entsetzlich aus«, gibt er sich geschlagen. »Hast du dich tatsächlich in mich verliebt, als ich dieses Ding anhatte?«
»Eher, als du es ausgezogen hast.«
Germán beginnt, den Mantel mit übertrieben lasziven Bewegungen auszuziehen und trällert dabei eine anzügliche Melodie.
»Tut mir leid, die Wirkung ist nicht mehr die gleiche«, sage ich mit gespieltem Ernst. »Mein Höschen ist ganz trocken.«
Germán muss lachen. Ein ansteckendes Lachen. Vielleicht sind wir deshalb nach zwölf Jahren noch zusammen. Weil wir manchmal miteinander lachen können. Dabei fällt es mir seit der Geschichte mit seinem Vater von Tag zu Tag schwerer, ihm ein Lächeln zu entlocken. »Die Geschichte mit seinem Vater« ist nichts anderes als dessen Tod. Komisch, wie wir versuchen, den Tod aus unserem Leben herauszuhalten, sogar aus der Sprache. Die Geschichte mit seinem Vater.
Tere meint, ich klinge wie eine alte Schachtel, wenn ich über meine Beziehung zu Germán spreche. Eine alte Schachtel von mindestens fünfundvierzig. Sie findet nämlich alles alt, was oberhalb unseres eigenen Alters von vierunddreißig liegt. Deshalb hat sie sich jetzt darauf verlegt, mit ein oder zwei Typen pro Woche ins Bett zu steigen. Sie will das letzte Jahr nutzen, das ihr noch vor dem körperlichen Verfall bleibt. Ich antworte dann, dass ich immerhin schon seit dem zweiten Jahr an der Uni mit Germán zusammen bin. Zwölf Jahre liegen hinter uns, eine Hochzeit, zwei Fehlgeburten, der Tod seines Vaters, der Tod meiner Mutter, vier Umzüge, seine zweieinhalb Jahre ohne Job, die immer länger zu werden scheinen. Obwohl er nie zugeben würde, dass er arbeitslos ist. Eigentlich schreibt er ja, nur dass er nicht schreibt und, weil er nicht schreibt, immer depressiver wird. Dieser Beschreibung müsste man noch eine hässliche Geschichte hinzufügen, die wir beide aber lieber vergessen wollen. Wir versuchen das so sehr, dass ich manchmal denke, unsere Ehe beschränkt sich nur noch darauf: zu vergessen, was geschehen ist. Wir erwähnen es nicht mal mehr. Theoretisch haben wir es längst vergessen. Beide glauben wir verbissen, dass es ein gemeinsames Leben danach gibt, und das probieren wir jetzt auch. Vielleicht ist es bitter, das zuzugeben, aber der Tod meiner Mutter und der seines Vaters haben uns dabei geholfen, durchzuhalten. In den schwierigsten Momenten haben wir uns gegenseitig sehr gebraucht.
Zu diesen beiden Tragödien kommen noch meine Versuche, die Abschlussprüfung als Lehrerin zu bestehen. Und jetzt die Reiserei, diese Vertretungsjobs, die ich an den entlegensten Schulen überall in Galicien übernehme. Denn ich habe zwar die Prüfung nicht bestanden, bekam jedoch ausreichend gute Noten, um als Vertretung zu arbeiten. Wenn eine Lehrkraft drei, vier Wochen oder auch ein paar Monate ausfällt, springe ich ein. Ich bin Vertretungslehrerin. Tere hat mir sogar ein T-Shirt drucken lassen: »Vertretungslehrerin – nicht zu entmutigen«.
Ja, stimmt genau. Was soll ich denn sonst auch machen? Meine Arbeit macht mir halt Spaß, selbst wenn ich die Schüler nie so lange unterrichten kann, wie ich möchte. Es hat mich nicht von Anfang an zum Lehrerberuf hingezogen. Im Gegenteil, eigentlich wollte ich nie an die Schule. Doch als ich das Unterrichten dann ausprobierte, fand ich schnell Gefallen daran. Vielleicht geht es mir irgendwann wie so vielen Lehrern, der Beruf hängt mir zum Hals raus, ich sehe, wie die Jahre vergehen, wie ich alt werde und die Schüler im Gegensatz zu mir noch immer genauso jung und energiegeladen sind. Aber im Moment kann ich mir das nicht vorstellen. Und außerdem gibt es ja auch Lehrer, die bis zum Schluss mit Begeisterung dabei sind, oder? Warum soll ich nicht eine von denen sein?
Diesmal habe ich Glück gehabt. Ich übernehme eine Vertretung von fast sieben Monaten. Das ist über ein halbes Schuljahr. Da werde ich mich wie eine echte Lehrerin fühlen. Mehr als sechs Monate, in denen ich die Schüler sich entwickeln sehe, ihnen weitergeben kann, was ich weiß. Das ist vielleicht nicht besonders viel, aber ich denke, zwei, drei Sachen kann ich ihnen schon beibringen. Wenigstens ist es lang genug, um in ihnen die Liebe zur Literatur, zu den Büchern zu wecken. Okay, okay, ich bleibe besser auf dem Teppich, ich klinge ja schon wie der Lehrer aus dem Club der toten Dichter. Ich stehe mit beiden Beinen auf dem Boden, und dass ich schon ein gewisses Alter erreicht habe – »Dreiundreißig ist kein gewisses Alter, meine Liebe, ein gewisses Alter beginnt mit sechzig«, würde Tere sagen –, macht mich zu einem ziemlich realistischen Menschen.
Die Vertretung ist außerdem und zu Germáns Freude an einer der zwei Schulen in seinem Heimatort, und zwar genau an der, wo er Schüler war. Zufall? Schicksal? Oder passiert das manchmal einfach so?
Und deshalb ziehen wir jetzt um. Germán kommt mit. So haben wir es beschlossen. Besser gesagt, er hat es beschlossen. Doch eins der Geheimnisse, um eine Ehe am Leben zu erhalten, ist es, in der Mehrzahl zu sprechen, auch wenn einer eine Entscheidung trifft und der andere nicht ganz einverstanden ist. Wenn du im Plural sprichst, glaubst du schließlich selbst, dass es eine gemeinsame Entscheidung war, und kommst besser damit klar.
Außerdem muss ich meinem Mann eins zugestehen: Germán ist schon das ganze letzte Jahr über ein bis zwei Mal pro Woche nach Hause gefahren, erst, um seinen kranken Vater zu pflegen, und dann, um sich um seine Mutter zu kümmern. Er hat es satt, dauernd unterwegs zu sein. Dies ist eine tolle Gelegenheit für uns beide, um in angenehmer Umgebung noch einmal neu anzufangen. Germáns Heimatort ist eine Kleinstadt mit zwölftausend Einwohnern tief in der galicischen Provinz, eine Gegend voller Geschichte, nebelverhangen, mit vielen Brücken aus der Römerzeit, vielen heißen Quellen, viel Grün, ein paar Barockklöstern, viel Fremdenverkehr im Sommer, aber im Grunde ein Dorf. Ah, und von der Krise gebeutelt: Einst ging es den Leuten dort gut, weil es eine große Konservenfabrik gab. Die machte aber pleite, und das ganze Städtchen gleich mit. Alles in allem haben sechstausend Menschen in der Region ihre Arbeit verloren. Die Arbeitslosenquote ist die höchste im ganzen Land. Und man darf den Ort niemals »Dorf« nennen, da sind sie beleidigt. Für sie ist es eine Stadt. Germáns Familie lebt fast komplett dort. Trotz des Dramas mit meinem Schwiegervater gibt es für Germán keine bessere Umgebung als seine Familie. Man muss zugeben, sie haben immer zusammengehalten, und die Stürme des Lebens haben sie noch mehr zusammengeschweißt. Sie können Krach haben, sich anschreien, sich die schlimmsten Sachen an die Köpfe werfen, doch nichts kann sie auseinanderbringen. Ich glaube, Germán muss in der Nähe seiner Leute sein, um das Andenken seines Vaters zu wahren und den Verlust zu verkraften. Darin sind wir ziemlich verschieden.
Insgeheim fürchte ich, wenn man mich nach den sieben Monaten an eine andere Schule versetzt, beschließt Germán, dass es jetzt reicht mit der Umzieherei und wir einfach in seinem Heimatort bleiben sollten. Vielleicht fällt ihm sogar ein, ein für alle Mal das Schreiben zu vergessen und in den Familienbetrieb einzusteigen. Ich dränge ihn zwar nicht dazu, aber es fällt mir schwer, ihn leiden zu sehen. Seine Unfähigkeit, mehr als eine halbe Seite pro Tag zu Papier zu bringen, lässt ihn schier verzweifeln. Die fehlende Inspiration versetzt ihn in einen Zustand der Lähmung, aus dem er nur schwer wieder herauskommt. Und während er sich anfangs immer auf mich gestützt hat, um diese düsteren Phasen zu überwinden, funktioniert das jetzt nicht mehr richtig. Er hat das Gefühl, ich kritisiere ihn zu viel. »Schon gut, Frau Professor …«, sagt er dann. Deshalb möchte er seine Familie in der Nähe haben, bei ihr fühlt er sich geborgen. Dort ist er wieder der Sohn, der immer alles richtig macht, der Talentierte, der Klassenbeste und der Klügste der Familie. Und wenn wir vielleicht doch noch Kinder bekommen, dann wäre es, so meint er, auf jeden Fall gut, die Familie in der Nähe zu haben.
Doch genau da liegt das Problem. Seine Familie ist nicht meine Familie. Und was Kinder angeht, so habe ich nach zwei Fehlgeburten weder Kraft noch Lust, es noch mal zu versuchen. Germán denkt, es ist wegen jener hässlichen Geschichte, über die wir nicht reden. Doch das ist nicht der Grund, ich hab einfach genug damit zu tun, die Kinder zu erziehen, die ich unterrichte. Ich habe versucht, das Germán zu erklären, doch er meint, ich sei zu negativ, wir hätten wohl zu lange in der Scheiße gesteckt, als dass ich akzeptieren könne, dass jetzt alles besser würde. Ob ich denn nicht sähe, dass die Vertretungsstelle in seinem Heimatort ein Zeichen dafür ist, dass die Dinge sich verändern.
»Wir haben’s aber auch verdient, oder nicht, Raquel? Wir haben’s verdient, dass das Leben ein bisschen freundlicher zu uns ist.«
Vielleicht hat er ja recht. Vielleicht sollte ich mich nicht gegen das sperren, was auf uns zukommt. Sein Dorf ist nicht übel, seine Familie ist nicht übel, und auch ein paar von seinen Freunden sind gar nicht so übel. Warum sollte dies nicht der Anfang von etwas sein, das wir wirklich verdient haben? Ich bin entschlossen, für unsere Beziehung zu kämpfen. Ja, das bin ich. Damit das funktioniert, reicht es nicht, einfach eine neue Seite aufzuschlagen, ich muss mir wirklich Mühe geben. Und dazu bin ich bereit.
Bin ich wirklich.
Jawohl.
Nanuk, unser vierjähriger Husky, den Germán uns als Welpen geholt hat, nachdem wir beschlossen hatten, die Kinderpläne auf unbestimmte Zeit zu verschieben, ist unruhig. Er versteht nicht, was das ganze Hin und Her zu bedeuten hat. Er reagiert immer ganz hysterisch, wenn er uns Koffer packen sieht, weil er spürt, dass wir ihn für ein paar Tage verlassen und bei irgendeinem Freund in Obhut geben werden. Aber diesmal ist es anders. Wir packen ja das halbe Haus zusammen, und das versteht er überhaupt nicht. Wollen die mich etwa allein lassen?, scheint er zu denken. Was zum Teufel ist hier los?
Als ob wir ihn je zurücklassen würden. Wir könnten eher auf den halben Hausstand verzichten, der Hund kommt auf jeden Fall mit. Wie kann man ein Tier nur so lieben? Nanuk hat es geschafft, dass ich, die eine Abneigung gegen Haustiere hatte, meine Meinung radikal geändert habe.
»Weißt du, welchen Namen wir ihm geben?«, fragte Germán, als ich das Wollknäuel auf den Arm nahm. »Nanuk. Wir nennen ihn Nanuk, Eisbär, weil er im Nu das Eis in deinem Herzen zum Schmelzen gebracht hat.«
Ja, so kitschig kann Germán sein. Das hat man davon, wenn man mit einem Möchtegern-Schriftsteller verheiratet ist. Doch tatsächlich passt der Eskimoname perfekt zu diesem wuscheligen, kleinen Wesen mit Augen von unterschiedlicher Farbe, das ich im Nu so lieb gewann, als sei es Teil der Familie. Was heißt hier Familie, Nanuk habe ich wirklich ins Herz geschlossen. Und das, obwohl er lange brauchte, bis er gelernt hatte, nicht in die Wohnung zu pinkeln. Vorher hat er schon alle vier Ecken unseres Sofas, unsere beiden Laptops und zwei der vier Couchtischbeine zerbissen. Nanuk gab mir den Sinn für das Wesentliche zurück. Mit ihm die wunderbaren Dinge zu entdecken, die das Leben bereithält, war überwältigend. Für ihn besteht das Leben nur aus Spielen, Fressen und Spaß haben. Mehr gibt es für ihn nicht, und das reicht auch völlig. Zu spüren, wie er jede kleine Entdeckung genießt, jede Zärtlichkeit, hat mir klargemacht, was wirklich wichtig ist. Es hört sich vielleicht komisch an, doch manchmal muss jemand oder etwas, manchmal eben auch ein Hund, einem beibringen, das Chaos von Zielen, Erfolgen, Niederlagen und der vielen Aufregungen, mit denen wir uns herumschlagen, beiseitezulassen und wieder zum Wesentlichen zu kommen: die Sonne zu genießen, Spielen, Zärtlichkeit, das Leben. Und Nanuk hat das geschafft. Wie soll ich ihn da nicht lieben?
Er tanzt weiter in der Gegend herum, bellt und jault herzzerreißend. Germán versucht ihn zu beruhigen.
»Ganz ruhig, Nanuk, wir nehmen dich ja mit. Jetzt geht’s nach Hause aufs Land. Da kannst du so viele Kaninchen jagen, wie du willst.«
»Gib dir keine Mühe. Bis er nicht sieht, dass wir ihn ins Auto springen lassen, wird er keine Ruhe geben. Nanuk! Platz!«
Es gelingt mir, ihn für ein paar Sekunden zum Schweigen zu bringen. Doch kaum fangen wir wieder an, Bücher in Kisten zu räumen, beginnt er zu bellen.
»Nanuk!«
Ich sehe mich ein bisschen wehmütig in der Wohnung um. Dabei geht mir das sonst nie so. Doch wer weiß, warum, jetzt habe ich das Gefühl, dass dieser Umzug ganz anders ist als die vorigen.
»Wird dir die Wohnung nicht fehlen?«, frage ich Germán.
»Seit zwei Jahren beklagst du dich darüber, dass die Feuchtigkeit in allen Wänden sitzt. Jetzt werd bloß nicht sentimental.«
»A Coruña ist nun mal feucht.«
Germán kommt zu mir, legt mir den Arm um die Schulter und gibt mir einen Kuss auf die Wange. Einen dieser Küsse, die früher Heilkraft hatten.
»Es wird phantastisch in Novariz, du wirst schon sehen.«
Kapitel 3
Wir haben beschlossen, einen großen Teil unserer Sachen in der Wohnung meiner Mutter unterzustellen. Na ja, jetzt spreche ich wieder in der Mehrzahl, aber diesmal war es mein Entschluss. Es kommt mir absurd vor, alles einzupacken und in Germáns Heimatort zu transportieren, wenn wir nur sechs Monate bleiben wollen. Weshalb sollten wir da unsere gesamte Bibliothek mitnehmen? Besser, wir lassen den größten Teil der Bücher in Mutters Wohnung. Ich nenne sie immer noch so, auch wenn sie inzwischen mir gehört. Es fällt mir halt schwer, mich daran zu gewöhnen.
Ich bin nur selten hier. Immer, wenn ich wie jetzt mit meiner Freundin Tere die Wohnung betrete, spüre ich Mutters Abwesenheit fast körperlich. Das ist kaum auszuhalten. Ich muss eine Entscheidung treffen, was die Wohnung angeht. Entweder ich verkaufe oder vermiete sie, oder ich überrede meinen Mann, hierher zu ziehen. Keine der drei Alternativen überzeugt mich jedoch.
Vermieten? Nein, natürlich nicht. Ich könnte den Gedanken nicht ertragen, dass fremde Leute in den Räumen wohnen, wo meine Mutter und ich so viele Jahre gelebt haben.
Mit Germán hierher ziehen? Nein. Ich könnte hier nicht leben. In jedem Zimmer würde ich Mamas Gegenwart spüren. Vielleicht geht es in ein paar Jahren, wenn ich endlich mit mir selbst und mit ihr Frieden geschlossen habe. Im Moment noch nicht.
Die Wohnung zu verkaufen ist wohl die klügste Option, aber ich kann mich nicht dazu entschließen. Und praktisch gesehen wäre es fast besser, zu warten, bis die Preise wieder steigen. Jetzt müsste ich sie unter Wert anbieten. Dazu der ganze Papierkram, einen Makler beauftragen, verhandeln: Vor alldem hab ich einen Riesenhorror.
»Hör mal, die verkaufst du doch im Handumdrehen«, sagt Tere. »Wenn du willst, kümmere ich mich drum, so schwierig ist das alles nicht. Und wenn du sie unter Wert verkaufen musst, was ich bezweifle, dann ist das eben so. Alles Geld geht an dich, es sind ja keine Belastungen mehr drauf. Ich an deiner Stelle würde sie so schnell wie möglich loswerden wollen. Sie löst bei dir noch so viel Kummer aus, dass du ein Gesicht ziehst wie drei Tage Regenwetter.«
Ich habe Tere gebeten, mir mit den Büchern zu helfen. Sie ist das beste Mittel gegen meine absurden Anfälle von Melancholie. Ich weiß, ihr unaufhörliches Geschnatter wird mich davor schützen, hier leidend herumzuhängen.
»Oder du vermietest sie an mich«, plappert sie weiter. »Es war ja schon immer mein Traum, in der Nähe des Hafens zu wohnen, in einer solchen Wahnsinnswohnung. Warum gibst du sie nicht mir?«
»Schlag dir das aus dem Kopf, Tere! Du könntest doch nicht mal die Miete fürs Badezimmer zahlen.«
»Du würdest mir also keinen Freundschaftspreis machen? Na, du bist mir ja eine schöne Freundin! Komm, wir lüften erst mal, hier riecht’s ja wie in der Leichenhalle … Ups, Entschuldigung, muffig, wollte ich sagen. Und ein bisschen Licht wollen wir auch mal reinlassen.«
Tere fängt an, alle Fenster aufzureißen. Die Geräusche der Straße, des Hafens, die Schreie der Möwen dringen herauf.
»Wie toll die Schiffe von hier oben aussehen! Der reine Luxus. Außerdem wird hier bald alles Fußgängerzone. Und du vergräbst dich mit deinem Mann in dieser winzigen Wohnung in Montealto. Verprügeln müsste man dich.«
Ich will nicht allzu lange hierbleiben, nur die Bücherkisten abstellen und wieder gehen. Doch wenn Tere es sich in den Kopf gesetzt hat, den Nachmittag in dieser Wohnung zu verbringen, dann ergebe ich mich besser in mein Schicksal. Sie tut gern so, als gehöre sie zu den Reichen von A Coruña.
»Was für ein Glück deine Mutter hatte! Ich weiß gar nicht, weshalb du es so schlimm findest, dass sie dir diese Wohnung vererbt hat. Ich würde Luftsprünge machen und jede Woche Orgien veranstalten, es auf allen Balkons treiben und die Yuppies schocken, die da unten ihre Models ausführen.«
»Das würdest du dich doch nicht trauen, nimm den Mund nicht so voll.«
»Lass mir die Schlüssel da, dann werden die Nachbarn dir’s schon erzählen.«
Tere geht ins Schlafzimmer meiner Mutter und direkt zum riesigen Kleiderschrank.
»Und die vielen Schuhe! Da steckt ja ein Vermögen drin! Ich kann mich gar nicht sattsehen daran! Was für eine elegante Frau sie war, deine Mutter, so viel Geschmack. Sie verstand sich zu kleiden, und Kohle hatte sie auch … Wenn ich mal älter bin, möchte ich so sein wie sie.«
Ich versuche gar nicht erst, Teres falsche Vorstellungen zurechtzurücken. Mir ist aber sonnenklar: Das Leben meiner Mutter war nie ein Wunschkonzert. Sie hat immer nur gearbeitet und gearbeitet, so viel, dass sie mitunter vergaß, dass sie eine Tochter hatte. Und wenn sie sich mal um mich kümmerte, dann war’s fast noch schlimmer. Meiner Mutter war ich immer zu wenig, nur ein schwaches Abbild all dessen, was sie erreicht hatte. Damit hat sie nie hinter dem Berg gehalten. Zwar sagte sie andauernd, ich solle mein Leben leben, wie ich wolle, doch ich wusste, das stimmte nicht. Dass ich nicht Medizin studieren und in ihre Fußstapfen treten wollte, war eine Enttäuschung für sie. Aber wie sollte das auch gehen? Ich hätte sie ja doch nie erreichen können, da wollte ich lieber gleich einen anderen Weg nehmen. Meine Mutter war die Beste auf ihrem Fachgebiet und wollte auch immer die Beste sein.
Sie war schwierig, meine Mutter. Sehr schwierig.
In den letzten Jahren kamen wir überhaupt nicht mehr miteinander klar. Meinen Mann hat sie nie akzeptiert: »Für eine Weile vielleicht, Töchterchen, aber heiraten? Und noch dazu eine so geschmacklose Hochzeit, wie ihr sie feiern wollt, so altmodisch und übertrieben, das passt doch gar nicht zu dir!« Nie gefiel ihr mein Beruf: »Willst du wirklich Lehrerin werden? Du? So wenig bist du dir wert? Willst du wirklich dein ganzes Leben in einer Schule verbringen?« Und nie verstand sie, dass ich nicht mehr Ehrgeiz hatte: »Eines Tages wirst du begreifen, was du wert bist, hoffentlich ist es dann nicht zu spät. So klug, aber so bequem!« Das waren ihre Worte.
Sie starb einsam und verlassen, weil wir nach einem Riesenkrach, der mir heute völlig absurd vorkommt, zwei Jahre lang nicht mehr miteinander gesprochen hatten. Ich habe noch den Anruf im Ohr, als mir einer ihrer Arbeitskollegen aus dem Krankenhaus die Nachricht überbrachte. Alles war sehr schnell gegangen, quasi von einem Tag auf den anderen, deshalb hatte sie mir nicht Bescheid sagen können. Und außerdem hatte sie mich nicht beunruhigen wollen. Meine Mutter lag im Sterben und wollte mich nicht beunruhigen.
Dass sie mich nicht beunruhigen wollte, habe ich ihr nicht verziehen. Dass sie meinte, sie müsse mich vor ihrer Krankheit schützen, oder vielleicht dachte, weil ich sauer auf sie wäre, würde ich nicht kommen, wenn sie mich bräuchte. Und mir selbst verzieh ich auch nicht. Ich verzieh mir nicht, dass ich mich zu diesem blödsinnigen Streit hatte hinreißen lassen. Ich weiß nicht mal mehr, worum es ging. Dass ich sie nicht anrief, nicht versuchte, eine Brücke zu bauen. Wir waren beide zu stolz. So stolz, dass meine Mutter einsam und allein starb. Ohne mich.
Bei der Beerdigung riss ich mich noch zusammen oder war, besser gesagt, in Schockstarre.
Dann drehte ich durch.
Und dann …
»Schade, dass ich nicht dieselbe Schuhgröße habe wie sie, sonst würde ich alle Schuhe mitnehmen, ich schwör’s dir. Schau mal die hier, wie schick die sind! Und noch fast neu! Darf ich ein Foto machen und es auf Facebook posten?«
»Teresa, wie wär’s denn, wenn wir jetzt gehen?«
»Schon?« Sie schaut mich an und spielt die Untröstliche, merkt aber sofort, dass ich nicht ganz bei mir bin. »Uiih, du siehst ja ganz bedröppelt aus! Dich hat’s wohl wieder erwischt. ›Hab mich nicht von meiner Mutter verabschiedet, bin eine schreckliche Tochter …‹ Stimmt’s?«
»Sei nicht so oberflächlich, Tere!«
»Deshalb hast du mich doch mitgenommen. Diese Rolle zu spielen fällt mir auch nicht leicht, ob du’s glaubst oder nicht. Aber das mach ich gern, dafür sind wir schließlich Freundinnen. Also gut, dann mal los. Und du lädst mich jetzt gefälligst zum Essen ein, damit ich drüber wegkomme, dass ich mir ein solches Leben nicht leisten kann. Was für eine tolle Wohnung, Herrgott noch mal, was für eine tolle Wohnung!«
Kapitel 4
Schweißüberströmt kam Iago in die Umkleidekabine des Sportstudios. Ein etwas heruntergekommenes Studio, ein bisschen Farbe hätte ihm gutgetan. Aber was die Geräte anging, war es optimal. Um diese Zeit, wenn Iago mit seinem Freund Roi trainierte, waren kaum Leute da. Er hörte, wie eine Dusche aufgedreht wurde, nur ein weiterer Mensch im ganzen Gebäude. Er öffnete sein Schließfach und nahm Badelatschen, Handtuch und Duschgel aus seiner Sporttasche. Das Training ließ seine Endorphine immer explodieren, der Kick konnte richtig süchtig machen. Doch in letzter Zeit reichte das nicht mehr, nichts konnte diese Angst vertreiben, die er spürte und die ihn manchmal wie ein schwarzes Loch zu verschlingen drohte.
Er wühlte in seiner Sporttasche, bis er seine Jeans gefunden hatte, durchsuchte die Taschen und fand, was er brauchte. Er nahm auch die Geldbörse, betrat schnell eine der Toilettenkabinen und schob den Riegel vor. Verschwitzt, wie er war, schüttete er ein ordentliches Häufchen weißes Pulver aus dem Tütchen. Dann holte er einen Zwanzig-Euro-Schein aus der Geldbörse und rollte ihn zu einem Röhrchen, zog eine lange Line Koks. Von Tag zu Tag brauchte er mehr davon. Er führte das Röhrchen an die Nase und schnupfte das gesamte Kokain auf einmal. Sofort spürte er die Wirkung: Euphorie. Eine Euphorie, die das schwarze Angstloch stopfte, wenigstens für ein paar Minuten. Als er die Kabine verließ und zu seinen Sachen zurückkehrte, fühlte er sich bärenstark.
Er zog die Sporthose, die Socken und das T-Shirt aus und betrachtete seinen nackten Körper im Spiegel. Vor nicht einmal zwei Jahren war er noch ein schmächtiges Bürschchen gewesen, und jetzt hatte er das Kreuz und die Muskeln eines richtigen Mannes. Nackt, wie er dastand, fand er sich unwiderstehlich, und das Kokain verstärkte dieses Gefühl noch. Er lächelte sein Spiegelbild an und fuhr sich mit den Fingern durchs Haar, um die Tolle zu richten, auf die er ebenso stolz war wie auf sein Sixpack. Dank Gel, Schaum und Fön überstand die Tolle sogar eine harte Trainingseinheit. Er trug sein Haar wie Tausende anderer Jungs: oben lang und an den Seiten ausrasiert. Als die Tolle perfekt stand, schlang er sich das Handtuch um die Hüften und griff zu seinem Handy, um ein Selfie zu machen. Das würde er später auf Instagram posten.
Während er noch die beste Pose suchte, kam Roi in den Umkleideraum, mit siebzehn ein Jahr jünger als sein Freund. Roi war etwas kleiner, trotz des Trainings hatte er keinen so athletischen Körper. Er war einfach nicht fähig zu einer so strikten Diät wie sein Kumpel. Ständig Proteinshakes und zu allen Mahlzeiten Hühnchen und Tunfisch aus der Dose waren einfach nicht sein Ding. Ein Bügel von Rois Brille wackelte, er hatte ihn mit Klebeband befestigt. Die Brille nahm Roi nicht einmal beim Training ab, und am liebsten hätte er sie auch beim Duschen aufbehalten. Wo die beiden Freunde auftauchten, zogen sie, so unterschiedlich, wie sie waren, die Blicke auf sich. Jeder auf seine Weise. Wegen ein paar Fotos, auf denen sie mehr Haut als Kleider zeigten, hatten sie Tausende Follower im Netz, vor allem Iago. Roi war in der Beziehung ein bisschen zurückhaltender.
Sie kannten sich zwar schon länger, waren aber erst in diesem Schuljahr Freunde geworden. Allerdings hatte Roi nicht einen solchen Hang zur Sucht wie sein Kumpel. Er hatte gar nicht richtig mitbekommen, wie oft Iago in letzter Zeit zugedröhnt war. Iago war nämlich inzwischen Experte darin, die Highs, die ihm das Kokain verschaffte, mit Ketamin oder Marihuana auszugleichen.
»Ist dir aufgefallen, wie toll die inzwischen aussehen?«, fragte Iago und spannte die Bauchmuskeln an. »Das ist mal ein Sixpack, was, Alter?«
»Nerea hat mir gerade geschrieben.«
»Was will die denn?«
»Bald ist die Beerdigung.«
»Na und?«
»Da müssen wir hin, oder?«
Iago verspannte sich, versuchte, gleichgültig zu wirken. Das war sein Schutzschild gegen Dinge, die ihn verletzen konnten: so zu tun, als sei er hart wie Stahl.
»Weshalb? Wir haben da doch nichts verloren.« Er merkte, dass ihn das Kokain dazu brachte, zu laut zu sprechen, und senkte die Stimme.
»Aber da geht doch bestimmt die ganze Klasse hin.«
»Seit wann sind wir, du und ich, so wie der Rest?«
Roi schwieg, er hatte keine Lust, mit Iago zu streiten. Noch dazu, wenn der diese Arroganz an den Tag legte. Auch darin unterschied er sich von seinem Freund. Roi hielt sich für viel entspannter. Aber Iago konnte unglaublich gut manipulieren, intrigieren. Er konnte andere dazu bringen, zu tun, was er wollte, und darum beneidete ihn Roi. Er versuchte, es ihm gleichzutun, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Für Iago, von Natur aus maßlos, war alles ein Machtspiel, und darin war er unbestrittener König. Er war so sehr daran gewöhnt, Sieger zu sein, dass er total die Beherrschung verlieren konnte, wenn die Dinge mal nicht nach seinem Willen liefen. Dann reagierte er mit völlig unkontrollierten Wutausbrüchen, die offenbarten, dass er noch nicht so erwachsen war, wie er tat. Und in letzter Zeit verlor er nur allzu leicht die Beherrschung. Sein zunehmender Drogenkonsum und ein paar Ereignisse in der jüngsten Zeit ließen ihn permanent gereizt wirken. Er versuchte das zwar zu vermeiden, stand aber einfach zu sehr unter Druck.
»Soll ich mit dem Duschen auf dich warten?«, fragte Iago.
»Okay.«
Roi holte seine Sporttasche aus dem Schließfach und begann sich auszuziehen. Er merkte, dass seine ziemlich abgetragene Unterhose ein Loch hatte, und schämte sich bei der Vorstellung, dass sein Kumpel es merken könnte. Deshalb bemühte er sich, seine Tasche so hinzustellen, dass Iago das Loch nicht sehen konnte. Das war ein weiterer Unterschied zwischen ihnen: Geld. Iago hatte immer genug, seinem Vater ging es gut, er gehörte zu den wenigen, die unter der Schließung der Fabrik nicht gelitten hatten. Jedenfalls nicht so sehr wie andere. Ganz ungeschoren war er aber auch nicht davongekommen. Er hatte ein paar Vorsichtsmaßnahmen ergreifen müssen. Rois Familie hatte es dagegen voll erwischt. Beide Eltern waren arbeitslos, der Vater machte Gelegenheitsjobs und die Mutter ging putzen, um irgendwie über die Runden zu kommen.
»Beeil dich mal ein bisschen, verdammt. Da ist ja jeder Behinderte schneller.«
»Ich komm ja schon. Und hör auf, mich anzustarren. Das macht dich wohl heiß, oder was?«, sagte Roi und zog sich eilig die Unterhose aus.
Iago grinste, rollte sein Handtuch zusammen und versetzte Roi damit einen Schlag auf den Hintern.
»An dir macht mich doch alles heiß«, frotzelte er. »Vor allem dein knackiger Arsch.«
»Halt’s Maul, du Schwuchtel, sonst hört dich noch jemand und denkt was Falsches«, gab Roi lachend zurück.
»Als ob es mir was ausmacht, was die Leute in diesem Kaff denken.«
In diesem Moment kam ein dicklicher, behaarter Mann um die vierzig aus der Dusche. Sie grüßten ihn im Vorbeigehen und stellten sich unter die Brausen.
»Wenn ich jemals so einen Körper habe, dann jage ich mir eine Kugel durch den Kopf«, lästerte Iago. »Ist ja ekelhaft, Alter.«
Dann begann er sich einzuseifen und sang dabei einen Rap-Song. Den obszönen Text begleitete er mit eindeutigen Handbewegungen an seinen Genitalien. Das Kokain war echt gut, keine Frage. Er freute sich schon darauf, noch eine lange Line zu ziehen, sobald er mit dem Duschen fertig war.
»Hey, weshalb bist du denn so gut drauf?«, fragte Roi. »Manchmal denke ich, du hast schon völlig vergessen, was wir getan haben.«
Diese Bemerkung beendete Iagos gute Laune schlagartig, sofort hörte er auf zu singen. Er wandte sich seinem Freund zu, setzte ihm den Zeigefinger auf die Brust und versuchte warnend, ja, drohend zu klingen:
»Du und ich, wir haben gar nichts getan. Mach dir das endlich klar.«
»Alter …«
»Wenn eine Verrückte auf die Idee kommt, sich umzubringen, weißt du, wer dann Schuld hat? Die Verrückte, sonst niemand.«
»Jetzt nennst du sie also verrückt?«
»Dass sie so unglaublich gut aussah, hat nichts damit zu tun, dass sie nicht ganz richtig im Kopf war.«
»Okay … Alter … Aber wir …« Roi merkte, dass es besser war, nicht weiterzureden. »Ach, schon gut.«
»Was denn? Na, sag schon!«
»Wir haben auch unseren Teil dazugetan. Wir haben sie fertiggemacht. Und ich sage nicht, dass es mir leidtut, klar?« Roi tat gelassen, obwohl er sich gar nicht so fühlte. »Aber ich sage, wie es ist.«
Iago wollte das Thema ein für alle Mal beenden, nie mehr drüber reden, zur Tagesordnung übergehen, und ihm fiel nichts Besseres ein, als sehr brutal zu reagieren. Sein Freund sollte sich so unwohl fühlen, dass er das Thema nie wieder anschnitt. Das Kokain stachelte ihn an.
»Und? Hat’s dir etwa keinen Spaß gemacht, festzustellen, dass wir so viel Macht haben? Schau mal her, ich krieg ’nen Ständer, wenn ich nur dran denke. Schau her, verdammt noch mal!«
Roi lief ein Schauer über den Rücken. Natürlich schaute er nicht hin. Wie konnte Iago nur eine Erektion bekommen, weil ihre Lehrerin sich das Leben genommen hatte?
»Bist du total übergeschnappt, Alter? Sie ist tot!«
Als er sah, wie ernst sein Freund geworden war, lenkte Iago ein. Vielleicht war er zu weit gegangen. Vielleicht hatte er die Wirkung seiner Worte falsch eingeschätzt. Er hörte auf, sich zwischen die Beine zu fassen und zu prahlen.
»Schon gut, schon gut, Alter, ich hab ja nur Spaß gemacht.«
Roi wusste nicht, ob sein Freund meinte, was er sagte. Er hatte seine Zweifel, nach allem, was geschehen war. Iago versuchte, das Thema zu beenden.
»Okay, Roi, hast du sie etwa mit deinen eigenen Händen ertränkt?«
»Nein.«
»Und habe ich sie zum Fluss getragen und unter Wasser gedrückt? Nein. Und deshalb weiß ich wirklich nicht, weshalb wir daran schuld sein sollen. Vergiss es! Und zwar für immer, okay?«
Doch für Roi würde es nicht so leicht sein, das alles zu vergessen. Und sosehr sein Freund auch den starken Mann spielte, Roi bezweifelte, dass er weitermachen konnte, als wäre nichts geschehen.
Kapitel 5
Ein wolkenverhangener Morgen in einem dunklen, kalten, nebligen Januar. Ich schaue auf die Temperatur, die mein Handy anzeigt: zwei Grad über null. Germán schläft noch, ich will ihn nicht wecken. Er hat mir versprochen, dass wir nur zwei, drei Tage bei seiner Familie verbringen werden, bis wir eine Wohnung gefunden haben. Sein Elternhaus ist eine alte, umgebaute Wassermühle an einem kleinen Nebenfluss des Río Limia, der früher einmal das Mühlrad angetrieben hat. Im ersten Stock liegt eine Wohnung mit sechs Zimmern, einer traumhaft schönen Küche und zwei Badezimmern mit Badewanne und Massagedusche. Ein Luxus, den man sich in der Kleinstadt leisten kann, wo die Quadratmeterpreise nicht so hoch sind wie in A Coruña. Das Erdgeschoss nimmt ein riesiges Restaurant ein, O Muíño, die Mühle, seit den Achtzigerjahren im Besitz der Familie. Bis kurz vor seinem Tod war Germáns Vater besessen davon, einen Michelin-Stern zu ergattern, hat es aber leider nicht geschafft. Jetzt sind seine Witwe, meine Schwiegermutter, und ihr Sohn Demetrio, der das Restaurant mit ihr betreibt, hinter dem Stern her. Um den Traum des Vaters zu erfüllen, vermute ich.
Für den Nachmittag habe ich schon drei Besichtigungstermine organisiert. Allerdings ist Germán nicht gerade begeistert von der Idee, eine Wohnung zu mieten: »Hier können wir uns doch ein Häuschen mit Garten leisten, schau mal, wie niedrig die Mieten sind.«
Das Essen gestern Abend verlief ziemlich angespannt. Meine Schwiegermutter bemüht sich sichtlich, zur Normalität zurückzukehren, über den Tod ihres Manns hinwegzukommen, doch es fällt ihr nicht leicht. Wenn man sie fragt, wie es ihr geht, dann antwortet sie so, wie in Galicien üblich: Muss ja. Typisch für die Leute hier. Man fügt sich in sein Schicksal, tut sein Bestes, macht gute Miene zum bösen Spiel, aber nicht allzu sehr, denn so toll sind die Zeiten ja auch nicht. Wie geht’s? Geht so. Alles gut? Muss ja.
»Wie geht’s, Claudia? Alles gut?«
»Muss ja.«
Germán versucht, sie aufzuheitern, doch die Einfälle ihres jüngsten Sohns, der sie sonst immer zum Lachen gebracht hat, können ihr jetzt nur ein müdes Lächeln entlocken. Sie wollte gestern Abend eigentlich alle ihre Kinder zum Essen einladen. Doch dann dachte sie, wir würden sicher sehr spät ankommen, und beschloss, das Essen zu verschieben. Sie hat uns etwas Wichtiges zu sagen. Also wird es erst heute ein Treffen aller Geschwister geben.
Ich könnte zu Fuß zur Schule gehen, doch bei dieser feuchten Kälte wäre das wahrscheinlich ein ziemlich ungemütlicher Spaziergang. Verdammte galicische Kälte, die dir bis in die Knochen dringt und gegen die kein Kraut gewachsen ist. Außerdem fürchte ich, es könnte regnen und ich käme klatschnass an. Deshalb beschließe ich, das Auto zu nehmen. Nanuk, der wie immer mit mir zusammen aufgewacht ist, springt ins Auto, kaum dass ich die Fahrertür öffne. Ich befehle ihm, rauszukommen.
»Ich muss zur Arbeit, Nanuk.«
Keine Chance. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als ihn am Halsband zu packen und wieder ins Haus zu bugsieren. Ich schließe die Tür und höre sein Winseln. Er ist ein toller Schauspieler, ein Meister der Manipulation, aber jetzt habe ich weder Zeit noch Lust, seinen Erpressungsversuchen nachzugeben. Germán wird bestimmt später mit ihm rausgehen. Es macht wirklich Spaß, den Hund auf dem Grundstück herumlaufen zu sehen. Er ist total glücklich, hier zu sein. Und ich denke, allein deshalb schon lohnt sich die Mühe.
Ich steige ins Auto, drehe den Zündschlüssel, doch weil es nachts so kalt war, will der Motor nicht anspringen. Zum zehnten Mal an diesem Morgen muss ich niesen, zwei Tage geht das jetzt schon so. Seit dem Umzug hat der Staub aus den Büchern, die wir in Kisten gepackt haben, meine Allergie förmlich explodieren lassen. Ich bin mit Medikamenten vollgepumpt. Und um die Müdigkeit wegen der Tabletten zu überwinden, trinke ich alle paar Stunden Kaffee. Jede Menge Antiallergietabletten und literweise Koffein. Kein Wunder, dass ich schlecht geschlafen habe. Sehr schlecht sogar.
Zum x-ten Mal versuche ich, den Motor anzulassen, doch nichts passiert. Mir bleibt nichts anderes übrig, als zu Fuß zu gehen. Es sind ja nur fünfzehn Minuten, das schaffst du schon, Raquel. Ist schließlich dein erster Tag, komm, nutze diese Energie, auch wenn dich der Schlafmangel, die Allergie und der viele Kaffee fertigmachen. Wenn du genau in dich hineinhörst, dann ist da immer noch die Freude darauf, die Schüler und deine neuen Kollegen kennenzulernen. So wie damals, als du klein warst und kaum erwarten konntest, dass der September kam und das neue Schuljahr begann. Der Geruch eines neuen, zum ersten Mal aufgeschlagenen Buchs war ebenso herrlich wie der eines eben aus dem Ofen geholten, frisch angeschnittenen Brots.
Die Straßen sind wie ausgestorben. Nur zwei Lieferwagen und vier PKW. Scheint fast so, als hätte man es hier nicht nötig, früh aufzustehen, vielleicht wegen der hohen Arbeitslosigkeit. Die Weihnachtsbeleuchtung hängt noch und ist eingeschaltet, keine Ahnung, weshalb. Ein gespenstischer Anblick: Die Straße liegt unter einer dicken, weißen Nebeldecke, durch die nur die Scheinwerfer der Autos und die bunten Lichter der Weihnachtsbeleuchtung dringen.
Als ich einen Zebrastreifen überquere, fährt plötzlich ein Auto direkt auf mich zu. Ich mache einen Satz zurück, das Auto bremst abrupt. Dank meiner Reflexe hat der Wagen mich nicht erwischt – in diesem Geisterdorf überfahren zu werden, das hätte mir gerade noch gefehlt! Durch den Schreck laufe ich zu Hochform auf. Ich baue mich vor dem Auto auf wie ein andalusischer Kampfstier.
»Bist du wahnsinnig? Weißt du etwa nicht, dass man am Zebrastreifen anhalten muss? Außerdem ist hier Tempo dreißig!« Dem Fahrer hat es die Sprache verschlagen, wie erstarrt sitzt er hinterm Steuer. Nach einem Moment lässt er das Fenster herab. Ich gehe auf ihn zu. »Hast du mich denn nicht gesehen, Mann?«
Der Fahrer, ein Mann um die vierzig, schüttelt den Kopf. Er trägt einen dichten, sorgfältig gestutzten braunen Bart mit ein paar grauen Strähnen darin. Und eine Sonnenbrille, was mich wundert an diesem nebligen, regnerischen Tag. Da sehe ich, wie ihm eine Träne über die Wange rollt. Schnell wischt er sie mit zwei Fingern weg. Weint er etwa? Oder hat er ein Problem mit den Augen? Irgendeine Krankheit, und daher die Sonnenbrille?
»Alles in Ordnung?«, frage ich. Die Träne hat mich verunsichert. Wenn das seine Taktik ist, um Streit zu vermeiden, dann hat sie funktioniert.
Er nimmt die Sonnenbrille ab. Seine Augen sind gerötet, wässrig. Eine Allergie? Trauer? Die Schatten unter den Augen deuten auf permanente Schlaflosigkeit hin.
»Entschuldige, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht«, sagt er mit angenehm tiefer Stimme.
»Schon gut, ist ja nichts passiert. Ich lebe noch.«
Er versucht zu lächeln. Ein Lächeln, das aussieht, als müsse es sich seinen Weg durch ein Meer von Traurigkeit bahnen. Ich spüre, welche Anstrengung es ihn kostet. Und stelle mir vor, wie gut diesem Gesicht ein echtes Lächeln stünde.
»Tut mir echt leid. Ich hätte das Auto stehen lassen sollen.«
»Wäre vielleicht keine schlechte Idee gewesen, aber es ist ja noch mal gut gegangen.«
Er senkt den Kopf, setzt wieder die Sonnenbrille auf. Ich stehe wie angewurzelt da, fast so, als sei ich verhext. Oder einfach nur verwirrt durch diese seltsame Begegnung. Ich schaue auf die Uhr und sehe, dass ich noch ein bisschen Zeit habe.
»Hör mal, hast du Lust auf einen Kaffee oder so? Ich weiß nicht …«
Was ich wirklich nicht weiß, ist, weshalb ich gerade einen Wildfremden zum Kaffeetrinken einlade. Er weckt in mir wohl Beschützerinstinkte. Oder vielleicht haben seine Tränen und die Sonnenbrille an einem Regentag mich neugierig gemacht.
Kopfschüttelnd lehnt er ab.
»Nein, danke, ich muss in die Schule. Ich parke da vorn.«
Ohne auf eine Antwort zu warten, lässt er den Motor an und fährt los. Ich sehe, wie er einparkt, aussteigt und in die Schule geht. Ob er Lehrer ist? Das wäre zwar nichts Ungewöhnliches, aber es überrascht mich. Keine Ahnung, weshalb, aber so ist es.
Da ich noch ein paar Minuten Zeit habe, beschließe ich, irgendwo einen Kaffee zu trinken. Ein paar Meter weiter sehe ich ein Café, O Forno. Ich gehe darauf zu. Vor der Tür steht ein blonder junger Mann von Anfang zwanzig, eine lange, schwarze Schürze um die Hüften, und raucht hastig eine Zigarette. Ich trete ein. Es duftet nach Milchkaffee, ein paar Gäste stehen, die Ellenbogen aufgestützt, an der Bar. Zwei, drei weitere sitzen verstreut an den Tischen. Die Dekoration ist bunt zusammengewürfelt, ein paar Bilder von Sonnenuntergängen über der römischen Brücke von Novariz, eine Zielscheibe für Wurfpfeile, ein ausgestopfter Hirschkopf und Miniaturmodelle der typischen galicischen Getreidespeicher auf den Tischen. Ich gehe zum Tresen.
»Guten Morgen, einen Kaffee bitte, schwarz.«
»Schwarz? Non o queres com leite mellor? Möchtest du ihn nicht lieber mit Milch? Um die Zeit brennt er einem doch ein Loch in den Magen.«
Die Frau, die mich bedient, ist ziemlich füllig und sieht aus wie eine typische galicische Großmutter.
»Mein Magen wird mit allem fertig«, frotzele ich zurück.
»Wenn du meinst. Un trociño de bica? Ein Stück Bica? Frisch aus dem Backofen.«
»Warum nicht?«
»Mijaíl! Komm endlich wieder rein! Ich mach hier nicht auch noch deine Arbeit.«
Der blonde junge Mann, der draußen raucht, wirft seine Zigarette auf den Boden, tritt sie aus und kommt herein.
»Ich komm ja schon, Doña Concha.«
»Immer nur rauchen, immer nur rauchen …«
Mit einer Geschwindigkeit, die kaum zu ihrem Alter und ihrer Leibesfülle passt, serviert sie mir den Kaffee. Sie schneidet ein Stück Blechkuchen ab und legt es mir neben die Tasse. Nicht einmal in Madrid wird man so schnell bedient.
»Eres a nova? Bist du die Neue?«
»Wie bitte?«
Die Frau wechselt sofort vom Galicischen ins Spanische. Ich will sagen, dass das nicht nötig ist, dass sie ruhig weiter Galicisch sprechen kann. Doch weil sie einfach weiterredet, will ich sie nicht unterbrechen.
»Die neue Lehrerin, oder? Drüben in der Oberschule. Ich erkenne euch auf Anhieb. Am Alter, an der Kleidung und an dieser Ungeduld anzufangen, die ihr immer ausstrahlt.«
»Ah … ja, ja, die Neue.«
»Tut richtig gut, junge Leute zu sehen, die Arbeit haben und Lust, sie zu tun.« Sie senkt die Stimme, damit niemand hört, was sie sagt: »Bei all den Zombies hier kommt man sich manchmal vor wie auf dem Friedhof. Seit die Fabrik geschlossen ist, laufen die Leute rum wie ruhelose Seelen im Fegefeuer.«
»Ja, das muss ein heftiger Schlag gewesen sein.«
»Kannst du dir gar nicht vorstellen, miña nena, mein Kind. Die Acebedos sollen mir bloß nicht über den Weg laufen …«
Keine Frage, auf die Acebedos, die ehemaligen Besitzer der Fabrik, ist sie nicht gut zu sprechen. Und das trifft bestimmt auf alle anderen hier auch zu. Die Acebedos haben dem Ort, der ganzen Region Gegenwart und Zukunft geraubt. Ich trinke meinen Kaffee und nehme einen großen Bissen Bica. Sie ist lecker, saftig und sehr süß.
»Hoffentlich klappt alles bei dir. Die Kinder hier haben’s verdient, sie haben so viel durchmachen müssen.«
Ich weiß nicht, was sie meint, doch die Frau bedient schon andere Gäste. Ich verzehre den letzten Bissen Bica. Als ich bezahlen will, wehrt die Wirtin ab.
»Heute geht das aufs Haus. In Zukunft aber nicht, gewöhn dich ja nicht dran.«
Lächelnd ziehe ich einen Euro Trinkgeld hervor. Doch auch den weist sie zurück.
»Steck das bloß wieder ein. Trinkgeld ist was für die Amerikaner. Wenn Concha einlädt, dann lädt Concha ein.«
»Verstanden. Na, dann vielen Dank, Concha!«
»Schon gut.« Sie sieht mich freundlich, beinahe mütterlich an. »Viel Glück, miña nena, du wirst es brauchen.«
Ich verlasse die Bar und gehe mit gemischten Gefühlen zur Schule hinüber, eines der seltsamsten Gebäude des Städtchens. Vielleicht bin ich nach meinen Begegnungen mit dem Autofahrer und Concha auch selbst ein bisschen komisch drauf. Ich schaue zur großen Glaskuppel hinauf, durch die tagsüber das Licht in den Innenhof fällt, vielleicht die meist fotografierte Sehenswürdigkeit von Novariz. Man findet sie auf jeder Ansichtskarte. Ein paar Schüler gehen hinein. Ich folge ihnen. Die Wände aus Stein, Eisen und Glas umschließen fast zwei Jahrhunderte Geschichte. Der Bau beherbergte in alten Zeiten ein Thermalbad, das aus heißen Quellen gespeist wurde und dessen Glanzzeit bereits in den 1920er Jahren vorbei war. Damals wurde das Bad geschlossen, während des Bürgerkriegs in ein Lazarett und schließlich in ein Gefängnis für republikanische Häftlinge umgewandelt. Als schließlich die Demokratie eingeführt wurde, kam irgendjemand auf die Idee, das Gebäude zur Oberschule zu machen.
Ich spüre die feuchte Kälte hier drinnen, dazu den typischen Schwefelgeruch, der mir schon auffiel, als ich mit Germán zum ersten Mal hier war. Der Geruch rührt von der heißen Quelle im Innenhof her, die ab und zu vierzig Grad heißes Wasser sprudeln lässt. Sie gehört zu den Naturschätzen, die den Ort einst berühmt gemacht haben und die viele jetzt wieder nutzbar machen möchten. Wenn die Stadt Ourense es geschafft hat, mit den heißen Quellen den Tourismus anzukurbeln, warum nicht auch wir?
Der Lärm der Schüler holt mich aus meinen Gedanken. Ich schiebe die Geschichte und den Nebel beiseite und lasse mich von der Energie der Jugendlichen ins Leben zurückholen. Der ganze Ort schien eben noch wie ausgestorben, doch hier drinnen beweisen die Schüler das Gegenteil.
Lärm und Leben morgens um zehn nach acht. In diesem Getümmel kann ich mühelos meine Vorfreude auf den Unterricht überspielen. Man muss mir die Begeisterung und die Aufregung ja nicht allzu sehr anmerken.
Ich brauche eine Weile, bis ich das Lehrerzimmer gefunden habe. Das Haus ist ein echtes Labyrinth. Das ist der Nachteil, wenn man alte Gebäude für neue Zwecke nutzt. Es gibt ihnen zwar Charakter, ist aber nicht immer praktisch.
Endlich finde ich den Raum. Als ich eintrete und den Trubel hinter mir lasse, spüre ich sofort ein anderes Ambiente. Nicht nur, weil es hier viel ruhiger ist. Die wenigen Lehrer, die ich sehe, machen ziemlich lange Gesichter. Ob sie besorgt oder unsicher sind, ist schwer zu sagen. Sicher, manchmal sind es nicht die anderen, du bist es selbst, der seine Gefühlslage auf die anderen projiziert. Neu an eine Schule zu kommen ist nie einfach, vor allem, wenn das Schuljahr schon vor Monaten begonnen hat und die Karten längst verteilt sind. Die altgedienten, abgeklärten Lehrer auf der einen Seite, auf der anderen diejenigen, die noch an ihre Arbeit glauben. Du weißt noch nicht, in welches Grüppchen du passen wirst, wenn überhaupt, und wie man dich aufnehmen wird. Vor allem, wenn du nur für ein paar Wochen oder Monate da sein wirst. Weshalb sich groß Mühe geben mit dir, wenn du doch bald wieder verschwindest?
Vielleicht ist es Einbildung, doch bei den fünf oder sechs Lehrern im Raum spüre ich etwas Merkwürdiges. Sie grüßen mich knapp, dann geht jeder wieder – ein wenig zu hastig? – seiner Beschäftigung nach. Einer liest die Zeitung, ein anderer rührt in seinem Kaffee, ein dritter korrigiert Arbeiten … Ihnen ist nicht wohl in ihrer Haut.
Weil ich nicht weiß, was ich machen oder sagen soll, betrachte ich die Natursteinwand des Lehrerzimmers, während ich darauf warte, mir einen Kaffee machen zu können. Da sehe ich plötzlich in einer Ecke den Mann aus dem Auto, den Gutaussehenden mit den Tränen. Unsere Blicke treffen sich, rasch schaut er weg. Schämt er sich wegen unserer Begegnung von vorhin?
»Ich bin Marga, die stellvertretende Direktorin. Bist du die Neue?«, spricht mich eine Frau um die fünfzig an.
Ich nicke und will mich vorstellen, da mischt sich der Mann aus dem Auto ein.
»Ist sie das?«, fragt er die stellvertretende Direktorin. »Übernimmt sie die Kursleitung?«
»Das ist noch nicht entschieden, Mauro, aber wahrscheinlich schon.«
Mauro heißt er also. Wieder stelle ich fest, dass da ein attraktiver Mann vor mir steht, der Wert auf sein Äußeres legt. Nicht zu verachten bei einem Kerl über vierzig.
»Pass gut auf dich auf! Lass dir von denen nicht das Leben zur Hölle machen!«, wendet er sich an mich.
Seine Worte lassen mich zusammenzucken. Wovon spricht er? Erst Tränen und jetzt Warnungen?
»Komm, wir reden besser in meinem Büro.« Marga zieht mich mit sich, sodass ich keine Zeit habe, zu reagieren.
Sie führt mich über die Korridore, wir begegnen ein paar Schülern, die uns nicht beachten.
»Was meint denn dieser Mauro damit, dass mir die Schüler das Leben zur Hölle machen könnten?«
»Keine Angst! Ich erklär’s dir gleich.«
Im Büro der Schulleitung riecht es nach Rauch, und mir fällt sofort das Päckchen Zigaretten auf, das unter einem Stapel Dokumente auf dem Tisch hervorlugt. Marga räumt einen weiteren Stoß Papiere von ihrem Stuhl, setzt sich und lädt mich mit einer Geste ein, es ihr gleichzutun. Ihre Haut ist gelblich, die Augen liegen tief hinter einer Brille mit Holzgestell, ein modernes Hipster-Attribut. Es soll wohl zeigen, dass sie nicht zum alten Eisen zählt. Ihre Frisur würde eher zu Lady Gaga passen.
»Raquel, richtig?«
»Ja«, antworte ich und unterdrücke ein Niesen. Schnell ziehe ich ein Kleenex aus der Tasche.
»Herzlich willkommen, setz dich doch.« Ihre Stimme klingt heiser, und ich meine, einen leichten Alkoholgeruch wahrzunehmen. Aber meine Nase ist verstopft, kann sein, dass ich mich irre. Ob sie ab und zu hier einen Schluck nimmt? Oder geht sie rasch zu Concha hinüber und bestellt sich einen Kaffee mit Cognac?
»Entschuldige meine Haare, heute Morgen ist mir der Fön kaputt gegangen und … na ja … das wird hier wohl den ganzen Tag Thema sein, aber das bringt mich auch nicht um.« Sie versucht, ihre Haare zu glätten, und sieht mich dann ernst an. Ich merke, wie sich ihr Ton und ihre Haltung verändern. Sie will mir etwas Wichtiges, offenbar Unangenehmes sagen. »Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, was, na ja, was passiert ist …?«
»Hm, nein.«
»Aha … Hier wird zurzeit von nichts anderem gesprochen, da kann man sich gar nicht vorstellen, dass jemand noch nicht davon weiß. Es ist ein schwieriges Thema. Du ersetzt die Spanisch- und Literaturlehrerin der Oberstufe, Elvira Ferreiro. Alle haben sie nur Viruca genannt. Sie hatte eine feste Stelle, seit drei Jahren. Sie war Kursleiterin, und ich fürchte, du wirst diese Kursleitung übernehmen müssen.«
»Wenn’s nicht anders geht«, antworte ich und versuche zu lächeln, will verbergen, dass ich nicht gerade begeistert bin.
»Nein, es geht nicht anders, tut mir leid. Sie war sehr beliebt bei den Schülern. Ja, solche Lehrer gibt’s tatsächlich noch. Mit fünfundzwanzig hat sie ihren Abschluss mit Bestnote gemacht, und sechs Jahre später bekam sie eine Festanstellung an dieser Schule. Das ist äußerst selten, die Stellen sind heiß begehrt. Dieses Schulzentrum gehört zu den wenigen, die einen gewissen Reiz haben. So ähnlich wie in Celanova, wo das alte Kloster jetzt als Schule dient. Das Gebäude hier ist nicht ganz so hübsch. Es war früher ein Heilbad …«
»Ich kenne es, mein Mann stammt aus Novariz.«
»Tatsächlich? Na, so was … Dann kann ich mir ja den Touristenvortrag sparen. Jedenfalls gehört dieses Schulzentrum auch zu jenen, deren Schüler noch nicht völlig verkommen sind. Wir sind noch in keinem Sensationsblatt aufgetaucht. Aber zurück zum Thema, ich schweife schon wieder ab … Das typische Lehrersyndrom, wir kommen immer vom Hundertsten ins Tausendste. Viruca war eng mit der Schule verbunden. Sie war Lehrerin aus Berufung, liebte ihre Schüler über alles, kümmerte sich um deren Probleme. Auch im Kollegium mochte man sie gern. Sie war eine von denen, die an ihrem Geburtstag Kuchen mitbringen und immer bereit sind, zu helfen … Doch plötzlich wurde das anders. Ich weiß nicht, ob die Trennung von ihrem Mann schuld daran war oder ob ihr zu Beginn des Schuljahrs etwas zugestoßen ist, auf jeden Fall war sie nicht mehr dieselbe. Vor knapp einem Monat bat sie dann um Urlaub, weil sie unter Depressionen litt. Das hätte ich von allen erwartet, aber nicht von ihr. Ihr Exmann arbeitet auch hier, er ist Geschichtslehrer. Es ist der, der dich im Lehrerzimmer angesprochen hat.«
»Ah …«





























