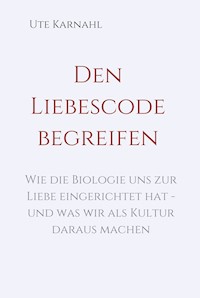
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie funktioniert der biologische Liebescode des Gehirns? In der heutigen Gesellschaft häufen sich Beziehungsprobleme, Bindungsschwierigkeiten und Stress-Krankheiten. Aber worin liegen die Ursachen dafür und was können wir tun, um als Kultur wieder liebesfähig zu werden? Die Biochemikerin Ute Karnahl präsentiert neueste Erkenntnisse der Neurobiologie und erklärt in überzeugender Weise, welche Bedeutung die Liebe für unser (Über)leben hat und wie der Zusammenhang von Biologie und Kultur ist. An vielen Beispielen wird deutlich, dass das Gehirn auf Bindung, Kooperation und Liebe angelegt ist und wie wir darauf in Zukunft besser Einfluss nehmen können. Zu wissen, wie wir "ticken", ist der erste Schritt zum Liebescode. Sachkenntnis und lebendige Sprache machen das Buch für Laien wie für Fachleute zu einer Leseüberraschung. Ein faszinierendes Buch über die Liebe aus neurobiologischer Sicht. Gründlich recherchiert, verständlich erklärt. Ernste Fragen und aktuelle Antworten mit Hirn und Herz verfasst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Dr. Ute Karnahl ist Biochemikerin, Systemische Sozialpädagogin und Feldenkrais-Pädagogin. Ihr besonderes Interesse gilt der Neurobiologie unseres Verhaltens und deren Einfluss auf unseren inneren Zustand, auf Wohlbefinden und Gesundheit sowie dem Einfluss der Kultur auf die Gehirnprozesse.
Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt in Beratung und Coaching sowie der Entwicklungsbegleitung von Babys und Eltern. Sie arbeitet vor allem mit körperbasiertem Erfahrungslernen und systemischer Herangehensweise. Darüber ist sie als Weiterbildnerin vor allem zu den Themen „Neurobiologie und Lernen“ bzw. „Neurobiologie von Liebe und Gesundheit“ tätig.
Ute Karnahl ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.
Ute Karnahl
Den Liebescode begreifen
Wie die Biologie uns zur Liebe eingerichtet hat – und was wir als Kultur daraus machen
© 2019 Ute Dr. Karnahl
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7497-2193-1
Hardcover:
978-3-7497-2194-8
e-Book:
978-3-7497-2195-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Einleitung
Kapitel 2
Wie ist die Natur des Menschen?
Kapitel 2.1
Woher kommen wir?
Kapitel 2.2
Was hat diese Entwicklung ermöglicht?
Kapitel 2.3
Welche Bedeutung hatte Sprache?
Kapitel 3
Wie funktioniert das Nervensystem?
Kapitel 3.1
Evolutionsziel Wohlbefinden?
Kapitel 3.2
Wie sind Nervensystem und Gehirn aufgebaut?
Kapitel 3.3
Was machen Synapsen?
Kapitel 3.4
Was bedeutet Lernen neurobiologisch?
Kapitel 3.5
Was Hänschen nicht lernt – Wie geschieht Anpassung?
Kapitel 3.6
Der Reiz des Neuen – wozu dient Neugier?
Kapitel 3.7
Wie geht das Gehirn online?
Kapitel 3.8
Wer lernen will, muss fühlen?
Kapitel 3.9
Wie wirken Neuromodulatoren?
Kapitel 3.10
Welche Funktion haben Stress und Störungen?
Kapitel 3.11
Raufen, Laufen oder Totstellen?
Kapitel 3.12
Wer lernen will, muss sich sicher fühlen?
Kapitel 3.13
Wie erfolgt eine Koordination der Sicherheitssignale?
Kapitel 3.14
Wer lernen will, muss sich erinnern?
Kapitel 4
Wie die Evolution uns zur Liebe eingerichtet hat – Wie funktioniert der Liebescode?
Kapitel 4.1
Wie beginnt Bindung bereits vor der Geburt?
Kapitel 4.2
Wie hilft Bindung einem Baby bei der Geburt?
Kapitel 4.3
Wie wachsen Bindung und Liebe in der Kindheit?
Kapitel 4.4
Wie entwickeln sich Mädchen und Jungen in der Pubertät?
Kapitel 4.5
Wie gestaltet das Gehirn unsere geschlechtliche Realität?
Kapitel 4.6
Warum kooperieren wir?
Kapitel 4.7
Liebe und Sexualität – Luxus der Evolution?
Kapitel 4.8
Wie ermöglicht der Liebescode Paarliebe?
Kapitel 4.9
Was macht eine Frau zur Mutter?
Kapitel 4.10
Was bewirkt der Liebescode beim Geburtsablauf?
Kapitel 4.11
Wie entsteht ein Vatergehirn?
Kapitel 4.12
Was lässt sich daraus schlussfolgern?
Kapitel 5
Welche kulturellen Zeugnisse hinterließen uns unsere frühen Vorfahren der Partnerschaftskultur?
Kapitel 5.1
Welche Mythen und Traditionen bestimmten das Denken und Erkennen?
Kapitel 5.2
Wie wurden die biosozialen Prozesses gestaltet?
Kapitel 5.2.1
Welche ersten Erfahrungen machten Babys?
Kapitel 5.2.2
Wie wurde die Kindheit gestaltet?
Kapitel 5.2.3
Wie hat die Kultur die Pubertät beeinflusst?
Kapitel 5.2.4
Wie wurden Liebe und Sexualität gelebt?
Kapitel 5.2.5
Wie war die Paarbindung organisiert?
Kapitel 5.2.6
Was macht monogam?
Kapitel 5.2.7
Wie wurde Mutterschaft gestaltet?
Kapitel 5.2.8
Wie wurde Vaterschaft gelebt?
Kapitel 5.3
Zwischenfazit: Wie hat die Partnerschaftskultur den Liebescode begriffen?
Kapitel 5.3.1
Welche Rolle hatten Frauen?
Kapitel 5.3.2
Wie gelang Konfliktvermeidung und Stressregulation?
Kapitel 5.3.3
Von Frauen, die teilen und sich mitteilen
Kapitel 5.3.4
Kooperation, weil es sich gut anfühlt?
Kapitel 5.3.5
Evolutionsvorteil der fürsorglichen Männer?
Kapitel 5.3.6
Sexualität als soziale und kulturelle Funktion?
Kapitel 5.3.7
Gemeinsame Elternschaft
Kapitel 6
Wie kam es zu Herrschaft statt Partnerschaft?
Kapitel 6.1
Wie veränderten neue Mythen und Traditionen das Denken und Erkennen?
Kapitel 6.1.1
Vom leiblichen zum logischen Erkennen – der Beginn der Körper-Geist-Spaltung
Kapitel 6.1.2
Wie aus Vätern Krieger wurden – Das Ideal der griechischen Antike
Kapitel 6.1.3
Wie die Beherrschung der Natur begann
Kapitel 6.2
Ist die Dominanzkultur ein Fehltritt der Evolution?
Kapitel 6.2.1
Angst essen Seele auf – Was erlebten Frauen in der Schwangerschaft und bei der Geburt?
Kapitel 6.2.2
Wie Bindung gezielt behindert wurde
Kapitel 6.2.3
Du sollst nicht fühlen – wie veränderten sich Kindheiten?
Kapitel 6.2.4
Wie haben sich Kindheiten zu verschiedenen Zeiten unterschieden?
Kapitel 6.2.5
Wie war die Pubertät in der Dominanzkultur?
Kapitel 6.2.6
Wie wurden Frauen und Männer erzogen?
Kapitel 6.2.7
Liebe und Sexualität in Zeiten der Dominanz
Kapitel 6.2.8
Wie gelang Liebe und Paarbindung in Zeiten der Dominanz?
Kapitel 6.2.9
Wie wurde Mutterschaft kulturell beeinflusst?
Kapitel 6.2.10
Wie gelang Vaterschaft?
Kapitel 6.3
Vom Lieben zum Töten?
Kapitel 6.4
Wie steht es um den Liebescode in der Dominanz-kultur?
Kapitel 6.4.1
Welche Rolle hatten Frauen?
Kapitel 6.4.2
Wie gelag Konfliktvermeidung und Stressregulation?
Kapitel 6.4.3
Von Frauen, die teilen und sich mitteilen
Kapitel 6.4.4
Kooperation, weil es sich gut anfühlt?
Kapitel 6.4.5
Evolutionsvorteil der fürsorglichen Männer?
Kapitel 6.4.6
Sexualität als soziale und kulturelle Funktion?
Kapitel 6.4.7
Gemeinsame Elternschaft?
Kapitel 7
Welche Kultur haben wir heute?
Kapitel 7.1
Wie veränderten neue Mythen und Traditionen das Denken und Erkennen?
Kapitel 7.1.1
Was haben uns die Jahrtausende der Dominanzkultur hinterlassen?
Kapitel 7.1.2
Ist die heutige Kultur das Grab der Zivilisation?
Kapitel 7.2
Wie begreift die heutige Kultur den Liebescode?
Kapitel 7.2.1
Wie verändern sich Schwangerschaft und Geburt kulturell?
Kapitel 7.2.2
Wie gestaltet die heutige Kultur die frühen Bindungen?
Kapitel 7.2.3
Kindheit heute – geistreich und beziehungsarm?
Kapitel 7.2.4
Was bewirken Cyber-Kindheiten?
Kapitel 7.2.5
Wie beeinflusst die heutige Kultur die Pubertät?
Kapitel 7.2.6
Welche jungen Erwachsenen bringt unsere Kultur hervor?
Kapitel 7.2.7
Liebe und Sexualität in Zeiten der Digitalisierung
Kapitel 7.2.8
Wie steht es um Paarliebe und Paarbindung?
Kapitel 7.2.9
Wie wird Mutterschaft gestaltet?
Kapitel 7.2.10
Wie gelingt Vaterschaft heutzutage?
Kapitel 7.2.11
Zu viel Neues – wenn das Gehirn Alarm schlägt
Kapitel 7.3
Zwischenfazit – Was bedeutet der biologische Liebescode heutzutage?
Kapitel 7.3.1
Welche Rolle haben Frauen?
Kapitel 7.3.2
Wie gelingt Konfliktvermeidung und Stressreduktion?
Kapitel 7.3.3
Von Frauen, die teilen und sich mitteilen?
Kapitel 7.3.4
Kooperation, weil es sich gut anfühlt?
Kapitel 7.3.5
Evolutionsvorteil der fürsorglichen Männer?
Kapitel 7.3.6
Sexualität und Liebe als soziale Funktion?
Kapitel 7.3.7
Wie gemeinsame Elternschaft heutzutage gelingt
Kapitel 7.3.8
Volkskrankheit Liebesunfähigkeit?
Kapitel 8
Wie können wir als Kultur wieder im Einklang mit der Biologie leben?
Kapitel 8.1
Welches neue Denken und welche neue Ethik brauchen wir?
Kapitel 8.1.1
Gefühle - nur das Nebenprodukt der Evolution?
Kapitel 8.1.2
Wir brauchen eine partnerschaftliche Ethik
Kapitel 8.1.3
Wir sind biologisch auf Liebe und Partnerschaft angelegt
Kapitel 8.2
Wie können wir den Liebescode wieder begreifen und umsetzen?
Kapitel 8.2.1
Was brauchen wir für Schwangerschaft und Geburt?
Kapitel 8.2.2
Wie wird Sicherheit erlebt?
Kapitel 8.2.3
Wie gelingen frühe Interaktionen am besten?
Kapitel 8.2.4
Lerne lieben, ehe Du erwachsen wirst
Kapitel 8.2.5
Welche pädagogischen Lernbedingungen brauchen wir?
Kapitel 8.2.6
Den Liebescode in der Pubertät begreifen
Kapitel 8.2.7
Liebe und Sexualität als Überlebensbedingung?
Kapitel 8.2.8
Den Liebescode anwenden und Paarbindung entwickeln
Kapitel 8.2.9
Als Mutter den Liebescode begreifen
Kapitel 8.2.10
Wenn Väter den Liebescode nutzen
Kapitel 8.2.11
Liebe hat Heilkraft
Kapitel 8.3
Zwischenfazit - Den Liebescode wiederentdecken
Kapitel 8.3.1
Welche Rolle werden Frauen haben?
Kapitel 8.3.2
Wie wird Konfliktvermeidung und Stressregulation erreicht?
Kapitel 8.3.3
Frauen, die teilen und sich mitteilen
Kapitel 8.3.4
Kooperation, weil es sich gut anfühlt
Kapitel 8.3.5
Evolutionsvorteil der fürsorglichen Männer
Kapitel 8.3.6
Sexualität als soziale und kulturelle Funktion
Kapitel 8.3.7
Gemeinsame Elternschaft
Kapitel 9
Zusammenfassung - Wer leben will, muss lieben
Anhang
Quellenverzeichnis
Kapitel 1 – Einleitung
Warum dieses Buch?
Allerorts wird die Zunahme psychischer und gesundheitlicher Probleme durch Stress, Einsamkeit und Beziehungslosigkeit festgestellt. Fast jeder leidet darunter und sucht Abhilfe. Trotz Wohlstand und Frieden nehmen psychische und psychosomatische Stressfolgekrankheiten zu, misslingen viele Beziehungen und steigt die soziale Vereinzelung an. Pädagogen und Eltern stellen eine zunehmende Unruhe und Bindungslosigkeit bei Kindern fest.
Immer mehr Menschen machen sich Sorgen und Gedanken über diese Entwicklung in Hinblick auf die Zukunft. Immer mehr Menschen stellen sich dieselben Fragen, wie auch ich:
Was läuft schief?
Warum haben wir so viele Bindungsstörungen bei Kindern?
Warum sind Kinder schon häufig verhaltensauffällig, unruhig und schlaflos?
Warum nehmen psychische Störungen und Stresskrankheiten so zu?
Wieso sind viele Menschen einsam inmitten von großem Wohlstand?
Was ist die Ursache der vielen Beziehungsprobleme und Trennungen?
Gesundheitsprobleme, Beziehungsschwierigkeiten und Bindungsstörungen sind alle der Ausdruck desselben Mangels: Wir beachten den biologischen Liebescode nicht. Daher fehlen Selbstliebe, Paarliebe und Elternliebe. Sie haben alle dieselben Ursachen in einer fehlenden Liebesfähigkeit unserer heutigen Kultur, die die biologischen Bedingungen für gelingende Liebesfähigkeit nicht zur Verfügung stellt.
Wir leiden unter den Folgen des Klimawandels. Dieses Thema ist jetzt sehr publik, aber wir fragen kaum nach dem Zusammenhang zu uns selbst und unserer Liebesfähigkeit:
Wie liebevoll gehen wir mit der Natur um uns herum um und wie mit uns selbst?
Weshalb entwickeln wir nicht mehr Betroffenheit und Mitgefühl?
Wenn wir das Klima und unser Überleben als Art retten wollen, müssen wir diese Fragen beantworten und vor allem unseren Umgang mit uns selbst verändern. Wir sind als biologische Lebewesen Teil der Umwelt. Wenn wir unsere Umwelt lieben und das Klima schützen wollen, müssen wir bei uns selbst als einem Teil davon beginnen und (wieder) lernen besser liebesfähig zu werden. uns selbst zu lieben und zu schützen.
Dieses Buch zeigt daher nötige und mögliche Veränderungen für eine bessere Liebesfähigkeit und Gestaltung der Lebensumwelt auf. Das betrifft die Fähigkeit zur Selbstliebe, Paarliebe und Elternliebe wie auch zur Liebe zum Leben ringsum. Drei Bereiche unseres Lebens lassen hauptsächlich diese Sehnsucht nach Veränderung entstehen. Das sind:
• die Liebe zu sich selbst - mit sich selbst zufrieden sein, sich wohlfühlen und gesund in einer gesunden Umwelt leben wollen
• Paarliebe - einen Partner finden, ihn lieben und erfüllte Sexualität genießen wollen
• Elternliebe - ein Baby lieben und begleiten wollen
Es sind unscheinbare Wünsche und Sehnsüchte gegenüber äußerem Status und Erfolg. Aber sie sind es, die letztlich ein erfüllendes Leben bedeuten, die uns gesund erhalten und uns zufrieden sein lassen. Nur Liebe heilt.
Liebe und Paarbindung sind biologische Notwendigkeiten und Grundbedingungen für unser individuelles und gesellschaftliches Überleben. Das wurde durch die neuesten wissenschaftlichen Forschungen klar belegt und soll in diesem Buch dargestellt werden. Es gibt klare biologische Kriterien für die Überlebensfähigkeit von Kulturen, die der Liebescode beschreibt.
Was ist der Liebescode?
Menschen haben sich innerhalb der Evolution so weit entwickeln können, weil sie zu tiefen und dauerhaften Bindungen auf der Basis von Liebe und Kooperation in der Lage waren. Diese Handlungen zur Erfüllung des Liebescodes, nämlich: Kooperation, Bindung, soziale Interaktion, Paarliebe, Sexualität und Elternliebe haben den höchsten biologischen Belohnungswert .Sie gewährleisen biologisches Gleichgewicht und Gesundheit des Einzelnen und das Überleben unserer Art.
Über die Hormone und Neurotransmitter der Liebe wird Wohlbefinden im sozialen Miteinander und damit der Drang zur Wiederholung solcher Handlungen neurobiologisch vermittelt. Diese kulturellen Bedingungen, der Liebescode, haben eine viel größere Bedeutung, als bisher gedacht wurde. Ohne sie kann weder Erholung und Regeneration stattfinden, was zwangsläufig zu Krankheit führt. Diese Beiträge des autonomen Nervensystems wurden bisher zugunsten der kognitiven Vorgänge weitgehend unterschätzt.
Dieses Buch leistet einen Beitrag zur Klärung der Ursachen für diese Probleme und stellt Ansätze zur Veränderung vor.
Für mich als Biologin tauchen immer wieder einige entscheidende Fragen auf, die sich mir bereits vor vielen Jahren im Biologiestudium stellten:
Wie hat die Evolution uns Menschen zu dem gemacht, was wir sind?
Wie geht es in Zukunft mit unserer biologischen Art Mensch weiter?
Wie verändert die Kultur, in der wir leben unser Gehirn und Gefühle?
Was macht die Kultur mit der Biologie?
Diese Themen sind heute drängender denn je. Mein Buch beschäftigt sich mit der gegenseitigen Wechselwirkung von biologischer und kultureller Evolution. Als Menschen werden unsere sozialen Beziehungen und unsere Liebesfähigkeit sowohl durch die Biologie bestimmt als auch durch die jeweilige Kultur beeinflusst. Die kulturellen Prinzipien können die biologischen Bedürfnisse überformen. Darin bestehen die Chancen, wenn sie die Biologie unterstützen, wie auch die Gefahren der kulturellen Evolution, wenn sie unseren biologischen Bedürfnissen entgegengesetzt verläuft.
Dieses Buch beinhaltet daher die Analyse der biologischen Evolutionsbedingungen, die unser Überleben als Art ermöglichen. Darüber hinaus werden systematisch die unterschiedlichen kulturellen Bedingungen in ihrem Einfluss auf die biologischen Überlebensbedingungen untersucht.
Am Beginn wird zunächst aufgezeigt, welches unsere biologischen Anlagen sind, die wir mit anderen Säugetieren bzw. unseren Primatenvorfahren teilen. Dabei wird die Frage aufgeworfen, ob die biologische Natur des Menschen aggressiv und konkurrierend oder eher kooperierend und liebevoll ist. Es wird dargestellt, welche Bedingungen des biosozialen Verhaltens einstmals günstig für die Entstehung und Entwicklung unserer Art waren. Anschließend enthalten Kapitel 3 und 4 die wichtigsten neurobiologischen Grundlagen für das Verständnis der weiteren Kapitel. Wer als Leser daran nicht so sehr interessiert ist, kann auch bei Kapitel 5 beginnen. Zahlreiche Querverweise ermöglichen es, bei Bedarf zu den früheren Kapiteln zurück zu blättern.
Es wurden Kriterien entwickelt, die die Einschätzung einer Kultur anhand aktueller neurobiologischer Erkenntnisse erlauben. Es wird gezeigt, ob die Regulation von Sicherheit und darauf aufbauend liebevolle Bindungsbeziehungen (der Liebescode) für Gesundheit und Wohlbefinden in einer Kultur verwirklicht werden. Damit wird eine Brücke zwischen biologischer und kultureller Evolution geschlagen. Im weiteren Verlauf werden gezielt die neurobiologischen Grundlagen der wichtigsten biosozialen Prozesse untersucht. Das ist die biologische Steuerung von Schwangerschaft, Geburt, frühe Bindung, Lernen der Kindheit, Pubertät, Geschlechtsidentität, Liebe, Sexualität, Paarbindung sowie Mutter- und Vaterschaft - also die Bereiche von gelingender Liebe zu sich selbst, Paarliebe und Elternliebe.
Es wird aufgezeigt, dass und weshalb Sicherheit, Bindung, Liebe und Kooperation als biologisches Säugetiererbe eine unbedingte Notwendigkeit für unser langfristiges Überleben als Art darstellen. Aufbauend auf den neurobiologischen Grundlagen werden im weiteren Verlauf des Buches die Einflüsse menschlicher kultureller Evolution auf die biologische Evolution beschrieben. Kulturelles Handeln wiederum beeinflusst und gestaltet die Arbeitsweise unseres Gehirns.
Diese Wechselwirkung von Biologie und Kultur in verschiedenen geschichtlichen Epochen wird erstmals ausführlich analysiert und gezeigt, welches Erbe wir in der heutigen Zeit verinnerlicht haben:
Wie werden die kulturellen Traditionen und Werte einer Kultur geprägt?
Wie begegnen sich biologische und kulturelle Evolution auf der Ebene der Neurobiologie/im Gehirn
Welche Beiträge kommen vom biologischen und welche vom menschlichen kulturellen System?
Wie weit und mit welchem Ergebnis haben wir unsere biologische Evolution kulturell überformt?
Im Buch werden die beiden Basismodelle der kulturellen Evolution, nämlich die frühe Partnerschaftskultur (Kapitel 5) sowie die darauf folgende Dominanzkultur (Kapitel 6) sowie unsere heutige Kultur (Kapitel 7), untersucht, inwieweit sie die biologischen Bedingungen des Liebescodes erfüllt haben. Anhand der eingangs entwickelten Evolutionskriterien wird analysiert, welche Traditionen und Vorstellungen als kulturelle Evolutionsbedingungen fördernd für die Weiterentwicklung und das Überleben unserer Art waren bzw. welche störend.
Die Analyse umfasst die Beiträge von verschiedenen Kulturen zu den biosozialen Prozessen von Geburt bis Elternschaft jeweils in Hinblick auf die unterschiedlichen kulturellen Traditionen. Veränderungen in der Denk- und Glaubenswelt der Kulturen führten zu großen Veränderungen in der Gestaltung dieser Abläufe. In diesem Buch werden die kulturellen Traditionen dabei aus der Perspektive des Evolutionsprozesses auf ihre Eignung für das Entstehen und Überleben der Art Mensch untersucht.
In der frühen partnerschaftlichen Kultur wurde dem Liebescode Rechnung getragen. Die Beziehungen waren von Sicherheit, Vertrauen und hoher Bindungsfähigkeit gekennzeichnet. Die kulturelle Evolution unterstützte liebevolle Beziehungen und verehrte das Leben. Große Veränderungen brachte der Übergang zur Dominanzkultur. Von da an bis heute wurden die biologischen Überlebensbedingungen von Liebe und Kooperation systematisch durch die kulturelle Evolution außer Kraft gesetzt. Seitdem herrscht die Meinung, der Mensch sei wegen seiner Denkfähigkeit die höchste Naturentwicklung und könne daher mit Recht über alles andere herrschen und die Natur für sich ausnutzen.
So finden wir uns wieder in einer Welt, die gar nichts mehr von den alten partnerschaftlichen Kulturen weiß. Diese Veränderungen führten zu einer Überbewertung logischen Denkens und daraus resultierend zu einer zutiefst von sich selbst entfremdete Menschheit, die sich ohne Zugang zum inneren Körpergefühl gerade die eigenen Lebensgrundlagen zerstört und ihr eigenes Aussterben herbeiführt.
Wie ist die heutige Kultur?
Kapitel 7 untersucht die heutige Kultur auf ihre Beiträge in Zusammenhang mit der biologischen Evolution.
Für unser Nervensystem ist die heutige Kultur nicht wirklich sicherer, als die Jahrhunderte der Vergangenheit. Wir erleben viel mehr Reize und nicht jeder davon bedeutet Gefahr, aber jeder aktiviert als Stressor das Nervensystem. Dadurch entsteht ein erhöhter Verbrauch von Ressourcen, einem ernsten Problem der gegenwärtigen Zeit, wie sich an der Zunahme von Stressfolgekrankheiten aller Art deutlich ablesen lässt. Wir überfordern die biologische Regulationskapazität unseres eigenen Organismus so, dass Gefahr für das Überleben unserer eigenen Art besteht. Aber wir überfordern ebenso die Regulationskapazität der Ökosysteme und des gesamten Klimasystems. Es besteht Gefahr für die Erde und uns selbst durch diesen Verlust Gleichgewichts der Selbstorganisation der Systeme. Wenn wir nicht rasch darüber nachdenken und unsere Lebensverhältnisse verändern, droht sowohl der Kollaps des Klimas als auch unserer Art selbst.
Was heißt es, in Einklang mit der biologischen Evolution zu leben?
Mit Hilfe der Evolutionskriterien des Liebescodes lässt sich ableiten, was wir lernen können und müssen, um die dringlichsten Menschheitsfragen in Zukunft beantworten zu können. Es wird untersucht, welche biologischen Bedingungen wir in Zukunft für die biosozialen Prozesse von Schwangerschaft, Geburt, Bindung, Paarliebe, Elternschaft für ein gesundes gelingendes Leben in Übereinstimmung mit der uns umgebenden Umwelt schaffen müssen (Kapitel 8).
Auf dieser Grundlage beschreibt das Buch praktikable Lösungsansätze für einige der häufigsten Probleme unserer Zeit: Stressfolgekrankheiten, Körperentfremdung, soziale Isolation, psychische Störungen, Beziehungsschwierigkeiten sowie Auffälligkeiten bei Kindern. Dabei wird die besondere Rolle von Sicherheit und Liebesfähigkeit als die zentralen biologischen Funktionen für das individuelle wie gesellschaftliche Überleben aufgezeigt. Anschließend werden konkrete Handlungsalternativen abgeleitet. Auf einer wissenschaftlich fundierten Basis wird dargestellt, was für Gesundheit und gutes (Über)Leben aus biologischer Sicht notwendig ist.
Anhand der eingangs entwickelten Kriterien der Biologie lassen sich die Bedingungen aufzeigen, die notwendig für unser weiteres Überleben in der Zukunft sind und wie die nötigen Veränderungen gelingen können.
Dabei betrachte ich die Kulturgeschichte aus dem Blickwinkel einer Biologin in Bezug auf die Evolution und verbinde geschichtliches mit neurobiologischem Wissen, um für die Frage „Wie wollen wir leben?“ Anregungen zu geben. Das umfasst auch die Frage, welche Werte, Traditionen und Glaubensvorstellungen wir in Zukunft zur allgemeinen sozialen Wirklichkeit werden lassen wollen.
Die nötigen Veränderungen gelingen nur, indem wir den Liebescode begreifen und berücksichtigen und indem wir als Kultur wieder unsere biologischen Notwendigkeiten in den Vordergrund stellen.
Zu diesen Überlebensbedingungen gehört die Gefühls- und Liebesfähigkeit der Menschen als Selbstliebe, Paarliebe und Elternliebe. Elternliebe braucht als Voraussetzung Paarliebe - Paarliebe braucht als Voraussetzung Selbstliebe.
Dieses Buch sollte ursprünglich kein Buch über die Liebe werden. Während des Recherche- und Schreibprozesses bin ich jedoch auf eine weite Reise gegangen und letztendlich bei der Liebe gelandet. Nicht bei dem romantischen Begriff, sondern bei der wissenschaftlichen, neurobiologischen Bedeutung der Liebe und ihrer Funktion in der Evolution. Es wird gezeigt, dass und weshalb fehlende Liebesfähigkeit typisch für unsere jetzige Zeit ist und inwiefern auch die Ursache von Krankheit. Das Fehlen von Liebe macht langfristig krank.
Zur Liebe sind viele Bücher geschrieben worden, dennoch möchte ich noch dieses hinzufügen. Ich bin fasziniert, heute mehr denn je, von der Schönheit und Funktionalität der Evolution. Umso wichtiger ist es, wieder das zurückzugewinnen, was uns als Art ursprünglich in der Evolution hat entstehen lassen: Bindung, Fürsorge, Liebe und dadurch Wohlbefinden und Gesundheit. Diese umfassende Liebesfähigkeit gilt für die Liebe zu uns selbst, zu unseren Angehörigen und Mitmenschen genauso wie für die Welt um uns herum und unser Klima.
Daraus erwächst die emotionale Kraft, um sich für Veränderung einzusetzen und kluge Zukunftsvisionen mit Leben zu erfüllen – gesellschaftlich und persönlich.
Es bedeutet: Veränderung muss im Kleinen beginnen, in der Basis der Gesellschaft: bei Ihnen und mir.
Für meine Kinder und für unser aller Kinder!
Kapitel 2 – Wie ist die Natur des Menschen?
Vor einigen Milliarden Jahren entstanden die ersten Lebewesen. Es waren bereits komplexe biologische Strukturen, auch wenn sie am Beginn nur aus einer einzigen teilungsfähigen Zelle bestanden. Das Überlebensziel jedes Lebewesens war es und ist es bis heute, wirksam auf Störungen im Außenmilieu zu reagieren, um sein Gleichgewicht zwischen innen und außen aufrecht zu erhalten und dadurch am Leben zu bleiben. Das betrifft die Einzeller mit einfacher Nahrungsaufnahme durch die Zellwand, wie auch alle höheren Organismen in immer weiter ausdifferenzierterer Form.
Jeder biologische Organismus selektiert aus zufälligen genetischen Veränderungen diejenigen heraus, die für ihn hilfreich zum Überleben sind. Dieser Prozess, die Evolution, hat so im Verlauf von Milliarden von Jahren zur Entstehung all der Arten geführt, die wir heute kennen. Dabei haben sich zur Aufrechterhaltung des inneren Gleichgewichts immer kompliziertere Organe und Organsysteme entwickelt, wie z.B. das Gehirn und das Regulationssystem der Hormone und Neurotransmitter, welches die unbewusst bleibenden inneren Zustände reguliert. Komplex sind ebenso die Sinnesorgane, die über die Außenwelt informieren, um angemessen reagieren zu können.
Ein großer Entwicklungsfortschritt fand im Übergang von den Reptilien zu den Säugetieren statt. Während sich Reptilien noch durch eine einfache Erstarrungsreaktion vor Gefahr schützen, kam später in der Evolution bei den Säugetieren die aktive Kampf- und Fluchtreaktion dazu. Während Reptilien sich nicht weiter um ihren Nachwuchs kümmern, ihre Partnerwahl zur Fortpflanzung beliebig ist und sie keine sozialen Interaktionen und Gefühle zeigen, bildeten sich bei den Säugetieren enge soziale Beziehungen, Gefühle von Liebe und Zuneigung, spezifische Paarliebe und sorgende Elternschaft heraus. Alles das hat sich über Jahrmillionen zur Arterhaltung entwickelt und bewährt. So hat die evolutionäre Auslese zu immer besserer Anpassung an die jeweiligen Lebensumstände, ja sogar zur Kommunikation der Lebewesen untereinander und zur Entstehung sozialer Strukturen geführt.
Neben der wachsenden Differenzierung innerhalb eines Lebewesens zu immer komplexeren Regulationssystemen erweiterte die Entwicklung von Kooperation den Spielraum einer Art zum Überleben. So kooperieren z.B. Bienenstaaten sehr effektiv in der Nahrungssuche und Fortpflanzung. Es gelingt ihnen gemeinsam leichter, das überlebensnotwendige Gleichgewicht jedes einzelnen Organismus und der Art insgesamt aufrecht zu erhalten. Aber ihr Verhalten ist kaum variabel, sie verhalten sich nach genetisch festgelegten Mustern.
Diese Einschränkung wurde im weiteren Verlauf der Evolution überwunden, als sich Arten mit stärker lernfähigen Gehirnen entwickelten und die Individuen innerhalb einer Art sozial miteinander kooperierten, um ihre Nachkommen besser angepasst großziehen zu können. Lernfähige Gehirne sind in der Lage, sich sehr viel schneller zu verändern, als dies evolutionär durch Veränderungen der Gene möglich ist. Aber Tiere, die Nachkommen mit unfertigen Gehirnen zur Welt bringen, müssen diese Nachkommen länger schützen bis die Gehirne fertig ausgereift sind.
Schutz und Versorgung über einen vergleichsweise langen Zeitraum der Kindheit – das gelang den Säugetieren im Verlauf der Evolution deshalb erfolgreich, weil sie eine soziale Bindung zueinander eingehen können. Vermittelt wird diese Bindung durch das Empfinden von Gefühlen der Liebe und Verbundenheit. Außerdem können sie einander mitteilen, wann soziale Interaktion gefahrlos möglich ist, wann sie ungefährdet z.B. Nachkommen füttern, mit ihnen spielen, wann sie zärtlich sein oder schlafen können.
Diesem Ziel dient die unablässige Überwachung der Umgebung auf Gefahren hin, um Freund und Feind unterscheiden zu können. Dafür interpretiert das Nervensystem die Gesichtsausdrücke und Bewegungen Anderer als vertraut und sicher oder unvertraut und nicht sicher. Durch mimischen, gestischen und stimmlichen Ausdruck von Affekten, wie Angst, Wut, Ekel, Schmerz oder aber Liebe und Zuwendung, vermögen es Säugetiere, ihren Artgenossen Befinden und Sicherheit der Umwelt mitzuteilen. Nur in als sicher wahrgenommen Situationen erfolgt soziales Verhalten und wird Verteidigungsverhalten herab geregelt. (1) Dadurch erreichen Säugetiere den nötigen Schutz für eine vergleichsweise lange Entwicklungszeit, für soziale Kooperation, für den Aufbau von Bindungen und damit ein besseres Überleben als Gruppe.
Die Arten, die das erreichten, konnten noch anpassungsfähigere Gehirne entwickeln. Mit den Säugetieren entstanden erstmals Tiere, die eigene innere Gefühlszustände signalisieren und steuern, ihren Artgenossen mitteilen und die der Artgenossen erkennen können. Sogar zwischen verschiedenen Arten vermittelt sich der Zustand von innerem Gleichgewicht und Wohlbefinden oder aber von Angst. Wir Menschen erkennen den Ausdruck einer zufrieden schnurrenden Katze als genau das, aber auch sehr präzise den Gefühlszustand eines aggressiv knurrenden Hundes. Auf diese Weise wurde den Säugern erstmals in der Evolution eine gegenseitige Einstimmung durch den Ausdruck von Gefühlen und die Mitteilung von Sicherheit für soziale Handlungen möglich. Dadurch gelang es ihnen immer besser, eine enge Bindung zwischen Eltern und Nachkommen zu entwickeln, Aggressivität unter Artgenossen zu minimieren sowie Sicherheit für die säugetierspezifischen Lernerfahrungen der Nachkommen zu kommunizieren. So konnten sie sich im Verlauf der Evolution immer weiter entwickeln und an die Umwelt anpassen.
Bereits bei Ratten lässt sich eine frühe Bindungsphase zeigen, in der die Rattenmütter eine Bindung an ihre Jungen aufbauen. Bei Schafen und Ziegen findet man ein noch weiter entwickeltes Bindungsverhalten. Sie haben bereits stark individualisierte Bindungen, so dass sie nach einer kurzen Prägungsphase jedes fremde Junge wegstoßen. Diese Bindungsphase ist bei den meisten Säugern nur kurz und sie haben kein enges soziales Band untereinander. Primaten jedoch haben bereits ein hochentwickeltes soziales Leben und einen individuellen langfristigen Bindungsaufbau zu ihren Babys und den anderen Mitglieder der Gruppe. Daraus lassen sich Hinweise für die Entstehung des menschlichen sozialen Lebens im weiteren Verlauf der Evolution ableiten. Die mit Wohlbefinden verbundenen Fähigkeiten zu Bindung, Nähe und Zärtlichkeit haben sich ursprünglich zur Sicherung der Aufzucht der Nachkommen entwickelt. Im weiteren Verlauf der Evolution wurde das Wohlbefinden in Bindung und Nähe mehr und mehr auch auf die Beziehungen der Artgenossen untereinander und zwischen weiblichen und männlichen Tieren als Paarliebe übertragen.
Eine weitere, erst mit den Säugetieren auftauchende Eigenschaft ist die Fähigkeit zur bewussten, willentlichen Steuerung und Lenkung der Aufmerksamkeit, um anstehende Probleme oder Störungen nicht reflexhaft wie Reptilien zu beantworten, sondern durch bewusste Lenkung der Aufmerksamkeit auf eine Lösungssuche. Je nach dem Ergebnis dieser Suche stehen den Säugetieren neue Möglichkeiten zur Abwehr einer Gefahr zur Verfügung, nämlich Kampf oder Flucht.
Kapitel 2.1 – Woher kommen wir?
Menschenaffen zeigen das größte Maß an Flexibilität und Anpassung an sich verändernde Umweltbedingungen und das am weitesten entwickelte soziale Leben unter den Säugetieren. Vor mehr als 10 Millionen Jahren lebten Vorfahren der heutigen Menschenaffen. Aus ihnen entwickelten sich Orang-Utan, Gorilla, Schimpanse, Bonobo und später auch der Mensch. Der Mensch steht unter den Menschenaffen von seiner Erbsubstanz her besonders den Bonobos, den Rhesusaffen und den Schimpansen nahe. Rhesusaffen haben ca. 95 % der genetischen Erbsubstanz DNA mit uns Menschen gemeinsam. (2)
Wissenschaftler haben in den letzten Jahren die Gene mehrerer Menschenaffen analysiert. Dabei zeigte sich, dass Schimpansen, Bonobos und Menschen am engsten verwandt sind. Schimpansen und Bonobos sind noch enger zueinander verwandt, als der Mensch mit beiden Arten. Allerdings gibt es Genbereiche, in denen Mensch und Bonobo einander ähnlicher sind sowie Bereiche, in denen Mensch und Schimpanse einander ähnlicher sind. Bei 1,6 % der untersuchten Stellen ähnelt sich die Erbinformation von Mensch und Bonobo mehr als die von Schimpanse und Bonobo. Bei 1,7 % ist das menschliche Genom dem Schimpansen ähnlicher. (3) Aus der Untersuchung geht hervor, dass vor ca. 4,5 Millionen Jahren die menschliche Evolution sich von dem gemeinsamen Vorfahren abtrennte und separat weiter verlief. Der Stammbaum von Bonobos und Schimpansen trennte sich erst vor ca. 2 Millionen Jahren.
Trotz der Ähnlichkeiten in der Erbsubstanz und der relativ späten evolutionären Trennung zeigen Bonobos und Schimpansen unterschiedliche Verhaltensweisen. Beide Arten leben in kleinen Gruppen von Artgenossen, pflegen soziale Beziehungen und kooperieren bei der Nahrungssuche. Leittier ist bei den Schimpansen fast immer ein Männchen. Schimpansen konkurrieren aggressiv um Weibchen, dabei richtet sich ihr aggressives Verhalten auch öfter gegen die Weibchen. Bei der verwandten Art der Bonobos werden die Gruppen meist von Weibchen geführt. Die Anwesenheit empfängnisbereiter Weibchen lässt auch bei den Bonobos die Männchen mit einer gewissen Zunahme von Aggressivität um die Weibchen konkurrieren, aber das führt niemals zu einer Aggressivität gegen Weibchen. (4) Bonobos gelten als friedlicher, im Gegensatz zu Schimpansen konkurrieren sie nicht so intensiv um den Rang in der Gruppe. Sie zeigen keine tödlichen Aggressionen und sind verspielter. (5, 6) Außerdem wurden sie dadurch bekannt, dass sie ein intensives sexuelles Interesse zeigen, welches nicht mehr nur der Fortpflanzung dient, sondern vorrangig dem sozialen Zusammenhalt und dem Wohlbefinden. (7)
Mit der Trennung von den gemeinsamen Vorfahren der Menschenaffen ging vor ca. 4,5 Millionen Jahren die biologische Gattung des Urmenschen (Homo) aus der Affengattung Australopithecus in Afrika hervor. Forscher gehen derzeit von sieben verschiedenen Arten aus: Australopithecus afarensis, hierzu zählt das 1974 in Äthiopien ausgegrabene Teilskelett von Lucy. Es ist 3,2 Millionen Jahre alt. Australopithecus afarensis soll der letzte gemeinsame Vorfahr mehrerer Abstammungslinien der Hominiden sein. (8) Vor 2,1 bis 1,8 Millionen Jahren lebte der Homo rudolfensis. Er hatte bereits ein größeres Gehirn als die anderen Vormenschen und nutzte Werkzeuge. Etwa gleichzeitig, vor 2,1 bis 1,5 Millionen Jahren, lebte Homo habilis in Ostafrika. Vor ca. 2 Millionen Jahren begaben sich diese Frühmenschen zum ersten Mal auf den Weg in die Welt und entwickelten dabei in der Anpassung an ihre jeweiligen Lebenswelten verschiedene Arten: den Homo neanderthalensis (Europa, Westasien), Homo soloensis (Indonesien), Homo rudolfensis (Ostafrika), Homo erectus (Asien), Homo sapiens (Afrika).
Bis auf den Homo sapiens sind alle anderen Urmenschenarten ausgestorben. (9) Sie hinterließen jedoch ihre Spuren. In Georgien fanden Forscher seit 1999 mehrere 1,75 Millionen Jahre alte menschliche Überreste, die dem Homo erectus (vor ca. 300 000 Jahren ausgestorben) zugerechnet werden. 1907 wurde ein ca. 500 000 Jahre alter Unterkiefer des Homo heidelbergensis nahe Heidelberg ausgegraben und 1995 wurden in Spanien 780 000 Jahre alte Überreste von vier Menschen dieser Art sowie ihre Werkzeuge gefunden. Sie zählen zu den frühesten Menschen Europas. Neuere Datierungen sprechen dafür, dass einige Gruppen des Homo heidelbergensis noch vor 35 000 Jahren lebten. (10) Ein Fund von 1856 in der Feldhofer Grotte im Neandertal bewies die Existenz des Homo neanderthalensis, der von ca. 400 000 bis 40 000 Jahre v.u.Z. gelebt hat. 2004 wurden auf der Insel Flores Überreste eines nur einen Meter großen indonesischen Urmenschen, Homo floresiensis, gefunden, der zwischen 120 000 und 10 000 v.u.Z. lebte. In Sibirien fanden Archäologen 2008 versteinerte Fingerknochen und einen Backenzahn, dessen Erbgut weder zu dem der Neandertaler noch zu dem der Homo sapiens passt und bezeichneten ihn als Frühmenschen Denisova hominins, der vor ca. 35 000 Jahren lebte. (11)
Seit ca. 350 000 Jahren gibt es den Homo sapiens. Die bislang ältesten Überreste des modernen Menschen wurden in einer Höhle bei Jebel Irhoud in Marokko entdeckt. Die analysierten Schädel- und Kieferknochen untermauern die Vermutung, dass die Menschen sich im afrikanischen Raum entwickelt und von dort aus in die ganze Welt ausgebreitet haben. Am interessantesten ist jedoch, wie das Fundalter belegt, dass der Homo sapiens gleichzeitig mit primitiveren Frühmenschenformen auf der Erde lebte. (12) Es muss eine Vermischung mit den anderen Frühmenschen, wie z.B. den Neanderthalern stattgefunden haben, denn die heutigen Europäer tragen noch 3 % seines Erbgutes, Menschen in Südostasien noch ca. 4 % Erbgut des Denisovans. Forscher gehen davon aus, dass in Afrika verschiedene Gruppen von Frühmenschen lebten, die sich begegneten, tauschten und auch fortpflanzten, bis allmählich der Homo sapiens entstand. (13)
Kapitel 2.2 – Was hat diese Entwicklung ermöglicht?
Im Vergleich zu den anderen Frühmenschenarten hat der Homo sapiens sich zu beispiellosen kognitiven Leistungen entwickelt. Die Genanalyse gibt eine Erklärung, was dazu beigetragen hat: Immer wieder im Verlauf der Evolution gab es spontane Veränderungen im Erbgut, die einen entscheidenden Vorteil für die jeweilige Art im Überleben darstellten.
Ein Beispiel für solche Mutationen, die die weitere Entwicklung der geistigen Fähigkeiten des Menschen begünstigten, wurde im Erbgut der Menschenaffen bei einem Gen des Eisenstoffwechsels gefunden. Ein Eiweiß ist als Bestandteil der roten Blutkörperchen für die Sauerstoffversorgung im Körper zuständig. Von dessen Gen BoIA2 besitzen alle Tiere zwei Kopien (1mal mütterlich, 1mal väterlich). Der Mensch hat davon jedoch mehr Kopien, manche Menschen besitzen sechs, manche 12 oder sogar 16 Kopien. Wie sich herausstellte, geschah diese zufällige Vervielfältigung des Gens vor 282 000 Jahren. Sie verbreitete sich rasch im Genom der Menschen und erlaubte die Entwicklung solcher großen Gehirne, wie sie die Evolution der Menschen in den letzten 300 000 Jahren hervorgebracht hat. Das frühmenschliche Gehirn hatte bereits das dreifache Volumen der Affenvorfahren. (14) Aber erst durch diese Mutation gelang eine Sauerstoffversorgung, die ein so enormes Gehirnwachstum ermöglichte, wie es in der Entwicklung des Menschen von da an stattgefunden hat. Der Energieumsatz des Gehirns ist 10mal größer als der anderer Organe. Es verbraucht bei Erwachsenen ca. 20 % der gesamten Energie, bei Kindern sogar fast 80 %. Diese bessere Sauerstoffversorgung ermöglichte die Entwicklung von räumlichem Vorstellungsvermögen, den Beginn des abstrakten Denkens und als einen entscheidenden Faktor: die weitere Entwicklung von sozialen Interaktionen zur Kooperation in großen Gruppen über Sprache.
Die ersten Frühmenschen ernährten sich vermutlich direkt von den Bäumen, Sträuchern und anderen Pflanzen, die sie unterwegs vorfanden. Allmählich entwickelten vor allem die Frauen ihre Hände dazu, Nahrung anzufassen, einzusammeln und mitzunehmen, während sie gleichzeitig ihre Babys mit sich trugen. (15) Dadurch entstand der aufrechte Gang, der die Hände frei ließ für das Sammeln und Wegtragen. Das wiederum bedeutete, Nahrung aufbewahren und teilen zu können.
Ein wichtiger Impuls zur weiteren Entwicklung bestand darin, Gefäße zum Transportieren und Werkzeuge zur Bereitung von Nahrung zu entwickeln. Insbesondere Frauen, die Nahrung für die Kinder aufbereiteten, haben zur Entwicklung dieser Werkzeuge beigetragen. Es wurde gezeigt, dass bei Primaten die Mütter Nahrung mit den Jungen teilen. Bei Schimpansen machen mehr die Weibchen als die Männchen Gebrauch von Werkzeugen. Da im Allgemeinen die Nahrungsmittelbeschaffung Aufgabe der Frauen war, ist anzunehmen, dass auch die Domestizierung der ersten Pflanzen und Tiere durch sie erfolgte.
Ein weiterer Impuls für die Gehirnentwicklung bestand in der raschen Vermittlung von Informationen über die Herstellung von Werkzeugen, über die besten Nahrungsplätze, über das soziale Leben in der Gruppe sowie in der Kommunikation zur Bindung zwischen Müttern und Kindern. Die Nachkommen überlebten eher, wenn ihre Mütter ihnen genug Nahrung beschaffen und teilen konnten. Diese Ergebnisse zeigen, dass die wesentlichen Grundlagen sozialer Ordnungen von Müttern stammen, die mit ihren Kindern Nahrung teilten. Das wird durch Untersuchungen an Primaten bestätigt, wonach Bonobos Futter bereitwillig teilen, sowohl mit Verwandten als auch mit fremden Artgenossen und dafür soziale Belohnung in Form von Zärtlichkeiten erhalten. (16)
Die Frühmenschen entwickelten in enger Kooperation untereinander umfangreiches Wissen über ihre Umwelt, über das Verhalten der Natur, über Orte mit reicher Nahrung, zur Werkzeugherstellung und zur ersten Herstellung von Kleidung. Alles das führte zur immer weiteren Ausdifferenzierung des Gehirns, zur Entwicklung von Sprache und in gegenseitiger Wechselwirkung zu noch größeren Gehirnen, mehr nachgeburtlichem Lernen und noch besseren Anpassungen.
Nachkommen mit immer größeren Gehirnen brauchen nach der Geburt noch sehr lange intensive Pflege und Schutz. Menschliche Babys können im Gegensatz zu anderen Säugetierbabys nicht bereits nach wenigen Stunden stehen und laufen, sondern brauchen eine viel intensivere und längere Fürsorge und Bindung. Dies hat während der Entwicklung der Frühmenschen zu einer weiteren sozialen Entwicklung zu noch mehr Bindung und Schutzverhalten geführt.
Durch die Entstehung von Sprache und abstrakten Begriffen hielt eine neue Art des Erkenntnisgewinns Einzug in die entstehende Menschheit. Nur einige hochentwickelte Menschenaffenarten sind teilweise zu leichten Abstraktionen in der Lage. (17)
Innerhalb dieser Entwicklung begann der Mensch vor ca. 100 000 -70 000 Jahren v.u.Z. andere Gebiete der Welt zu besiedeln. In dieser Zeit wurden in Afrika bereits Schneckenschalen zu Schmuck gestaltet und Ritzzeichnungen auf Steinen hinterlassen. (18) Ca. 70 000 v.u.Z. wanderte der Mensch von Ostafrika in Richtung östliches Mittelmeer. Die weiteren Wanderungen gingen ca. 60 000 v.u.Z. höchstwahrscheinlich zur arabischen Halbinsel und von dort weiter nach Südasien. In weite Teile von Europa erfolgten die Wanderung ca. 45 000 v.u.Z. Etwa 13 000 v.u.Z. erreichten die Menschen von Nordostsibirien aus den Kontinent Amerika. Diese frühen Menschen verfügten bereits über eine entwickelte Sprache, über Werkzeuge und Schmuckgegenstände und ein hoch entwickeltes soziales Leben, also eine eigene Kultur. (19)
Kapitel 2.3 – Welche Bedeutung hatte Sprache?
Wie oben ausgeführt, sind nur Menschen zur Nutzung abstrakter symbolischer Sprache und Bilder fähig. Damit wurde der Austausch nicht nur über reale, sondern auch über vorgestellte Dinge möglich. So entstanden Geschichten, Mythen, Religionen sowie gemeinsame Vorstellungen von der Welt. Es wurden Traditionen, Werte, Erklärungen und Glaubensvorstellungen entwickelt, die größere Gruppen von Menschen zu einer Einheit verbanden. Auf dieser Grundlage entwickelten sich Bindung und Kooperation als Voraussetzung für bessere Anpassung und Überleben immer weiter.
Der soziale Austausch über die Welt und die Vorstellungen der frühen Menschen davon schafften neue Begriffe und Abstraktionen, mit andern Worten „soziale Realitäten“. Diese Weiterentwicklung erfolgte durch den Einbezug der Sprache als Medium zur Konstruktion von Wirklichkeiten sozialer Systeme. Denn durch den Austausch erzählter Vorstellungen und Überzeugungen von der Welt erschaffen wir Menschen unsere jeweilige persönliche Realität und gleichen diese individuellen Vorstellungen untereinander sowie mit der kulturellen Allgemeinheit ab. Demnach ist „Realität“ ein Begriffskonstrukt das durch menschlichen Austausch darüber zur allgemein akzeptierten Realität Aller wird. Allgemein akzeptierte Ansichten und Realitäten erlauben die Kooperation von Menschen in großen Gruppen und sind die Basis jeglicher Kultur. So erschufen sich unsere Vorfahren mit zunehmender Sprachfertigkeit allmählich ihre Kultur. Neben der eingangs erwähnten biologischen Kopplung von Organsystemen innerhalb eines Lebewesens sind wir Menschen dadurch in der Lage, sprachliche Kopplungen zwischen vielen Lebewesen herzustellen.
Allein wir Menschen vermögen es, durch unsere kulturellen Vorstellungen Einfluss auf unsere biologische Evolution zu nehmen: auf unsere eigene soziale Wirklichkeit, auf die Art, wie wir denken und erkennen und auf die Art, wie wir unsere eigenen Geschichte schreiben. Dieser Prozess markiert das Auftauchen einer sich immer weiter entwickelnden kulturellen Evolution zusätzlich zur biologischen Evolution. Im Folgenden wird dargestellt, wie in menschlichen Kulturen in der Vergangenheit Einfluss auf die biologische Evolution genommen wurde und noch wird und welche Konsequenzen das für die Menschen als Individuen und als Gesellschaft hatte und hat.
Dazu ist es jedoch nötig, die Arbeitsweise unseres menschlichen Gehirns zu beleuchten, um besser zu verstehen, was die biologischen Grundlagen der Entwicklung des Menschen sind. Es wird gezeigt, was wir mit anderen biologischen Lebewesen gemeinsam haben und was uns als Menschen unterscheidet. Davon handelt das nächste Kapitel.
Kapitel 3 - Wie funktioniert das Nervensystem?
Im vorigen Kapitel wurden die Grundzüge der Menschwerdung und deren wesentliche Ergebnisse beschrieben: der aufrechte Gang sowie die Entwicklung von Werkzeugen, Sprache, engen sozialen Bindungen und einer gemeinsamen Kultur. Dadurch gelang es den frühen Menschen, sich zu größeren sozialen Verbänden mit gemeinsamen Zielen zu einigen und zu organisieren.
In diesem Kapitel wird es um das Nervensystem gehen, welches alle diese Leistungen ermöglicht. Die größte menschliche Errungenschaft ist die Fähigkeit, sich auf rasch verändernde Situationen und Umwelten durch Lernen einstellen und sich dadurch anpassen zu können. Damit nahmen die Möglichkeiten der Reaktionen auf die Umwelt durch Lernen und eigene Problemlösungsfähigkeit unaufhörlich zu.
Um diese Prozesse verstehen zu können, sind Antworten auf viele Fragen nötig. Glücklicherweise konnte die Neurobiologie in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr viele dieser Fragen beantworten. Davon handelt das folgende Kapitel und beschäftigt sich u.a. mit diesen Fragen:
Wie gelingt die Aufrechterhaltung des inneren Gleichgewichts?
Wie gelingen gleichzeitig Veränderungen und Lernen?
Wozu brauchen wir überhaupt Gefühle?
Kapitel 3.1 – Evolutionsziel Wohlbefinden?
Zu den bahnbrechenden Arbeiten für ein Verständnis der Evolution gehören die Erkenntnisse der Biologen Maturana und Varela über selbstorganisierende Systeme, zu denen auch die biologischen Organismen gehören. Das Ziel selbstorganisierender Systeme, vom Einzeller bis zum Menschen, ist es, ihr inneres und äußeres Gleichgewicht, zu bewahren und es nach Störungen möglichst rasch wieder herzustellen. So werden das Überleben, Wachstum und Fortpflanzung ermöglicht. (1) Wenn z.B. unser inneres Gleichgewicht durch Hunger oder Durst gestört wird, haben wir den dringenden Wunsch, unser Gleichgewicht wieder herzustellen, indem wir essen oder trinken. Wenn unser inneres Gleichgewicht gestört wird, weil wir uns bedroht fühlen, haben wir den dringenden Wunsch, uns zu wehren oder wegzulaufen.
Allgemein lässt sich daher sagen, dass es oberstes Handlungsziel eines jeden Organismus ist, das eigene psychobiologische Wohlbefinden aufrecht zu erhalten. Dieses Wohlbefinden bzw. inneres Gleichgewicht umfasst bei uns Menschen so einfache Prozesse wie Blutdruck, Körpertemperatur, Muskelspannung, Nahrungsversorgung oder Hormonspiegel. Aber auch so komplexe Prozesse wie die Regulation von Aufmerksamkeit, Angst, Erregung und Liebe gehören dazu. Das Nervensystem reagiert auf alle Abweichungen mit dem Ziel, das alte Gleichgewicht wieder herzustellen bzw. ein neues Gleichgewicht zu finden, also mit Lernen. Unser Gehirn erzeugt Verhalten stets auf der Grundlage solcher selbstorganisierender Prozesse. Der Umgang mit jeder neuen Erfahrung wird im Gehirn immer wieder am Evolutionskriterium „brauchbar zur Sicherung psychobiologischer Gesundheit bzw. zur Wiederherstellung oder Aufrechterhaltung des inneren Gleichgewichts oder nicht“ gemessen, also mit dem Vermerk „suchen“ oder „meiden“ abgespeichert.
Diese Überlegungen zur selbstorganisierenden Herstellung eines Gleichgewichts werfen natürlich sofort die Frage auf, wie das gelingt. Um diese Frage zu beantworten, ist es nötig, die Organisation des Nervensystems genauer betrachten.
Kapitel 3.2 – Wie sind Nervensystem und Gehirn aufgebaut?
Unser Gehirn und Nervensystem sind grundsätzlich wie bei allen anderen Säugetieren aufgebaut. Zum Nervensystem gehört das periphere Nervensystem, also die Nervenfasern die zu den Muskeln (somatisches Nervensystem) sowie zu Körperorganen und Sinnesorganen (autonomes vegetatives Nervensystem) ziehen bzw. von dort zum Gehirn führen.
Autonomes Nervensystem
Das autonome Nervensystem (ANS) vermittelt die wesentlichen Erfahrungen über das innere Gleichgewicht der inneren Organe (Homöostase), über Störungen des Gleichgewichts und Wohlbefindens, über Sicherheit und Abwesenheit von Gefahr bzw. bevorstehende Kampf- und Fluchtmobilisierung. Es besteht aus dem sympathischen Teil (SNS), über den eine allgemeine Mobilisierung und Aktivierung bis hin zur Kampf- und Fluchtreaktion vermittelt werden kann, sowie dem älteren und dem neueren parasympathischen Teil (PNS) für Erholung und Regeneration. Die parasympathischen Regulationen werden durch den Nervus Vagus vermittelt. Neuere Forschungen zeigen, dass es sich dabei nicht um einen einzigen Nerv handelt, sondern um eine Familie von Nervenbahnen, die an mehreren Orten des Hirnstamms entspringen. (2) Der neue, in der Evolution nur bei Säugern entstandene parasympathische Zweig des autonomen Nervensystems (neuer Vagus) reguliert den Ausdruck und das Empfinden von Körpergefühlen, Affekten sowie Herzfrequenz und Atmung im Zustand von Sicherheit. Der alte Zweig des Vagus ermöglicht die Aufrechterhaltung des inneren Gleichgewichts, vor allem der inneren Organe unterhalb des Zwerchfells, sowie die Notreaktion der Erstarrung bei Gefahr. (3) Das sympathische und parasympathische System leiten die emotionalen Bewertungen von Handlungen und Umweltreizen an die Zielorgane im Körper weiter und Rückmeldungen von dort in den Hirnstamm zurück. Die jeweilige Aktivierung wird nach dem Bedarf des Organismus über Neuromodulatoren (Hormone und Botenstoffe) reguliert, die vorrangig in der Hypophyse (Hirnanhangsdrüse) des Gehirns, aber auch im Nebennierenmark gebildet werden.
Zentrales Nervensystem
Zum zentralen Nervensystem gehören das Gehirn sowie das Rückenmark. Innerhalb des Gehirns werden mehrere Teile unterschieden: Den Übergang vom Rückenmark zum Gehirn bildet die Medulla oblongata (verlängertes Mark). Daran schließen sich das Mittelhirn, Kleinhirn, Zwischenhirn und Großhirn (Cortex) an. Der evolutionär älteste, innen liegende Teil des Gehirns wird als Hirnstamm bezeichnet (Verlängertes Mark und Mittelhirn). Im Bereich des verlängerten Rückenmarks treten die Hirnnerven aus bzw. ein. Zu ihnen gehören die Nervenbahnen des autonomen Nervensystems sowie Gesichts- und Kopfnerven. Sie dienen der Regulation des inneren Zustands durch soziale Kommunikation (Kapitel 3.12.). Hier befindet sich die Formatio Reticularis. Sie umgibt die Hirnstammgebiete netzartig und hat wichtige Funktionen bei der Kontrolle von Aufmerksamkeit und Erregung, aber auch für die Regulation von Schlaf, Blutkreislauf und Atmung besitzt. Ihre Informationen werden im Hypothalamus verarbeitet.
Hypothalamus-Hypophysen-System
Im Zwischenhirn ist der Hypothalamus als zentrale Regulationsstelle zwischen Hormonsystem und Nervensystem lokalisiert. Vermittelt werden diese Funktionen hauptsächlich über Hormone und Neuromodulatoren aus der zugehörigen Hirnanhangsdrüse (Hypophyse), die über das autonome Nervensystem ihre Zielorte erreichen. Hier erfolgen die Regulation von Herzschlag, Blutdruck, Atmung, Hunger, Durst, Ausscheidung, Temperatur sowie das Gefühl von innerer Sicherheit oder Gefahr. Die Wirkungen der einzelnen Hormone müssen immer genau an die Bedürfnisse des Organismus angepasst sein. Um das zu erreichen, gibt es übergeordnete neuromodulatorische Regelkreise, die das steuern. Dazu zählt vor allem das Hypothalamus-Hypophysen-System. Der Hypophyse kommt eine zentrale Rolle bei der Regulation des Hormonsystems im Körper zu. Sie ist eine Art Schnittstelle, mit der das Gehirn über die Freisetzung von Hormonen wichtige Vorgänge wie Stoffwechsel, Wachstum und Fortpflanzung reguliert, aber auch die Reaktion auf Stress.
Die entsprechenden Informationen führen durch die Wirkung von Hormonen zu einer Aktivierung des sympathischen bzw. der beiden parasympathischen Zweige des autonomen Nervensystems. In dieser Funktion stellt die Hypophyse einen zentralen Bestandteil des limbischen Systems dar, welches für emotionale Bewertungen zuständig ist. Ihre Funktionen werden über das autonome Nervensystem an die Zielorgane (Herz, Atmung u.a.) vermittelt und deren Rückmeldungen in das limbische System zurückgeführt. Hormone und Neurotransmitter haben hemmende und erregende Einflüsse auf das autonome Nervensystem. Die Strukturen des Hypothalamus-Hypophysen-Systems bündeln die Informationen von Augen, Ohren, Gleichgewichtssystem und die eingehenden motorische Informationen, aber sie empfangen auch Impulse der Großhirnrinde, die auf Nervenzellen der unteren Ebene von Hirnstamm und Rückenmark weiter geleitet werden. Sie haben damit eine zentrale Umschaltfunktion für Ein- und Ausgänge des Großhirns. An dieser Stelle vermag das Großhirn willentlich die untergeordneten Ebenen der Regulation zu beeinflussen.
Limbisches System
Das limbische System vermittelt bei Säugetieren die emotionalen Komponenten vieler Gehirnprozesse. Die limbischen Zentren sind Teil eines allgemeinen Bewertungssystems im Gehirn. Es gestattet uns die Entscheidung, ob ein Ereignis vorteilhaft und lustvoll ist und demzufolge wiederholt werden sollte, oder ob es sich schlecht und schmerzhaft anfühlt und demzufolge gemieden werden sollte. Diese Körperempfindungen, Affekte und Emotionen, die uns über angenehm und „suchen“ oder unangenehm und „meiden“ informieren, bilden die Grundlage für Wohlbefinden und Entspanntheit bei Sicherheit oder von Kampf- oder Fluchtreaktionen bei gefühlter Gefahr (Kapitel 3.12.). Das limbische System bildet damit die Grundlage der psychischen Vorgänge im Organismus. Dieses System sichert das innere biologische Gleichgewicht sowie das äußere Gleichgewicht in den Beziehungen zur belebten und unbelebten Umwelt. Es durchzieht sowohl die älteren Teile des Gehirns als auch das Großhirn.
Zum limbischen System gehört das oben beschriebene Hypothalamus-Hypophysen-System zur Aufrechterhaltung der Grundfunktionen des Lebens. Als Reaktion auf lebensbedrohliche Situationen wird der Totstellreflex von dieser Ebene des limbischen Systems ausgelöst bzw. bei Sicherheit erfolgt die Freisetzung von Serotonin oder Oxytocin (Kapitel 3.9.). Die basalen Teile des limbischen Systems im Hirnstamm und Hypothalamus regulieren das vegetativ-affektive Verhalten. Sie beeinflussen insbesondere die Funktion der Stressreaktion und der Erholung, also die Regulation des inneren Zustandes über den alten und neuen Vagusnerv sowie die Mobilisierungsreaktion des sympathischen Nervensystems. Übergeordnet zur basalen Struktur gehören zum limbischen System jene Zentren, die die Entstehung von Emotionen hervorrufen und die Bewertung aller Erfahrungen in „suchen“ und „meiden“ ermöglichen. Das sind einige Bereiche des Großhirns wie der Mandelkern (Amygdala), der Hippocampus, die Basalganglien sowie einige Teile der Großhirnrinde.
Der Mandelkern erhält u.a. Eingänge aus Geruchszentren, Informationen aus den Eingeweiden über den alten Teil des Vagus – unser „Bauchgefühl“ sowie Informationen des Großhirns über Sicherheit oder Gefahr in der Umgebung und löst entsprechende hormonelle Reaktionen im Hypothalamus aus. Der Mandelkern verarbeitet den emotionalen Kontext positiver wie negativer Situationen in Hinblick auf eine Risikoeinschätzung. Frühere Erfahrungen, insbesondere der frühen Kindheit, werden als affektive Vermeidungs- oder Annäherungswünsche (Kapitel 3.8) abgespeichert, als Gefühl der Angst oder des Wohlbefindens, „suchen“ und „meiden“. Die genaue Abspeicherung der Kontextinformationen erfolgt im Hippocampus. Wir erleben die Gefühle als Körperempfindungen, z.B. das Herz hüpft vor Freude oder öffnet sich liebevoll, Furcht schlägt auf Magen, Angst schnürt die Kehle zu etc. Diese Empfindungen werden u.a. von den Neuromodulatoren Oxytocin, Dopamin, Vasopressin und Serotonin (Kapitel 3.8.) hervorgerufen.
Teile der Basalganglien spielen die wesentliche Rolle bei Belohnung und bei Belohnungserwartungen. Die Nervenzellen reagieren mit der Freisetzung von Dopamin vor allem auf unerwartete Belohnungen im Sinne erfolgreicher Handlungen. Der besondere Wert einer unerwartet erfolgreichen Handlung treibt zur Wiederholung mit erneuter Belohnung an und unterstützt die Einspeicherung dieses Lerninhaltes. An einer emotionalen Bewertung sind neben den Basalganglien ebenso der Hippocampus für die Kontextbewertung, die Amygdala für die Bewertung von Gefahr oder Sicherheit beteiligt.
Das Ergebnis dieses Abgleichs auf der unbewussten Ebene wird dann an die bewusstseinsfähige limbische Ebene des Großhirns vermittelt. Der limbische Cortex stellt die Ebene unserer bewussten Motive und Gefühle dar, wie sie im Verlauf der Entwicklung eines jeden Menschen über Sprache durch die jeweilige Kultur und Gesellschaft vermittelt werden. Diese Zentren reifen sehr langsam im Verlauf der Kindheit und insbesondere der Pubertät heran. Hierzu zählen Teile des frontalen Cortex, die mit der Planung von Handlungen und mit dem Vorhersehen von positiven der negativen Konsequenzen zu tun haben. Die Cortexbereiche des limbischen Systems vermitteln die Informationen der unteren Zentren von Empfindungen des autonomen Nervensystems (Körperempfindungen und Bauchgefühle, Herzrasen, Freude etc.) und von allen anderen emotionalen Zuständen an die bewusstseinsfähigen denkenden Cortexbereiche, um bewusste Handlungen des Annäherns oder Vermeidenns auszulösen. Diese Übermittlung kann verhindert werden indem die willentliche obere Ebene die körperlichen Signale unterdrückt oder ignoriert. Das Fehlen bzw. Nichtwahrnehmen der Körperempfindungen wird als sensomotorische Amnesie bezeichnet.
Großhirn
Das Großhirn (Cortex) ist die in der Evolutionsgeschichte jüngste und beim Menschen besonders entwickelte Hirnstruktur. Innerhalb des Großhirns ist der präfrontale, hinter der Stirn gelegene Teil in der Evolution am meisten gewachsen. Er ist beim Menschen 29 % größer als bei Ratten, beim Schimpansen 17 %. größer. (4) Dieser enorme Größenzuwachs wurde dank einer besseren Sauerstoffversorgung möglich. Der präfrontale Cortex ist hauptsächlich zuständig für Handlungskontrolle, Handlungsplanung, das Abschätzen von Konsequenzen und soziale Interaktion - also Moral, Regeln und Vernunft der kulturellen Evolution.
Kapitel 3.3 – Was machen Synapsen?
Das gesamte Nervensystem besteht aus untereinander verbundenen Nervenzellen. Innerhalb des Gehirns sind ca. 100 Milliarden Nervenzellen miteinander vernetzt. Diese Zahl entspricht etwa der Menge an Bäumen im Amazonaswald. (5) Dabei haben die Nervenzellen untereinander etwa so viele Vernetzungen, wie dort Blätter an den Bäumen sind. Eine einzige Nervenzelle hat bis zu 100 000 Verzweigungen.
Die Informationssignale der Nervenzellen werden als elektrische Impulse übertragen, ähnlich wie die Bits eines Computers. Die Übertragungsstellen für diese Impulse zwischen zwei Zellen werden als Synapsen bezeichnet. Von einer Nervenzelle werden Informationen als Impulse auf andere Nervenzellen, Muskelzellen oder Sinneszellen übertragen und wirken von dort aus als Feedback-Information wieder auf das Nervensystem zurück, um die jeweilige Handlung zu steuern und zu optimieren. Eine Nervenzelle besitzt viele verzweigte Fortsätze (Dendriten). An diesen Dendriten befinden sich die Kontaktstellen anderer Nervenzellen (Synapsen), die Informationen übertragen. Darüber hinaus besitzt jede Nervenzelle einen langen Fortsatz (Axon), der sich an seinem Ende verzweigt und damit einen Informationsimpuls auf viele Zielzellen überträgt.
Der Informationsaustausch von einer Nervenzelle auf die nächste erfolgt dabei an den Synapsen zwischen den zwei eng aneinander liegenden Zellwänden durch die Freisetzung verschiedener neurochemischer Botenstoffe (Neurotransmitter). Sie wirken in dem schmalen synaptischen Spalt zwischen zwei Nervenzellen auf Transportkanäle der nachgelagerten Zelle ein, indem sie an spezifische Rezeptoren dieser Zelle binden. Dadurch wird der elektrochemische Informationsimpuls auf diese Zelle übertragen. Nach erfolgter Informationsübertragung werden diese Neurotransmitter (z.B. Adrenalin, Noradrenalin, Serotonin) entweder abgebaut oder von der Ursprungszelle wieder aufgenommen. Auf diese Weise kann jede Nervenzelle mit Tausenden anderer Zellen verbunden sein und ihre jeweils hemmende oder erregende Information an viele Zielzellen verteilen. Entscheidend für die Hemmung oder Erregung der Zielzelle sind der spezifische Neurotransmitter sowie die Struktur des Rezeptors. Er erkennt nur einen bestimmten Transmitter und erlaubt die Bindung nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Diese außerordentlich schnelle Erregungsleitung erfolgt innerhalb von Millisekunden. Über Neurotransmitter werden sämtliche Prozesse der Informationsübertragung mit dem gleichen Funktionsprinzip gesteuert, von einer einfachen Beugebewegung des Armes bis hin zu komplexen Aktionen wie Sprechen, Denken, Auto fahren etc.
Kapitel 3.4 – Was bedeutet Lernen neurobiologisch?
Lernen bedeutet immer eine Veränderung in der synaptischen Übertragung der beteiligten Nervenzellverbände. Wie Lernen als neurobiologisches Geschehen abläuft, lässt sich am Beispiel des Greifenlernen des Babys Flora betrachten.
Flora und ihr Freund Paul werden uns durch dieses Buch begleiten und wir werden an ihnen beobachten, wie das Gehirn sich entwickelt, wie sie mit ihrer Umwelt interagieren und wie sie in den verschiedenen Kulturen leben.
Flora sieht ein Spielzeug, welches sie haben möchte. Dieser Wunsch weckt die Aufmerksamkeit des Gehirns nach dem Spielzeug und das setzt die nötige Aktivität für den Problemlösungsprozess frei. Dann probiert Flora aus, danach zu greifen, was ihr bei den ersten Versuchen nicht gleich gelingt. Aber Flora probiert es immer und immer wieder aus. Wenn eine Aktivität erlernt wird, wird das Ergebnis eines jeden Versuchs in die Nervenverbindungen als Feedback-Rückmeldung im Gehirn eingespeist. Über die Muskelspannung der Armbeuger, der Hand und der Finger, über die Stützmotorik des Rumpfes, über die optischen Informationen zu Entfernung des Spielzeugs und über die haptischen Informationen zur Oberfläche des Spielzeugs. Alle diese Informationen werden in unglaublicher Geschwindigkeit ausgetauscht, mit bereits vorhanden einfachen Mustern abgeglichen und in einem neuen besseren Bewegungsversuch umgesetzt. Jeder Versuch verändert die synaptische Verbindung aller beteiligten Nervenzellen. Sie werden entweder mehr oder weniger erregt. Je nachdem, ob Flora z.B. den Arm etwas mehr strecken oder beugen muss, werden alle Armmuskeln unterschiedlich stark über die Synapsen erregt oder gehemmt, bis die Gesamtheit der synaptischen Verbindungen untereinander genügend gut in ihrer Aktivität abgestimmt ist.
Wenn Flora immer besser und immer öfter das Spielzeug erfolgreich erreicht, werden diese Erfahrungen gelernt. Gelernt bedeutet in dem Fall, dass alle miteinander aktiven Nervenzellen mit ihren Feedbackschleifen vernetzt und zeitgleich aktiviert werden. Erfolgreiche Handlungen führen zur Ausschüttung von Dopamin und werden dadurch bevorzugt abgespeichert. Lernen bedeutet in dem Fall für Flora, dass in einem ersten raschen Schritt bereits vorhandene synaptische Übertragungsstellen verstärkt werden, indem z.B. mehr Rezeptoren mehr Neurotransmitter ausscheiden können. Als nächsten Schritt, dass innerhalb einiger Stunden mehr synaptische Verbindungen zwischen den beteiligten Zellen entstehen und dass 3. innerhalb einiger Tage bei den entsprechenden Wiederholungen der Handlung neue Nervenzellen in das Netzwerk eingebaut werden. Auch die bei einem erfolgreichen Versuch ausgeschütteten Belohnungsstoffe werden dann immer mehr ausgeschüttet und ebenfalls gebahnt.
Der Prozess hat eine enorme Eigendynamik und ist nicht – wie früher angenommen – in den Genen festgelegt. „Stellen Sie sich das Verhalten eines Organismus als die Darbietung eines Orchesterstückes vor, dessen Partitur während der Aufführung erfunden wird.“ (6)
Kapitel 3.5 – Was Hänschen nicht lernt – Wie geschieht Anpassung?
In jeder Körperregion wird zunächst ein erheblicher Überschuss an synaptischen Vernetzungen spontan und zufällig gebildet. Später werden funktionierende Verbindungen verstärkt und funktionslose Verbindungen wieder gelöst. Es gilt das Grundprinzip: Use it or loose it.
Die große Formbarkeit (Neuroplastizität) des menschlichen Gehirns ist der entscheidende Mechanismus, der Lernen ermöglicht. Folgende Lernabfolgen lassen sich unterscheiden: die Verstärkung vorhandener alter Synapsen, die Ausbildung neuer Fortsätze sowie die Integration neuer funktionstüchtiger Nervenzellen in das bereits gebildete Netzwerk. So können komplexe neue Erfahrungen langfristig gespeichert werden. Solche erfahrungsabhängigen Veränderungen in der Vernetzung der Nervenzellen des Gehirns sind die biologische Basis von jeglichem Lernen – sei es die Selbstorganisation der grundlegenden Lebensvorgänge wie Muskelspannung, Bewegung, Blutdruck oder aber das Erlernen von Sprache und Mathematik. Jedes Lernen verändert die Struktur des Gehirns. Jedes Lernen umfasst: ausprobieren, Rückmeldungen einarbeiten, neu ausprobieren.
Wer sich davon ein Bild machen will, braucht sich nur Flora bei ihren unentwegten Versuchen und Irrtümern und neuen Versuchen anzuschauen. So lernt Flora aus vielen zufälligen und fehlerhaften Greifversuchen allmählich die richtigen Muskeln zur rechten Zeit zu aktivieren und mittels Versuch und Irrtum langsam die korreketen Verbindungen im Gehirn zu stabilisieren. Auf diese Weise konstruiert Flora ihre eigenen Gehirnverbindungen entsprechend ihrer Erfahrungen.
Babys bilden bzw. konstruieren ihre ersten und wesentlichsten Lernerfahrungen mit Hilfe ihrer Mutter, d.h. die beiden ko-konstruieren die Lerninhalte. Immer dann, wenn z.B. ihre Mutter ihnen hilft, sich zu beruhigen, wenn sie ihnen ein Bilderbuch zeigt oder mit ihnen spricht, laufen Ko-Konstruktionsprozesse zwischen beiden ab. Das ermöglicht ihnen, sich über die Bedeutung von Dingen, Worten, Gefühlen und Vehaltensweisen zu verständigen und ihre soziale Realität abzugleichen. Einen vergleichbaren Prozess stellt die gegenseitige Ko-Regulation von Sicherheit und innerer Befindlichkeit dar, der fortwährend gegenseitig stattfindet. Auf diese Bedeutung der Ko-Regulation von Lernprozessen und Ko-Konstruktion von Lerninhalten zwischen Flora und ihrer Mutter bzw. anderen Bindungspersonen wird im Verlauf des Buches immer wieder eingegangen.
Aus der Tatsache, dass das Nervensystem sich erst durch eigenes Lernen vernetzt, lässt sich die hohe Bedeutung der Umwelt für vielfältige Lernerfahrungen und demzufolge ein umfangreich entwickeltes Gehirn ableiten. Nur eine Umwelt, die reichhaltige Erfahrungen ermöglicht, unterstützt den Lernprozess ausreichend. Wir bekommen die Gehirne, die wir uns selbst schaffen können bzw. die unsere Eltern uns schaffen lassen. Untersuchungen haben gezeigt, dass bei einer angereicherten sozialen und materiellen Umwelt das Gehirn eine größere Masse erreicht, die Großhirnrinde dicker ist und die Nervenzellen untereinander dichter verzweigt sind. Zur Umwelt gehört immer auch die soziale Umwelt. Auch hier bestimmt das Angebot seitens der Mutter und anderer Bindungspersonen die Art der Erfahrungen, die Flora, wie jeder andere Mensch auch, macht. Flora und ihre Mutter, aber auch Affenweibchen und ihre Jungen, konstruieren gegenseitig ihre Erfahrungen von Sicherheit, Wohlbefinden und Willkommensein in der Welt. In ihrer Interaktion ko-konstruieren sie gemeinsam ihre soziale Realität.
Nach dem Nobelpreisträger Gerald Edelman, der auf dem Gebiet der Neuroplastizität bahnbrechend forschte, kann man das Nervensystem mit einem dichten Straßennetz vergleichen: Intensiv genutzte Straßen werden ausgebaut und schneller. Sie funktionieren wie eine Dreispurdatenautobahn, die wir ganz automatisch und selbstverständlich benutzen. Wenig genutzte Wege wachsen allmählich zu und werden unbenutzbar. Neue Handlungen und Verhaltensweisen zu erlernen, gleicht dem Anlegen eines kleinen Wiesenpfades, der erst durch vielfache Benutzung ausgetreten und zu einer Straße verbreitert wird. Ähnlich verhält es sich mit den Bahnen im Gehirn. Hier verändern neue Erfahrungen die Bahnen und Vernetzungen im Nervensystem. Sie ersetzen oder überlagern oder ergänzen ältere vorhandene Bahnen. „Lernen besteht in der Verstärkung synaptischer Verbindung zwischen Neuronen.“ (7)
Bei häufig benutzten Vernetzungen werden die Verbindungen von der Nervenzelle zu ihrer Zielzelle allmählich myelinisiert, das heißt mit einer Isolationsschicht umgeben, die zu einem schnelleren und effizienteren Informationsfluß führt. Dieses hohe Maß an erfahrungsabhängiger Vernetzung des Nervensystems ist typisch menschlich. Andere Säugetiere kommen mit einem weitgehend ausgereiften Gehirn zur Welt.
Kapitel 3.6 – Der Reiz des Neuen – wozu dient Neugier?
Wie organisiert es das Gehirn, aus der Flut von ständig einströmenden Reizen, wichtige von nebensächlichen Informationen zu unterscheiden?
Diese Organisations- und Filterungsfunktion übernimmt das Aufmerksamkeitssystem des Hirnstamms. Wenn ein neuer Reiz in der Umgebung auftaucht, wechseln wir aus der Entspannung in eine äußere Aufmerksamkeit und Wachheit mit einem höheren Muskeltonus. Der ganze Organismus wird über die Neurotransmitter Adrenalin und Noradrenalin wacher und handlungsbereiter. Die Fähigkeit zur bewussten Lenkung der Aufmerksamkeit ist bei den Säugetieren erstmals innerhalb der Evolution aufgetaucht. Sie erlaubt das bewusste, willentliche Hinwenden zu einem Problem oder einem Reiz oder einem Gegenüber.
Damit wurden die typisch menschlichen Fähigkeiten zur bewussten Problemlösung und geplanter Erfüllung von Aufgaben möglich. Diese Fähigkeit wird durch eine Mobilisierung des Stoffwechsels über das sympathische Nervensystem vermittelt, bei gleichzeitiger abgestufter Hemmung des neuen Vagus der sozialen Interaktion. (8)
Neben der Filterung ist die Aufgabe des Aufmerksamkeitssystems die ausreichende Aktivierung des Gehirns zur Bearbeitung wichtiger Reize sowie die Herabsetzung der Aufmerksamkeit zum Schutz vor einer Informationsüberflutung. Damit gewährleistet es seine Hauptaufgabe bei der Sicherung des biologischen Gleichgewichts des Organismus. Es ist ein ökonomisches Prinzip, nicht jederzeit und auf alles aufmerksam zu sein, denn das Gehirn verbraucht mehr als 20 % der Nahrungsenergie, wenn es dauerhaft im Einsatz ist. Das Abziehen der Aufmerksamkeit ist vor allem bei Babys eindrucksvoll zu beobachten. Sie wenden spontan den Blick ab, wenn ihre Aufmerksamkeit ermüdet ist und gehen spontan wieder in Kontakt, nachdem sie sich ausreichend regeneriert haben.
Die Wechselwirkung zwischen neuem parasympathischen Vagus und sympathischem Nervensystem ermöglicht ein rasches Hin und Her zwischen Mobilisierung und Erholung, je nach einwirkenden visuellen, optischen, akustischen Außensignalen (Kapitel 8.2.2). Die erfahrungsabhängige Vernetzung des Gehirns steht immer unter dem Einfluss von Aufmerksamkeit und Motivation. Das Aufmerksamkeitssystem schafft eine Verbindung zum Großhirn und kann dadurch die Aktivität der Großhirnrinde beeinflussen und modulieren, je nach Bedeutung des Reizes. (9)
Die Organisation der Aufmerksamkeit beeinflusst die Lernfähigkeit, indem sie die Aktivität des Gehirns so steuert, dass eine Handlung optimal koordiniert und dadurch situationsangemessen und erfolgreich ausgeführt werden kann. Das gilt sowohl für unser Beispiel des Greifens nach einem Spielzeug als auch für die Zuwendung einer Mutter zu ihrem Baby, wenn es weint. Die Fähigkeit, aufmerksam zu sein, ist abhängig vom inneren Erregungsniveau des Nervensystems, vom Gefühl der inneren Sicherheit und vom Grad des Wachbewusstseins. Im Schlaf, wo das parasympathische Nervensystem dominiert, ist sie sehr niedrig, dann nehmen wir die äußere Welt nicht wahr. Im Zustand eines hohen inneren sympathischen Erregungsniveaus sind wir unaufmerksam, ziellos, ruhelos mit fahrigen, nervösen Bewegungen und Handlungen.
Am leistungsfähigsten sind wir in einem mittleren Erregungsniveau, wenn sowohl der neue Vagus sichere Entspanntheit vermittelt (Kapitel 3.12), als auch eine gewisse Mobilisierung durch das sympathische Nervensystem erfolgt. Aufmerksamkeit bewirkt eine selektive Aktivierung gerade dieser Areale und Strukturen des Gehirns, in deren Bereich gelernt wird. Gleichzeitig werden nicht benötigte Bereiche deaktiviert. Die Aktivierung und Lenkung der Aufmerksamkeit, insbesondere der zielgerichteten selektiven Aufmerksamkeit ist ein Lernprozess wie die meisten menschlichen Handlungen auch. Sie ist eng verbunden mit den anderen Lernaufgaben der frühen Kindheit: Sicherheit erkennen und herstellen; den inneren Zustand regulieren lernen; Affekte und Emotionen verständlich dem Gegenüber mitteilen; den Umgang mit Stress regulieren und sich mehr und mehr selbst beruhigen können.
Aber die Beantwortung dieser Frage wirft schon die nächsten auf:
Wann beginnt ein Baby damit?
Woher kommt das erste Netzwerk?
Wie kann ein ganzes Nervensystem selbstorganisierend sein?
Kapitel 3.7 – Wie geht das Gehirn online?
Der Beginn des menschlichen Lebens ist von einer unglaublichen Entwicklungsgeschwindigkeit gekennzeichnet. Bereits 30 Stunden nach der Befruchtung einer Eizelle beginnt diese sich zu teilen. Ab dem 6. Tag beginnt sich das winzige Ungeborene in die Gebärmutterwand einzunisten und besitzt zu der Zeit bereits zwei Zellschichten, wobei die Wandschicht die Ernährung aus der Gebärmutterwand gewährleistet. Ab dem 12. Tag sorgen biochemische Signalstoffe für die Differenzierung einiger Zellen in die ersten Nervenzellen (Vorläuferneuronen). Um den 20.-23.Tag beginnt sich das Neuralrohr zu bilden, aus dem später Rückenmark und Gehirn hervorgehen. Zu dieser Zeit herrscht ein unglaublich schnelles Zellwachstum vor, so dass die Zahl der entstehenden Nervenzellen sich alle 90 Minuten verdoppelt. (10)





























